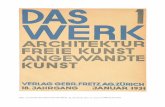Grenzfiguren. Kultur, Geschlecht und Subjekt bei Hegel und Nietzsche
Somalia zwischen Krieg und Frieden - Strategien der friedlichen Konfliktaustragung auf...
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Somalia zwischen Krieg und Frieden - Strategien der friedlichen Konfliktaustragung auf...
ARBEITEN AUS DEM INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE ------ 113------
Markus Virgil Höhne
Somalia zwischen Krieg und Frieden
Strategien der friedlichen Konfliktaustragung auf internationaler
und lokaler Ebene
iiAKII INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE im Verbund Deutsches Übersee-Institut
Höhne, Markus Virgil : Somalia zwischen Krieg und Frieden. Strategien der friedlichen Konfliktaustragung auf internationaler und lokaler Ebene I Markus Vlrgil Höhne. -Harnburg : Institut für Afrika-Kunde , 2002.
(Arbeiten aus dem Institut für Afrika-Kunde; 113) ISBN 3-928049-84-4 ; ISSN 0945-3601
Alle Rechte vorbehalten Institut für Afrika-Kunde
im Verbund Deutsches Übersee-Institut Neuer Jungfernstieg 21, 20354 Harnburg
VERBUND DEUTSCHES ÜBERSEE-INSTITUT Mitgied der Wissenschaftsgemeinschaft Golt1ried Willlern Lelbniz (WGL)
Das Institut für Afrika-Kunde bildet zusammen mit dem Institut für Allgemeine Überseeforschung, dem Institut für Asienkunde, dem Institut für lberoamerikaKunde und dem Deutschen Orient-Institut den Verbund Deutsches ÜberseeInstitut in Harnburg. Aufgabe des Instituts für Afrika-Kunde ist die gegenwartsbezogene Beobachtung und wissenschaftliche Untersuchung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Afrika. Das Institut ror Afrika-Kunde ist dabei bemüht, in seinen Publikationen verschiedene Meinungen zu Wort kommen zu lassen, die jedoch grundsatzlieh die Auffassung des jeweiligen Autors und nicht des Instituts fOr Afrika-Kunde darstellen.
Harnburg 2002 ISSN 0945-3601
ISBN 3-928049-84-4
Copynghlcd m31cria
.. Alle Philolophen haben den gemeinsamen Fehler an sielt, da.!s sie >'Om gegenwärtigen Men
schen ausgehen und durch eine AnalyJe desselben an 's Ziel zu kommen meinen. Unwi/lki/rlich
schwebt ihnen , der Mensch ' als eine CICterna '·eritas, als ein Gleichblcilx!ndes in allem Stru·
del, als ein sicheres M(l.fs der Dinge vor. Alles. W(l.f der Philosoph ülx!r den Menschen aus
sagt, ist aber im Grunde nicht mehr, als ein Zeugnis über den Menschen eines sehr be·
schränkten Zeitraums. Mangel an historischem Sinn ist ein E:rbfehler llller Philosophen: mon
ehe sogar nehmen um·ersehens die allerjüngste Gestaltung des Mt!nschen, wie eine solche
unter Eindruck bestimmter Religionen, ja lx!stimmter politischer Ereignisse entstanden ist. als
diefeste Form, von der man ausgehen müsse."
Fried.rich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches I, Berlin, 1988 (1878) .
.. Wohin mm• blickt: Die Staaten Afrilws sind bedeutungslose Hallen, ihre lnstitutionen - Re
gierung, Parlament, Verfassungen - nur die Kulisse, !Jinter denen sich die Unterdriicker von
heute per.sönlich schadlos halten: die Despoten, Clans wrd herrschenden Eliten."
Michael Birnbaum: Der Böse Kontinent, Süddeutsche Zeitung, 2.6.00.
Copynghtcd matcria
Danksagung
Die vorliegende Arbeit entsW!d ursprUnglieh ats Magisterarbeit im WS 200012001 am Institut
filr Völk.erk:w1dc und Afrikanistik der Ludwig-Maximilians Univcrsitlit in München.
Zahlreiche Freunde, Bekannte und Mitarbeiter des Instituts unterstützen mich in dieser Phase.
Den kritischen, aber sehr konstruktiven Diskussionen in den Kolloquien von Prof. Mattbias
Laubscher und Prof. Kurt Beck verdanke ich die rigorose Einschränkung des Themas auf ein
bewä.ltigbares und inhaltlich intc:n:ssantcs Maß·. Auch Prof. Hermann Ambom nahm sich die
Zeit, mir auf Basis seines tiefgehenden Wiss-ens Ober die soziopolitischen Strukturen und
Zusammenhänge am Horn von Afrika von einem zu weiten Fokus abzuraten und mich i n
meiner Konza�tration auf Somalia zu bestllrkcn.
Prof. Thomas Zitelmann (�erlin) antwortete mir immer schnell und inhaltlich sehr ergibig
auf dringende Fragen. Prof. Michael Bollig (Köln) unterstützte mich in der Wahl des Themas
und ,.heilte" meine Zweifel und Panikattacken mit Ruhe und Einfllblungsvennögen.
Besonders dankbar bin ich Prof. Kurt Beck:, der stets bereit war, meine unangemeldeten
,,Besuche'' zu ertragen und der mir in langen Diskussionen wertvolle Anregungen gab.
Kathrin Lindauer, Hansjörg Höhne. Petra Schreiner. Alexander Knorr und Holger Ptaccck
lasen die Arbeit in verschiedenen Stadien Korrektur und zwangen mich zu einer kritischen
Renek:lion des bisher Geschaffien. so dass ich die Arbeit in wesentlichen Punkten verbessern
konnte. Darüberhinaus opferte Alexandcr Knorr viel Zeit und Energie, um mit mir sowohl
inhaltliche als auch formale Fragen zu besprechen und Probleme zu lösen.
Nach Abschluss der Magisterarbeit setzte sich Prof. Günther Schlcc in HallciSaale
großzUgigerweise mit meiner Albeil auseinander und half mir somit, sie zu verbessern. Karl
Hafuer und Hansjörg Höhne nahmen sich d.ie Zeit, die neuen Passagen des Manuskripts zu
korrigieren. Hans Hofmann war so freundlich, die Kanen zu bearbeiten. Dem lnstitut filr Afrikakunde in Harnburg danke ich dafilr, dass meine Arbeit dort in verbesserter und
aktualisierter Form veröffentlicht wird.
Meine Eltern ermöglichten mir mit ihrer finanziellen Großzügigkeit und geistigen
Flexibilität Oberhaupt erst das Studium. Meine Freunde zeigten mir, dass es auch ein Leben abseits von Stapeln bedruckten Papiers gibl Mein tiefster Dank geht an Petra Schreiner, die
mir in der Zeit meines Studiums mit ihrer Liebe und Klugheit zur Seite stand, die mir aus
t.ahllosen schwarzen Löchern half und die in der Phase der Magisteralbeil meinen Stress und
m eine Frustatiooen enrug.
Copynqhted matcria
I
1 Einleitung .................................................................................................. .4
1.1 Ausgangspunkt und Frag estellung der Arbeit ........................................... .4
1.2 Fallbeispiel Somalia .................................................................................... 7
1.3 Vorgehensweise ... ....... ................................................................................. 8
2 Ethnographische Grundlagen .... ............ .............. ........... ....................... 1 0
2.1 Zur Einfilhrung: Siedlungsgebiet, Bevölkerungsverteilung, Umwelt und
die Frage nach der ,.kulturellen Homogenität" ......................................... ! 0
2.2 Zentrale Aspekte der traditionellen Gesellschaftsordnung ...................... 12
2.2.1 Somali-ldentität. ............................................................... ................... ... l2
2.2.2 Familie und Wirtschaft .......................................................................... 13
2.2.3 Segmentäre Gesellschaftsordnung und die Rolle von Verwandtschaft
(tot) und Vertrag (xeer/hecr) .................................................................. l4
2.2.4 Allgemeine Versammlungen (shir) und Egalität ... ................................ l7
2.2.5 Religiöse und wehliehe Autoritäten ...................................................... 18
2.2.6 Recht und Konflikt.. ............................................................................... 20
2.2. 7 Besonderheiten der soziopoli tischen Ordnung im sesshaften Komext.23
2.3 Traditionelle Ordnung zwischen Autorität und Anarchie ........................ 24
3 Die Kolonialzelt ....... ..................................... ............................... ....... ..... 26 3.1 Koloniale Eroberung ................................................................................. 26
3.2 Antikolonialer Widerstand .................................................................... . 27
3.3 Von der Fremdherrschaft zur Unabhängigkeit .............. ........................... 28
3.4 Auswirkungen der Kolonialherrschaft ...................................................... 30
4 Postkoloniale Entwicklung in Somalia bis 1988 ................ ................... 33
4.1 Unabhängigkeit und Klan-Demokratie (1960-1969) ................................ 33
4.2 Der Nord-Süd-Gegensatz ........... .. .......................... ...................... ..... ........ 33
4.3 Die "Greater Somalia"-Politik und ihre Folgen ........................................ 35
4.4 Konfliktgegenstand und Konflil!ctverlauf in den 1960er Jahren: Die
"Wiege" der "Krisenrcgion Horn von Afrika" ......................................... 37
COi-Y' Jhl _ n�teria
1
4.5 "The Problem ofTribalism"- Innenpolitische Entwicklungen bis 1969.38
4.6 Die Militärdiktatur ( 1969-1988) ............................................................... 39
4.6.1 "Scjentific Socialisrn" yersus "Tribaljsm" . . . ........... . . 40
4.6.2 Barres Pragmatismus ........................... .................................................. 42
4.6.3 Das Ende des "Scientific Socialism" und der Ogaden-Krieg ............... 44
4.6.4 "Re-Tribalisierung" und schleichender Staatszerfall ........................... .46
4.6.5 Der Bürgerkrieg 1988-1991 ................................................................... 49
4.7 Analyse der Entwicklung somalischer Staatlichkeil bis 1988 im Lieht der
traditionellen Gesellschaftsordnung .............................................. ....... .... 51
5 Internationales Eingreifen ...... ._ ............................................................. 58
5.1 Der internationale politische Rahmen nach 1989 ..................................... 58
5.2 Die politischen Rahmenbedingungen vor Ort - Staatszerfall in Somalia.60
5.3 Eingreifen auf Ebene der internationalen Politik: UNOSOM I, UNITAF
und I JNOSOM II 62
5.3.1 Ziele und Strategie der UNIUS-[ntervention in Somalia ...................... 65
5 3 2 Humanitäre Arbeit und Suche nach Frieden 66
5.3.3 Vom Krieg mit Aideed bis zum Rückzug aus Somalia ......................... 69
5.3.4 Beurteilung der Intervention der Staatengemeinschaft ........ ....... ....... ... 71
5.4 Internationales Eingreifen auf zivilgesellschaftlicher Ebene ................... 73
5.4.1 Die Ziele und Strategien des LPI... ........................................................ 74
5.4.2 Der Einsatz des LPIIHAP in Kooperation mit den UN ......................... 74
5.4.3 Evaluation der Bemühungen .................................................................. 76
5.4.4 Quellenkritische Anmerkung ................................................................. 79
5.5 Generelle Überlegungen zu internationalen Interventionen ..................... 80
6 Die Lokale Ebene .......... .,. ........ """"''"'"""'"""'''"'"'"'''"'""""'"'""""'82
6.1 Die Entwicklungen in Somaliland ............................................................ 82
6.1.1 Der Führungsanspruch der SNM ........................................................... 83
6.1.2 Die Übergangsregierung und der Rückgriff auf traditionelle
Strukturen .. " . 84
Cow hl nu .ria
J
6.1.3 Die weiteren Entwicklungen in Somaliland .......................................... 92
6.2 Die Entwicklungen im Süden .................................................................... 97
6.3 Schlaglicht auf den Nordosten -"Puntland" .......................................... 1 00
6.4 Charakteristika der friedlichen Konfliktaustragung im Rahmen der
Tradition 100
6.5 Ethnologische Analyse des Staatszerfalls und der Gewalteskalation in den
1990er Jahren ............................ .. 103
6.5.1 Die Frage nach der Relevanz der Klanstrukturen ............................... ! 03
6.5 2 Soziale Strukh!ren im Bereich der warlord-Herrschatlen
6.5.3 .. Tmdj tiona)jsten" yersus Transfoanationjsten"
110
113
7 Dibouti 2000- "back to the national roots"? ... . _.. ...... .... .................... 1 15
7.1 Verlauf und Ergebnisse ........................................................................... 115
7.2 Problematik des Djibouti-Prozesses ....................................................... 116
7.3 Bewertung der Ergebnisse ....................................................................... IIS
7.4 Überlegungen zu den Chancen einer staatlichen Ordnung im Gebiet der
ehemaligen Republik Somalia ................................................................. l21
8 Somalia und der Terror ........................................................................ 123
8.1 Spekulationen und Gerüchte ................................................................... 123
8.2 Einschätzun g der Lage ............................................................................ 125
9 Schlussbemerkung ................................................... .............................. l27
10 Llteraturverzelcbnts ............. ...... .................. ......................................... IJJ
Glossar ._ ............... ._ ......................................................................................... 142
Karten ............................................................................................................... 143
Summarv ...... ..................................................................................................... l45
Angaben zum Autor ........................................................................................ 147
Copynghted mdteria
4
EINLEITUNG
1.1 AUSGANGSPUNKT UND FRAGESTELLUNG DER ARBEIT
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts rückten die in vielen •• Entwicldungsländem" schon
lange schwelenden, z.T. auch erst in den 1990er Jahren aufbrechenden innerstaatlichen Kon
flikte in das Zentrum der ,.westlic hen" Aufmc:rksamkeil Gerade Afrika, dessen Bild in den
Medien seit Jahrzehnten von Annut, Hunger und Naturkatastrophen geprägt war, wurde ange
sichts der großen Zahl aktueller Gewalteskalationen 1 zum ,,Krisenkontinent" schlechtbin (Bol
lig!Kiees 1994: llf; DcbieVFischer 2001: 14). Immer dringlicher wurden in Europa und
Nordamerika Fragen nach dem Umgang mit Konflikten (.,conflict managernent") und im Hin
blick auf besonders schreckliche Gewaltcskalationen. wie z.B. in Somalia und Ruanda. nach
den Möglichkeiten ihrer Deeskalation und Pr ävent ion gestellt.2 Im Rahmen internationaler
Organisationen wie UN. OAU (Organiz.ation of African Unity) und EU begann der Aufhau
von ,,Ftilhwarosystemen" bzw. ,.Präventionsnetzwerken"J und ,.Konfliktlösungsmechanis
mcn". ln der Bundesrepubli k Deutschland wird seit Mitte der 1990er Jahre auf akademischer,
zivilgesellschal\licher und pol itischer Ebene intensiv zu Themen wie Konflikt. Konniktprl
vention und Friedenspol itik gearbeitet (Mchler/Ribaux 2000: 12f; Engel 1999: 92f; Matthies
1998: 4511).•
Vor diesem Hintergrund bemühte sieb auch das Bundesministerium ftl r wirtschaftliche Zu
sammenarbeit (BMZ) um eine neue entwick lungspolit is che Konzeption: .. Die Entwicklungs
zusammenarbeit steht - gerneinsam mit der Außen- und Sicherheitspolitik - vor der Aufgabe,
dazu beizutragen, den Ausbruch von Krisen zu verhindern, zuallererst aus humanitären Griln
den, nicht zuletzt aber auch aus ökonomischen: Die Kosten der Präv ention sind um ein vielfa
ches geringer als die Kosten der Beseitigung der Folgen des Krieges" (Wieezorec-Zeul 1999:
I). ln der Halbzeitbilanz des BMZ vom September 2000 wurden Krisenprävention und fried
liche Konfliktbeilegung als .,übergreifende Ziele der Bundesregierung·• bezeichnet (BMZ
1 Baechlc:r schreibt von 25 bcwaffr�eten Konlliktc:n in Afrika in den Jahren 1997/98 und konstatiert: Afrika ,.bleibt [ .. . ] der Kontinent mit don meisten laufenden bewaftioeten Konflikt<n." (&eehl<r 1998: 2).
' Oie neuere Lit<ratur zu diesem lnema i•� enorm umfangreich. Wichtige neuc:re Autoren sind, neben den zitierten, Donald Rothchild, Michael Lund, Cluistian P. Scherrc:r. William Zartman und Francis M. Ocng.
' Diese werden in der Liter.Jtur hiufig unter dem Stichwort .. carly waming" erwlihnt. ' Den aktuellsten Überblick über diese llemühungen auf europäischer und bundesdeutseher Ebene
biet<n Ocbiellfischc:r 2001. Eine kritische Auseinandersetzung mit Denkstil und Diskursgeschich-
Copynghtcd ma riR
5
2000: 16). Bevor jedoch im Rahmen der nationalen und internationalen Entwicklungszusam
menarbeit ein effizientes und u.U. sogar präve11tives Eingrcifens in Konflik tsituationen mög
lich wird, sind administrative Hürden zu ilberwinden. Um politische Entscheidungsprozesse
zu beschleunigen, müssen die vorhandenen Informationen über Konfliktentwicklungen ge
bUndelt und in einer Form weit ergeleitet werden, die eine rasche und zu einer klaren Analyse
der jeweiligen Situation fdhrende Auswenuns einer Vielzahl relevanter EinzclinJom1ationen
ermöglicht (Spelten 1999a: 1211).
Im Jahr 1998 wurde vom BMZ die Entwicklung eines , .l nd ikator enkatalogs" in Auftrag
gegeben. Dieser soll im Hinblick auf die ,.Partnerländer" der deutschen Entwicklungszusam
menarbeit Ober di e Veränderung von ionergesellschafllichen Konflikt lini en und Uber die
.,Gcwaltncigung'' bzw. ,.Friedensfahigkeit" von Gesellschaften Auskunft geben. Diese Kate
gorisierung von Gesellschaften soll in ein Schema verschiedener Eskalationsstufen mit den
dazugehörigen Schwellenwenen eingebettet werden (Spelten 1999a: 122; dies. 1999b: 10).
,.In diesem Sinne soll der Indikatorenkatalog die Funktion eines minimalen Frühwarnsystems
erfüll en, das direkt in den Arbeitsprozess zur Formulicnong der U!ndefPoli tik im BMZ integ
riert werden köMte" (Spelten 1999n: 123).
Schon die Prän1isse, komplexe innerstaatliebe Konflikte in sehr unterschie dlichen kulturel
len Kontexten mit einem möglichst einfach strukturicnen und wenig Zeitaufwand erfordern
den Instrumentarium erfassen zu wollen, erscheint höchst fragwilrdig.6 Diese ersten Zweifel
tc im Bereich der Krisenprävention und Entwickl ungspolitik allgernein findet sich bei Zi tdmann 2001.
' Der gegenwanigen Konfliktforschung liegt ein Schrrna von mindestens drei ,.Konfliktpha sen" zu Grunde. Man spricht \'On Pr5-Konnikt-, Konni.kt- und Post-Konflikt-Phase. Präventiv kann gcnau genommen nur vor dem gewaltsamen Ausbruch, oder nach der Beilegung von Konflikten cingcgrif. fen werden (Mehler/Riboux 2000: 981). Das Spektrum des Eingreifens ist sehr groß und reicht von zivilen Maßnahmen im Rahmen der .,Technischen Zu sammenarbeit ... erz), WlC z..B . ..,klassischen·· ökonomischen und sozi alen ,.Entwicklungsproj eklen", bis hin zur zivilen, aber auch militärischen lktciligung an ,.Fricdenscinsätzcn" der UN (Me hler/RibaW< 2000: 93-136; DebicVMatthics 2000a: 2SOf).
• Spelten schreibt selbst, dass es nicht das Ziel is.t, Konflikte auf Ba.•is des Indikatorenkatalogs nach wiss enschafilichcn Maßstäben zu analysieren (Spelten 1999a: 122). Dies spiegeh jedoch nicht nur die Unzulllnglichkeiten eines einzelnen AnS3tzes wieder, sondern weist auf die Problematik des hJufig sehr reduktionistischen Ursache-Wirkung-Denkcns im Bereich der Kriscnprtvention und dcr Entwicklungspolitik generell hin: ,. Was sic h schleichend durchsetzt ist ein funktiona listisches Erklärungsmodell von Konniktcn , das komplexe Oynamiken ausklammen" (Zitclmann 2001: 10). Statt die Kontexte einzelner Konniktc differen;zi en zu analysieren und daran ori enti en nach konkreten, angepassten Strategien ihrer Beilegung zu suchen, \'ersu cht man, unive:rsalistischc Modelle. oft im Kern :m ökonomischen Primlssen orieotic.n. zu entwickeln. Diese sollen es ermöglichen, Konnikte IYLw. die Gefahr ihrer Eskalation zu �berechnen" (ein gutes Beispiel fllr diese Hernngchensweisc bieten Collicr/Hocrflcr 2002); dementsprechend soll auch da• Eingriffsinstnrmcntarium standardisiert und effektivier! werden (Zitelmann 2001: 16).
Copynghtcd ma riR
6
an der Brauchbarkeit des Indikatorenkatalogs im Rahmen einer intemalionalen Friedenspolitik
erbl!rtcn sieb bei der Untersuchung seines inhaltliehen Aufbaus.' 1n sieben Analysesektoren
wird nach den Auswirkungen verschiedener externer und interner politischer, ökonomischer
und gesellschat\licher Entwicklungen auf das innerstaatliche Konfliktpotential gefragt; sehr
oft steht das Regierungshandeln im Zentrunt der Analyse. Insgesamt werden "westliche" Vor
stellung von Staatlichkeil und sozialer Ordnung Obertragen und als • .Messwert" genommen.
Dies erkl!irt auch, warum z.B. in Analysesektor 2a zwar nach dem "gesellschaftlichen Kon
fliktbewusstsein" gefragt wird, aber nur im Hinblick auf die Diskussion k.onfliktrelevanter
Themen in der Öffentlichkeit, i n den Medien oder auf staatlieheT Ebene. Der konkrete Um
gang mit Kontlikten und deren möglicherweise erfolgreiche Beilegung abseits der staatlichen
Institutionen wird ausgeblendet. Angesichts der "Schwäche" des Staats in vielen "Entwick
lungsländern" bis hin zum ,,Staatszerfall" sind die m.E. gnJndlegenden Fragen: Wie wurde
bisher in den jeweiligen Gesellschaften auf lokaler Ebene mit Konflikten umgegangen? Wel
che historisch und kulturell verankerten Strategien friedlicher Konfliktaustragung. dio nicht
auf staatl.ichem Eingreifen basieren, sind vorhanden? Können diese traditionellen Ansitze
auch in aktuellen Konflikten eine Rolle spielen'?
1n der intcn.�ationalen und selbst in der BMZ-internen Diskussion zu Konflikt und Kon
fliktprävention fehlt es nicht an Stimmen, die auf die Notwendigkeit von differenzierten Ana
lysen der verschiedenen Konf li ktsituationen im jeweiligen kulturellen Umfeld und auf die
möglichen Beiträge "traditionelle(' Konfliktlösungsansätze fllr den Erfolg des friedenspoliti·
schen Eingreifens hinweisen (Sisk 1997: 1841196f; Ndumbe LU 1999: 3/281). Doch diese
Hinweise und das durchaus vorhandene Wisscn1 Uber die komplexen kulturellen, historisehen
und soziapolitischen Zus ammenhänge in konkreten Konfliktsituationen werden im Rahmen
der aktuellen "Entwicklungspoli tik als Friedcnspolitik" (BMZ 2000: 16) ignoriert. Stattdessen
hlilt man weiterbin an der Vorstellung fest, dass Frieden und Entwicklung letztlich durch die
globale Übertragung der im "Westen" erprobten und funktionierenden Muster soziopolitischer
und ökonomischer Ordnung erreicht werden könnten. Selbst wenn der .,Speltensche lndikato-
' Ich beziehe mich hier auf eine unveröffentlichte Vorlage des "Spcltenschnl Kri.senidikatorenkatalogs". der mir im Juli 2000 freundlicherweise von Andreas Mehler, einem damaligen Mitarbeiter des Instituts fllr Afrikakunde in Hamburg. zur Vertllgung g<stellt wurde. ln verkürzter Form ftndct sich der Inhalt des Kaulogs bei Spelten 1999a: 133f. Von den Mitarbeitern des Deutschen Obcrsec:-lnstituts, die den Fragebogen von Spelten probeweise auswenetrn, liegt eine durchaus kritische Stellungnahme vor. Doch auch darin wird nicht auf die von mir noch aufzuwerfenden Fragen nach den lokal vorhandenen Strategien der friedlichen Konllikuustr:Jgung cingeg:mgen.
Copynghtcd malcria
7
renkatalog'' in der mir vorliegenden Form schon wieder veraltet sein sollte,' bleiben die oben
aufgeworfenen Fragen relevant. da sowohl auf bilateraler a.ts auch auf multilateralcr10 Ebene
die • .Blindheit" entwicklungspolitischen Handeins gegenOber den Realitäten vor On, die nicht
den im "Westen" gt'Prllgteo politischen Vorstellungen und Vorgaben entsprechen, bisher im
mer noeh grundsätzlicher Natur ist.11
ln meiner Arbeit soll an dem konkreten Fallbeispiel der Konfliktsituation in Somalia in den
1990cr Jahren den fragen nachgegangen werden, welche kulturell verwurzelten Strategien
friedlicher Konfliktaustragung abseits des staatlichen Handeins vorhanden sind, wie diese
Konfliktlösungsansfil2e vor On wirksam werden und in welcher Beziehung diese lokalen An·
sfitze zu internationalen friedenspolitischen Eingriffen stehen.
1.2 FALLBEISPIEL SOMALIA
Somalia bietet sich aus drei Gründen als Fallbc:ispiet an:
I.) Hier wurde Ende der 1980cr, Anfang der 1990cr Jahre zum ersten Mal nach Ende des
.. Ka.ltcn Krieges" das inzwischen in Bezug auf das subsaharische Afrika vielzitiene Phänomen
des Staatszerfalls in erschreckend umfassender Weise sichtbar.
2.) ln der ersten Hälfte der I 990cr Jahre fanden intensive intcmutionalc Interventionen so
wohl auf zivitgcseltschafllicher als auch auf staatlicher Ebene statt. Der Vertauf des militfiri·
sehen Eingrcifens der Staatengcmcinschafl prägte die internationale politische Ordnung nach·
haltig: Zu Beginn des Eingrcifens erschien das Chaos und das enorme Leid der somatischen
Zivilbevölkerung der ideale Prüfstein zu sein, um den Gehalt der neuen, ,.globalen" Friedens·
politik, ausgedrückt in Schlagwonen wie "Ncw World Order·• oder "Weltinncnpolitik"12• nach
Ende der Blockkonfrontation zu beweisen; rum Ende markierte die Somalia-Intervention die
' Ich häue diese Arbeit zu Somalia nicht ohne das Vorhandensein eines ausreichenden und üffcnt· hch zugangliehen Bestands an Literntor zum Thema de r fncdlichen Konßiktoustragung im lokalen Kontext schreiben können.
• Dies ist auf Grund der Dynamik des .,heiß umkämpficn'" Marktes für krisenpräventive und kon· flikbearbcitende Massnahmen sogar wahrscheinlich (Mehlcr/Robaux 2000: 13). Allerdings sei hier angemerkt, dass der Indikatorenkatalog in einschtagigen neueren Beitragen zur deuts<:hcn Krisenprävcntionsdiskus.•ion sehr positiv bewertet wird (DcbieUFiseher 2001: 19; Debiei!Manhics 2000b: 10).
'0 Damit sind die im Rahmen von internationalen OrganisatiOnen. w1e z.ß. der UN, verfolgten Ent· wicklungakonzcpte gemeint.
11 Hier schließe ich mich auf BaSIS der Erkenntnisse. die ich in meiner Arbeit. vor altem in Kapitel 6 und 7, gewonnen habe. der von Klute und von Trotha hinsichtlic h des internationalen Umgangs mit demjüngsten Tuarcgkonnikt in Mali geäußerten Kritik an (Klute/von Trotha 2000: 31).
" Dieser Ausdruck bezieht sich auf grundleg ende Vernnderungen des Völkerrechts im Zeitalter der ''Giobalisierung" und erfasst z.B. die neue Rolle des UN-Sichcrhcitsmls nach 1989 oder die ßc·
Copynqhted malcria
8
Grenze sowohl fi1r die globale Ordnungsmacht der USA als auch fllr die Friedensmacht der
Vereinten Nationen. Im Rahmen des zivilgesellschaftlichen Eingreifens konnten zwar durch·
aus Teilerfolge erzielt werden. Letzilieh schei·terten jedoch bis heute alle Versuche, mittels
externen Eingreifens den Frieden und die politische Ordnung im gesamten Gebet der ehemali
gen Republik Somalia wiederherzustellen.
3.) Trotz des innersomatischen Desasters und des weitgebenden Scheiteros der internatio
nalen Interventionen hat sich in Nordsomalia und Teilen Südsomalias in den letzten zehn Jah
ren ein aus ethnologischer und politologischer Sicht höchst interessanter Prozess der Reko.n
struierung einer friedlichen Ordnung vollzogen.
1.3 VORGEHENSWEISE
ln den Kapiteln 2-4 werden die ethnographischen und historisch-politischen Grundlagen lllr das Ventllndnis des aktuellen Geschehens in Somalia gelegt. lo Kapitel 2 wird zunächst die
externe Wahrnehmung der Somali-Kultur hinterfragt. Die in diesem Zusammenhang angedeu
tete Disk!!�on iooerl!a!b der jüngeren Sornalia-For$Chung wird im Verlauf der Arbeit an den
entscheidenden Stellen immer wieder aufgenommen. Anschließend werden die zentralen As·
pekte der traditionellen somatischen Gesellschaftsordnung beleuchtet. Im Zentrum der Dar
stellung stehen die Strukturen von Verwandtschaft, Autorität, Recht und KonOikten. Kapitel 3
beschäftigt sich mii dem Verlauf und den Auswirkungen der Kolonialhcrrschaft, während
Kapitel 4 die postkolonialen Entwicklungen von 1960 bis 1988 zum Gegenstand hat. Hier ist
die Rolle der traditionellen Gesellschaftsstrukturen und deren Wandel in den Jahrzehnten
nach der Erlangung der Unabhängigkeit von großem Interesse. Auf Grundlage der bis dahin
gewonnenen Erkenntnisse folgt die Analyse der somalischen Staatlichkeil am Ende des vier
ten Kapitels.
Die Kapitel 5-7 stellen den Hauptteil der Atbeit dar. lo Kapitel 5 werden nach einer Be
schreibung des somaliscben Bürgerkriegs und Staatszerfalls zwischen 1988 und 1991 die Stra
tegien und der Verlauf des ime:rnationalen Eingreifens auf staatlieber und zivilgescllschaftli·
eher Ebene ausgefUhrt. Kapitel 6 besehllftigt sich mit den unterschiedlichen Entwicklungen
auf lokaler Ebene. Sehr ausfUhrlieh werden die gut dokumentierten Strategien der friedlichen
dcutung der ,.Gemeinschaltsintcn:ssenu wie Umwcltsehutz. Menschenrechte und nachhaltige Enwicklung (Paulus 2001: 1881).
Copynghtcd ma riR
9
Konfliktaustragung in Somaliland im Nordwesten vorgestellt; ähnliche Prozesse können auch
im Nordosten und in Teilen Südsomalias verfolgt werden. Der relative Frieden in diesen Re
gionen wird mit den nach wie vor von Gewalt gekennzeich.neten Verhältnissen in und um
Mogadishu verglichen. Mit Blick auf diese r•egionalen Differenzen diskutiere ich einander
widersprechende Forschungspositionen zur gcgenwänigen Lage in Somalia. ln Kapitel 7 wird
ein Schlaglicht auf die jüngste internationale Friedensinitiative in Djibouti und deren Auswir
kungen auf die gegenwärtige Situation in Somalia geworfen.
ln dem der traurigen Aktualität geschuldeten und angesichts der Vagheit vieler lnfomtatio
nen bewusst kurz gehaltenen Kapitel 8 wird versucht, die Lage Somalias im Lichte der Ter
roranschläge aufNew York und Washington vom II. September 2001 zu beleuchten.
Abschließend werden in Kapitel 9 die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. Die Be
handlung der oben aufgeworfenen Fragen am Beispiel Somalias kann wichtige Hinweise auf
die Möglichkeilen und Grenzen nationaler und internationaler Friedenspolitik sowie auf djc
Rolle "afrikanischer·· Ansätze zur Lösung ''afrikanischer" KonOikte geben. Zudem wird bei
der Beschäftigung mit Somalia nicht nur das Problem des Staatszerfalls in exemplarischer
Weise deutlich, sondern es lii$Scn sich auch nnhand der jüngsten Entwicklungen in einigen
Regionen des Landes, alternative ,.parastaatliche"IJ Ordnungsfonneo erkennen, die filr die
Wahrung des Friedens im lokalen, regionalen und nationalen Kontext sehr bedeutend sind.
Die bisher erreichten Fortschritte erscheinen jedoch angcsichts des in jüngster Zeit, insbeson
dere nach dem II . September 2001, wieder aufkeimenden Interesses der internationalen Poli
tik filr Somalia gefährdet.
" Der Begriff •. Pamstaatlichkcit" �hretbt rutcru Klute und von Trotha den Sachverhalt, dass gcsclls.:hafiliche Machr.u:ntren und nichtstaatDicht Gruppen cmen Teil der staatlichen Souvaäniti!lsltthte an Steh gezogen haben: . . .Der Prozrss drr Abgabe von Souv.:rmitätsrechten und grundlegenden staatlichen Verwaltungsaufgaben geschieht gleichsam als Enteignungsvorgang staatlicher Souveränität und Verwaltung durch Vorg!lnge 'informeller De7.entralisierung· und 'Pnvatisierung·• (Klute/von Trotha 2001: 2).
Copynghtcd malcria
10
2 ETHNOGRAPHJSCHE GRUNDLAGEN ''Tbc ancirlft mtrropolis [Harar] of a once mighty rac�. rlrr only �rmanent sett/nnent in Eastern Africa. tltt nporttvl stat of Mo.slem lrarnfng. a 'tlt'tiJIM c.ity of sto11e housn. posessing Iu indt�nd�nt chit/. i/.1 p«uÜar populalion. ils un.known /anpage. a.n.d iu OM.W coinage. the emporium of tlte coffte rrade, tltr lrtad-qwotm of s/ovrl)'. th� binlt�place of tltt Kat plant, and tlre grraz manufac-Jory of couon-clollts, omp/y. it appeared, Je... sl!r\'rd litt" Jrouble of uploration" ( Burton 1000: 18).
Aus europäischer S icht war das Land der Somali, an der nordöstlichsten Spitze des subsahari
schen Afrika (Somali-Halbinsel) gelegen, bis in die Mine des 19. Jalubundcrts .,terra incogni
ta". Die erste ausfUhrliehe Forschungsexpedition ins Innere des nördlichen Somali-Gebietes
wurde von Oktober 1854 bis April 1855 unter der Leitung des Engländers Richard Bunon
(1821-1890) unternommen. einem der wohl aullet'gewöhnlichsten Privatgelehrten und For
schungsreisenden des 19. Jahrhundcrts (Bunon 2000: 18n7/318; Hulse 2000: 323).14 Zu des
sen Reisbericht schreibt der englische Ethnologe loan M. Lewis: "Richard Burton's First
Footsteps in East Africa. 1856, remains the best genend description of northem Somali soci
ety" (Lewis 1999a: I).
Auch knapp 150 Jahre nach diesen "First Footstcps" gibt es zur Gesellschaft der Somali,
verglichen mit anderen Ethnien im subsaharischen Afrika, relativ wenig ethnographische Ar
beiten. Die zentrale, heute noch als Grundlage der Somali-Forschung dienende Studie "A Pas
toral Dernocracy" (London, 1961), basiert auf einer in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre
vornehmlich in Nord-Somalia (Somaliland) von l.M. Lewis durchgefllhrten Feldforschung
(Farah!Lewis 1993: l).'s
2.1 ZUR EINFÜHRUNG: SlEDLUNGSGEBIET, BEVÖLKERUNGSVERTEILUNG,
UMWELT UND DLE FRAGE NACH DER ,,KULTIJRF.l.l.EN HOMOGENn'Ä'I"'
Das Siedlungsgebiet der Somali-Klans reicht über die Grenzen des bis 1991 existenten Staates
Somalia (Dcmocmtic Rcpublic of Somalia) bioaus und umfasst Gebiete im Staat Djibouti, in
Südost-Ätbiopien (Ogaden-Region) und Nord-Kenia (Northcm Frontier Distriet). Die beute
auf dem Tenitorium der ehemaligen Republik Somalia lebenden ca. acht Millionen Somali
werden sechs großen Klanfamilien zugeordnet. Die Dir, lsaq und Hawiye leben vornehmlich
in Nord- und Zentralsomalia, während sich die Darod über das gesamte Gebiet der Somali
Halbinsel verteilen; im SUden sind die Digil und Rahanweyn beheimatet (Lewis 1999a: 7f).
" Alexandcr Knorr in Manchen hat gcnde seine Doktorarbeit abl!"schlosscn, die u.a. auch die Person Durtons unlff sehr interessanten, neuc:n Gesichtspunkten beleuchtet.
" lcwis hat bis in die 1990cr Jahre zahlreiche weitere Arbeiten zu den soziopolitischen und religi6-scn VerMitnissen in Somalia verOffentlieht (l.cwis 1999b: i-xxvi).
Copynghlcd ma riR
I I
Die sehr kargen Umwehbedingungcn in Nord- und Zentralsomalia bellirdenen die Heraus
bildung einer nicht-scsshaflen. pastoralnomad!ischen Lebens- und Wirtschaftsweisc. Neben
Kamelen, die Prestige und Reichtum ausmachen, werden Schafe, Ziegen und Rinder gehahen.
Ftlr Landwirtschaft geeignete Umwehbcdingungen Iinden sich hauptsächlich in den vom Shn
bellc- und Juba-Fiuss durchflossenen sUdliehen Gebieten der Halbinsel. Hier hat sich auch ein
von der in den anderen Regionen verbreiteten Sprnche (Af-Somali 16) abweichender Dialekt,
Af-Maymaygenannt, herausgebildet (Lcwis 19'99a: 7-IJ/31/83f; ders. 1995: 12).
Trot'� dieser schon von Lewis in den 1950er Jahren erkannten Nord-Süd-Differenzen beto
nen viele Forscher bis in die 1980er/9Qer Jahre die Homogenität der Somali-Kultur: "One
fcature of Somali society that strikes thc eyc of even thc most casual obscrvcr is thc homoge
neity of Somali cuhurc" (Laitin!Samatar 1987: 21 ). Dieses "Homogenitäts-Dogma" wird von
neuercn Forschungen relativiert. Besonders nachdrucklieh verweist Cathcrine Besteman auf
den Unterschied zwischen Nord- und Südsomalia im Licht jüngerer historisch-kuhureller Un
tersuchungen. Sie spricht von einem Teil der Bevölkerung des Südens, den an den Ufern des
Jubba-Fiusses lebenden Ackerbauem, als den .,Gosha" und unterscheidet diese Gruppe, nicht
als eigene "Ethnie", jedoch als abgegrenzte. politisch relevante J<lentitlltsgruppc, v<m den So
mali. Die Gosha sind vornehmlich Nachfahren ehemaliger SkJavcn und sind somit in Bezug
attf die Abstammung wesentlich von der pastoralnomadischen "Somali-Kultur" verschieden,
der sie allerdings in Bereichen 'vie Sprache, Religion, Gebräuchen durchaus angehören. Durch
,.Adoption" (sheegad), im Falle der Gosha auch .. ku tirsan'· genannt. sind die Gosha mit den
slldsomalischen Klans verbunden (Besteman 1995: 43156; dies. 1999: 801! 13).11 Insgesamt
stellt die Autorio die oftmals angenommene ethnische Homogenität der Gescllschaf\ Somalias
in Frage: "Somalia can no Ionger bc rcprcscnted as a 'nation of nomads' or a 'pastor•l democ
racy'" (Bestem an 1 995: 43). Bestemans Kritik triff\ jedoch nicht auf Lewis' Werk "A Pastoral
Democracy" zu, das sich ausdrucklieh auf Nordwest-Somalia (Somaliland) bezieht und be
schränkt. Vielmehr wendet sich Besteman gegen die in der Somalia-Forschung bis heute ver·
breitete Verallgemeinerung von Lewis' Grundlagenforschung, die zu einer undifferenzierten
Analyse aller so7Jopolitischen Entwicklungen in Somalia im Licht des in .. A Pastoral Democ
racy" angelegten .,Kianfok\JS'' fUhrt. ln den Abschnitten 4.3 und 6.5 wird, im Rahmen der
Diskussion aktueller Forschungspositionen zur somatischen Staatlichkeil und zu den Gewalt
eskalationen in den 1990cr Jahren. detailliert auf die von Besteman g�ußcne Kritik cinge-
•• Af-Sorroli gebön zur F:umlic der kuschtusch<:n Spmchen. " ln Ietzierern W<'Tk arbeitet die Autorio die hier angedeuteten Thesen aus. die besonders 101 I !in
blick auf die Gewallcskalouon im SOden in den 1990cr Jahn::n erhellend smd.
Copynghlcd malcria
12
gangcn. Anzumerken ist, dass Lewis selbst zu dem simplifizierenden Somalia-Bild beigetra
gen hat. Er sprach z.B. in einem 1969 veröffentlichten Aufsatz von einer "homogeneous
common culture embodying the notion of Somali identity" (Lewis 1969: 356).
Insgesamt lllsst sich eine grobe Zweiteilung der präkolonialen SollUili·Gesellschaft in vor
nehmlich pastoralnomadisch lebende Gruppen im Norden und weitgebend sesshafte, Land
wirtschaft betreibende Gruppen im Süden erkennen. Allerdings gab es im Norden stets auch
feste Ansiedlungen18 und Landwirtschaft; im Silden spielte auch Viehhaltung eine Rolle. Oie
pastoralnomadische Kultur war jedoch numerisch und soziapolitisch dominierend (Lewis
1999a: 12).'9
2.2 ZENTRALE ASPEKTE DER TRADITIONELLEN11 GESELLSCHAFfSORDNUNG
2.2.1 SoMALI·lDENTITÄT "Certainly for t:t-'ei)Vkly purp01e:1 Somolf was a relotfvely mr:anJngless lt'rm. ldt'nlily was dt'-t('mt/ned by geneal· ogy. which worl:td ftom lhe individual up and a progenitor dO'Mt'fl and grew mor� incluli'-"'t! with n-ery gr.nrration r<m<mbernl" (Simoru 1995: J9).
Das wichtigste Gesellschaft konstituierende Identitätsmerkmal der Somali ist die patrilineare
Abstammungsrecbnung. ln einer "national genealogy" werden Dir, Isaq, Hawiye wld Oarod in
der Abstammungslinie "Somali/Samaale" zusammengefasst, Digit und Rahanweyn gehen als
Nachkommen der Linie "Sab" (Lewis 1969: 341 f; ders. 1999a (1961): llf). In mAnnlieber
Linie kann die individuelle Deszendenz Ober diese alle Klanfamilien erfassenden zwei Haupt·
Iinien bis zu einem gemeinsamen "mythischen" Vorfahren (Hiil) zurückgereebnet werden.
Diese auf Blutsverwandtschaft beruhende somatische Identität, die in der Gegenwart und jün·
geren Vergangenheit "faktischer", bei wachsendem historischen Abstand jedoch zunehmend
"li.ktiver'' Natur ist, wird im Bereich der Religion durch den starl<en Glauben an eine direkte
11 Harar, Hargcisa, Berbern sind alte stlldtische Zentren. 19 Dieser Befund wird von Bradbury auch Rlr die jOngcre Gogmwan beslllligt "lkfore the 1990s
war morc ihan 60 per cent ofSorJUJ!ia's populatiion engag<d in some form ofnomadic pastoralism" (Bradbury 1997: 3 ).
20 Die nun folgende Darstellung der als "traditionell" bezeichneten soziapolitischen Ordnung der somafischen Paston�l-Nonuden basiert zum großen Teil auf den Ergebnissen der von I.M. Lewis in der Mitte der 1950cr Jahren durchgefllluten Feldforschung, auf die sich alle mir bekannten nach· folgenden Autoren beziehen. Die Ordnungsmuster sind somil weder "uralt" noch frei von kolonialer Beeinflus•;ung. D:J.S "ethnographische Prisens" wird, allerdings nur in den Abschninen 2.2.1· 2.2.6 verwende!, da trotz aller Vmnderungen zentrale Aspekte der lr:lditioncllen Gcsdlschafls. onlnung bis heute auflokaler und, in gewandelter und z.T. manipulierter Form. auch auf ,,nationa· !er Ebene relevant sind.
Copynqhled malcria
/3
Verbiodung zur Familie des Propheten Moharnmed ergänZ! (Lewis 1999 ( 1961 ): I f; Mukhtar
1995: lf; Mansur 1995: 1 17).21
Die Somali sind stre.nggläubige sunnilischc Moslems. Der Islam halle sich ab dem 7. Jahr
hunden n.Chr. an der KUste SUd-Somalias ausgebreitet. Im Norden etabliene er sich, entgegen
lr.ldilioneller somalischer Überlieferungen, erst wesemlich später, deutlich nach der Jahrtau
sendwende (Mukhlar 1995: 3-11 ). 22 Mit Blick auf das ethnisch-religiöse Selbstverständnis der
Somali ist fcstzuhallen: "(. .. ] through their frequent auachcmcnt to lsl•un thcir faith bccomcs a
vehiclc for the exprcssion ofthcir remarkablc pridc as a people" (Lewis 1999a: 26).23
2.2.2 FAMILIEliND WIRTSCHAFT Ein Somali-Mann kann mehrere Frauen beirat.en.24 Die Frauen und ihre Kinder leben jedoch
in seperaten Haushalten. Oie Kernfamilie (raa.o;/haas) besteht aus einem Ehepaar und seinen
Kindem und vcrrugt Ober Kleintierherden (Ziegen, Schafe) sowie einige Kamele. Die somati
sche Wandcrwinsehafi ist durch zwei sozioökonomischc Gnmdeinheiten gckcnnzcichncl:
1.) Das "nomadic hamlet" (reer/gu.ri) besteht meist aus mehreren verwandten Männem mit
ihren Frauen, ihren Kleintierherden und einigen Last- und Milchtieren, also Kamelen oder
Rindern. Als Gmppe sind diese sozialen Einheiten häufig nur temporär zusammengeschlos
sen. Ent.scheidungen werden entlang informeller Autoritlitsstru.kturen getroffen, die vornehm
lich an Alter Wld Erfahmng gebunden sind (Lewis 1999a: 56ff).
2.) ln den sog. "Camel camps" hüten Jungen und junge Männer mehrere, in einem um?.äun
ten Kral eingeschlossene Familienhcrden; diese stellen die winschatlliche Grundlage des No
madenlebens dar (Lewis 1999a: 89). Weder in Bezug auf die ''Bclcgschafi" noch bezUglieh
der Lokalität sind die "camel camps•· festgerugte soziale Einheiten. Neben der Sorge um die
" Historische Untcr.;uchungen bezOglieh der ZusammenschlOsse von Veni<:hiedcncn, z.T. ethnisch nicht zu den Soma Ii gehörenden Gruppen, verdeutlichen das Ausmaß der Konstruktion der Somaliidentität "1 ... I somali clon structurc lypically is not based on blood rclauonship, but rather is a fruit ofnomadic pastoral life" (Mansur 1995: 122).
n Als einen wichtigen Grund fllr das Ausbleiben einer frOheren lslamisierung des Nordens gibt Mukht:Jr die nieht-scsshafic Lehensweise der Nord-Somali an. Im Norden war die urbane Kultur. in der sich religiöse Zentren hllllen bilden können, wesentlich schwächer ausgeprftgt als im Silden (Mukhtar t995: 8).
" Allerdings wird sich in den wciteron Ausfiihrungcn, besonders zu Autoität und Recht bei den Somali, noeb zeigen, dass "Somah custom" und Islam z.T. stark miteinander verschmelzen. Dies fOhrt dazu, das$ religiöse Regeln durchaus in unorthodoxer \Vdsc hinter pastor:�l·nomadlschcn Aspekten som3Hscher Kultur zurücktreten.
" Heiraten werden nach vorheri!,'tll Verhandlung,en durch Austausch von Geschenken zwischen dc't'l Familien·Gmppen der IIenalSpanner abgeschlossen; der vom Brilutigam zu zahlende "bride
Copynghtcd malcria
Tiere haben die "camcl camps" auch die Funktion, die jungen Somali in das Nomadenleben
cinzufilhrcn.lS Autorität wird von den ältesten und erfahrensten Hirten ausgcUbt {Lewis
1999a: 7211).
Insgesamt sind sowohl •·nomadic b.amlets" als auch "camel camps" autonome und lokal
wie sozial instabile Einheiten. Nur in BcdrohlLngssituationen, wie z.B. Krieg, schließen sich
mehrere solcher Einheiten zusammen {Lewis 1994: 28). Die Wandetbewegungen beider Ein
heiten verlaufen weitgehend unabhängig voneinander. Sie richten sich nach den aktuellen
Umwcltbedingungen. nach der Vcrfilgbarkcit von Brunnen und Weiden sowie nach den unter
schiedlichen ökonomischen Anforderungen der Kleintier- und Kamelherden (Lewis 1999a:
82f; ders. 1994: 23-28; Laitin/Samatar 1987: 24). Bei der Betrachtung dieser beiden wirt
schaftlichen Grundeinheiten wird ein wichtiges Element deutlich. welches das auf Verwandt
schaft und infonneller Autoritllt (s.u.) basierende Gesellschaftssystem ergänzt: Der "Sinn" der
Soma Ii filr Unabhängigkeit und Individualismus (Lewis 1999a: I).
2.2.3 SEGMENTÄRE GESEI.LSCHI\FTSORPNUNG UND DIE ROU.E VON VERWI\NDTSCHI\FT (TOI.)
UNo VERTRAG (XEERIHEER) Die Somali-Gesellschaft basiert auf einer ,,segmentären" Ordnung. Dieser Begriff soll kurz
erläutert werden, da Aspeide der damit verbundenen Theorie einen wertvollen Beitrag filr das
Verständnis der politischen Entwicklungen in Somalia zwischen I %0 und der Gegenwart
leisten können: Ocr ursprOnglich von Emile Durkheim geprägte Begriff der "segmentären
Gesellschaft" wird von Siegrist definiert als: ••eine akcphale {d.h. politisch nicht durch eine
Zentralinstanz organisierte) Gesellschaft. deren politische Organisation durch politisch gleich
rangige und gleichartig unterteilte mebr- oder vielstufige Gruppen vertnittelt isf' {Sigrist
1979: 30). Entscheidende Elemente segmentärer Gesellschallen sind unilineare Abstam
mungsrechnung26 und die soziopolitische Organisation von Individuen und Gruppen entlang
dieser Abstarnmungslinien.21 Nach der von britischen (Struktur-) Funktionalisten, wie z.B.
Evans-Pritchanl aufgestellten Theorie der segmentären Gesellschaften können verschiedene
"Segmente" je llllch "Tiefe" der zur individuellen Identifikation herangezogenen Genealogie,
u.U. verbunden mit oder ausgedrOckt in territorialer Zusammengehörigkeit, voneinander un-
wealth" (Yarad) variiert je nach den an Schönheit, Familienstatus cl<:. festgemachten "Qualitlten'' der Braut tmd Obersteigt die Mitgift (Dibaad) deutlich (Lewis 1994: 330).
" Lewis bcuichnet sie als "'initiation schools for the nomadic life" (Lewis 1999 (1%1): 75). ,. Dies erleichtert die Etablierung eindeutiger loyalitiitsbcziehungen, da jedes Individuum seine Stel
lung in dcr Gescollschafi klar bestimmen kann. " So k:mn das Fehlen einer politischen Zentralinstanz "kompensiert" werden.
Copynghtcd ma riR
1 5
terschieden werden. Auf Grund dieser variablen Konstruktion sind die politischen Einheiten
segmentärer Gcscllschaficn meist nicht klar untereinander und gegeneinander abgrcnzbar.
luoerbalb dieser segmentllren "Verschachtelung'' (Stag! 1999: 338) entwickeln sich dynami·
sehe politische Beziehugen. deren charakteristisches Merkmal Fusions· und Fissionstcnden·
1.en sind. Abhängig von äußeren Zusammenhängen, wie der Eskalation von Konflikten oder
der Bedrohung durch Naturkatastrophen, und. inneren lnteressenlagen, wie Sicherheit oder
wirtschaftlichen Vorteilen, tendieren untere Segmente hin zu einem Zusammenschluss auf
höherer Ebene (Fusion), oder es kommt, umgekehrt, zu einem Zerfall der Obergeordneten Ein
heit in mehrere Teilsegmente bis hin zur Abspaltung von Gruppen (Fission) (Sigrist 1979:
211251732145-47; Evans-Pritchard 1962 ( 1940): 278ff; Stagl 1999: 338). Zentral fllr die
Idenliftkation der verschiedenen Segmentalionsebenen und somit auch fllr den Verlauf so?jo
politischer Prozesse ist das Prinzip der ,.segment!lren Opposition'.28• 1m Hinblick auf Kon
Oikteskalation oder Allianzbildung stehen einander gleichrangige Segmente gegenüber. Ver
mittlungsbemUhungen können auf einer übergeordneten, (noch) nicht direkt tx:tciligtcn Ebene
unternommen werden (Sigrist 1979: 47/124). Mit Blick aufdiese theoretischen Ausruhrungen
ist anzumerken, dass die konkrete "Lebenswirklichkeit" nicht ohne weiteres diesen funktiona
listisch-schematischen Annahmen entspricht: "Auch die 'Abstammung' ist kein Schicksal,
sondern politischen und religiösen Wirkkräften, menschlichen Ambitionen also, zugänglich"
(Sch1ee 1996: 141 ).29
Die wichtigsten Ebenen der scgment.!lren Gesellschaftsordnung bei den Somali sind: "clan
family", "clan"f'sub-clan". "primary lineage" und "dia-pa}ing-group". Klan-Familien können
ihre Zusammengehörigkeit Ober bis zu 30 Generationen herleiten. Sie sind somit in den meis
ten Fällen zu groß, um als korporicrte politische Einheit zu agieren. Allerdings kann die indi
viduelle Zugehörigkeit zu rivalisierenden Klan-Familien in Städten, in denen Menschen sehr
unterschiedlicher HerkunO versammelt sind, eine Rolle spielen. Auch im Bereich der kolonia
len und postkolonialen Parteipolitik (s.u.) sind Klan-Familien bestimmend. Auf der im "scg
mentllren Schema" den Klanfamilien untergeordneten Ebene befinden sich die Klans. Deren
"Abstammung" kann bis zu 20 Generationen zurilckverfol!,'l werden. Auf politischer Ebene
sind sie, unter Beachtung der eben erwähnten Einschränkungen, "[ ... J the upper Iimit of corpo
ratc political action" {Lcwis 1999a: 5). Zwar kann an der Spitze der Klans ein "clan-hcad"
(Sultan) stehen; insgesamt ist die Klan-Strulktur jedoch nicht durch eine zentrale, interne
11 Sigrist spricht von ,,komplemcnwcT Oppositoon" (Sigrist 1979: 47). ,. Bt,.t.cnum betont di< RelativitJII der Klan-ldcntilllt lx-sonders hinsichtlich SUd-Somalias (Bosteman
1999: 20).
Copynghtcd malcria
16
"Verwallung" geordnet. l n der traditionellen somaliscben Gesellschaftsordnung ist Territoria·
lität als Identifikationsmuster kaum relevant. Nur Klans sind in einem gewissen Maß an das
Territorium ihrer saisonalen Wanderungen gebunden (Lewis 1999a: 2/41). Unterhalb der
Segment:uions-Ebene der Klans können Sub-Klans und "primary lineagcs" unterschieden
wcrdett, wobei in Lcwis' Darstellung erstere nur am Rande genannt werden, während l etztere
als "( ... ) most distinet descent group within the clan( .. .)"' (Lcwis 1999a: 5) herausgehoben
werden. Diese sechs bis zehn Generationen runfassenden '"primary lincages" sind im Alltag,
7..8. hinsichtlich Identifikation oder Heirat. meist der erste BC?.ugspunkt der Individuen. Ob
wohl Lineages durch Deszendenz-Linien imem sehr eng vernunden sind, kommen Konflikte
hier h:l.ufig vor.30 Das Fundament der segmentären Somali-Gesellschaft stellen die "dia-paying
groups" dar. Die Zugehörigkeit zu dieser sieb Ober bis zu sechs Generationen herleitenden
politischen und rechtlieben Grundeinheit" wird sowohl durch patrilincare Verwandtschaft
(tol) als auch durch eine Vc:nragsbindung (xoerlheer)l2 bestimmt. Zentral ist, dass die Mit·
glicder dieser von wenigen hundcn bis zu einigen tausend Menschen" umfassenden Gruppen
sieb gegenseitig bei der Zahlung oder der Einforderung von Kompensationen (diya)l4 beiste·
hcn, die fiir verursachte:; oder erlittenes Unrcchi zu entrichten sind (lcwis 1999a: 6).
,. KonOigierende Interessen sind fllr alle Ebenen von Segmentalion charakteristisch. Oie lllufigkeit von KonOikten gmule innerhalb der verwandtschaftlich ··stabil"' verbundenen Lineages kann mit Bezug auf die raumliehe Nähe des sozio-ökonomischen Handeln.< erktart werden: W2hn:nd die Mitglieder von Klan-Familien und Klans sehr v<:rstreut lcben. stehen Lincogc-Angehörige im Be· reich des HUtens von Herden und der Nutzung von Weiden und Brunnen oft in enger sozialer und territorialer Verbindung; daraus ergeben sich gerade in der Trockenzeit (Jiilaal) Spannungen (lewis 1999a: 45).
" Lewis spricht von "'basic politic:U and jural unit'" (Lcwis 1999a (12961): 6). " Verträge können auch auf anderen Ebenen der Segmentalion wirksam werden und z..B. Friedens·
v<:n:inbarungcn zwischen verfeindeten Gruppen absichern. " Militärosche und ökonomische Stärke. interne Führungsstrukturen etc. sind wichtige Faktoren f"ur
die StJbilisi<rung bzw. das Auseinanderbrechen dieser Gruppen. Die interne Stabilit5t der "diaJXIYil•g groups" hängt stark von '"jiffo-groups·· ab. Diese engen BUnde unmitielbarer Verwandter. die im Falle eines Homizids einen zcntr:1lcn Teil der Kompensation empfangen oder zahlen. verfU. genOber großes FOhrungs-, aber auch Spannungspotential {Uwis 1999a: 172f/183f).
,. Kompensationen. in Af·Somali auch "mag" genant, werden z.B. in Form von Kamelen gezahlt. Oie 1!6he der Zahlungen ist gtwohnheitsrcchtlich sowie durch vertraglich variable Abmachungen fest· gelegt. Allerdings ist zu beachten, dass KompensationS7.ahlungen nur von einer Position der milit2· riscben Überlegenheit aus erLWIJngen werden können und dass ("Blut"'·) Rache dem Empfang \'On Kompensationszahlungen ''Orgezogen werden k:lnn (Lcwis 1999a: 162-164). Bei Schlee findet sich ein aktuelles ( 1990) Beispiel von Kompenutionsvcrhandlungcn zwischen zwei pastoral· nomadischen Gruppen in Nordkenill. dos die große Rolle von milillrischer Stärke im Hinblick auf diya-Zahlungen sehr gut illustriert Besteman ste.Jit diesen Punkt im Zusammenhang mit Konflikten zwischen bodenbauenden und Vith haltenden S:Omali im SOden heraus. ln beiden nllen wird fol· gendes Muster deutlich: Wenn eine schwächere Gruppe von einer sl!lrken:n Kompens.1tion fordert, besteht die letztere Gruppe darauf, den KonOikt .,brüderlich" beizultgen und dementsprechend
Copynghtcd ma riR
1 7
Insgesamt lässt sich erl<ennen, dass patrilinearelS Verwandtschaft das wichtigste, die seg
mentäre Gesellschaftsordnung der Somali strukturierende Element ist. Die Desr.endenzord
nung ist dynamisch: "[ ... ] kin group alliances form and divide in responsc to intcmal und cx
temal changcs, such as a specific tllrcat to sccurity" (Bradbury 1997: 4). Auf Ebene der "dia
paying groups" tritt das Instrument des Vertmges hinzu; dadurch werden diese im soziopoliti
schcn Bereich sehr wichtigen Gruppen stabilisiert. Obwohl jeder Somali-Mann36 in eine "dia
paying-group� hineingeboren wird und eine solche Gruppe somit aus nahen patrilinearen
Verwandten besteht, köMen vertragliche Bindungen auch Uber die Grenzen verwandtschaflli
cher Zugehörigkeil hinweg etabliert wenlen. Die traditionelle Gesellschallsordnung wird da
durch flexibilisiert31, aber auch konkretisiert (Lewis 1999a: 186fl).'s
2.2.4 ALLGEMEINE VERSAMMLUNGEN (SHIR) UND EGALITAT .. Evtry fr«bom man holds himsclf cqua/ to lri.f rulr.r. and allows no royalities or prerogutin�s ro abridge Jtu bi•thright oflilx!rty •• (Burton1000: I J4/).
Grundsätzlich werden alle wichtigen soziopolitischcn und ökonomischen Entscheidungen,
wie die Aushandlung von Gruppen- oder Friedensverträgen, die Planung von Kriegszügen. die
Installation eines KlanR!brers, die Auswahl der WcidegrUnde, aur Ebene der verschiedenen
Segmente kollektiv getroffen (Lcwis 1999a: 198). Auf allgemeinen Versammlungen (shlr) hat
jeder zur sich versammelnden Gruppe gehörende MaM Rederecht Im Falle sehr großer shirs,
z.B. auf Klanebene, werden in zuvor abgehaltenen kleineren Versammlungen von den einzel
nen beteiligten Untergruppen Repräsentanten ausgewählt. Shirs unterliegen lmum formalen
Regeln; Zeit und Ort werden spontan festgelegt. Von d•:n Aktcurc'tl wird lediglich erwartet,
dass sie sich den ub'lllen Sillen" cntsprcchend3• verhalten. Auf shlrs vereinbarte Friedcnsab-
niedrigere diya-Forderun,gen zu stellen als zwischen nicht eng miteinander verbundenen Paneren Obiich (Schlte 200 I: I I : Besteman 1999: 1260.
" Andere vcrwandtschafiliche Bindungen spielen im politischen Bereich eine untergeordnete Rolle, sind jedoch nicht völlig zu vemachlassigen. Die häufig in lineages und diya-paying groups vorgeschriebene Exogamie weist auf die llcdctllung; von Heiratsverbindungen im Bereich der Bildung von Allianzen hin. Zudem sind z.B. matrilaterale Baude im Bereich alltäglicher sozialer Kontakte und Solidaritätsbeziehungen von Bedeutung (Lewis 1995: 15; ders. 1994: 47f/S3·S5; ders. 199% (1961): 1410.
" Frauen sind in obgeschwöchtcr Form tn die Gruppe ihrc.s Mannes integriert, erholten jedoch ouch noch Verbindungen zu ihrer Gehunslinie aufrecht (Lcwts 1999:1: 162f/171 ).
" Simons geht soweit, zu sagen: "Xecr is thc pa."oralists' counterbalance of scgmcntation" (Simons 1995: 43).
" Farah und lewis sprcchc�t insgcsomt von einem "[ ... ] segmentary system ofrela ltvely mobthsed l,>rOUps( ... )'' (Farah/lewis 1993: 1 1 ).
•• Die• bcinho.ltet z.B. die Achtung vor den "Ältesten".
Copynghted malcria
18
kommen werden in Fonn eines durch Eid besiegelten xeer/heer bekräftigt (Lewis 1999a: 198f;
Menkhaus 2000: 186).4()
Insgesamt entspricht diese Art des "Politik-Machens" dem flir segmen täre Gesellschaften
"typisehenH und auch im einleitenden Burton-Z'itat deutlich anklingenden "Egalitäts-ldeal" der
Somali. Allerdings darf die Gleichrangigkeil auf einer idealen, abstrakten Ebene nicht mit der
Gleichheit des realen soziapolitischen Einflusses von Individuen verwechselt werden. Der
Einfluss des Einzelnen h!lngt stark von seinem sozialen Status ab, der wiederum mit
Wohlstand, individuellen Begabungen, religiösem Wissen etc. verbunden ist (Lewis 1999a:
196; Laitin/Sarnatar: 421).
2.2.5 RELIGIÖSE UND WELTLICHE Alfi'ORITÄTEN
Im Bereich der traditionellen somatischen uPolitilc'"'1 gibt es durchaus klar umgrenzte Zustän-
digkeitsbereiche und herausgehobene Autoritllten. Eine generelle Dichotomie besteht zwi
schen religiösem und profanem Bereich. Den "'Männem der Religion" (wadaad), die im rituel
len und religiösen Bereich agieren. als friedliche Vermittler fungieren und sich idealerweise
physiseher Gewalt enthalten, stehen die ,,Krieger'' (waranleh) gegenüber, denen wichtige so
ziopolitisehe Führungsaufgaben zukommen. Allerdings ist diese Trennung nicht absolut (Le
wis 1999a: 27f/196f72131).
Sbelkhs: Die wichtigsten religiösen Würdenträger werden ,.Sheikhs" genannt. Als lslam
Gclehne sind sie fllr die VemJittlung islamisch.en Wissens, z.B. in Koran-Schulen, zust!lndig.
Sie leiten die täglichen Gebete und halten im Landesinneren Gericht, da institutionalisierte
islamische Richter (kadis) vornehmlich in Städten ansässig sind. Den Sheikhs kommen auch
wichtige Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Religion und Politik zu: Zum einen segn.en
sie die allgemeinen Versammlungen (shirs) und die dort getroffenen Entscheidungen; zum
anderen bildet ihre über die verwandtschaftlichen Beziehungen hinausgehende religiöse Stcl-
"" Während man vertragliche Obereinkünfte in vorkolonialer Zeit mündlich tr.sdierte, wurden sie in der Kolonialzeit zunehmend schrifllich fixiert und bei der Kolonialverwaltung, als Teil des Kolonialrechts hinterlegt; (Lewis 1999a: 175l).
" Der Begriff "Politik" wird hier, in Anlehnung an den Bedeutungsgehalt des zu Cmmdc liegenden griechischen Adjektives "politikos" (wOrtl.: die !Bürger betrefl'end) sehr weit gefasst und beinhaltet alle die soziale Gerneinschan betreffenden Entscheidungen. Im somalischen Kontext sind demnach, unvereinbar mit den europäischen ,Jdealv.o,..tellungen", Verwandtschaft und Religion wichtige Inhalte von Politik.
Copynghted ma riR
/ 9
Jung eine Ausgangsbasis filr VennittlungsbemOhungen zwischen verfeindeten Gmppen (Le·
wis 1999a: 199/214-217; Farah/Lewis 1993: 26-28} 42
Sultane: Die exponieneste politische Position in der somalischen Gesellschaftsordnung ist
die des "Sultans". Dieser steht an der Spitze eines Klans oder Sub-Klans und symbolisien
dessen Einheit. Er ist tllr das Wohlergehen seiner Gruppe verantwortlich und Obernimmt be·
sonders in Bedrohungs· und Konfliktsituationen die politische Führung. Allerdings ist seine
Stellung instabil. Ein Klan oder Sub-Klan muss nicht Ober einen Sultan an der Spitze verfU
gen. Das "Sultanat"' als Amt hängt trotz seiner prinzipiellen Erblichkeit von den ökonomi·
sehen und charuktcrlichen Rcssou.rccn, z.ß. Eloquenz, Entscheidungskraft, moralische lntegri·
tät, seines Trägers ab (Lewis 1999a: 20311).
Aklls43: Der zentrale Fokus der Kolonialverwaltung war auf die "dia-paying groups" als
die wichtigsten soziopolitischen Einheiten der traditionellen Somaligesellschafl gerichtet. Aus
dieser kolonialen Entwicklung ergibt sich die bis heute politisch sehr wichtige Stellung der
Akils. die irmerhalb von "dia-paying groups" eine herausragende Stellung inne haben. Akils
konnten sich gegen den anmnglichen Widerstand seitens der Sultane und der Bevölkerung als
Partn.cr der jeweiligen kolonialen und postkolonialen zentralen stantlichen Verwaltungsinstan·
zen etablieren, in deren Auftrag sie vor Ort filr Ordnung sorgen sollten (Farah/Lcwis 1993:
24f; Lcwis 1999n: 20 I).
Älteste: Die entscheidende und umfassendste gesellschaftliche Ordnungsfunktion liegt in
den Händen von "Ältesten''.« Diese zeichnen sich vornehmlich durch Alter, Abstammung,
Wohlstand, physische Stärke, Mut, politische Erfahrung, Wissen über Recht, Kultur, Traditio
nen und Religion, Beredsamkeit und Großzügigkeit aus. In verschiedenen Situationen sind
unterschiedliche Qualitäten wichtig; somit kann keine "Hierarchie von Tugenden" aufgestellt
werden. Allgemein ist es eine Auszeichnung für einen .i\Itesten und politischen Führer. wenn
'1 Dies ist auch filr die postkoloniale Stabilisierung des somalischen Staates bedeutend: "Nationalists and religious idealists meet on common ground in opposing the d••·paying group system, which ( ... ] they regard as the fundamental obstacle to the prornotion of national and Muslim solidarity:· Lewis 1999a: 2171).
"' Die Bezeichnung "Akil", die sich von der arnbischen Wortwurzel ftir ,.wcise"l"intelligt'111"nbleilct. wird schon von Burton fllr Berater eines lokalen Sheikh oder "head man" erwähnt. Als Vermittler zwischen KolonialadminisiTation und Bevölkerung standen die Akils Jedoch erstmals im Dienste der Ägyptcr und wurden schließlich von Großbritannien "übcmornmcn" (Burton 2000: 134; Lewis 1999a: 19)
" Dieser Begriff w1rd in der ctl111ologischen Litrrarur häufig sehr allgem<:in verwendet und bedarf noch genauerer Untersuchung: Andrea Nicolas (Max Planck Institute for Social Anthropology, HalldSa.alc) arbcitc:t dC"rzc:il an einer Dis.scnat ion zu die�m Thema mit dem regionalen Schwer· punkt Äthiopien; siebe: www.eth.mpg.de/peoplelnicolas/nicola;.html.
Copynghtcd malcria
20
er als "belaayo" (sinngemäß: "Katastrophe filr den Gegner") bezeichnet wird. Älteste spielen
auf allen Ebenen der segmentären Gesellschallsordnung vornehmlich als Vermittler in Kon
flikten und "Schiedsrichter" (s.u.) eine wichtige Rolle. Sie Oben ihre Entscheidungsmacht
kollektiv auf den eingangs dargestellten allgemeinen Versammlungen (shirs) aus (Lewis
1999a: 196-1981200; Famh/Lewis 1993: 18: Menkhaus 2000: 1851).
Zusammenfassend ergibt sich, dass in der traditionellen Somali-Gesellschaft durchaus hie
rarchische und, in Grenzen. zentralisierte Autoritätsstrukturen existieren. Diese sind aber im
Vergleich zu einem System dauerhaft institutionalisierter Zentralgewalt instabil wld hängen
stark vom jeweiligen ''Kontext" (individuelle Fl!higkeiten. externe Einflüsse) ab. Autoritilt
wird nicht generell akzeptiert und filhrt häufig zu Rivalitäten zwischen Individuen und Grup
pen um politische Entscheidungsmacht sowie materielle Rcssourcen.•s
2.2.6 RECtfTIJNDKOSFUKT Rt(hUgrundlagm: Das Recht der Somali-Gesellschaft fußt auf traditionellen pastoral-
nomadischen Nonnen. ergllnzt durch das islamische Sharia-Recht.46 In den immer nur filr be
stimmte Gruppen (''dia-paying group", "primary lineage" etc.) von allen Beteiligten ausge
handelten YeTITilgen (xeerlheer) werden Rechte und Pflichten der Mitglieder detailliert festge
legt_ Wl!hrend die Delikts-Kategorien, wie z.B. Mord, Verwundung. Beleidigung, unzulässige
Heiraten, im gesamten pastoral-nomadisch gqJrägtcn Somali-Gebiet relativ allgemeingültig
sind, variieren die Strafen in Fonn von Kompensations01ahlungen je nach Vertrag. Auf Ver
änderungen im Umfeld einer vertraglich zusammengeschlossenen Gruppe kann durch Modifi
kation des Vertrages reagiert werden (Lewis 1999a: 1 74-180).
Rt(btsdurcbset•ung: In der Somali-Gesellschafl gibt es kein 1.entrales Gewaltmonopol.
Oie Rcchtsdurchsctzung ist von der militärischen Stlirke des in seinen Rechten verletzten In
dividuums und seiner Gruppe abhängig. Das pastoral-nomadische Rechtssystem basiert also
auf der Androhung von und dem ROckgriff auf gewaltsame Selbsthilfe. Dabei sind die schon
" Treffend nn•1ystcrt Bunon die Autontlltsbasis eines "Odd:ti (shaikh or head man)": "He is obeycd only when his orders suit the taste of King Demos [gri<eh.: Volk - allgemein, nicht <thnisch). is always supc:rior to his fcllows in wca1th of catt1e. sometimes in talent and eloqucnce[ .. .]" (Burton 2000: 134). Lewis bezeichnet "Älteste" als "odayaal" (Lcwis 1999a: 196). Diese Merkmale mn "abh3ngiger" Autorität lassm sich durchaus fllr politische WOrdenträger unter den Somali verallgemeinern.
" Hierbei ist anzumerken, dass beide Normenkomplexe in wichtigen Bereichen. wie z.B. der Bestrafung von Homizid. im Widcrsp.ruch zueinander stehen: "Biut·Geld"-Zahlungen und "Blut-Rache" entsprechen nicht der Sharia. deren Inhalt der Koran und die "Troditionen" (Hadith) ousmacben (Lewis 1999a: 12612t7f).
Copynghtcd ma riR
21
erwl!hnten dynamischen sozialen Verbindungen innerhalb des scgrncnt:lren Gesellschaflssys·
tems von entscheidender Bedeutung. "ln Somali lineage polities the assumption that might is
right bas overwbelming authority and personal rights, rights in Jivestock, and rights of access
to grazing and wntcr, cvcn if thcy arc not always obtaincd by force, can only be defendcd
against usurpation by force of arms" (Lcwis I 999a: 3). Der RUckgriff auf Gewalt fördcn, in
Zusammenhang mit dem Prinzip der "segmentären Opposition", die Eskalation von Konnik·
ten (Lewis I 999a: 253-255).
Gericbtsbarkell: Um den Frieden wieder bcnustcllen, köMcn scbr gewichtige Konniklc
innerhalb eines Klan5 vor den jt-weiligen Sult:an gebracht werden, der jedoch nicht mehr als
ein Yenniltier ist und über keinerlei bindende Sanktionsgewalt vertilgt (Lewis 1999a: 206).
Die meisten ungelösten Dispule werden vor ein ad hoc Schiedsgericht (guddi) gebracht. Das
Konfliktlösungs-Potential dieser von Ältesten geleiteten. u.U. von externen Mediatoren unter·
stützten, Sch.icdsgcrichte ist jedoch bcscbriinkt. Nur innerhalb von stabil verbundenen Solid.�
ritätsgruppen können effektive Sanktionen gegen einen Rechtsbrecher verhängt werden, so·
fern dieser in der Gruppe verbleiben will und sich nicht zur Abspaltung entschließt. Gegen
Nicht-Mitglieder lassen sich kaum effektive Stmfen erwirken. Bei Konnikten zwischen den Angehörigen verschiedener sozio-politischer Einheiten Mngt der Erfolg der schiedsgerichtli·
chen Verhandlung47 von dem Friedenswillen der beteiligten Konfliktparteien ab; so kaM z.B.
innerhalb des eigenen sozialen Umfeldes der in einen Konflikt verwickelten Individuen Druck
auf diese ausgeiibt werden, um d.ie friedlichen Beziehungen auf dem imer·SCb'lllentären L.cvel
zu erh.alten (Lcwis 1999a: 1681228). Hier wird ein allgemeines Charakteristikum somatischen
Rechts deutlich: Träger von Rechten und Pflichten sind stets Gruppen, auch wenn sich Kon·
Oikle natürlich am Verbalten von Individuen emz!lndcn.'8
Insgesamt zielt der Pro?-ess der Uneilslindung in Schicdsgcricht.svcrfahrcn weniger auf
Konfrontation als auf einen mr alle Beteiligten akzeptablen Kompromiss ab.'• Wenn die fricd·
41 Zum allgememen Abl3uf: Die dem "gudd1'' vorsitzcndt.-n Ältesten arbcilcn auf der Basis der gegnc· rischen Aussagen den Konfliktgegenstand h<raus. Anschließend mü..•scn die Positionen der Kon· Ooktpartcicn durch l.cugcn, doe unter Eod stehen, gestützt wcrdcn. Auf Grund der so gewonnenen Erkenntnisse t1illen die Ält<.-sten ein Urteil. Wird die Entscheidung der Ältesten nicht angcnom· men. kann dies Abspaltungen und Gewaheskalationtn rur Folge haben (Lewis 1999a: 229-232).
" "Excq>t bctwccn tho� clo� kinsmcn who inh.crit togcther and who comonly assist <-:�eh othcr in payrncnt ofbride-wealth and who share the bride-wealth reCCIVcd wbcn a girl is marricd. all delicts conccm groups" (l.ewis t999a: 167). Oieses Rcehtsver>tandniss herrscht nach Sii,'list allgemein in verwandosch:lftlich organisierten Gt.-sellschaflcn vor, in denen "( ... ] die mctstcn subjektiven Rechte den dn'lelnen nur als Angehörigen bcslimmtcr Gruppen ( ... )'' zusoebcn und deshalb auch die Ver· Ietztongen der Rechte eines Individuums ganze Gruppen betreffen (Sigrist 1979: 123).
49 Dies kommt z.B. darin 7J.lm Ausdruck, dass nicht frstgc1c:gt ist. Wie oft (vemü_nfttgcrweJse) Einspruch erhoben werden kann. bevor da.s Schellern cim.·s Schicdsverfahrcns ak.7.cplicrt wird (t..cwis
Co Y' ghK-d n a nia
22
liehe Austragung von Konflikten scheitert oder von vomherein nicht in Betracht gezogen
wird, kommt es sehr oft zu einem RUckgriff auf Gewalt (Lc"�s l999a: 27/232).
Konßiktgegenstlnde: Die zentrale Lebensgrundlage der Pastoral-Nomaden sind ihre
Groß- und Kleintierhcrden, deren Überleben und Wachstum in einer kargen Umwelt von der
effektiven und gesicherten Nutzung des Weidenandes und der Wasserressourcen abhängt. So
mit können diese beiden knappen natürlichen Ressourcen als hauptsächliche Konfliktgegens
tände idcntifizicn werden (lewis 1999a: 3/2421).
KonOiktaustragung: ln Konflikten geht es jedoch nicht um die Etablierung dauerhafter
Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet und seine Ressourcen. sondern um die temporäre
Durchsetzung von unmittelbaren Interessen. Besonders in der Trockenzeit Gilaal - von De
zember bis Anfang April) kommt es zu Zusarnrnenstössen, die sich rasch von Konflikten zwi
schen Individuen zu Gruppenkonflikten entwickeln und sich im Falle gewaltsamer Eskalation
zu Fehden und Krieg50 ausweiten können. Die Spannungen können sich über lange Zeiträume
erstrecken, da u.U. erst in der Regenzeit (gu - Mai bis Juli) genUgend Kraftressourcen vor
handen sind, um adäquat auf erlittenes Unrecht zu reagieren zu können (lewis 1 999a: 43-45).
KonOiktc eskalieren in unregelmäßigen Abständen immer wieder und werden auch "vererbt".
Wie oben erwähnt ergeben sich im Konlliktfall die zwei grundsätzlichen Optionen der ge·
waltsarncn Vergeltung bzw. Rache51 und des friedlichen Ausgleichs durch Verhandlungen
und Kompcnsationszahlungen. Während gewaltsame Selbsthilfe im Zusanunenhang mit dem
noch darzustellenden Kriegerideal die Möglichkeit bietet, individuell oder als Gruppe "Ehre"
zu gewinnen, dienen Kompensationszahlungen der Stabilisierung des weiteren sozialen Um
feldes. Allerdings haben diese Zahlungen ofi keine nachhaltigen Auswirkungen fllr den Frie
den. weil die Kompensationssumme auf die gesamte Solidargruppe des Rechtsverletzcrs ver·
1999a: 23 t ). Paul Bohannen erkennt allgemein in Bezug auf .. Law in statclcss socicties .. : "lnstcad of 'dccisions thcre are ·compromises"' (Bohannen 1967: 53).
'0 Lcwis v<rwcndel die Begriffe "feud .. und "wnr· synonym. mit der einzigen (sehr unkonkrcten) Einschrlinkung, dass "war" verwendet wird, "[ ... ] whcn hostilitics are general and involvc !arge groups" (Lcwis 1999a: 242). Innerhalb der ethnologischen Theorie scheinen Begriffe wie .. feud" (Fehde) und ·•war" (Krieg) wenig geklärt. Allgemein wird angenorrunen, dass "Fehde" Gewalttatigkciten innerhalb von eng begrenzten (z.B. Verwandtschafts·) Gruppen umfasst, während ·'Krieg" mit einem hohen Maß an Organisation einhergeht und grolle Gruppen betriffi, die nicht eng miteinander verbunden sind (Cameirol994: 6; Pospisil 1994: 1140. Dieses Verstandniss der Begriffe wird in Ermongelung klarer ethnologischer Definitionen in dieser Arbeit übernommen. Allerdings werde ich nach Möglichkeit auf umfassendere Begriffe wie .. Gewalt" und ,,Auseinandersetzung" zurückgreifen, um definitorische Missverstlindnisse zu vermeiden.
" Das "Opfer" der Rache kann nach Gruppenzugehörigkelt ausgewöblt werden. Je höher die segmentäre Ebene des KonOiktes, desto undifferenziener winl das individuelle Ziel der Vergeltung (l.cwis 19'.!9a: 254).
Copynghlcd ma riR
1J
teih und dieser somit von der vollen Last seiner Verantwortung entbunden wird (Lewis 1999a:
243-246).
Kooßiktrelevaote Ideale: Die Aufrechterlhahung stabiler, friedlicher Beziehungen wird
zudem durch das Kriegerideal der somatischen Kamelhirten erschwert. Kriegerisches V erhal
ten gilt als m:lnnlich. Wer seine Interessen und Rechte in einer unsicheren sozialen und öko
logischen Umweh gegenüber anderen behaupten kann und den Ruf eines belaayo erwirbt,
wird geachtet. Die wichtigsten lnhahe des somalischen Kriegerideals sind Kampfesmut und
Unabhängigkeit (Lewis 1999a: 26).52
h.ISgcsamt wird deutlich: Es sind durchaus Strategien der friedlichen Konfliktaustragung
vorbanden; doch die segmentäre Dynamik und der durch das Kriegerideal der Somali gesiUIZ·
te Rekurs auf gewaltsame Selbsthilfe als zentrales Instrument der Rcchtsdurchsctzung tOrdem
Konftikte: "Senlements reachcd with the tmnsfer of compensation are rnrely if ever final solu
tions and in prevailing struggle for survival there is a vicious circle of dispute, negotiation,
conciliation or fcud, and further dissention" (Lcwis \999a: 247).
2.2.7 BESONDERHEITEN DER SOZIOI'OUTISCHEN ORDNUNG IM SESSIIAFTEN KON1'EXT
Nachdem bisher auf soziopolitische Aspekte der pastoral-nomadischen Somali-Kultur einge
gangen worden ist, sollen nun kurz einige Unterschiede zwischen den viehhallenden und den
bodenbauenden oder in Stadten lebenden Somali hervorgehoben werden. Neben der Vcr
wandtschaftsordnung hat sich vor allem in den urbanen Zentren in Nord- wie in Südsomalia
eine "neue" Sozialordnung entwiekcll, die von der Handels-, Bildungs- und Yetwallungselite
getragen wird. Deren Angehörige sind als "permanent townsmcn" darum bc,nUht, sich von
den als belastend empfundenen verwandtschaftlichen Bindungen zu lösen. Diese Opposition
gegenOber der pastoral-nomadischen "lincage-Politik" ist ein Smtzpfeilc:r der somalischen
Nationalbcwegung, die sich im Zuge der KolonialherrschaO ab den J940er Jahren herauszu
bilden begann (Lewis 1999a: 941).
Sowohl unter der urbanen Elite als auch unter der bodenbauenden Bevölkerung Nord· und
SOd-Somalias'J haben sich im Zusammenhang deutlich hierarchische und autoritäre politische
Strukturen ausgebildet (Lewis 1999a: 13f/941fll 25f; Laitin/Sarnatar 1987: 281). Das Recht
" Lewis spricht von "[ ... ] belligcrencc, independcncc:, daring and pamche" (Lewis t 999a: 198). " Lewis bezieht sich fast ausschließlich auf Nordwestsomalia (Somaliland). Eine Grundlagenstudie
fOr den SOden ist mir nicht bekannt. Nur das jOngstc Buch Bestemans .. Unra,·eling Somalia" kann in Grcrw:n als .,Gegenstück" w .. A Pastorol l)cmocracy" gesehen werden. Allerdings konzentriert sieb Besteman auf eine sehr spezielle Gruppe von ,.')Udsomalis"; zudem hat sie zwar einen historischen Blickwinkel. doch ihre Positionen sind s.tark auf die Situation in den J980er/90er Ja.hren fo-
Copynghtcd malcria
24
dieser sesshaften Gruppen unterscheidet sich von dem der ihre Herden hütenden Somali inso
fern, als 1.) der Islam, vor allem in den Städten, in Form von Koran-Schulen und Kadi·
Amtssitzen fest etabliert ist und somit das Sharia-Recht leichter als im nur schwer kontrollier
baren H.interland Ober "unorthodoxe'' Normen der pastoral-nomadischen Selbsthilfe-Ordnung
obsiegt, 2.) die Vererbung von Landbesitz in bodenbauenden Gen1cinschaftcn von zentraler
Bedeutung ist und 3.) die Sanktionsmöglichkeiten im sesshaften Kontext größer sind, da ei
nem Rechtsbrecher kaum Ausweich- oder Abspaltungsmöglichkeiten offen stehen. Im Ver
gleich zu pa.�toral-nomadischen Gruppen sind hier die Bereiche enger sozialer Kooperation
sowie der Zuständigkeitsbereich des Rechts erweitert (Lewis 1999a: 122f/233f; Besteman
1999: J06f; Heiaoder 1997: 138-140). in Bezug auf das ''Kricgerideal" der Somali gelten die
Bodenbauern generell als "schwach", da sie weniger kämpferisch auftreten als die Pastoral·
Nomaden (Lcwis 1999a: I 0 I).
Trotz dieser besonderen Aspekte der sesshaften Sozialstruktur sind jedoch auch städtisch
und landwirtschaftlich geprägte Somali-Gemeinschaften eindeutig, wenn auch in "abgemilder
ter" Form, von der oben beschriebenen V crwandtschaftsordnung bccinftusst (Lcwis 1994:
137·139).
2.3 TRADITIONELLE ORDNUNG ZWISCHEN AUTORITÄT UND ANARC.HIE Die bisherigen Ausfilhrungen verdeutlichen, dass die komplexe soziapolitische Ordnung der
traditionellen Somali·Gesellscbaft nicht befriedigend mit Schlagworten wie "Demokr.llie",
"egalitäre Gesellschaft" oder "Anarchie" charakterisiert werden kann.s. Lcwis stellt fest: "Few
societies can so conspicuously Iack those juridical, administrative, and political procedures
wh.ich He at the hean of tbe weslern conception of government" (Lcwis 1999a: I). DeMoch
,.versinkt" die Somali-Gesellschaft nicht in Anarchie. Der Autorität von religiösen und weltli·
eben WUrdenträgem sowie den pastoral-nomadischen und islamischen Rechtsnonnen wohnt
ein crhcblich.cs soziopolitisches Ordnungspotential iMe. "Politik" und "Recht" sind im Kon
text der somalischcn Kultur stets in dynamische Verwandtschaftsbeziehungen eingebettet. Die
segmentäre D}nan1ik hat zur Folge, "( ... ] that political instahility is the society's normative
kussiert. Auf Bestemans differenzierte Betrachtungen SOdsomalias wird besonders in Abschmtt 6.5.1 eingegangen.
" Laitio IIJ)d Samatllr sprechen in Bezug auf die lr.lditioncllc politische Kultur der Sormli von"( ... ] a curious blend ofdemocracy, equality, and anorchy" (Laitin/Sarmtar 1987: 41). Sie relativieren ihre plakative Aussage jedoch sofort wieder, indem sie fest>1elh:n, dass zwar alle drei Schlagworte auf Teilbereiche der Somali-Ordnung zutreffen, jedoch die komplexen, oftmals konlligierendcn Beziehungen zwischen den angesprochenen politischen Charakteristika nicht erfasst werden können.
CowughK'CI na riR
25
cbaractt:ristic" (Laitin!Samatar 1987: 31). I)Qch auf Basis dieser instabilen Gesellschaflsord·
nung ist es möglich, dass in der pastoral-nomadischen Lebens· und Wirtscbaftswcise, die den
karg� Umweltbedingungen angepasst ist, grundgelegte Bedürfnis nach Flexibilität einerseits
und nach sozialer Sicherheit im Gruppenverband andererseits, zu befriedigen (Laitin/Samatar
1987: 22).
Copynghtcd malcria
26
3 DIE KOWNIALZEIT
3.1 KOLONIALE EROBERUNG Mit dem Bau und der im Jahr 1869 erfolgten Öffnung des Suez-Kanals r1lckte das Horu von
Afrika ins Zentrum der europäischen Aufinerksamkcit, die auf die Kontrolle des Verkehrs und
des Handels zwischen Mittelmeer und Rotem Meer gerichtet war. Die Hafenstadt Adcn an der
SUd-West-Spitze der arabischen Halbinsel diente Großbritannien ab 1839 als Stützpunkt, vor
allem um den Seewege nach Indien zu sichern. Von hier aus wurden Handelskontakte zwi.
sehen Briten und den Somali an der gegenüberliegenden Küste geknüpft, die in erster Linie
der Versorgung d.er britischen Truppen mit Nahrungsmitteln dienten. Erst ab dem Jahr 1884
begannen die Briten sich dauerhaft auf der Somali-Halbinsel festzusetzen. Zunächst wurden
"Schutzverträge" mit Ältesten der nördlichen !Klans abgeschlossen. Im Juli 1887 wurde das
Protektorat Britisch Somaliland offiziell gegründet. Die britischen Besitzungen konzentrierten
sich neben Somaliland im Norden auch auf Jubbaland im SOdwesten. Frankreich, das sowohl
an der Kontrolle des Seewegs nach Madagaskar und lndochina entlang der nordost
afrikanischen K!lste a!s ll!lc!! an der OberwachY!lg des K9!tlrn!'m!lcn Owßbrit;mnien inter es
siert w:u.55, ließ sich ab den 1860er Jahren an der nördlichsten KOste des Horns, in der von
Afar, lse und Somali bewohnten Region um die Hafenstadt Djibouti (heute Republik Djibou
ti) nieder. Erst Ende der 1880er Jahre stimmte Italien in das "Konzert der europäischen Mäch
te" arn Horn mit ein und etablierte seine Herrschaft entlang der gesamten Nord-Süd-KOste der
Somali-Halbinsel; in einem 1925 vereinbarten Vertrag erhielt Italien die Jubbaland·Gebiete
von Großbritannien (Laitin!Samatar 1987: 48-52; Matthies 1977: 44f/50; Brons 1993: 4).
Neben dieser europäischen Expansion fand auch eine afrikanische Kolonisation in der Re
gion statt. In den 1870er Jahren errichtete Ägypten, das formal bis 1914 zum osmanischen
Reich gehörte, seine Herrschaft Ober die nordsomali.sche Küstenregion östlich der Hafenstadt
Zeila und konnte zudem ins Landesinnere bis Harar expandieren. Die ägyptische Hem;chaft
im Gebiet der Somali-Halbinsel wurde 1884 abrupt aufgegeben, da der sog. Mahdi-Aufstand
im Sudan den konzentrierten Einsatz von Truppen und Finanzen erforderte. Als zweite afrika
nische Macht spielte Äthiopien (Abessinien) eine wichtige Rolle im somalischen Gebiet. Der
christliche Herrscher von Äthiopieo, Menelik ll (1889-1913), wollte sich den externen Mäch
ten nicht unterordnen. Indem er die Europäer gegeneinander ausspielte, Krieg filhrtc und Ver
träge abschloss, gelang es ihm, seinen Herrschaftsbereich um die Stadt Harar und die frucht-
" Konkurrenz spielte bei allen am ,.scramblc for Africa" beteiligten Machten eine große Rolle.
Copynghtcd ma riR
27
baren WeidegrUnde der Region Haud im Norden sowie um die Ogaden-Regions• im zentralen
Westen zu erweitern (Laitin/Samatar 1987: 52f; Matthics 1977: 45f: Lewis 1999a: 19f; ders.
1965: 40-62).
Die Kolonisierung des Horns von Afrika i n der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte
letztlich eine Fünfteilung Somalias zur Folge. Die Somali unterstanden im Nordwesten briti
scher, im äußersten Norden französischer, vom Nordosten bis in den SUden italienischer, im
zentralen Westen :Uhiopischer und im Sudwesten britisch·kenianischcr Kontrolle (Bradbury
1997: 2).
3.2 ANTIKOLONlAJ.ER WIDERSTAND Bis Mitte der 1890er Jahre hatten sich Großbritannien. Frankreich, Italien und Äthiopicn
weitgehend auf die Grenzen ihrer jeweiligen Herrschaftsgebiete auf der Somali-Halbinsel ge·
einigt (Lewis 1965: 62). Diese äußerliche Konsolidierung stimmte jedoch nicht mit der Situa·
tion im Inneren der fremdbeherrschten Somaligebiete Uberein. Im Jahr 1899 brach, gefllhrt
von dem als "Mad Mullah" bekannten Sheikh Sayyid Mohamed Abdille Hassan, einem isla·
mischen Gelehrten und Allhanger des Derwischordens Salihiya. eines militanten Zweiges der
AhmadiyaSJ, eine somalische Rebellion gegen die britische Kolonialherrschaft aus. Der Reli·
gionsgelehrte sah die Gefahr einer Zerstörung islamischer und lr'aditioneller somatischer Wer·
te durch die christlichen Europäer. Es gelang dem Sheikh, der als Friedensstifter berUim•t war
und der sich auf weitreichende patrilineare und matrilatcrole Verbindungen stUtzen konnte,
mittels geschickter Verhandlungen, mehrere somatische Klans im Widerstand gegen die
Fremdherrschaft zu einen. Getragen vom Ethos des "heiligen Krieges" (jihad) begann der 20
Jahre dauernde "Kampf dcr Derwische", dem sich zeitweise mehrere tausend Kämpfer an·
schlossen. Der Erfolg Sayyid Mohameds beruhte wesentlich auf einer Fehleinschätzung seiner
Rolle durch die Briten, die ihn lediglich als Klanfllhrer, gefangen im Netz somatischer Ver
wandtschaftspolitik wahrnahmen. "The lr'uth of course was [ ... ) that the Sayyid occupied a
,. Fitzgibbon schildert den Verlust dieser Gebiete sehr plakativ als "Betrug" Großbritanniens on den Somalis: Im Mai 1897 schloss Großbritannien mit Abessinien ein Abkommen, das dem expandie· renden afrikam5Chen Reich, entgegen der ähcn:n somatisch-britischen Oben:inkünfte, die Kontrol· le tlber nord.�malischc Gebiete Oberließ . In späteren Verträgen (1948 und 1954) zwischen Groß. britannien und Äthiopien wurden die Ogadtn· und Haucl-Region endgtlltig an Äthiopien gegeben. Diese: Abkommen bildetm den Ausgangspunkt tnr die Konflikte, die nach 1960 zwischen Somalia und Äthiopien eslullierten (Fitzgibbon t982: 5/151T/28f; Lcwis 199911: 19f; ders. 1994: 4; Monhies 1977: 45053f/1411).
Copynghtcd malcria
28
unique position as a national figure appeallog to the patriotic Sentiments of Somal.i as Mus
l.irru; irrespective oftheir clan or lineage allegiance" (l...cwis 1965: 76). Erst in1 Februar 1920,
nachdem Großbritannien empfindliche personelle und finanzielle Verluste erlitten hatte, ge
lang es der Kolonialmacht, die Rebellion durch intensive milit!lri.sche Angriffe zu zerschlagen.
Sayyid Mohan1ed konnte fliehen, starb jedoch. bevor er eine erneute Erhebung hätte organisie
ren können, im Dezember 1920. ln der somatischen National-Überlieferung steht er mit Ah·
med Gurcy/Ahmed Gran (1506-1543), unter dessen Führung das abcssinisehe Reich von So·
malis unterworfen und fllr zwei Jahr.tchnte kollirolliert worden war, in der Reihe der
wichtigsten somatischen Helden (Fitzgibbon 1982: 7/34-39; Lewis 1965: 63-80; ders. 1999a:
225-228; Laitin/Samatar 1987: 22). Bis heute gilt Sayyid Mohamcd Abdille Hassan als einer
der größten somalischen Dichter. Er verfUgte somit Ober eine Begabung, die im Rahmen tradi
tioneller somalischer Politik durchaus als wichtige Machtressource eingeschätzt werden muss
(Said S. Samatar 1982: 55113711 87; Laitin/Sarnatar: 35-40).�8
3.3 VON DER fREMDHERRSCHAFf ZUR UNABHÄNGIGKEIT
Die endgültige Konsolidierung kolonialer Herrschaft in Somalia erfolgte zwischen 1920 und
1940. Wie in anderen Kolonien auch, bemühten sich die europäischen Mächte ihre Herrschaft
in Somalia mittels "indirect rule"s9 auszuüben .. Im Falle NordsomaJjas versuchte Großbritan
nien, sich auf Akils (siehe 2.2.5) als Vertreter von Verwandtschaftsgruppen zu stützen. Diese
auJ Grund ihrer charakterlichen Eigenschaften herausragenden M4nner wurden von ihrer
" Derwischbruderschaflm spielen im rehgiösen leben der Somalis <ine große Rolle. Die zwci wichtigstm Orden sind die im 12. J.hrhundert in ßagdad g<grllndet< Qadiriya und die im 18. Jahrhundert in Mekka gegründet Alunadiya (Lc:wis 1965: 631).
" Di< große Bodeutung der Dieht.k'Ullst i.nnerhalb d<r Somali-Kultur allgemein <rkannte schon Burton: '11K: country t<ems with 'pocts. poctasters. poctitos. and poctaccios'[ .. .]" (Burton 2000: 102).
'' Das Prin2ip der ''indirekten Herrschaft., wurde um 1900 cn;tm:!ls \'On Lord F. Lugard bei der Etob· li<rung d<r britischen Kolonialherrsclafl in Nord-Nigeria (Sokoto-Kalifat) cingetuhrt und entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten, entsprechend der unterschiodlichen "afrikanischen Bedingungen'' leicht modifiziert. zum zentralen Konzept europäischer Kolonialverwaltung (lliffc 2000: 2691). ln Gcscllsclaften ohne institutiona.lisierte Zentralherrschaft, wie 1.B. bei den Somali, erwies sich dieses Konzept jedoch als problematisch. In den auf den ersten Blick als egaliCir angesehenen sog. akeplalen Gesellschaften, deren p>Oiitischc OrganiS3tionsmuster sich durch tcmporli· n:n und situationsbedingten Wechsel von Autorilllten und Zustllndigkciten auszeichneten, fand dio Kolonialadministration keine " natOrliehen" Pannc:r tur "indin:ct rule". Ein wichtiger Beitrag der (struktur-) funktionalistischen Ethnologie der 1930cr/40cr Jahre bcsund in der ErforschWlg dieser Gescllschaflcn. Man bcmOhre sich, im Dienste der Kolonialverwaltung, praxisbezogenes Wissen Ober polirische Organisationsmuster troditioneller Gesellschaften zu produzieren: "We do not wish to imply, howcver, that anthropology ts tndifferent to practical affairs. The pohcy of lndirect Rute is now generally aceepted in British Africa. We would suggest that it can only prove advantageaus
Copynghtcd ma riR
29
Gruppe aus1,>ewählt und fungienen als Panner der Kolonialverwaltung. Im Jahr 1950 wurde
mit der Einfilhrung eines unter den "first class" Akils stehenden Systems ''lokaler Autoritäten"
noch eine weitere einheimische Vcrwallungsebene eingeschoben. Obwohl diese "erfundenen"
Autoritäten im Falle von Loynlitätskonflikten :zwischen Kolonialverwaltung und Mitgliedern
der eigenen Gruppe meist ihre offiziellen Aufgaben zugunsten verwandtschaf\licher Bindun
gen vernachlässigten, war <lieses "in<lirect rule"-Konzcpt erstaunlich erfolgreich. Lewis fUhrt
dies auf die Möglichkeit zurilck, mittels solcher Akii-Positionen sowohl individuell als auch
kollektiv lukrative finanzielle und machtpolitische Ressourcen erwerben zu können (lewis
1999a: 191200-203).
Der Aufgabenbereich der Akils war aufuntergeordnete legale Funktionen und aufdie Ver
mittlung zwischen der lokalen britischen V crwaltung und der ansansässigen Bevölkerung
beschränkt. ln allen wichtigeren Angelegenheiten, besonders in ernsthaften Konfliktfllllen,
griff die Kolonialverwaltung selbst ein. Britisch-Somalia wurde also, trotz einiger Konzessio
nen an das Prinzip der "indircct rule", relativ "direkt" verwaltet (Lewis 1999a: 29; dcrs. 1965:
105). Im italienischen Gebiet wurde ein ähnliches System besehrilnkter "indirect rule" einge
ftlhrt; insgesamt wurde Süd-Somalia jedoch deutlich zentralistisch von Mogadishu aus ver·
waltet (Bradbury 1997: 5; Matthies 1977: 57). In der Ogaden-Region und auch im britisch
kenianischen Teil wurden jegliche Anikulations- und Mitbcstimmungsmöglicbkeitcn der So
mali durch militärische Unterdrilckung seitens äthiopischer Truppen bzw. durch politische
Marginalisierung im kolonialen Randdistrikt Britisch-Kenias verhinden (Matthies I 977: 57{).
Oie durch die verschiedenen Verwaltungsgebiete getrennten Klan-Familien wurden mit der
Ausweitung des Machtbereichs des faschistischen Italiens erstmals wieder vereinigt. Zwi
schen 1935 und 1940 hielten Mussolinis Truppen Äthiopien okkupien; die Ogaden-Rcgion
war somit wieder mit den anderen Somali-Gcbictcn irn Süden verbunden. Im August 1940
venrieben die Italiener zudem die britische Verwaltung im Norden, wurden selbst jedoch
schon im folgenden Jahr wieder zurilckgcschlagen. Im Zuge des zweiten Weltkriegs kam die
gesamte Somali-Halbinsel mit Ausnahme der französischen Besitzungen um Djibouti unter
britische Verwaltung. ln dieser Zeit begann sich, auch im Zusammenhang mit fonschreitender
Urbanisicrung, ein somatisches Nationalbewusstsein zu entwickeln, das u.a. in der Formie
rung politischer Gruppierungen und Paneicn in den 1940er Jahren Ausdruck fand und neben
in the long run if the principles of African potitical system.< ( ... ) are 111\<krstood" (Fortes/E\'lUISPritchard 1962: 1).
Copyngh!cd matcria
30
der Befreiung von kolonialer Herrschaft die Wiedervereinigung aller Somalis zum Ziel hatte
(Brons 1993: 6f: Matthies 1977: 731). Allerdings war dieses somalische Nationalbewusstsein,
nach Lewis, deutlich verschieden von clcn in anderen Kolonien entsprechend dem europ!i
schen Vorbild übernommenen .. neuen•· nationalen Ideen. In Somalia v•;urden .. alte" Vorstel
lungen von somalischcr Identität und Loyalität in eine moderne Form gegossen. Politische
Parteien formierten sich weitgehend entlang der Deszendezlinien (l.ewis 1969: 345).
Internationale machtpolitische Verwicklungcn60 führten jedoch zu einer erneuten Auftei
lung der Somali-Gebiete: Die Ogaden-Region fiel 1954 endgültig an Ä!hiopicn, das Nordost
und Südsomalia wurde 1950 als UN-Treuhandgebiet wieder an Italien gegeben und der Nor
thern Frontier Distriel wurde wieder als Teil der Kolonie Kenia verwaltet. In den 1950cr Jah
ren verstärkten sich die Forderungen nach Unabhängigkeit in den zersplitterten somalischen
Gebieten. Anfang 1960 schließlich erlangten Italienisch- und Britisch-Somalia die Unabh11n
gigkeit und vereinigten sich im Juli desselben Jahres zur Republik Somalia (Laitin!Samatar
1987: 62-67; Lewis 1965: 139).
3.4 AUSWIRKUNGEN DER KOLONL<\LHERRSCBAFT
Drei wichtige Auswirkungen der Kolonialherrschaft auf die präkoloniale Gesellschaftsord-
nung der Somali und die weiteren soziopolitischen Entwicklungen am Horn von Afrika kön-
neo erkannt werden:
1.) Durch kUnstlieh gezogene Grenzen wurden Klan-Familien getrennt und die mit der no
madischen Lebensweise verbundene Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt. Besonders der
in Bezug auf die Ökonomie und die ethnische Zusammengehörigkeit der Somali als unerträg
lich empfundene Verlust der Ogadcn-Rcgion, aber auch das Ziel, die unter franZÖsischer und
kcnian.ischcr Verwaltung stehenden Somali-Gcbictc in die Republik Somalia zu inkorporie
ren, f(Srdcrten "pansomalische"' Bestrebungen, die für die Entwicklungen des zukünftigen
Staatsgebildes Somalia und für die Stellung d.es Landes in der ganzen nordostafrikanischen
Region von großer Bedeutung sein sollten (Matthies 1977: 61-63; Lcwis 1965: 1781).
2.) Die Kolonialherrschaft ftlhrte jedoch nicht nur zu einem Erstarken des somalischen Na
tionalbewusstseins, soodern trug gleichzeitig zur Fragmentierung der Somali bei: Im wirt-
00 Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges verweigerten Frankreich, USA und UdSSR, die zusam
men mit Großbritannien als ,.Siegermi!chte .. und st�ndige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats eine entscheidende Rolle bei der Neustruktirierung -der internationalen Beziehungen >1>idten. die von London ''<lfgeschlagene Vereinigung aller Somali-Gebiete. Zudem konnte der äthiopische Kaiser
Copynghled ma riR
31
schaftlieben Bereich setzten sich die ols "Sicdlcrkolonie" geplanten italienischen Besitzungen
im Silden vom soziapolitisch und ökonomisch weitgehend vernachlässigten Britiseh
Somaliland im Nordwesten ab (Laitin!Samatar 1987: 59-61; Lewis 1965: 101-105/112).01 Auf
politischer Ebene bildeten sich in der Kolonialzeit besondere Beziehungen zwischen einzel
neu, die urbanen Zentren kontrollierenden Klan-Familien und den dort ansässigen Kolonial
verwaltungen heraus; andere Gruppen wurden nachhaltig politisch marginalisiert (Lewis
1969: 3431). Damit wurde sowohl das "truditionclle" KonOiktpotcntial zwischen den Klan
Familien als auch pr1!kolonial schon bestehende Unterschiede zwischen Nord- und SUd
Somalia vergrößert.
3.) Im Bereich der traditionellen Gesellschaftsordnung wirkte sich die Kolonialherrschaft
vor allem im Bereich von Recht und Autorität aus. Traditionelle KonOiktrcgelungsstrategicn
wurden von der ungebetenen "dritten KonOiktpartei" beeinflusst, z.T. auch schlichtweg unter
drllckt und von europäischen Ordnungsmustern überlagert (Lewis 1999a: 281):. Die koloniale
Verwaltungsordnung und schließlich die Einfiihrung einer formal "westlichen" Staatlichkeil
ver!lndertc das soziopolitischc Gefüge grundlegend: "As ncw forms ofwcalth accumulated in
thc statc, thc mandate of political leadcnhip altered from rcgulating kio rclations and entitle
ments to pastoral resou.rces, to rcgulating access to ihc political and cconomic benefits of the
state, thus sowing seeds of disunity and conOict" (Bradbury 1997: 5).
Obwohl Matihics die Auswirkungen der Kolonialherrschall auf die Somali relativ ausfUhr
lieh behandelt, kommt er zu dem Schluss: "Die koloniale Penetration im Horn von Afrika war
von relativ kurzer Dauer und geringer Jntensitllit und bewirkte keine tiefgreifende Veränderung
der traditionellen Sozialstruktur, Ökonomie und Kultur der Somali� (Matihics 1977: 64). Die
ses Ergebnis ist m.E. nicht nachvollziehbar. Allein die Einfolhrung formeller, zentralstaatlicher
Strukturen in eine "akephal" organisierte Gesellschaft ist aus ethnologischer Sicht als !iChr
intensive "Penctration" der Somali anzusehen. Vor allem mit Blick auf die konfliktreichen
Entwicklungen Somalias von Erreichung der Unabhängigkeit bis zu Bürgerkrieg und Staats
zerfall erscheint die Aussage gerechtfertigt, dass in der Kolonialzeit die "Saat" späterer Kon-
Haile Selassie, unterstatzt \'00 den USA, seine AnsprOehe auf die Ogaden-Region durchsetzen (Laitin/SarDllt:lr t987: 631).
" Die "ROckseite der Medallie" im Hinblick auf die ökonomische Entwicklung des Südens durch die
ltlliene.r ist, dass, wie Besteman im Zuge der Rekonstruktion der Geschichte des italienisch verwalteten Jubba-valleys darlegt, unte.r der HCTTS<:Iuft der Faschisoen ab 1935 auf den Planoagm in SOdsomalia Teile der lokalen Bevölkerung als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden (lksteman 1999: 881).
Copynghted matcria
32
flikte innerhalb Somalias, aber auch zwischen dem Land und benachbarten Staaten, gesät
worden ist.61
61 Mazrui meint dazu: ''The ideology of lhe stale hegan lo trodc Somali sk•lls of ordered anarchy: how 10 have orda wichout govemment. how 10 have rules wilhoul rulas" (Mazrui 1997: 7). Gera· dc im Hinblick auf die gcgenwänigc Situation in Somalia erscheint dtcse: Position interes.�nt.
Cow1 ghK-d ma riR
33
4 POSTKOLONIAI..E ENTWICKLUNG L'l SOMALIA BIS 1988
4.1 UNABHÄNGIGKEIT UNO Kt.AN·DEMOKRA HE ( 1 960-1969) Das britische Protektorat Somaliland wurde am 26. Juni 1960 unabhängig; die unter UN-
Treuhandscbaft italienisch verwalteten Gebiete erlangten die Unabhängigkeit am I . Juli 1960.
Am selben Tag schlossen sich beide ehemals autonomen Verwaltungseinheiten zur unabhän
gigen Republik Somalia zusammen. Aden Abdulle Osman, ein Hawiye aus dem Soden, wurde
von einem vereinigten Parlament zum Interimspräsidentcn6J gewählt; erster Prcm.icrminiSicr
wurde der als Majerteyn zur Darod-Kianfamilic gehörende Abdirashid Ali Shennarkc. Im
Sinne einer ausgewogenen Repräsentation der zwei Regionen war der Nord.en mit 33, der SO
den mit 90 Sitzen im Parlament (national asscrnbly) vertreten. Neben dieser regionalen Balan
ce sollte innerhalb der Regierung das Prinzip der Klan-Repräsentation gewahrt werden (Lcwis
1965: 165; Bongartz 1993: 25; Brons 1993: 8). "Clan balancing bccame a Standard Operating
proeedure in democratic Somalia, as govcmmcnt jobs ncccssarily meant representation for any
clan� (Laitin/Sarnatar 1987: 70).
4.2 DER NORD-SüD-GEGENSATZ
Die Vereinigung und Staatsgründung verliefnicht reibungslos. Beide Gebiete waren bezüglich
der Schaffung politischer Institutionen und Parteien, der Ausweitung des Erziehungswesens
etc. sehr unterschiedlich auf die Unabhängigkeit vorbereitet. Während die Somali im SOden
unter italienischer Verwaltung, die entsprechend dem UN-Treuhandmandat das Gebiet inner
halb von zehn Jahren auf die Unabhängigkeit vorzubereitert hatte, schon ab Mitte der 1950er
Jahre in das westlich-politische Betätigungsfeld eingefilhrt wurden, unternahm die Verwal
tung des britischen Protektorats em sehr spät die nötigen Schritte, um eine stabile Basis flir
die selbststilndigc staatliche Verwaltung im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie zu
bereiten.64 Somit übten Politiker aus dem SOden bei der Konstitution des neuen Staates we-
senilich größeren Einfluss als ihre nord-somatischen Kollegen aus (Brons 1993: 9). Von Be
ginn an kam es zu Spannungen zwischen beiden Landesteilen. Im Juli 1961 wurde pcr Volks·
6) Eine erneute \V ahl war Rlr 1961 vorgesehen. 64 Umgekehrt k6nnlc man mit Matthics forrnulicn:n, dass ili< soziapolitischen und 6konomischen
"Penelnltion" Nordsomalias durch die Briten geringer war als die Südsomalias durch die .Italiener. Im Norden gab es deshalb nur eine kleine stlldtische Mittelschicht. die als Tlilger einer neuen, von Fremdherrschaft befreiten politischen Ordnung in Frage k3m (Matthics 1977: 71 ). Zur unterschiedlichen politischen Vorbereitung auf die Unabhllngigl<cit vgl. Matthies 1977: 75; Bongartz 1993: 21.
Copynghtcd malcria
34
entscheid Ober die neue, nach italienischem Vorbild entworfene Verfassung abgestimmt. Im
Norden wurde dieses Fundrunent der somalischcn Union eindeutig abgelehnt Da dort jedoch
die Bevölkerungsminderheit wohnte, fiel das Gesamtergebnis des Referendums positiv aus.
Noch bevor die parlamentarisch·demokratische Verfassung offiziell verkündet werden konnte,
eskalierten die Spannungen zwischen den beiden Regionen: Im Dezember 1961 unternahmen
Offiziere aus dem Norden einen Militärputsch. Der Putsch scheiterte, da trotz der generellen
Sympathie vieler Bewohner des Nordens mit dieser spektakulären Unmutsäußerung ilber die
weithin als beschämend empfundene Benachteiligung der Region keine Mehrheit fllr eine tat
sächliche Au.flösung der Union gefunden werden konnte (Lewis 1965: .173f/178; Bonganz
1993: 21-25).
Politisch und ökonomisch war Nord-Somalia eindeutig im Nachteil. Mogadishu im SOden
war das Machtzentrum; Hargeisa, die alte Hauptstadt Somalilands. wurde marginalisiert. Ein
zig die nördliche Hafenstadt Berbern behielt ihre Bedeutung als wichtiger ökonomischer Kno
tenpunkt filr den Expon \'OO Lebendvieh nach Saudi-Arabien. Doch der Großteil der Agrar·
und Industrieproduktion konzcntriene sich auf den SUden (Bongartz 1993: 22; Brons 1993:
40f; Lewis 1994; 121),
Ein weiterer den Nord-SUd-Gegensatz verschllrfender Faktor war das grundlegende
Kommunikationsproblem. Italienisch war im SOden als Amts- und Ausbildungssprache von
großer Bedeutung. Die Bevölkerung des ehemaligen britischen Protektorates war somit von
eincnt wichtigen Teil des Öffentlichen Lebens ausgeschlossen, das sich gemde im Zentrum
Mogadishu entwickelte, wo sich das Nationaltheater und die einzige Universität des Landes
befandcn.65
Insgesamt lässt sich im Zusammenhang mit der Gründung der Republik Somalia ein großes
innerstaatliches Konfliktpotential crketmcn. Die bestehenden historischen und kulturellen Un
terschiede zwischen Nord- und SUdsomalia wurden durch die unterschiedliche ökonomische
und politische Entwicklung der britisch und der italienisch verwalteten Kolonialgebiete ver
größert. ln den ersten Jahren nach E.rlangung der Unabhllngigkeit wurde dieses Ungleichge
wicht perpetuiert. Die Vereinigung Nord- und SUdsomalias hatte das Aufeinandertreffen von
" Die Nord-SUd-Konkurrenz schlug sich in einer die soziale Entwicklung des ganr.en Landes hc:mmcnden Unfähigkeit zum politischen Kompromiss nieder. Dies zeigte sich besonders drastisch dar.Jn, dass keine Einigung bezüglich einer offiziellen Amtssprache: erreicht werden konnte . So fanden, da man sich auch nicht auf die Einfllhrung einer allgemeinen somalisehc:n SchriO..prache hatte einigen können, Italienisch. Englisch und Arabtsch in der Administration Verwendung; dies behinderte den bUrokratischcn Fluss erheblich ( Bonganz 1993: 22f; le".is 196S: 171 ).
Copynghtcd ma riR
35
zwei sehr unterschiedlichen soziopolitischen und ökonomischen Systemen zur Folge und be
lasiete die junge Republik mit dem Problem politischer Instabili tät (Bongartz 1993: 22).
4.3 DIE "GREATER SOMALIA"-POLITIK UND IHRE FOLGEN
Trotz der innersomafischen Diskrepanzen entwickelte sieb ein somalisches Nationalbewußt-
sein auf der Grundlage des schon in den 1940cr Jahren aufgekeimten somalischcn Nationa
lismus und der damit verbundenen pansomalischen Vercinigungsbestrebungen. Beide Phäno
mene werden unter dem Bcgriff"Greater Somalia"-Politik subsumiert ( Bonganz I 993: 17).
Die Ziele der "Grcater Somalia"-J>olitik waren die Erreichung der Unabhängigkeit und die
Vereinigung aller somalischen Territorien; letzterer Aspekt wird in der Literatur häufig mit
dem Begriff "irredentistisch" bzw. "lrrcdcntismus·.-6 erfasst. Nach der Union von Italienisch
und Britisch-Somalia forcierte die unabhängige Republik Somalia diese in ihrer Verfassung
festgeschriebenen Ziele auf innen- und außenpolitischer Ebene.61 Um die einende, über die
erwähnten internen Probleme der somalischen Union hinweg wirkende Kraft des Somali
Nationalismus zu verstehen, ist es wichtig, den Bezug zur externen Situation der Republik
herzustellen: "Tbc appcal to Somali national idcntity has generally been most efTective when
an overt externalthreat has existed" (Hasch im 1997: 60). Anfang der I 960er Jahre erscheinen
folgende Entwicklungen am Horn von Afrika als "extemal threat" im Sinne des somalischen
Nationalismus: Athiopicn und Großbritannien wehrten alle Uher die Grenzen der 1960 konsti
tuierten Republik hinausgehenden Territorialforderungen ab. Bis 1963 wurden die Unabhl!n·
gigkcit Kenias inklusive des Nonhcrn Frontier Distriels sowie die Gründung der "Organisati
on of African Unity" (OAU). in deren Cha:ner u.a. die Unverrückbarkeil der kolonialen
Grenzen festgeschrieben wurde, vorbereitet (Lewis 1965: 178fll82fl).
" Abgeleitet von dem lateinischen Verb "reddere·· (zurückgeben, wiederherstellen), erweitert um das Pn'lfix "ir"-, das eine Negation ausdrOckt (z.B. ir-rnrional), ist unter einer irredentistischfll Pohtik im Falle Soma.lias eine Politik Zll verstehen, die auf dtc (noch 11icht wiederhergestellte) Einheit aller Somali gerichtet ist.
01 Anders als in allen anderen afrikanischen Stru!tcn war das wichtigste Ziel Somalias nach Ende der KolonialhCJTSChaft nicht die S<:haffung einer -Nation", da die Somali in ihrer eigenen (kolon�al geprllgten) politischen Ideologie schon eine nationale Gemeinschaft, basierend auf Abstammung, Kultur etc., bildeten. Das wichtigste Ziel war vielmehr die ·'Etatisierung·· dieser SomaliGemeinschaft tmd damit die Sicherung einer ge:meinS.'Imcn politischen und ökonomischen Zukunft. Diesem Ziel stand die koloniale Trennung der Somali im Weg. Der lllnfzackige Stern in der somatischen NationalOa�"' stand fllr die filnf in der Kolonialzeit getrennt verwalteten Somali.(Jebictc, die vereinigt werden sollten (Matthies 1977: 761102 (Anm. 219); Laitin/Samotar 1987: 67f: Lewis 1965: 161).
Copynghtcd matcria
36
Der Soroal.i-National.ismus hatte sein Zentrum zwar in der Republik Somalia, doch auch in
den anderen von Somali bewohnten Gebieten war diese politische Strömung verwunelt. Oie
soroalische Nationalbewegung halle seit Mille der 1940er Jahre in Älhiopien und Kenia Fuß
gefasst In der Ogaden-Rcgion und im Northern Frontier Distriel wurden die pansomalischen
Bestrebungen auch durch die extrem schlechte ·ökonomische und soziopolitischc Situation der
dortigen Bevölkerung gefl!rdert. Oie unabhängige Republik Somalia diente als Beispiel dalllr,
dass die Somali ihre Geschicke selbstständig lenken und verbessern konnten. Davon beein·
flusst bildete sich in den 1960er Jahren eine z.T. militant agierende nationalistisch·
sezession.istische Bewegung unter den in Älhiopien und Kenia61 lebenden Somali heraus. Die
se wurde von der Republik Somalia unterstützt (Matthies 1977: 760.
Der als Reaktion auf die Kolonialherrschafi entstandene Somali-Nationalismus, der nach
1960 in der ''Greater Somalia" Politik seinen wesentlichen Ausdruck fand, stellte also die in
der Kolonialzeit geschaffene territoriale Ordnung im Horn von Afrika radikal in Frage (Mal·
lhies 1977: 65). Die direkten Folgen der skizzierten politischen Entwicklungen waren die
Konzentration von dringend filr die innere Entwicklung der Republik benötigten Ressourcen69
aufkawn Erfolg versprechende außenpolitische Untemehmwtgen und die Perpetuierung eines
enormen Konfliktpotentials zwischen der Republik Somalia und ihren Nachbarn Äthiopien
und Kenia (Laitin/Samatar 1987: 68).
" Die nationalisti.sch-sezessionistischen Bestrebungen unter den Sornali Älhiopiens waren sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einzelne Gruppen, wie die zur Klan-Familie der Darod gehörenden Osa· den. konnten sieb sehr gut mit der äthiopischen Regierung am111gieren, wlhrend andere Klans, nicht zulctzt auf Grund ihrer Konlcurrenz zu den Ogaden um Weide· und WaSSCITechte, aktiv die Sache des Soiilllli·Nationalisnrus vertraten. Die Somali im Norlhern Frontier Distriel waren in ihrer politischen Opposition gegen die britisch·keniaoische Zentralregierung sLilrker vereint. Sie koMten jedoch trott langwieriger Verhandlungen im Vorfeld der Unabblngigkeit Kenias 1963 keinen Zu· sammenschluss mit der Republik Somalia erreichen (Matthies 1977: 77ft).
"' Soiillll.ia bemilbte sich ab 1960 um militärische Aufrüstung; im Jahr 1963 wurde ein Militlirbilfe. abkomn1en mit der UdSSR abaeschlosscn. Die somatische Rüstungspolitik "'irk:te sich auch auf die mit dem "Westen" aliicnen Nachbarn Älhiopien und Kenia aus. Es kam, unter Beteiligung der "Großmlichte", zu einem "Rüstungswettlaur· am Horn von Afrika (Motthies 1977: 163-185). Zu den somatischen ROstungsausgaben siehe auch Laitin/Samatar 1987: 138-140.
Copyngh!cd ma riR
37
4.4 KONFLIKTGEGENSTAND UND KONFL!IKlVERLAUF IN DEN l960ER JAHREN: DIE "WIEGE" DER "KruSENREGION HORN VON AFR1KA"70
Der zentrale Konfliktgegenstand waren die mit der Wiedervereinigung aller Somali verbunde
nen territorialen Fordenmgen des somalischen Staates an Äthiopien und Kenia. Die Regierung
Somalias betmchtete alle in der Kolonialzeit abgeschlossenen Grenzvcnrägc als U.Db'Üitig u.nd
filhrte, gestützt auf das propagandistische Konzept einer in vorkolonialer Zeit formierten ''So
mali-Nation" (Matthies 1977: 109), das Selbstbestimmungsrecht der Völker an. Dieses galt
nach somatischer Meinung auch fllr unterdrttcktc Bevölkerungsgruppen in bereits unab
h!ingigen Staaten. Äthiopien und Kenia dagegen erkannten die kolonialen Verträge an, lehnten
die Anwendbarkeit des Selbstbestimmungsrechts der Völker im konkreten Konfliktfall ab und
stellten die völkerrechtlichen Grundsätze bezüglich des Schutzes der territorialen Integrität
von Staaten in den Vordergrund (Matthies 1977: .106-122).
Neben der völkerrechtlichen Austragung des Konflikts auf der Ebene der internationalen
Politik kam es Anfang der 1960cr Jahre zu massiven politisch-propaga.ndistischcn und auch
militärischen Auseinandersetzungen zwischen Somalia, Äthiopien und Ken.ia (Matthics 1977:
133fl). Zwischen 1963 und 1966 eskalierten in der Ogadcn-Region und im Nortbern Frontier
Distriel Somali-Au(�t!inde, die zumindest inoffiziell von der somatischen Regierung unter
stützt wurden und sogar zu vereinzelten Kampfhandungen zwischen den regull!rcn Truppen
der verfeindeten Nachbarstaaten fllhrtcn (Matth.ics 1977: 205U).
In der Region des Horns von Afrika konnte n1it dt.'tll Ende der Kolonialzeit" auf innen- wie
außenpolitischer Ebene keine Stahilitlit erreicht werden. Vielmehr verstellte das pr!ikolonial72
und kolonial angelegte Konflikipotential eine friedliche Zukunft. Somalia. dessen Unzufrie
denheit mit den postkolonialen politischen Verhältnissen im Zentrum der Krise am Horn
stand, wurde seitens seiner Nachbarn, aber auch international zunehmend isoliert (Lewis
1965: 199-201 ).
"' Diese Zitu nimmt Bezug ouf den Titel eines von Urllnc und Matthics herausgegebenen Buchs. das die 6konomischc und politische Krise am Horn bis Ende der 1980er Jahre thematisiert. Es .,..;rd auf viclfliltige politische Probleme. von den Auswirkungen der Blockkonfrontation bis hin zu innerstaatliehen Spannungen zwischen ,·erschicdenen ethnischen Gruppen. z.B. innerkalb Äthiopicns, ein�en. Hier erscheint mir dieses inhaltlich sehr weitreichende Zitot dennoch gerechtfertigt, da nach Mci11ung der Autoren die zwischcnst3Atlichen Gewalteskalationcn am Horn weitgehend auf den somalischen lm:dcntismus zurückgehen (Brüne/Matthics 1990: 3).
11 Djibouti wurde erst I 977 unabhllngig. " Insbesondere der Konflikt mit Äthiopien basierte auch auf dem religiösen AOlagonismus zwiS<hcn
den moslcmischen Somal.i und den christlichen Älhiopiern (Manhics 1977: 89).
Copynqhted matcria
38
4.5 "THE PROBLEM OF TRffiAl.ISM"73 - (NNENPOLmSCHE EN1WICKLUNGEN BIS 1969
.
In der Republik Somalia waren die ,,neuen" staatlichen und die .,allen" verwandtschaftlichen Strukturen eng miteinander verwoben. Hieraus resultierte die Komplexität und lntransparenz der somalischen Innenpolitik zwischen 1960 u.nd 1969 (Bongartz 1993: 21; Heyer 1997: 7).
Die Problerne einer auf Verwandtschaftsbeziehungen aufgebauten innenpolitischen Ordnung
wurden von den in den Städten lebenden und westlich ausgebildeten Intellektuellen klar er
kannt. Mit Blick auf die Vergangenheit, in der die Gegnerschaft der verschiedenen Abstam
mungsgruppen die Zersplitterung der Somali durch die Kolonialmächte erleichten hatte, waren nationalistische Politiker darum bemüht, den Einnuss partikularistischer Klaninteressen
auf die Staatsordnung insgesamt zurückzudrängen. Dennoch blieben innerhalb der politischen
Allillll2en, die auf nat.ionaler Ebene geschmiedet wurden, die Deszendenzverbindungen wirk
sam. Sie verbanden die pastoral-nomadische Landbevölkerung mit der politischen Elite in den
Städten. (Lewis 196S: 167f; Bongartz 1993: 19). ,;No other single line ofcommunication and common interest connected so directly and incontravenibly the pastoral nomad in the interior with his kinsmen in the civil service, in the National Assembly, or in the cabinet itself' (Lewis
1965: 1661). Die lnstabilitat der dynamischen Verwandtschaftsbeziehungen war somit im po
litischen System Somalias zwischen 1960 und 1969 angelegt, das als "Klan-Demokratie'' bezeichnet werden kann. 7•
Die Überwindung des erwähnten Nord-SUd-Gegensatzes stand in der ersten Hlllfte der
1960er Jahre im Vordergrund. In diesem Zusammenhang kam es verstärkt zu politischer Zu
sammenarbeit über verwandtschaftliche Grenz:en hinweg. Bis 1964 wurden im Hinblick auf das Zusammenwachsen der Republik gute Fonschritte erzielt. Im Hinblick auf die von Beginn
an angespannte und schwierige innenpolitische Lage der Republik wird jedoch deutlich, dass
paradoxerweise gerade die außenpolitische Konfrontation mit Äthiopien und Kenia und die
daraus resultierende äußere Krisensituation zur Stabilisierung der somalischen Staatlichkeit
beitrug (Lewis 1969: 348-350). Die Auseinandersetzungen mit den Nachbarstaaten können
vor dem Hintergrund der iMerhalb von segmentären Gesellschaften wirkenden Fusions- und
" Obwohl Rlr die somalische Politik genaugenommen Lineage· und Klanbeziehungen charakteristisch wan:n, sprachen die Somalis 5elbst von "tribalism". So konnte der B=g zwischen der somalischen Politik nach 1960 und den allgcmcineru Problemen "afrikanischer" Staatlicbkeit, wie z.B. die mangelnde Transpare111: und Effi1.ienz staatlicher lnstitutionrn auf Grund der großen Rolle in· formeller Beziehungen auf Staatsebene, bergestellt werden (Lewis 1969: 3541).
" Lewis onalysiert die Sitwltion klar: "National pany politics is not so�tbing separate and distinct from local traditional polities but rather a direct extension of it, and kinship rctains its all·pervasive
Copynghtcd malcria
.19
Fissionstendenzcn durchaus als Ableitung interner Spannungen nach außen interpretien wer
den.75
Ab Mille der 1960er Jahre begann sich das Scheitern der pansomalisehcn Politik immer
deutlicher abzuzeichnen. Im Zuge der außenpolitischen Entspannungspolitik des 1967 ge
wählten Premierministers Mohamed Ibrahim Egal verlor die Politik des Somali·
Nationalismus an Integrationskraft Der Wegfall des einenden außenpolitischen Zieles filbrte
zu starken Fragmentierwtgstcndenzen entlang genealogischer Gren.zen. Die in der ersten Hülf·
tc der 1960er Jahre entstandenen klanOhergreifendcn Allianzen begannen sich aufzulösen. Die
Aufteilung der Staatsressourcen wurde zum wichtigsten Ziel der politischen Akteure. Sie
stUtzten sich zur Durchsetzuns ihrer individuellen AnsprOehe auf verwandtschallliehe Netz
werke. Der überwiegende Teil der Bevölkerung blieb allerdings von d.icsen politisch-
6konomisehcn Prozessen ausgeschlossen (Bon ganz I 993: 261). Jegliche innerstaatliche Ent
wickiWtg stagniene und die Demokratie wurde zur Fassade. Letzteres zeigte sich deutlich dar
an, dass bei den Parlamentswahlen im März 1969 über 60 Paneicn16 zur Wahl standen (Brad
bury 1997: 5; Hashim 1997: 61177; Laitin!Samatar 1987: 76; Lewis 1969: 352f; dcrs. 1988:
202-204).11
4.6 DIE MILITÄRDIKTATUR ( 1969-1988) Im Oktober 1969 wurde die Regierung durch das Militär gcstOrtt. Der unblutige Putsch fand
zunächst die Zustimmung dt-r Bevölkenmg (Lewis 1994: ISO; dcrs. 1988: 205-207). in der
Folge des Umsturtes wurden die vorhandenen ibrmellen politischen Strukturen aufgelöst. Das
Machtzcntntm des in "Somali Ocmocmtic Rcpublic" umbenannten Staates bildete ein aus 24
hohen Militärs bestehender "Supreme Revo1utionary Council .. (SRC), an dessen Spitze der
General Muhammed Siyad Barre stand. Auf allen Ebenen der Verwaltung bemühte man sieb,
Status as the basic, though not solc, pnncople ofunity and division .. (Lewis 1969: 354). Hier lässt sich der Ausgangspunkt 11lr Heyers Thesen erkennen, die in Abschnitt 4. 7 ausgel1llU1 werden.
" Diese Interpretation wird von Matlhies erwlihnt, der sie jedoch verwirft, weil die Ableitung interner Spannungen nach nußen nls Ursache der K()llfliktc bedeuten "iirde, dass die Konflikte Somolias mit seinen Nachbarn .,kllnstlicber" Natur bzw. ,.erfunden" waren. Matthies betont dagegen doe ,,realistische", in der Kolonialzeit gelegte Grundlage der Spannomgcn am Horn (Matthics: 1977: 65; ders. 1990: 232). Meines Erachtcns ist hier nicht die Fr:tge noch der ,.Realität" der Konflikte ents<:hcidcnd, sondern, wie in Abschnitt 4.7 noch ausgefllhrl wird. das Verständnis der segmentlln:n Dynamik und ihrer Manipulicrbarkcit im Sinne der politischen Machihnher in Somalia.
" Wer innerhalb seiner Partei keinen hohen listenplatz erreichen ltonntc und somit kein< Chnncc auf Einzug ins Parlament hatte, gründete mit Unterstützung seiner VerwandtschaOsgruppe eine eigene Partei. um als deren (einziger) Spitzenkandidat zu kandidieren.
Copynghtcd malcria
40
die verwandtschafilichen Traditionen durch Neubesetzungen mit Militärs und Tc.:hnokraten
zu durchbrechen (Lcwis 1988: 2071). Die offiziell verkündeten Ziele des neuen Regimes
waren: "( ... ) the elimination of corruption and tribat nepotism and lhe re-establishment of a
just and bonourablc society in which proper a.ttention would be given to real economic and
social benerment for all" (Lcwis 1988: 207). Der Umsturz lässt sich auch klanpolitisch inter
pretieren: Das offensive Vorgehen gegen den soziopolitischen Einfluss der mächtigen Klan
gruppen, besonders Majertcyn und Hawiye, ebnete Barres patrilincarer Verwandtsehaflsgrup
pe, dem bisher politisch marginalisierten Marehan-Kian, den Weg an die Macht
(Laitin!Samatar 1987: 163; Bongartz 1993: 41).
4.6.1 "SCIENTiftC SOCIAUSM" VERSUS "TRIBALISM"
Als ein Jahr nach dem erfolgreichen Putsch, der im Nachhinein als Revolution bezeichnet
wurde, die öffentliche Unterstützung fiJr die Regierung zurückzugehen drohte. wurde die neue
politische Ideologie des ,,Scientific Socialism"71 eingefilhrt. Die hcJTSChenden Militärs wand·
ten sich somit eindeutig dem sozialistischen Lager und insbesondere dem wichtigen militäri·
sehen UnterstUtzer Russland ru. Die von der städtischen Intelligenz mitgetragene Ideologie
sollte als gemeinsame Basis aller Somali dem in.nenpolitischen Kampf gegen die spaltenden
Kräfte des "Tribalismus"79 dienen. Dabei bemühte s.ich das Barre-Regime, die ncucn politi·
sehen Ideen "volksnah" zu präsentieren und glcicbzcitig verwandtschaftliche Slrukturen mas·
siv �.u bekämpfen. Das Konzept des ,.Scientific Socialism'' wurde in Af-Somali wörtlich als
"weallh-sharing based on wisdom" (Lcwis 1988: 209) umschrieben. Siyad Barre förderte den
"Kult" um seine eigene Person als "Vater der Nation" und ließ sich, die schon erwähnten poc
tischcn Neigungen der Soma Ii ausnutzend, in Gedichten und Reden verehren. so
Traditionelle Titel und Anreden wurden durch neue Bezeichnungen ersetz111 und territoria
le Bezüge bestimmter Klans wurden durch eine Neueinteilung und Umbenennung der Regio-
" Lcwis stellt fest: ,.In the opinion of thc more disillusioned critics, democracy had lapsed into commercialised anarchy[ ... )" (Lcwis 1988: 206).
71 Diese "Art" von Sozialismus basiert auf einer dem lokalen Kontext angepassten, pragmatischen Anwendung der marxistisch-leni nistischen Theorie (lewis 1994: 150).
" Laitin und Samatar sehen eine Wurzel der anfänglich "anti·tribalistischen" Haltung Barres in dessen eigener patrilinearer Abstammung aus dem politisch sehr schwachen MMeehaan-Kian (Laitin/Samatar 1987: 9QI).
"' Lc.,'is weist in diesem Zusammenhang auf den Eklektizismus der Diktatur Barros hin, der sieb neben russischer und chinesischer Anleihen vor allem am Vorbild des nordkoreanischen Herrschcrs Kim II Sung orientienc (Lcwis 1994: 152-t54).
" So wurden z.B. "akils" zu "peace·S«kers"; verwandtschaftliche Anreden wie Onkel etc. wurden allgemein durch jaalk (Kamerad) ersetzl.
Copyngh!cd ma riR
41
nen und Distrikte des Landes aufgelöst. Die verwandtschaftliche Identifikation wurde zu
Gunstcn der Identifikation mit dem Siedlungsort zurückgedrängt. Die Todesstrafe wurde ein
gefllhrt, um im Falle von Tötungsdelikten die eskalierenden Blutracheqklen zu beenden. Die
Bemühungen um eine politische Neuorientierung waren wnfassend: "Tribalistic bebavior bc
came a serious criminal offense" (Lcwis 1990: 55). Als Mittel der allgemeinen Kontrolle der
politischen Stimmung im Land bediente sich das Regime der medialen Propaganda via Zei
tung und Radio sowie der vornehmlich unter städtischen Arbeitslosen rekrutierten "Victory
Pioneers� bzw. ''Revolutionary Youth", die ideologisch geschult wurden und vor Ort Mobili
sierungs- und soziale EotwickJungskampagnen organisierten. Zudem wurden geheimdienstli
ehe Institutionen wie der "National Sccurity Service'' (NSS) eingerichtet (Bradbury 1997: 6;
Laitin/Samatar 1987: 81; Lewis 1988: 208-214; ders. 1994: 1551).
Die ideologischen Neummgen erwiesen sich als am wenigsten nachhaltig. Bald zeichnete
sich ab, dass Siyyad Barre keine Opposition duldete. Das Klima der Unt�·rdrückung erfasste
selbst das SRC., den engsten Zirkel der Macht.32 ln der ersten Hälfte der 1970er Jahre
etablierte sich der Gcncml als Alleinherrscher. Unter der hirten-nomadischen Mehrheit der
Somali konnte sich die politische Rcthorik clcs "Scientitic Socialism'' nicht durchsetzen.
Somit tat sich im politischen leben Somalias ein Graben zwischen Theorie und Praxis auf
(lewis 1988: 214).
Jm Bereich der Ökonomie konzentrierte sich die neue Regierung auf die Förderung der
nicht-industriellen Wirtschaftszweige, z.ß. Lao.d- und Fischwirtschaft, und glich somit den bis
1969 dominanten. sehr einseitigen Fokus auf Industrieproduktion aus (Laitin!Samatar 1987:
851). Obwohl entsprechend der sozialistischen Wirtschaftspolitik große Produktionskoopera
tiven initiiert wurden, konnte kein ausschließlich vom Staat gelenktes planwirtschaftliches
System etabliert werden. Die pastoral-nomadische Viehwirtschaft verblieh zum großen Teil.
die Landwirtschaft zum kleinen Teil in privaten Händen. Die weitestgehende Kontrolle übte
der Staat im Bereich der Industrieproduktion sowie im Außenhandel aus (lewis 1988: 214-
216). Neben der einheimischen Produktion stellten die von somatischen Gastarbeitern im ara
bischen Ausland verdienten und rtlcktrdnsferierten Gelder eine sehr wichtige staatliche wie
auch private Einnahmequelle dar; allerdings wurde der Großteil der Einnahmen über das in
formcUe "franco valuta" System an der Staatskasse vorbei direkt an die Angehörigen weiter-
geleitet (Bongartz 1993: 351).
"' Im Juli 1972 wurden zwei Generäle und Mitglieder des SRC. unter dem Vorwurf eines geplanten Umstunversuches ölTentlieh hingerichtet (lewis 1988: 213).
Copynqhted malcria
42
Unterhalb der sozialistischen Fassade blieb Raum fUr traditionelles und privates Wirtschaf·
ten bestehen. Barre arrangierte sich mit den Realitllten der somalischen Klan-ökonomie. Die
se feine Balance zwischen zentraler Herrschaft und regionaler Autonomie trug wesentlich zur
Stabilisierung des Regimes bei (Hashim 1997: 84-87; Heyer 1997: 8).
Am deutlichsten manifestierten sich die revolutionären Ansätze des Barre-Regimes in den
sog. "crash programmes". Diese soziopolitischen Entwicklungsprogramme zielten auf die
allgemeine Verbesserung des Lebensstandards der somalischcn Bevölkerung und beinhalteten
z.B. Frauenförderungs-83 u.nd Alphabetisierung;skampagncn.34 Die weitreichendsten Entwick
lungsziele waren die Ansiedlung der Nomaden und die "Dctribalisation" (Lewis 1988: 218).
Als lausende Nomaden aus dem Norden während der verheerenden Dürre 1974n5 ihre J...e..
bensgrundlage verloren, forcicrte die Regierung ihre Umsiedlung in den Süden, wo sie als
Bodenbauern und Fischer eine neue Existenz gründen sollten. Dieser durch den Zufall
begünstigte, gegen die traditionelle soziapolitische Ordnung gerichtete "Entwurzelungs·
Kampagne" war allerdings kein dauerhafter E�folg beschieden. Während Kinder und Frauen
in den neu eingerichteten Kooperativen vctblieben und von der staatlichen Unterstützung, wie
Ausbildung und Nahrungsmittclhilfe, profilierten. nahmen die erwachsenen Mlinncr schon
bald wieder die nomadische .Lebensweise auf (Lewis 1988: 217 -219; Heyer 1997: 9).
4.6.2 BARRES PRAGMATISMUS
Trotz der dargestellten rhetorischen und tatsächlichen politisch-ideologischen Umwälzungen
musste sich Barre mit den zwei stärksten ldentitiitsmerkmalen der Somali, der verwandtschaft·
Iichen Basis der Gesellschaftsordnung und dem muslimischen Glauben, arrangieren. Schon zu
Beginn seiner Herrschall bemUhte sich der Diktator, der im Bereich der Programme der Frau-
" Duch die angestrebte Gleichstellung von Mann und Frau geriet das sozialistische Regime 1975 in einen schweren Konflikt mit religiösen Fahrern, d<r schließlich in der öffentlichen Hinrichtung von zehn Sheiks eskalicrte. Dies fördene oppositionelle Haltungen vornehmlieh unt<r d<r Landbevölkerung. Im urbanen Kontext jedoch halle die Kampagne insgesamt positive Effekte (Bonganz 1993: 391).
" Im Jahr 1972 wurde das lateinische Alphahel als sehriflliche Basis des Af.Somali eingefiihrt. Die Kommunikationsprobleme auf administrativ<r Ebene konnten Oberv.'Unden werden. Nun wurde auch die Herausbildung einer breiten somalisprachigen Gebildetenschicht und Verwaltungselite möglich. Interne soziale Ungleichheiten und der Nord-SUd-Gegensatz konnten abgebaut werden. Im Juli 1974 wurden unt<r dem Motto .. ifyou know teach, if you don't [know] leam"" uhntausen· de Studenten. Lehrer und Mediziner ins land geschickt. um den Nomaden Lesen, Sc.hreiben, moderne Hygienest:ondards etc. zu lehren. Obwohl dieses Entwicklungsprogramm teilweise von den schwierigen Bedingungen. z.B. der hohen Mobilität, der nomadischen Lebensweise behindcrt wurde. erhöhte sich das allgemeine Bildungsniveau deutheb (lcwis 1988: 216; ders. 1994: 160; Lai· tin/Samatar 1987: 831).
Copynghtcd ma riR
43
enfllrderung und der Verfolgung fundamentalistischer religiöser Führer auf heftigen Wider
stand gläubiger Muslime gestoßen war. in öffentlichen Reden die Verbindungen zwischen und
die Kompatibilität von "'Scicmific Socialism " und Islam aufzuzeigen. Diese fllr ein sozialisti
sches Land außergewöhnliche Linie wurde durch den Bcitrifl Somalias zur -Arabischen Liga"
im Jahr 1974 bekräftigt. Ebenso blieben die Verwandtschaftsverbindungen als Basis der so
malischen Innenpolitik erhalten. An der Zusammensetzung des .. Somali Rcvolulionnry Coun
cil" Mille der 1970er Jahre zeigte sich. dass entgegen der rcvolutioniiren Propag:mda die in
der ersten postkolonialen Phase eingefühne Tradition der Klan-Repräsentation fongefilhn
wurde. Auch d.ic Macht Siyad Barres selbst war innerhalb der sog. "M.O.D."-AIIianz vcr
wandtsc:hafilich vcranken: Wichtige politische Positionen wunlcn an die nächsten Venvand
ten des Generals entsprechend seiner eigenen Patrilinic (Marrehaan) und der seiner Mul!er
(Ogadcn) sowie der Abstammungsgruppe seines Schwiegersohnes (Dulbahante) vergeben
(lewis 1990: 56).85 Über die matrilaterale Linie konnten Verbindungen zur äthiopisch kon
trollienen Ogaden-Region hergestellt werden, während die im Norden vcnvurzehen Dulba
hante den Graben zwischen der Nord- und der Süd-Region überbrücken sollten: ,.The M.O.D.
constellation was thus an apt formula for ruling Somalia, providing the President with a power
base wbich offercd extemal as weil as intemal security" (Lewis 1988: 222). Diese Zusam
menhänge unterhalb der "anti-tribalistisc:hcn" Oberfläche waren in der Bevölkerung bekannt
(Lewis 1988: 219-223; ders. 1994: 150f/t65-167).
losgesamt lässt sich feststellen. d.'lSs die Politik des .. Scicntifie Socialism", mitgetragen von
der urbanen Intelligenz. in Bezug auf die Gleichben:chtigung der Geschlechter. den allgemei
nen Zugang zu Bildung und die landliehe Entwicklung durchaus erfolgreich war und dem
Ausgleich sozialer Gellilie diente (Laitin!Samatar 1987: 88). Im vollmundig propagierten
Kampf gegen die "tribalistischen" Strukturen des Landes wurden jedoch k.:tum mehr als ober
flächliche Erfolge erzielt. Die sozialistisc:he Ideologie kormtc, vor allem unter der Bildungseli
te, ca. zwei Jahre lang talSlieblich die VerwandtschaRsbande als Mobilisationsbasis zurück
d.rangen. Barre selbst bemühte sich jedoch schon sehr früh. seine HerrschaJl, den
Notwendigkeiten des somalischen Kontexts16 entsprechend, in die Linie der religiösen und
verwandtschaftlichen Traditionen zu stellen. Dieser Pragmatismus. gepaart mil militärischer
.., Alle dn:i Klans gehören zur Klan-Familie der D:lrod: .. Thc mag�c letters MOD thus represented thc inner circte orDarod powcr·· (Lcwis1994: 223).
.. Hierzu gehört sicherlieb auch. doss Siyad Barre im Umgang mit den Angehörigen seiner nächsten machtpolitischen Umgebung einen sehr direklen und offenen Kontakt pflegte, sich öffentlich fllr die Untcq>rivilegienen einse!Zle und die 7Ali'Sthaustellung von pri\'lltem Luxus <tc. vermied (l.ewis 1994: 153).
Copynqhted malcria
44
Macht und gewaltsamer Repression, war eine wichtige StOtze der Herrschaft BarTes, der ein hinsichtlich der akephalen Tradition der somatischen Gesellschaft ungewöhnliches Maß an
persönlicher Macht erlangen und stabilisieren konnte (Laitin/Samatar 1987: 91f; Lewis 1988:
224!). Barre selbst sprach in Bezug auf sein politisch-ideologisches Fundament von der .,[ ... )
ideology of political survivalM (Laitin!Samatar 1987: 159).
4.6.3 DAS ENDE DES "SCIEN11FIC SOCIAUSM" UND DER 0GADEN·KRIEO
Mitte der 1970er Jahre begann der sozioökonomischc Aufschwung zu stagnieren. Obwohl der
Sozialismus mit der Einrichtung der "Somali Revolutionary Socialist Pany" im Jahr 1976
äußerlich gefestigt schien, verlor die Ideologie des "Scicntific Socialism" auch im Kreis d.er
Regierung an Bedeutung. Alltägliche gewaltsame Repression und umfassende Kontrolle folg
ten der revolutionären Aulbruchstimmung; viele, oft lltllPCistisehe, Intellektuelle verließen das
Land. Das Regime begann sich in dieser Situation, bestllrkt durch die Mitgliedschaft in der "Arabischen Liga" und den gleichzeitigen Vorsitz in der OAU im Jahr 1974, zunehmend auf
außenpolitische Ziele zu konzentrieren. Die "alte" pan-somalische Politik wurde erneut rele
vant, weil sie den filr den weiteren Machterbalt dringend benötigten politischen Erfolg zu ver
sprechen schien. Dieser "Gesinnungswechsel" in der somatischen Politik stand in engem Zu·
sammenhang mit den Entwicklungen am Horn von Afrika:87
1.) Ab Mitte der 1970cr Jahre bahnte sich die Unabhängigkeil Französisch-Djiboutis an. Der sezessionistischen Somali-Minderheit in dieser Kolonie gelang es nicht, den Anschluss an
die Republik Somalia durchzusetzen. Am 27. Juni 1977 erlangte die Republik Djibouti die
Unabhängigkeit. Dieser Status sollte auch in Zukunft durch französische Militärhilfe gegen
expansionistische Bestrebungen der Nachbarstaaten Äthiopien und Somalia gewahrt werden
(Lewis 1988: 228-23 1; Laitin!Samatar 1987: 141).
2.) Im Jahr 1974 wurde der äthiopische Kaiser Hailc Selassie gestUrLt; die anschließenden,
mehrere Jahre dauernden staatlichen Umstrukturierungen destabilisierten das Land massiv.88
" Wie oben dargestellt, hane schon Anfang der 1960cr Jahre das Zusammenkommen von innenpolitischen Schwieriglceiten und außenpolitischen Verlinderungen enlsehcidenden Einfluss auf die gesamte somatische Pohtik.
" Mit Ausbruch dt'f verheerenden Dllrre im Jahr 1973, die ein Jahr später Somalia erreichte, hegan".,n die innenpolitischen Umwälzungen in Äthiopien. Hunger und die generell unbefriedigende politische und ökonomische Situation unter dem altersschwachen Monan:hen Haile Selassie fUhnen im Frllhjahr 1974 zu zahlreichen Protesten und Demonstrationen von Studenten, Arbeitern und Mi· litärs. Trotz rasch initiierter Refo"""n gelang es der Regierung um den Kaiser nicht, die Ordnung wiederhc:rzustellen. Im Sommer 1974 Ubernahm ein aus Militärs zusammengesetztes Komrnitee (amharisch: Detg), in dem Major Mengistu Haile Mariam eine fUhrende Rolle zu.kam, die Macht.
Copynghtcd ma riR
45
Die Gelegenheil schien gUnslig, um eine KJärung des lilhiopisch-somalischen Konnik1es
bezUglieh der Ogaden-Rcgion zu Somalias Gunstcn herbeizufilhren. Priisident Ba.rre versuch·
te, mit der neucn äthiopischen Regierung Ober die Autonomie der Ogad<11·Region zu vt-rhan·
dein. Doch trotz der nun gemeinsamen sozialistischen Basis89 konnte keine Annäherung er
reicht werden. Die in der Ogaden-Region operierende "Weslem Somali Liberation Front", mit
der die somalische Regierung offen sympathisierte, nahm Ende 1976. Anfang 1977 den
Kampf gegen die äthiopische Zentralmacht auf, und wurde dabei von weiteren gegen die am
harische Zentralregierung kämpfenden ethnisc!hen Gruppen. z.B. einem Teil der Oromo. un
terst!ltzt. Im Verlauf des Jahres 1977 griffen somalischc Truppen inoffiziell in das Kampfge
schehen ein und bis zum Herbst des Jahres erlangten die anti-!Uhiopischen Kllmpfer die
Kontrolle ilbcr ca. 90% der Ogaden-Region. ln dieser Situation kam es zu starken Spannungen
zwischen Moskau und Mogadishu und schließlich zum Bruch des vor allem mililärisch fUr
Somalia wichtigen Bündnisses. Ab August 1977 floss umfangreiche sowjetische Militllrh.ilfe.
erg5nzt durch 1..-ubanischc Unterstützung. nach Äthiopicn. Die nun folgenden dringenden Be·
mtlhungen Barres um den Beistand de-s "Westens" schlugen fehl. Oie USA und ihre VcrbOn
detei't betonten ihren Respekt vor den OAU-Bestinmmngen bezüglich der kolonialen Grenzen
Afrikas und machten die endgültige Abkehr der Republik Somalia von der nationalistischen
"Grcater Somalia"-Politik zur Bedingung tur aktive Mi lil!lrhilfe, die nur dem Schutz der
Grenzen der Republik dienen sollte. Das auf die "Befreiung" der Ogaden-Region fokussierte
Barre-Regime war außenpolitisch als "Aggressor" diskreditiert, wHhrend die somalisch
nationalistischc Bewegung innenpolitisch ihren Höhepunkt erreichte: "At its hcight thc Oga
den war had been immensely popular in Somalia and President Siyad's public standing never
beigher" (Lewis 1995: 67). lm Fcbmar 1978 1rnt Somalia offi2.iell in den Krieg mit Äthiopien
ein. Die somalischc Armee wurde nur von einigen arabischen Ländern unterst\lt�.t und vcrfilg
te nicht über die neuesie sowjetische WaOC:ntcchnologie; sie war damit den llthiopisch
russisch-kubanischen Truppen hoffnungslos unterlegen. Schon am 9. Mllrz 1978, nach einer
verheerenden Niederlage der somalischen Truppen bei Jijiga (ca. I 00 Ion westlich von Harar),
Der Kaiser wurde Ende September zum Abdanken gezwungen. Damit war die nalionalc Krise Ä·
thiopiens noch nicht bcendct. Innerhalb des Derg kam es zu Sp:1nnungcn; schließlich setzten srch die sozialistisch oricntierttn "hardliner" unter Mengistu gewaltsam durch. Ab Ende 1974 wurde eine sozialistische Staatsordnung durchgesetzt. Die Revolution filhne jedoch zu weiteren innerstaatlichen Zerwürfnissen. Die politische lnsubililät wurde durch die Sezessronsbemnhungen Ent· reas versciW-ft (Marcus 1994: 181-196; Laitin!Samatar 1987: 88) . .. Durinw 1977 ( ... ) anarchy reigncd in Addis Abcbn, in thc major urban ee:nters. and cven in the country sidc" (Marcus 1994: 196).
Copynghtcd malcria
46
verkündete Siyad Barre auf Drängen Amerikas den ROckzug der somatischen Soldaten aus dc:T
Ogaden-Region und gestand somit den Sieg Äthiopiens ein.QO
Aufinternationaler Ebene tnbrte der Ogaden-Krieg zu einer nachhaltigen Umstrukturierung
der Verhältnisse am Horn von Afrika. Während d.ie äthiopische Regierung den Supermacht
partner tauschte und im Verbund mit der Sowjetunion ihre internen und externen Machtan
sprüche gewaltsam dun:hsetztcn konnte, verlor die Republik Somalia ihren wichtigsten Bünd
nisp311tler zunächst ohne Ersatz und unterlag somit in der zwischenstaatlichen
Auseinandersetzung. Die "Greater Somalia"-Politik war endgültig gescheitert" und Somalia
außen- wie innenpolitisch dauerhaft geschwächt.
4.6.4 "RE-TRIBAUSIERUNG" UND SCHLEICHENDER STAATSZERFALL
Oie Niederlage im Ogaden-Krieg war ein Wendepunkt filr Barres Regime und filr die Politik
in der somatischen Republik insgesamt: "Defeat ended any sense of national unity'' (Bradbury
1997: 7). Viele hunderttausend92 Ogaden-Somali flohen in die Republik und belasteten die
schwachen politischen und ökonomischen Strukturen zusätzlich. Besonders in den von den
lsaq bewohnten nördlichen Gebieten, wo die meisten Flüchtlinge in Lagern untergebracht
wurden, kam es zu Spannungen.•; Oie innere Ordnung der Republik konnte nur mittels um
fassender humanitärer Hilfe seitens der internationalen Gerneinschan gesichert werden; die
Kontrolle dieser externen Zuflüsse wurde ein .zentraler Konfliktgegenstand.
Nach Antritt der Reagan-Administration im Jahr 1980 wurde Somalia ab 1982 militärisch
in das "westliche" Bündnis integriert. Dies war ein wichtiger Stützpfeiler der weiteren Herr
schaR des Barre-Regimes. Denn trotz oder gerade wegen der humanitären Notlage im Land
19 Auch Äthiopien folgte nun offiziell der Ideologie des "Scientific Socialism": Mengistu brach den Kont>kt zur den USA ab und wandte sich im Mai I 977 Moskau zu.
00 Ein offizielles Friedensabkommen wurde jedoch erst 1988 geschlossen . Äthiopien gab sich mit der ROCkeroberung der Ogaden-Region zufrieden und wandte sieb dem Problem der eritreischen Sezessionsbestrebungen zu (lcwis I 988: 231 ff: l.aitin/Samatar 1987: 141-143).
91 Die "Western Somali Liberation Front" blieb weiterbin in der Ogoden·Reg.ion aktiv. Es gehlog aber nicht mehr, den "Befreiungskampf' zu internationalisieren. Die Republik Somalia wurde auf Ebene der internationalen Politik, vornehmlich seitens der "westlichen" Kreditgeber, zur endgültigen Beilegung der alten Grenzstreitigkeiten mit den Nachbarstaaten gedrängt. Im Jahr 1986 begannen offi1ielle Friedensverbandlungen zwischen Ätbiopien und Somalia (Lewis 1988: 253) .
• , Da die Zahl der Flllchllingc das Ausmaß der international gewährten Hilfe bestimmte, war jede Zl!hlung in den lagern ein Politikum; 1981 einigten sich die somali.sche Regierung und die UNHCR auf eine feste Größe von 700.000 Flüchtlingen (Lewis 1988; 247).
" Oie Spannungen resultierten zum einen daraus, dass es den Ogadcn-Somali in den lagem auf Grund der internationalen Hilfe in den Augen der lsaq besser ging als der übrigen Bevölkerung des Nordens; zum anderen spielte auch die traditionelle Feindschan zwischen lsaq und Ogaden um Weidegebiete im Haudeine Rolle (Bongartz 1997: 45).
Copynqhled malcria
47
invc:stiene die Regierung einen großen Teil der imemen und externen Ressourcen in den Auf
bau einer schlagkräftigen Anncc, die weniger der Landesverteidigung als der innerstaatlichen
Repression diente. Neben dieser "westlichen" Ausrichtung war die Allianz mit den arabischen
Staaten von großer Bedeutung rur Somalia (Laitin/Samalar 1987: 144-147; Besteman 1996:
581; dies. 1999: 15).
Im Laufe der 1980cr Jahre verschlcchtcne sich die innersomatische Situation auf allen E
benen. Als Saudi Arabien aus vctcrinärrnedizinischcn Gründen im Jahrl983 ein Einfuhrverbot
fiir somatisches Vieh verhangte, kam es im Bereich der Ökonomie zu einem extremen Ein
bruch, denn Vichcxponc nach Saudi Arabien machten 1982 ca. 80% des gesamten somali
schen Außenhandels aus. Der Staat musste num. auch auf Druck des "Internationalen Wäh
rungs-Fonds" (l\VF), verstärkt regulierend in bisher weitgehend autonome Bereiche der Klan
Ökonomie eingreifen. Dies provozicne politische und ökonomische Konflikte. ln Folge der
allgemein schlechten Winschaftslagc gewann eine von der Zentralgewalt nicht mehr kontrol
licrbnrc Schattcnwinschnft an Bedeutung: Im Norden spielte z.B. der von den lsnq kontrollicr·
le illegale Qat-Handcl eine große Rolle und ftihrtc zu weiteren Konflikten zwischen der Zent-
1'1llrcgierung und dics.;r Klanfamili�"'. Im Bereich der Staatsadministration verbreitete sich ein
hohes Maß an Korruption; die Abhängigkeil der Regierung von externer Hilfe, um die Grund
versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitlein zu gewährleisten sowie größere winschaft
liche Entwicklungsprojekte zu initiieren, ermöglichte den Inhabern verwaltungspolitischer
Schlüsselstellungen lukrative Zusatzeinkommen (Lewis 1988: 258f; Hcycr 1997: 10; Lai
tin/Samalar 1987: 12Sf; Bradbury 1997: IOf; Schlee 2001: 6).
Auf soziapolitischer Ebene wurde angesichts der außenpolitischen und ökonomischen Mi·
serc die "klanistische''95 Orientierung im Jahrzehnt nach dem Ogaden-Krieg wieder sehr wich·
tig. Dies ftlhne. schlimmer noch als in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, zur innenpoliti
schen Fraktionierung und Destabi1isicrung der formalen staatlichen Ordnung. Es kam zu
inneren Unrultcn und vereinzelten Umsturzvcrsuchcn. Ende der 1970cr, Anfang der 1980er
Jahre wurden zwei sehr einflussreiche bewaffnete Oppositionsgruppen ge1,'lilndet. wobei Exil·
.. Lewis berichtet: 'The north as I saw when I last visited it in 1985, began to Iook and feel like o colony unda a fordgn miliiJiry lyrnnny" (Lcwis 1990: 5 8).
" Hier ist zu beachten, dass der Ausdruck "klanistisch" zwei unU."r•ch•rdlich<: Bedeutungen hat: Zum einen soll ausgedrllckt waden, dass die der somahschen Gesellschaft zu Grunde liegenden vcrwandiSchafllichcn Strukturen, deren sozio-politischc Relevanz besonders Anfang der 1970er Jahre seitens der Zcnlnllrcgicrung offiziell unterdrückt wurde, in den 1980cr Jahren als ßasis der Organisation von politisch aktiven Gruppen auf regionaler Ebene w1edcr offen zu Tage traten. Zum a.nderen bezeichnet ''klanistisch" IYLW. "clanism" Jirdueh auch den Kampf der Mitglieder der Staats·
Copynghtcd malcria
48
gruppen in England und Saudi Arabien eine große Rolle spielten. Die "Somali Salvation Oe
mocratic Front" (SSDF) wurde von den Majeerteen (Darod-Klanfamilie) dominierte, während
die "Somali National Movemcnt� (SNM) von den Isaq getragen wurde. Beide Gruppen wur
den maßgeblich von Äthiopien unterstützt. In den folgenden Jahren kol)nten diese Oppositi
onsbewegungen kleinere Erfolge gegen die somalische Regierung erringen, doch das Ziel,
Barre zu stürzen, scheiterte 1.) an der segmentären Begrenztheit und der inneren Zerstritten
heil der Opposition, 2.) an der mangelnden klanObergreifenden Akzeptanz; dieser mit dem
(ehemaligen) Feind Äthiopien verhundeneo Bewegungen in großen Teilen der Bevölkerung
und 3.) an der internationalen Unte.rstützung der Zentralregierung durch die USA und andere
Staaten.96 Das Barre-Regime reagierte mit massiven gewaltsamen Repressionen. die sich nicht
nur gegen die bewaffnete Opposition. sondern auch gegen die 7.ivilen Klanmitglieder richteten
(laitin!Samatar 1987: 92Ul 57f; Bradbury 1997: 7-10; Lewis 1988: 248-254; ders. 1994: 178-
214).97
Um seine Macht zu erhalten, war Siyad Barre neben der internationalen Unterstützung in
nenpolitisch stllrker denn je von den fiilhcr �kämpften "tribalistischen Kräften" abhängig.
Entscheidend war. das.'i er die Entstehung einer geschlossenen Opposition verhinderte, indem
er die machtpolitischen Ungleichgewichte innerhalb verschiedener Klan.s geschickt ausnutzte;
wichtige politische und militärische Posten wurden an Angehörige marginalisierter Unter
gruppen vcrgcbcn.98 Als Ende der 1980er Jahre Barres M.O.D.-Allianz zerfiel, musste sich
der Diktator im wesentlichen auf loyale Segmente seiner patri.lincaren Deszendenzgruppe
(Mareehaan-Klan) stutzen. Die letzte Hoffnung fiir Barre bestand darin, Klanantagonismen
durch Veneilung von Geld und Waffen an "befreundete'' Gruppen zu scharen. Mit Blick auf
die politische Dynamik der Verwandtschaftsallianzen war dieser "divide ct impera"·Ansatz
Barres jedoch höchst gefahrlich; politischer Einfluss, Geld und Waffen konnten schnell in die
elitc um den Zugang zu Sla3tsressourccn. wobei Klanzugehörigkeit im Hinblick auf die persönliche Bereicherung manipulien wurde (Bestelll3II 1996: 590).
" "ln order to maintain military bases in Somalia capable of monitoring affairs in the Gulf, thc U.S. govemment provided S 163.5 million during 1980-88 in military technology and four times !hat amount in e.;onomic aid" (Besteman 1996: 581). Daneben wurde Barre auch von England, ltalien, Deutschland Wld Saudi Arabien gestützt.
91 Zu den vagen politischen Programmen der Oppositionsbewegungen vgl. Bonganz !993: 48-51/67· 72184-90 (Dokumentenanhang).
91 Als Erfolg dieser Politik ist woh.l zu bewerten, dass der aus einer politisch wenig einflussreichen Familie stammende Vizepräsident General Mult:unmad Ali Samatar den schweren Autounfall Barres im Mai 1986 Wld die darauffolgende ea. einmonatige Abwesenheit des Präsidenten nicht nutzte, um selbst die Herrschaft an sich zu reißen (Lewis 1988: 254-257).
Copynghtcd ma riR
-19
Hände der Opposition gelangen (Lewis 1988: 260f; Laitin/Samatar 1987: 94/156f; Besteman
1999: 17; Compagnon 1998: 76).
Insgesamt lässt sich in der letzten Phase des Barre-Regimes vor dem oiTencn Ausbruch des
Bürgerkrieges im Jahr 1988 eine deutliche "Re-Tribalisierungs"-Entwicklung erkennen. Be
züglich der soziopolitischcn Situation Somalias um 1987 stellen Laitin und Samatar fest: "[ ... )
virtually cvcry political action in the Somali Republik today is analyzcd with a view to thc
tribal affiliations of the relevant actors" (l.aitin/Samatar 1987: 931). Nach fast drei Jahr
zehnten fonnaler somalischer Staatlichkeit waren die Spannungen zwischen den Klans, ge
schickt manipuliert von Barre, grofk-r denn je: .. Thus, in its desperate light for survival, Siy
ad's family and elansmen sought to cxploit to• thc full segmcntary lincagc rivalry within thc
Somali nation" (Lcwis 1994: 226). Das Barre-Regime selbst wies den Weg in den BOrgerkrieg
(Laitin/Samatar 1987: 94/161 ).
4.6.5 DER BORGERKRIEG 1988-1991
Obwohl die gesamten 1980er Jahre als ein Zustand latenten Bürgerkrieges bezeichnet werden
können, kam es erst 1988 zu einem umfassenden, die Republik Somalia letztlich zerstörenden
Ausbruch von Gewalt (Lewis 1994: 214). Ende der 1980er Jahre wurde der Druck der SSDF
und der Sl\rr-1 auf das Barre-Regime so groß. dass sich der somatische Präsident um ein Frie
densabkommen mit Äthiopien bemühte. Die Stabilisienmg der Beziehungen zwischen den
langjährigen Feinden war auch im Sinne der Regierung Mengistus, die Ende der 1980er Jahre
in schwere militärische Auseinandersetzungen mit den eritreischen Befreiungsbewegungen
EPLF (Eritrea.n Pcoples Libcrntion Front) und TPLF (Tigrayan Peoples Liberation Front) ver
wickelt war. Durch einen Friedenschluss mit Barre wurde der Abzug vieler der im Ogadcn
stationierten Rcgierungssold:ucn möglich� die unschliclknd in den Aurstand.sgcbictcn irn Nor·
den Äthiopiens eingesetzt werden konnten (Prunier 1994: 61; .Marcus 1994: 21 1 1). Im April
1988 kamen die äthiopische und die somalischc Regierung Ubcrcin. ihre bilatcralen Bczichun·
gen zu normalisieren und somit auch die UnlerstUtzung von Oppositionsgruppen im Land des
ehemaligen Gegners aufzugeben. Als Re-aktion auf dieses Abkommen eskalierte die gegen das
Barre-Regime gerichtete Gewalt in der lsaq-Rcgion. Die SNM-Guerilla versuchte, den Norden
unter ihre Kontrolle zu bringen, woraufhin reguläre somatische Truppen hart durchgriiTen.
Tausende von Jsaq flohen aus Somalia. Berichte, z.B. von "Africa Watch", Ober Bombarde
ments, Massaker und Folter durch die Annee ftlhrtcn schließlich zur Reduzierung der exter-
Copynghtcd malcria
50
nen Hilfsleistungen fllr die somatische Regierung.99 Obwoh.l Barre und seine Anhänger sich
nach Kräften bemühten, Rivalitäten und Oynamikcn innerhalb der somatischen Klangesell
schaft zu ihren Gunstcn auszunützen, wurden die regierungstreuen Kämpfer von einer immer
breiteren bewaffneten Oppositionsbewegung zurückgeschlagen, an deren Spitze der SNM und
die erst 1989 gegJÜildete Hawiye-Organisation "United Somali Congress" (USC) stand. Oie
Entscheidung in dem Bürgerkrieg, der als "against-system conflict" eingestuft werden kann,100
fiel in der Hauptstadt. Auf Grund der blutigen. Unterdrückung selbst der ZivilbevOikcrung101
und der verhandlungswilligen Opposition 102 verlor das Regime jegliche Loyalität; schwere
Unruhen eskalierten in Mogadishu. Die Ende 1989; Anfang 1990 durch die regierende "Soma
li Socia.list Revolution.ary Party" (SSRP) hektisch eingeleiteten politischen Reformen kamen
zu spät und wurden zudem von den GuerillafUhrern als nicht weitgehend genug abgelehnt. 1m
August 1990 schlossen sich die bewaffneten Oppositionsgruppen zu einer vereinigten Front
gegen das Regime zusammen und im Dezember desselben Jahres begann der Kampf der
USC-Truppen um Mogadishu. Am 26. Januar 1991 Ooh die Regierung aus der Stadt. Wäh-
.., Der Historiker Gerard Prunier hielt sich im Frühjahr 1990 im Norden auf und fllhne u.a. Gespräche mit politisch-milit!rischen FOhrem. In einem betont unakadcmischen Aufsaiz schildert er eindrucksvoll die alltägliche Realität im Knegsgebiet. Im zivilen wie auch im militärischen Bereich erkannte er (in Anlehnung an Lewis) eine "pastoral anarchy", geregelt entsprechend der traditionellen pastoral-nomadischen Normen: selbst die SNM-Gucrilla stellte Prunier als "simply the lsaaq people up in arms" dar (Prunier 1990/91: 107-109); zu SNM-Kampfstrategien siehe ebd . . 112-115.
100 7.anman unterscheidet drei Konflikttypen: 1.) Konflikte zwischen Systemen - darrut sind zwischenstaatliche oder auch interethnische Konfl·ikte gemeint, deren Protlgonisten durch kcincrelei gemeinsame Wcne, Autorillten ctc. verbunden sind; 2.) KonOikte innerh4lb eines Systems - dieser Kategorie werden Konflikte zwischen lndividu""' oder Gruppen innerhalb einer auf gemeinsamen Werten basicrenden sozio-politischon Ordnung zugeordnet; 3.) Konflikte gegen das Syteml"against-system conOicts" · diese Konflikte sind auf die Zerstörung des Sytems gerichtet {Zanman 2000: 7-9). Der somatische Bürgerl<rieg ist m.E. als "against-systcrn conOict" einzuordnen, da die bewaffnet< Opposition gegen das politische System insgesamt kämp!lo. ZW111 war eine gemeinsame kulturelle Basis vorhanden; aber diese hielt Somali im Dienste Barros sowie somalischc Guerilla und Oppositionelle nicht davon ab, sich gegenseitig extrem gewaltsam zu bcklmpfen. Die Perspektive des Systemerhalts wurde, abgesehen von den Reformvorschlägen der zivilen lnitoativc der "Manifesto"-Gruppc (vgl. Anm. 102), nur höchst vage formuliert.
101 Bei Simons wird ausfUhrlieh auf die Ausschreitungen in Mogadishu eingegangen, die Mine Juli {.,Biack Friday"/14.7.1989) in Fol�e der Ermordung des katholischen Bischof.• der Stadt eskalierten (Simons 1995: 80fl).
1"' Anfang 1990 wurde Siyad Barre ein von 1 14 einflussreichen Bllrgcm, u.a. dem früheren demokratischen Prasidenten Aden Abdulle Osman, unterzeichneter "offener Brief' übergeben. ln diesem in Somali und Englisch veröffentlichten sog. ·'Manifesto I" wurde das ökonomische, politische und soziale Elend des Landes deutlieb artikuliert und der Vorschlag unterbreitet, eine ··conferenee of National Reconciliation and Salvation" nach dem Vorbild eines traditionellen Shir einzuberufen. Die Ziele der Konferenz sollten die Beendigung des Blutvergießens und Einleirung substantieller politischer Reformen sein. Dieser mutige Schri n hanc jedoch keinen Erfolg. Viele Mitglieder der "Manifesto-Group" wurden verhaftet und Bane setzte weiter auf eine Politik der gewaltsamen Repression. ln den Bürgerkriegs,. irren des Jahres 1990 ging jegliche Gesprllehsbasis verloren (Bonganz 1993: 57f: Somali Eidcrs 1990: 109-124).
Copyroghtcd ma riR
51
rend ein Teil der USC-Truppen unter Führung von Gem.:ral Aideed den gcslUr�lcn Diktator
verfolgte, bemtihtc sich ein anderer Teil der Hawiyc·Bcwcgung, auf einer im Nachbarland
Djibouti abgel1altenen Konferenz eine Interimsregierung mit Ali Mahdi an der Spitze zu in·
stallicren. Obwohl sich Mahdi, der von der ,.Manifcsto-Gruppe" unterstützt wurde, bei der
Rcgierungsbiklung um die Einbeziehung aller rcle,•antcn Klankräfte bemühte, scheiterte der
Versuch, den somatischen Staat unter einer neuen Regienmg zu erhalten, an den unvereinba·
ren Interessen der verschiedenen Oppositionsbewegungen (Gilkes 1994: 47-49).
Barre und seinen Getreuen gelang die flucht in das Gebiet seiner Darod·Kianfnmilic. Hier
konnten auf Basis der Klanzugehörigkeit Truppen mobilisiert werden, um gegen den USC zu
kampfen. Barres letzte Bastion fiel jedoch Anfang 1992; der ehemalige Herrschar selbst konn·
tc sich Uber Kenia ins Exil nach Nigeria retten. wo er AnfangJanuar 1995 starb. Während sieb
die lsaq· bzw. Majcerteen-Gucrillas auf die Sicherung ihrer vornehmlich im Norden gelege·
nen Klan-Regionen konzentrierten, entbrannte um Mogadishu ein Konflikt zwischen den ver·
schiedeneu USC·fraktionen. der Fraktion des auf den Abgul·Subklan gestützten Ali Mahdi
und der Fraktion des aufden Habr Gidir-Subklan gestülzen Mohammed Aideed.101 Mogadis·
hu wurde völlig venvüstet Wld die gesamte Region um die Hauptstadt stUnte in Not und Cha·
os (Lcwis 1995: 69; dcrs. 1994: 225-229; Besteman 1996: 582; Bradbury 1997: I 0-13; Bon·
gam. 1993: 51f; Zitelmann 1996: 276!).
4.7 ANALYSE DER ENTWICKLUNG SO MAUSCHER ST AATLICIIKEIT DIS 1988 IM LICIIT DER TRADITIONELLEN GESELLSCHAFTSORDNUNG
Drei Jahrzehnte nach Erlangung der Unabhängigkeit lag der somatische Staat in Trtimmem,
obwohl mit der lange Zeit allgemein konstatierten ethnisch-kulturellen "Einheit" der Somali
e-in festes Fundament filr den Aufbau eines somaJisc:hcn Staates vorhanden gcweicn zu sein
schien (Schlce 1996: : 135). Die zentrale ethnologische Frage ist, welche Rolle die scgmcntä·
ren Gesellschaftsstrukturen bei dem letztendlichen Scheitern der somatischen Staatlichkeil
spielten.
Heycr scheint. geleitet von strukturfunktio·nalistischcn Überlegungen, eine einleuchtende
Antwort auf diese Frage geben zu köMen: Sie setzt die politischen Entwicklung in der Repu·
b1ik Somalia in Bezug zur somatischen Frunilienökonomie und entwickelt aus den sich somit
ergebenden politisch..(!konomischcn Korrelationen eine ,.TI1eorie des temporären Staa·
Copynghtcd malcria
52
tes"(Heyer 1997: 3). Die Autorio geht, in Anlehnung an die von F. Bayard und G. Hyden vor
gelegten allgemeinen Analysen der afrikanisc.hen Staatlichkeit, davon aus, dass der Staat in
Somalia unauflöslich mit den somatischen Gesellschallsstrukturen verbunden war. Der Staat
wurde von den Europäern übernommen und, als interessante ökonomische Ressource, in die
,.economy of affectionM'"' eingegliedert. Eine zentrale Rolle spielten dabei die in der Koloni
alzeit entstandenen Eliten, die stets noch in die traditionellen sozialen Netzwerke eingebunden
waren. Sowohl in der Zeit der Klandemokrallie bis 1969, als auch in der Zeit des "Scientific
Socialism" war der Staat Ober die stets soziapolitisch relevanten Klanbindungen in die soma
Hschen F:unilienOkonomicn integriert. Nach außen hin diente die formale Staatlichkeil der
Akkumulation externer Ressourcen in Form von militärischer und wirtschafilicher Hilfe, im
Inneren war der ,,schwache"10� somatische Staat jedoch immer auf die Kollaboration mit den
klanstrukturierten Netzwerken der Gesellschaft angewiesen. Schon nach der Niederlage im
Ogaden-Krieg, als die Regierung in die bis dahin relativ autonomen Klanökonomien ein
zugreifen versuchte, um die eigene politische ·und ökonomische Position zu festigen, geriet sie
in Konflikt mit den Verwandtschaftsgruppen. Als gegen Ende der 1980er Jahre der Zufluss
externer Ressourcen und damit deren Venei Jung an die politisch einflussreichen Klans ins
Stocken geriet, verlor die somatische Regierung auch die letzte Funktion in der somatischen
Familienökonomie (Heyer 1997: 6-11). Mit Blick auf diese Entwicklungen stellt Heyer fest,
dass ab Ende der 1970er Jah.re "[ ... ] eine An klanstrukturierter Gerinnungsprozess das ganze
Land erfasste und den Staat desintegriene" (Heyer 1997: 12). Heyer steht mit ihrer Analyse in
der Tradition von Lewis (vgl. Anm. 74). Der Staat erscheint als ein zusätzliches Segment
höchster Ordnung: ,.Die Perioden konstruktiver und destruk1iver staatlicher Organisation ste
hen dabei mit den Perioden des ,fusion and fission' [ ... ) somatischer strategischer Gruppen in
'"' Diese Gruppen babcn sieb in den folgenden Jahren des Kampfes weiter fraktioniert und gegenseitig bclcämpft (Schlee 1996: 144). Der Frage, inwiefern der Kampf der warlotds den traditionellen Muslern d<r segmentaren Gesellscbaftsordnung folgte. wird in Absclmin 6.5.2 nachgc:!lllngen.
'"' Hcyer bezieht sich hier auf Goran Hydcn; nach dessen Ausführungen dient die ,.economy of a(fection" dem Überleben und der Verbesserung des Lebensstandards von auf Basis von verwandtscbaftlichen. religiösen etc. Gemeinsamkeiten mileinand<r kooperierenden Gruppen in .. schwachen" Staaten (Heyer 1997: Sn[).
'"' Nach Max Weber zeichnet einen Staat aus, dlass er in einem bestm1mten Territoroum erfolgreich ,.das Monopol legitimer physischer Gcwaltsamkeit" beanspruchen kann (Weber 1980: 822). Von dieser .empirisch" bcgrOnd<:ten Slllatlichkcit lässt sich die .fonnale" Staatlichkeil unterscheiden. Letztere genUgl zwar ,.:iußerlich", in ß<ZUg aufTerrioorium, Regierungsstrukturen, und internationale Anerkennung, den Anforderungen eines Staates; das legitime Gewaltmonopol im Inneren fehlt jedoch. Oie meisten der auf BaSis der Kolonialordnung entstandenen Slllaten Afribs sind somit rein formale (n:bildc (Heytt 1997: 9f). Die Rede vom ,.<chwacben Staat" bezieht sich auf diese formale Staatlichkeit. wird jedoch in der Literatur hllulig mit weiteren Faktoren, wie Gkonomischcn und sozialrn Problem<n, verbunden (vgl. Anm. 120).
Copynghtcd ma riR
Zusammenhang: Sobald eine Ressource durch eine segmentübergreifende Fusion politischer
Akteure errungen ist, beginnt die Fraktionierung, die den Staat letztlich erodiert" (Hcycr 1997:
3). Insgesamt ergibt sich aus Hcycrs Analyse: Der Staat konnlc sich in Somalia nie von den
segmentären Strukturen "emanzipieren"; deren Dynamik verhindene die permanente Konsoli
dierung von Staatlichkcit.
Heycrs Analyse ist plausibel, und doch reicht ihr Ansatz m.E. n.icht aus, um zu erklären: a)
warum sich die somalischen Regierungen immer wieder in fast aussichtslose militärische Un
ternehmungen stOrzten, die hohe Kosten und. in Folge der stetigen Niederlagen, ökonomische
Rezessionen verursachten; b ) warum sich Barre und die ihn umgebende Elite so lange an der
Spitze des Staates halten konnten, während die Masse der Bevölkerung vollkommen verarm
te; '"" c) warum sich der Staat zwischen 1988 und 1991 zum Nachteil aller in einem unkontrol
lierten Chaos auflöste, in dem die Hälfie der Bevölkerung durch Hunger und Tod bedroht
wurde.
Im Folgenden versuche ich. diese drei Fragen 1.) mit Blick auf Schices Ausruhrungen zu
"Inklusion und Exklusion'"07 sowie 2.) auf Gnmdlagc von neueren Untersuchung zur Eliten
bildung in Somalia und den sich daraus ableitbaren Üb�rlegungen zur Veränderung der sozia
len Kooperationsstrukturen zu beantworten.
Zu 1.) Heyer blendet in ihrer auf die Familienökonomie gerichteten Analyse den somali
schen Nationalismus und dessen politische und ökonomische Folgen weitgehend aus. Ein
großer Teil des externen Ressourcenzuflusses diente militärischen Zwecken und war somit
nicht im Rahmen der Familienökonomie nutzbar. Das zeigte sich daran, dass 1969 die unzu
üiedenc Militärelite putschte; wäre das Militär in die Klanökonomie eingegliedert gewesen,
wäre es wohl nicht zu einem Umsturz gekommen. Zudem ven1rsachten die mit extemer Mili
tärhilfe ermöglichten irredentistischen Untemehmungen in den J 960er/70er Jahren hohe Fol
gekosten, die, in Kombination mit DUrren und FIOchtlingsströmen. die nomadische Ökonomie
, .. Bradbwy schreibt mit Bezug auf die Zeit vor cfcm Bürgcrkneg: .,lt was cstimatcd that 70 pcr cem oflhe rural population livcd below thc absolute poverty Ievel" (Bradbury t997: 7).
107 Schlcc bezieht sieh hier auf die Theorie der "cross-cutting lies'', derentsprechend individuelle ldcntit.iitskonstruktlonen im Hinblick auf ohr gruppenverbondendes Potential untersucht werden. Wlhrend cross-cuning ties bislang fast aussehhcßlich als Faktoren der so7.ialen Kohäsion un<l der KonOikt-Oeeskalation diskutiert wurden (siehe besonders Gluckman), betont Schlcc die ''Doppel· funk:tion" der ldcntillitskonstruktion, die sowohl gruppenbildend als auch ausgrenzend \\1rken kann (Schlee 2000b: 72-74). Daran anknllpfend empficlt der Autor: .,Stall Identität und Differenz nach bestimmten Kriterien, das heißt der Abwesenh.,it oder dem Vorhandensein gemeinsamer Markierungen, fUr sich genommen als Faktoren zu betrachten, die Feindsceligkeit oder Kohäsion generieren, sollte man sie als Rohmaterial fnr die politische IUictorik betrachten. das selektiv rum Zweck der lnldusion oder Exklusion verwendet werden kann" (Schlee 2000b: 73).
Copynghtcd malcria
54
schwer belasteten. Auch die enonne Aufrilstung nach dem Ogaden-Krieg, die der Unterdril
ckung der eigenen Bevölkerung diente, lässt sich nicht sinnvoll ,.familienökonomisch" inter
pretieren (Matthies 1977: 276; ders. 1990: 238-240; Bradbury 1997: 71).1011
Diese deutet m.E. daraufhin, dass der Staat nicht nur, wie Heycr annimmt, der KlangeseU
schaft ,,ausgeliefert" war, die entsprechend der ökonomischen Bedürfnisse ihrer Segmente
fusionierte und fissionierte; Fusions- und Fissionsbewegungen konnten auch vom Staat bzw.
der Staatsfilhrung sclb�'t eingeleitet werden, um. die zentralstaatlichen Machtstrukturen jenseits
der ökonomischen Logik breiter Gesellschaftsschichten zu erhalten. Die auf der Ebene des
postkolonialen Staates stets bedeutsame "Deszendenz-Ideologie", die auch von Barre nur o
berflächlich verdrängt wurde109, diente der "nationalen� Mobilisierung und somit dem Macht
erhalt der regierenden Eliten, die sich spätestens im Laufe der 1980er Jahre aus den Netzwer
ken einer breitgefächerten "eeonomy of affection" lösten (siebe dazu 2.). bn Sinne der
Positionen Schlees (vgl. Anm. I 07) kann festgestellt werden. dass die genealogisch kons1itu
iene somalische ldentitat von denjeweiligen politischen FUhrungen in den 1960ernOer Jahren
als Rohmaterial genutzt werden konnte, um im Zuge der irredentistischen Politik eine die in
nenpolitischen Machtverhältnisse stützende Fusion cin.rolcitcn; die gesamte snmalischc Ge
sellschaft wurde zu ei.nem Zusammenschluss auf nationaler Ebene bewegt (Inklusion). Nach
der Nicdcrl3ge im Ogaden-Kricg ging der Staatsfilhrung das außenpolitische Mobilisierungs
potential als Basis ihres Machterhalts verloren. Ab Ende der l970er Jahre war die politische
Führung somit darauf angewiesen, die segmentäre Dynamik im innenpolitischen Kontext zu
Gunsten ihres Machterhalts auszunutzen. Damit wurden Fissionsprozessc eingeleitet; Barre
und die Seinen bemühten sich, gestUtzt auf einen kleinen Kreis enger Verwandter und selektiv
ausgewahlter Gruppen. die frilher politisch marginalisiert waren und nur durch Barre Zugang
zur Macht erhielten, die im Rahmen der formalen Staatl.ichkcit erwirtschafteten Ressourcen
unter Ausschluss weiter Teile der Bevölkerung zu .,konsumieren" (Exklusion).110 Der Groß
teil der nicht mehr am Staat beteiligten Bevölkerung konnte sich nur noch auf die verwandt
schaftlichen Wurzeln verlassen, um das Überleben zu sichern. Als Ende der 1980er die exter
nen Ressourcenzuflüsse ins Stocken gerieten, verlor das Barre-Regime jegliche Möglichkeit,
die manipulierte segmentäre Dynamit unter Kontrolle zu behalten; selbst die einstmals so
101 ln Anrn. 17 schreibt Heycr selbst, dass zv.�schen 1971 und 1975 43% dc.s filr zivile Zwecke bestimmten Staatshauslulltes l'llr die militllriscbc Aufrtlstung ausgegeben wurden {Heyer 1997: 7).
104 Der Ogaden-Krieg bedeutete ja faktisch die Anerkennung dieser .. Deszrodenz-ldeologie" zu den Hochzeiten des "Scientific Socialism".
110 Said S. Samatar zitiert Bam: mit den Worten: .. Whcn I am finally forced to rclinquish power, thcre will bc no nation lcfl to govem" Said S. Sall13tar 1997: 1 10).
Copynghtcd malcria
55
wichtige M.O.D.·AIIianz bmch auseinander . .,Thc complctc ,succe.ss' of the rcgimc's stmtcgy
of divide-and-rule through blood-tics in the end eonsumed its own strength, thereby leading to
tbe total collapse of govemment authority" (Abdi I. Samatar 1992: 637). Somalia wandelte
sieb also unter aktiver Mithilfe der Regierung .. [ ... ] from a nation on the move to a nation
adrifl" (Laitin/Samatar 1987: 155).
Zu 2.) In der traditionellen soziopolitischen Ordnung waren land und Wasser die wichtigs·
ten Ressourcen und somit die zentralen Konfliktgegenstände. Um eine effektive Nutzung die
ser statischen Ressourcen zu gewährleisten, mussten die gcscllschaflsimmancntcn 7.Cntrifuga·
Jen Kräfte zumindest zeitweise durch Kooperation verschiedener Gruppen, vcmlittelt durch
ihre Fahrer, überwunden werden. Diese im Rahmen der .. �onomy of affection" so zentralen
Kooperationsbeziehungen konnten nach Erreichung der Unabhängigkeit zunächst, wie von
Hcycr gezeigt, auf der Ebene des Staates perpc:tuiert werden. "Somali Ieaders procured more
international aid per capi ta than anywhere else in Africa" (Laitin/Samatar 1987: 108). Die
Familienökonomien nutzten jede Möglichkeit, um von dem neuen politischen System zu prof·
titieren. Dieser Prozess kulminierte in den Wahlen des Jahres 1969. Die 1970er Jahre stellen
m.E. eine Übergangsphase dnr; Auf politischer Ebene wurden die geronlokratischen KJ�n
strukturen111 abgelöst; unter F!lhrung einer neuen intellektuell-militärisch konstituierten Elite
wurden die alten Strukturen sukzessive aufgelöst. Dabei beziehe ich mich jedoch nicht auf die
obcrfl�chliche ,.anti-tribalistischc" Rhetorik des Barre-Regimes, sondern auf die Entwicklun
gen ab Ende der 1970er Jahre, die sichtbar machen, dass sich die Regienmg erfolgreich über
die Zwänge einer auf brcitgell!chcnen Kooperationsbeziehungen basierenden Fanlilienöko
nomie erheben kormtc. Die Nutzung der mobilen externen Rcssourccn112 zwang nicht zu
breitgellicherter sozialer Kooperation. Die permanente Bereicherung im Rahmen kleiner
Gruppen wurde möglich. Dieser Prozess der Verfestigung von Machtpositionen auf nationaler
Ebene wird von neucren Forschungen bestätigt, die spätestens ab Anfang der 1980er Jahre
Anzeichen filr die Herausbildung einer "Klassengesellschaft" in Somalia erkennen. An deren
111 Heyer inlerpr<lim den Umsturz 1969 als Aufbegehren einer durch das gtrontoknlische Sy.rem ausgeschlossenen "political age group" (Hcyer 1997: 7).
"' .By the 1980s, de>-elopment assismnce constiruted a stunning 57 percent of Somalia's average annual GNP" (Mcnkhaus 1998: 220; vgl. auch Zitelmann 1996: 279). Von diesen Geldem wurde ein sehr großer Prozentsatz von Angehörigen der Regierung und der Verwaltung abgeschöpft. Beskman kommt in ihrer jüngsten Studie zu dem Schluss, dass dieser in der Forschung weil verbreil<le Fokus auf die Rolle der externen ZuflDs.se fUr die somatische Sraallichktit zu einseitig ist. Gerade im Hinblick auf rue landwirtschafilich genutzten Regionen Südsomalias muss der staatli· ehe Umgang mit Land im !Uhmen von Lanc±rechtsrefonnen, Entwicklungsprogrammen clc. als zentrale Komponente der Konsolidierung der Staatsmacht milbeachtet werden (Besteman 1999: 226). Bestemans Positionen werden in Abschnitt6.5.1 weiter erll!utert.
Copyngh!ed malcria
56
Spitze stand eine Staatsbourgeoisie, die sicll. losgelöst von der Masse der Bevölkerung, um
die Kontrolle der externen und internen Ressourcen bemühte (Bcstcman 1999: 194ff; dies.
1996: 585f).lll ,.The ethos and the rcproductive requircments ofthis commercial order began
to crodc the effcctiveness of the rules of kinship" Abdi I. Samatcr 1992: 633). Die Herausbil
dung einer auf die eigene Bereicherung ausgerichteten "Ausbeuterklasse" kann also mit Blick
auf die in älteren Darstelhmgen herausgearibeitete "Egalitl!t" der (männlichen) Somali
Gesellschaft durchaus als auf die Ebene der politischen Führung konzentrierter "Kulturwan
del" verstanden werden. Zwar waren die verwandtschafilichen Bande, wie gerade die .,Re
Tribalisicrungstendenzen" im Laufe der 1980er Jahre zeigen, auch auf Ebene der Staatslllh·
rung noch entscheidend; doch nicht mehr im Sinne einer .. economy of affcction", sondern in
lllr die Durchsetzuns individueller Macht· und Bereieherungsansprilehe manipuliener
Fonn.1" Dies ging soweit, dass Barre versuchte, sich Ende der 1980er Jahre die notwendige
Unterstatzung mit Waffen zu "erkaufen", um weiterhin an der Macht bleiben zu können.
Heyers Sicht, dass sich die Funktion des Staates darin erschöpfte, externe Ressourcen t1Jr
die Distribution im Rahmen der somalischen Familienökonomie anzuzieheo1 und ihre daraus
abgeleitet Schlussfolgerung, dass ab Ende der 1970er Jahre .,[ ... ] eine Art klanstrukturierter
Gerinnungsprozess das ganze Land erfasste und den Staat desintegriene" (Heyer 1997: 12)
klingt, als wäre der Staat unausweichlich den Klanstrukturen .,ausgeliefert" gewcsen.115 Dies
erscheint mir zu einseitig. Die irredentistischen Unternehmungen und vor allem die Tatsache,
dass sich der Swt ein Jahrzehnt lang, zwischen 1978 und 1988, gegen die Interessen vieler
großer Klans halten konnte, verdeutlichen, dass die somalische Staatlichkeil nicht ausschließ.
lieh der funktionalistischen Logik der Familienökonomien folgte. Vielmehr zeigt sich, dass
die formale Staatlichkeil ihren Repräsclltanten die Möglichkeit bot, die segmentäre Dynamik,
"' "ln the 1980s. Somalia wus a place of opulent decadcnce :ond quiet tcrror. Upper-cchclon govc:mment officials lived in lavishcd villas, drovc expensive caTS, and dined in faney Rstaur.mts. Lowerltvel governmcnt employees scrambled to access as many funds ofmoney as thcy could find" (Bestc:man .1999: 30).
1" Diese Manipulation der verwandtSChafllich·�gmcntllren Strukturen stimmt mit den Überlegungen Schices Oberein, der betont, dass konstruierte und manipuliene ldentiliten auf einem gewissen Maß liD Realität, ''Wirklichkeit im Sinne von Wirksamkeit", beruhen müs.'iCtl (Sehlee 2000b: 78).
"' Hcyer Oberträgt ihre Annahmen, dass der Staat sich im somatischen KonteXt nur als "Ressourcengenerator" halten kann, auch auf die Republik Somaliland und prophezeit die ROckkehr zur .,fun.ktionalc(n] Koopcr11lion", wenn auf O.uer die intemalionalc Anerkennung und somit der externe Ressourcenzufluss ausbleibt (Heyer 1997: 21). Mit Blick auf die unten (Kapitel 6) ausgefilhrten Entwicklungen in Somaliland ist dazu zu sagen: Die Staatlichkeil in Somaliland wurde Oberhaupt erst durch funktionale Kooperation möglich. die allerdings nicht auf ökonomische Ziele, sondern auf die Wiederherstellung des Fr
iedens gerichtet war. 8osher konnten sich staatliche Strukturen in
Somaliland auch ohne intemaoionale Anerkennung. vielleicho sogar gerade. wegen dem weitgehenden Ausbleiben eines m:ossiven Ressourcenzunusses, halten und stabilisieren.
Copyroghtcd ma riR
57
gestUtzt auf die Kontrolle der externen Ressourcen, zum eigenen Voneil zu manipulieren und
sich somit 1:war nicht vollkommen. aber doch sehr weitgehend von den Zwängen der Famili·
enökonomicn zu befreien. Die von der Regierung llbcr zehn Jahre aktiv betriebene Untcrmi·
nicrung der traditionell breitgcllichencn KoopcrationsSirukturcn crklän auch, warum es den
verwandtschaniich organisierten Oppositionsl>ewcgungcn nach dem Sturt. Barres nicht g��
lang, ein gewisses Maß nn Ordnung aufrecht zu crhallcn. um das in den I 990er Jahren folgen·
de, fiir alle Somali verheerende Chaos zu vermeiden."• Auf die Entwickhmgen nach 1991
und deren Analyse, die an diese Diskussion anl.-ntipfl. wird in Kapitel 6 ausführlich eingegan-
gcn.
"' Auch Said S. Samatar weist (sehr plakativ) a11f die Unterminierung der kooperativen Strukturen durch das Barre-Regime hin: ..Practically each and O\'Cryonc of the cstimatcd fiV<: to sevcn million Somllli is, in his inflamro ambition. inflcxibly bcnt on h.oving thc top job 10 thc country, namely the prcsidcncy, and if hc cannot h.ovc it, he will not hcsitate to v1sit ruination on cvcryonc. includ· ing immediate mernbcrs ofhis kin" (Said S. Samatar 1997: 1 10).
Copynghlcd malcria
58
S INTERNATIONAUS EINGREIFEN
Im folgenden Kapitel soll an zwei Beispielen der Verlauf und die Auswirkungen e•terner In-
terventionen dargestellt werden, die auf eine Verbesserung der humanilllren und politischen
Situation in dem von Bllrgcrkricg und Staatszerfall erschOllenen Somalia zielten. Dabei ver
milieh die UNIUS·Intcrvention Einblicke in die Krisenreaktion auf Staatsebene ("Track One"
Ansatz11\ während das Handeln der schwedischen .,Non Governmental Organization"
(NGO) "Life & Pcace Institute" (LPI) die Arbeit auf zivilgcsellschafilicher118 Ebene ('"Track
Two"·Ansal7.119) beleuchtet.
5.1 DER INTERNATIONALE POLmSCHE RAHMEN NACH 1989
Zwei im Rahmen dieser Arbeit wichtige Folgen des Endes der Blocklconfrontation 1989/90
sollen kurz erläutert werden, bevor weiter auf das Fallbeispiel Somalia eingegangen wird: I.)
Die innenpolitischen Umwälzungen in vielen Ländern der "Drillen Welt"; 2.) Die Erweiterung
des Handlungsspielraumes auf der Ebene der internationalen Politik.
Zu 1.) Das Ende des "Kalten Krieges" führte in vicll:n Regionen der Welt l>U cnonncn SO·
zie>-politischen und ökonomischen Veränderungen. Die globalen Finanz- und WaffenstrOme,
die aus den Supemtachts-Zentren an loyale Machthaber in der Peripherie ("Dritte Welt") flos
sen, versiegten abrupt. Die häufig nicht demokratisch legitimienen Herrscher in den Ländern
der "Drillen Welt" verloren mit der Veringerung bzw. dem Ende des externen Ressourcenzu
flusses die wichtigste Basis ihrer Macht; zudem war die ökonomische Lage in vielen Ländern
des "Südens" sehr schlecht. Ende der 1980er, Anfang der I 990er Jahre erhöhte sich der inter
ne, aber aucb der externe Reformdruck. z.B. durch IWF, Weltbank, UN und EU, auf diese
politisch und ökonomisch "ausgehöhlten" Herrschaften. Diese theoretisch durchaus positiv zu
bewertenden Ansätze einer "Demokratisierungs-Welle" gingen jedoch praktisch in vielen
Ländern des "Südens·• mit einer massiven Destabilisierung bestehender innerstaatlicher Ord·
nungsstrukturen einher. Dies wirkte sieb besonders im subsaharischen Afrika verheerend aus.
'" Mit dem lkgriff "Truck One"-Ansatz wird das Handeln auf Ebene des Staates und der internationalen Politik, z.B. im Rahmen von Diplomatie oder, im Falle einer Situation des Sl.alltszerf311s, Verhandlungen mit militärischen FOhrem, erfasst (Heinrich 1997: I I I).
"' "Zivilgesellschafi" wird hier, sehr weit gefasst, als vom Staat abgegrenzte gesellschaftliche Sphäre verstanden und beinhaltet sowohl Individuen als ouch Organisationen (Windfuhr 1999: 761).
'" Unter "Track Two"·AnS2l2 versteh! man, dass Akteure, die nicht der Sphlrc der offiziellen sl.alltli· chen Polilik angdiÖr<:n, wie z.B. NGOs, in Kri,;cnsituationc:n aktiv werden und sich in Zusammenarbeit mit Angehörigen der loknlen Zivilgesellschaft um eine Lösung der Krise bemühen (Windfuhr 1999: 75617S9f; Heinrich 1997: 12).
Copynghtcd ma riR
.59
Viele der i n der Kolonialzeit konstruic"rtcn ''kt;nstlichcn'' Staaten waren auf Grund jahrzehn
telanger sozialer und ökonomischer Misswirtschaft zu "schwach"t20• um die "limenale Phase''
der Umstrukturicrung der inneren Ordnung friedlich zu bewältigen. "Alte" und "neue" inteme
Konfliklc brachen auf und behinderten den angestrebten Übergang von autoritären und kor·
rupten Herrschaften zu stabilen Dc•tnokratien (Engel 1999: 91; Baechelet 1998: 2f; Press
1999: 3). Zentrale Aspekte dieser Entwicklungen werden in nktucllen politologischen und
ethnologischen Analysen mit den Begriffen "Staatszcrfall"r'failcd statcs", "Kricgsher
ren"f'warlords" und "Gewaltmäri<tc"f'gcwaltoffcne Rnumc" erfa.�st (Mallhics 1998: 59; Tetz
laff2000b: 34-47; Bollig 1999: 425-444; Elwert 1997: 86-101).
Zu 2.) Die fast filnfzigjährigc Blockade des gemHß An. 24 (I) UN-Chartet fllr die "Wah
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" zuständigen Sicherheitsrates wurde
mit dem Ende des pern•ancntcn KonOiktcs zwischen den ständigen Ratsmitgliedern USA und
Sowjetunion aufgehoben. Ein deutliches Zeichen dieses Umbmchs auf Ebene der intcmatio
nalen Politik war, dass der S icherheitsrat zwischen 1989 und 1994 18 neue Friedensmissionen
mandatierte, während zwischen 1945 und 1989 ins�esamt nur 15 internationale Peacekeeping
Missioncn entsandt worden waren (Windruhr 1999: 755). ln der Einleitung seiner 1992 er
schienenen "Agenda for Peacc"t2t driickte der damalige UN-Generalsckrctär Boutros Boutros·
Ghali die Hoffnungen aus, die mit dieser Erwcitenmg des Handlungsspielraums auf Ebene der
internationalen Friedenspolitik verbunden waren: "In thcsc past month a conviction has
grown, arnoug nations !arge and small, that aJ!1 opportunity has bccn rcgaincd 10 aehieve thc
grcat objcctives of the Charter - a United Nations capable of maintaining international peace
and sccurity, of seenring justice and human rig.hts and of promoting. in the words of thc Char·
"0 Die "Schwache" der afrikanischen Staaten b<:zicht sich cinerscits auf das in Anm<rkung 105 erlüutc:rt.e Konz�t der ttformalcn•· Suaattichkcit: andererseits spielen in diesem Zuummenh::mg hliufig auch eurozentrischer Klischeevorstellungen, ausgedrUckt mit Schlagwon<n wie "Kiientclismus", "rUck.sl!ndige Traditionen" etc .• eine Rolle. So schreobt :t.D. d<r Politologe R. TetzlaO': "Da$ jeweilige 'kulturelle Erbe' einer Gesellschaft bestimmt die Geschwindigkeit und die GeschmeidigJceit, mit der d<r Staat die gesellschafllichc lnlegration im Transitionsprottss, da immer Vcrunsicherungen mit sieb bringt. auffechtcrhlilt." Als in der Erziehung vennittcltcs "kulturelles Erbe" afrikanischer Länder macht dieser Autor in Anlehnung an einen UNESCO-Bericht "Gehorsam" sowie "Ahnenverehrung und religiösen Glauben" aus (Terzlaff 2000a: 41 -43). Eine wesentlich differenziertere Sicht auf die politisch<n Entwicklungen in Afrika biet<n z.ß. die neueslen Arb<:iten von Chabai!Doloz und Bayart. Meines Eraciht<ns kann allgemein das häufige Fehlen cmcr breoten, gebOdelen und ilkonomisch stabil<n "Mitte lsehicht" als ein wichtiger Fal1or im Zusammenhang mit den z.T. cnOfTll scbwierig<n politischen Transformationsprozessen in den 1990er Jahren angtsehen werden .
"' Die "Agenda for Peace" beinhaitel wichtige Neuerungen im Bm:ich der intcmalionalen Fric:denssicbcrung; �8. wurde das Konzept det "präventiv<n Dtplomatic" und der "Friihwamung" einge·
Copynghtcd malcria
60
ter, 'social proyess and a bener Standards of )ife in !arger Frec:dom'" (Boutros-Ghali 1992;
I f). Auch Georgc Bush, der damalige Pr'.isident der einzig verbliebenen "Supermacht", sah An
fang der 1990er Jahre eine "Neue Weltordnung'' heraufdämmern. In dieser zumindest im
"Norden" weitverbreiteten Euphorie schien der Traum vom "ewigen Frieden" zum Greifen
nah (Beruand 1995: 126f; Nuscheler 19%: 23)·. Das enorme Ausmaß des menschlichen Leids
und des politischen Zerfalls in Somalia zu Beginn der 1990er Jahre schien den praktischen
Beweis der Wirkungsm3ehtigkeit dieserneuen UNIUSA-Fric:densordnung geradezu herauszu
fordern.
52 DIE POLITISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN VOR ORT - STAATSZERFALL IN
SOMALIA
"Stllle c:ollap.rt ls nnt a shorf.t�rm phtnomenon but a cu.mullllivt. incremmtal proctJS 1fmllar to a degml!:f'Oti� dluwc .. (Lyottt/Soncatar 199S: /).
Der Kollaps des somatischen Staates, der schon mit dem Ende des Ogaden-Krieges begonnen
hatte vollendete sich 1991/92. Die Verhältnisse in Somalia Ende der 1980er, Anfang der
1990cr Jahre können als "fortgeschrittener Staatszcrfall" bezeichnet werden. der mit der "Imp
losion" der staatlichen Ordnung einhergeht. 122 Der von Tctzlaff allgemein geschilderte Ver
lauf eines Staatsterfalls erfasst wesentliche Aspekte der jilngstcn Entwicklungen in Somalia,
die in Kapitel 6 detailliert dargestellt werden, sehr gut: "Je mehr der 'Staat' als koloniales und
postkoloniales Herrschafts- und Verwaltungszentrum verschwindet. desto wahrscheinlicher
übernehmen bewährte gesellschaftliche Ein.richtungen der V ergangenheil - ethnische, religiö
se, kulturelle Institutionen - wenigstens teilweise notwendige Ordnungsfunktionen, weM es
nicht gar zu einem anhaltenden Machtvakuum als Tor zur Anarchie kommt" (Tctzlaff2000b:
36).
Nach dem endgültigen Zusammenbruch der Zentralregierung bemühten sich größere und
kleinere Klangruppcn, regional autonome Herrschaftsgebiete zu errichten: "[ ... ) fighting be
came endemic in ma.ny areas, and localized war economies prevailed. with all resources re
garded :lS means for increasing military power, and militarypower seen as a means for gaining
führt. Die ''Agenda for Pcacc" iSt som.it eine der Wur<eln der aktuell dislcutienen Kriscnprlivcnti· onsanslltu (Boutros-Ghali 1992: 13-19; Bc:rtrand 1995: 127).
"' Tet:daff unterscheidet insgesamt drei Voriantcn von Staats7.erfall: 1.) "Territorial partieller Stllatszcrfall". 2.) "Fongeschrittener Staatsurfall", J.) "Schleichender Staatszerfall" (fe12laff 2000b: 36).
Copyngh!cd ma riR
61
comrol of resources" (Ramsbotham/Woodhouse 1996: 198). Während sich 1saq, Majeerteen
und Harwiyc auf die Kontrolle ihrer "angestammten" Gebiete im Norden konzentrierten und
dort somit trotz anhaltender Machtkämpfe die Wiederherstellung der regionalen Ordnung auf
Basis vertrauter Strukturen möglich war, erhoben bewaffnete Gruppen im Süden territoriale
Ansprüche, die nicht klan-historisch begründet waren. Dies hatte zahlreiche gewalttätige Kon
flikte und die "ZerstUckelung" der Region zur Folge (Mukhtar 1997: 54f; Gilkes 1994: 51).
"Thc political gcography of thc Somalia hinterland in 1992 [ ... ) closely resembled that re
ported by European explorers in the 19th century, with spears replaced by Kalashnikovs and
bazukas" (Lcwis 1995: 76).
Zwischen Januar 1991 und Dezember 1992 wurde der Untergang des 1960 etablierten so
matischen Staates cndgUitig besiegelt: Einerseits kämpften Teile der Opposition noch bis Mit
te 1992 gegen die letzten Truppen Barrcs, andererseits kam es schon zu heftigen Auseinander
setzungen innerhalb der Opposition; mehrere in Djibouti abgehaltene Friedenskonferenzen
konnten die Gewalt nicht bcenden. Die SNM erkämpfte im Nordwesten die Vorherrschaft und
konnte schließlich die Abspaltung der Region in den Grenzen des ehemaligen britischen Pro
tektorats durchsetzen. Am 18. 5. 1991 wurde die Unabbl!ugigkeil "Somalilands" ausgerufen;
im Anschluss daran gelang dort eine schrittweise Stabilisierung der Lage (siehe Kap. 6) (Herr
mann 1995: 81-85; Schlee 1996: 138; Lyons/Samatar 1995: 23).
Im von warlord-Herrschaftcnm und Hunger heimgesuchten Zentral- und Südsomalia ver
breiteten sich weiterhin Tod und Zerstörung. Der Mittelpunkt der Gewalt war Mogadishu, um
dessen Beherrschung die bekanntesten Kriegsherren Mahdi und Aideed kämpften. Aber auch
in anderen Teilen der Region lieferten sich die verfeindeten USC-Fraktioncn in Allianz mit
verschiedenen Guerillabewegungen schwere Gefechte. Bei einer Gesamtbevölkerung von
sechs bis sieben Millionen Menschen starben in den zwei Jahren nncb der Vertreibung Barres
aus Mogadishu insgesamt ca. 300.000 Menschen; bis zu einer MiUion Menschen waren auf
der Flucht (Herrmann 1995: 86; Ramsbotham/Woodhouse 1996: 198; Gilkes 1994: 50-56).
"' Auch wenn sich die Anhängerschaft der warlords entlang genealogischer Linien rekrutierte. ist es wichtig, Aidced. Mah<ti und andere Kriegsherren von traditionellen Führern und ihrem Gefolge zu unterscheiden: "Thcy [<tie warlords) are ombitious modern politieans, formcr army officers, covil servants, memhers of partiament, merchants or univcrsity professors, who have quickty adaptcd to the nc:w rules of tbe gnmc of compctition for power'' (Compagnon 1998: 83). Die aus ethnologi scher Siebt intereSS!lßtc Frage, ob das Wirken der warlords und die jüngsten Gewatteslaotationen in SOdsomalia insgesamt aufGrundtage der in Kapitel 2 vorgestellten somatischen Traditionen analysicn werden können, wird in Abschnitt 6.5 disk'Uticrt.
Copynghtcd ma riR
62
Erst Anfang 1992 wurde die Weltbevölkerung durch Medicnberichte124 auf diese humani
täre Katastrophe aufmerksam (Adibc 1995: 23). Der internationale politische Handlungs
druck, vor allem auf die UN,m wuchs und fllhrte zu ersten gezielten Reaktionen: Der UN
Sicberbeitsrat verbllngtc ein Waffenembargo; im Februar/März 1992 wurden auf Ebene der
internationalen Diplomatie Waffenstillstandsabkommen zwischen Aideed und Mahdi verrnit·
telt; arnerikanische Flugzeuge flogen Lebensmittel ein (Lyons!Sarnatar 1995: 24/29-33; Rarns·
botbam/Woodhousc 1996: 202-204). Dennoch konnte die politische und humanitäre Notlage
in Somal.ia nicht unter Kontrolle gebracht werden. Darnuthin begannen, getragen vom Geist
der in der ,,Agenda for Pcace" ausgedrilckten Friedcnscupboric, auf Seiten Amerikas ergänZt
durch innenpolitische Überlegungen im Zusammenbang mit den anstehenden Präsi·
dcntscbaftswahlen126, die Vorbereitungen einer internationalen Intervention (Rarns-
botham/Woodhouse 1996: 206).
5.3 EINGREIFEN AUF EBENEDER INTERNATIONALEN POLITIK: UNOSOM I, UNIT AF UND UNOSOM ll
Am 24.4.1992 beschloss der Sicherheitsrat mit Resolution 7$ I, eine aus SO Militärbeobach
tern und 500 Blauhelmsoldaten bestehende UN-Peaceke�iog-Operation127 in Somalia
,, Sarkastisch, abo:r treffend schreibt C. Abide in einem UN-Poper: "( ... ( tbe telcvision media were very instrumental in bringing live pictwes of dying Snmalis to tbc living room.< of their wide audicnccs arow1d the world" (Adibe 1995: 25).
"' Entgeg<n der Selbsteinschätzung der UN konstatieren Ramsbotbam, Woodhouse u.a., dass trott K<nntnis d<r schlimmen Situation in Somalia im ganzen Jahr 1991 keine effektive Hilf• seitens d<r UN geleistet wurde, teils weil <lie Lage als zu gelihrlieh eingeschlitzt wurde, teils aber auch, weil der laufmde Golf-Krieg und die Probt"""' in Jugoslowicn die 'italm Interessen des "Westens" bcrQhrten und deshalb Vorrang vor einem Engagement im seit 1989/90 gropolitisch unbe· deut<nden Somalia genossen. In der "heißesten Phase" des somatischen Staatszerfalls 1991 arbeiteten nur einige NGOs, wi< z.B. das "Rote Kreuz" und die "Ärzte olmc Grenzen", vor Ort (RamsbothamiWoedhouse 1996: 2001).
,,. Im Frilhjahr 1992 konnte im Sicherheitsrat nur eine in Bezug auf Mandat und Ausstattung sohr eingeschränkte fri<dmsmission durchgesetzt werden, da vor den Wahlen in den USA auf Seiten des am<rikanisehen Präsidenten der Wille fehlte, sich auf ein neues und sehr komplexes außenpolitisches Thema ei nzulassen. Erst nachdem die Wahlen tnit einem Sieg Clintons abgeschloSS<n wa· ren, sah Bush eine Chonce, S<iner Amtszeit durch einen schnellen internationalen Erfolg "finalen Glanz" zu verleib<n; somit war der Weg frei !Ur die Mandatierung einer mit weitreichenden Mitteln und Kompetenun ausgestatteten Mission (ll.ewis 1997: 188!).
'" Das Konupt des "Peaeekeeping" wird in der UN-Charter nicht ausdrilcldich erwähnt, ist jedoch noch g�ngiger vOikerrechtlicber Interpretation implizit in dem Vertragswerk enthallen. Peaeekeeping-Opcrationen werden als Ausdruck des z.B. in der Präambel und in Art. I (I) der UN-Chorter festgeschriehen<n FriedenS>tiels der Vereinten Nation<n verstanden. Ihre rechtliche Basis liegt als imaginlres "Kap. VI 1/2" zwisch<n Kap. VI (Friedliche Streitbeilegung) und Kap. VU (Zwang.smoßnabmcn). Den Friedensmissionen liegt immer ein Mandat des Sicherheitsrats zu Grunde (Schmidl: 2000: 155 ).
Copyroghted ma riR
63
(UNOSOM, später UNOSOM I genannt) zu etablieren, um den im März ausgehandelten Waf.
fenslillstand mit friedlichen Mitteln zu überwachen. Der UN-Gcneralsckretär ernannte den
Algerier Mohamed Sahnoun zu seinem Sonderbeauftragten fllr Somalia. Dessen Ausgangspo·
sition in Südsomalia war sehr schwierig. Die von den USA wtd von versc-hiedenen NGOs
Oberbrachten Nothilfemittel wurden zum bevorzugten Beutegut bewaffneter Banden. Es be
durfte langwieriger Verhandlungen zwischen Sahnoun und den sUdsomalischcn warlords, al·
Jen voran Aideed und Mahdi i n Mogadishu, bevor man sich auf die Stationierung der in Reso·
lution 751 vorgesehenen 500 Blauhelm-Soldaten einigen konnte. Trotz dieses Erfolges wurde
Sahnoun im Oktober durch den Iraker lsmat Kittani ersetzt. Ausschlaggebend dafllr war, dass
Sahnoun als Inhaber einer hohen UN-Position nicht davor zurückgeschreckt war, <las Versa·
gen der internationalen Gemeinschaft im Vorfeld der Katastrophe zu kritisieren.'28 Da er au
ßerdem eher eine Strategie des sensiblen Verhandlungsausgleichs im somalischcn Klankon·
text verfolgte, als auf die Erzwingungsmacht von UN und USA zu vertrauen, geriet Sahnoun
immer stärker in Gegensatz zur Position des UN-Hauptquartiers in New York.t29
Die "klassischen" Peacekeelling-Missionen bis 1989 bestanden aus nur zum Zweck der Selbstverteidigung leicht bewaffneten, neutralen Truppen, die unter Zustimmung aller beteiligten KonJltkt· parteien einen zuvor ausgehandelten Frieden Oberwachen sollten ("Peacekeeping der ersten Generation"). Seit Ende des Ost-West·KonOiktes nahm das Ausmaß der UN-Friedenseinsätze enorm zu und die Mandate der ßlaubelm-Einsätze wurden sukzessive erweitert: zunehmend wurden von den UN-Truppen ziv;lgesellschafilicbe Funktionen (humanit�rc Hilfe, Abhaltung \'On Wahlen, Polizei· aufgaben etc.) Obemommen ("Peacekeeping der zweit<:n Gcneration"rmultifunktionale" Missionen). Die Intervention in Somalia stellt einen deuOichcn Wendepunkt in der Geschichte des Pc;�cc· keeping dar: UNOSOM I war als eine peacekeeping-Mission der "ersten Generation" konzipiert. Als sieb das Scheitern der friedenserhaltenden Maßnahmen abzeichnete, wurde mit der USgclciteten UNIT Af·lntcrvmtion w1d deren Ablösung durch UNOSOM U der Versuch untemom· men, mittels einer Erweiterung des Mandats um "multifunkttonale", aber auch um militärische Funktionen den Frieden zu erzwingen; dabei musste unter Aufgabe der Neutralit9t in der Situation eines virulenten Krieges eingegriffen werden. Dieses inzwischen als "Pcacckceping der dritten Generation" ode1' "robustes Peacekeeping" bekannte Kon>.tpt ist sehr umstritten (Eisele 2000.: 163f: Unser 1997: 106-109: Boutros-Gh:tli 1996: 4).
'" Sahnoun macht drei "missed opporturuties" aus: 1.) Als sich die Auseinandersetzungen zwischen dem Barre-Regime und den lsaq 1988 zuspit7.4en, lll!tte die internationale Gemeinschaft \"T11lit· telnd eingreifen können, um weitrrc f.skalationen zu verhindern: 2.) Auch 1990 wäre es noch müg· lieb gewesen, durch eine entschiedene Unterstützung der "Manifesto-group" eine Basts somah· scher Stutlichkeit zu erhalten; 3.) Die im Jahr 1991 \'On der Regierung Djiboutts unternommenen Versuche, zur Versöhnung ihrer somalischen Nachbarn beizutragen, wurden nicht von der UN unterstützt; die Cbance, d.ie Eskalation der Gewalt zu einem möglichst frOhen Zeitpunkt mit vereinten Kranen aufzuhalten, wurde somit vertan (Sahnoun I 997: 305·307).
tlO Folgendes lkispiel illustriert die unterschiedlichen Stmtegien von Sahnoun in Mogadishu und seinen Vorgesetzten in New York: Nachdem Sahnoun das Vertrauen der warlords gc"'Onnen h:ttte und somit die Stationierung von SOO Blauhelm-Soldaten gem!ß SR/Res/75 I möglich geworden war, beschloss der SicherbeilSrat auf Betreiben Boutros-Gbalis ohne Rücksprache mit der UNOSOM-Leirung vor Ort die Entsendung von 3800 Soldaten. Dies zerstöne die mühsam erarbeitete Vertrauensbasis zwischen der UN und den somalischen Milizen-führern (Sahnoun 1997: 3 I 1). Zu "Sahnoun's Way'' und den Differenzen innerhalb der UN vgl. auch Ste\'cnson 1993: 1440'.
Co Y' ghK'CI malcria
64
Im September 1992 erreichten die UN· Truppen Mogadishu, wurden aber von Aideed, der
weiterhin die strategische Kontrolle in Teilen Mogadishus behalten wollte130, an der effekti·
vcn Ausübung ihrer friedensstilt7�nden Mission gehinden. Entschiedeneres Handeln schien
der UN-FUhrung in New York nötig, um das menschliche Leid rasch zu beenden, obwohl
schon zu diesem Zeitpunkt das mit einer Politik der Stiirl<e verhundene Risiko erkennbar wur·
de, dass die intematiuonale Gemeinschaft in das Konfliktgeschehen hineingezogen werden
könnte. Boutros-Ghali erwähnt als Schwierigkeit am Beginn des Eingreifens: "( ... ) the wide·
spread perecption among Somalis that the United Nations ( ... ) was planning to 'invadc' the
country, and that lhe United Nations had thus become the 'common enemy' of the Somali
factions" (Boutros-Ghali 1996: 28).
Ende I 992 bot die US-Regierung den Vereinten Nationen an, amerikanische Soldaten fllr
einen begrenzten Zeitraum zur Unterstützung der Blauhelm-Truppe nach Somalia zu entsen
den. Die Aufgabe der US-Operation sollte es sein, einen sicheren Rahmen fllr die Versorgung
der Bevölkerung mit Hilf.�gütem zu schaffen und die Arbeit der UN-Mission zu ermöglichen.
Dieses Angebot wurde angenommen. Mit der Sicherheitsrats-Resolution 794 vom 3.12.1992
wurden die nötigen rechtlichen Voraussetzungen mr die Erweiterung des internationalen Ein·
sa tzes geschaffen; gemäß Kap. Vll der UN·Charter wurden die internationalen Truppen auto
risien, ihren Auftrag mit allen notwendigen Mitteln unter Ei.nschluss militllrischer Gewalt
auszufllbrcn. Diese Resolution markiert den Übergang von einer friedlichen Pcacekecping·
Mission zu dem .,ncuen Typus" des ,.robusten"· Peac.ekeeping (vgl. Anm. 127), der als "huma·
nitllre lntervention"111 deklarien wurde. Am 9./IO.Dezemher landeten die ersten Einheiten der
"" Die KontrOlle über verkehrsstrategische Kon<>tenpunkte wie Schiffs- und Flughilfen stellte ein vitales Interesse aller warlords dar, da hier "Zölle" auf die Waren und "SchutzzOlle" von dt:n Hel· fern genommen werden konnten oder schlicht die Chance aufBeute bestand (Lcwis 1997: 187).
'" Zum völkerrechtlieben Hintergrund des Konzepts der "humanitlr<n Intervention": Das gnmdslltz· liehe Paradoxon besteht darin, dass im Rahmen einer human.itliren Intervention rum Zweck der Verhinderung oder Be<ndigung massiver Menschenrechtsverletzungen gewaltsam in Staaten ein· gegriffen werden muss. Mit Blick auf die in der UN-Charter festgeschriebenen Grundsätze des Völkerrechts scheint eine solche Unternehmung zunächst nicht zulissig: Die Chaner verbietet den Staaten in Art. 2 (4) jegliche Anwendung \'OD Gewal� außer zu Zwecken der unmittcllxlren Selbst· verteidigung (Art. SI). Nach Art. 2 (7) dürfen auch die Vereinten Nationen selbst nicht gewaltsam in die .,inneren Angeleb>enheiten" von Staaten eingreifen; die einzige Ausnahme bilden die vom Sicherheitsrat gemäß Kap. Vll beschlossenen Maßnahmen zur Sicherung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Die staatlichm Sc>u,·mnitllt steht im Zentrum dieser Normen. Im Schatten dieser Souvcränitllt galten Mensehcnrcchtc lange Zeit als .,innere Angclegenheit<n". ln den l<121en fiinf Jahrzehnten hat der Mcnsehcorcchtssehutz als Gegenstand des Völk<'tTCChts je· doch immer mehr an Bedeutung gewonnen und wurde somit zunehmend :w einer .. internationalen Angelegenheit". Zudem erhöhte sich mit Ende des Ost-Wcst·Konnikts die Handlungsflihlgkcit des UN�'licberheitsrats. Dies hatte eme besonders ftlr den Menschenrechtsschutz positive Neuorientie· rung bezOglieh der staatlichen "Souverllnitat" zur Folge: Bis t989 wurde die Mcnsehenrechtssitua·
co,..yllqhltd .nd!Cria
6:5
von Amerika gefilhrten United Task Force (UNIT AF) im Krisen gebiet, die neben US-Truppen
auch Soldaten aus 23 anderen Staaten beinhaltete; die "Operation Restore Hope" begann (Ly
ons!Samatar 1995: 30fT; Ramsbotham!Woodhouse 1996: 202fT; Herrmann 1997: 1 17-123).
5.3.1 ZIELE UND STRATEGIE DER UN/US-INTERVENTION IN SOMALIA " ( ... ] Ulnnf!n die Vcrdnten NationOJ ihren Willen durch.scc:en, wt'nn .sie mit EntschloJJcnhcit und sic}ubarer mi/ltllrischer Ob<!r�heil ouftrtte• " (Eis•l• ]()l)l)b: 2S5).
Oie Ziele des Eingreifens, wie sie in den im Zusammenhang mit der humanitären Intervention
grundlegenden Sicherheitsrats-Resolutionen 794 (UNITAF) und 814 (UNOSOM U) formu
liert wurden, waren die Leistung humanitärer Hilfe, die Beendigung der Gewalt und der Wie
deraufbau der nationalen politischen Ordnung in Somalia.132 Der Zeitrahmen fllr die Errei
chung dieser Ziele war entsprechend der Vorgaben aus Washington und Ncw York sehr eng
gesteckt.m Die bei der Operation verfolgte St.ratcgie bestand aus einer Mischung aus Diplo
matie und Androhung von Gewa1t.13• Da keine verantwortliche somalische Staatsfilhrung vor
handen war, v.11rdc der Kontakt zu den scheinbar die Lage kontrollierenden Führern der be
waffneten Fraktionen gesucht. Mit diesen sollten bindende Abkommen Uber die Einstellung
der Kampfhandlungen, die Abgabe der Waffen und die Bildung einer neuen Regierung fllr
tion in Staaten nur zweimal. im Fall von Rhodesien 1968 und SUdafrika 1977. gemäß Kap. Vll UN-Charter als BcdrohW>g oder Bruch des Friedens und der internationalen Sicherheit interpretien, woraufhin Zwangsmassnahmen, wie Waffen- und Handelsembargos, eingeleitet wurden. ln den letzten zehn Jahren dagegen wertete der ON-Sicherheitsrat schon in mehreren Fßllen. wie z.ß. im lral: (Unterdril<:kung der Kurden im Nordi:rak), in Somalia (humanitäre Katastrophe) und in Haiti (Vertreibung des gewahlten Präsidenten) die innere Lage des Landes als Bedrohung der internationalen Sicherheit in einer bestimmten Region Wld infolgedessen als lkgri!ndung flir das internationale Einschreiten ( Schorlerner 2000: 41-43; Fassbender 2000: 4931). Diese jüngeren Entwicldungcn im Völkem:cht sind nicht unumstritten: Aus rechtspositivistischer Sicht ist einzuwenden, dass bisher keine Völkerrechtsnorm klar das Ausmaß von MenscheDiechtsverlctzungcn im Inneren eines Staates bestimmt. das zu einem internationalen Eingreifen bercch· tigt . Auch dje "Aufweichung'' der staatlichen Souveränität ist ein wenig transparenter und somit in Bezug auf die Konsistenz des völkcrn:chtliehen Nonnengebäudcs, das ja auf der Durchsetzling der Normen durch die Staaten beruht, bedenklicher Prozess. Zweifel an der "Aufrichtigkeit" humanitärer lnterYentionen kommen auf, da nicht in allen Notsituationen intervenien wird (siehe Tscheischenien) und der Sicherheitsrat z. T. massiv durch die außenpolitischen Interessen einzelner Staaten (siehe z.B. die Rolle der USA im Falle der Irak-Sanktionen) gelenkt wird.
"' Das in der SR/Res/794 formulierte Mandat der UNIT AF war darauf begrenzt. die Leistung humanil!rer Hilfe mit allen Mitteln zu ermöglichen (Hinch/Oaklcy 1995: 180). Nachdem diese Vorar· heilen geleistet waren, sollte das Kommando an UNOSOM ß weitergegeben werden, deren Aufgabe gemAII SR/Res/814 die Sicherung des Friedens und der Wiederaufbau der politischen Sirukturen in Somalia sein sollte (Hirsch/Oa.kley 1995: 202-204; Boutros-Ghali 1996: 4).
m Die UNOSOM wurde immer nur fllr einen begrenzlen Zeit:raum (meist ca. sechs Monate) mandatiert und musste dann \'erl�ngert werden; der Einsatz der UNIT AF war von voroberein nur mr einige Monate geplant.
'"' Die Amvendung von Gewalt sollte möglichst V<'T111ieden werden, da die dabeo drohenden Verluste in den Herkunftsländern der Soldaten kaum zu n:chtfertigen sind.
Copynghtcd malcria
66
Somalia ausgeltandelt werden. Die massive Präsenz internationaler bewaffneter Truppen sollte
den Kriegsherren die dringende Notwendigkeit von friedlichen Verhandlungen vor Augen
fllhren und die Umsetzung der ausgehandelten Vereinbarungen fOrdern (Hirsch/Oakley 1995:
13/150-15&/177-181/199-205; Ramsbotham/Woodhouse 1996: 2101). Auf politischer Ebene,
aber auch hinsichtlich der geographischen Schwerpunkte des UN/US-Einsatzes wurde in ers
ter Linie eine "top-down"-Ansatz verfolgt: Man ging davon aus, dass die Versöhnung der her
ausragendstell Akteure des Bürgerkrieges und die Befriedung Mogadishus und der anderen
der Zentren der frilhercn Republik auf das ganze Land ausstrahlen würden. Als sich Mitte
1993 das Scheitern dieses zentralistischen Ansatzes abzeichnete, wurden auch dezentroJe
Friedensbemllhungen, auf lokaler und regionaler Ebene, unterstUtzt (Menkhaus 2000: 194-
196: ders. 1996: 46f/521).
5.3.2 HUMANITÄRE ARBEIT UND SuCHE NACH FRIEDEN
Die im Rahmen der UNIT AF-Mission gelandeten Truppen konzentrienen sich auf Zentrot-
und Südsomalia_ Insgesamt Uber 38.000 Soldaten, 213 davon aus den USA, waren ab Januar
1993 in Somalia im Einsatz. Die UNITAF-lntervention sollte in vier Phasen. von der Siche
rung Mogadishus Uber die Ausdehnung der internationalen Präsenz in Zcntrol· und SUdsoma
lia bis zur Übergabe des Kommandos an UNOSOM n verlaufen (Hirsch/Oakley 1995: 44).
Unmittelbar nach ihrer Landung konzentriene sich die internationale Mission auf Moga
dishu. Man bemühte sich, ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Aidced und Mahdi, den
''Herrat" der geteilten Stadt, :w Stande zu bringenm, die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte
wie den Hafen und den Flughafen zu sichern und die Bevölkerung via Zeitungs- und Radio
mineilungen mit der Arbeit der UNIT AF vcnraut zu machen. Noch im Dezember 1992 be
gannen die Interventions· Truppen ihren Wirkungskreis aus7A!dehnen. Südsomalia wurde in
acht "Humanitarian Relief Sectors- (HRS) zwischen Betet Weyne und Kismayo eingeteilt, in
denen Srtttzpunkte errichtet wurden. Vor On bemllht.e sich die UNIT AF um den Schutz des
internationalen humanitären Hilfspersonals und, in Zusammenarbeit mit den anwesenden
"' Die masSJ\'e internationale Militärpräsenz schien positive Wirkung zu zeigen. Noch im Dezember kamen Mahdi und Aideed auf Einladung der önlichen Leiter der UN· und US-Mission im USHauptquanier m Mogadishu zusammen; von den Klirnpfen erschöpft einigten sieb die �gner auf ein "'Seven Point Agreement"". das den Frieden innerhalb des USC wiederherstellen und somit das Ende der Gewalt in der Stadt etnleiten sollte. Doch letztlich hielten sich die warlord• nicht an die Vereinbarungen, und die UNITAF hatte weder den Auflrng noch den Willen, das Ende der Waffengewalt aktivherbeizufuhren ( Hirsch/Oakley 1995: 55-58: Bradbwy 1997: 15).
Copynghtcd m3lcria
6 7
NGOs, um den Aufbau der lnrrastmktur, wie Strassen, Brunnen, Kliniken, Schulen etc.
(Hirsch/Oakley 1995: 54-73).
Gleichzeitig mit diesen regionalen Stabilisierungsmaßnahmen der internationalen Truppen
unter US-Kommando wurden auf Ebene der UN-Diplomatic eine Reihe von Konferenzen in
Addis Abeba ioitiien. Anfang Januar 1993 kan1en die Venreter der Kriegspaneien SUdsomali·
as zusammen, um Ober die militärischen Fragen des Friedensprozesses zu verhandeln. Am 15.
Januar wurde ein Abkommen unterzeichnet, das als ersten Schritt einer nationalen Aussöh·
nung einen landesweiten Waffenstillstand und den Beginn der Demobilisierung aller Kriegs
parteien unter Aufsicht von UNITAF und UNOSOM beinhaltete. Mitte M:!rz folgte ein Tref·
fen, das sich mit der humanitären Unterstützung des Friedensprozesses beschllftigte;
Gegenstand der Verhandlungen war der Wiederaufbau und dessen internationale Finanzie
rung. Direkt im Anschluss daran fand die groß angelegtc1J6 "National Reconciliation Confe·
rence" statt. Hier wurde am 27. Mä.rz ein Abkommen unterzeichnet, in dem noch einmal die
strikte Einhaltung der Waffenstillstands· und Entwaffnungsvereinbarungen vom Januar unter·
strichen wurden. Die UNOSOM wurde aufgeforden, diesen Prozess zu unterstützen, mit
Sanktionen gegen Waffenstillstandsbm:her vorzugehen und Waffcnzunasse Ubcr die Grenzen
zu verhindem Die internationale Gemeinschaft wurde um massive Hilfe bei dem Aufbau der
Infrastruktur im Land gebeten. Das politische HerzstUck des Abkommens war ein Rahmen
konzept 1\lr den politischen Wiederaufbau des Landes. Im Zentrum der "Transitional Mecha·
nisms" stand die Einrichtung eines aus 74 Venretem der verschiedenen Regionen und Kon·
niktparteien bestehenden "Transitional National Council" (TNC); des weiteren wurde die
Etablierung von "Central Administrative Dcpanmcnts" (CAD), "Regional Councils" (RC)
und "District Councils" (DC) vereinban. Dem "top-down"-Ansatz der UN entsprechend soll·
ten auf Ebene des TNC. des.'ICn Sitz in Mogadishu geplant war, die wichtigsten internen und
externen Entscheidungskompetenzen gebündelt werden (Hirseh/Oaklcy 1995: 93-991191-198;
Hemnann 1997: 126-128; Heinrich 1997: 46-48).
Trotz d.ieser scheinbar weitreichenden Verhandlungserfolge war nicht erkennbar, wie die
Basis jeglichen Friedens, das Ende der Gewalt und die kontrolliene Waffenabgabe, gegen den
WiUen der Guerilla-Kä.mpfer geschaffen werden sollte, weil 1.) die Mitglieder der Milizen,
die neben dem vorhandenen Kriegsgerät aus der Zeit des "Kalten Krieges" auch auf die per·
"6 Zwar nahmen an der Konferenz sehr viele loknie somnlischc Autoritäten teil. doch die abschlic· llende Übereinkunft durfte auf Grund des UN-Reglemcnts nur von wenigen exponierten Molilär· FOhrern unterzeichnet werden. Dies filhrtc dazu. dl!s.1 letztendlich die warlord$ ihre Interessen ohne ROcksieht auf einen breiten Konsens durchsetzen konnten (Menkhaus 1996: 47).
Copynghted malcria
68
manent über die äthiopische und kenianischeGrenze zunießenden Waffen zugreifen konnten,
vom Plündern und Rauben profitierten (Lewis 1997: : 191)1l1 und 2.) eine enwungene Ent
waffnung höchst wahrscheinlich mit Verlusten auf Seiten der internationalen Truppen ver
bunden gewesen wäre; dies wollte das UN-IUS-Kommando venneiden (Bradbury 1997: 15).
Wie unberechenbar die Situation in SUd-Somal.ia während der internationalen
Friedensbemühungen war, zeigte sich daran, dass es ab Anfang 1993 zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen den von General Morgan, dem Schwiegersohn Barres,
gefllhnen Kämpfern der •·somali National Front� (SNF) und den "Somali Patriotic
Movement"' (SPM) von Colonel Jess, einem V erbUndeten Aideeds und seiner "Sornali
National Arn1y" (SNA), um die Stadt Kismayo kam. Trotz der Präsen.z der internationalen
Truppen gelang es General Morgans Guerilla Ende Februar, Colonel Jess aus der Stadt zu
venreiben. Als die Medien berichteten. Morgan habe Kismayo eingenommen, verbreiteten
sich in Mogadishu Gerüchte, dass sich die UNIT AF mit dem Schwiegersohn des ehemaligen
Diktators gegen den Verbündeten Aidceds zusammengeschlossen habe (Hirsch/Oakley 1995:
76f$SI:illömll!Q6od4dj.analytischen Rückblick ist die eindeutige Beuneilung der Rolle der in
ternationalen Truppen in Kismayo auf Grund der unterschiedlichen Darstellungen der Ge
schehnisse in der Literatur unmöglich: Hirsch und Oakley, die beide in den 1980er Jallrcn
Ieiteode Positionen in der amerikanischen Botschaft in Mogadishu inne hatten und auch im
Rahmen der "Operation Restore Hope" hohe offizielle Stellen vor On bekleideten, berichten,
dass nach dem Vorfall vom 22. Februar sowobl Morgan als auch Jess ein Ultimatum gestellt
worden sei, sich aus Kismayo und Umgebung in verschiedene Richtungen zurückzuziehen;
beide Paneien seien dieser Au(forderung nachgekommen. Lyons und Sarnatar (Ober deren
Hintergründe ist mir leider nichts bekannt, außer dass Alunad I. Samatar ein gebürtiger Soma
li ist) dagegen schreiben, dass die Truppen von Colonel Jess bei dem Versuch, die von Mor
gan eingenommene Stadt zurückzuerobern, von belgiseben UN-Soldaten gewaltsam zurück
geschlagen worden seien (Hirsch/Oakley 1995: 77; Lyons/Samatar 1995: 56).
Die Frage, ob sich die internationalen Truppen tats ächlich auf die Seite von Jcss' und Ai
deeds Gegnern gestellt haben oder nicht, bleibt also ungeklän. Eindeutig ist jedoch ein gene
reller '"Stimmungswechscl" in Somalia im Frühjahr 1993 festzustellen: Der Frieden konnte
auf Basis der Verhandlungen mit den Mili:r.enfiihrern nicht gefunden werden; die UNIUS
Kräfte mussten zunehmend auf Maßnahmen der Friedensenwingung zurückgreifen. Dies
"' Traurige Berühmtheit trlangten die sog. ••technicals'". Dieser Begriffbczcichneo schwcrbcwaffnele Jeeps, dessen l.nsas"'n sich auf Raub und PIOndem spczialisicn hatten (Cassanelli I 996: 13: Marehol 1997: 20 1 ).
Copynghtcd ma riR
69
fUhrte dazu, dass die externen Friedenstruppen zu einer direkt in den Krieg der somatischen
warlords involvierte Konfliktpartei wurden.
5.3.3 VOM KRIEG MIT AIDEED ßiS ZUM ROCKZUG AUS SOMALIA
Im Zuge der Ereignisse in Kismayo kam es in Mogadishu tt:�eh Aufrufen Aideeds via Radio
zu Demonstrationen gegen und Angriffen auf dje internationalen Truppen durch Anhänger des
Kriegsherren. Dies war nur der erste gewaltsame Ausbruch eines schon lllngcr schwelenden
und immer bedrohlicher werdenden Antagonismus zwischen UNIT AFIUNOSOM und Ai
deed, der eine Führungsrolle im Bereich der zukünftigen somatischen Politik anstrebte, die
von dem internationalen Kommando nicht uneingeschränkt anerkannt wurde (Hirsch/Oaklcy
1995: 76-79; Stevensort 1993: 140; Compagnon 1998: 88).
Die USA kündigten ihren Rückzug aus Somalia !Ur Mai/Juni 1993 ao. Da jedoch aus Sich!
des UN-Gcneralsckn:Ulrs die Situation im Land noch keineswegs stabilisiert war, bemühte
sich Boutros-Ghali um die FortfUhruns der "Operation Restore Hope" unter UN-Kommando.
Zu diesem Zweck wurde am 26.3.1993 mit der Sicherheitsrats-Resolution 814 die Mission
UNOSOM II etabliert. Das sehr komplexe Mru1dat der 20.000 Soldaten. die von über I 0.000
logistischen und zivilen Helfern begleitet wurden, enthielt Aufgaben des "peacekeeping", des
''peace-a�forccmcnt" und des "pcacc-building".IJS Anfang Mai wurde das Kommando der
bumanilllrcn Mission offiziell von der UNIT AF an die UNOSOM n übergeben (Herrn1ann
1997: 129; Ramsbotham/Woodhousc 1996: 211}.
Die vom Sicherheitsrat festgelegten sehr weitreichenden Kompetenzen der UN-Truppen in
Somalia lösten Unruhe in der Bevölkenmg aus; die Einmischungen des internationalen Kom
mandos wurde zunehmend als Bedrohung empfunden (Bradbury 1997: 16). Dies war im Zu·
sammcnhang mit den oben erwähnten Spannungen zwischen Aidced und den inlemalionalcn
Kräften der Nährhoden filr den Gewaltausbruch in Mogadishu am 5.6.1993. Als pakistanische
UN-Soldatcn ein Waffenlager der SNA inspizjerten, das in der Niihc von Aideeds Radiostati
on "Radio Mogadishu" lag und somit die BefUrchtung bestand, die internationalen Solda1en
könnten auf dieses !Ur den warlord wichtige Propaganda-Zentrum übergreifen, kam es hier,
gleichzeitig aber auch an einem anderen Ort in Mogadishu, zu Angriffen auf die internationa
len Truppen; 25 UN-Soldaten wurden getötet und mehrere dutzend verletzt. Sowohl innerhalb
der UN in New York als auch von den US- und UN-Kommandaturcn vor Ort wurde Aideed
Copynghlcd malcria
70
und seine SNA-Fraktion rur die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Um des "Schuldi
gen'' habhaft zu werden, wurde eine Prämien• ausgeseczt; die �Kopfjagd" auf den Kriegsher
ren begann. Innerhalb ci.nes guten Jahres, seit den ersten Friedensverhandlungen unter UN
Oherhoheit im März 1992, war General Mohammed Farah Aideed von einem hofierten und
ernstgenommenen Partner der internationalen Gemeinschaft zurn Sinnbild des Bösen in So
malia geworden (Lyons/Samatar 1995: 57f; Zitclmann 1996: 273; Lcwis 1997: 193).
1n dem Zeitraum von Juni bis Oktober kam es zu mehreren schweren Gefechten zwischen
UNOSOM-Truppen und der SNA-Guerilla Aidceds; dabei starben Kämpfer aufbeiden Seiten,
aber auch Ober hwtdert somalische Zivilisten. Schließlich gelang es dem somalischen warlord,
die internationale Gemeinschaft in die Knie zu zwingen: Anfang Oktober kamen 18 amerika
nische Soldaten bei dem Abschuss zweier US-Hubschrauber um; anschließend wurde die Lei
che eines Amerikaners vor laufenden Kanteras durch Mogadisbu geschleifi und verstümmelt.
Die Bevölkerung in den USA war geschockt, und Präsident Clinton kündigte den Rückzug
aller amerikanischen Truppen bis zum 31.3.1994 an. Aideed wurde in Somalia nun auch Ober
die Grenzen seiner Anhängerschaft hinaus als Held gefeiert und konnte am 9.10.1993 als
"Sieger" die einseitige Einstellung der Feindseeligkeiten gegen die UNOSOM erklären. Ab
Ende 1993 begann der Abzug der amerikanischen und europäischen Soldaten. GestUIZt auf
pakistanische, indische ctc. Soldaten bemOhtcn sich die UN weiterhin um die Stabilisierung
der sozio-politischen Situation im Land. Im November und Dezember 1993 und im Frühjahr
1994 wurden noch einmal Friedensverhandlungen in Addis Abeba und Nairobi initiiert; Ai
dced war nun wieder "rehabilitiert". Docb auch diese Konferenzen blieben erfolglos und ver
kamen immer mehr zu Veranstaltungen, welche von den verschiedenen Milizenftlhrcr genutzt
wurden, um internationale Aufinerksamkcit zu werben und UN-Gelder einzustreichen (Mcnk
haus 1996: 4717561).
Schließlieb waren die andauernden Fehlschläge und die den peacekeeping-Truppen dro
henden Gefahren international nicht mehr zu rechtfertigen; die Mission wurde abgebrochen.
Bis Anfang Mllrz 1995 waren alle internationalen Interventionstruppen abgezogen: "Scattered
gunfire and looting, particularly near the airport, accompanied this final stage of UNOSOM 's
"' Die Konupte des "peae<-<nforcemcnt" und des "pe�ce-bwlding'' wurden in der "Agenda for Pellce" dargelegt und publik gemacht (Boutros-Ghali 1992: 26132-34; Ramshothan!Woodhouse 1996: 211).
'" Adibe sieht, gestUtzt auf Salmoun, in der Aussetzung einer Prämie auf die Ergreifung Aidceds einen schlimmen "cultural fnux pas" des intemationaltn Kommandos: "[ ... ) no one familiar with, and sensitive to the Somali culture would have promised So=lis [ ... ] money in cxchange for the dclivery of their 'brother' to a foreign army" (Adibe 1995: 102). Die UN benirdenen damit unfreiwillig Aideeds "lleldenstatus".
Copynghlcd m31cria
71
departure" (Boutros-Ghali 1996: 77). Insgesamt waren in Folge der Zusammenstöße zwischen
somatischen Bewaffneten und den UNIUS· Truppen ca. 6000 Somali und ca. I 00 internationa
le Soldaten ums Leben gekommen (Ramsbotham/Woodhouse 1996: 212f: Bradbury 1997: 17;
Lyons/Samatar 1995: 58-60; Lewis 1997: 180).
5.3.4 BEURTEILUNG DER INTERVENTION DER STAATENGEMEINSCHAFT
Die Intervention war hinsichtlich der selbst gesetzten Ziele, im ganzen Land Frieden 7.u schaf-
fen und stabile soziale, politische und ökonomische Strukturen zu etablieren, ein Fehlschlag.
Nur im Bereich der humanitären Nothilfe konnten Erfolge erzielt werden: Eine bctriichtliche
Zahl von Somali wurde vor dem Hungertod bewahrt; in dem offiziellen UN-Bericht zur Mis
sion am Horn von Afrika ist von ca. 250.000 gerelletcn Menschenleben die Rede. Teile der
Infrastruktur des Landes wurden wieder aufgebaut, fielen jedoch den anhaltenden Kriegshand
lungen und BeutezOgen schnell wieder zum Opfer (Boutros-Ghali 1996: 5184; Compagnon
1998: 85).
Der politische "top-down"-Ansatz des internationalen Kommandos hatte zur Folge, dass
der Blickwinkel der UNIUS-Politik sehr stark auf die Fraktion.�fiihrer als die "politischen
Reprasentanten" der somatischen Bevölkerung verengt war, die demnach auch die potentielle
FUhrungsschicht in einem wieder errichteten Zentralstaat darstellten. Die warlords wiederum
verstanden es meisterhan. aus dieser ihnen entgegengebrachten Aufmerksamkeit der interna
tionalen Gerneinschan Kapital zu schlagen. Die großzügig finanzierten und publicityträchti
gen Konferenzen dienten aus Sicht der Kriegsherren weniger der Sicherung des Friedens a.ls
dem Erwerb von internationaler Legitimität, die zum Ausbau der eigenen Machtposilion vor
Ort eingesetzt werden konnte. Zudem verschll:rfle der von den UN propagierte zentralstaatli
che Ansatz die Konkurrenz unter den Kriegsherren um die Kontrolle der herausragenden Posi
lionen.140 Die Verhandlungsstrategie der internationalen Gemeinschaft fllrdenen eher die Ge
walt als sie zu unterbinden. Alle erziehen Vereinbarungen wurden bald wieder gebrochen
(Bradbury 1997: 15; Mcnkhaus 1996: 610.
lm Zuge des geographischen "top-down"-.Ansatzes konzentrierte sich der internationale
Einsatz ausschließlich auf Zentral- und Südsontalia, und hier wiederum vornehmlich auf die
urbanen Zentren wie Mogadishu und Kismayo. Die Entwicklungen in Somaliland (siehe Kap.
6) wurden weitgehend ignoriert. Dennoch wurde der AnSPruch erhoben, den Frieden und die
140 Hier wird eine Parallele 7ll den Verhältnissen während der Parlamentswahlen 1969 deutlich: "Each warlord drcamcd of replacing Siyad Barre, and there can only be one central seat of power in a unituy country, intra-faction conflicts ensucd, reminisccnt but more deadly than those wittnessed in the highly competitive elections held in t969'' (Abdi I. Samatar 1992: 638).
Copynghlcd malcria
72
politische Ordnung in ganz Somalia wiederlterzustellen. Diese geographische Unausgewogen
heit des internationalen Einsatzes hatte zur Folge, dass der zumindest theoretisch weitrei
chendste politische Erfolg der Intervention, die Addis Abcba-Vereinbarungen über die Ein
richtung zentraler Regierungsstrukturen, ohne nennenswerte Beteiligung von Vertretern des
Nordens cm:icht wurde und die BcschlQssc von der Bevölkerung Somalilands abgelehnt wur
den (Bradbury 1997: 15; Lewis 1997: 1992).
Insgesamt lässt sieb erkennen, dass der internationale Einsatz in der sehr komplexen Situa
tion des BUrgerkriegs und des Staatszerfalls in Somalia in Be-lug auf die Aufgaben und Kom
petenzen sowie die Angepasstheil an die sozio-politischen Besonderheiten vor Ort ungenü
gend geplant und ausgertihrt wurde. Dies vcrurs.achte, gemeinsam mit der kompromisslosen
Haltung der warlords, die vor allem auf den Erhalt und den Ausbau der eigenen Macht be
dacht waren. das fast vollständige Scheitern der UNIUS-Int.ervention.141
Der Fehlschlag des Vorgehe-os der Staateng.emeinschaft in Somalia haue auch nachhaltige
Auswirkungen auf die internationale Politik: Die Grenzen der Macht der UN und der USA
wurden aufgezeigt. Die Niederlage in Mogadishu haue einen spürbaren Rückzug der UN und
besonders der USA, die als größter Beitragszahler der UN und ständiges Sicherhcitsratsmil·
glied großen Einfluss auf das peacekeeping-Engagement der Weilorganisation hat, von dem
Feld der internationalen Friedcnserzwingung Zllr Folge.142 "The cuphone optim.ism about tbe
rote of the United Nations tbat had developed in capitals worldwide inunediatcly aller tbe end
of the cold war gave way to greater realism and, for some of the world's leading powers, a
"' ln der Lit=tur >wrdcn, je n:u:h HintcrgJUnd, viele verschiedene Erklärungsansätze filr das Scheitern dargelegt: Die auf amerikanischer Seite in den internationalen Einsatt involvierten Autoren Hirsch und Oaklcy machen "die Som:ali" verantwortlich: "The Somalis lu!d been given every opportunity and assistanee to resolvc thcir differences and st:lrt rebuilding their count.ry but bad instead turned the other way, back to"oanl Vlolont struggle for personal political and faetional advant.ge" (Hirsch/Oaklcy 1995: 147). tn der nachlliiglichcn UN-Analyse wird sowohl die fehlende Kooperationsbercitsclu!ft der somatischen Milizenfllhrer als auch eigene Fehler, wie das unklare Mandat, die ungenOgende Koordination mililärischer und humanitaret Aufgaben, die mangelnden Hintergrundinformationen etc., herausgestellt (Boutros-Ghali 1996: 84-87). Der Ethnologe I.M. LewiS wiederum siebt das Hauptproblem in der Anwendung einer falschen politischen Strategie, die auf Unkenntnis des somalischen Kontextes beruhte: "While thus not pa);ng sufficient attenuon to gcnuinely representative local leadership, both the Americans and the UN lu!ve paid too mueh anention ( ... )to the 'wartords'" (Lewis 1993: 2).
'" Die Abneigung dagegen, noch einmal in einer unilberschaubaren Situation eskalierender Gewalt aktiv einzugreifen und das Leben amcrikanischcr Soldaten aufs Spiel zu setzen, wurde im Fall des Genozid in Ruanda auftragisehe Weise deu1tich (Press 1999: 5/2101).
Copynghtcd ma riR
73
dedine in coofidence in the Organization's ability to taclde comple.' pcacekeeping missions"
(Boutros-Ghali 1996: 84 ). "l
5.4 INTERNATIONALES EINGRED'EN AUF ZIVILGESELLSCHAFTLICHER EBENE
Das offizielle diplomatische und militärische Eingreifen internationaler staatlicher Akteure
wurde in Situationen des Staatszerfalls enorm erschwert, da sich die wichtigsten Angriffs·
punkte im Sinne des "Track One"·Ansatzes, Regierungen und staatliche Institutionen, wie
oben gezeigt, z.T. vollständig verflüchtigten. Im Folgenden sollen am Beispiel der zivilgesell
schaftlichen l.ntervention des .. Live & Pcace Institutes" (LPI)1'" die Möglichkeiten und Gren·
zen eines ,.Track· Two"-Ansatzes dargestellt werden.
Das LPir'Hom of Africa Prograr1mc" (HAP) wurde 1992 auf Anfrage des Sonderbcauf·
!ragten des UN-Generalsekretärs,Mohamed Sahanoun, von der Regierung in Stockholm als
Berater der UN vermittelt.14s Die Bemühungen der schwedischen NGO, die im Bereich der
Friedensforschung arbeitet, eignen sich m.E. aus drei Gründen als Beispiel fiir die Darstellung
einer zivilgesellschal\lichen Intervention:
I.) Das LPI kooperierte einerseits mit den UN; andererseits waren die Forschungen des ln·
stituts auf das Verständnis und die Nutzung der vorhandenen, gesellschallsimmanenten Poten
tiale der friedlichen Konfliktaustragung ausgerichtet. Somit stellt die Arbeit dieser NGO eine
"natUrlichc" Oberleitung zu Kapitel 6 meiner Arbeit dar, in dem auf die Friedensprozesse im
Rahmen der somatischen Tradition eingega ngen wird.
2.) Das Institut stand in engem Kontakt mit renommierten europll.iseben und nordamerika
nischen Somaliaspezialisten, wie I.M. Lewis. K. Menkhaus und B. Helander. Der Einsatz der
Organisation in Somalia basierte also auf soliden Hintcrgrundinformationen.
3.) Die Literaturlage ist im Falle des LPJ gut, da mit der Monographie des Ethnologen W.
Heinrich ein ausfilhrlicher Bericht über die Arbeit des Instituts in Somalia vorliegt. Ein weite·
rer Evaluationsbericht wurde von B. Helander, M.H. Mukhtar und I.M. Lewis auf Basis einer
Feldstudie des somafischen Historikers Prof. Mukhtar ausgearbeitet. Während der Fokus von
••• Lewis fasst die Auswirkungen der gescheiterten Sormliaintervention auf die globole politische Ordnung der 1990er Jahre leger aber treffend so zusammen: ·Thus the New World Order Ooundercd and perhaps foundercd in the mcan strcets ofMogadishu .. (Lewis 1997: 180).
'"' Das Institut mit Hauptquartier in Uppsala wurde: 1984 auf Initiative schwedischer Kirchen gegründet und beschiifligte Mitte d<r 1990<r Jahre insgesamt acht feste Mitarbeiter in Schweden, Kenia u.nd Somalia. Das LPI gibt die Publikation �Horn of Africa Bulletin" heraus (Heinrich 1997: 31 f).
Copynghtcd malcria
74
Heinrichs Arbeit auf Mogadishu und Hatgeisa sowie auf die Regionen Bari, Nugal (Norden)
und Godo (Südwesten) gerichtet war, konzentrierte sich Mukthar auf die Bay- und Bakoolrc
gion im zentralen Süden.
5.4.1 DIE ZIELE UND STRATEGIEN DES LPI "Ratlttr, our roJe ltas b«n IQ lrtlp, swpport and fnciliate tlte peop/ts irr tht Horn as they th�msci"',.S art searcJt. lngfor wtzyl lt> sol•·• •Adrown conjlicu " (Normarl: 1997: /).
Der Fokus des Instituts war nicht, wie die Intervention der UN, auf die Erreichung offizieller
Abkommen zwischen den exponierten Kri�arteien, sondern auf die Schaffung einer breiten
und stabi.len zivilgesellschaftlichen Basis filr den Frieden gerichtet. Die wichtigsten Bezugs
punkte des LPI waren traditionelle Autorilliten, Intellektuelle und diverse soziale Gruppen vor
Ort. Im Rahmen der Strategie des �community-based pcaccbuilding", verbunden mit "institu
tion-building'', stand zunachst die lokale Ebene im Vorderg1Und; bier sollten möglichst früh,
nicht erst, wie es den aktuellen Konfliktphasen-Theorien der Konflikt- und Friedensforschung
entsprach, nach dem Abschluss eines offiziellen Waffenstillstands (Heinrich 1998: 58), Struk·
turcn verantwortlicher Selbstverwaltung aufgebaut werden. Durch die Multiplizierung und
Vernetzung der FriedcnsbemOhungcn in begrenzten Gemeinschaften sollte Schritt filr Schritt
ein nationaler Versöhnungs- und Friedensprozess eingeleitet werden. Insgesamt kann diese
Strategie als "bottom-up"-Ansalz zusammengefasst werden (Heinrich 1997: xiflxxiiif).
5.4.2 DER EINSATZ DES LPIIHAP IN KOOPERATION MIT DEN UN
In der Zusammenarbeit mit der UN Obernahm das LPI Beratungs-, Trainings- und "fund rai-
sing"-Aufgaben außerhalb und iMerhalb Somalias; das Institut war allerdings, mit Ausnahme
der materiellen Unterstützung der lokalen und nationalen Friedenskonferenzen, nicht in Soma
liland tätig (Heinrich 1997: xvf/25/97-103). Im August 1992 fanden die ersten Konsultationen
zwischen UN, LPIIHAP und Somalia-Experten unter Vorsitz von UN-Botschaftcr Sahnoun
und Sture Norrnark, dem Direktor des LP\/HAP, statt. An einem weiteren Treffen im Oktober
nahmen erstmals auch Angehörige verschiedener somalischer Klans teil. Die Diskussionen
beider Zusammenkünfte konzentrierten sich auf die Sondierung des soziokulturellen Umfel
des in Somalia mit dem Ziel, lokale Akteure, insbesondere tradilionelle Autoritlitcn, aber auch
"' Anfangs konzentri<rte sich die Titigkeit cks Instituts auf Sudan und Äthiopicn. Im Jahr 199t begann die Bcschlf\igung der schwedischen NGO mit der Situaton in Somalia (Heinrich 1997: 33-36).
Copynghtcd m31cria
75
Händler, warlords etc .. in die UN-Arbeit einzubinden. Des Weiteren wurde empfohlen, keine
militärische lmervention durchzufllhren und den externen Ressourcentransfer so weit wie
möglich zu vermindern, da der HOhepunkt der Hungerkatastrophe Ende 1992 vorbei war und
der Ressourcenzufluss sich im Kontext der somatischen "Plünderungs-Ökonomie" kriegsver
längemd und konfliktvcrsch!\rft'lld auswirken konnte (Heinrich 1998: 5 1-56). Mit dem Ende
der UN-Tätigkeit Sahneuns im OJ.:tobcr 1992 sanken die Chancen, den bisher forcierten "bot
tom-up"-Ansatz weiterhin effektiv auf UN-Ebene einbringen zu können. Dennoch wurden im
weiteren Verlaufder Zusammenarbeit zwischen UN und LPI bis Juni 1994 noch filnfwcitere
dieser Treffen abgehalten. deren wechselnde Teilnehmer die sog. "Refcrcncc Group" bildeten;
in den Diskussionen wurden die Strategien der UNOSOM z.T. stark kritisiert (Heinrich 1997:
40/56).
Das LTP/HAP assistierte der UNOSOM bei der Planung und Durchfllhrung der Addis Abc
ba-Konferenzen Anfang 1993, wobei die NGO besonders auf die Teilnahme von zivilen Ak
teuren bedacht war. die nicht direkt mit den verschiedenen warlords verbundenen waren. Das
besondere Augenmerk des LPI galt der Förderung von Frauen. die in der somatischen Gesell
schall nur wenig politische Mitbestimmungsrechte hattcn.146 So vcrnnstaltctc die NGO beson·
dere Workshops fllr Frauen, die deren Teilnahme an den regionalen und nationalen Friedens
und Wiederaufbauprozessen ermöglichen sollten. ln der Folge der Addis Abeba-Bcschlüssc
war es ab Sommer 1993 bis zum Ende des UN-Einsatzcs im April 1995 die Hauptaufgabe des
LPI/HAP, die Einrichtung von "District Councils". also der untersten Verwaltungsstrukturen
eines unter der Aufsicht der UN wiedcrzucrichtenden somatischen Staats, voranzutreiben.
Entsprechend der Vorgaben der UNOSOM sollte die regionale Verteilung dieser Verwal
tungsbüros der bis zum Ende der HerrschaR Siyud Barres existierenden Distrikts-Ordnung
entsprcchcn.''7 Von einem UNOSOM-LPI/HAP-Teant wurden die Gemeinschallen eines
Distrikts auf einer öffentlichen Versammlung über die Addis Abcba-Beschlüsse infom1iert
und aufgefordert, Uber die Einrichtung eines Cotutcils zu beraten. Nach einigen Wochen fan
den weitere Besuche statt, um das lokale Votum zu erfahren und, bei einem positiven Be
schluss, die weitere Einrichtung eines Verwaltungsbßros unter Leitung der von den Gemein
schallen ausgewählten Repräsentanten zu begleiten. Die schwedische NGO veranstaltete in
Zusammenarbeit mit dem "Southem nnd Eastcm Africa Management Institute" (ESAMO
'" Dcnnocb spielen Frauen in traditionellen Vc:nöhnungsprozessen eine wichtige Rolle; siehe Abschnin6.4. 141 Es handelte sich also nicht um traditionelle Strukturen. Oaran knOpfk die Kritik vieler NGOs und der Somoliacxpertcn an (siehe 5.4.3 sowie Heinrich 1998: 58).
Copynghtcd malcria
76
Trainingskurse filr die Träger der lokalen Verwaltwtg zu verschiedenen Themen, wie ''good
govemancc", "development management", wfinancial managemenr". und organisierte mate
rielle wtd finanzielle Hilfe fUr die Einrichtung der Büros (Heinrich 1997: 37-59; dcrs 1998:
59; Helander/Mukbtar/Le";s 1995: 9).
5.4.3 EVALUATION PER BEMÜHUI'iOEN Ikr Bericht voa W. Helarlch: Heinrich fasste auf Basis von Hintergrundliteratur den Ver-
lauf des LPI·Engagcmcnts zusammen. Anschließend bewertete er die Arbeit des Instituts auf
der Grundlage von Interviews, die im Frohjahr 1996 innerhalb und außerhalb Somalias durch·
gefUhrt wurden; dabei standen Fragen nach den lokalen Beziehungen zwischen den Concils
und traditionellen Autori tälen, Gerichten etc., nach den Verbindungen der Concils zu interna
tionalen Akteuren, wie NGOs, und nach den friedlichen Entwicklungen auf lokaler und ge
sarntsomalischer Ebene im Mittelpunkt (Heinrich 1997: 21 0). Die Auswertung der mit Somalis vor Ort gcfUhrtcn Interviews ergab: Das vom LPI in Ko·
opcration mit den UN durchgefUhrte Projekt der Etablierung von grundlegenden lokalen Ver
waltungsstrukturen in Eigenverantwortung der Kommunen stieß iMerhalb Somalias weitge
hend auf Zustimmung. Besonders die Trainingsprogramme des LPI wurden sehr positiv
aufgenommen. Der Erfolg dieses "bonom-up"-Ansatzes zeigte sich auch darin, dass viele der
ab I 993 eingerichteten Distriel Councils auc:h nach dem RUckzug der UN bestehen blieben
und die Etablierung weiterer Verwaltungsbüros von der Bevölkerung vor Ort angestrebt wur
de. Die meistgenannten Schwli<:hen der Councils waren die Handlungsunfllhigkeit auf Grund
fehlender Ressourcen und die ungenügende Koordination der lokalen Zuständigkeiten zwi
schen Councils und traditionellen Autorit!Uen, Polizeikräfien, externen und internen NGOs
etc. (Heinrich 1997: I 19). Die Verwaltungen sollten entsprechend dervon der UNOSOM aus
gearbeiteten Richtlinien umfassende politisclte und administrative Kompetenzen vor Ort ha
ben. Dieser Ansatz ignorierte, wie die Ausfilhrungen von Helander, Mukhtar und Lewis (s.u.)
zeigen, die tatsächlichen politischen Verbälmisse vor Ort. In diesem Zusammenhang stellt
sich z.B. die Frage. inwiefern es möglich und siMvoll ist, informelle Auioritäisstrukturen zu
formalisieren und somit besser in die Arbeit von Distriel Councils zu integrieren. Zum Zeit·
punkt von Heinrichs Analyse waren viele Di.strict Councils wtd Älteste pragmatische Verbin
dungen eingegangen, innerhalb derer z.B. die traditionellen Autoritäten als Legislative, die
Councils als Exekutive fungierten. Heinrich empfahl, die nur vage vereinbarten Zustandigkei-
Copynghtcd ma riR
77
ten zu klären, um zukünftige Interessenkonflikte zu vermeiden (Heinrich 1997: 104-124;
1481).
Die Ergebnisse der Gespräche mit externen Akteuren, wie ausHindiseben NGOs, UN-Staff,
Exilsomali und Somaliaexpenen, waren sehr unterschiedlich und insgesamt sehr viel kriti
scher als die Sicht der innersomatischen lnterviewpartner. Einige zentrale Kritikpunkte sollen
hier herausgestellt werden:
1.) Viele NGOs kritisierten, dass UN und LPl andere Akteure in Somalia nur unzureichend
über ihre Arbeit informierten. Die Distriet CoWJeils gahcn zudem oft als den Somnli von au
ßen aufgezwungen; demnach wurde ihre Legitimität in Bezug auf die Repriisentation der loka
len Bevölkenmg in Frage gestelh.
2.) Viele Somaliaexperten schlossen sich der Kritik der NGOs hinsichtlich des Problems
der legitimen Repräsentation an. Der im Rahmen des begrenzten UN-Mandats vorgegebene
Zeitrahmen fllr die Etablierung von lokalen Verwaltungsstrukturen wurde unter Verweis auf
die zeitintensiven Entscheidungsfindungsprozesse unter somatischen Gruppen als zu eng filr
den Aufbau stabiler lnstitulionen angesehen. Das Konzept gah insgesamt als zu statisch; unter
der Zielvorgabe der UN, eine einheitliche Verwaltungsstruktur aufzubauen, konnte kaum auf
die Besonderheiten der lokalen Verhältnisse eingegangen werden.
3.) Innerhalb der UN wurde die Einrichtung von Distriel Councils zwar als mögliche Basis
einer zukünftigen Staatsverwaltung angesehen. Das Hauptaugenmerk galt jedoch den Ver
handlungen mit den militärischen FUhrern auf den großen Friedenskonferenzen. Dies kam
dotin zum Ausdruck, dass die Umsetzung der ••bottom·up"-Stratcgie einer externen Organisa
tion, dem LPl, anvertraut wurde und innerhalb der UN nur wenig Mittel für die Einrichtung
der lokalen Verwaltungsbüros bereit gestellt wurden (Heinrich 1997: 125ff).
Zusammenfassend erkennt Heinrich mit Blick auf die Arbeit des LPI in Kooperation mit
den UN zwei Phasen: ln der ersten Phuse bis Frilhjahr 1993 bemilhtc man sich, im Rahmen
eines von dem UN- Repriisentanten Mohamed Salmoun mitgetragenen "two track"-Ansatzes,
der staatliche und zivilgesellschaftlich Strategien miteinander verbinden sollte, sowohl auf
höchster politischer Ebene, unter Einschluss der Fraktionsfllhrer, als auch auf Ebene der loka
len Gemei.nscbaflen zu agieren. Das LPI baue vornehmlich beratende Funktionen und erleich
terte Konsultationen zwischen den UN und zivilen Akteuren vor Ort. Die Arbeit der NGO
kann in diesem Zeitraum hinsichtlich des selbst gesetzten Ziels, die Bevölkerung vor Ort in
den Friedensprozess zu integrieren, als sehr erfolgreich angesehen werden. Im Sommer 1993
begann die zweite Phase, in der sich das LPl entsprechend der Vorgaben der UN um die lmp-
Copynghled matcria
78
lcmentierung der in Addis Abeba vereinbarten regionalen Verwaltungsstrukturen kümmerte.
Im Vergleich zur ersten Phase der Zusammenarbeit war die NGO nun wesentlich stärker UN
Vorgaben abhl!ngig. Die Chancen, die staatliche Intervention im Sinne eines zivilgesellschafi
lichen Ansatzes zu beeinflussen, gingen zurilck. Dies wirkte sich besonders negativ auf die
informell strukturierte "Refcrcnce Group" aus: Deren Ratschläge waren fUr das LPI von gro
ßer Bedeutung. während die Hinweise dieses Berntungsgremiums auf UN-Ebene nur wenig
Gewicht hatten (Heinrich 1997: 136-144). Der Erfolg des LPI-Engagements in dieser zweiten
Phase ist sehr umstritten. Die existierenden "District Councils" waren zum Zeitpunkt der Eva
luation 1996 bezOglieh ihrer effektiven Arbeit vor Ort mit schwerwiegenden Problemen kon
frontiert.
Die Studie kommt zu dem Schluss. dass trotz der zwiespältigen Bewertung der Arbeit des
LPf in Kooperation mit den UN der auch nach dem Ende der UN-Mission weiterverfolgten
Ansatz des "community-based pcaccbuilding", ausgebend von lokalen Trainingsprogrammen
ftk zivile Akteure, einen positiven Beitrag zur Stabilisierung der lokalen Verhältnisse in So
malia leisten kann. Allerdings sollte die Arbeit des Instituts besser mit internen und externen
zivilgesellschaftlichen Akteuren koordiniert werden (Heinrich 1997: 176-182).
Der Bericht von Htlander, Mukhtar und Lewls: Mukhtar fllhrte z;wischen Juli und Sep
tember 1994 eine Feldstudie durch, um zu untersuchen, inwiefern die Distriel Councils der
Artikulation lokaler Bedürfnisse und de.r KonOiktlösung vor Ort dienten, welche Rolle traditi
onelle oder andere spontane Friedensinitiativen in den Distrikten spielten, wie sich die Bezie
hung zwischen UNOSOM und den Regionalverwaltungen gestalteten und ob die Councils
auch nach dem Abzug der UNOSOM Bestand haben könnten. Der Untersuchungsfokus
schloss das weitere soziopolitiscbc Umfeld in den Regionen mit ein. Mukhtar interviewte so
wohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder der lokalen Verwaltungen (Helan
der/Mukhtar!Lewis 1995: 2f).
Im Gegensatz zu Heinrichs Studie werden die Ergebnisse hier nicht nach Interviews aufge
schlüsselt, sondern nur zusammengefasst dargestellt. Helander, Mukhtar und Lewis kommen
zu folgenden Ergebnissen: Bei der Einrichtung der DCs wurden weitgehend die lokalen sozi
opolitischen Strukturen und die damit verbundenen Entscheidungsfindungsprozessc berück
sichtigt. Oie Councils wurden meist von der Bevölkerung akzeptiert und waren somit reprä
sentativ. Allerdings spielten die Councils hinsichtlich der lokalen und regionalen politischen
Entwicklungen nur eine periphere Rolle, da es in den Zeiten des Bürgerkriegs auf lokaler
Copynghtcd m31cria
79
Ebene zu starken Zersplitterungen entlang der Klanidentität gekommen war 148 Zusammen
schlüsse zwischen den verschiedenen Klans, wie das 1993 in der Bay-Rcgion von den .Führern
der Merifte- und Digit-Klans gebildete "Comminee of Clan Chiefs"f'Guddiga Malaqiiyada"
(GM), waren somit wesentlich einflussreicher als die Distriel Couneils hinsichtlich der Auf
rechterhaltung der politischen Ordnung und des Friedens vor Ort. ln diesem Zusammenhang
spielten auch islamistische Gruppen und Händlergemeinschaften eine große Rolle. Nur im
Bereich der Vermittlung von liN-Gcldem fllr lokale Projekte. die vonjedem Einwohner eines
Distrikts vorgeschlagen werden konnten, waren die Councils tatsäeblich gefragt und somit
sehr aktiv. Die Autoren stellen die Bemühungen um die Etablierung von lokalen Distriel
Councils in Frage: "The local administmtion. of disputes, resources and social afTairs are
firmly in the hand ( of] intra-clan insritutions at various Ievels. Inter-clan cooperation is in
crcasingly a matter that is handlcd outside the local communities" (Helander/Mukhtar/Lewis
1995: I I). Helander, Mukhtar und Lewis sehen die Gefahr, dass die Distriel Councils in Kon
kurrenz zu den zwischen den Klans vereinbarten Strukturen geraten und somit Konflikte ge
neriert werden (Helander.'Mukhtarllewis 1995: 5-1 1).
5.4.4 QUEllENKRITISCHE ANMERKUNG
Abschließend soll angemerkt werden, dass beide Studien in Zusammenarbeit mit dem LPI
erstellt wurden. Während allerdings Helander et al. ihre Arbeit, zumindest in der mir vorlie
genden Version. unabhängig vom LPI veröffentlichten, wurde Heinrichs Studie, die in BCZ\Ig
auf die letztendliche Bewertung des "bonom-up"-Ansatzes wesentlich unkritischer ist als der
erstere Rcpon. vom LPI herausgegeben. Somit mUssen aus quellenkritischer Sicht Vorbehalte
bezüglich der oben referierten Evaluation Heinrichs bestehen bleiben. Diese Annahme wird
durch einige kritische �merkungcn von Lcwis bcslätigt, der dem LPI ''Profilicrungssueht"149
und "Eurozentrismus"1so vorwirll. Auch zwischen den Positionen Heinrichs und Brndburys
werden Diskrepanzen erkennbar: Heinrieb stellt fest: "The fact thal in many arcas ofSomalia
, .. "The clan Je"" I of identity has assumed a signiiicancc it probably never held in the past and 'true descent', r:1ther than adopted onc has comc to bc the 1diom by which communities establish themscl\'es" (HelanderiMukhtar/Lewis 1995: 6).
, .. ''But aller Sahnoun resigned over his disagrcernent with tho: UN bureaucracy ( ... ], the Life and Peace Institute becamc more closcly involvcd with the political wing of UNOSOM. and clearly interested in high profile activity, the roJe or the 'referenee group', in my opinion, largely deteriorated into that of rductanl and sometimes unconsdous ltgitimation" (lewis 1999b: xvii).
,,. "lt also scemed to me that. in common with olher well-intentioned e.,temal cbampions of peace. the activities of the Life and Pc.acc Institute were cxcessively Eurocentric and, partlcularly ini·
Copynghlcd matcria
80
the councils have survived and continued to function ( ... ) clearly indicates that LPI was suc
cessful bolh in sparldng a sustainahle indigenous process of peacebuilding and in establishing
the foundations of accountable and lhereby legitimized administrations" (Heinrich 1997: 182).
Bmdbury dagegen schreibt: "UNOSOM's anempts to create civil administrations in southem
Somalia foundered wben communitics failcd to accept tbeir legitimacy" (Bradbury 1997: 38).
Diese WidersprOcbe in der Bewertung der Arbeit des LPI können hier nur angedeutet, jedoch
nicht aufgelöst werden.
5.5 GENERELLE ÜBERLEGUNGEN ZU INTERNATIONALEN INTERVENTIONEN Sowohl "Track One"- als auch "Track Two"-Jnterventioncn stellen eine folgenschwere Ein
mischung in die vorhandenen Strukturen dar und können sich vor On negativ, z.B. konßikt
ve.rschärfend, auswirken. Unvermeidlich werden bestimmte Interessen geforden, andere zu-
11k:kgedr'.ingt. Dies bringt die Gefahr der Jnstrumentalisierung mit sich, die umso größer ist, je
mehr materielle und machtpolitische Ressourcen durch die Intervention mobilisiert werden.
Eine genaue und differenzierte Analyse der Lage vor On, unter Einbezug der historischen und
kulturellen Rahmenbedingungen, muss somit. am Beginn einer jeden Intervention stehen
(Heinrich 1998: 49).
Ein Vergleich der oben gegebenen Beispiele von zivilgesellschaftlichen und staatlichen In
terventionen zeigt: Zivilgesellschaf\Jiche Interventionen genießen ein größeres Maß an Hand
lungsfreiheit, da relativ ungehindert von politiS<:hen Vorgaben verschiedene Optionen verfolgt
werden können. Der ,.Track Two"-Ansatz c:nnöglicht. auf Grund seiner Offenheit gegenüber
sehr vielen verschiedenen, auch informellen, I:nformationsquellen, eine differenzierte Heran
gehenswe.ise an lokale Probleme. Eingriffen oicht-staaJiicher Akteure mangelt es jedoch in
vielen Fällen an finanziellen und materiellen Mitteln sowie politischer Durchsetzungskraft.
Nicht selten mUssen, wie am Beispiel der Arbeit des LPI in Somalia deutlich wurde, inhaltli
che Kompromisse eingegangen werden, um diese Schwächen in Zusammenarbeit mit staatli
chen Akteuren auszugleichen.
Staatliche Interventionen dagegen sind schwerllllig und beruhen aus kulturwissenschaßli
cher Sicht auf einer sehr oberflächlichen Wahrnehmung der Situation,151 da sie offiziellen
tially, did not take sufficient account of the Somali techniques of peace·making wbich were brought to lheir attenlion" (Lewis 1999b: xviii).
'" Boutros-Ghali selbst weil darauf hin: ''Beuer in formation and analysis in advance are needed. and to this end lhe United Nations should elict inforrruuion from Mcmber States, regional organ•xations, NGOs and academic cxperts. ln the case of Somalia. such consultations did not take place
Copynghtcd ma riR
81
Formalien genügen sowie politischen und zeitlichen Vorgaben folgen mUssen. Lokale Beson
dcrheitw werden im Rahmen des inhaltlich sehr begrenzten .,Tmck One"-AllSalzcs Ieichi ü
bergangen. Im Bereich der finanziellen und machtpolitischen Ressourcen sind die EingriiTe
auf Ebene der internationalen Politik den zivilgesellschaftlichen Interventionen überlegen.
Militärische wld materielle Potenz kann sich jedoch, wie das Beispiel der internationalen hu
manitären Intervention in Somalia zeigt, auch negativ auswirken und zur weiteren Eskalation
einer Krisensituation beitragen (Wind fuhr 1999: 761-763 ).
Insgesamt muss festgestellt werden. dass die Krise in Somalia durch das internationale Ein
greifen aufzivilgesellschaftlicher und politischer Ebene nicht becndet werden konnte: �[ ... ) in
February 1995, militia continued to hold sway over much of the country. There was no
national govcrnment. no state; but thcrc was no Iack of military and civilian authority at thc
local Ievel" (Press 1999: 216).
until aftcr tlu: opcra110n w11s alrcady weil undcr way" (Boutros-Gh:!li 1996: 85). Hier lässt sieb ein Widmpruch erkennen: Wie oben gcuigt. fanden schon vor dem Beginn der humanitJrcn lntcrvcntioo im Dezember 1992 Konsultationen mit dem LPI und Solll31iae�pertcn statt, dc:n:n Empfehlungen nicht bcochtet wurden.
Copynghlcd malcria
82
6 DIE LOKALE EBENE
ln diesem l<Bpitel wird darauf eingagangen, wie auf lokaler Ebene mit der Situation des ßUJ.
gerkriegs und des Staatszerfalls umgegangen wurde und welche Rolle die in Kapitel 2 darge
stellten Traditionen, besonders die Ansätze der friedlichen Konfliktaustragung im Rahmen
von shirs, in den 1990er Jahren spielten. Die soziopolitischen Entwicklungen abseits oder am
Rande der extemen Interventionen sind im Bereich Somal.ilaods im Nordwesten gut dokumen
tiert, lassen sich aber auch in Nordost· und Sildsomalia verfolgen.
6.1 DIE ENTWICKLUNGEN IN SOMALILAND
Ali Mahdis provisorische Regierung in Mogadishu wurde im Februar 1991 ohne Zustimmung
der SNM etabliert. Besonders die Isaq werteten dies als Zeichen dafllr, dass auch nach dem
Sturz des Militllrregimes der Süden die Vorherrschaft in Somalia beanspruchte. Die SNM
hernahte sich darum, politische Distanz zu Mogadishu aufzubauen, um die befllrchtctc Domi
nation zu vermeiden und um nicht in die im SUden eskalierenden Kämpfe der warlords ver
strickt zu werden. Damit war auch die Hoffuung verbunden. dass ein stabiles Somaliland in·
tematiooale Hilfsgüter anziehen wUnle (Hcyer 1997: 12; PlliOier 1994; 62f).
Im Februar kamen Vertreter der Klans der Regionm aufeinem ersten großen shir in Bcrbe·
ra zusammen, um die kriegsbedingten Spannungen zwischen den verschiedenen Verwandt·
schaftsgruppen abzubauen. Im Mai fand die '"Grand Conference of thc Northem Peoples" in
Burco (Zentral-Somaliland) statt. GestUtzt auf die Zustimmung der Teilnehmer dieser Konfe
renz rief die SNM-FUhrung am 18.5.1991 die Eigenständigkeil der "Republik Somaliland"
aus. Dieser Schritt wurde von der internationalen Gerneinschaft stark kritisiert; die Republik
Somaliland wird bis heute von keinem Staat der Welt aneri<annt (Compagnon 1998: 82; Brad·
bury 1997: 18; Prunier 2000: 1-3).
ln der Interpretation der SNM-Fabrung war die Ausrufung der Unabhängigkeit Somali·
Iands in den Grenzen des ehemaligen britischen Protektorats kein Akt der Sezession, sondern
die Auflösung der seit Juli 1960 bestehenden Union eigenständiger Staaten, deren Grenzen
auf Grund der unterschiedlichen Kolonialverwaltungen Nord- und Sildsomalias festgelegt
WdrCO. Damit wurden im Nachhinein die im Zeichen der "'Greater Sonutlia"-Pol.itilc: Ober Jahr
zehnte bekämpften kolonialen Grenzen anerkannt (Brons 1993: 21f; Lewis 1994: 229).
'" In Somalilond leben neben den lsaq auch Angehörige der Dir· (Gadabursi und lisn) und Oarod· Klan-Familien (Dulbahante, Warsangeli, Majerteyn und Ogaden) (Farnh/l.ewis 1993: 12!).
Copynghtcd ma riR
83
6.1.1 DER FüHRUNGSANSPRUCH OER SNM "ScmolilunJ bnt�fit:s from tl:c abscnC<' of major warlords comJH:.Ii"gfor po .. o•tr on rite dcva.sting saJie currenl in
soutlrun SomtJiia" (Lewis 1997: 186).
Die Geschicke Somalilands wurden seit Ende des Ogaden-Krieges immer starker von der
SNM beeinflusst. Diese Guerillabewegung wurde weitgehend von lsaq. der größten Klanfami
lie des Nordwestens, getragen und verfl!gte somit über eine enom1e verwandtschaftlich be
gründete Machtbasis. Brons betont, dass die Berufung der SNM auf den Islam ein wichtiger
Faktor flir den Rückhalt der bewaffneten Opposition unter der Bevölkerung war (Brons 1993:
24/27). Dies konnte jedoch von Prunicr, der sich Anfang I 990 im lsaq-Gcbiet aufhielt, nicht
bestätigt werden.m Dazu ist anzumerken. dass in den Zeiten des BUrgerkriegs die Oberregio
nale politische Integrationskraft des Islam in dem genealogisch fraktionierten Umfeld Somali
as als gering einzuschätzen ist.'�
Ihren alleinigen Führungsanspruch in der Region konnte die SNM erst ab 1988 durchset
zen. In den letzten drei Jahren der Herrschaft Barres, die von umfassenden grausamen Repres
salien des Militärs gegen die Bevölkerung Somalilands geprägt waren. gewannen die expo
nierten Ami-Regime-Kämpfer slark an ldcntilikationskraft. DeMoch fUhnen die Isaq auch
inne.rhalb des Nordwstens Krieg gegen andere Verwandtschaftsgruppen, die, wie die Gadabur
si- und Dulbahante-Kians, auf Seiten Barres standen oder. wie der Ogadcn-Kian, traditionell
mit den lsaq verfeindet waren. Anfang 1991, unmittelbar nach der Flucht Barres aus Moga
dishu. hatte die SNM als st11rkstc Gruppe die Vorherrschaft in Somaliland errungen. Nach
ihrem Sieg sahen die lsaq jedoch weitgehend d.avon ab, Rache an ihren Gegnern zu üben. Die
SNM-Führung bemühte sich, die Situation durch die Einberufung des oben erwähnten großen
shirs in Bcrbcra zu beruhigen. Ocr Führungsanspruch der SNM war somit. im Unterschied zu
den Gewaltherrschaften der warlords und Klanmilizen im SOden.' 55 in der traditionellen Ge
sellschaftsordnung veranken (Brons 1993: 270'33; Prunier 1990/91: 1 15f; ders. 1994: 62;
Compagnon 1998: 82).
'" "Much has bcen made of the supposcd 'lslwnic fundamenllllism' of the SNM bccausc it has • Alahu Akbar' written on its !lag and becousc somc joumahsts thought that. these dllys, it would make good copy. [ ... ) To the bcst of my knowledgc. whatcvcr lslamic rundamentalist stmin exists within the SNM is dcfinitcly a minority trcnd" (Prunicr 1990/91: 109).
'" So schreibt der Journalist Mauro Merosi: "A Hawiyc fundamentalist in Somaliu tS (and will bc for a long time) considcrcd with suspicion by a Darod fundamentalist. Thcy share the same faith and t.he same political airns: but thcy cannot forgct their different gcnealogics" (zitiert nach Prunicr 1996: Sf).
lll "[ ... ) southcm Somalia was (and largcly rcmains) under conquest and occupation by warring clan militios, nonc of which havc lcgitmJatc historical claims on thc citics and agricuhural land ovcr which they have fought" (Mcnkhaus 2000: 191 ).
Copynghtcd malcria
84
Dennoch war der Frieden in Somaliland noch lange nicht wiederhergestellt: Der Alltag war
in Folge der zehnjährigen Auseinandersetzungen mit Barre von ökonomischem und sozialem
Zusammenbruch geprägt. Nach der Unabbiingigl<eitserklärung Somalilands bestand das größte
Problem fllr die SNM, die weder über ausreic�hende finanzjelle Mittel noch Uber die nötige
Infrastruktur fllr die Ausübung effektiver Verwaltung verfiigte, darin, die eigenen schwer be
waffneten Truppen wieder unter Kontrolle zu bringen und zu entwaffnen: ., Warfare [bad be
come] a way oflife, and the automatic rille a rneans ofliving" (Compagnon 1998: 80).116 FUr
die Relc.onstruktion einer friedlichen Ordnung war die Reduzierung dieses enormen gescll
schaffiiehen Gewaltpotentials notwendig.
6.1.2 DIE ÜBERGANGSREGIERUNG UND DER ROCKGRIFF AUF TRADmONELLE STRUKTUREN
Die fllr zwei Jahre eingesetzte Übergangsregierung der Republik Sornaliland mit Sitz in Hat-
geisa, an deren Spitze der Präsident Ahdurahman Ahmed Ali Tuur (lsaq) stand, stUtzte sich
stark auf die personellen und organisatorischen Strukturen der SNM. Dennoch bemUbte man
sieh, durch die Beteiligung von Vertretern der anderen nördlichen Klans eine repräsentative
politische Basis zu schaffen (Brons 1993: 28135; Bradbury 1997: 19; Prunier 1994: 64). Um
die soziopolitiscbe Situation in Sornaliland zu stabilisieren und so interne und externe Res
sourcenflOsse in Gang zu bringen, die fiir den weiteren Aufbau der Region benötigt wurden,
griff die Regierung auf das Ordnungspotential tr3ditioneller Autoritäten zurück. Ein "Guur
ti"1s7 genannter nationaler Ältestenrat wurde einberufen. um Klankonflikte zu schlichten.
Doch der weitere Aufbau der soziopolitischen Strukturen wurde durch zahlreiche "alte", noch
in der Zeit der Barre-Herrschaft und davor wunelnde. und "neue", in Folge des Bürgerkriegs
aufgekommene, Konflikte innerhalb und zwischen den verschiedenen VctWandtschaflsgrup·
pen der Region behindert (Farah!Lewis 1993: J0-54; Compagnon 1998: 82f; Bradbury 1997:
19). Der Regierung Ali Tuurs gelang es nicht, die interne politische und ökonomische Situati-
"• Dieses Zitat bezieht sich bei Compagnon auf die Situation in Somaliland um das Jahr 1991 und markiert den Übergang von Klmpfen entlang von Klanzugehörigkeilen hin zu den gemeinsehafllichcn Bemllhungen um friedliche Konfliktaustragung und Rekonstruktion der sozio-politischcn Ordnung. Die Banden jugendlicher Plünderer, die sich um die großen Slldte zus•mmenzogen, konnten nun nieht mo:hr auf die Unterstlltzung durch ihre Verwandtschansgruppen rechnen (Compagnon 1998: 80).
'" Dieser Begriff, der sich sowohl auf d3s Gremium als auch auf des.o;en einulne Mitglieder bezieht, taucht in Lewis' "Pastoral Demoeracy" nieht auf (Farah/Lewis: 1993: 14). Ein Guuni gilt als höchste traditionelle Autorität und setzt sich aus den herausragendsten Vertretern von Klans und Sub-Klans zusammen. Unterhalb des Guuni existieren subalterne Ältestenrllte, die "Ergo" und "Xccrtecgti" genannt werden. Diese setzen sich z. T. aus Mitgliedern des Guuni msammen und werden ad hoc in Konfliktsituationen auf Klan-bzw. Subklanebene oktiv (Fmbll..cwis 1993: 141).
85
on Somal.ihmd.< deutlich zu verbessern. Bis Ende I 992 halle sich eine breite Opposition gegen
den Präsidenten gebildet. dem Führungsschwäche und korruptes Gewinnstreben vorgeworfen
wurden (Brons 1993: 37; Bradbury 1997: 19; Bali 1997: 19).
Angesichts dieser KonOiktlage wurden ohne Zutun der Staatsführung neben dem nationa
len Ällestenrat .tahlreiche Guurtis auf Klan- u,nd Subklanebene gegr!lndct, die als "standing
clan couocil of cldcrs" (Farah/Lcwis 1993: 15)1!8 zusätzlich zu den auf jeder Ebene der Scg
mentatiorl ad hoe einberufbaren shirs im Bereich der lokalen Konfliktaustragung eine große
Rolle spielten (Brons 1993: 29: Hcycr 1997: 12). Parallel zu dem Versagen der staatlieben
Administration k.am es somit zwischen 1991 und 1993 zu einer "Revitalisierung" und "Proli
feration" von traditionellen Flihrem.15• Auch traditionelle Werte, wie z.B. religiöses Wissen
und poetische Begabung, gewannen wieder an politischer Relevanz (Farahll.ewis 1993: 27-
29).11.0 Auf Basis dieser Strukturen setzte, ausgehend von der niedrigsten lokalen Ebene, der
Friedensprozess im Nordwesten ein.
Konni.ktaustraguog aur dem �Grass-Rools"-uvel: Ab 1991 begannen die Bemühungen
in Somaliland, die in Folge der Bürgerkriegswirren zahlreichen Konflikte in.ncmalb und zwi
schen den KJan.Fnmilien und Kinns beizulegen. Es fanden viele TrefTen u,nd Verhandlungen
auf lokaler Ebene stall, die zum Ziel hanen, in einem begrenzten Bereich die alltägliche Ko
CJ(istenz und Kooperation zu ermöglichen. "Grassroots commilces" (Guddia turxaan bixin)
sollten im Aufirag der meist in urbanen Zentren ansässigen Guurtis die Einhaltung der abge
schlossenen Vereinbarungen vor Ort Oberwachen (Farah/Lewis 1993: 17).
Die Bemühungen u,m die friedliche Austragung von Kannikten folgten grundsätzlich der
Tradition der shirs, auf denen Friedensabkommen in Fom1 eines heer/xeer ausgearbeitet wur
den. Der tradüionelle Rahmen dieser Versammlungen wurde allerdings um moderne Konfe
renztechniken crweiten. So standen den Ältesten. den Leitern der Fricdensforcn. nun oll Sek
retariate und "technische Komitees'" zur Seite, denen z.B. ehemalige Staatsbedienstete und
'u Die Jnstitutson eines .. ständigen Racs" scheint eL.ne Innovation zu sein - bei Lewis wird nur von ··ad hoe" einberufenen Beratungs- und Entschcidung.instanzen bcnchlet - und könnte m.E. als Anpassung an die Anforderungen fonneller S13atlichkeit verstanden werden.
,,. So gab� z.B. Mine der 1990er Jahre in SomaWand deutlich mehr "Sultane" als in der Koloni31-zcit. Oie "Proliferation'' von traditionellen Führungspositionen wirkte sieb allerdings nicht immer stobilisicrcnd ous, sondern konnte auch Konkurrcn.z und somit Auseinandersetzungen schOren (Fnntlv'Lewis: 19-23). Auch Akils und religiöse Würdcnträgrr gCW11ßnen Anfang der 1990cr Jahre an Einnuss in der Region (Fornhll<·wis 1993: 261).
160 Bei der Motivation der Ältesten, 1hre Fähigkdten a.ktiv 1n die Friedensprozesse einzubringen, spi<ltc neben der generellen moralischen Verpflichtung dieser lraditionellcn Autoritäten sicherlich auch die Möglichkeit eine Rolle, Prestige und pcr.;önlichc Vorteile zu gewinnen (Älteste wurden aufTreffen hofien und verköstigt) (Far:üv'lewis 1993: 181).
Copynghlcd matcria
86
Militärs angehörten (Farah!Lewis 1993: 14/18). Die Aufgaben und Möglichkeiten der lokalen
Friedenskonferenzen waren je nach dem Kontext der Konflikte verschieden. Farah und Lewis
unterscheiden 1.) "Pastoral Conllicts", 2.) "Sedentary Conflicts" und 3.) "Politically Insligated
ConJlicts".
Zu 1.) 1m pastoral-nomadischen Umfeld standen die Regelung des Zugangs zu ökonomi
schen Ressourcen, vornehmlich Weiden und Wasser, die rasche und effektive Wiedergutma
chung von liiihcren Übergriffen auf Herden und Mitglieder der Konfliktparteien sowie die
Möglichkeiten, auf zukünftige Angriffe bewaffneter Banden schnell reagieren zu können, im
Zentrum der Verhandlungen. Die Vereinbarungen Ober Land- und Wasserrechte wurden da·
durch begünstigt, dass in den Jahren 1992193 ausreichend Niederschl!ige fielen. Auch der
Glaubenssatz, dass Allah die Land- und Wasserressourcen allen Nomaden zur freien VerfU
gung gegeben habe. konnte zur Unterstützung der Verhandlungen herangezogen werden.161
Ein weiterer Falc.tor, der die Chancen der friedlichen KonOiktaus.tragung erhöhte, war, dass
vor allem die Isaq durch die lange Zeit des externen und internen Kampfes erschöpft waren;
die Sehnsucht nach Frieden tmd Versöhnung wuchs (Farah/Lcwis 1993: 361).
Neben den oben angesprochenen typisch pastoral-nomadischen Themen wurden auf den
shirs jedoch auch Fragen Ober die Zukunft "Somalilands" behandelt. So forderten z.B. die
Teilnehmer der vom 23. 1 1 . bis zum 1.12.1992 in Garadag abgehaltenen "Peace.Conference of
the Eastem Alliance", dass nur eine na.tionale Konferenz unt.er Beteiligung aller Klans Ober
die Zukunft Somalilands entscheiden dürfe. Eigenmächtige Regierungshandlungen der SNM
wurden als Auslöser fllr erneute Gewalteskalationen in der Region bezeichnet Wld abgelehnt.
Auch die Rolle der UN und anderer internationaler Akteure wurde diskutiert. So wurde be
schlossen, dass auf Grund der Abwesenheit einer stabilen Regierung Somalilands die Arbeit
von UN und NGOs im Gebiet der "Eastern Alliance" über deren zentrales Guurti koordiniert
werden sollte. Man verhat sich externe Einmischungen gegen den Konsens der lokalen Klan
fllhrer. Die Konzentration der internationalen Hilfeleistungen auf wenige Zentren wie Hargei
sa und Berbera aufKosten des Hinterlandes wu:rde kritisiert (Farahllewis 1993: 31-33).
Die Bestimmungen der lokalen Abkommen hatten unterschiedliches Gewicht: Die im Hin
blick auf den hirten-nomadischen Alltag getroffenen Entscheidungen konnten durch die An·
'" Eine Verweigerung des Zugangs zu diesen "Geschenken" Altahs galt •ls Sünde. Werin kommt dte starke Abhängigkeit von Umweltfaktoren zum Ausdruck, die jenseits des menschlichen Einflusses liegen. Die unzuverlässige Verteilung von Nic<krscbl3gen macht Kooperation notwendig: "lf a paniculllr clan or lineage refuses rival groups access to pasturage and "'"'ter tbat occur in its sphere of inßuence, it will face similar IJ'eaternent at a time of distress when exploitation of grazing eontrolted by othm is indispens3ble" (Farahltcwis 1993: 41).
Copyrogh!cd ma riR
87
drohung von effektiven Sanktionen, wie z.B. kollektives bewaffnetes Vorgehen gegen
Rechtsbrecher, untennnuen werden. Es war möglich, konkrete Fristen filr die ROckgabe ge-
raubter Tiere und die Zahlung von Kompensationen festzulegen. Dagegen blieben die Äuße·
rungen zur zukünftigen Gestaltung Somalilands zunächst reine Willenserklärungen, die
höchstens durch diffuse Drohungen verstärkt wurden (Farahll.ewis 1993: 341).
Obwohl die Entscheidungen auf den shirs im Konsens getroffen wurden, hing die
Effektivität der pastoralen Abkommen grundslltzlich von dem Respekt ab, der den
traditionellen Autori täten als den Koordinatoren der Versammlungen entgegengebracht
wunle. ln diesem Zusammenhang stellten Farah und Lewis fest, dass unter den Angehörigen
der Dir-KJanfamilie und des Harti·Kians (Darod·Kianfamilie) die Autoritllt der Ältesten
größer war als unter den sehr egalitären lsaq: • .Among thc indogcnous clans in ,Somaliland' in
general, those who bclong to lsaq, are more egnlitarian and anareh.ic t.han Dir and Harti clans"
(Farah!Lewis 1993: 23). Auch das allgemeine ökonomische Umfeld wirkte sich auf die
Stabilität der Übereinkllnlle aus: Friedensabkommen in der pastoralen Peripherie waren
tendenziell stabiler als in den ökonomischen und politischen Zentren wie Hargeisa und Burao,
in denen es z.B. im Zusanmtcnhang mit dem Qat·Handel häufiger zu Plünderung und Gewalt
kam (Farah/Lewis 1993: 23).
Die Durchsetzuns der Bestimmungen oblag den Klans in ihren jeweiligen Gebieten. Gene
rell fanden innerhalb der vertraglich \'erbundenen Hirtennomaden-Gruppen immer wieder
Übergriffe auf die Henlen der schwllchcrcn Vertragspanner stall, die auch mit menschlichen
Verlusten verbunden waren. Die Verpflichtung:. d en so \'crursaehtcn Schaden du.n:h kollektive
Kompensationszahlungen auszugleichen. reichte ofl nicht aus, die Gewahlätigkeilen zu been·
den. Um die Gefahr extremer Gewaheskalationen in einem hoch militarisierten Umfeld zu
verringern, musste der Druck auf Rechtsbrecher erhöht wcnlcn. ln diesem Zusammeohang
sind Beschlüsse \'On Ältesten zu sehen, die d!ar•uf abziehen, das Netzwerk der kollekli\'en
Sicherheit zu lockcm1•2, Blutrache zu ächten1w oder die Tötung von Banditen von der Kom·
tt.l Kompcnsationszoblungen lllr verur53chten Schaden sollten direkt von den Familien der Recht•bre· eher gezahlt werckn. Diese Verlagerung der Verantwonlichkeitcn erhöhte den familieninternen Druck auf PIOnderer stark: "Instauces of habitiJlll looters killed by lhcir immediate kin who could not bc-ar any morc the burden of thcar vao1rnt acls, arc cltcd by somc clans in thc rcg1on"' (Farah/Lewis 1993: 40).
"' t.n dem Abkommen, das auf der ··Sh1mbiralc l'eaee Confcn:n<:e'" am 18.11. t 992 vernbschieckt wurck, beißt es: '"Thosc who suiTer c�usalities should not Iake any stcps bul infonn lhe standing commiutt on pcacc. lf they Iake favournble sleps such as rcvcnge. thc:y "ill be treatod as bandits" (farah/Lewis t993: 76).
Copynghtcd matcria
88
pensationspOicht auszunchmen.1�>< Der intensive Kontakt friedenswilliger Gruppen filhrte
auch dazu, dass Nachrichten über geplante Aggressionen ausgetauscht wurden und somit prä
ventiv gegen Rechtsbrilche vorgegangen werden konnte (Farah/l.ewis 1993: 39-41).
Dabei ist jedoch zu bedenkeo. dass es mittels der lokalen shirs zwar möglich '''urde, das
Ausmaß unkontrollicrtcr Gewalt und gewaltsamer Bereicherung im Zusammenhang mit
BUrgerkrieg und Staatszerfall zu reduzieren, dass aber auch der "pastorale Friede" traditionell
ein höchst instabiler Zustand war (siehe Abschnitt 2.2.6).
Zu 2.) In den landwirtschaftlich genutzten Gebieten lebten oft Angehörige verschiedener
Verwandtschaftsgn�ppen zusammen. In den Zeiten des Bürgerkrieges verlief die Front z.T.
quer durch die Siedlungen, worauJhin ein Teil der Bevölkerung fliehen musste und ihr Besitz
von feindlichen Nachbarn übernommen wurde. Auch zwischen landbesitzenden und nomadi
schen Somali kam es zu Konflikten. Diese wurzelten noch in den 1970cr Jahrco. als im Zuge
der "anti-tribalistischen" Ansiedlungskampagnen des Barre-Regimes traditionell von Noma
den kontrolliertes Weideland an regierungstreue, wohlhabende Privatpersonen und deren Fa
milien verkauft worden war. Nach dem Sturz Barres flohen die ehemals Privilegierten und das
Land wurde wieder als Weidezone genutzt (Farahllcwis 1993: 41-48). Der zentrale Fokus der
Konflikuustragung im sesshaften Umfeld war also auf die ROckgabe von Landbesitt und an
derem materiellem Besitz, wie z.B. Häuser, gerichtet; z.T. spielten zusättlich auch Vergehen
wie Viehdiebstahl eine Rolle (Farah/Lewis 1993: 471781).
Im Vergleich zum nomadischen Kontext wurde die Konfliktlage dadurch verkompliziert,
dass die Kultivierung von Land individuelle Investitionen erforderlich gemacht hatte und die
ser wertvolle Besitz deshalb nicht geteilt werden sollte. Konflikte über kultiviertes Land sind
schwerer beizulegen als Streitflllle hinsichtlich. der gemeinschafilichcn Nutzung von Weiden
und Wasserstellen: ,,Tbey [sesshafte Gruppen) do not readily plungc into war, but oncc they
Cllgage in a conflict, they are said to be slow in restering peace" (Farah/Lewis 1993: 49). Die
Abkommen, die im Rahmen von Siedlungsgemeinschaften erreicht wzrden, waren allerdings
sehr stabil, da die Sanktionsgewalt auf Grund der Ortsgebundenheit der Mitglieder groß war
(Farah/Lewis 1993: 49).
Zu 3.) Unmittelbar nach der Vertreibung Barres aus Mogadishu begannen die Kllmpfe um
die politische Vorherrschall in Somaliland. Der Konfliktgegenstand war der Zugang zu Macht
und Ressourcen. Im Zentrum der Auseinandersetzungen standen die lsaq als die soziapolitisch
, .. In demselben Abkommen legte man fest: "Anybody killed or injurcd while involved in acts of banditry will bc trtated as a dcad donkey! (dameq bakhtim) and should not havc any rights•· (Farah!Lewis 1993: 76).
Copyroghtcd ma riR
89
dominante Verwandtscbaftsgmppc in Somaliland. Zwischen dieser Klanfamilie und anderen
Gruppen, aber vor allem innerhalb der lsaq, kam es zu Spannungen, die z.T. gewaltsam eska
lic"cn (Brons 1993: 34/36).
Der schwerste Konflikt in den ersten zwei Jahren nach der Unabhängigkeitserklärung So
malilands brach Anfang I 992 zwischen zwei lsaq-Gruppen aus. als Präsident Ali Tuur ver
suchte, den Hafen der Stadt Berbcra 165 unter seine Regierungskontrolle zu stellen, um seine
Macht auszuweiten und zu zentralisieren. Es kam zu Kämpfen zwischen dem Habar Yonis
Klan, der Gruppe des Präsidenten, und dem lisa Musa-Klan, der den Hafen in Berbern kon
trolli�e.166 Dieser Konnikt, der den bisher erreichten Zusammenhalt Somalilands zu zerstö
ren drohte, konnte erst im November 1992 durch die Vemtittlung von Ältesten in friedliche
Bahnen gelenkt werden. Das Guu"i setzte sich aus vier religiösen Würdcntrllgern und 36 her
ausragenden V�retem verschiedener Klans zusanunen. Eine entscheidende Rolle bei diesem
.Friedensprozcss ("Sheikh Pe-Jce-Conferences-} spielten die Ältesten des Gadabursi-Kians
(Dir-Kianfamilie}. Da sie als "neutrale" Vennittlcr galten, konnten sie den von beiden Kon
fliktparteien akzeptierten Vorschlag machen, alle Häfen, Straßen etc. Somalilands als zentral
verwaltete öffentliche "Güter" zu betrachten, deren Nutzung den Bewohnern Somalilands frei
stehen sollte. Somit konnte sowohl der Machtanspnoch der "Regierung" befriedigt als auch die
Furcht der Jisa Musa vor gezielter Verdrängung zerstreut werden (Famh!Lcwis 1993: 531).
Um rasch zu friedlichen Kooperationsbeziehungen zurliekkehren zu können. wurden Kom
pensationsansprOche fllr Vergehen im BOrgerkrieg z.T. gänzlich abgclehnt.167 Die auf den
.,Sheikh Peace-Conferences" vereinbarten Abkonuncn sahen zur Stabilisierung des Friedens
"' "\Vith revcnucs of about S700.000 pcr monlh, Berbern lwbour was the only seroous Cashgeneratingelement in the country[ ... ]" (Prunier 1994: 66).
, .. Schon bei Burton wird von dem Konflikt dieser beiden Gnoppcn um den Hafen Berbern berichtet: .,Both these powerful tribes (die Hab:lr Gerhajis, zu denen die llagnr Yunos �hören und die Habar Awal, zu denen die lisa Musa zilhlen] •= a claim to the customs and prolits of thc port on the grounds that they jointly conquered it from thc Gallas. Thc llabr Awal, however. bcing in posscssion. would monopoli:re the rights: a blood feud rnges and the commerce of the place suiTcrs from thc dissensions of the owners" (Burton 2000: 290}. Mit Blick auf die segmentäre Dynamik innerhalb der somatischen Gesellschall kann der j!lngste Ausbruch dieses offensichtlich ..:hr ahen Konfliktes folgendermaßen interpreric" werden: ln der Zeit des Bürgerkrieges wurde die Ernheil der Jsaq-Klanfamilie durch die Kämpfe mit Angehörigen anderer Klanfamilicn, besonders mit den Oulb:iliante und den Ogadcn. sestärkt. Nachdem diese äußere Bedrohung im Zuge der Versöhnwtg der nör dlichen Klanfamilien auf dem großen shir in Berbern (Februar 1991) Oberwunden war, wurde der Zusanunenhalt der lsaq-Kianfamilic wieder schwächer und interne KonOikte brachen aus (Bali \997: 20).
"' So heißt es z.ß. in eonem arn 3.11.1992 in Shcild> vercmba"cn Abkommen zwischen l laba.r Yonis und lisa Mu<:�: .. Excluding pcnnanent property [ ... 1. human and material Iosses sustained by both sidcs during thc Cl\il war, 27.03.-07.10.1992. are declared null and void" (Farnhllewis I 993: 82).
Copynghlcd malcria
90
drastische Strafen f'ilr Rechtsbrecher vor.16' Zudem wurde der Austausch von 50 Frauen, 25
von jeder Konniktpartei, vereinbart, um dauerhafte Friedensbande zwischen den beiden Klans
zu knüpfen (Farah/Lcwis 1993: 83).
Insgesamt gelang es Anfang der 1990er Jahre in weiten Teilen Somalilands mittels lokaler
Friedcnsabkommcn. die im Rahmen von shirs vereinbart wurden, eine V crtraucnsbasis zwi
schen den verfeindeten Gruppen zu schaffen. Besonders die friedliche Be.ilegung der
machtpolitischen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen lsaq-Klans in Sheikh
ebnete den Weg filr die Abhaltung einer "nationalen" Konferenz in Borama, auf der die
künftigen Ordnungsstrukturen der "Republik Somaliland" verhandelt werden sollten
(Bradbury 1997: 19; Farah!Lewis 1993: 54).
Nationaler16' Level - Die Borama Konferenz: Am 24.1.1993 wurde die "Grand Confe·
rcnee on National Reconciliation" in Borama170 eröffnet. Vier Monate lang trafen sich die ca.
2000 Teilnehmer des shirs, um entsprechend traditioneller Muster Tradition alte Streitigkeiten
beizulegen, neue Verbindungen zu knüpfen. einen ncuen Präsidenten zu wählen und die
grundlegenden Fragen der nationalen Versöhnung und der staatlichen Ordnung Somalilands
zu diskutieren: "Poetry was written and recited ( ... ). Quarrels were resolved through public
excuscs, arranged marriagcs and exchangcs of cercmonial gifts ( ... ]" (Prunier 1994: 67). Fol
gendes Zitat charakterisien den von der politischen Kultur der pastoral-nomadischen Somali
geprägten Verlauf der Borama-Konfercnz sehr gut: "ln a way, one could say that electing the
new president became alrnost a side issue and that the political and eultural display of social
dynamies became essential" (Prunier 1994: 67).111
Den Vorsitz der Konferenz hatten die 150 Ältesten inne, die auch die einzig Stimmberech
tigten waren. Die Konferenz wurde im wesentlichen von somaliscben Geldgebern finanzien.
Daneben wutden von NGOs, wie z.B: dem LPI, einige externe Ressourcen beigesteuert. Von
Seiten der UNOSOM wurde das Treffen nicht gellirden (Bradbury 1997: 21; Heinrich 1997:
97). Mit Blick auf die parallelen internationalen Entwicklungen wird vielmehr deutlich, dass
diese "nationale" Versammlung in Opposition zu den Bemühungen der UN stand: Auf Drän·
gen des UN-Generalsekretärs erstreckte sich das in der Resolution 814 vom 26.3.1993 festge·
'" So wurde z.B. in dem am 3.11.1992 geschlossenen Vertrag zwischen den Vertretern des Habar Yonis· und de11 1isa Musa-Klans festgeschrieben: "Any Memhcr of thc two panies convieted of frcclance banditry or highway robbery, shall hc killed" (Fanoh/Lewis 1993: 83).
'" Bezogen auf Somaliland. 110 Diese Stadt liegt im Gebiet der Godabursi an der Grenze zu Äthiopien. 171 Dennoch ist zu beachten, dass gerade im lichte der sozialen [)ynllmik die Wahl des Präsidenten
schwerwiegende Folgen fUr die weiteren Entwicklungen Somalilonds hatte (siehe 6.1.3) und dies den Teilncluncm der Konferenz wohl bewußt gewesen sein dürfte.
Copyroghtcd m3tcria
9/
sehnebene Mandat von UNOSOM U eindeutig auf ganz Somalia. Auf der Bor:nna-Konferenz
setzten die nördlichen Klans diesem Ansinnen kl:rrc Zeichen der "nationalen" Eigenständig
keil Somalilands entgegen, um nicht durch eine unkontrollierbare externe Intervention in ihrer
Handlungsfreiheit eingeschränkt zu werden (Prunier 1994: 66f; Brons 1993: 37f; Bmdbury
1997: 21).172
Die Vereinbarungen bezüglich der Stabilisierung des Friedens und der Sicherheit im Land
wurden in der "Somaliland Communitics Sccttrity and l'eace Charter'' fcstgehaltcn. Rahmen
konzepte !Ur die Demobilisierung. filr den Aufbau von Polizeik.rnfien und eines Justizsystems
wurden beschlossen. Die Ältesten sollten Vcrantwonung filr die Umsetzung des Abkommens
tragen. Bradbury interpretien die "Peace Chaner'' als "national xeer'', der im Einklang mit
tmditionellen und religiösen Normen das Handeln der Bevölkerung Somalilands leiten sollte
(Bradbury 1997: 22).
Als Basis der staatlieben Ordnung und som.it als vorläufige Verfassung der Republik So
maliland wurde die "National Chaner'' verabschiedet. Die Trennung von Exekutive, Lcgisla·
live und Judikative wutde festgeschrieben. Zudem wurde festgelegt, dass sich das Parlament
der Republik aus zwei Versammlungen zusammensetzt; dem "Assembly of Elders" (Guurti),
dessen Mitglieder sich durch Wissen um die Tmditioncn auszeichneten, und dem "Asscmbly
ofRepresentatives", das vornehmlich aus Rechtsgelehnert und Verwaltungsfachleuten besteht
Beide Kammern haben je 75 Mitglieder, von denen 25 ein "Ständiges Komitee" bilden. Das
Guuni steht nur Männem offen. die älter als 40 Jahre sind. Dem Nationalen Ältestenrat wurde
das Recht zugestanden, den Präsidenten, den Vize-Präsidenten sowie die Angehörigen des
Reprilscntantenhauscs zu wählen. Zudem bekl'llftigte die Charter die Rolle der Ältesten als
Wahrer des Friedens und der Sicherheit auf lokaler und nationaler Ebene; in die Hände der
traditionellen Autoritäten wutden die zentralen Konfliktschlichtungskompetenzen gelegt
(Hcyer 1997: 13f; Bradbury 1997: 22).m Zum Abschluss der Bomma-Konfcrcnz Ende Mai
wählte die Mehrlteit der 150 Vorsitzenden Mohamed Haji lbrahim E&'31, der bis 1969 amtie
rende letzte Premierminister der demokratischen Regierung Somalias, zum neuen Präsidenten
m Während die eigenmächtige UN/US-Einmischung in politische Angelegenheiten abgelehnt wurde, drOckten die in Boroma versammelten Reprl!.s<.ntantcn Somalilands bei einem Besuch des USBotschaficrs am 17.4.1993 den Wunsch noch Zusammenarbeit mit internationalen Kriificn im Be· reich der Entwaffnung. des Aufbaus von Polizeikräften und der Reintegration fruhorer Milizionäre aus (Brons 1993: 89).
171 ln der Literntur witd nicht erwähnt, wie die Mi�gliedcr des nationalen Guurti ernannt bzw. gtwählt wurden. Einzig Bradbury schreibt: "Tbe mcchanism for selecting tbe Guurti was poorly dcflncd. Those who bc<:ame tl� National Guurti in 1993 wcre active individuals, but were largely selfselccted rather than selccted by their clans" (Bradbury 1997: 34).
Copynghtcd malcria
92
der Republik Somaliland; Abdulrahman Aw Ali wurde Vizepräsident (Bradbury 1997: 22;
Prunier 1994: 67).
Insgesamt wurden in den Bestimmungen sowohl der Pcace- als auch der National-Chancr
d.ie schon früher im Programm der SNM fonnulierten Ziele verwirklicht, eine zentrale Regie
rung auf Basis des kulturellen Erbes der Somali zu errichten. Zumindest auf theoretischer E
bene schien im Rahmen der Borama-Konfercnz eine fruchtbare Verbindung von "Tradition"
und "Modeme" gelungen (Bradbury 1997: 21; Menkhaus 2000: 189).
6.1.3 Dt.E WEITEREN ENTWICKLUNGEN IN SOMAULAND
Scheinbare Konsolidierung der staatlichen Ordnung bis Ende 1994: Oie schwierige und
unsichere Übergangsphase Somalilands vom BUrgerkrieg zu einer friedlichen Staatsordnung
schien mit dem erfolgreichen Abschluss der Borama-Konfcrcnz und der Neuwahl der politi
schen Führung becndet. Sowohl in Bezug auf die internationale Anerkennung als auch hin
sichtlich der internen Stabilisierung der Republik wurden große Hoffnungen in die neue Ad
ministration des Landes gesetzt (Prunier 1994: 67). Doch die Verbesserung der internationalen
politischen Stellung Somalilands war im Frllhjahr 1993, als die internationale Intervention in
Zentral- und SUdsomalia ihren Höbepunkt erreichte, unmöglich. Die neue Regierung konzent
rierte sich auf die Schaffung einer stabilen innerstaatlichen Basis. Im Bereich der öffentlichen
Verwaltung konnten Fortschritte erzielt werden: Eine neue Währung wurde im Oktober 1994
eingcffibrt ("Somaliland Shilling").; in den Städten Hargeisa, Boroma und Berbera wurde eine
Polizeitruppe eingerichtet; bis Ende 1994 war die Verteilung des Regierungshaushaltes an die
verschiedenen Ministerien gcklart; regionale und lokale Gerichte wurden auf Basis des "penal
code" von 1960 etabliert und bildeten somit das Fundament eines Justizsystcms; ein spezielles
Ministerium bcmOhte sich um Koordination dC1' internationalen und nationalen Aufbauprojek
te. Obwob.l die Regelungskompetenzen der Regierung im wesentlichen auf die zentralen Städ
te Somalilands begrenzt waren, konnten auch Verbindungen zu den Regionen aufgebaut wer
den. ln Zusammenarbeit mit den Klans wurde auch die Herrschaft plündernder Banden
zumindest im Bereich der wichtigsten Handelswege zurückgedrängt. Mitte 1993 wurden ver
stärkt Anstrengungen unternommen, die noch aus der Zeit des BOrgerkrieges übriggebliebe
nen Milizen zu entwaffnen und Teile der alten Kämpfer in die nationalen Sicherheitskräfte 7.11
integrieren. Dies gelang jedoch nur unvollständig. Dennoch wurde bis Ende 1994 ein zumin
dest in Grenzen kontrollierter Handel und die schrittweise Konsolidierung des Regierungs
haushaltes möglich. Dieser beruhte im Wesentlichen aufden wachsenden Einnahmen aus dem
Copyngh!cd ma riR
93
Expon von Lebendvieh nach Äthiopien und Saudi Ambien und der Besteuerung des Qat
Handels {Bradbury 1997: 22-24).
Insgesamt jedoch war die winschaftlichc Situation Somalilands in Folge der totalen Zerstö·
rung der ökonomischen und sozialen Infrastruktur zwischen 1988 und 1991 noch immer
schlecht. Der ungekläne diplomatische Status der Republik verhindenc weitgehend den Zu·
fluss externer Ressourten. Zudem war die Regierung bei der Erreichung all dieser Fortschritte
auf die Kooperationsbereitschaft der einfluss.rcichcn Vetwandtschaftsgntppcn angewiesen.
Dies wurde vor allem im Hinblick auf den Staatshaushalt deutlich: Die Egal-Administration
konnte relativ ungehindert von großen Teilen der im Rahmen des Schiffshandels erwinschaf
teten Exporteinnahmen profitieren. da der Präsident dem lisa Musa-Klan angehöne, der den
Hafen von Berbera kontmlliene. Der Flughafen der Hauptstadt Hargeisa dagegen war dem
zentralen Zugriff weitgehend entzogen, da er von Aidagalla-Milizcn beherrscht wurde, die in
Opposition zu der neuen Regienmg standen (s.u.) (Bradburyl997: 24; Prunier 1994: 681).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die soziopolitische Situation Somalilands unter
der Fllhrung Präsident Egals in den ersten 18 Monaten nach Ende der Bor.una-Konfercnz
deutlich verbessert werden konnte. Dennoch blieb der politische Rahmen der Republik Som3·
liland instabil, da die Effektivität der zentralen Administration von der Kooperationsbereit
schaft der einflussreichen Verwandtschaflsgruppcn abhängig war. Die Regierung verfilgte
nicht Ober ein zentrales Gewalt- und Stcuem10rnopol (Heyer 1997: 141).
Genealogische, ökonomische und politische Hürden: Der Präsident lbrahim Egal gehör·
te zum lisa Musa-Klan, während sein Vorgänger Ali Tuur ein Angehöriger der Habar Yonis
war. Letztere Gruppe filhlte sich als Verlierer des politischen Konsolidierungsprozesses in
Bonuna und lehnte die von Egal angebotene Regienmgsbetciligung ab. Somit waren die Vor
aussetzungen filr einen erneuten schweren Konflikt innerhalb der lsaq entlang der genealogi
schen Zugehörigkeit zur Gruppe der Habar Awal (Saad Musa und lisa Musa) und der Hagar
Garhajis (Habar Yonis und Aidagalla) gegeben (vgl. Anm. 166; Prunierl994: 67).
Als die Regierung Ende 1994 versuchte, den Flughafen von Hargeisa unter ihre Kontrolle
zu bringen, eskaliencn diese Klanrivalitäten in bewaffneten Auseinandersetzungen. Oie
Kämpfe zwischen den Habar Awal und den Habar Garhajis weiteten sich aus und erfassten
neben der Hauptstadt auch die Togrhecr- und Sanaag-Region im Osten Somalilands. Ocr Kon
flikt zwischen den lsaq-Gntppen hatte zudem das Potential, sich Uber die Grenzen Somali
lands auszuweiten und alles bisher Erreichte in Frage zu stellen: Der Habar Yunis Ali Tuur,
der ehemalige Präsident Somalilands, hatte nach der verlorenen Wahl 1993 begonnen, mit der
Copynghtcd matcria
94
UNOSOM zu kooperieren und sich ftlr die Schaffung eines Rkleralistisch strukturienen Staa
tes in den Grenzen der ehemaligen Republik Somalia einzusetzen. Die Spannungen zwischen
Somaliland und dem SOden nahmen zu, als sich Ali Tuur und der prominente Aidagalla
Politiker Jama Mohamed Qalib Yare mit General Aideed zusammenschlossen und Anfang
1995 in die selbsternannte Regierung des wa.rlords in Mogadishu eintraten.174 Die "Doppel
deutigkeit" des Konnikts verkompliziene seine Beilegung. Aus der Sicht der Egal
Administration handelte es sich in erster Linie um eine politische Angelegenheit, in deren
Zentrum die Frage nach der Unabhi!ngigkeit Somalilauds stand. Die Lösung des Konnikts
bestand in der Durchsctzung der Autoritlit der Regierung. Die Einberufung einer nationalen
Versöhnungskonverenz nach dem Vorbild des shirs in Boroma wurde abgelehnt, da dies einen
Autoritätsverlust bedeutet hätte. Aus Sicht vieler Ältester dagegen stand der Klankonflikt im
Vordergrund; somit wäre ein lsaq-shir die angemesscns Lösung gewesen. Der Dialog zwi
schen den Verwandtschaftsgruppen wurde jedoch durch Meinungsverschiedenheiten im nati
onalen Ältestenrat bchinden. Das Guuni brach auseinander; die in Hargeisa verbliebenen
Mitglieder galten als VerbOndete der Regierung (Bradbury 1997: 25f729f; Bali 231).
Die Kämpfe weiteten sich aus. Im Frühjahr 1995 kam es zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen Anhi!ngem und Gegnern der Regierung in Burao, der
zweitgrößten Stadt Somalilands.m In Folge des Krieges flohen insgesamt mehrere
zehntausend Menschen in ruhigere Gebiete im Hinterland; einige hundcn Somalis wurden
getötet Ende 1995, Anfang 1996 ließen die Kampfhandlungen in Somaliland nach. Doch erst
ab Mai 1996 begannen die Verhandlungen zwi.scben den Panoien des Burao-Kontlikts; im
Juli ttafen sich die Protagonisten des Hargeisa-Kontlikts in Camp Abokor (Äthiopien). Der
Friedensprozess wurde dadurch bcgOnstigt, dass General Mohamed Farah Aideed am ersten
August an den folgen einer Gefechtsverletzung starb und somit die mit diesem warlord
\'erbundenen Truppen der Habar Garhajis einen wichtigen UnterstOtzer verloren. Bis Herbst
1996 konnten in beiden Fällen Friedensabkommen geschlossen werden Bradbury 1997: 31f;
Bali 1997: 24; Prunier 1996: 2J4n; Compagnon 1998: 85).
Die Eskalation der Gewalt zwischen 1994 und 1996, die in dem Konflikt um den Flugha
fen von Hargcisa ihren Ausgangspunkt hatte, spiegelle drei grundlegende Problerne der Repu
blik Somaliland wieder:
'" Hier ist 3117.1UDC:rken, dass viele Älteste der Habar Yunis nicht hinter der flidcralistiscben Position Ali Tuurs standen. Zudem erhielten die gegen Egal und seine Anhänger kiimpfenden Gruppen nur mat<riclle Untcrst0t211ng aus dem Soden.
Copyroghted ma riR
95
1.) Die ökonomische Basis des Landes war so schwach, dass der Kampf um die Kontrolle
der wenigen gewinnversprechenden Ressourcen, in Verbindung mit dem Mobilisierungspo
tenzial genealogisch konstituiener Gruppen, eine massive Bedrohung der Staatlichkeit Soma
lilands darstellte. Die Egal-Administration war in einem ··vicious circle'' gefangen: Einerseits
hing die Verbesserung der politischen und sozialen Situation vom ökonomischen Aufschwung
ab; andererseits war soziC>-politisehe Stabilität die Voraussetzung fllr die Entwicklung der
Ökonomie Bali 1997: 25; Bradbury 1997: 26f). Die ökonomische Stabilisierung des Landes
durch externe Unterstützung seheitene an der immer noch nicht erreichten internationalen
Anerkennung: .. Still today [1996) the international community, and especially the UN organi
zations, arc perccived at best as having " distanc<.xl if not hostilc attitude towards Somaliland"
(Heinrich 1997: 991).
2.) Das in der National Chaner theoretisch ausbalanciene Nebeneinander von zentralen
und regionalen Zuständigkeiten fühne in der Praxis zu Konflikten. Da der Flughafen Hargeisa
in ihrem Gebiet lag. beriefen sich die Aidagalla auf die in der Chaner als Konzession an die
Macht der Verwandtschaftsgruppen festgeschricbnc lokale Sicherheits· und Stcuerautonomie.
Die Macht der Zentralregierung konnte auf Basis der Übergangsverfassung in Fmgc gcstclh
werden (Bradbury 1997: 27f; Heyer 1997: 15).
3.) Der nationale Ältestcnr�t war nicht neutral und somit auch nicht fahig. überpaneiiseh
konOiktschlichtend einzugreifen. da die Mitglieder des Guurti zum einen von der Regierung
bezahlt wurden und zum anderen selbst in verschiedene verwandtschafiliche Netzwerke ein
gebunden waren Bradbury 1997: 29; He)-er 1997: 15).176
Die Republik Somalila nd bis heute- ,..Bol peace bad fioally broken out 1···1" (Pruoier
1998: 227): Die Amtszeit Präsident Egals, die nach den Vereinbarungen der Boroma·
Konferenz im Frühjahr 1995 geendet hätte. wurde angesichts der Krisensituation um 18 Mo
nate, bis Anfang November 1996 verlängert. ln dieser Zeit sollte der Krieg im Land beende!.
eine Verfassung ausgearbeitet und Neuwahlen vorbereitet werden. Diese Vorgaben konnten
bis Mitte 1996 nicht erftillt werden. Im September des Jahres kündigte das Guuni die Einberu
fung einer nationalen Klankonferenz im Herbst an, um die innenpolitische Krise Somalilands
unter Kontrolle zu bringen. Die Eröffnung dieses Shir Beclccdka in Hargeisa am 15. Oktober
war von Spannungen begleitet. weil einige Klans, Politiker und lotcllcktuclle Somalilands
m Schon Anfang 1 99 1 war es hier zu bcwaffitcten Auseinandersetlungen zwischen Habar Yunis und Habar Jelo (bcides sind Jsaq-Klans) gekommen (FDiahllcwis 1993: 501).
Copynghtcd malcria
96
Vorbebalte gegen das Guurti sowie gegen Zeit und Ort der Konferenz hallen. Letztlich konnte
die Konferenz jedoch abgehalten werden, nicht zuketzt, weil sich die Beteiligung an der von
der Regierung getragenen Versammlung, deret1 Ziel die endgfiltige Konsolidierung der zu
künftigen politischen Strukturen Somalilauds war, machtpolitisch und finanziell auszuzahlen
versprach. Auf dem Shir Bccleedka wurde Anfang 1997 die aktuelle Verfassung der Republik
angenommen. Sie sollte zunächst nur fllr drei Jahre gfiltig sein und im Jahr 2000, nach einer
Revision durch das Parlament, bestehend aus dem "House of Elders" und dem WHouse of Re
prescntatives", in einem nationalen Referendu:m endgültig angenommen werden. Auch die
Prl!sidentsebo.ftswahlen fanden statt; Mohamed Haji lbrahim Egal settte sich gegen neun Ge
genkandidaten durch und wurde am 23.2.1997 fllr weiter fllnf Jahre zum Präsidenten Somali
lands gewählt. Trotz der anfliogliehen Spannungen Oberwog insgesamt in Folge der Konferenz
eine Atmosphäre des nationalen Konsenses. Zer weiteren Stabilisierung der innenpolitischen
Situation trug bei, dass Egal bei der ZusrunmCilstellung des neucn Kabincns auf eine au:sge
wogene Repr'dsentation der Regionen des Landes achtete (Bradbury 1997: 331745; Balil997 :
26f; Jamn 2000: 1).
Die Quellenlage bezüglich der weiteren irmenpolitischcn Entwicklungen bis 2001 ist äu
ßerst dürftig. 111 Generell kann gesagt werden, dass es bis heute gelungen ist, die politische
Ordnung auf nation31em Level aufrecht zu erhalten. Die fUr FrOhjahr 2000 geplante Revision
der Verfassung wurde vom Parlament um ein Jahr verschoben, um Zeit !Ur eine fundierte Re
vision u:nd fllr geplante Verfassungsanderungen zu gewinnen (Jama 2000: I 1).
Noch immer existieren viele bewaffnete Milizengruppen, deren gesellschaftliche Rein
tegration ein großes Problem darstellt. In der nationalen Annec, die auf Grund ihrer Übergrö
ße eine enorme Belastung fUr den Staatshaushalt darstellt, finden nicht alle ehemaligen Bür
gerkriegskämpfer einen Platz. Eine stabile soziale Infrastruktur, basierend au:f einem
geregelten Ausbildungssystcm, einer allgemeinen Gesundheitsversorgung etc., ist nicht vor
handen. Die wirtschaftliebe Lage ist nach wie vor angespannt und der Regierungsetat ist ent
sprechend gering: Im Jahr 1999 beliefen sich die Steuereinnahmen auf 36 Millionen DM.
Obwohl von internationaler Seite in einigen Projekten humanitäre Hilfe geleistet wird171,
scheitert ein deutlicher wirtschaftlicher Aufschwung weiterhin an der fehlenden diplomati-
'" Auf Grund der Blockierung des Guurti gründe1en somatische Intellektuelle in London tm April t99S du "Peace Commil!ee for Somaliland". Von Addis Alx:ba aus lx:mUhtc sich dieses Gremium
ab September !995, '"'""inclnd in Somaliland einzugreifen (Bnodbury 19?7: 32135). on Die JOngstc Publilmtion von Marin Brons bietet cinen detaitlienen Überblick über die Entwicklun
gen in den verschiedenen Regionen Somalias bis ca. 1999 (Brons 200 I: 245-28 t ).
Copyroghtcd ma riR
97
sehen Anerkennung des Landes (Prunicr 2000: 2f; dcrs. 1998: 228; Annan 2000: 9; Brons
2001: 2541).
6.2 DIE ENTWICKLUNGEN IM SODEN
Nach dem Abzug der intemalionalen Truppen kam es im SUden zu einer Vielzahl verschiede
ner soziapolitischer Entwicklungen. Um einen differenzicnen Überblick zu gewinnen. werden
in der folgenden Darstellung 1.) die Ereignisse auf Ebene der ,.nationalen"119 Macbtpoliti.k
und 2.) das Geschehen im önlich begrenzten Rahmen unterschieden.
Zu I.) Auf machtpolitischer Ebene dauent."n die Kämpfe zwischen den auf verschiedene
Allianzen gestützten warlords an. Mogadishu war nach wie vor der Mittelpunkt der Auseinan
dersetzungen. Mitte 1995 verlor Mohamcd Farah Aidccd seine Position als Führer der SNA
an Ali Osman Auo, der mit Ali Mahdi Kontakt aufnahm; die SNA wurde gespalten. Ajdccd
Ucß sieb von einigen Getreuen zum "Präsidenten .. der .. Republik Somalia" wäbletL Dies hatte
Kämpfe zwischen Aideeds Truppen und der Allianz Attos und Mahdis zur Folge. die sich
Ober Mogadishu hinaus in den SOden bis Baydhabo und Kjsmayo ausweiteten. ln diesem Zu
sammenhang wurden auch General Morgans Truppen sowie Rahanwcyn-Milizcn in das
Kampfgeschehen involvien. Ende Juli 1996 wurde Mohamed Farah Aidecd bei einem Gefecht
in Mogadishu venvundet und starb J,;un darauf. In der Position des MilizenfUhrcrs folgte ihm
sein Sohn Husscin nach, der den Kampf seines Vaters fonluhrtc (Prunicr 1996: 2·4).
ln den Ietzt�" vier Jahren wurde zweimal der Versuch unemommen, mit intemalionaler
Unterstützung eine Regierung Somatins zu etablieren. Im Jahr 19<)7 fand ein Treffen der mili
tlhischen FOhrcr des Südens in Kairo statt, aufdem die Einrichtung einer Übergangsregierung
vereinbart wurde. Doch erst auf Initiative Präsident Gucllehs (Djibouti) wurde im August
2000 uusäcblich ein ,.Transitional National Assembly'' in Dlibouti gerundet, das am 26.8.2000
Abdulkassim Salad Hassan zum neuen ,.Prilsidenten" Somalias wählte (Ahmed I. Samatar
2000: 59f; Somalia wählt ... 2000: I). Doch dessen Exilregierung konnte bisher keine effektive
Regierungsmacht in Somalia ausübcn.1so Auf den Verlauf und die Folgen dieses sog . .,Djibou
ti-Prozess" wird in Kapitel 7 dctaillien eingegangen.
11' Die. EU unters10tZI \Viederaulbauarbeiu:n am Hafen von Berbcr3. Auch \'Crschicdcne UN· Organisationen sind in Somaliland llltig.
"' Oie Sezession des Nordwesti11S wurde 1m SOden nie anerkannt '" Am 17.10.2000 wurde ein Mitglied der in Djibouti gegründeten Obergangsregierung, der "Chair·
mon of the National Demobihulion Authority". von einem wohl zur Truppe eines der wnrlords geh6=den Klimpfer erschossen (Anrum 2000: 4).
Copynghtcd malcria
98
Zur politischen Realität im SOden des Landes Ende 2000 schreibt der amtierende UN
Gcneralsckretär Kofi Annan in seinem Bericht: ,.ln thc ccntral and southcm parts of thc
country, the security situation continucs to bc uncertain and sometimes extrernely tense. [ ... ]
Banditry is rampant in Mogadisbu. Therc is no single authority for the maintcnancc of law and
ordcr. Significant parts of the city continue to bc under thc control of different militias ( .. .]"
(Annan 2000: 61).
Zu 2.) Auch im Hinterland, abseits der von den warlords umkämpften urbanen Zentren,
kam es zu zahlreichen Auseinandersetzungen, die zu extremen regionalen Fraktionierungen
fllbrten. Heiaoder schreibt mit Bezug auf die aktueUe Situation: "Thc only safe way of getting
an income is to set up yet another chcckpoint, blocking off an even smaller arca than before"
(Helander n.d.: 2). Besonders entlang des "Lower Sbebelle" und des �Lower Jubba", der zent·
ralen FlUsse SUdsomalias, kam es zu zah.lrcichen Gefechten um die Kontrolle des fruchtbaren
Bodens, dessen Ertrilge ökonomische Gewinne im Exporthandel versprachen. Am schlimms·
ten hatte die ansässige Bevölkerung der bodenbauenden Gosha zu leiden. Diese bezüglich
ihrer Abstammung nicht ,,rein" somalische Gruppe hatte innerhalb Somalias einen niedrigeren
soziopolitisehcn Status als die sie umgebenden Klans. Da die Gosha auch nicht an einer der
großen, vor allem von Ätbiopien mit Kriegsgerät unterstUtzten Oppositionsbewegungen in den
1980er Jahren partizipicn hatten, waren sie wesentlich schlechter bewaffnet als die Klaruni Ii·
zen. Somit stellten die Flussbewohner und ihr Besitz in den Zeiten das BUrgerkriegs und des
Staats7.erfalls eine leichte ,.Beute" im Rahmen der Plünderungsökonomie des Südens dar. Sie
wurden ausgeraubt und z.T. versklavt (siehe 6.5.1) (Menkhaus!Pcndcrgast 1995: 5f; Menk·
haus 1998: 222f; Cassanelli 1996: 14fl23; Prunier 1996: 3; Ahmed I. Samatar 2000: 45).
Daneben konnte jedoch in einigen Gebieten ,erfolgreich auf informelle religiöse und troditi·
onelle Ordnungsmuster zurückgegriffen werden, um die minimalen Aufgaben einer "day-to·
day govemance" (Menkhaus./Pendergast 1995: 4) zu erfllllen. Besonders Sharia-Gerichte
spielten in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Unter dem Rückgriff auf die von den
muslimischen Somali anerkannte islamische Gerichtsbarkeit, die Rechtsbrechern mit drasti·
sehen Sanktionen droht, gelang es z.B. Mitte der 1990er Jahre in dem von Mahdi kontrollier
ten nördlichen Teil Mogadishus, ein Mindestmaß an Sicherheit wicderhcrt:ustellcn. Die Sha·
ria-Gerichte breitete sich sowohl in der ehemal.igen Hauptstadt als auch im Hinterland weiter
aus. Auch die Anstellung von lokalen Aufpassem und Naehbarsehaftsschutzgruppen, die sich
aus jungen bewaffuetcn Männem zusammensetzten, trug im urbanen Kontext zur Eingren·
zung der Gewalt und Kriminalität bei (Men.khaus./Pcndergast 1995: 4; Heinrich 1997: 61; So-
Copynghtcd ma riR
99
rens/Wantchekon 2000: 61). Auch traditionelle Ordnungsmuster gewannen. ähnlich wie im
Nonien. allerdings in einem wesentlich begrenzteren Rahmen. wieder an Bedeutung. Wie
schon erwähnt, kamen im Frühjahr 1993 Repräsentanten verschiedener Merifle- und Digil
Kians in Boonka (Bay-Region) zusammen und vereinbarten die Einrichtung eines .,Guddiga
Malaqiiyada" (GM) genannten Ältestenrats. Obwohl dieses Gremium von den UN nicht offi
ziell als Verwaltungsorgan anerkannt wurde. ßbtc das GM faktisch die entscheidende politi
sche und rechtliche Autorität in der Bay-Rcgion aus .1s1 Auch in der Bakool-Region wurde ein
solches Komitee geschaffen. Die Arbeit dieser zwischen verschiedenen Klans vereinbarten
Ordnungsinstanzen bestand im wesentlichen aus dem Sammeln von Infonnationen und dem
flexiblen Eingreifen in .Dispute, weshalb die Mobilität der Räte sehr wichtig war und das GM
also nicht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit tagte Helandcr/Mukhtar/Lcwis
1995:5).
Der mr die sUdliehen Klans ungewöhnliche, durch die Kriegswirren gelllrdcrte genealogi
sche Fokus ffibrte einerseits zu regionalen Zusammenschlils.�en Ober Klangrenzen hinweg;
andererseits kam es jedoch in diesem Zusammenhang auf lokaler Ebene zu Zersplittenmgs
tcndcnzcn: Die lraditioncllcn Autoritäten vervielfachten sich; sowohl Konlc:u=· als auch
Allianzbeziehungen verfestigten sich. Auch die regionale Bewegungsfreiheit wurde auf Grund
der starken Abgrenzung von Zugehörigkeilen eingeschränkt. Zu jedem Klan gehörten bewaff
nete Milizen, die jedoch, im Unterschied zu vielen Kämpfem in Mogadishu, meist von ihren
Verwandtschaftsgruppen kontrolliert werden konnten; z.T. Obernahmen die Klanmilizen Poli
zeiaufgaben im Auftrag der Klanffihrcr (Helander/Mukhtar/Lcwis 19'J5: 6-8).
Es wird deutlich, dass in Südsomalia die Kämpfe und Verwüstungen in der zweiten Hälfte
der 199Qer Jahre weitergingen. Unter soziopolitischen Gesichtspunkten ergibt sich jedoch ein
durchaus differenziertes Bild des Südens: Während es in den letzten Jahren weder den war-
Iords noch internationalen Vermittlern gelang. einen stabilen machtpolitischen Rahmen zu
etablieren, konnte mit Hilfe des Rückgriffs auf religiöse und soziale Traditionen in einigen
Gebieten durchaus ein gewisses Maß an lokaler Ordnung erreicht werden.
111 Auf diesen Strukturen wurde auch in den folgenden Jahren aufgebaut. Oie Selbstverwaltung der Bay- und Bakoi-Region wurden auf einem grolkn shir in Hoddur im Jahr 1999 bekräftigt (Prunier 2000: 6). Lewis spncht sogar von einem autonomen • .Bay rcgion statc" mit der Hauptsbdt Baidoa, der gleichwertig neben Somoliland und Puntland besteht (Lewis 2000a: I; Lcwis etal. 1995: 9).
Copynghtcd malcria
/00
6.3 SCHLAGLICHT AUF DEN NORDOSTEN - "PUNTLAN0"182 in den nordöstlichen Regionen Bari, Nugal undi Mudugm vollzogen sich im letzten Jahrzehnt
ähnl.iche sozio-politischc Entwicklungen wie in Somaliland. Nach dem Zusammenbruch der
staatlichen Instanzen wurden traditionelle Autoritäten aktiv, um die Ordnung zu stabilisieren.
Die Voraussetzungen ftJr die Befriedung der Siruation waren hier sogar besser als in Sornali
land, da der Nordosten fast ausschließlich vom Majertcyn-Kian (Darod-Kianfamilie} bewohnt
wurde. Die bestimmende politische Kraft war die ,,Somali Salvation Democratic Front"
(SSDF}. Der Prozess der regionalen Stabilisierung wurde jedoch durch Auseinandersetzungen
innerhalb des Majerteyn-Kians bzw. innerhalb der SSDF, z.B. um die Verteilung der Gewinne
aus dem aber den Hafen Sosaso abgewickelten Handel, der seit der Schließung des Hafens
von Mogadishu enonn prosperierte, behindcn. Die große Zahl von Flüchtlingen aus den Bür
gerkriegsregionen belastete die sozioökonomische Lage zusätzlich. ln Abwesenheit von war
lords und plündernden Milizen gelang es, die vorhandenen Konflikte friedlich zu lösen.
Nachdem i n den Jalm:n zuvor dw-ch viele lokale Initiativen die Basis einer stabilen soziopoli
tischen Ordnung gelegt worden war, konnte man sich Mitte 1998 auf einem großen shir in
Garowe, der Hauptstadt der Nugal-Rcgion, auJ die Schaffung einer autonomen VerwaltWlg
mit Sitz in eben dieser Stadt einigen. Zum Obcrllaupt der Verwaltung Puntlands wurde Oberst
Yussuf Abdullahi, ein ehemaliger Komandeur der SSDF, gewählt. Im Gegensatz zu Somali
and verzichtete die politische Führung bisher darauf, diesen regionalen politischen Zusam
menschluss fllr unabhllngig zu erklären. Offiziell strebte man eine somalische Föderalion an.
Doch gegenwärtig mehren sich die Zeichen dafUr, dass auch Puntland an d•.,. Etablierung einer
slllbilen Eigenstaatlichkeil arbeitet (siehe Kapitel 7) (Mohamed 1997: 327f; Menkhaus 1998:
221 f; Prunier 2000: 3f; Hcirich 1997: 72-74}.
6.4 CHARAKTERISTIKA DER FRIEDUCHEN KONFLIKTAUSTRAGUNG IM RAHMEN DER TRADmON184
Charakteristisch ftJr die oben dargestellten FricdensbemOhungen. die in den 1990er Jahren vor
allem in Nord-, z.T. aber auch in SUdsomalia auf der Grundlage der vorhandenen Traditionen
"' Oie Seeleute des Alten Ägypt<ns nanntro die sorruolische KOste ,.Punt" (Prunier 2000: 7). '" Die von Dolbahante bewohnte Sonaag-Region an der Grenze zwischro Somaliland und Puntland
lut faktisch einen Sonderstatus zwischen beiden Vewahungen (Prunier 2000: 5). , .. Der Begriff • Tr.�dition" bezieht sich auf die sltirs als die Grundlage der friedlichro KonOikt.aus
tragung. Da jedoch die shirs um moderne KonfcrcnZlechnikt:n erweitert "'"'den und bei den Verhandlungen n:ttOrlich die auf die aktuelle KonOiktsitwnion bezogenen Inhalte im Vordrrgnmd
Copynghtcd ma riR
101
unternommen wurden, sind: 1.) die Rolle der verwandtschafilichen Netzwerlee beim Aufbau
einer Vertrauensbasis zwischen den Konlliktparteicn; 2.) die Verbindung fester Rahmenstruk
turen mit der enormen inhaltlichen Dynamik der Verhandlungsprozesse bzw. das Nebenein
ander von autorilllren und egalitären Strukturen; 3.) die Erarbeitung eines fllr alle Beteili!,'len
akzeptablen Konsens auf Basis gemeinsamer Werte und Traditionen; 4.) der direkte Bezug der
Vereinbarungen auf die Lebenswirklichkeit vor On; 5.) die soziale und religiöse Einbettung
der Abkommen.
Zu 1.) Die wichtigste Voraussetzung rur die Einleitung eines Friedensprozesses war die
V crhandlungswilligkcit aller Konfliktpaneicn. Bevor also mit der friedlichen Konfliktaustra
gung begonnen werden konnte, mussten lnfonnationen Uber die jeweiligen Positionen der
Beteiligten ausgetauscht werden.185 In diesem Zusammenbang spielten die in die patrilinear
kon."ituienen Gruppen eingeheirateten Frauen eine große Rolle. Da sie sowohl mit der Grup·
pc ihrer M!lnner und Söhne, als auch mit der Gruppe ihrer Väter und BrUder vernunden waren,
konnten Frauen im Falle von Konflikten zwischen Angehörigen dieser beiden Abstammungs
linien als effektive Vermittleriru1cn agieren. Sie konnten z.B. Klangrenzen Oberschreiten und
Informationen Ubermittcln, .,In ,Somaliland', this function lcd thcm to be labcll.t:d ,clan am
bassadors'" (Farah/Lcwis 1993: 55). Da auf sbirs nur Männcr Rederecht hatten, war der Bei
trag von Frauen zu den oben dargestellten Verhandlungsprozessen nur indirekter Natur: Ver
handlungsstillstände konnten in einigen F:illcn von Ältesten tibeiWUJldcn werden, die Gber
Heirat oder Geburt mit der gegnerischen Gruppe verbunden waren (Farah/Lewis 1993: 54-
56). '86
Auch im Hinblick auf die Stabilisierung des Friedens waren matrilineare Verbindungen
von Bedeutung, wie der in einem der in Sheikh abgeschlossenen Abkommen vereinbarte Aus
!Jlusch von Frauen zeigt (siehe 6.1.2). Dass dieser Vorgang ein grundlegendes Muster der
friedlichen Konßik!Jlustragung in Somalia darstellt, geht aus folgendem soßiJllisehen Sprich·
won hervor. ,,meesbii xinjiri ku daadato xab baa lagu bururiyaa- ,thc stains ofblood should
be cleansed with a fertile virgin Iady"' (Farab/Lewis 1993: 55).
standen (siehe 6.1.2), beinballet der Begriff ,.Tradition" an dieser Stelle eine Synt� alter und neuer Aspekte des Konfliktmanagement (Menkhaus 2000: 196).
'" Dies stimmt mit den allgemeinen Feststellungen Gullivers zu ,.Disputes and Negotiations• aberein (Gulliver 1979: Sf/701). Oie Rolle des Informationsflusses wahrend der Verhandlungen beschreibt dieser Autor in seinem zyklischen Verhandlungsmodell S. 83·120.
,,. Das politische Gewicht der Heiratsbeziehungen wurde in Abschnitt 3.2 schon im Zusammenhang mit dem von Mohamed Abdillc Hassan geleiteten Befreiungskampfes gegen die Kolonialherren erwähnt.
Copynghted matcria
JQ}
Zu 2.) Oie Versammlungen wurden stets von anerkannten Autoritäten, den in Guurtis zu
sammcngescblossencn Ältesten, ergänzt um Intellektuelle und Militllrs etc., initiiert und gelei
tet. Oie vereinbarten Abkommen wurden von diesen offiziellen Repr'.!sentanu:n der Konflikt
parteien unterschrieben. Diese Autoritäten bereiteten somit den legitimen Rahmen der
Friedenskonferenzen. Für den Erfolg der Verhandlungen waren jedoch nicht Beschlüsse "von
oben ... sondern die Einigung auf einer breiten gesellschaftlieber Basis entscheidend. Die Ver
bandlungsprozcsse waren sehr dynamisch: innerhalb eines weiten zeitlichen Rahmens wurde
ein FOlie von sehr verschiedenen Themen diskutiert. Die Inhalte der Diskussionen entwickel
ten sich im direkten Austausch zwischen den Konfliktparteien. Nur im Falle von Verhand
lungsblockaden gritTm WUrdenträger als Mediatoren ein.117
Zu 3.) Den dynamischen Vemandlungsprozcsse lagen gemeinsame religiöse und soziale
Werte und Traditionen zu Grunde. Diese konnten, wie z.B. der Glaubenssatz, dass die lebens
notwendigen natUrliehen Ressourcen Geschenke Allalts sind und ihre friedliche Nutzung so
mit allen Somali offen steht, instrumentalisiert werden, um die Gegensätze zwischen den
Konfliktparteien zu Uberwinden.
Die Vereinbarungen mussten in Abwesenheit zentraler Erzwingungsinstanzcn im Konsens
getroffen werden. Oie wichtigste Aufgabe der shirs war somit nicht, zu entscheiden, welche
Partei im Recht und welche im Unrecht war, sondern, in Abwägung der gegenseitigen SUirken
und Schwächen, eine stabile Basis flir die zukilnftigc Kooperation der ehemaligen Gegner zu
legen. Widersprüche zwischen den Verhandlungspartnern wurden entweder informell und
"diplomatisch .. gekllin oder "vertagt" (Farah/Lcwis 1993: 561).1" Diese Konsensstrategie
erforderte von allen Beteiligten, insbesondere den Mediatorcn, ein hohes Maß an Geduld. Die
Friedensprozesse waren also eher ,.prozess-.. als ,,produktorientiert". Ihr Fokus lag auf dem
Management von Konflikten und nicht auf deren cndgUltigcr Lösung (M.enkhaus 2000: 198).
Zu 4.) ln Folge der Bürgerkriegswirren bestand die Gefahr immer neuer Gewalteskalatio
nen: In dem stark militarisierten Umfeld drohten auf Grund der vergangeneo Auseinanderset
zungen viele Racheakte. Vor diesem Hintergrund war es ein zemrnles Interesse der auf den
'" Mediatoren fl!Uen, im <kgmsatz zu Richtern, micbt auf sich gesttUt autoritat iv< Entschtidung<o, sondern greifen vennittelnd und unterstOtund ein. Sie können dabei durchaus auch eigen< Ziele =folgen (Gulli= 1979: 209-2t4). Zu Rollen und Strategien der Mediation allgemein siehe ebd.: 219-231.
111 Gultiver schreibt bezOglieh dynamischer Verhandlungspro:u:ssc allgemein: "The instrinct contradiction here is between, on the onc band, the recognized conßict in which parties seek different objeetives at cach othcr's cxpcnsc and, on the other band, their need for joint action in order to achieve an outcome m circumstances whcrein neilher pany f<els able merely to impose his own demands upon 1hc olher" (Gulli.:C. 1979: 181 ).
Copynghtcd malcria
103
shirs versammelten Parteien, die rdSche und gewaltfreie Kompensation von geschehenem Un
recht einzuleiten. In manchen Fällen entschied man sich jedoch, vergangenes Unrecht unge
sOhnt zu lassen, um den Aufbau stabiler Kooperationsbeziehungen in der Gegenwart nicht zu
behindern. Insgesamt sprachen die Abkommen in Bezug auf die konkreten Schritte der Wie
derherstellung des Friedens lokalen Kontext eine klare Sprache: Die Strafen filr Rechtsbrecher
wurden drastisch fommliert; die Sanktionsgewalt wurde direkt den lokalen Verwandtschafts
gruppen übertragen.
Zu 5.) Die Konferenzen wurden am Anfang und am Ende von religiösen WUrdcntrllgem
(wadaads) gesegnet. Oie in Form eines xccr/hecr abgeschlossenen Abkommen wurden durch
einen Eid bekrllftigt. Religiöse und politische Autoritäten machten ihren Einfluss gehend und
verpflichteten sich, zum Gelingen der Verhandlungen und zur Einhaltung der Abkommen
beizutragen. Da diese Autoritl!ten besonders im Norden Somalias noch immer großen Respekt
genossen, wurden die Friedensprozesse durch die soziale und religiöse Einbettung wesentlich
unterstützt.
6.5 ETHNOLOGISCHE ANALYSE DES STAArSZERF ALLS UND DER
GEWALTESKALATION IN DEN 1990ER JAHREN
,, Wlaot mlght o"C't hm-e be�n N!ildlly conuiwtl ofm lht> 'totnlity' hus tllsappearetl slnce thr n·f'nts (if /991, and C'\'n)'OIW implicated in the proj«t of making scnsl' of SomalUJ proceeds with only panial und�ntandings of r.ontotalitles" (Btsttman /999: 43).
Auf der Grundlage der bisherigen Ausfilhrungen wird eine enorme Diskrepanz zwischen der
Lage im Norden und im SUden deutlich. Während im Norden die Krise des BUrgerkriegs und
des Staatszerfalls im Laufe der 1990er Jahre bewältigt werden koMte, herrscht in weiten Tei
len des Südens bis heute Gewalt und Chaos. 1m Folgenden soll versucht werden, die oben
dargestellten lokalen und regionalen Entwicklungen auf der Basis zentraler ethnologischer
Positionen zum Staatszerfall und zur Gewalteskalation in Somalia zu analysieren.
6.5.1 DIE FRAGE NACH DER RELEVANZ DER KLANSTRUKTUREN
In der aktuellen ethnologischen Literatur zu Somalia lassen sich zwei einander in wesentli-
chen Punkten diametral entgegenstehende Positionen erkc.nnen. Schlee vertriit in seinen
jUngsten Veröffentlichungen nachdrUcklieh die These, dass die Situation im Somalia der
1990er Jahre vor dem Hintergrund der Theorie der segmentären Gesellschaften analysiert
werden kann. Er nimmt generell an, dass dem Chaos, das nach dem Sturz Barres eskalierte,
Copynghlcd malcria
104
Klanrivalitäten zu Grunde lagen: "tbe country collapsed into numerous zones in which local
power-elites tried to gain control of rcssourccs on the basis of clan membership and clan alli·
ances" (Schlee 200 I: 16).1��'� Dem widerspricht Besteman in ihrem jUngst erschienen Buch zur
Geschichte und aktuellen Lage der Gosha, der Bewohner des Gebietes zwischen Sbebcllc und
Jubba: "(. .. ) I will be argujng against the view that the warfare that raged across the southem
'triangle of death • was a simple , war over ressources' in which clans fought to cl3im land"
(Besteman 1999: 22).
Im Folgenden werden beide Positionen genauer beleuchtet und gegeneinander abgewogen:
Schlee spricht in seinen hier verwendeten Publikationen allgemein von ,.Somalia", kon
zentriert sich aber auf den Süden, vor allem auli die Vorgänge im von Aideed und Mahdi samt
ihren jeweiligen Anhängern umkämpften Mogadishu. Hier kam es im Jahr 1991 zum Zerfall
des,, United Somali Congress" (USC), der Oppositionsbewegung der Hawiye, in das von Ai·
deed gefilhrte .. Somali National Movcment" (SNM) und die von Mahdi geleitete .,Somali Sal
vation Alliance" (SSA). Beide Fraktionsftlhrer wurden von ihrem jeweiligen Subklan im
Kampf um die Macht unterstützt.190 Dieses Beispiel der Feindschaft zwischen Aideed und
Mahdi untcnnaucrt nach Schlcc das in Bezug auf Somalia schon aus präkolonialen Zeiten
bekannte und !Ur die Theorie der segmenlllren Gesellschaften zentrale Prinzip, dass die inner·
gesellschaftlichen Konfliktlinien cnt!Jlng der Grenzen verwandtschaftHeb konstituierter Grup·
pen verlaufen. Auch die �.B. im Zusammenhang mit dem Kampf um Kismayo im Februar
1993 (siehe 5.3.2) relevanten Zusammenschlüsse zwischen verschiedenen Bürgerkriegspartei
en über verwandtschaftliche Grenzen hinweg lassen sich nach Schlee entsprechend traditio
neller Muster als xeer/hcer interpretieren. Er betont auf Basis dieser Beobachtungen, dass sich
in der gegenwärtigen KonOiktsituation in Somalia deutliche "Transkontinuitäten" erkennen
lassen. Mit diesem Begriff erfasst der Autor: "Elemente einer Sozialstruktur oder eines politi·
sehen Systems, die revolutionäre Umgestaltungen Oberdauern und sich - und sei es unter neu
en Be'Leichnungen Wld in anderem Gewande - Ober alle gesellschaftlichen Brüche hinweg
wiederfinden" (Scblee 1996: 146). Die Hauptunterschiede zu den aus präkolonialer Zeit be·
kannten Strukturen bestehen nach Schlee darin, dass die genealogische Tiefe der heutigen
'" Der Inhalt dieses AufsalUs ist weitgehend identisch mit dem 1996 cl'5chicnenen Text .. Regelmli· ßigkeiten im Chaos [ ... )". Dennoch zitiere ich an dieser Stelle die englische Version. da sich so der Widerspruch zwischen den z. T. fast wortglcichen, aber inhaltlich vollkommen entgegengesetZ1en Positionen Schices und Bestemans besser aufzdgm l!sst.
'"' Sowohl der Abgal-Subklan Aideeds als auch deT Gabr Gidir-Subklo.n Mahdis gehörten zum HernbKlon (Hawiye-Kianfamilie).
Copynghtcd malcria
105
Konfliktparteien geringer ist und das Eskalationsniveau der Gewalt auf Grund der weiten
V erbrcitung automatischer WalTen höher (Schlee 1996: 143-148: ders. 200 I: 16-21).
Schlcc selbst fasst zusammen: ,.ln spite of thesc outside interfercnces [die Einflllssc seitens
der Kolonialmlichte und der UN], of cxogcnous and cndogenous variations, howcvcr, thc ba
sie principles of group formation are those already described by LM. Lewis back in the period
of pax Britannica: namely patrilinear descend and contmct (xeer)" (Schlee 200 I: 27).
Besteman dagegen spricht in ihren Publikationen191 nicht generell von ,,Somalia", sondern
betont ausdrilcklich ihren Fokus auf das Gebiet zwischen den FlOssen Shebelle und Jubba und
auf die an den Ufern des Jubba lebenden Bodcnbaucrn, die sog . .. Gosha''. Während ihrer Feld
forschung am unteren Jubba zwischen 1987 und 1988 untersuchte Besteman die Siedlungs
und Sozialgeschichte dieser Bcvölkcrungsgruppe.192 Die wichtigsten Inhalte ihrer Arbeit, die
in Zusammenhang mit der in diesem Abschnitt behandelten Diskussion stehen, werden im
Folgenden kurz referiert:
lna 19.Jb. gelangten viele Menschen19l aus den umliegenden ostafrikanischen Gebieten als
Sklaven in den SOden des heutigen Somalia. Sie mussten auf den Plantagen und Feldern ent
lang des Shebellc�Fiusscs arbeiten, die von wohlhabenden Somali-Händlern und pastoral·
nomadischen Klans kontrolliert wurden. ln dieser Sklaven-Plantagen-ökonomie dienten die
importierten Arbeiter ausschließlieb der Bereicherung ihrer Herren und wurden nicht in ein
kooperatives Netzwerk inkorporicn, wie es schon früher in dieser Region zwischen boden·
bauenden, z.T. mit frtlher unterworfenen Bantugruppen vermischten. und viehhaltenden So
mali bestand (Besternan 1999: 49fl) . .,Siaves werc tbe ernbodiment ofkinless beings, divorccd
from tbe rcsponsibilities that rclations ofkinship cntail" (Desternan 1999: 53).
Viele geflohene Sklaven siedelten sich an den bewaldeten und schwer zugänglichen Ufern
des "Lower Jubba" an. Wltbrend sie sich zum!fchst von den anderen Bewohnern des Gebietes
abgrenzten, Obernahmen die Flussbewohner um die Jahrhundertwende unter dem Einfluss
splter zuströmender ehemaliger Sklaven, die schon als Kinder zu somatischen Gruppen ge
stoßen waren und deren Identität somit an die Identität ihrer Herren geknüpft war, die zentra
len Merkmale der Somali-Kultur: Islam, Klanbindungen1"' und die somalischc Sprache, in
'" Die folgenden Auslnhrungt:n beziehen sich ausschließlich auf die Monographie "Unravcling Somalia". Die wesentlichen Aussagen der Autorio finden sich knapp ZUS311UDC!lgcfasst in dem Arti· kel ,.violent politics".
191 Bestemans Auslnhrungc:n 1.llT Lage d<r Gosha nach 1991 beruhen auf Aussagen südsomatischer Flüchtlinge (Besteman 1996: 580).
191 Bis zu SO.OOO bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 300.000 ( Destoman 1999: 56). '" Die Form der Anbindung der Gosha an die im SOden Ichenden Klans wird mit dem Terminus .. ku
tirisan" ( .. leaning on") bezeichnet. Diese Bniehung ist nach Besteman schwächer als die ansons-
Co ya ghK-d ndlcria
106
Fom1 eines Af-Maymay genannten Dialekts (Besteman 1999: 60!1). Trotz ihrer Bemühungen
wn Integration und obwohl die Sklaverei Anfamg des 20. Jahrhunderts auf Druck der Koloni
almächte offiziell abgeschaffi worden war, beh.ielten die Gosha ihren niedrigen sozialen Status
(Bcstcman 1999: 61/87171 13). Selbst in der Zcit des ,.Scicnlific Socialism'·, als Barre offiziell
.,Nationalität" Gber �Kianzugehörigkeit" stellte. blieben die Gosha auf nationaler195 und loka
ler sotialcr Ebene stets den patoral-nomadischen Somali untergeordnet Die Flussbewohner
wurden als .,jarccr" stigmatisiert - dieser Ausdruck bezog sich auf die angeblich ,.harten" Haa
re der ehemaligen Sklaven und diente ihrer .,rassischen" Unterscheidung von den ,.wirkli
chen" Somali, deren Haare als ,.weich" galten (Besteman 1999: 113-115). Insgesamt entwi
ckelte sich im Laufe des 20.Jh. ein ,.racialized space" in Südsomalia (ßestcman 1999: 116).
Die Gosha wurden im sozialen196 und politisch-ökonomischen197 Bereich marginalisiert.
Dennoch konnten sie sieh in den ersten Jah:rzchntcn nach der Unabhängigkeit im Bereich
der Landwirtschaft eine autonome und stabile ökonomisch Basis aufbauen (Besteman 1999:
183). Diese Grundlage ihrer Existenz wurde angegriffen, als der Staat im Zuge der großange
legten Um- und Ansiedlungskampagne filr die von der Dürre 1974n5 betroffenen Nomaden
begann, staa�igcno Farmen im SOden aufzubauen. Der Zugri IT auf das Land entlang des JuiF
ba verst!lrk.te sich in den 1980er Jahren. Nach dem verlorenen Ogaden-Krieg bemühte sieb
Barre, seine Position durch wirtschaftliche Ein.gritTe in die Ökonomie zu stabilisieren. Dabei
geriet er im Norden in Konnikte mit den Klans, die sich dem staatlichen ZugritT durch ein
Ausweichen in die Schattenwirtschaft und durch bewaffnete Opposition entzogen. Im Süden
jedoch konnte die Regierung, gestützt auf internationale Hilfe, landwirtschaftliche Entwick
lungsprogramme initi.icren, die in Verbindung mit neuen Gesetzen den Bodenbauern des
,,Jubba River Vallcy" lc12.tlicb weitgehend die Kontrol.le über Produlctionsm.inel und Produk
tion entzogen. Bis Ende der 1980er Jahre gingen große Teile des Gosha-Landes zumindest
,.auf dem Papier", in Form von Rechtstiteln, in den Besitz des Staates bzw. der regierenden
Elite und ihrer Anhänger über (Besteman 1999: 181-1841203-223). Nach dem Zusammen-
ten im Zusammenhang mit den Rah:lßweyn· UJid Digii-Kianfamilicn bekannten Adoptionsb3nde (..sh«gat") (lkstcman 1999: 80).
,., Viele Gosha wurden in den 1970er/80er Jahren fllr die Mili!Aruntc:mchmungen gcgtt� Äthiopien und gegen Rebellen im Norden zwangsrckrutien ( Besteman 1999: 1281).
, .. Dies drOdc.te sich z.B. dari.n aus, dass die Dorfucwohner in Konflil.'tcn mit vorbcizicbcndcn, oft bewaffneten Pa.<toralnomaden fast immer unlerlagcn. selbst wenn slnlltlicbc Vermittlungsinstanzen angerufen wurden (Besteman 1999: 124-131).
191 Die Bewohner des .,Jubba Valley" waren auf Regierungsebene kaum präsent und profitierten somit nicht von dem inncrholb der Staatselite verteilten c:::<tc:mcn Ressourccnzufluss. Auch am "franco >'llluta"-System, das von den Somali aus dem Norden dominiert wurde, panizipienen d.ie sOdsomalischen Bodenbauern nicht (Bcstcman 1999: 196-198).
Copynghtcd ma riR
107
bruch des Staates vollendeten warlords, Plnnderergruppen und Klan-Milizen das von der
vonnaligen Staatselite begonnene Werk: Während i.n Mogadishu um die Kontrolle der Han
delsknotenpunkte gekämpft wurde, versuchten bcwaffn<"'e Banden im Jubba-Tal, sich die Op
tion :wf die zu handelnden Güter zu sichern. Die nur schlecht bewaffneten Bodenbauern die-
ser Region ilohcn, starben oder wurden wieder versklavt (Besteman 1999 2241).
Vor diesm Hintergrund fasst Besteman ihre Position folgendermaßen zusammen: "While
such connict found popular expression in the Somnli idiom of clan, to say that kinship, or
segmentary opposition, underlay the breakdown of the Somali state into genocidal violence is
a noncxplanation that ignorcs both thc domcstic rcpercussions ofSomalia's geopolitical status
during the l980s and its intemal hirachics" (Besteman 1999: 230).
Zu dieser Diskussion ist zu sagen: Vor dem Hintergrund der oben dargestellten sehr WJter
schiedlichen KonOiktverläufe in Nord- und in Südsomalia in den 1990er Jahren erscheint mir
Schices auf Mogadishu fixierter Ansatz zu undifferenziert.198 um der Analyse der gcgenw:!rti
gen Situation in ganz Somalia zu dienen. Im Norden verliefen sowohl die gewaltsamen Aus
einandersetzungen als auch die friedliche Konfliktaustragung entlang der Gren7..en genealogi
S�;ber Zugehörigkeit. Hier ist der von Schlee vertretene Klanfokus also durchaus sinnvoll.
Doch gende im Norden wurde die Gewalt rcl.ativ schnell WJter Kontrolle gebracht, während
sie im SOden weiter eskaliene. Demnach scheint die Theorie der segmentären Gesellschallen
eher den relativen Frieden im Norden als die extreme Desintegration der sozia-politischen
Ordnung im Silden zu erk1Aren.199 l..etztere Entwicklung wird eher vor dem Hintergrund von
Bestemans Untersuchungen, ergänzt um H.inweise anderer Autoren, verständlich:
Helandcr/Mukhtar/l..ewis weisen darauf hin., dass in der Zeit des Bürgerkrieges auch unter
den Klans des SOdens die .,reine" verwandtschallliehe Identität enonn an Bedeutung gewann.
ln diesem Zusammerthang warfen die Autoren die von ihnen selbst aus Glilndcn des begrenz
ten Studienfokus nicht weiter verfolgte Frage auf, welche AuswirkWJgcn diese Besinnung auf
die genealogischen Wurzeln auf die sog. "sheegad"-Gruppen hatte (Helander/Mukhtar/Lewis
1995: 61). Bestemans Studie kann m.E. als (Tell-) Antwort auf diese Frage gelesen werden: ln
den Zeiten allgemeiner Bedrohung lösten sic.h die Bindungen zwischen den ,,reinen" Somali-
"' Bei Schlee wiederholt sich der schon im Rahmen der ON-Intervention kritisi<11c Fokus auf Aidccd und Mahdi als die zentralen Figuren des somatischen BQrgerkrieges. Damit folgt dieser ansonsten sehr gcnau und difTerenzicn arbeitende Autor einnn weitverbreiteten Klischee, das die .. europl· isch-ammbnische" Rezepzion des Bürgerkrieges in Somalia prägt.
199 Genau an diesem Punkt setzt der Analyseansatz Bestemans ein: "An additional problern with the segmcntary lincage modcl is its inability to cxplain why so much of the dcstruction, thc militia wars. the looting. and the k:illings ha'� occurrcd in the fanning n:gions of the south" (Bcsteman 1999: 22).
Copynghtcd malcria
108
Klans und den genealogisch "obskuren" Gruppen wie den Gosha auf. Die Bodenbauern des
Jubba-Tals, die auf Grund ihres historisch verwurzelten niedrigen sozialen Status schon in der
Zeit existierender Staatlichkeil auf lokaler wie nationaler Ebene Übergriffe und Erniedrigun
gen erdulden mussten, waren nach dem Zusammenbruch jeglicher formaler Ordnung schutz
los den wesentlich bes.�er bewaffneten Klanmilizen, Plünderergruppen und warlords ausgelie
fert. Die Gosha waren wieder zu "kinless being.o;" geworden, die den ökonomischen
Wünschen der sie umgebenden Somali-Gruppen zu Diensten sein mussten. Hier wird, wenn
auch in Bezug auf den Grad der Gewalttätigkeit und die Selbstwahrnehmung der Unterdr11ck
tenl00 gewandelt, das prllkoloniale Herren-Sklaven-Verhältniss erkennbar. 201 Hinsichtlich die
ser Geschehnisse llissi sich m.E. treffender von "Trnnskontinuitäten" sprechen als, wie von
Schlee vorgeschlagen, in Be-�ug aufden Konflikt zwischen Aideed und Mahdi.202
Wie Schlee dazu kommt, in Bezug auf die warlord-Allianzen von ,,xeer" zu sprechen (s.o.),
ist unvcrstlindlich. Solche Verträge werden unter dem Vorsitz von anerkannten politischen
und religiösen Autoritäten auf allgemeinen shirs ausgehandelt. In der gesamten hier verwende
ten Literatur konnte ich keinen Hinweis darauf finden, dass es zwischen den warlord
Fraktionen zu einem ,.shir·ähnlichcn" Treffen gekommen wäre, auf dem sie ihre Waffenbru·
derschaJ\ besiegelt hanen, geschweige denn, da.ss die warlords selbst als Autoritllten im Sinne
der Tradition anerkannt worden wären.l03
Der Verweis auf die von tol und xeerlhccr geprägte segmentäre Gesellschallsordnung der
Somali dient der Erklärung der Gewalt im SUden nur bedingt: Die warlords und die PIOnde
rergruppen bedienten sich der traditionellen Strukturen, um Mitglieder zu rekrutieren. Auch
einige Klans im Soden hatten ein vitales Interesse an der Ausbeutung politischer und ökono-
,.. Die Bodenbauern des Jubba-Tales waren offi>jeJI und in ihrem Selbstverstlndnis .. Somali". ''" Auch Prunicr schreibt: [Aidecd] ,govcmcd' mainly by rcducing thc local pcople, c:speciolly the
non·Somali Bantu minorities, to a slave-lik.e starus. making them work. on tbe loeal banan plantations to eam export TC\'Cflues" (Prunicr 1996: 3) •
.., Auch Bestemans Sicht der warlords steht den diesbezOgliehen Positionen Sehlees entgegen:
"These warlords could uS<O the language and sentimenl of clan to rally allegiance along blood lines but built their aulhority on the power of the gun. Thcy becamc magncts for a gcneration of you1hs who h:ld grown up in an cra of poisoncd clan rclations, boken clan oulhority, nnd dcstroycd clan· based moral codcs ofconduct" (Bestcman 1996: 590f). ln Abschnitt 6.5.2 wird austnhrlich aufdie .. warlord-Diskussion'' eingegangen.
,., Vielmehr widerspricht der unbedingte Machtanspruch der Kriegsherren den egalitären soziopolitischcn Traditionen der Soma Ii. Bakonyi betont mit Bezug auf d1e warlords: ,,Diese Milnner haben in der traditionellen Ge>cllschafl Somalias keine Enlsprechlmg. Im Gegenlcil handelt es sich zu. meist um ehemalige leitende Staatsan gestellte, hoehrangigc Militiirs oder Geschäftsleut" (Bakony1 2002: 234).
Copynghtcd ma riR
109
miseher Ressourcen auf Kosten schwächerer Gruppen. >().I Im Gegensatz dazu zeigt das Bei
spiel des in der Bny-Rcgion etablierten ,.Guddiga Malaqiiya", dass im Süden traditionelle
Strukturen gerade abseits der warlord-Herrscbaften zur Stabilisierung des Friedens genutzt
wurden. Diese Traditionen \1/Urden von warlords, plündernden Banden und unkontrollierbaren
Klanmilizen bedroht.l<l' Die Gewalteskalation in und um Mogadishu basierte auf der Mis
sachtung traditioneller Ordnungsmuster: "There [im südlichen Somalia), traditional elders
were faced with heavily militarized gangs of youth who answcred to no one; mililia Ieaders
who rejected their authority; and whole zone:s of territority under conqucst by new clans�
(Mcnkhaus 1996: 5 l f; ders. 1998: 222).
ln seiner oben dargestellten Analyse der Lage i.n Somalia betont Schlee einseitig die Kon
flikt gerierenden Aspekte der segmentären Gcscllschaftsordnun�06 und vernachlässigt die
ebenfalls auf dieser Ordnung basierenden Strategien der friedlichen Konfliktaustragung. Mit
Blick auf die Entwicklungen im Norden und, in Grenzen, auch im Soden, wird klar, dass ge
rade dort, wo die scgment!ircn Strukturen wirksam wurden, die Gewalt im Laufe der Zeit un
ter Kontrolle gebracht werden konnte.
Um Konfusionen bei der Diskussion Ober die Rolle traditioneller Muster in der somali·
sehen Krise zu vcnncidcn, ist eine klare Trennung zwischen den Konfliktverliiufen in Nord
und in Südsomalia notwendig_ 207 Auch diese grobe regionale Trennung muss in ei.ner exaklen
"" Darauf weisen Menkhaus und Prendergast hin: .entire clans ( ... ( have benefited from the occupation of new and valuablc real estate in Mogadishu and the river valleys, ( .. . ) who would stand to lose considc:mbty in a P""CC !hat might i:nvolvc the retum of stolen property'' (Menkhaus�J>ren<krgast I 995: 2).
"" Menkhaus beschreibt. wie eine frieden.•konferen7, die im Februar 1994 in Kismayo stllttfand, kurz vor der Abschlusserklärung ,·on einem Milizenfiihrer, der um seine Macht filrehtete, sabotiert wurde (Menkhaus I 996: 52).
,.. ln einem aktuellen Tagungspaper schreibt Schtcc: .. ( ... ) lhe old ccntrifugal forces havc rcestabl.ished the nonnal state of disunjty among. tbe Somali" (Scblee 2000a: 5). NatOrl.icb möchte ich nicht grundsätzlich gegen die '"" Schlee hier Jconsllllienen zentrifugalen und Konflilcl generierenden Kriflc im somolischcn lincagcsystcm argumenticn:n. Aber vor dem Hintergrund der in Kapitel 6 herausgearbeiteten Pr=sse der friedl:ichen Konfliktaustragung im segmentAr geordneten Norden erscheint mir das Won vom . .normal state of disunity'' als Etkllrung der Gewalt in Somalia unzutreffend.
"" Indirekt bestätigt Schlce die Notwendigkeit dieser Nord-SOd-OlfTerenzierung in Bezug auf die Relevanz s<!gmcr>tlrcr Strukturen im somalischcn Bürgerkrieg selbst: ln seinem Aufsatz ,,RegelmAßigkcitcn ... " geht er in Anm. 37 auf die in dcnt t996 von Cassanelli und Besteman herausgegebenen Buch .,Tbe Struggle for Land in Southern Somalia" vertrrtenen Positionm ein, die im Wesentlichen mit der oben dargelegten Sichtweise Bestemans obereinstimmen. Schlee erkennt durchaus an, dass der in den Beitrigen dieses .Buches herausgearbeitete Fokus auf die Rolle der unterprivilegierten ,.Minoritäten" Südsomalias und ihrer Ökonomie im Bürgerkrieg dazu beitr!gt, zu verstehen, worum der Krieg in dieser Region ging (eben um die Arbeitskraft, das Utnd und die Produkte der Gosha). ln der weiteren Auseinandersetzung mit Cassanclli et al. versucht Scblee jedoch naehzuweisen, dass dieser .,Minoritllten-Fokus" nicht in der Lage ist, die Fonn des Konfliktes
Copynghlcd malcria
J/0
Analyse konsequenterweise weiter verfeinert werden (Menkhaus 1998: 221-223). Menkbaus
schreibt in diesem Sinne: ,Jostead, Somalia is better understood as tbree distinct political and
cconomic environments: zoncs of recovery [Nordwesten und Nordosten], crisis [vor allem
Mogadishu, Kisma}'ll und Jubbatal), and tr.msition [Zentmlsomalia und einige Gebiete im
Süden)" (Menkhaus 1998: 221 ). Diese Unterscheidung erscheint ja schon auf Grund der un
terschiedlichen kolonialen Erfahrungen in diesen Regionen geboten: Die Briten griffen in
Somaliland im Nordwesten wesentlich weniger in die soziopolitiscbcn und ökonomischen
Strukturen ein als die Italiener im SUden. Hier muss allerdings mit Blick auf die ebenfalls ita
lienisch beherrschte Region im Nordosten (Puntland) weiter differenziert werden: Der heutige
Unterschied zwischen den ehemaligen nördlichen und sUdlieben ital.ienischcn Kolonialgebie
ten lässt sich einerseits mit dem starken Fokus der Italiener auf den filr die Plantagenwirt
schaft geeigneten SUden erklären; hier trugen die Italiener mit dazu bei, die soziale Minder
wertigkeit der Gosha zu untermauern und so den erwähnten ,,rncialized space" aufzubauen,
indem sie die Abkömmlinge der Sklaven als Zwangsarbeiter missbrauchten (Besteman 1999:
118-122). Andererseits ist das Konfliktpotential im heutigen Puntland schlicht deswegen ge
ringer als im Süden, da der Nordosten fast ausscbließlich von einer Gruppe, den Majertcyn,
bewohnt wird. Im Norden blieben als Resultat der unterschiedlichen Kolonialherrschafien und
der dar.luf aufbauenden postkolonialen Entwicklungen traditionelle Ordnungsstrukturen bis
heute relevant, während sie im SUden unterminiert wurden und ihre gegenwärtige Wirkungs·
mächtigkeitsomit begrenzt ist (Farah/I.A:wis 1993: 26; Prunier 1994: 225; Sorens!Wantchekon
2000: 10).
6.5.2 SoZIALE STRUKTUREN IM BEREICH DER WARLORD-HEAASCIIAFTEN
ln diesem Abschnitt soll der oben schon angedeuteten Frage nachgegangen werden, inwiefern
die Auseinandersetzungen zwischen den warloro-fraktionen Aidecds und Mahdis .,präkoloni
alen Mustern" folgten und hier somit "Transkontinuitätcn" erkennbar werden. Auch hinsieht·
lieh dieser Fragestellung ist sich die ethnologische Forschung uneins:'Ol!
und die Frontverläufe zu erklären, da die Konfliktlinien ,.[ ... ) nJmlich innerhalb der relativ homogenen Gruppe der Nord-und Zentralsomali [ ... )" verlaufro (Schlee 1996: 1531). Schlee betont also selbst. dass zwischen den KonOikn'l:rlAufen i n Nord· und in SUdsomalia unterschieden werden muss und dass eben nur in Nord- und Zentralsomalia die segmentllren Strukru.ren wirklieh entsehc:idcnd waren. Worum Schlee dennoch immer wieder auf das Beispiel Aidccds und Mobdis zu. lil<:kgreift, um den Verlauf der jüngsten Gewaltnkalationcn in Somolia allgemein zu erklören, bleibt unverstandich.
"" Alle Untersuchungen der .. warlord-Gcscllschaficn" wcrden dadurch erschwert, dass auf Grund der Lebensgefahr in den von Kriegsherren beherrschten Regionen keine substantiellen f'eldforschun-
Co y11ghK-d .ndlcria
111
Bollig kommt in einem historischen Überblick hinsichtlich der soziopolitischen Organisa
tion gewaltoffener Räume. auch mit Blick auf die gegenwärtige Situation in Somalia, zu fol
gendem Schluss: ,,Allen Zeugnissen schent gemeinsam, da.<S sich die Gefolgschan von
Kriegsherren bliufig aus Entwurzelten zusammensetzt" (Bollig 1999: 436). Dem widerspricht
Schlee, mit Bezug auf die oben erwähnten Klanallianz�'ß der Kriegsherren, aber auch unter
Verweis auf die Praxis, Friegsgefangene auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten
Klan zu töten ( .. Todesgcnealogien"): .. Gerade lur Somalia konnte aufgezeigt werden, daß bei
der Fr:lktionicrung von Gruppen und der BildL.mg von Allianzen eben nicht die freie Will.kllr
von Kriegsherren herrscht, sondern dass diese Prozesse Mustern folgen, die wir schon in prä
kolonialer Zeit vorfinden" (Schlce 2000b: 83).2<)9
Seide Sichtweisen scheinen mir zu starl<. generalisierend, um wirklich hilfreich bei der A
nalyse der warlord-Hcrrschaficn zu sein. Auf Basis der Untersuchungen Marchals ergibt sich
ein wesentlich differenzierteres Bild: In der Beschäftigung mit dem Phänomen der .,Moory
aan", .,lhosc young boys. chcwing qaat and carrying weapons as tall as lhemsclves"(Marchal
1997: 196),210 die einen Teil der Gefolgschan Aidceds und Mahdis ausmachten, erkennt der
Autor verschiedene Facetten und Phasen der sozia-politischen Ordnung iMerhalb der Kllmp
fcrgruppen. Die Mitglieder einiger Gruppen entsprachen tatsächlich dem von Bollig beschrie
benen »Rambo-Typ"211 - mit skurrilen Assecoircs ausgestaltete, verschiedenste Drogen kon
sumierende und dadurch "unerschrockene" Einzelkämpfer. Der Drogenkonsum trug dazu bei,
dass die Gewalttlltigkeit einzelner Krieger außer Kontrolle geriet und sich gegen die eigenen
Verwandten richtet (Marchal 1997: 199!). Dieser "Typus" von Mooryaan stUtzt also eher die
(}berlegungcn Bolligs. Doch Marehai erwähnt auch, dass die Mooryaans z.T. Älteste rcspck-
gcn vor Ort möglich sind. Die im Folgenden dargelegten Positionen stellen also im Wesentlichen theoretische Überlegungen dar, die nicht auf aktuellen Eigenerfahrungen im Zentrum des Geschehens beruhen.
"" Oie von Schlee als Beweis der Relevanz segmentärer Strukturen im !kreich der wnrlordHerrschaficn angeflihrten "Todesgenealogicn" werden, zumindest m der von mir verwendeten Literatur. nur von Prunier erw�hnt, und zwar aus.drOcklich im ZusallUTM!llhang mit <kn K4mpfen der SNM gegen Regienmgstruppen im Norden Ende der J980er Jahre. Gerade im Norden war der Bürgerkrieg llllsäehlieh noch von Klanstrukturen geprl!gt: warlords spielten hier jedoch keine Rolle (Schlee 2000b: 83; Prunier 1990191: 116).
210 In Somaliland werden die kaum kontmllierborcn Freischärlergruppen ,.Ocydey" genannt; sie sind das Pendnnt zu den Moory:mn im Süden . • Mostly composcd of leenage boys and unmarricd mcn with limitcd or no urban and rural livestock weahh, the deydey dislike the elder generation and the Guurti in particular" (Farah/U:wis 1993: 60).
211 Bollig schreibt bezOglieb der Symbolik der K!lmpfcr in gewnhoffcncn Rl!umen: .,Sie posieren [ ... ] kampfbereit in Rambo-Manier eines universal warrfor mit T-Shirt, Stirnband, Kalashn.ikow und Patronengurt" (ßollig 1999: 439).
Copynghlcd malcria
/1'2
tierteo und Klanbeziehungen bei ibrern Vorgeben eine Rolle spielen konnten (Marchal 1997:
202). Dies wiederum weist auf die Relevanz von Schlees Position hin. Schlees Sicht wird zu.
dem von der Aussage eines Mitarbeiters des ,,Roten Halbmondes Somalia" !Ur die Anfangs
zeit der somatischen Krise gestützt, filr die Gegenwart jedoch wieder relativiert: • .Es scheint,
daß die Kriegsherren nicht mehr so wie liilher :aus ibrern jeweiligen Klan unterstützt werden"
(Haji 1 999: 42).212
Diese Diskussion deutet darauf hin, dass hinsichtlich der dominanten soziapolitischen
Strukturen im von warlord-Herrschaften, PIUnderergn1ppen und Klankonflikten zerrisseneo
Südsomalia gegenwärtig keine definitiven Aussagen möglich sind Einerseits weist die Situa·
tion in und um Mogadishu durchaus An7.eiche:n der von Elwert allgemein analysienen Öko
nomie der Gewaltmllrkte auf. Diese zeichnet sich durch einen mit größter Brutalität durchge
setzten Zugriff auf interne 1U1d externe Ressoull'Cen aus (EI wert 1997: 89). Andererseits folgte
die Gewalteskalation gerade in Jubbaland nicht ausschließlich den Prinzipien einer von skru
pellosen Untemelunern zweckrational organisierten ,,radikalfreien Marktwinscbaft" (Eiwen
1997: 92), sondern basiert, wie in Abschnitt 6.5.1 dargelegt. auch aufhistorisch verwunclten
sozialen Sttu.kturen. Zudem kann Südsomalia nicbt generell als ..gewaltoffencr Raum""J an·
gesehen werden. da hier ja parallel zur Gewalteskalation Strategien der Gewnlteind:lmmung,
die auf den traditionellen Sozialstrukturen basierten. lokal erfolgreich angewandt wurden. Die
durch externe Eingriffe und rnschen soziopolitischen Wandel dynamisierte Situation im Be
reich der warlord-Herrschaften entzieht sich so.,Ut jeglicher eindeutigen Analyse.
Mit Blick auf die Auslllhrungeo in den Abschnitten 6.5.1 und 6.5.2 ist festzustellen: Die
getrennte Betrachtung der Konlliktverll!ufe in Nord- und SUdsomalia sowie die klare Unter
scheidung ''traditioneller" und scheinbar "traditioneller" Strukturen in dem dynamischen Um
feld des Krieges in und um Mogadishu sind bei der Auseinandersetzung mit der somatischen
Krise in den 1990cr Jahren sinnvoll. Das von �hlee eingetuhne Konzept der "Transkontinui
tliten" ist hinsichtlieb der jOngsten Geschehnisse in Somalia relevant, allerdings in inhaltlich
und regional differenzierter Form: Im Norden erfasst es die Klanstrukturen; im SOden dagegen
kann die nicht-segmentär interpretierbare soziale Hierorchisierung, die letzilieh zur gewaltsa
men Ausbeutung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe lllhne, als Element der somatischen
"' ln diesem Interview crw!hnt Haji auch, dass das .. Internationale Komitee \'Om Roten Kreuz" (IKIU<) eine Studie Qber die traditionellen Regeln der 50malischen Kricgsfllluung mit dem Titel ..spared from spear" angestellt hat. Diese u.U. interessante Untersuchung zum Thema liegt mir Iei· der nicht vor.
"' Bollig nennt u.a. den Zerfall des Normen- Wld Wertesystems und die Auflösung vcrwandr:schaftlich organisierter Verbinde als Charakteristika gewaltoffener Rllume (Bollig 1999: 4321).
Cow1 ghtcd ma riR
/13
GcscUscba!lsordnung erkannt werden, das Ober alle gescllscha.filichen BrUche hinweg immer
wiedcrt.ufindcn ist.
6.5.3 ,.TRAOITIONAUSTEN" VERSUS ,.TRANSFORMA TIONISTEN"
Abschließend sollen diese Überlegungen zu dC'Il Ausfilhnmgcn in Abschniu 4.3 in Bezug ge
setzt werden: Oie in der Literatur venretenen Positionen hitt�ichtlich der Entwicklungen in
Somalia von 1960 bis heute lassen sich, gestUtzt auf Abdi I. Samat:u-114, grob in zwei ,.Lager"
einteilen: Ocr Fokus der .,Tr4ditionalisten"215 ist, aulbauend auf den Forschungen Lewis' in
den 1950er Jahren. auf die scgrnentlin.'ll Gcscllschaflsstrukturen und ihre Logik gerichtet. So·
wohl die somalische Staatlichkeil als auch der Bürgerkrieg und der darauffolgende Staatszer·
fall werden im Rahmen von Fusions- und Fissionstendenzen interpretien. Die .,Transformati
onisten'"'16 dagegen betonen. dass sich die soroalischen Gesellscbaftsstrul.:turen im Zuge des
starken Zuflusses externer Ressourcen nachhaltig veränden haben. Zudem waren im SUden,
wie vor allem Besteman betont, neben den verwandtschaftlichen Strukturen auch historisch
verwurzelte hierarchische Muster relcvant.211 Die Ausbeutung des Staates durch eine relativ
kleine Elite und der völlige Zerfall nationaler, regionaler und sogar lokaler Ordnungsstruktu·
ren, gefolgt von einer extremen Gewaltesknlation, ist nicht befriedigend mit dem Verweis nuf
die dynamische segmentäre Gesellschallsordnung zu erklären (Abdi I. Srunatar 1992: 626-
639).
Ich möchte mich keiner der beiden Seiten bedingungslos anschließen. Zweifellos sind die
segmentären Strukturen in Somalia bis heute wichtig und viele soziapolitische Entwicklungen
werden vor dem Hintergrund dieser dynrunischen Ordnung vcrstllndlich. Doch muss, wie A.l.
Samatar zu recht fordert, klar zwischen .,tol" und .,hccrixccr" einerseits und ,.clanism" ande
rerseits getrennt werden (Abdi I. Samatar I 9'92: 6291). Die Manipulation der segmenlllren
Strukturen durch die Staatselite um Barre wie auch durch die warlords, um individuelle
machtpolitische und ökonomische Bedürfnisse auf Kosten der Masse der Bevölkerung zu be
friedigen, entspricht nicht der traditionellen Gesellschansordnung. die zwar nie so friedlich
'" Dieser Autor spricht von ,.Trnditionalist Thesis" w1d "Transfonnationist Thesis" (Abdi I. Samatar 1992: 626162).
"' Hierzu sind z..B. Lewis. Laitin/S:unatar, Schlcc und Heycr zu rechnen. ". Dazu gehören z.B. A.l. Samatar, Besteman und Cassanclli. "' Bestetw111 ist somit nicht eindeutig auf der Seite der '1'ransformationisten" einzuordnen. Sie betont
zwar den EinOuss der Elitenbildung auf den Verlauf der politischen Entwicklungen in den 1980er Jahren. doch ihr Fokus auf dm .,111cializcd space" im Soden unterscheidet sie \'On anderen .,Transformationisten". die Besteman selbst als "Moterialists" bezeichnet (Beslcman I 999: 228).
Copynghlcd matcria
114
und dem.okratisch war, wie z.B. von AJ. Samatar suggeriert (Abdi I. Sarnatar 1992: 6301),218
in der Macht jedoch immer auf Kooperation aufbauen musste und somit neben Gewalt auch
Frieden eine sinnvolle Option war. Zudem ist es vor dem Hintergrund der Oberzeugenden
Ausfllhrungen Bestemans, die auch von anderen Autoren bestätigt werden, nicht sinnvoll, den
segmentlircn Fokus, gestUtzt auf zweifelhafte Verallgemeinerungen der vor einem halben
Jalubundert von Lewis im Nordwesten Somalias erforschten Verhlll tn isse, unhinterfragt auf
das ganze Land zu übertragen.
"' Schtee h!!lt dc:n Beschönigem der somoliscben Vergangc:nheit entgegen: "Insbesondere in benlg auf die Somali jedoch ist diese These von plikolonialer Friedfertigkeit geradezu absurd" (Schlee t996: 139).
Copynghlcd ma riR
115
7 DIBOUTI 2000 - "BACK TO TllE NATIONAL ROOTS"? ''f ... J thu CllrY'("Rt procas t.t out ofphas� M'rtJr tlrc r�aUtr'es in Somalit1 " (lldondtr IUI.: /).
7.1 VERLAUF UND ERGEBNISSE 1m September 1999 kündigte der Präsident Djiboutis, lsmail Omar Guelleh, vor der UN-
Gcncralversammlung in New York eine erneute Friedensinitiative !Ur Somalia an.219 Anfang
des Jahres 2000 begannen die Vorbereitung !Ur das grolle Treffen der somalischcn ,,Zivilge
sellschaft'.210 in Ojibouti: Im Januar wurden, unter Mitwirkung des Abgesandten des UN
Genernlsekretärs, Oavid Stephen, Gespräche mit den politischen Vertretern der autonomen
Regionen im Norden und im SOden gcftlhrt. 1m Miln kamen 60 somalische Intellektuelle aus
aller Welt in Djibouti zusammen, um beratend bei der Vorbereitung der Konferenz mitzuwir
ken; hier vertrat Mohamed Sahnoun die UN. Weitere Konsultationen mit wichtigen sozio
politischen Akteuren im Land, z.B. den Repräsentanten der Sharia-Geriehte in Mogadishu,
schlossen sich an {Annan 2000: 2).
Die ,,Somali National Pcace Conference" wunlc offiziell am 2.5.2000 in Arta, 30 km süd
lieb der Hauptstadt Djibouti, cröffitet. An der Konferenz nahmen, neben mehreren hundert
Beobachtern. melu als 650 somalische Delegierte, Vertreter verschiedener Klans, Intellektuel
le und Frauengruppen, teil. Bis Anfang Juni 'vurde die Agenda ausgearbeitet; deren zentrale
Punkte waren: 1.) Versöhnung der verfeindeten Gruppen; 2.) Bildung einer aUgemeinen Re
gierung; 3.) Erhalt der Einheit Somalias; 4.) RUckgabe allor materiellen und immateriellen
Vermögenswerte, die im Bürgerkrieg geraubt worden waren; 5.) Einhaltung und Schutz der
Menschenrechte; 6.) Bine um internationale Unterstützung (Somalia: Confercnce 2000: l). Im
Verlauf der Gespräche, die mehrere Monate dauerten und von einem Kulturprogramm beglei
tet wurden, erarbeiteten die Konferenzteilnehmer eine "Transitional National Ch..1rter". Man
einigte sich darauf, die neue politische Ordnung, ähnlich wie 1960, auf Basis von Klanzuge
hörigkeit z.u errichten. Allerdings wurden neben den vier Klanfraktionen {Darod, Digil
MeriOe, Dir, Hawiyc) auch erstmals Frauen- und Minoritätengruppen bei der Zusammenset
zung der zunl!chst auf drei Jnhrc befristeten Göergangsregierung ("Transitional National As
scmbly"ITNA) berücksichtigt. Viele der 245 Mitglieder des TNA waren schon unter Barre
219 Diese Initiative Wdr innerhalb von zehn Jahren der dreizehnte Versuch. untef internationaler V<rmittllDlg den Frieden und die Ordnung in der .• Republik Somalia" wiederher.rustellen.
"" Oie5<.'r gerade im somatischen Kontext unpräztse Ausdruck (Lcwis 2000a: I) sollte vor allem darauf hindeuten, da.'s auf dieser Konferenz nicht, wie frllher so oft, die Kriegsherren und Fraktionsfl:ihrtr im Zentrum standen. Es war das Ziel der Veranstalter. möglichst alle clcvanten sozio-politischen Akteure, von Fraucngnrppen b1s hin zu Ältesetcn, in die Gcsprlche einzubeziehen.
Copynghtcd malcria
ll6
politisch aktiv gewesen. Auch hatten einige von ihnen längen: Zeit im nordamerikanischen
oder europliseben Exil gelebt (Lewis 2000a: I f; IRIN Focus 2000: I).
Die aussichtsreichsten Kandidaten unter den 16 Bewerbern filr das Ami des Präsidenten
waren Abdullahi Ahmed Addow und Abdiqasim Salad Hassan, die beide schon im Barre
Regime hohe politische Ämler bekleidet hatten, sowie Ali Mahdi Mohamed, der ehemalige
Geschäftsmann, der seit 1991 einer der wichtigsten Fraktionsfllhrer im Kampf um Mogadishu
war. Alle drei sind Hawiye221; während Addow und Hassan jedoch dem Habr Gedir-Subklan
angehören, siOtzl sich Mahdi auf den Abgal-Subklan. Das TNA wählle schließlich am 26.
August Abdiqasim Salad Hassan zum neuen Präsidenten der ,,Republik Somalia". Er wurde
einen Tag später unter Teilnahme von Vertretern der UN, der OAU, der IGAD (Inter·
Govcrnmenta1 Authorily for Development) und einiger S1aa1en (z.B. Djibouti, Jemen. Sudan,
Ätbiopien. Eritrea, Frankreich, Italien) vereidigt. Der S!aal Djibouli, der den Hauptanteil der
Konferenzkosten getragen hatte, erhielt großes Lob von der internationalen Staatengemein
schaft, die den Prozess offiziell nur mit diplomatischer und materieller Hilfe begleitel hatte
(Aves 2000: 1f; IRIN WebSpecial 2000: lf; IRIN Focus 2000: lf; Annan 2000: 3/51).
7.2 PROBLEMATIK DES 0JIBOUTI·PROZESSES
An der .. Somali National Peace Conference" nahmen keine politisch autorisierten Vertreter
Somalilands und Puntlands teil. Zwar wurde dje Initiative Guellehs von Egal und Yusuf zu
nlk:hst grundslltzlich begrüßt; doch das Ziel der Konferenz, in AnknOpfung an die politischen
Strukturen vor 1991 eine somatische Zentralregierung mit Sitz in Mogadisbu zu etablieren.
wurde als Bedrohung der bisher erreichlen politischen Ordnung im Nordweslen und Nordos
ten empfunden und abgelehnt. Schon Anfang Juru 1999 ließ das BOro des Präsidenten von
Puntland verlauten: .. We believe, however, tbat Somalia shall never retum to thc uniiary sys
tem of govemment [ ... )" (Warsante 1999: 1). Im Mlln 2000 en11.og die Führung Puntlands
dem Friedensprozess ihre Unterstützung. Zwar nahmen noch im April einige Ältesle aus dem
Nordosten an den Vorbereitungen der Konferenz teil; doch nachdem sie in Garowe (Regie
rungssitz Puntlands) Bericht erstattet hatten, keltrten sie nicht nach Arta zurOck (Annan 2000:
S). Das kSomaliland Council of Elders" veröffentlichte im April 2000 eine Warnung an alle
Under und Individuen, die gegen die Unabhängigkeit Somalilands arbeiteten. Die Konferenz
in Djibouti wurde als .,politischer Angroff auf Somaliland" bezeichnet, der das Recht der
Völker auf Selbstbestimmung verletzt (Somaliland Council n.d.: I). Das ,.House of Represen-
Copynghtcd ma riR
1!7
tatives" erließ ein Gesetz, das allen Somaliländem jegliche Teilnahme an der Djibouti·
Konferenz bei hoher Strafe untersagte (Somaliland Council n.d.: 2). Die Regierungen Punt·
Iands und Somalilands venraten die Position. dass 7.un5chst die soz.io-politischen Strukturen
in SUdsomalia geordnet und stabilisicn werden sollten. Anschließend könnten mit einer aner·
kannten Führung des SUdcns Verhandlungen Ober die künfligc politische Ordnung im ganzen
Gebiet der ehemaligen Republik Somalia aufgenommen werden (Annan 2000: 2/4f; Warsame
1999: I; Somaliland Council n.d.: 1).
Auch wichtige politische Akteure im SOden standen dem Djibouti-Prozess distanzien ge·
genüber: Die Vertreter der in der Bay-Region sehr einnussreichen ,.Rahanwe)1l Resistanee
Army'' (RRA) verließen die laufenden Verhandlungen im Juni. Viele warlords. allen voran
Hussein Aideed, nahmen von vomherein nicht teil oder wurden bewusst ausgeschlossen (An·
nan 2000: 2; Lc:wis 2000a: I 1).
Insgesamt wird deutlich, dass die Konferenz nur von weniger als 50% der somalischen Be
völkerungm mitgetragen wurde. Zudem blieb Wlklar. wie das drängendste Problem SUdsoma
lias, die Beendigung der Gewaltherrschall der war Iords, gelöst werden sollte. Der Exilpräsi·
dcnt Hassan koMte Mogadishu zwar Ende August 2000 besuchen und wurde laut UN·Bericht
von der Bevölkerung freundlich empfangen. Doch war es seiner Regierung bisher urunöglich,
in dc.r von bewaffneten Banden und Kricgshcncn kontrc>llicnen ,,Hauptstadt" Fuß zu fassen
(Annan 2000: 3).m
Ein weiteres Problem ist, dass viele hohe P-ositionen in der neuen Regierung von ehemali·
gen Mitgliedern des Barre-Regimes, unter dem ein großer Teil der Bevölkenmg lange gelitten
hatw, und von Exii·Somalis. deren Yenrautheil mit den Verhältnissen vor On beschränkt ist,
bekleidet werden Lewis 2000a: 2; ders. 2000b: 2).
m Mogadishu liegt im traditionell von Haw1yc bewohnten und kontrollicrlen Territorium. 222 Jn Somaliland. Puntland und der Bay·Regton lebt über die Hälfte der Bewohner der ehemaligen
Republik So�mlia (Lcv.u 2000a: 2). '" Zwar ist nach jahrelangem Kleinkrieg der Einnuss der warlords mnerhalb und damit auch aulkr·
halb Somalias in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Sie sind jedoch noch stark genug. um eine in <k.T Bevölkerung nicht vcrankenc, im Exil aufgebaute Regierung z.urtlckzuschtagen. Anfang Miirz 2001 trafen sich die aktuellen .. Herren Mogsdisltus", Hussein Aideed, Osman Ali .Ano" und Musse Sudi Yotahow, erg3nzt um Mohamtd Said Hirs1 .Morgan" aus Kislllllyo, m Addis Abeba. Hier bekr!llib>trn sie ihre Opposition zur Regierung Hassans und insxenieneo S<Jmit einen neucn .. Akt" des somalischcn .. Tmucrspicl•" auf der internationalen .. BOhne" (Warlords op· posed 200 I : t ).
'" Gerade unter den lsaq sind die Reserniments gegen die schon untet Barre llltigon Mitglieder der 111 Djibouti gewählten Regierung sehr stark. Diese: werden 7-T. persönlich fnr das brutale Vorg<:hcn des Mililllrs gegen die Zivilbevölkerung im Nordcn Ende der t 980er Jahre ,·erantwortlich gemacht und gelten somit als . .Kriegsvcrbrecht-r". Zudem schilrt der in Djibouti verfolgte Fokus auf Moga·
Copynghlcd ma riR
118
7.3 8EWER1UNG DER ERGEBNISSE Im Zenlrum der Diskussion Ober die jüngste Djibouti-lnitiative steht die Frage IUICh ihrer Rc-
präsentativität und, damit verknüpft, nach der Legitimität der hier erarbeiteten Ergebnisse.
Auf der ,,Somali National Peace Conference" wurden einige wichtige Aspekte traditioneller
Entscheidungs/indungsprozesse im traditionellen somalischen Kontext berücksichtig: Der zeitliche Ralunen war weit gesteckt; traditionelle Autoritäten waren, neben einem breiten
Spektrum weiterer soziopolitischer Akteure, an den Verhandlungen beteiligt; auch auf die
kulturelle Einbettung der Konferenz wurde geachtet, indem z.B. somalische Poeten auftraten,
die inhaltlich zur Diskussion beitrugen.m Im Vergleich mit den UN-BcmUhungen Anfang der
1990er Jahre, die im wesentlichen auf eine rasche Lösung der somalischen Krise unter Be
rücksichtigung der Interessen der warlords ausgerichtet gewesen waren, stellte der Djibouti
Prozess also durchaus einen Fortschilt dar. Dennoch kann die Konferenz nicht, wie z.B. die
Versammlung io Borarna 1993, als modernes shir bezeichnet werden. Die Agenda folgte in
haltlich einem in allen zentralen Punkten von den Interessen der internationalen Staatenge
meinschaft geprägten ,.top down" -Ansatz: Obwohl die Entwicklungen im Norden und in eini
gen Gebieten des SU<Iens gezeigt hatten, lbss nw in lokaler "Kieinarbeir.226 eine stabile Basis
filr den Aufuau Obergeordneter formaler Strukturen gelegt werden konnte, wurde in Djibouti
von Beginn an die Einrichtung einer Zentralregierung angestrebt. Auch das Vorhaben, den
Ausgleich des im Vedauf der Wirren der 199Qer Jahre geschehenen Unrechts mittels einer
zentralen Verordnung einzuleiten, entbehr1e jeglicher Sensibilität filr die durchaus bekannte
Komplexität der Friedensarbeit: Eine erkennbare ,.Lehre" des Friedensprozesses in Somali
land ist, dass Rechtsnormen in den unsicheren Zeiten des Wiederaufbaus der soziopolitischen
Ordnung nur auf Basis des Konsens' der direkt beteiligten Gruppen vor Ort durchgesetzt wer
den können.
Doch in Djibouti wurden nicht nur wichtige. im Norden Somalias gewonnene Erkenntnisse
in Bezug auf die Strategien der friedlichen Konfliktaustragung ignorie.-t.m Es wurden sogar
dishu die im Norden schon seit 1960 bestebenden Ängste vor einer bedingungslosen Unterordnung unter die •. sOdli<:he Herrschaft" (Somaliland Forum 2000: I t): Helander n.d.: 2).
"' In dem "web spccial" von IRIN (lntegnued Regional lnfonnation Nctworks) wird der Aullrih des Poctc:n Abdukadir Hirsi "Yam Yam" besonders hervorgehoben (IRIN WebSpecial 2000: 4).
226 Dies implizicn auch. dass Verhandlungen nicht außerhalb Somalias gefllhrt werden, sendem durchaus ein regionaler Bezug zum Konfliktgeschehen erlulltcn wird, um die Spannungen vor Ort wirklich erfassen und de�kalieren zu können (Lewis 2000a: 2).
"' Das erschreckende Ausmaß der Ignoranz auf Ebene der internationalen Politik gegenober den regionalen Rcalillitcn in Somalia korrunt im aktuellen Bericht des UN-G<neralsekretlirs zum Ausdruck: Annan schreibt. dass die Lage im Nordwesten und Nordosten relativ ruhig ist. Doch nnstatt nach den Gründen fllr diese im Vergleich zur Situation in weiten Teilen des Südens <ntaunliche
CowughK-d oßd riR
1/9
neue Spannungen inncrbalb221 und zwischen den Regionen generiert, indem man gegen die
Positionen Somalilands und Puntlands die Eintiteit Somalias in den Grenzen der früheren Re
pu.blik festgeschrieb. Die Festlegung zentalstaatlicher Strukturen erhöhte zudem die Wahr
scheindlichkcit neuer Machtkämpfe mit und u:nter den warlords in Mogadishu stark, die un
verb.ohlen mit einer erneuten Gewalteskalation drohten (Annan 2000: 5; Lewis 2000b: 3).
AU diese offc:nsichtlichcn Unzulänglichkeiten, die von Anfang an einer wirklichen Befrie
dung Somalias auf Basis der von dem Präsidenten Djiboutis initiierten und von der internatio
nalen Gemeinschaft unterstUtzten Konferenz entgegenstanden, nähren den Verdacht einer
"hidden agcnda" l29 ln diesem Zusammenhang werden von Lewis jedoch zwei m.E. wider
sprUchliehe Faktoren genannt: Der seit der Widerherstellung der regionalen Ordnung "boo
mende" Hafen Berbern steht in direkter ökonomischer Konkurrenz zum Hafen Djibouti . Inso
fern könnt.e tatsächlich die Entmachtung Somalilands durch die Etablierung einer zentralen,
Djibouti vetpflichtetcn Regierung in Mogadishu eine Rolle bei Guellehs Bemühungen gespielt
haben. Die EU dagegen dOrflc ein vitales lntcressc an der raschen Wiederberstellung der so
matischen Staatlichkeil haben, um die im Zuge des Bürgerkrieges und des Staatszerfalls ge
flohenen Somali wieder in ihre Heimat entlassen zu können. Dabei wäre allerdings die regio
nale Dcstabilisierung. die mit der Entmachtung Somalilands sehr wahrscheindlieh
einhergehen würde, hinderlich (Lewis 2000a: 21).
Zusammenfassend wird klar: Die jüngste Friedenskonferenz in Djibouti war in Bezug auf
die somatische Bevölkerung nicht repräsentativ. Somit kann auch die dort etablierte somati
sche Regierung keinerlei ,JUitionalc" Legitimität beanspruchen. Vielmehr stellte der Djibouti
Prozess wiederum eine externe, diesmal jedoch auf die politische Ebene beschrilnkte, Inter
vention dar, die von "curozentrisehcn" bzw. "westlichen" Vorgaben und außersomatischen
Interessen geprägt war (Lewis 2000a: 3). Doch die Konferenz war nicht nur im Hinblick auf
die "somatische Realität", sondern auch i n Bezug auf die in Anmerkung 105 erwähnten Kon-
,.Ruhe .. �u frag�n. stellt er wenige Seiten spltcr pauschal fest: .. Thr Djibouti initiative for pcacc in Somalia was a wcltomc devdopment that was Jaunched in the abscnce of any othc:r viable peacc process in the country ( ... )" Annan 2000: 10; vgl. ebd.: 6).
l1i So versuchten z.B. Mitglieder der puntlllndischen Opposition, die an der Konferenz teilnahmen, die in Ojibouti verwendete nationale Rhetorik fllt ihre regionalen Machtinteressen a=utzcn: vgl. Helander, S. I. Dies erinnert an die Situation in Somaliland in den Jahren 1993-1995. als sich der abgeWählte Prasident Ali Tuur die von UN und Aidecd \'crtretcne nationale Position zu eigen mochte, um den Machtkampf in Somuliland flir sich und seine Verwandtschaftsgruppe zu entscheiden.
m Damit ist eine ,.vc:rstcckte Absicht" gemeint Hier bez1ehe ich mich auf ein Konzept, das 7..itelmann 1m Zusammenhang mit dem Konflikt um den .. Oromiya Regional Statc" in Äthiopien erwähnt (Zitelmann 1999: 5).
Copynghtcd ma riR
120
7.cpt von "empirischer" und "fonnalet' Staatlichkeil fehlgeleitet: Die ,.empirisch"230 in ihrem
Henschaftsbereich legitimen Ordnungen in Somaliland und Puntland wutden ausgegrenzt.
Stattd�scn konslnlierte man, wie schon am Ende der Kolonialzeit. eine rein ,.fonnale" staatli·
ehe ,.HUlle".231 Der im land selbst nicht aner.kannte Präsident Hassan wurde auf Ebene der
Staatengemeinschaft protegiert und gefOrdert. Unmittelbar nach seiner Amtseinfllhrung nahm
er an mehreren internationalen Großercignissen, wie z.B. dem "Millennium Summit" der UN in New York teil (Annan 2000: 3f).m Im Gegensatz dazu blieben die Vertreter Sornalilands
und Puntlands diplomatisch isoliert.m
Ein Vergleich zwischen dem jDngsten Djibouti-Prozess und dem UN-Engagement Anfang
der 1990er Jahre verdeutlicht. dass die Handlungsmuster gleich geblieben sind, auch wenn das
,.Ambiente" verändert wurde: Frieden und Ordnung sott nach ,,westlichen" Vorstellungen
gemacht werden w1d nicht "unkontrolliert" bzw. außerhalb der bekannten Raster staatlicher
Ordnung enwehen. ,.Tbc Somalis havc had sevcral years of hell, I !hink, to rcllect. I !hink the atmospherc is
very positive now " (David Stephen in lRJN WebSpecial 2000: 2). Dieses angesichts der bis·
herigcn Rolle der internationalen Gemeinschaft in Somalia an Zynismus nur schwer zu Ober·
bietende Statement des ON-Repräsentanten David Stephen im Rahmen der Djibouti·
Konferenz illustriert die potentiell destruktive Ratlosigkeit, die immer noch auf Ebene der
internationalen Staatengemeinschaft gegenüber den somatischen Verhältnissen herrscht.
vo Hier muss allerdings die Maxime Webers (vgl. Anm. 105) vom legitimen, zentralen Gewalunonopol relativiert werden: Die S12bilitllt in den autonomen Regionen beruht im wesentlichen auf ei· nern ,,Klan-Arnngernenl": Zentrale Entscheidungen mUssen von den vor Ort dominierenden Yt:r· wandtschaftsgruppcn milgttragen werden, um durchsetzungsfähig zu sein. Doch dieses auf Konsens beruhend ,.Gewaltmonopol" kann durchaus transparenc und im wehersehen Sin.ne legitim sein. Um dies abschließend zu beut1eilen. mas:ste man z.B. die aktuelle somalil!ndische Verfas· sung in Verbindung mit den gegenwärtigen politischen Entwicklungen vor Ort eingehend untersuchen. Hier sei angemerkt, dass auch in der Bundesrepublik, deren untralstaaUiches Gewaltmono· pol theoretisch nichl in Frage steh� im Bereich der Ökonomie staatliche Entscheidungen in der Praxis zunehmend im Konsens mit den ,.vor Ort·· m!lcbtigen Akteuren getroffen werden.
m Die Politikwissenschaftler Sorcns und Wantchekon kons121ieren in diesem Zusammenhang: "The fact that social ordcr could be created in Northem Somalia without outside intcrference rcprescnts an imponant departure from the historie experi.ence of mosc African Sl2tes where state has been created from the cop by colonial powersrt (Soren:s!Wantchekon 2000: 10).
"' In seinem sehr kritischen Kornmetar interpretiert l.el.is die internationale Unterstützung zugespitzt: "{ ... ] it is clear tlut the UN has in fact created a ncw milituy faction which is busy importing arms from Y emen to challenge ehe established warlords in the South" (Le .. is 2000b: 2). Lewis • Sicht wird von Bussein rudeed besliitigt, der in Präsident IIassan "einen weiteren lokalen Führer'' und somit einen Ri\'2len erkannte (Helander n.d.: 4).
m Im Herbst 2000 reiste der Außenminister Somaljlands, Mohamoud Salch Nur, in die USA, um auf das durch die Djibouti-Konfercnz generierte Konfliktpotenzial hinzuweisen und um die Anerken·
Copynqhled malcria
121
Vor Ort hat die Regierungsbildung in Djibouti bisher kaum zur Friedenskonsolidierung
beigetragen. Im Gegenteil hat sich die Gefahr erneuter regionaler Auseinandersetzungen, auch
unter Einflussnahme von Seiten Äthiopiens, erhöht (Bakonyi 2002: 236).
7.4 ÜBERLEGUNGEN ZU DEN CHANCEN EINER STAATLICHEN ÜRDNUNG IM GEBIET DER EHEMALIGEN REPUBLIK SOMALJA
.. [ ... ] th� d<1minont tharncttristi..:oftlre.political hmd.J('UP� U ru,/kal loculizution·· (Menl:huw 1998: 111).
Im Jahr 1995 erstellten Politikwissenschaftler und Ethnologen der "London School of Eco
nomics" (LSE) im Au firag der EU eine Smdie, die sich mit den Optionen der politischen Re
konstruktion Somalias beschäftigt. Vier Modelle von Staatlichkeil wurden vorgestellt: Konfö
deration, föderales System, dezentralisierter Einheitsstaat und ,.Consociation''. Die ersten drei
Systeme basieren auf der Territorialität; eigenständige Staaten, weitgehend autonome Regio
nalregierungen oder von einer Zentrdlregicrung mit Entscheidungsbefugnis ausgestattete Re
gionen sind unterschiedlich intensiv zusammcngo"Sehlosscn. Nur im fMeralen System und im
dezentralisierten Einheitsstaat ist eine regional übergreifende Zentralregierung vorhanden. Das
"consociational system" ist kein territoriales Modell, sondem regelt mittels Quoten, Vetorecht
etc. die Beteiligung der verschiedenen sozialen Gruppen an der Macht (Lewis et al. 1995: 12-
1 5). Die Studiengntppe bemühte sich, die theoretischen Konzepte in Ber.ug zur Praxis in ver
schiedenen Staaten und auch zu den konkreten Verhaltnissen in Somalia zu setzen; am Ende
der Studie wurden die Voneile und Nachteile: jedes Modells =mmcngcfasst (Lcwis ct al.
1995: 12-32).
Im meiner Arbeit soll nicht weiter auf diese theoretischen und im Rahmen der Studie be
züglich der Ökonomie, der staatlichen Admi.nistraion. des Rechtssystems ete. im Detail ausge
arbeiteten Überlegungen eingegangen werden. Sie sollen vielmehr in Bezug zu der Situation
gesetzt werden, die sich im Zusarrunenhang mit der jüngsten Djibouti-lnitiatve herauskristalli
sien hat: Keine der autonomen Regionen, die den Djibouti-Prozess ablehnten, waren grund
sJltzlich gegen eine umfassende Rekonstruktion von Frieden und Ordnung in Somalia. Im
Liebte der Positionen Somalilands, Puntlands und der Vertreter der stabilen Regionen des
Südens wäre die gegenwärtig nahcliegendste Option die Bildung einer Konföderation, die
nung eines diplomatischen Sonderstatus' fiir Somatiland 7ß erwirken. Er wu.rde weder von der IJSRegierung noch von der UN unterst0121 {DJtbollri Deal 2000: I).
Copynghtcd ma riR
122
sukzessive in eine Föderation umgewandelt wird. m Dies wOrde jedoch auch auf internationa
ler Ebene zunächst die Anerkennung der ,,radikalen Lokalisienmgk in Somalia voraussetzen.
1n diesem Sinne könnte mittels gezielter und begrenz.ter staatlicher und nicht-staatlicher Hilfe,
z.B. in Bereichen wie Demobilisierung und Gesundheitsversorgung, zur Stabilisierung der
Lage in Mogadishu und in den anderen Regionen beigetragen werden. Eine umfassende politi·
sche Ordnung fUr das ganze Gebiet der ehemaligen Republik Somalia erscheint gegenwärtig
nicht erreichbar. Alle diesbezüglichen zukünftigen Anstrengungen müssen, wie schon die bis·
herigen regionalen Rerkonstruktionsprozesse, in erster Linie von der somalischen Bevölke
rung vor Ort unternommen werden. Das ,.Credo" der kritischen ethnologischen und politilogi
schcn Beschäftigung mit der Entwicklung der zukünftigen Staatlichkeil in Somalia in den
letzten zehn Jahren lässt sich mit folgenden Aussagen erfassen:
Schon im Jahr 1993 empfahl Lewis: ,.Clearly, the Somalis sould be left to choose their own
Ieaders, howcver long-drawn the process. What the international community can helpfully do,
in addition to supplying humanitarian aid as needed (but not to excess) is to try to establish a
secure environment [vor Ort, nicht im Exil!) in which local leaders can come to the fore and
armcd militias will seem less ncccssary for suiVival" (Lcwis 1993: 2). Inhaltlich eine sehr lihn·
liehe Position vertritt Brons in ihrer jüngsten Publikation: ,.[ ... ] 1 argue that the peace and sc
curity of Somali society will best he served by strengthening those ernerging political struc
tures that already have the finn backing of their inhabitants" (Brons 2001 : 218).
"' ln diesem Sinne kamen auch Vertreter Puntlands, der ,,Rah•nweyn Rtsisl3nce Army" und des "Somali Patriotic Movemcnt", die sich F.nde Oktober 2000 in Garowe 1n1fen, Oberein (Annan 2000: 5; Somal.iland Forum 2000: 3f; Somaliland Couneil n.d.: 1).
Copyngh!cd ma riR
123
8 SOMAUA UND DER TERROR
.,Dtt.r Spii!Yn des Tt•rrorsfoltrrn imm!!r h'irdn 1UJeh Scmalra " (/Jimbttwn 11)02: 16)
Somalia geriet schon bald nach den Anschlägen vom II. September in das Fadenkreuz dc.r
.,Ami-Terror-Allianz". Al-Qu'aida soll Anfang der 1990er Jahre Trainingscamps in Südsoma
lia unterballen haben; die in Somalia ansässige al-lttihad al-lslamyya (lsl:unische Union) so
wie das somatische Finanzinstitut al-Barakat. das u.a. Träger des somatischen Telekommuni
kationsnetzes ist,235 gelten als Verbündete Bin J!..adens {Nord 2002: I; Zitelmann 2002: 311 0).
8.1 SPEKULATIONEN UND GERÜCIHE
Bei eingehender Betrachtung zeigt sich, dass f1lr die Verbindungen von Somalia mit Bin La
dens Terrornetz in der öffentlichen und politischen Diskussion weniger Tatsachen, sondern I.)
Spekulationen und 2.) Gerüchte von Bedeutung sind.
Zu 1.) Ein oberflächlicher Blick auf die Verhältnisse in Somalia ftlhn unter Rückgriff nuf
die fast scl10n topisch gebrauchten. medienwirksamen Schlagwörter von "Anarchie" und
"Chaos" leicht zu der Einschätzung, dass Somalia, das ,.schwane Loch" am Horn von Afrika,
eine Bedrohung flir die Region und die ganze Welt darstellt. Nur Terroristen können sich in
einem implodierten Staat wohlfilhlen (Birnbaum 2002: 163). Zitelmann betonte in einem
jilngst am MalC Planck Institute for Social Anthropology in Halle/Saale gehaltenem Vortrag:
"Somalia, as a [lOtential initial place for global tcrrorist actions, is less defined by an alarming
agency than by structurnl features as a faill-d statc, the power of warlords, violencc-open
spaces and ,markets ofviolence··· (Zitelmann 2002: 3).
Die Spekulationen bezüglich der strukturellen Eignung Somalias als zerfallener Staat flir
den Aufbau einer internationalen terroristischen Infrastruktur gehen aus zwei Grilnden an der
Realität vorbei. Zum einen haben sich. wie in .Kapitel 6 gezeigt, in einigen Teilen des Landes
durchaus stabile soziopolitische Strukturen und somit auch ein Maß an politischer Tr.mspa
renz herausgebildet. Die Duldung von Terroristen, die angesichts d<.'T intemationalen politi
schen Lngc sehr wahrscheinlieb einen nmcrikan.ischcn :VIilitärschlag nach sich ziehen wUrde,
wäre kaum im Interesse der Regierungen in den autonomen Regionen. Zum anderen könnten
sich international gesuchte Terroristen in den noch instabilen Gebieten des SOdens kaum si
cher fühlen. Sie würden zur .. Manövriermasse" im Wettstreit der warlords, die u.U. mehr an
lU Am 22. November 2001 wurden im Zuge der mtcmation>len Terrorismusbekämpfung die Auslnndsvcrbindungcn der Bank scknppt und ihre internatiOnalen Konten eingefroren. Unter diesen Maßnahmen leidet vornehmlich die Zivilbevölkerung, da die Kommunikation mit dtm Ausland
Copyngh!cd malcria
114
den auf die Ergreifung der Terroristen ausgesetzten PrM!ien interessiert wl!ren als an islami
scher Solidarität. Diese steht ja eher im Widerspruch zu dem egoistischen Gegeneinander der
warlord- und PIOnderergruppen (Farah 2002: I f). Ein Angriff von außen könnte die Lage je
doch, wie schon 1993 im Falle Aideeds, fundamental verlindern und zu einer Solidarisierung
vieler Somalis mit den Jslamisten gegen die Invasoren fiihrcn.
Zu 2.) Die Verantwortung !Ur die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Somalis und
amerilcanischen Truppen am 3. Oktober 1993, bei denen .18 Amerikaner und ca. 500 Somalis
starben (vgl. 5.3.3), wurde jahrelang Aideed angelastet. Im Jahr 1997 ilußene sich Bin Laden
erstmals in einem Interview zu einer Beteiligung des ai-Qu'aida Netzwerkes an den K!l.mpfen
in Mogadishu. Diese unkonkreten Andeutungen verdichteten sich im Lauf der folgenden Jah
re, wesentlich gelbrdert durch die Anschläge auf die amerikanischen Botschaften in Nairobi
und Darcssalam im August 1998 und auf die Spitze getrieben in Folge der internationalen
Terroristenjagd nach den Anschlägen vom I I . September 2001, zu dem Gerücht, dass es ein
islamistisches Netzwerk von Bin Ladens Gnaden am Horn von Afrika gllbe (Zitelmann 2002:
8f).
Generell zeichnen sich Gcrilchtc dadurch aus; dass sie weder verifiziert noch falsifiziert werden können (Zitelmaoo 2002: 4). Unkritische und oberOächliche Interpretationen komple
xer Ereignisse gehen Ober diese Unschllrfe hinweg und machen aus Gelilchten unter Rückgriff
auf scheinbare ,.Beweise" Wahrheiten.236 Einer dieser immer wieder genannten .,Beweise" !Ur
die Nllhe Somalias zu dem international verfolgten Saudi und der ai-Qu'aida ist, dass die Gra
natwerfer sowjetischer Bauart, die im September und Oktober 1993 gegen amerikanische
Hubschrauber zum Einsatz kamen, dem Waffentyp entsprachen, der von Kämpfern in Afgha
nistan verwendet wurde. Hier waren Bin Laden und al-Qu'aida nachweislich seit Anfang der
1990er Jahre aktiv. Im Lichte des tödlichen Hasses militanter lslamisten aus dem Umfeld Bin
Ladens, mit dem sich der Westen seit Ende der 1990er Jahre konfrontiert sah, wurden die Er
eignisse vom 3. Oktober 1993 uminterpretiert: Der Erfolg der militärisch sch.lecht ausgelilste
ten Somalis gegen die amerikanischc Übermacht musste in der Unterstützung afghanischer,
mutmaßlieh mit Bin Laden verbundener .,Giaubenskrieger'· beglilndet liegen.m Diese Inter-
und die fllr das Überleben wichtigen Fin:uuuansfers aus der somalischen Diaspora unterbrochen wurden (Bakonyi 2002: 229).
l» Beispiele fllr wescn Prozess fmdcn sich immer wieder in dem allzusehr auf raschen Publikumserfolg angelegten und daher trott �iner Detailtlllle oberflllchlicben Buch des langjährigen SZ. Afrikakorrespondenten Michael Birnbaum (Birnbaum 2002: t5/142/t60t).
"' ,.J)ll waren piOI%lich neue Waffen bei der Gegenseite aufgetaucht, Gr:�natwerfer, die geschulte Terroristen von der Schulter abfeu= konnten, so, wie die Kämpfer in Afghanistan oder der Vielkoog in SOdostasien" (Birnbaum 2002: 110).
Copynghtcd ma riR
125
pre.tation übersieht jt-doch, dass Aidc'Cd in dcr islami schen Ordnung eine Konkurrenz fiir sei
nen eigenen, auf keinen Fall religiös begriindc1cn Herrschaftsanspruch sah (Zitelmann 2002:
9; Birnbaum 2002: 140).m Zudem konnte der Umgang mit sowjetischen Waffen durchaus
auch von Somalis gelernt werden, die ja bis 1977 Verbündete der UdSSR waren. Ein Offizier
Aideeds soll Ober eine entsprechende Ausbildung vcrfllgt haben (Zitelmann 2002: 9). Ein wei
teres ,.BeweisstOck'' ist ein jUngst in einer Höhle in Afghanistan gefundenes Navigationsger'.it,
dass einem 1993 in Somalia gefallenen US·Offizicr gchön haben soll. Allerdings wurde das
Modell laut Hersteller erst ab 1997 gebaut (Grill 2002: 3f).
Die oben angeftihnen ,.Beweise" flir eine enge Verbindung somaliscber Gruppen mit Bin
Laden und al-Qu'aida können nicht überzeugen. Klar ist aber, dass es islarnistische Machen
schaften am Horn von Afrika, auch in Somalia, gab. Al-lttihad al-lslarniyya agierte Mitte der
1990er Jahre in Somalia und verfolgte neben friedlichen sozialen Zielen. wie z.B. der Einrich
tung von Komnschulcn, Schariagcrichtcn,Waisenhäuscm etc. auch militärische, vornehmlich
gegen Äthiopicn gerichtete Ziele (Nord 2002: 6). Bin Laden besuchte wohl 1994 tatsächlich
ein militärisches Ausbildungscamp dieser Organisation. Inzwischen scheint diese islamisti·
sehe Vereinigungjedoch an Starke und Einfluss verloren zu haben. (Nord 200Z: 6f; litelmann
2002: 13).
Welcher Sinn diesen bisher nur als verstreute Puzzleteile erkennbaren Anhaltspunkten ge
geben wird, hängt mit den vielschichtigen Interessen der verschiedenen Interpreten zusam
men. Viele lnforn1ationen des an1crikanischen Geheimdienstes über bedrohliche Macheo
schanen in Somalia speisen sich aus äthiopischen Quellen. Äthiopien kann mit Blick auf die
Geschichte des Horns bis in die jüngste Zeit durchaus ein Interesse an der Destabilisicrung
bzw. der nachhaltigen Schwiichung Somalias unter.;telh werden (Grill 2002: 4; Farah 2002: 2:
Nord 2002: 8: Birnbaum 2002: 1661).
8.2 EINSCHÄTZUNG DER LAGE
Das Bild Somalias als .. Hon des Terrors" c!Wcist sich als starl< verzem. Ein Ei.ngreifcn der
,,Anti-Terror-Allianz" wi!re auf Basis der in den Medien und auf Ebene der internationalen
Politik kreisenden Spekulationen und Gerüchten nicht gercchtfenigt. Zudem würde ein milüli
rischer Einsatz angesichts der fragilen regiotu�len Strukturen am Horn mit großer Wahrscbcin·
Iiehkeii zu erneuten gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Somaliland und der Über-
"' Bei Birnbaum Iinden s1ch Aussagen, d1e A1deeds Dist:lnz zum Islam betonen (Birnbaum 2002: 138-140). Gleichzeitig stellt der Autor jedoch die Unterslützung des warlords durch militante Islnmistcn als Faktum dar (Birnbaum 2002: 15/141 1).
Copynghtcd matcria
116
gangsregierung in Mogadishu sowie zwischen den verschiedenen warlord-Fraktionen fUhren.
Die internationale Gemeinschaft müsste bei ihrem Eingriff mit einzelnen Parteien bzw. Grup
pierungen zusammenarbeiten. Politische Legitimation und ökonomische Untersttllzung wären
der Lohn ftlr die somaliscben Partner. Ein bewaffueter Weusrreit um diese Ressourcen wäre
eine mögliche Folge. Erste Anzeichen filr deranige Spannungen werden im Werben des war
lords H ussein Aideed, der Regierung in Hargeisa und der Übergangsregierung Abdulkassim
Salad Hassans um die Gunst der USA und ihrer Verbündeten ericennbar (Bakonyi 2002: 229;
Birnbaum 2002: 154-158). Parallelen zu den im Kap. 5 geschildenen Folgen des internationa
len Eingreifens Anfang der 1990er Jahre wären zu befilrchten: Anti-west.liche Strömungen
würden geschun, die Not der Zivilbevölkerung würde gesteigen, das gesamte regionale Gefil
ge am Horn wUrde in Aufruhr geraten (Nord 2002: 8; Farah 2002: 21).
Die Anschläge vom II.September 200 I haben dem gegenüber der arabischen Halbinsel ge
legenen Soma.lia wieder zu geostrategischer Relevanz verholfen, d.ie das Land zuletz.t zu Zei
ten des Kalten Krieges ,.genoss" (Bakonyi 2002: 2291) und die sich im RUckblick tnr das Land
und seine Bevölkerung negativ ausgewirkt ha.t. Angesichts der komplexen soziopolitischen
Lage in dem kriegsgebeutelten und ressourcenarmen Land am Horn könnte sich die erneute
militllrisch begründete Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft als ,,Büchse der
Pandora" erweisen.
Copynghtcd matcria
117
9 SCHLUSSBEMERKUNG
Senghaas seilrieb sehon 1973, allerdings im Hinblick auf die winschafiliche Zusammenarbeit
der EG mit einigen Ländern der • .Dritten Wett•·, in der er die Perpctuierung ,.struktureller Ge·
waltverhältnisse" mit friedlichen Mincln erkannte: .. Deshalb ist bei der Etiketticrung von Ent·
wicklungspolitik als Friedenspolitik Vorsiehe geboten [ .. .j" (Senghaas 1973: 266). Wie
wichtig diese Mahnung auch heute noch ist, zeigt sich an der Position von Mchlcr und Ri·
baux219 gcgL'tlUbcr .,indigcncn lösungsansätzen": .,Sie [die indigcnen lösungsansätzc] sind
zwar eine notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Voraussetzung dafür, einen Konflikt zu
,managen·, denn die traditionellen Kontrollmechanismen haben ja zuvor versagt. als es darum
ging, die Eskalation zu einem bewaffneten Konflikt zu verhindern. Viele der traditionellen
Ansätze im Umg311g mit Kannikten und sozialen Untersehiedcn vcrstärl<cn undcmokratischc
Patron-Klientenbeziehungen und haben vielleicht zur Enl,tehung und Ausbreitung des Kon
nikts bcigctrogcn" (Mchlcr/Ribaux 2000: 109). Diese Position ist bezüglich des Konzepts von
.. Tradition" unklar. da hier der Wandel und die Manipulation von ,.Traditionen" im Zuge der
Übenra!,>ung der europäischen Staatlichkeil in der Kolonial- und Postkolonialzeit übersehen
wird.No Erst wenn man die komplexen Verllcchtungen kultureller, sozialer und politischer
Faktoren im postkolonialen Afrika durchleuchtet, )!Isst sich erkennen, ob in den sehwachen
und zerfallenden Staaten Afrikas nicht doch abseits der formalen staatlichen Strukturen Tradi·
tionen vorh:mden sind, die einen Beitrag zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung einer
friedlichen Gesellschallsordnung leisten können.
". Mir wurde pcr>Önlich mitgeteilt, dass nach Meinung von Mchler/Rjbau.� Entwock]ungspohttk mcht gleich Fnedenspolitik ist. Dennoch sind diese Autoren maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen entwicklungspolitischen Konzeption des BMZ im Bereich Krisenpriivention und Konßiklhcarbei· tung beteiligt. Hier wird Entwicklungspolitik als Friedenspolitik begriffen (BMZ 2000: 16).
:.eo Siehe zur Problematik sogenannter ,,Tradilioncn .. insgesamt HobsbawmiR.angcr, die ganz zu Anfang des von ihnen herausgegebenen Buches feststellen: ,;Traditions' which appcar or claimto be old arc often quotc rccent in origin and sometlmes invemed" (Hobsbawm/Ranger 1993: 1). Eine einfache Dichotomisierung der in verschiedenen Gesellschaften vorhandenen soziopolitischcn Strukturen in ,.tnditionell" und ,.modern'· erscheint demnach unbrauchbar. Häufig ist gerade das, was aus heutiger Sicht als besonders .,trnditioocll" erscheint, ein Produkt von Staathchken. So scbreibt Btck in Bezug auf tribale Strukturen im Sudan: ,.Machtminel, die innerhalb eines Stammes Anwendung Iinden, sind häufig von Mächtigeren geborgt. Historisch ist i.d.R. eine Verhär· tung von Stammesstrukturen dann fest2UStellen., wenn eine S1l1Jltlichc Gewalt ihren Ann nach den Stanunen ausstreckte und einen Herrscher unterst01Zte" {Deck 1989: 21 ). Entscheidend ist. die Strukturen in ihren ''llriablcn lokalen und histo.-i.schen Konte�ten zu erkennen. Dazu gehön auch, die in einem gewis<en Rahmen immer gegebene Handlungsfreohc!l der Triger diescr Strukturen zu akzeptieren. Diese Position wurde im Bereich der ncuercn afrikaoricntienen Politikwissenschaft besonders deu.tlicb von Bayan anikuliert: ,.ln ordcr to understand ,govanmcntality' in Africa we need to understand the concrete proeedures by which social actors simultaneously borrow from a
Copynghtcd malcria
128
Die gegenwärtige entwicklwtgspolitische Diskussion in Europa und den USA zum Thema
Krisen- und Konfliktprävention zeichnet sich in ihrer Suche nach kaum beweisbaren allge
meingOitigen Kausalbeziehungen und dement�-precbenden Standardinstrumentarien des Ein
greifens durch einen starken Reduktioo.ismus aus. Die ,,Modelle" und ,.Mechanismen'" werden
den kulturspezifischen Besonderheiten nicht gerecht; ihre praktische Brauchbarkeit steht
demnach in Frage (Zitelmann 2001: 19). Zudem weist die oben zitiene Sichtweise von Mch
lcr!Rib:lux auf die ideologischen Gundiagen der in der Einleitung skiz.zienen Friedenspolitik
hin: Die .,westlichen" Vorstellungen von Staatlichkeil und geordneten sozialen Bet.iebungen
gelten als die einzig .,richtigen"; nur sie könnrn letztlich den Weg aus der Krise weisen?••
Die soziopolitiscben Entwicklungen in Somalia von der Kolonialzeit bis heute, wie sie in
dieser Arbeit vorgestellt wurden, zeigen, dass die eurozentrischen Konzeptionen der in der
Einleitung erwähnten .,Entwicklungspolitik als Friedenspolitik" fehlgeleitet sind, da sie fast
ausschließlich auf staatliches Handeln und fonnale Staatlichkeil konzeutrien sind und die
Realitäten vor Ort nicht erfassen. Welche Konsequem-.cn dieser sehr eingeschränkte Fokus
haben kano, wurde auf dmstischc Weise am Beispiel des Verlaufs und der Auswirkungen der
r:utgc of discursivc genres, interrniJ< tbern and, as a resul� are able to invcnt original cultures of the slllte" (Ba}':ltl 1996: 249).
"' Das aktuellste Beispiel westlichen Krisenmanagments in Afgh3nistan verrnillelt auf den ersten Blick ein anderes Bild: Traditionen. wie die fllr Juni 2002 geplante .,Stammesversammlung" (loya Dschirga), sowie ethnische Faktoren. wie sie bei der V<rteilung politischer Ämter auf dem Petcrsberg bei Bonn Ende 2001 eine wichtige Rolle spieltrn, werden berilcksichtigt. Sie sollen, eingebettet in ein untralswtliches Lösungskonzept noch curo-amc:rikanischcm Vorbild, einen Beitrag zur Befriedung eines Krisenherds leisten. Dennoch !bleibt es gerade aus kulturwissensch3ftlicher Sicht fraglich, wieviel die in diesem Zusammenhang erkannten ,.Traditionen" und ,.ethnischen" Komponenten im Dienste der internationalen Konfliktlösung wirklich mit der Rc:llität vor On zu tun ha· ben. Der diskursi.-e Rückgriff auf .. Traditionen" und ,.Ethnien" dient eher der Etikenierung verschiedenster Interessen. von der Beruhigung des eigenen Gewissens scitens der Politiker und der Zivilgesellschaft in Eurupa und Amerika bis hin zur Mobilisierung internationaler und nationaler Ressourcen zum Vorteil einzelner Konfliktakteure und -parteien. Im schlimmsten Fall tragen diese auf partikulare Interessen reduzierten kulturellen Interpretationsmuster zur Perpetuicrung vorhandener oder :zur Cknericrung oeuer KonfliklpOtentialc bei ($ebener 2002: 473/475). Die im Dereich der c:uropllischcn und nordamerikanischen Politik diskutierten und angcwandten Entwicklungs- und Konfliktprilventionsmodclle kr:utken m.E. an folgendem Paradoxon: Einerseits werden einzelne Aspekte dn- tigenen, wesdichen Kultur, meist unter Schlagwöncm '"'ie ,.Demokrntic .. , ,.Mcn· scbenrechte" .. freie Marktwirtsch3ft" als unbedingte Wegbereiter des globalen Fortschrius gopriescn; andererseits sollen Defizite, die sich aus der offensichtlichen Nichtangepasstheil dieser euro· amerikanischen Ideen in •ielen lokalen Kontexten ergeben, unter dem ROckgriff auf oft nur oberflächlich verstandene Trnditioncn und ethnische: Dynamiken ausgeglichen werden. Oieses "Patchwork•· aus westlichen Vorg3ben und cwopäiscb·amcribnischcn bzw. von lokalen Intcrcsscntcn. wie z.B. Wllllords, manipulierten Traditionen und ethnischen Zugehörigkeilen kann, wie Schoner im Hinblick auf die jOn�sten Encwicklungcn in Afghanistan feststellt, sogar zu einer Zementierung vonnoderner Machtstrukturen fUhren (Schener 2002: 4771480). Die so erreichte Ordnung ist m.E. weder traditionell noch demokratisch legitimiert.
Copynghtcd ma riR
129
UNOSOMJUNlTAF-Intcrvcntion in Somalia ersichtlich. Trotz des enom1en politischen, mate
riellen und personellen Aunvands scheiterte diese Interventionen. die in erster Linie auf die
Wiederherstellung eines somalischen Nationalstaats gerichtet war. Dieses Scheitern lässt sich
sicher nicht monokausal erklären. Doch ein Vergleich der staatlichen Intervention mit dem
zivilgesellschaftlichen Eingreifen durch das LPI macht deutlich, dass ein wesentlicher Faktor
lllr das Fehlschlagen der UN/US·Politik in ihrem Ansatz bestand: Der .,top-down"-Ansatz der
internationalen Staatengemeinschaft war auf die höchste politische Ebene fokussiert. Da in
Somalia zu Begilm der 1990er Jahre keine anerkannte Regierung mehr vorhanden war, wur
den die warlords, die scheinbaren Machthaber, als Verhandlungspanner akzeptiert. Da diese
jedoch keinen ROckhalt in der Zivilbevölkerung hatten, sondern ihre Macht lediglich durch
Manipulation der soziapolitischen Strukturen und durch bruta.le Gewaltanwendung erwarben,
lllhnen die Bemühungen der Staatengemeinschall letztlich zu einer enonnen Verschwendung
von Ressourcen und zu erneuten Gewalteskalalioncn. Dagegen konnte die schwedische NGO
im Zuge ihres .,bottom-up"-Ansatzcs. der auf die lokale Ebene gerichtet war, in einigen Fällen
durchaus erfolgreich zum Aufhau friedlicher Struk!Ul'(.'ft beitragen. Allerdings war der Erfolg
der zivilgcsellschafilichc lntcrvl'lltion begr enzt: Um breitenwirksam in Somalia arbeiten zu
können, war das LP.l, das als NGO kaum über ausreichende materielle und machtpolitische
Mittel verlllgte, auf die Kooperation mit der UN angewiesen. Diese Zusammenarbeit schrllnk·
te die Handlungsfreiheit der zivilgesellschaftlichen Organisation ein. Der auf Grund seiner
Offenheit gegenOber den lokalen Verhältnissen vielversprechende "bottom-up"-Ansatz wurde
den Vorgaben der UN untergeordnet, die auf die nationale Konsolidierung Somalins ausge
richtet waren. Die zivilgesellschafiliche Friedensarbeit verlor somit an Wirksamkeit.
Vergleicht man Ansätze. V<.-rlllufe und Ergebnisse der internationalen Interventionen mit
den Entwicklungen auf lokaler Ebene. zeigt sieb, dass die nachhaltige Etablierung einer fried
lichen Gesellschaftsordnung nur abseits der internationalen Eingriffe gelang. Im Unterschied
zu den externen Bemühungen folgten die internen Str�tcgicn der friedlichen KonOiktanstra
gung im Wesentlichen den soziopolitischen Trdditionen der Somali-Gesellschaft: Anfang der
1990cr Jahre wurde in Somaliland im Nordwesten begonnen, die in Folge der Gewalteskalati
on zahlreichen Konflikte im Raluncn von shirs beizulegen. Diese Versammlungen, die allen
männlichen Somali oO'L-nstanden und von anerkarmten Autoritäten geleitet wurden, fanden
zunlichst auf lokaler Ebene statt. Ausgehend von den konkreten Verhältnissen vor Ort wurde
die Basis lllr die regionale Konsolidierung des Friedens und der soziopolitiscben Ordnung
geschaffen. Mitte der 1990er Jahre kam es auch im Nordosten und Teilen Südsomalias zu
Copynghtcd ma riR
IJO
ähnlichen Eotwicldungen. 1m Zuge dieser dezentralen und sehr zeitintensiven Friedensprozes
se bildeten sich in den drei Regionen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in Abwesenheit
einer somatischen Zentralregierung ,,staatsähnliche" bzw. ,.parastaatliche" Strukturen heraus.
Oie traditionellen Ansätze der friedlichen Konfliktaustragung entsprachen somit nicht den
,.westlichen" Vorstellungen und wurden deshalb international kaum unters10tzt.
Bei der Analyse der Entwicklungen in den 1990er Jahren, die letztlich zu einer Vierteilung
Somalias in das Krisengebiet in und um Mogadishu und die drei autonomen Regionen Soma·
Jiland (Nordwesten), Puntland (Nordosten) und Bay- und Bakol-Region (SOden) gefllhrt ha·
ben, muss regional differenziert werden: 1m Norden waren auf Grund der prllkolonialen, kolo
nialen und po..o;tkolonialcn Entwicklungen die traditionellen pas1oral-nomadischen
Gesellschaftsstrukturen auch in den 1990er Jahren noch dominant. Hier lassen sich die Ent·
wiekJungen in den 1990er Jahren also simwoll auf der Grundlage der segmentären Klanstruk·
turen analysieren. Diese waren jedoch nicht nur in Bezug auf die Gewalteskalation, sondern
auch hinsichtlich der Gewaltdeeskalation entscheidend: .,The strengtb of the relatively suc
ccssful peace efford ofthe traditional leaders in the north lies in the fact that it is anchored in
thc fundamental social segmentar)' order" (Farah/Lcwis 1993: 61). Bis heute konnten Frieden
und Ordnung in Somaliland auf Basis einer an die existierenden sozialen Strukturen der Regi
on angepassten staatlichen Ordnung erhalten werden (Brons 200 I: 251 ).
Die Verhältnisse im SOden waren dagegen komplizierter: Im Gebiet zwischen den FJUssen
Sehebelle und Jubba hatte sieb in prllkolon.ialcr Zeit neben der pastoral-nomadischen auch
eine ausgeprägte sesshafte Kultur entwickelt Die Bodenbauern stammten z.T. von früheren
Sklaven ab. Im Lauf der Zeit wurden sie zwar lose in die Klanordnung der pastoral
nomadischen Somali, der ehemaligen .,Herren". integriert. Doch ihr sozialer Status blieb auch
im gesamten 20. Jahrhundert dem der Nomaden untergeordnet. Im SOden waren also neben
den aus dem Norden bekannten egalitären und dynamischen Klanstrukturen lange Zeit von der
Forschung ignorierte hierarchische und statische Sozialstrukturen relevant. Zudem war der
relativ fruchtbare SUden den Eingriffen kolonialer und postkolonialer Machthaber wesentlich
stllrker ausgesetzt als der sehr trockene Norden. Die traditionelle Ordnung wurde hier vor al
lem durch die machtpolitischen Manipulationen Barres ab Ende der l970er Jahre untermi·
niert. Mit Blick auf die unterschiedlichen Entwicklungen in Nord- und in Südsomalia in den
1990er Jahren wird klar, dass sich das enorme Ausmaß der Verwüstungen in und um Moga
dishu nicht befriedigend mit dem Verweis auf die dynamische segmen täre Gesellschaftsord·
nung erklären lässt. Vielmehr legt die differenzierte Betrachtung der soziapolitischen Ge-
Copynghtcd ma riR
131
schichte des SUdcns d1.-n Schluss nahe. dass !hier im Zuge des Staatszerfalls alte Ausbeu
tungsmuster zwischen .. reinen" Soma Ii und den Abkömmlingen der Sklaven wieder hervortra
ten. Daneben wurde der Konfliktverlauf im Silden natUrlieh von den segmentären Strukturen
beeinflusst. Im Gegensatz zum Norden konnte sich hier das friedliche Potential der pastoral·
nomadischen Gcscllsehafisordnung jedoch nicht frei cntf.11ten. Die Friedensprozesse im Rah
men von shirs wurden häufig von warlords und bewafTneten Milizen sabotiert, deren aus der
Plünderungsökonomie gezogene Gewinne durch jegliche cmsthnfic Option auf Frieden be
droht wurden. Die Kriegsherren nUtzten die traditionellen Strukturen lediglich zu ihren Gun
sleu nusw und standen somit in der Herrschaftstradition Barres: .. Tims did General Moham·
med F. Aidiid add a new proverh to Somali Iore: ,Cadyohow ama ku cunay ama ku
ciidceyey', ,0. thou benutiful cut of meat (meaning thc national state), either I will eat you all
by myself or I will ensurc to soil you in the din so that no other can have you .. (Said S.
Samatar I 997: I I 0). Im SUden kam es also, zumindest teilweise, zu einer Gewalteskalation
jenseits des segmentär erklärbaren Ausmaßes (Ahmcd I. Samatar 2000: 45; Mcnkhaus 1998:
223; Prunier 1996: 31).
Der in der polilologisehen und ctiUJologischen Somaliaforschung z.T. bis heute gcncrnli·
sierte20 und von den Medien fleißig rezipierteu-� Klanfokus erweist sic.lt vor dem Hintergrund
der regional sehr unterschiedlichen Entwicklungen im Gebiet der ehemaligen Republik Soma
lia nls zu einseitig: "[ ... ) Somalis bceamc canoon-like imagcs of primordial man: unable to
break out of their destructivc spiral o f ancicnt clan rivalries. loyalitics and bloodshcd" (Bc
steman 1999: 4). Diese Sichtweise verbinden, das Potential der traditionellen Gesellschalls
strukturen hinsichtlich der Rekonstruktion von Frieden und soziopolitischcr Ordnung zu er
kennen. Auf staatlicher Ebene wird bis heute an der Vorstellung festgehalten, dass Frieden
und Entwicklung in Somalia nur möglich sind, wcn.n das koloniale Konstrukt der Republik
Somalia wieder aufgerichtet wird. Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass dieses Festhalten an
"' Diese Sicht der KonOiktsituation im Süden wird vielleicht am deutlichsten durch d•s letztendliche Seileilern des • .lubbaland Peace Accord" bestt�tigt. Dieser Vertrag wurde im Sommer 1993 m Kismayo auf einem großen, von der UN unterstützten shir ausgehandelt. Die Fraktions· und Mili· zenfllhrer erkannten d1e von den Ältesten ausgehandelten Vereinbarungen jedoch nich an. Anfang \994 kam es wieder zu schweren Ausemandersel2Ungen in und um Kismayo (Menkhaus 2000: 194f; ders. 1996: 54f; Besteman 1999: 2241).
"" Heyer spricht m1t Bezug auf SollLllia nach 1991 von einem .,Schlachtfeld interner Klankricge" (He)tt 1997: 2}.
,.. Man vergleiche das dieser Arbeit als Warnung vor OberOi!chlichkeit vornngestclltc Motto von Michael Birnbaum. Derselbe Autor schreibt auch in seinem nc:ucstcn Buch: .. Bis heute lassen sich
jeder Politiker oder Krieg.<;herr und die Grundz.llge seiner Politik in Somalia schnell auf <bs beste· hende Klansystem zurilcldllhrcn" (ß1rnbaum 2002: 33 ).
Copynghtcd ma riR
132
bekannten europäischen Mustern von Staatlichkeil nicht nur eine weitere Verschwendung von
Ressourcen bedeutet, sondern auch die bisher in verschiedenen autonomen Regionen erreich
ten Fortschritte zu zerstören droht.
Auf globaler Ebene machen die Entwicklungen seit den Terroranschlägen vom I I . Sep
tember 2001 deutlich, welches Ausmaß die intellektuell beanspruchte und ökonomisch
militärisch untermauene Definitionshoheit und. Handlungsmacht des Westens im Bereich des
Konfliktmanagements und der Konfliktprävention erreicht hat.1•s ln Afghanistan wird aktuell
ein ganzes Staatswesen unter Federfilhrung d.er internationalen Gemeinschaft neugeordnet;
deren Handeln wird wesentlich von Europa und Nordameri.ka aus gelenkt. Die in unregelmä
ßigen Abständen immer wieder auflauchenden Spekulationen llber weitere Einsätze der ,,Anti·
Terror-Allianz" bzw. der USA und ihrer VerbOndelen möglicherweise auch in Somalia lassen
zudem erkennen: Die europäische und nordamerikanische Politik ist versucht, ihre Interpreta
tion dessen, was ein geordnetes und friedliches Staatswesen ist, weltweit mit Gewalt durchzu
setzen. Abgesehen davon, dass ein solches Vorgehen nach geltenden YOikerTCCbt 11icht zu
rechtfertigen ist, verlassen sich westliche Militärstrategen bei der Auswahl potentieller zu
künftiger Ziele, zumindest im Fall Somalias. eher auf Spekulationen und GcrUehte denn auf
Tatsachen. Die Folgen solcher EingifTe sind unabsehbar.246 Klar ist jedoch, dass die Leidtra
geoden in jedem Fall die Zivilbevölkerungen der betreffenden Länder wären. In Somalia wür
de ein militllrischer Einsatz internationaler, insbesondere amerikanischer Truppen, die Gefahr
erneuter Gcwalteskalationen bis hin zum erneuten großflächigen Bürgerkrieg mit sich bringen.
,., Es steht ausser frage, dass die USA und die imemotionale Gemeinschaft auf den mcnschcnvcrach· tenden Terrorschlag reagieren mussten. Doc:h d.ie Art der Realmon ist dun:haus diskussionswürdig. Kontrin: völkerm:htliche Positiontn hinsichtlich der Frage der Angemessenheil der Reaktion der USA und ihrer Verbündeten vertreten z.B. Stuby 2001 und Green"''OOd 2002.
,,. Oie seit dem Ende des Kalten Krieges sehr offen zur &hau getr.lgcne Macht des Westens. vornehmlich der USA, in den internationalen Beziehungen war eine wichtige Ressource 1m Rahmen von Osama Bin Ladens dschihad-Propaganda in weiten Teilen der muslimiseben Welt (Bergen 2001: 331).
Copynghtcd ma riR
/33
10 LITERATURVERZEICHNIS
Adlbe, Clement ( 1995): Manogmg Ann.• m l'cacc l'roccsscs: Somalin, N<-w York.
An non, Kofi (2000): Report of the Sccrctary-General on the Situation in S<Jmalia (SnOOOfl211 ), 19.Dee.2000, S. J.l2 (www.somaliuwatch.org/archivc:decOOIOIOI I6601.htm). [21.4.01 I
Aves, Mahn (2000): Ote Sache des Volkes, taz 28.2.2000, S. 1-1 (www.taz.deltpi/2000/0Sn8/a0 17.nf/stcxt.Nam<:,ask0 1606aaa.idx.35 ). 128.2.0 I I
Baecbler, Günther (1998): Hmtcrgründc der Kncgc und bewaffneten Kontlikte in Afrik>, in: UII'Engel, Andrcas Mehlcr (Hg.): Gewaltsame KQnfliktc und ihre Prävention in Afrika, Hamburg, S. 1-24.
Ball, Mobamed Saleh (1997): S<Jmaliland: An lntroduction. S. 1-36 (\\-ww.llnaserve.comt-mbali/iniTo22.htm). [21.4.01 I
Bakooyi, Juua (2002): Somnlin im Visier der t\nti-Tcrror-Allianz. �lintcrgrilndc des Swts=falls, in: Bl3ttcr fllr deutsche und internationale Politik. Heft 212002, S. 229-236.
ßayart. Jean-Francois (1996/1989): The State in Africa. The Politics ofthc Bclly, London.
BKk, Kurt (1989): Stilmm<: un Schatten des SL,.ts: Zur Entste.hung admmismtivcr Hlluptlingstilmer im nOrdliehen Sudan, in: Soeiologus. 39.Jg Hefl l. 1989, S. 19-35.
B�rgeo, Petcr (200 I): llctliger Krieg lnc., Osarna Bin Ladens Terromet1, Berlin.
Bcstcman, C. (1995): 'Thc Invention ofGosba: Slavcry, Colonialism. and Stigmn in Somali History, in: Ali Jimale Ahmed (Cd.): The lnvc-nuon ofSomahn, L:awrenceville. S. 42-62.
dies. ( 19%): Violent politics and thc politics of violencc: the dissolution of thc Som:oli nation�tatc, in: American Ethnologist, Vol. 23 No. 3, August 1996, S. 579-596.
dies. (1999): Unra,·cling Somalia. Ruce. Yiolence, and the lcgacy ofSiavery, Pbiladelph••·
Bertrand, Mauriee (1995): UNO. Geschichte und Bilanz, FrankJurt/M.
Birnbaum, Michael (2002): Knsenhcrd Somalia. Das Land de-s Terrors und der Anarchtc, München.
BMZ (2000): Zwei Jahre Entwicklungspolitik der Bundesrepublik aus SPD und Bündnis 90/Dic Grünen, Halbzeitbilanz und Pcrs')>Cktivcn, Sept. 2000, (www.bmz.de/). (30.10.00J
Bobannen, Paul (1967): The Dtfli:ring Realms ofthc Law, in: dcrs. (cd.): Law tlßd Warefare. Srudtes in the Anthropology ofConnict. New York, S. 43-56.
Bollig, Michael ( 1999): Afrikamsche Kriegsherren • iJherlegungcn zur Entstehung von Gewultmärktcn im pr.lkoloni>lcn und postkolontalen Afrlka, in: Hans-Peret Hahn; Gcrd Spittlcr (Hg.): Afnka Wld die Globalisierung, Harnburg. S. 425-444.
BoUig, Michael; KI<H, Frank ( 1994): Einlllhrung: Die •afrikanische Krise• . Medien, Wissenschaft und afrikanische Perspektive. in: dies. (Hg.): Überlebensstrategien in Afrika, KOin, S. 1 1-28.
Copyngh!cd ma riR
134
Boogam. Maria (1993): Somalia im BOrgerkrieg. Ursachen und Pcrspcktiven <k1 innenpolitischen Konflikts. Hamburg.
Boatros-Ghlll, Boutros ( 1992): An Agenda for Peace, New York.
den. (1996): Thc United Notions ond Somolia 1992-1996, Ncw York.
Bradbury, Mark (1997): Somaliland, CIIR Counlry Repon.
Broos, Maria {1993): Somaliland. Zwei Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, llamburg.
dies. (200 I): Society, Sccurity and the State in Somalia. From Statelessness to Stetelessness? Utrecht.
Brane, Stefan; M.atthles, Volker (1990): Einleitung, in: dies. (Hg.): Krisenregion Horn \'Oll Afrika, Hamburg, S. 1..(5.
Burtoo, Ricbard {200011856): First Footsteps in East Africa or An Exploration ofHarar, Köln.
Carntiro, Robtn L. {1994): War and Peacc: Alteming Realitics in Human History, in: S.P. Reyna: R.E. Downs (ed.): Studying Wor. Anthropological Perspectives, Lang""""', S. 3-27.
CauancUl, Lee V. (1996): Explaining thc Somali Crisis, in: Cothcrinc ßestcmon; lcc V. Caos:mclli: Thc Struggle for l.and in Southem Somalia, London, S. 13-26.
Chaba� Potrick; Daloz, Jcan-Pascal (1999): Unordnung und ihr polilischcr Nutzen, in: der nberblick 2199, s. 17-22.
CoiUtr, Paul; Hoemer. Anke (2002): On thc lncidence of Civil War in Africa, in: Journot of Conflict Resolution Vol. 46, Nr. I , February 2002. S. 13-25.
Compagnoa, Danicl (1998): Somali Anned Mo•·emenls, in: Christopher Clapham (ed.}: African Guerillas, Oxford, S. 73-90.
Debitl, Tobias: Fischer, Manina: Krisenprävention in einer gewalttr!chtigen Weit. Was kann europ!iscbe und deutsche Entwicklungspolitik leisten?. in: Aus Politik und Zeitgeschichte 81212001. S. 14-23.
Deblel, TobiiiS; l\1atthles, Volkcr (20Q0a): Krisenprävention - mehr Fragen als Antworicn? Eine Zwischenbilanz zur deutseben Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik. in: Entwtcklung und Zusammenarbeit, Jg. 41 HeR 9, 2000, S. 250-253.
dies. (2000b): Kriscnprivention: Was wurde erreicht? Eine BcstandSllufnahme zur deutschen Entwicklungs-. Außen- und Sicherheitspolitik. 1\FB-Texte Nr. 212000, Bonn.
Djlboutl Deal won� bnng pcace, Oct. 9, 2000 (www.somaliland.com/Fagadhe_IO I O.htm). [21 .4.0 I )
Elsclt, Manf"'d (2000a): Fricdcnstruppen, in: II. Volger (lig.): Lexikon der Vereinten Natiouen, MOneben, S. 160-167.
ders. (2000b): UN-Missionen: ln Afrika entschlossen auftreten. Interview mit M. Eiselc. in: Entwicklung und Zusammenarbeit (E+Z), Jg 41, 2000:9, S. 254-255.
Copynghlcd ma riR
/35
El.,·ut, Gcorg (1997): Gewaltmrukte. Beobachtungen :>.ur Z.wcckr�tionalilat der Gcw;•lt, in: Trutz von Trotha (Hg.): So7jolog1e der Gewalt. Kölncr Zeitschrifl für So1jologic und Sozialpsychologie. Sonderheft 37, 1997, S. 86-101.
Engtl, Ulf (1999): EU·Kon1l1ktprüvcnuon in Afri�: K.onuptc und l'erspck11Vtn. in: Hans Pctcr Hahn. Gm! Spittkr (Hg.): Afri� und die Globahsicrung, S. 91-98.
Evaas-Prltchard, E.E. (1962/1940): TI1c Nu,·r of thc Southcm Sudan, in: M. Fortes, E.E. EvansPritchard (ed.): Africnn Politicnl Systems, London. S. 272-297.
Farab, Ahmed Yusuf; l.ewb. I.M. (1993): Somalia: The Roots or Re<:on<.'ihation. Peace Malong Endeavours of Contempornry Lineagc Le.adcrs: A Sun·ey of Grassroots Peace Confcrences in "Somaliland", AC:TIONAID.
Farah. Nuruddin (2002): Der Ruf des Satans (www.7.<:tt.de/2002/02/l'olitil</print_200202_somalia.html) [10.5.02).
Fassbeader, Bardo (2000): Souver!lnitat. in: llclmut Volger. Lexikon der Vereinten Nationen, München,
s. 492-495.
Flrz;lbbon. Louis ( 1982): Thc Bctrayal of thc Somalis, London.
Fortes. M.: Evans-Pritchard, E.E. (196211940): lntroducuon. m: dies. (ed.): Afnoun Poliucol System." London, S. l-23.
Gllkcs, Patrick ( 1994): Descent into ch3os: Somnlia. January 1991-Deccmber 1992. in: Charlcs Gurdon (ed.): Thc Horn of Africa. New York, S. 4741.
Greenwood. Chri51opher (2002): International law and the 'war against tcrrorism', in: International Affairs Vol. 78, Nr. 2, April 2002, S. 301-317.
Grill. Bartholomllus (2002): Mutmaßungen ubcr eine Leiche. Somalia - das nl!chste Ziel der Allianz gegen den Terror'! Ein Ortstermin im HcrLCn des Londes (W\I.w .zeit.de/2002120/Politil</200220 _ somalia.html) [I 0.5.021.
Gullh•er, I•.H. (1979): Otsputes and Negollations. A Cross-Cult\lrnl Pcrspccth•e, New York.
lbjl. Abdulqadir lbrah1m (I 999): Selbst d1c jungen Kämpfer in Somalia wollen Frieden, in: der überblick 2199, S. 42-14.
Uublm. Alite Bcttis (1997): Tbe Fallen Statc. Disson>nce. Dictatorship lllld Death in Somaha. l..anham.
Helnrkh. Wolfgang (1997): Building the Pcacc. Expcricnces ofCollaborativc l'cacebuilding in Somalia 1993-1996. Uppsala.
dtrs. (1 998): KonOiktfors<:hung, Emwicklungszusanunerwbeit und Konlilctbtarbcitung - und die Rolle der Ethnolog1e, in: Entwicklungsethnologie 7 (2), 1998. S. 49-63.
Helander, Bemhard (1997): Clanship, Kinship and Communily among thc Rahanwcyn: A Model for othcr Som•li?, in: Husscin M. Adam . .Richard Ford (cd.): Mcnding Rips in thc Sky, Lawrcocc11ille. S. 131-143.
ders. (n.d.): Will therc bc pcace in Somalia now'l. S. 1-S. (www.somaliland.com/Bcmhard%20Hclandcr.htm). (21.4.0 I J
Copynghlcd malcria
/36
Hdaader, B.; Mukbtar, M.H.; l.ewls, I.M. (1995): Building P= from lklow? A Critical Review of the Dislrict Coun<:ils in the Bay und Bakool Regions of southem Somalia, S. 1-12 ( www .arlaadinet.eom/D&Mhistorylbuilding_peaee _ from _ helow .htrn). [2 I .4.0 I)
Jlerrmaaa, Ron H. ( 1997): Der kriegerische Konflikt in Somalia und die internationale Intervention 1992 bis 1995, Frankfurt/M.
Heyer, Sonja (1997): Staatsentstehung und Staatszerfall in Somalia: Dezentralisierungsmodelle jenseits des Staates, Worlcing Papers on Afiic:m Soeieties, Nr.23.
Hirsch,John L; Oakley. Robcrt B. (1995): Somalia and ()perotion Restore Hope. Washington.
Hobsbawm, Eric; Raoger, Terence (199311983): [ntroduction: lnventing Traditions, in: dies. (ed.): The Invention ofTndition, Cambridge, S. 1-14.
Hube, Michael (2000): Editor's Note, in: ßurton, Richard: First Footsteps in East Afiica or An Exploration ofHarnr. Köln, S. 323-324.
lUlle, John (2000): Geschichte Afrikas, München.
lrla Focus on tbc Djibouti Peaee Coofercnce, August 23, 2000, S. 1-4 (http://allafrica.com/storiesl200008240042.htnll). [21.4.01 1
IRIN WebSpeelal: Somali National Peace Conference, Introduction (www .reliefweb.int/IRIN/webspccials/somal ia _ npc/index.phtml). [21.4.0 I 1
Jama, Ihnhirn Hashi (2000): Tbc Revised C<>nstitution of the Republie of Somaliland. S. 1-7 (www.somalilandforum.eomiRevised-Constitution.htm). [21.4.0 l]
Klate, Georg; Trotha, Trutt von (2000): Wege zum Frieden. Vom Kleinkrieg zum parastaatlichen Frieden im Norden von Mali, in: Soeiologus, SO. Jg. Hell I, 2000, S. 1-36.
Laltla, David 0.; Samatar, Said S. (1987): Somalia. Nation in Seareh ofa State, london.
l.ewls, I.M. (1999:1/1961): A Pastoral Deroocracy. A Srudy of Pastoralism and Politics among thc Nonhem Somali ofthe Horn of Afriell. Hamburg.
drn. (1999b): Aflerword. Some renections on a long engagcment in Somali anthropology. in: dcrs.: A Pastoral Dcmocraey, S. i-xxvi.
den. (196S): Tbc Modem History ofSomaliland. From Nation to State, New York.
ders. (1988): Modem History of Somalia. Nntion and Sute in the Hom of Afriea, london.
ders. (1969): Nationalism and Panicularism in Somalia, in: P.H. Gullivcr (cd.): Tradition and Transition in East Mrica. Studies of the Tribai Element in t:he Modem Era, London, S. 339-361.
ders. (1990): The Ogaden and thc Fragility ofSomali Segmenwy Nation.11ism, in: Horn of Mriea, Vol. Xlll No. 1&2, 1990, S. SS�I.
dtrs. (1993): Misunderstanding thc Somali Crisis. in: Anthropology Today. Vol. 9 No.4, August 1993, S. 1-3.
Copynghlcd malcria
137
d<r$. (1994): Blood and Bone. Thc Ca II of Kinship in Soma Ii Socicty. l.awrcncevillc.
den. ( 1995): Undersl:lndins Sor1131ia: Guidc to Cu hure. History and Social lnstitutions. London.
den. (1997): Clan Conflict and Ethnicity in Sor113lia: Humanitarian Intervention in a Statdess Society, in: David Tunon (ed.): War and Ethnicity. Global Connections and Local Violcnce. Rochcstcr. S. 179·201.
dtn. (2000;,): Ncw UN Adventures in Somolio will not work, 5.6.2000, S. 1-J (www.somaliawatch.org/archiveoctOO/OOI I 01601.htm). [21.4.0 I]
dtrs. (2000b): UN 'Peace Confcrence' creates new Somali warlord and rc-ignites Somali wars, 24. Oct. 2000, S. 1-3, (www.somaliawatch.org/archtveoctOO/OO I 02920 l.htm). [21.4.01)
U:wls d al. ( 1995): A Study of Deccntralised Political Structures for Somalia: A Menue of Options.
Lyons, Terrence; Samatar, Ahmed I. (1995): Somalia. State Collapse, Multilateral Intervention, and Stntegies for politicol Reconstntction, Washington.
lllaasur, Abdalla Omar (1995): The Nature of the Sor113li Clan System, in: Ali Jirnole Ahmet!: The Invention of Somalia, Lawrenceville, S. 1 17-134.
Morebal, Roland (1997): Fonns of Violence and Ways to control it in an urban War Zone: The Mooryaan in Mogadishu, in: H.M. Adam, R. Ford (ed.): Mentling Rips in the Sky, Lawrenceville, S. 193-207.
Marcus, llarold G. (1994): A History of Ethiopia, Berldcy.
Maltbles. Volkcr (1977): Der Grenzkonflikt Somalias mit Äthtopicn und Kcnya, Hamburg.
dtrs. (1990): Der Somali-Konflikt: Nation ohne Staat, m: S. ßrünc, V. Matthies (Hg.): Krisenregion Horn von Afnka. Hamburg. S. 223-247.
dtrs. (1998): Die Organisation fllt Afrikanische Einheit (OAU): Der Mechanismus tllt die Privcntion tr!ld die Lösung von Konflikten, in: U. Engel, A. Meh.ler (Hg.): Gewaltsame Konflikte und ihre Prli'"'ntion in Afrika. Hamburg. S. 41-59.
M.az.rul, Ali A. (1997): Crisis in Somalia: From Tyranny to Anarchy, in: Bussein M. Adam, Richard ford (ed.): Mending Rtps in the Sky. Options For Somali Communities in the 21st Century, Lawrc:nceville. S. 5-11.
M�bler, Andreas; Rlbaux, Claude (2000): Krisenprlvention und Konfliktbearbeitung in der Technischen Zus;tmmcnarbeit. Ein Überblick zur nationalen und intcmationolcn Diskussion, Wiesbaden.
l\lenkhaus, Ken (1996): International l'eaeebuilding and the Oynamics of Local and National Reconciliatton in Somalia. in: International Peacckeeping, Vol. 3 Nr. I . Spring 1996. S. 42-67.
ders. (1998) Sonulia: Political Order in a sta!<less So<:iety, in: Currenl History, Vol. 97 No. 619. May 1998, s. 220-224.
den. (2000): T111ditional ConOict Management in Contemporary Somalia, in: William I. Zanman (ed.): T111d1tionol Cures for Modem ConOicts. African Conflict "Medicinc". London, S. 183-199.
Copynghlcd ma riR
138
1\lenkbaus, Ken; Pendergast, John ( 1995): Governance and economic Survi\,•1 in Postintervention Somalia, CSIS Afriea Notes, No. 172, May 1995.
1\Jobamtd, Abdi·asis M. (1997): How pcace is maintained in the Nonheastem Region, in: H.M. Adam; R. Ford (ed.): Mending Rips in the Sky, U\\Tcnccvillc, S. 327-333.
1\tukbtar. Mohamed Haji (1995): Islam in Somali History: Fact and Fiction, in: Ali Jimale Ahmed (ed.): The Invention ofSomalia, Lawrmce\ille, S. 1·27.
ders. (1997): Somalia: Betwtt'n SeJf.O.tennination and Choos, in: H.M. Adam; R. Ford (ed.): M.ending Rips in the Sky, l.awrencevilk, S. 49�.
Nd um� UJ, Kum'a ( 1999): Formen und Möglichkeiten lnlditioneller Konfliktlösungsmedumismen in Afrika und Handlungsempfehlungen fllrdie GTZ. Berlin, (unveröffentlichtes GTZ-Paper).
Nord, Antonic (2002): Somalia und der internationale Tttrorismua: Wie stark sind islamistiscbe Fundamentalisten am Horn ,·on Afrika?, in: Afrika im Blickpunkt Nr. 1, Februar 2002.
Normark, Stute (1997): Foreword, in: Heinrich, Wolfgang: Building the Peace. Expcriences of Collaborative Peacebuilding in Somalia 1993-1996, Uppsala, S. i-iii.
Nuscboler, Franz(l996): Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, Bonn, (4. AuO.).
P1ulus. Andreas (2001): Die intcmatioalc Gcmeinschofl im Völkerrecht. München.
Posplsil, Leopold (1994): "I am very sorry 1 cannot kill you anymore": War and Peace among the Kapauku. in: S.P. Reyna; R.E. Do\\115 (ed.): Studying War. Anthropological Pcrspccti\'es, Langhomc, s. 113·126.
Press, Robc:n (1999): The New Africa. Dispatches from a Changing Continent, Gainesville.
Prunlor, Gerard (1990191): A Candid View ofthe Somali National Movement, in: Horn of Africa. Vol. XllJIXIV No. 3&411&2, 1990/91, S. 107·120.
dtrs. (1994): Somaliland: birth ofa ncw country?. in: Charles Gurdon (ed.): The Horn of Africa, Guild· ford, S. 61-75.
dtrs. (I 996): Somalia: Update to End of August 1996. (www.unbcr.chlrefworldlcountry/writcnetlwrisom02.htm), S. 1·15. [15. 12.00)
ders. (1998): Soll131iland goes ahme, in: Cu�t History, Vol. 97 No. 619, May 1998, S. 225·228.
ders. (2000): Aufgerappelt aus Ruin<n. Somaliland und das Modell der Dezentralisierung, in: die tag=.eitung, 14.4.2000, s. 1·7, ( www .ta7_dc/tpl/2000/04/14/a0251.nf/stext.Namc:,ask0 1679baa. idx.4). (28.2.0 I J
RaJDJbolbam, Olivtr, Woodboun. Tom (1996): Humanitarian Intervention in Contemporary ConOict, Cambridge.
SabnouD, Mohamed M. (1997): Prevcntion in Connict Resolution: The Case ofSomalia, in: H.A. Adam; R. Ford (ed.): M.cnding Rips in thc Sky, Lav.Tenceville, S. 303·315.
Samalar, Abdi I. ( 1992): Destruction of State and Soeiety in Somaha: Beyond the Tribai Convention, in: Tbc Journal of Modem African Siudics. 30/3, 1992, S. 625� I.
Copynghtcd m31cria
139
Samatar, Ahmed I. (2000): The Somali Catastroph<: Explanation and lmplication. in: Einar Bmathen et al. (ed.): Ethnieity Kills? The Politics of War. Peaec and Ethnic1ty in SubSaharan Africa, London. S. 37-67.
Samatar, S:oid S. (1982): Oral Poetry and Som:lli Nationalism. Thc case of Sayyid Mahammad Abdillc Hasan, Cambridge.
den. (1997): Somalia: Africa's Problem Child?. in: Horn of Africa. Vol. Xv No. 1-4. Dec. 1997. S. 1 10-137.
Sebetter, Conrad (2002): Das Zeitalter der cthnisc� KonOiktc, in: Bl.ättu fllr deutsche und int<'fßationale Politik, April 2002, S. 473-481.
Seblee, GOnthu (1996): Rcgelmlßigk.eiten im Chaos: Die Suche nach wiederkehrenden Mustern in der jOngcren Geschichte Somalias, in: G. Schlec; Karin Wemer (Hg.): Inklusion und Exklusion: Oie Dynamik. •·on Grenzbeziehungen im Spannungsfeld von Markt. Staat und Ethnizitllt, Köln, S. 133-159.
den. (2000a): lntroduction: ldcntity Discourse and practical Politics; Redrawing the map of the Horn: ibe politks of differencc. Vereinigung von Afribnisten in Deutschland e.V .. 17. Tagung Afrika 2000. Leipzig. 30. Mlrz bis 1. April 2000.
den. (2000b): Identitätskonstruktionen und Paneinahme: Überlegungen zur Konfliknheorie, in: Sociolo· gus, 50Jg Heft I, 2000, S. 64-89.
den. (2001 ): Rcgularity in Chaos: Thc Politics of Differcncc in the recent History of Somalia (Max Plaock Institute For Social 1\nthropology Working Paper No. 18). Halle/Saale.
Sehmldl, Erwin A. (2000): Friedensmissionen. in: Helmut Volger (Hg.): Lexikon der Vereinten Nationen. MOnchen, 154-155.
SeborlttMr, Sabine •·on (2000): Menschenrechte und "humanitäre lntervmtion·, in: Internationale Politik, 212000, S. 41 -48.
Sengboas, Oieter (1973): Friedensforschung und Dritte Welt, in: Afrika Spectrum, 3m, S. 245-266.
Slgrlst, Christion (197911967): Regulierte Anarchie. FmnkfuntM.
Slmon•. Anna (1995): Networks ofDissolution. Solll31ia Undone, Bould<r.
Sl•k:, Timothy ( 1997): Mediatins Afric•'• Civil Conflicts - A User's Guide, in: Gunnar M. Sorobo; Pcter Vale (ed.): Out ofConnict. From War to Peace in Africa, Uppsala, S. 179-198.
Somalia: Conforence Stage ofDjibouti peaee talks opens, 2000, S. 1 ( www.reliefwcb.inti!RIN/cca/countrystorics/somalia/20000615 .phtml). [21.4 .0 I )
Somalia wlhlt einen Präsidenten, taz 26.8.2000 ( www.taz.de/tp112000/08126/a0070 .nflstc•LName,askO 1606aaa.idx,3S). [28.2.0 1)
Somall Eldero: 1\n Open Letter To Prcsidcnt Mohruncd Siyaad Barre. in: Horn of Aftica, Vol. xlii No. 1&2 {Jan.-Junc) 1990. S. 109-124.
Somalllaud Coundl of Elders says no to unification wiib Somalia, S. 1·2 (www.somalilandforum.com/SL %20C.ouncil%20ol%20elders. htm). [21.4.0 1]
Copyngh!cd malcria
140
SomaUiaad Forum (2000): The Djibouti-Sponsored Somali Pcact Conference: A Critique, March 22nd, 2000, S. 1-4, S (www.somalilandforum.com/ForumPosition.btml). ( 1 .2.01 I
Soreas, Jason P.; Wantcbekon, Lronard (2000): Social Order without lhc State: The C.ase of Somalia, 2000, S. 1-16 (www.yale.edu/ycias/african/as2.pdJ). [21.4.01]
Spelten, Angelilcll (1999a), Pr:lventive Massnahmcn in der EntwicklungszusanutlCnarbcit. lndikatorenlclltalog zur Bestimmung des Einsatu.citpunktes, in: Östcrreithisches Studienzentrum fllr Frieden und Kontliktk!sung (Hg.): Krisenprä,-ention, Friedensbericht 1999, S. 121-136.
dies. (1999b). Instrumente zur Erfassung von Konflikt- und Krisenpotntialcn i.n P3!lnerländcm der Entwiclclungspolitik, BoM.
Stagl, Justin (1999): Segmenl!re Gesellschaft, in: Ch. Fest, H. Fischer, Th. Schwci1.cr (Hg.): Wörterbuch der Völkerlwnde, Berlin, S. 338.
Steveosoo, Jonathan (\993): Hope Restored in Somalia?, in: Forcign Policy Nr. 91, Summer 1993, S. 138-154.
Stuby, Gerhard (2001}: Internationaler Terrorismus w1d Völkerrecht. in: Blätter fllr deutsche W\d internationale Politik. Hcft l l/2001, S. \330-1341.
TetzlafT, Rainer (2000a): Globalisicrung - "Dritte Wclt"-Kulturcn zwischen Zukunftsängsten und Aufholhoflhungen, in: dcrs. (Hg.): Weltkultw-en unter Globalisierungsdruck, BoM, S. 18-64.
den. (2000b): Afrika zwischen Zivilisierung und Zerfall des Staates: Zu den gewaltsamen Umbrüchen in Afrika nach dem Ende des Kalten Krieges, in: Rolf Hofmeier; Cord Jakobeil (Hg.): Afrika Jahrbuch 1999, Opladcn, S. 34-47.
Uaser, GOnter (1997): Die UNO, MOnchen.
Warlords opposed to the Somali governmcnt mcct, March 5, 200\ (www .cnn.com/WORLDiafrica/03/05/somalia. warlords.reutlindcx.html). (7 .3.0 I I
Warsamo, \smai\ Haji (1999): Message frorn thc Office of thc President, Jun. 4, 1999 (www.puntlandnct.com/prcsidcnt.htm). [\4.3.01]
Weber, Max {1980): Wirtschaft und Ge-sellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, Tilbingcn, S. 822 (zitiert nach Hcyer, S. 10).
Wlt<"llrtk-Zeul, Hcjdcmarie (1999): SicherheitspOlitische Be20gc der Entwicklung,;politik, Rede von BW\dcsrninistcrin Heidemarie Wieczorek-Zeul zur Abschlussveranstaltung des Kernseminars der Bundcsakadtmie ßlr SicherheitspOlitik am 28. Mai 1999, S. 1-10. (www.bmz.delinfiotheklredct99905280\.html). (8.5.00]
Wlndfuhr, Michael (1999): "Track Two"-lnterve:nlionen. Die Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure in der KonOiktprävcntion, in: Univcrsitas, Heft 8, August 1999. S. 755-766.
Zartman, William I. (2000): lntroduction, in: dcrs. (ed.): Traditional Cures for Modern ConllictS. African Conflict "Medicine", l.ondon, S. 1-1 I.
Zitelmann, Thomas (1996): Begegnungen im globalen ldeoraum: Mohammed Fanh Aidid, Klan, demokratische Autonomie und Apokalypse, in: Hans-Pctcr Milllcr (Hg.): Weltsystem und kulturelles Erbe, Bcrlin, S. 271-285.
Copynqhted malcria
141
den. ( 1999): Oromiya Regional St3te - Äthiopien 1997: Bericht aus der Konfliktforschung, in: Sozialanthropologische Arbeitspapiere. Nr. 76.
ders. (200 I): Krisenprllvention und Entwicklungspolitik -Denkstil und Diskursgeschichten, in: PeripherieNr. 84,Jg200l,S. 10-25.
den. (2002): Rumors, Networl<s, Alliances: Bin Laden's Sh3dow on thc Horn of Africa (unveröffentlichtes Diskussionspapier, Halle/S:Iale, März 2002).
Copyngh!cd malcria
/42
GWSSAR
tol patrilineare Verwandtschaft
xecrlhccr Yenragsbindung
shir allgemeine Versammlung
Guuni Ältestenrat auf nationaler und lokaler Ebene
M.O.D. Allianz der nächsten Verwandtschaftsgruppen des Ge-
oerals Barre (Marrehaao , Ogaden, Dulbahante)
EPLF Eritrean Peoples Liberation Front
SSDF Somali Salvation Democratic Front
SNM Somali National Movement
TPLF Tigrayan Pcoples Liberation Front
usc United Somali Congress
Ali Mahdi wichtige Kriegsherren im somalischcn Bürgerkrieg
Mohammed Aidccd
LPI üfe & Peace Institute
Copynqhted matcria
143
GOLF VONADEN
ÄTHOPEN
INDISCHER OZEAN
- ·-· - Wernationale Grenze
t \ --- Distrikt Grenze
SOMALIAS ADMTNISTRATIVE REGIONEN NACH 1 975
Quelle: llron•, Maria (2001): Soctety. Secunty and lhc Sl4t< in Som>lto. From Statclcssncss to Statt· les$ne.ss? Utreeht
(,opy hl nt II
145
SUMMARY
The escalation of violence in Somalia sincc the end of the 1980s, methodieally presented hen: in the form of a litenuy essay, is the centre of this ethnological and histori· eal study. This analysis brings to focus the different stratcgies pursued at local and international Ievels to rc-establish pcace in tbc country. Thc study finds it's theorctical origins in thc ficld of conflict-research. lt qucstions the validity of thc proposcd concepts of this rclativcly ncw ficld of German and international devclopment policics, which aim ai promoting peace in a contcxt of violence specifically in the countries of the South.
In the introduction, the German as weil as the general Western political conceptions in regard to thc main preventive mcasures against crises and conflicts are considcred. These idens invariably assumc a unitary state systcm as thc point of dcparturc or thc object of thc commitment. This appears paradoxical sincc the weakness of the state moulded according to the Europcan model was in many instances an important contributing factor to the escalation of violence. Although the problern of the weak state with its Iack of fi.rm roots at the local Ievel is thcoretieally recognised, praxisorientated conceptions of devclopmcnt policies as pcace-promoting policies do hardly consider or encouragc any alternatives to n statc-ccntred approach. ln thc framcwork of Western strategies, the specific cultural aspects of handling local conflicts are generally ignored. Locally and regionally existing politico-social modes are often disqualified as backward and conflict-generating "tr.aditions."
ln order to understand the situation in Somalia in the 1990s, the study starts by outlioing tbc fundamental featurcs of thc traditional Soma Ii social ordcr as weil as tbc cvolu· tion of thc statc structures in thc country. ln thc analysis of the Soma Ii state it is argued tbat the rcferenccs made to the unstable structures of thc traditional society do not provide convincing reasons for the state collapse. To the contrary, particularly during the era of President Barre existing traditions wen: strongly manipulated to such an extent tba.t at the end of the 1980s and the bcginning of the 1990s a politico-social disintcgration of a previously unknown scalc was able to Iake placc.
The principal part of thc study dcals with the different strategics, which rcstrain violence and enhance a peaceful social order. Externat political interventions at international Ievels, under the auspices of the UN and the USA, proved to be unsuccessful. Even the measun:s undertaken by the Life and Peace Institute on behalf of civilian Organisations and in co-operation with the tJNO ultimately failed owing to insufficient efforts to adapt thc projects to local conditions and considerations. However, a closc cxamination of dcvelopmcnts within thc local and regional context nnd unrelatcd to the international intcrvcntions shows thnt peace-promoting policies can be successful if local realities are Iaken as starting point and thc responsibility for curtailing violence and maintaining peace is primarily left to the persons directly affected. This means, however, in the case of Somalia that the priority is not likely to be the reconstruction of a unitary state system within thc borders of thc former Republic of Somalia. Rather, a
Copynghtcd ma riR
146
regional consolidation of the peaceful social forces appears to be thc bcst way for achieving peace.
Such a decentralised peace proccss in Somalia has brought about political autonomy and cven led to indcpendencc of regions. Since the policies of the international com
munity, as witncssed at the Peace Conference in Arta (Djibouti) in 2000, are so much focussed on the idea of a central statc structure, the Republic of Somaliland, de fncto independcnt since 1991, has not becn intcrnationally recogniscd. Yct it was prcciscly in this region that ii was possible to end thc civil war by thc middlc of thc !990s based on a rcliancc of ex.isting traditions. From an ethnological and politological point ofview, Sornaliland has so far dcvelopcd n vcry intercsting model of a state structurc wbose stability depends largcly upon the integration of Sornali traditions in the govemmental apparatus.
Just as the analysis of thc cvolution of statc strucrures in Somalia also thc results of invcstigations madc into thc civil war, bascd on assumptions about unstable traditional and social structures, arc only of limitcd validity. Thc frcqucntly prcsented clan focus in acadernic studics and in the rnedia, superticially characterising the escalation of violence in Somalia during the last ten years as clan and tribal wars, is distoned. ln the Nonh wherc owing to special historical circumstances traditional structures of society arc in fact still dominant, the violence was quicldy brought to an end. In thc South, howevcr, war arnong the different warlord factions continues to this day. II is evident that for an understanding of the rcccnt deve'lopmcnts in Somalia a complctely new ethnological and historical approach is neccssary.
The case of Somalia on the whole presents itself as considerably more complex, but also - considering the developments in the autonomaus rcgions - much more positive than the connotations of tbe continuously lilsed slogans "Clan Wars", "Anarchy'' and "Chaos" would suggest. Presently, thc alrcady achicvcd progrcss scems, however, to bc again in dangcr. Following thc tcrrorist attacks of militant lslamic groups against the US, Somalia has now come into the limelight of the international Anti-TerrorAlliance. Thc Scenario of a dangeraus threat emanating from Somalia has, howcvcr, upon carcful local investigations been proved as false. A renewed international military intervention would most likely Iead t o another escalation ofviolence in thc country.
Copyngh!cd malcria
147
ANGABEN ZUM AUTOR
Marlms Virgil Hölmc, M.A. Ethnologie
Geboren in Trauostein arn 21.07.1975. Studium nn der Ludwig-Maximilians Universität in
MQnchen, HF: Ethnologie, NF: mittelalterliche Geschichte, Turkologie und VölkerrechL Er
lnngung des Grades eines Magister Artium im Frtlhjahr 2002, Planung eines Praktikums in
Somaliland zusammen mit einer lokalen NGO.
Copynghtcd malcria
INSTITUT FÜR
AFRIKA-KUNDE
Harnburg
Liefetbare Titel zu politischen, ökonomischen tmd sozinlen Entwicklungen in Somalia,
Älhiopien, Eritffil tmd Sudan. Bitte fordern Sie auch unser Publikarion.n<eneichnis an oder besuchen Sie uns im Internet.
N"!Cde Hin: Eritrm l'\Uchm Kri'8 und Fritrkn. Dit Em<idlung Stil der Unai:Jh/Jngigktit. 2001. llambu'ger Bcitrf&e zur Afiika·KW1dc. Bond 62. 276 S., ISBN :>-928049-'104. € 17 ••
An1onic K. Nord: Polilischt Parr;tipation in tin.r 1>/ockimm Dtmol:ratlt. Das Btisp/tl Äthiopitn. 1999. Arbeilen aus dem IJU'irut fllr Afrika-Kunde. Band I 02. 163 S .. ISBN 3· 928049·S7·7, € II,·
Sandra Dicrig: Urban EJn'irtNim�nzal Managtmtnt in Addis Ababa. Prol>ltms, Policltt. PtrS[Netii'<S, and rhe Rolt of NGOs. 1999. Hmbvr& Mri� Studie,. Band 8, 236 s., ISBN 3·928049-59-3, € IS.·
Rainet Hanmann: EriJrta: Ntubtgitur mil TouriJmus. Ein inJtgrarivts Planungs- mJd Entwlcklunglkonupr. 1998. Arbeiten ous dem lnstillll fllr Afrika-Kunde. Band 99, 256 S., ISBN 3·928049-52·6, € 16,·
Jasmin Touad: Politik muJ Gtsttlsclrnft in Somalia (/89()./991). 1997. Hornburger Beitrlge zur Afrika-Kunde. Band S4, 259 S .. ISBN 3-928049-45-3, € 16,·
Elke Zimprich: RtlllltgraJiorr '"" Ex· K�erinnen in Erirrta. Eint gtnder-sptZi·
fischt Sfudit in fritdens- und tnt\\tfckl ungs· politisch.r P.rsptl::tlvt. 1996. Arbeiten aus dem Institut fllr Afrika-Kunde. Band 94. ITI S .. ISBN 3-928049-41-0, € 4,·
Cbristiane Auf: S/041 und Mililär in ÄJhlopltn. Zur Wtchstlwirtung im hisrori· sehen Prot.t8 du Stootsbildung. 1996. Ar· beiten aus dem lnstiiUI ftlr Afrika-Kunde. Bond 92, 164 S .• ISBN 3-92ro19-36-4, ( 4,·
Maria Brons: Somaliland. Zwd JaJtrt nach du Unabh�glg·ktltse<*JifUIIg. 1993. Ar· beiten lU$ dem Institut fllr Afrika-Kunde. Band 89. 112 S .• ISBN 3-928049·23·2, € 4,·
Maria Bonganz: Somalia Im Btirgertrieg. Ursachen und Persptbivtn des iMtnpoliri· schtn Korrjlikts. 1991. Arbeiten aus dem ln· stilul ßlr Afrik:a·Kunde. Band 74, 131 S . . ISBN 3·928049·03·8, ( 4,·
Lisa Sendker: Erilrtilcht Flür.hrlingt im Su. dan. Zwischttr A,ssimilarion und �grtgatiOfl. l990. Arbeilen aus <km Institut ftlr Afrika· KW1dc. Bll!ld 70, 300 S .. ISBN 3·923m·99-0, (4,·
Huben Laux: Die Bnnnhalz· und Holl);ohlt· >'trsorgwrg in Mogotlishu (Somalia). 1989. Arbeiten aus dem Institut filr Afrika·Kunde. Band 62, ISS S .. ISBN J.923SI9-87·7, € 4,·
EI· Walhig Mobamed Ka.meir: 71rt Political EcorrotlfJ of l.abaur Migration in the Sudan. A comparwive cast study of migram worktn in an urban sirumion. Arbeiten aus dem ln· stilut filr Afrika-Kunde. Band S7. 1988. 131 S . . ISBN 3-923519-79-6. ( 4,·
Dellef Kalb: Fmuthtn und 1/iullicht Ent· wlcklrmg. Du Fall Sudan. 1986. Arbeiten aus dem lnstiiUI ftlr Afrika-Kunde. Band SI. 298 S .. ISBN 3-923519-67-2. ( 4,·
Siefan Briine: Ärhiop/tn · Unttrtnrwicklung wul radikalt Mlllrirhtmchaji. Zrrr Aml>i· wJltlll tinu schtinhtiligtn Rtl'Oiution. 1986. Hornburger Beitrage zur Afrika-Kunde. Bond 26,381 S .. ISBN 3-923SI9-63-X, € 4,·
INSTITUT FÜR AFRIKA-KUNDE im Verbund Deutsches Übersce-Institut
NetJer Jungfernstieg 21, 20354 Hamburg. Tel.: 040/42825-523, Fax: 040/42825-51 1
[email protected] - http://www.duei.de/iak
Copy1K}b!tod .na ria