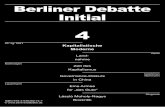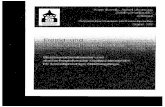Yuval Christliche Symbolik und juedische Martyrologie zur Zeit der Kreuzzuege
Bedeutsamkeit und Sprache in Heideggers Sein und Zeit
-
Upload
lmu-munich -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Bedeutsamkeit und Sprache in Heideggers Sein und Zeit
Francesco Castorina
Bedeutsamkeit und Sprache in Heideggers
„Sein und Zeit“
Masterarbeit
zur Erlangung des Grades eines Master of Arts (M.A.) im Masterstudiengang Theoretische Philosophie
an der Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswis-senschaft
der Ludwig-Maximilians-Universität München
Betreuer der Arbeit: Prof. Dr. Axel Hutter
Eingereicht am: 02.02.2015 Geburtstag/-ort: 12.01.1990 Catania (Italien) Adresse: Stahleckstr. 13, München Email: [email protected] Matrikelnummer: 10801500
Inhalt
Einleitung 3
1. Der Begriff der Bedeutsamkeit
6
1.1. Vorbemerkungen zur Bedeutsamkeitsanalyse
1.2. Zeug und Verweisung
1.3. Welt als Bedeutsamkeit
1.4. Betrachtungen zum Begriff der Bedeutsamkeit
1.5. Die Welt und die Anderen. Die Mitwelt
6
10
17
26
31
2. Rede und Sprache
36
2.1 Verstehen und Auslegung
2.2 Rede und Sprache in „Sein und Zeit“
2.3 Sprache bei Wittgenstein. Bilder aus den „Philosophischen Untersuchungen“
37
44
55
3. Sprache und Erschließungsfunktion
67
3.1. Wort und Bedeutung
3.2. Sprache und Erschlossenheit
68
73
Schlussbemerkungen 86
Bibliographie 89
Siglenverzeichnis 92
3
Einleitung
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Das erste Kapitel ist der Erläute-
rung des Begriffes der Bedeutsamkeit gewidmet, wie er in Sein und Zeit vorgestellt
wird. Unter diesem Terminus ist nicht das zu verstehen, was man mit „Bedeutsam-
keit“ gewöhnlich meint. Denn Heideggers Reflexionen über diesen Begriff trachten
nicht danach, die Idee der Bedeutsamkeit, als Wert zu verstehen, zu erforschen. Um-
so weniger versuchen sie, eine Antwort auf die Frage zu geben, was es bedeutet, dass
ein Ding für jemanden wertvoll bzw. bedeutsam ist. Bedeutsamkeit bzw. Wichtigkeit
der Dinge und Ereignisse kommt weder im oben genannten Werk noch in dieser Un-
tersuchung infrage.
Bedeutsamkeit in der Terminologie Heideggers hängt hingegen mit dem Studium der
Welt zusammen. In welchem Sinne dieser Zusammenhang verstanden werden soll,
wird im Folgenden erklärt. Momentan gilt es, explizit zu machen, dass der erste
Schritt dieser Arbeit in der Auseinandersetzung mit dem Problem der Welt besteht.
Das Problem der Realität oder des Wesens der Welt beschäftigt die Philosophie, von
ihrem Ursprung an. Die erste Aufgabe, welche man sich vornimmt, ist die Erläute-
rung der originellen Züge, die die Weltcharakteristik Heideggers auszeichnen.
Ein Punkt muss aber bereits in der Einleitung klargemacht werden. Die Ausführun-
gen zur Welt sind methodologisch nicht von der Analyse der menschlichen Existenz
getrennt. In anderen Worten: es wird keine „subjektlose“ Welt beschrieben, sondern
immer die Welt des Menschen, was insofern eine bedeutende Einsicht darstellt, als
dass sich Heidegger durch sie von der philosophischen Tradition, d.h. der Erkenn-
tnisphilosophie, distanzieren will, welche die Opposition eines Subjekts (Menschen)
zu einem Objekt (der Welt) für unbegründete Voraussetzung hält.
Nachdem das erste Kapitel die wesentlichen Aspekte der Weltanalyse ausgeführt
hat, widmet man sich der Frage nach der Sprache. Auch in diesem Fall geht es nicht
um einen isolierten Forschungsgegenstand. Denn das Wesen der Sprache zeigt sich
immer im konkreten Dasein des Menschen. Aus dieser Erwägung behandelt Heideg-
4
ger das Thema der Sprache und ihres ontologischen Fundaments (der Rede) im
Rahmen einer umfassenden Analyse, die beabsichtigt, die für die menschliche Exis-
tenz konstitutiven Momente zu finden und charakterisieren.
Verstehen und Auslegung machen zwei dieser Momente aus, die zusammen mit der
Sprache und Rede im zweiten Kapitel verhandelt werden. In demselben Kapitel wer-
den auch einige Aspekte der Sprachauffassung des späteren Wittgensteins beschrie-
ben. Damit visiert man nicht an, das Terrain für die Herstellung einer Parallele zwi-
schen beiden Philosophen vorzubereiten. Man zielt vielmehr darauf ab, Merkmale
des Gedankens Wittgensteins vorzubringen, um die Interpretation der Spracherschei-
nung, wie sie in Sein und Zeit dargelegt wird, deutlicher zu veranschaulichen.
In den ersten zwei Kapiteln geht es also um eine allgemeine Beschreibung von Un-
tersuchungen, die im ersten Teil von Sein und Zeit enthalten sind, und einiger Be-
trachtungen aus den Philosophischen Untersuchungen. Diese Beschreibung soll den
Bezugsrahmen präparieren, innerhalb dessen die folgende Frage gestellt und dann
ausgearbeitet werden muss: Was für ein Verhältnis besteht zwischen der Welt als
Bedeutsamkeit und der Sprache? Diese Frage, welche den Schwerpunkt des dritten
Kapitels darstellt, wird selbstverständlich unter Bezugnahme auf das philosophische
Projekt von Sein und Zeit beantwortet. Ein Projekt, dessen erster Schritt in der Expli-
kation der Seinsstrukturen des menschlichen Daseins besteht.
Die Bezugnahme auf das Hauptwerk Heideggers ist kein Nebendetail. Sie bedeutet
vielmehr, dass die angesprochene Fragestellung ausgearbeitet werden muss, indem
der Grundsatz, der schon angedeutet wurde, aber noch präziser zu definieren ist, be-
rücksichtigt wird. Das Problem der Rolle der Sprache in der Strukturierung der Welt
wird aus der Perspektive des faktischen Existierens des Menschen verhandelt. Man
muss also die These ablehnen, man könne das Verhältnis Welt-Sprache so analysie-
ren, als wären diese zwei „an-sich“ bestehende Instanzen, zu denen sich der Mensch
nur a posteriori verhalten würde.
5
Was das angesprochene Verhältnis betrifft, bleibt Heidegger in seinem Hauptwerk
sehr dunkel, weswegen seine Ausführungen zu diesem Thema viele Interpretationen
zulassen. Hier beschließt man, der Lesart von Herrmanns1 zu folgen.
Im Rahmen der Problematik des Verhältnisses Welt-Sprache wird die folgende The-
se verteidigt: Obwohl Heidegger eine innovative Weltvorstellung entwickelt, welche
das Studium des Seins überhaupt in einen neuen Horizont stellt, vermag er nicht, sich
von der Metaphysik, die seinen Gegner darstellt, vollständig zu distanzieren. Die un-
begründete Prämisse, jedes „Seiende“, sei es die Welt, die Sprache oder die Zeit,
müsse aus der Perspektive des effektiven menschlichen Daseins untersucht werden,
zeigt sich einerseits als fruchtbar hinsichtlich einiger Analysen (wie der der Bedeut-
samkeit) aber andererseits als irreführend bei der Erörterung des Wesens der Spra-
che.
Dadurch, dass Heidegger von der menschlichen Existenz seinen Ausgang für jedwe-
de Frage, sogar für die nach der Sprache, nimmt, fasst er die Sprache selbst als
Werkzeug auf und nicht als ursprüngliches Phänomen. Genau wie eines Werkzeugs
bedient man sich, Heidegger zufolge, der Sprache in einer bereits (vorsprachlich)
strukturierten Welt. Daraus folgt: Die Sprache trägt nicht dazu bei, die Welt zu be-
stimmen und gliedern.
Im Argumentieren für diese These stützt man sich auf die Interpretation Lafonts2. Sie
erkennt diese Tatsache: Die Bestimmung der Sprache als Werkzeug hat ihren Urs-
prung in der Annahme der unbegründeten Prämisse, von der schon die Rede war.
Aus der Perspektive des Existierens des einzelnen Menschen kann den Charakter der
Ursprünglichkeit der Sprache nicht erfasst werden.
1 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“. 2 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers.
6
1. Der Begriff der Bedeutsamkeit
1.1. Vorbemerkungen zur Bedeutsamkeitsanalyse
Heidegger bedient sich des Begriffes der Bedeutsamkeit, um die formale Struktur der
Welt zu bezeichnen. Diese Bestimmung stellt allerdings in Sein und Zeit nur den
letzten Schritt der Untersuchung des Weltphänomens dar. Um das richtige Verständ-
nis dessen zu gewinnen, was im Werk mit dem angesprochenen Begriff gemeint
wird, bedarf es einer vorläufigen Erläuterung der vollständigen Weltanalyse und, all-
gemeiner, des Projekts Heideggers3.
Der erste Teil von Sein und Zeit ist der existenzialen Analytik gewidmet. Dieser Titel
nennt die Explikation der ontologischen Strukturen des menschlichen Daseins.
Grundsätzliche Prämisse dieser philosophischen Aufgabe ist, dass sich das menschli-
che Dasein von der Subsistenz der „Dinge“ wesentlich unterscheidet. Aus diesem
Grund werden Termini wie „Dasein“, „Existenz“, „Existieren“ ausschließlich in Be-
zug auf das menschliche Dasein verwendet. „Vorhandenheit“ gibt hingegen die
Seinsweise der Substanzen an4.
In der Formulierung des Begriffes der existenzialen Analytik war die Rede von onto-
logischen Strukturen und menschlichem Dasein. Das heißt, dass Seinsverfassung (d.i.
die Gesamtheit der ontologischen Strukturen) und Existenz nicht gleichzusetzen sind.
Diese enthüllt sich nämlich nicht als unveränderliche Seinsstruktur (die Heidegger
Phänomen nennt), sondern kann diese oder jene Form annehmen. In nicht philoso-
phischer Sprache ausgedrückt: Jeder Mensch vollzieht seine eigene Existenz (sein
eigenes Leben) anders als die Anderen. Jede Existenz wird aber gemäß unveränderli-
cher existenzial-ontologischer Charaktere (daher „Existenzialien“ terminologisch ge-
3 In Folgendem werden nur die Punkte des Projekts Heideggers beschrieben, die für die vorliegende Arbeit relevant sind. 4 Heideggers terminologische Auswahl wird auch in der vorliegenden Arbeit beachtet.
7
fasst) durchgeführt, welche die jeweilige Existenz eben als (menschliches5) Dasein
gegenüber allem anderen Seienden auszeichnen. Die Existenzialien dürfen keines-
wegs als Kategorien begriffen werden, da diese in der überlieferten Metaphysik das
nicht daseinsmäßige Seiende kennzeichnen. Außerdem lassen sich diese Charaktere
nicht als Eigenschaften interpretieren, welche zur „Ich-Substanz“ hinzukommen
würden. Sie gehören vielmehr zum Sein des Daseins so, dass es unmöglich wäre, sie
außerhalb der existenzialen Strukturganzheit vorzustellen. Gleichermaßen muss man
sich stets den Grundsatz vor Augen halten, dass Dasein konstitutiv durch die Exis-
tenzialien bestimmt ist.
Die Freilegung der durch die Existenzialien konstituierten Seinsverfassung des Da-
seins ist nicht ein innovativer Vorsatz der Philosophie. Diese Frage wurde jedoch
von einer besonderen Seinsweise bzw. einem besonderen Vollzug her gestellt und
ausgearbeitet. Das Wesen des Menschen wurde nämlich vorwiegend ausgehend vom
theoretischen Erkennen ergründet. Einer der originellen Züge der Überlegungen
Heideggers besteht darin, dass er in der Durchführung seiner Analytik den Ausgang
von der „durchschnittlichen Alltäglichkeit“ (SuZ S. 16) nimmt. In dieser Perspektive
repräsentiert das Erkennen nur einen möglichen (nicht primären) Aspekt der Exis-
tenz. Insofern behauptet Heidegger, das Sein des Daseins lasse sich ausgehend von
der faktischen durchschnittlichen (alltäglichen) Existenz selbst untersuchen, nicht in-
dem man von dieser absieht.
Das Sein des Daseins lässt sich, wie schon erwähnt wurde, nicht nach den Bestim-
mungsmodalitäten des Vorhandenen erfassen. Sein des Daseins heißt immer In-der-
Welt-sein. Bevor der Sinn dieser existenzialen Charakteristik hinsichtlich seiner
Strukturmomente hinterfragt wird, gilt es, zwei einleitenden Bemerkungen zu ma-
chen.
Erste Bemerkung. Das In-der-Welt-sein ist keine Eigenschaft, welche das Dasein ge-
legentlich besitzt, keine Möglichkeit also, die es nur zuweilen bestimmt. Es ist nicht
so, dass das Dasein zuerst existiert und erst danach in einer Welt ist, sich zu ihr ver-
hält. Ein ausdrückliches Verhältnis zur Welt (etwa das Studium eines Ökosystems)
kann man nur deswegen haben, weil diese immer schon da ist. Dieser Sachverhalt 5 Von nun an wird das Adjektiv „menschlich“ neben dem Wort „Dasein“ nicht mehr auftauchen. Da-sein ist immer menschliches Dasein.
8
kann vielleicht ontisch, d.h. von den konkreten „Lebenssituationen“ her, trivial er-
scheinen. Denn es leuchtet jedem ein, dass jegliche menschliche Tätigkeit in einer
„Welt“ unternommen werden muss. Ontologisch gesprochen, bleibt aber dieses Fak-
tum total dunkel, und zwar sowohl hinsichtlich der Frage, „was“ Welt ist, als auch in
Hinblick auf das, was „in einer Welt zu sein“ bedeutet. Sowohl Descartes Metaphy-
sik als auch Kants Transzendentalphilosophie und auch Husserls Bewusstseinsphilo-
sophie fassen das Subjekt bzw. Ich bzw. Bewusstsein zuerst „an sich“ ontologisch
auf und thematisieren an zweiter Stelle sein Verhältnis zur Welt. Analog ist die Welt
zunächst „an sich“ bestehend, um dann wahrgenommen und erkannt zu werden. Hei-
degger will hingegen sofort feststellen, dass das Dasein von Anfang an6 durch das In-
der-Welt-sein charakterisiert ist. Aus dieser Perspektive stellen sich das Wahrneh-
men und das Erkennen als zwei Möglichkeiten des In-der-Welt-seins heraus, welche
diese existenziale Determination immer schon voraussetzen.
Zweite Bemerkung. Unter „In-der-Welt-sein“ versteht man den grundlegenden
Seinsmodus des Daseins. Es muss also erklärt werden, inwiefern diese Seinsweise
vom In-der-Welt-vorhanden-sein des nicht daseinsmäßigen Seienden abzugrenzen
ist. Ein vollständiges Verständnis dieser Unterscheidung lässt sich lediglich entwi-
ckeln, indem das angesprochene Phänomen transparent gemacht wird. Vorbereitend
kann auf die folgende Erwägung aufmerksam gemacht werden: Dasein ist nicht in
der Welt, wie Dinge in anderen Dingen sind. Ihr Verhältnis ist ontologisch anders als
das zwischen Gegenständen. Das besagt: Das In-der-Welt-sein des Daseins drückt,
verglichen mit der Relation zwischen Vorhandenen, eine ganz unterschiedliche In-
sein-Relation aus. Das In-sein-Verhältnis zwischen Vorhandenen lässt sich durch ba-
nale Beispiele verdeutlichen: der Tisch ist in dem Zimmer, das Zimmer ist in dem
Haus usw.. Dieser Regress lässt sich zurückführen bis an die Grenzen des „Welt-
raums“. Leitfaden dieser Vorstellung von In-Sein ist die Idee der Räumlichkeit, wel-
che ihrerseits nicht den richtigen Boden für die Interpretation des In-Seins des Da-
seins bieten kann. Nicht aber deshalb, weil sich der Mensch nicht als Substanz (Vor-
handenes) begreifen lässt. Denn dieser kann sich als reine „Körperlichkeit“ in einem
Raum verstehen. Solche Interpretation erfasst allerdings die Seinsstruktur der Exis-
6 In dieser Passage habe ich mich der Ausdrücke bedient wie „zuerst“, „an zweiter Stelle“, „dann“, „von Anfang an“. Diese dürfen keineswegs zeitlich verstanden werden, sondern streng genommen on-tologisch.
9
tenz nicht, sondern beruht auf ihr. In anderen Worten ist das Bild des Menschen als
Substanz nicht falsch, doch als nicht ontologisch ursprünglich ist es immer eine Mo-
difikation des In-der-Welt-seins. Der Versuch, die ontologische Verfassung des Da-
seins durch die Idee der Substantialität klarzustellen, wäre dementsprechend wider-
sprüchlich.
Der Begriff des In-der-Welt-seins lässt sich nicht am Leitfaden der Vorstellung des
„Ineinander-seins“ des Vorhandenen aufklären. In-Sein des Daseins heißt hingegen,
immer schon mit der Welt vertraut zu sein: „‚Ich bin‘ heißt so viel wie: Ich wohne,
halte mich auf bei der Welt als dem Vertrauten. Sein als In-Sein und ‚Ich bin‘ heißt
wohnen bei …, und ‚in‘ bedeutet gar nichts Räumliches, sondern besagt primär: ver-
traut sein mit.“ (GA 20 S.213) Dasein ist immer bei der Welt, jedoch wiederum nicht
im Sinne von zwei Vorhandenen, die nebeneinander sind. Als mögliche Weisen des
In-Seins des Daseins führt Heidegger folgende Beispiele an: „zutunhaben mit etwas,
herstellen von etwas, bestellen und pflegen von etwas, verwenden von etwas, aufge-
ben und in Verlust geraten lassen von etwas, unternehmen, durchsetzen, erkunden,
befragen […].“ (SuZ S.57) Möglichkeiten wie diese zeichnen das Sein eines Seien-
den aus, das nicht im „Raum“ bloß vorhanden ist, sondern immer schon eine Ver-
trautheit mit der Welt hat. Ontologische Bedingung der genannten Möglichkeiten ist
nämlich die Vertrautheit mit der Welt. Nicht also besteht das Dasein in der Welt und
ergreift auf der Basis dieses „Bestehens“ die jeweiligen Vollzugsmöglichkeiten. In-
sofern wird der Gedanke noch klarer, das Dasein könne sich als Substanz nur auf der
Grundlage seines In-der-Welt-seins verstehen, denn die Möglichkeit, sich aus der
Idee der Räumlichkeit (d.h. als reine Körperlichkeit) zu begreifen, ist eben eine da-
seinsmäßige Möglichkeit und nicht die ontologische Bedingung alles Existierens.
Inwiefern ist die Welt von Anfang an da und das Dasein immer schon darin? Die
Formel des In-der-Welt-seins besteht aus drei Momenten, denen in Sein und Zeit drei
verschiedene Analysen entsprechen. Erstens muss die Welt in ihrem ontologischen
Fundament untersucht werden. Dabei erhebt sich die Frage, ob sie als Vorhandenes
oder daseinsmäßig zu begreifen ist. Diese Untersuchung beschäftigt dieses erste Ka-
pitel. Zweitens setzt sich Heidegger mit dem Problem des „Wer“ auseinander, der in
der Welt ist. Diese Überlegung ist im Rahmen meines Textes nicht von Belang,
weswegen sie nur marginal, und zwar nur in Hinblick auf den Begriff der Mitwelt,
10
berücksichtigt wird. Drittens steht das „In-Sein“ als solches, d.h. „Wie“ das Dasein
in der Welt ist, im Blick. Mit diesem Thema befasst sich das zweite Kapitel.
1.2. Zeug und Verweisung
Wovon soll die Weltanalyse ihren Ausgang nehmen? Worum geht es bei der Erörte-
rung der Welt? Dieser begegnet man offensichtlich nicht so wie dem Vorhandenen.
Es ist nicht so, dass es Tische, Häuser, Bäume, Straßen gibt und unter denen etwas
wie die Welt. Jene können als innerweltliche Seiende definiert werden, denn ihre
Anwesenheit hängt von der Anwesenheit der Welt ab. Diese ihrerseits ist selbstver-
ständlich nicht innerweltlich. Daraus folgt aber nicht, dass sich die Welt „frei“ von
innerweltlichen Seienden zeigt. Anders ausgedrückt: Seiendes ist nur in der Welt;
Welt kann allerdings nicht als vom innerweltlichen Seienden separat gedacht werden.
Wenn das Dasein wesenhaft in der Welt ist, dann ist es stets beim Innerweltlichen.
Das Sein der Welt und das des innerweltlichen Seienden decken sich nicht, hängen
dennoch gewissermaßen zusammen. Die Erforschung des Weltphänomens zeichnet
sich also nicht als Abstraktion dessen ab, was es darin gibt, sondern als Klarstellung
der Bedeutung des „darin“.
Der erste Schritt der Weltanalyse Heideggers besteht darin, Licht ins Sein des inner-
weltlichen Seienden zu bringen. Jeden Tag geht man mit „Dingen“ um. Ihre ontolo-
gischen Charaktere sind der überlieferten Metaphysik zufolge Substantialität, Aus-
dehnung usw.. Kommt durch diese Beschreibungsart die Seinsweise, nach der Dinge
im Alltag zumeist vorkommen, zum Vorschein? Unter welchen Umständen ˗ fragt
sich Heidegger noch ˗ erscheint ein Seiendes, z.B. ein Tisch, gemäß dieser metaphy-
sischen Charakteristik? Oder anders formuliert: Welche Einstellung muss man an-
nehmen, um einen Tisch als Substanz zu betrachten?
Es ist offenkundig, dass man mit Tischen und anderen Dingen nicht dergestalt um-
geht, dass man sie durch ihre ontologischen Eigenschaften charakterisiert. Das be-
sagt: das rein theoretisch-anschauliche Erkennen, das die metaphysische Charakteris-
tik führt, macht die unmittelbarste Zugangsart zum innerweltlichen Seienden nicht
11
aus. Damit ein Tisch als „selbstständiges Seiendes“ gesehen wird, muss man eine be-
stimmte (in einem gewissen Sinne „nicht übliche“) Einstellung annehmen und ihn als
isoliertes Ding, als Vorhandenes, beobachten. Wie früher betont wurde, stellt das Er-
kennen nur eine Möglichkeit des Verhältnisses zur Welt und zu den Seienden dar,
nicht ihr Fundament. Aber wenn die Metaphysik gerade diese Einstellung als primäre
menschliche Seinsweise betrachtet, dann erfordert die korrekte Herausarbeitung der
Frage nach dem Weltphänomen, dass dieser Interpretationshorizont, den Heidegger
Ontologie der Vorhandenheit nennt, verlassen wird.
Die Bestimmung des Seienden als „Ding“ setzt die Untersuchung, wenn auch impli-
zit, in einen Horizont, der das Erkennen privilegiert. Nach welcher Seinsart muss
man folglich das Innerweltliche auffassen, wenn die Ontologie der Vorhandenheit
nicht den zu dieser Untersuchung passenden Boden bieten kann? Bevor diese Frage
beantwortet wird, sei auf einen anderen bedeutenden Punkt hingewiesen. Die Onto-
logie der Vorhandenheit geht nicht nur in der Annahme fehl, das Seiende sei zu-
nächst eben Vorhandenes, sondern auch darin, dass sie beansprucht, das ontologische
Fundament der Welt ausgehend von dieser Annahme zu beschreiben. Demzufolge
sieht sie die Welt als Seiendes und zwar als Summe von Seiendem. Sein der Welt
und Sein des innerweltlichen Seienden stimmen aus dieser Perspektive überein, wes-
halb es sogar nutzlos resultiert, die spezifische Frage nach dem Weltphänomen zu
stellen. Wenn das, „worin“ das Dasein existiert, als Vorhandenes verstanden wird,
dann überrascht es nicht, dass die klassische Ontologie das Erkennen (die Hauptexis-
tenzweise) als unmittelbares Verhältnis zwischen getrennten Entitäten (Subjekt und
Objekt) begreift. „Das ist ein so oder so beschaffenes Haus“, „das ist eine Pflanze“.
Seiende würden sich unmittelbar als isolierte Vorhandene zeigen. Dieses Bild will
Heidegger als falsch zurückweisen.
An der Stelle des Subjekt-Objekt-Modells fügt er das einheitliche Phänomen des In-
der-Welt-seins ein. In dieser Seinsverfassung repräsentiert die Welt das dritte Mo-
ment, das sich „zwischen“ Subjekt und Objekt stellt. In Sein und Zeit werden aber
diese Termini („Subjekt“, „Objekt“, „zwischen“) nicht verwendet, weil diese da-
durch, dass sie die Tradition der Metaphysik kennzeichnen, sozusagen die Vorstel-
lung nahelegen, die angesprochenen Momente seien voneinander unabhängig. Die
Formel „In-der-Welt-sein“ soll hingegen die Ansicht akzentuieren, es handle sich um
12
eine einheitliche Struktur. Diese Erwägungen können folgendermaßen zusammenge-
fasst werden:
1) Innerweltliches Seiendes kann (so oder so) nur in der Welt begegnen, weswegen
beides eine ontologische Differenz aufweisen muss.
2) Seiendes kann nur deshalb als Gegenstand der theoretischen Erkenntnis betrachtet
werden, weil das Dasein immer schon in einer Welt ist.
Diese zwei Einsichten sind der vorliegenden Untersuchung nicht neu. Allerdings
müssen sie ständig im Auge behalten werden, um den Ansatz Heideggers vor der
Vorhandenheitsontologie abzugrenzen.
Kehre man nun zu der vorher gestellten Frage zurück. Es wurde gefragt: Nach wel-
cher Seinsart muss das Innerweltliche aufgefasst werden? Wie gezeigt wurde, bewegt
man sich innerhalb eines unpassenden Horizonts, wenn man Welt und Seiendes als
„Dinge“ auffasst, denn dieser Terminus verweist auf die für die Metaphysik typi-
schen Bestimmungsmodi. Nun muss man veranschaulichen, wie innerweltliches
Seiendes zunächst begegnet, wenn nicht als Vorhandenes, d.h. nicht als Gegenstand
der thematischen Beobachtung. Um diese Frage zu beantworten, macht Heidegger
darauf aufmerksam, dass der Umgang mit innerweltlichem Seienden zumeist in Ge-
stalt des hantierenden gebrauchenden Besorgens stattfindet. Das folgende Beispiel
soll diese Erkenntnis vereinfachen: Im Alltag wird ein Tisch vorwiegend zum Essen,
Schreiben usw. gebraucht, dementsprechend nicht als Objekt der Wahrnehmung
bzw. Erkenntnis betrachtet. Wiederum befindet man sich vor einem trivialen Gedan-
ken, dessen ontologischen Sinn jedoch der Philosophie meistens dunkel bleibt. Um
den spezifisch pragmatischen Charakter der Dinge hervorzuheben, bezieht sich Hei-
degger auf das im Besorgen nächstbegegnende Seiende mit dem Terminus „Zeug“.
Was ist das Sein des Zeugs? In vorphilosophischer Sprache: Was macht das Zeug zu
Zeug? Dieses kann sich als solches manifestieren nur im besorgenden Umgang des
Daseins. Das Besorgen vollzieht sich nicht mit einem einzigen Seienden, sondern
bewegt sich immer in einer „Zeugganzheit“. In der Tat geht man nie mit „isoliertem
Zeug“ um. Ein Kugelschreiber z.B. kann sich nur als Zeug (um zu schreiben) zeigen,
wenn schon Papier, Tisch, Stuhl usw. gegeben sind. Gegen diese Betrachtung könnte
man den Einwand erheben, der Kugelschreiber sei unabhängig von anderen Seienden
13
da, und zwar als „reiner Stoff“ neben anderem Stoff. Dabei wird jedoch die Tatsache
übersehen, dass es reinen Stoff gibt, nur wenn es auch jemanden gibt, der ihn so be-
trachtet. Solcher Einwand verlässt also das Gebiet des Alltagsumgangs, denn hierin
kommt das Zeug eben sehr selten als bloßer Stoff vor. Gleicherweise werden Papier,
Tisch, Stuhl und anderes nicht als „bloße Dinge“ erfasst, die das Zimmer bilden.
Dieses ist gewissermaßen „früher“ als das einzelne Seiende anwesend, und zwar
nicht als Vorhandenes. Das Zimmer macht vielmehr die Umwelt aus, in der man
handelt. Die jeweilige nächste Umwelt des Daseins (Zimmer, Büro, Werkstatt) bietet
sich (obwohl nicht thematisch) in einer gewissen „Ordnung“ dar. Das Besorgen wird
in der Umwelt durch die Umsicht geleitet und geordnet.
Es wurde erwähnt: Seiendes als Zeug erscheint immer „mit“ anderem Zeug. Jetzt er-
hebt sich die Frage: Inwiefern sind Seiende aufeinander und auch auf das Zeugganze
bezogen? Die Idee, die einzelnen Seienden würden zuerst „an sich“ bestehen und erst
später das Ganze bilden, lässt sich aus den erwähnten Gründen nicht vertreten. Das
Ganze muss irgendwie schon da sein und folglich muss Seiendes eine Verweisung
auf etwas anderes in sich bergen. Das vordem beschriebene Beispiel kann erweitert
werden, wie folgt: der Kugelschreiber verwahrt in seinem Sein eine Verweisung auf
Papier, Tisch, Stuhl usw.. Die Verweisung ist nicht als Eigenschaft zu begreifen, die
den Kugelschreiber zuweilen bestimmt. Umgekehrt: Sie ist sein Sein (die Zeughaf-
tigkeit), das sein Begegnis überhaupt ermöglicht. Der Kugelschreiber kann sich als
solcher zeigen, weil er immer schon auf das Zeugganze bezogen ist.
Was heißt: sich selbst als solcher (als Kugelschreiber) zeigen? Die Antwort lautet:
sich selbst als Zeug um zu… zeigen. Im Beispiel: der Kugelschreiber begegnet als
Zeug ‚um zu schreiben‘. Dem Anschein nach könnte man den Eindruck haben, zu-
nächst sei der Kugelschreiber verfügbar und auf diese bloße Verfügbarkeit hin wird
er als Zeug verwendet, um zu schreiben. Heideggers Sicht nach geht man dagegen
mit dem Seienden nur auf der Grundlage dieses Verweisens um.
Innerweltliches Seiendes hat also in sich die Struktur des „Um-zu“, es ist immer auf
etwas anderem verwiesen. Im alltäglichen besorgenden Umgang wird Seiendes nach
dieser Struktur entdeckt. Damit wird deutlicher aufgewiesen, inwiefern das Inner-
weltliche zumeist nicht als Vorhandenes sondern als Zuhandenes in den Blick meis-
14
tens kommt: Seinsart des Nächstbegegnenden ist nicht die Vorhandenheit sondern
die Zuhandenheit. Zwischen den genannten Seinsweisen besteht derselbe Unter-
schied wie zwischen Ding und Zeug: das Ding ist Gegenstand des anschaulichen Er-
kennens bzw. Wahrnehmens, während sich das Zeug in seinem jeweiligen Um-zu
enthüllt:
„Das Zuhandene ist weder überhaupt theoretisch erfaßt, noch ist es selbst für die Umsicht zunächst umsichtig thematisch. Das Eigentümliche des zunächst Zuhandenen ist es, in seiner Zuhandenheit sich gleichsam zu-rückzuziehen, um gerade eigentlich zuhanden zu sein.“ (SuZ S. 69)
Die Hervorhebung der Struktur des Um-zu soll darauf hinweisen, dass Seiendes auf
der Basis seiner Verweisung auf etwas anderem, und letztendlich auf die Zeugganz-
heit, ergriffen wird. Die Zeugganzheit ihrerseits, welcher jedes Zuhandene zugehört,
wird folglich nicht dadurch konstituiert, dass isolierte Seiende nebeneinander sind,
sondern durch eine Verweisungsmannigfaltigkeit, welche vor dem Begegnis des ein-
zelnen Seienden in seiner Zuhandenheit liegt.
Das Um-zu macht nur eine unterschiedlicher Verweisungsarten aus. Denn das Zeug
verweist nicht nur auf seine jeweilige Verwendung, sondern auch wesenhaft auf das
herzustellende Werk, welches das Wozu des Zeugs selbst darstellt. Auch in diesem
Fall bestimmt die genannte Verweisung das ganze Besorgen seit Anfang an. Das zu
verfassende Buch z.B. kommt nicht erst in einem zweiten Moment, nachdem man
mit dem Schreibzeug (Kugelschreiber, Tisch, Lampe, Stuhl) schon umgegangen ist.
Die Werkzeuge, um zu schreiben, verweisen vielmehr aufs Buch als ihr gemeinsa-
mes Wozu. Das Buch seinerseits ist nicht zuerst Vorhandenes, sondern birgt selbst
die Verweisung des Um-zu in sich: es ist um zu lesen.
Werk und Werkzeuge verweisen auch auf die Materialen, d.h. auf das, woraus sie
bestehen. Das Buch besteht aus Papier, das kein unmittelbar verfügbares Zuhandenes
ist. Es wird von den Bäumen gewonnen. Das Besorgen schließt in sich, wenn auch
implizit, auch die Natur mit ein.
Darüber hinaus: das Werk ist immer für jemanden verwendbar. Das Buch wird ver-
fasst, damit die Anderen es lesen können7. Die „Vorliebe des Publikums“ ist schon
im besorgenden Umgang mit dem Zeug, um das Werk herzustellen, mit dabei. Das 7 Hier wird angedeutet, dass die Welt des Daseins insofern keine private Welt ist, als die Anderen schon immer mit-begegnen. Dieser Gedanke wird später ausführlicher entwickelt werden.
15
innerweltliche Seiende im Besorgen lässt nicht nur nicht Daseinsmäßiges, sondern
auch Seiendes der Seinsweise des Daseins.
Die Zeuganalyse zielt darauf ab, zu zeigen, dass die Verweisung für das Seiende we-
senhaft konstitutiv ist. Es verweist auf anderes und zwar nach verschiedenen Rich-
tungen. Es wurden aber noch zwei Punkte angedeutet, die noch eine weitere Erläute-
rung erfordern. An erster Stelle behauptet Heidegger zwar, dass mit dem Zeug die
Verweisung anwesend ist, aber legt auch (und vor allem) Wert darauf, dass diese das
ontologische Fundament (das Sein) des Zeugs selbst ist. (Man erinnere sich daran,
als gesagt wurde, das Schreiben entdecke den Kugelschreiber, nicht umgekehrt): „die
Umweltdinge [begegnen] in Verweisungen und aus ihnen her.“ (GA 20 S. 257) „In“
und „aus … her“ sollen gerade den Vorrang der Verweisung dem Zuhandenen gege-
nüber hervorheben. An zweiter Stelle wurde eine Pluralität von Verweisungsarten
abgehoben und damit die Einsicht, jede Verweisung des jeweiligen Zuhandenen sei
nicht isoliert, sondern schon immer einer Verweisungsganzheit zugehörend. Dieselbe
Meinung hat man vertreten, als man betont hat, dass das Zeug wesenhaft zum Zeug-
ganzen gehört.
„Das Begegnen der Umweltdinge in ihren Verweisungen vollzieht sich aus einer Verweisungsganzheit her. Damit zeichnet sich schon ein gewis-ser Strukturzusammenhang vor innerhalb der genannten Charaktere, daß nämlich die Verweisungen es sind, die die Dinge gegenwärtig sein las-sen, und daß die Verweisungen ihrerseits durch die Verweisungsganzheit gegenwärtig oder appresentiert werden.“ [Hervorhebung von F. C.] (GA 20 S. 257-8)
Die ontologische Priorität der Verweisung vor dem Zeug einerseits und dem Verwei-
sungszusammenhang vor der einzelnen Verweisung andererseits repräsentiert zwei
wesentliche Charaktere des Begegnens des Seienden. Dieses Begegnen ist auch da-
durch ausgezeichnet, dass es nicht auffällt. Umso mehr sich nämlich das Zuhandene
in seiner Zuhandenheit „zurückzieht“, d.h. je weniger es aus der Verweisungsman-
nigfaltigkeit hervortritt, desto „angemessener“ wird vom besorgenden Umgang er-
fasst. Die Verweisungsganzheit ihrerseits wird keineswegs thematisch erkannt. Sie
bietet sich dagegen in Form der „Selbstverständlichkeit“ dar; als selbstverständlich
fällt sie nicht auf. Umso fließender sich der alltägliche Umgang mit dem Innerweltli-
chen Seienden bewegt, desto mehr verbergen sich die Umwelt, als der Schauplatz
des Besorgens, und das Zeug hinter die Selbstverständlichkeit, d.h. desto weniger
16
springen sie ins Auge. Die Zugehörigkeit des Zeugs zur Verweisungsganzheit ist
zumeist nicht thematisch.
Doch es gibt Möglichkeiten des Besorgens, welche diese Zugehörigkeit explizit
enthüllen. Das passiert jedes Mal, wenn sich ein Seiendes als nicht-verwendbar für
…, nicht geeignet zu …, Hindernis, beschädigt usw. zeigt. Zunächst wird die Unzu-
handenheit des Werkzeugs nicht von der theoretischen Beobachtung verstanden,
sondern von der Umsicht, die das Besorgen führt. Das Unzuhandene fällt dabei auf.
Wodurch wird dieses Auffallen verursacht? Das beschädigte Werkzeug fällt deswe-
gen auf, weil es nicht mehr auf etwas anderes verweisen kann. Die Verweisungen,
aus denen her, Zuhandenes als solches begegnet, sind dabei gestört. Das Besorgen
bewegt sich innerhalb der Verweisungsmannigfaltigkeit nicht mehr fließend, es kon-
zentriert sich auf das bestimmte Unzuhandene. Dabei verliert dieses immer mehr sei-
ne spezifische Zuhandenheit, um als bloßes Vorhandenes zu erscheinen. Gerade in
der Störung der Verweisungen zeigt sich ausdrücklich, dass das Zuhandene wesen-
haft in diese eingebettet ist. Die Ausdrücklichkeit, von der hier die Rede ist, muss on-
tisch begriffen werden. Denn die Verweisungen machen sich nicht als formale Struk-
tur, d.h. ontologisch, auffällig, sondern immer als jeweilige Konkretion. Wenn z.B.
die Lampe nicht funktioniert, das, was sich im Besorgen durchsetzt, ist die Unmög-
lichkeit, die Lampe selbst und alle andere Werkzeuge ihrem jeweiligen Um-zu nach
zu verwenden. Was auffällt, in anderen Worten, ist diese bestimmte (ontische) Ver-
weisung. Die Lampe verweist weder auf den Stuhl, Kugelschreiber usw. noch auf das
Schreiben noch auf das zu verfassende Buch. Es stellt sich als auffällig heraus, dass
diese Seienden irgendwie aufeinander bezogen sind, nicht aber die Verweisungen als
solche.
In dieser Darlegung wurde pointiert, dass das innerweltliche Seiende in Verweisun-
gen begegnet. Hierbei wurde allerdings die Welt immer vorausgesetzt und nie thema-
tisiert, und zwar ist das Seiende als innerweltlich eben immer schon in einer er-
17
schlossenen Welt entdeckt8. Die spezifische Anwesenheitsweise der Welt hinterfragt
Heidegger anhand einer eingehenden Analyse des Begriffes der Verweisung.
1.3. Welt als Bedeutsamkeit
Als Beispiele von Verweisungen wurden das Um-zu (der Kugelschreiber ist, um zu
schreiben), das Wozu als herzustellendes Werk (das Buch ist das Wozu des Schreib-
zeugs), das Woraus (das Buch besteht aus Papier), die Anderen, die das Buch lesen,
erwähnt. Damit sollte gezeigt werden, dass Seiendes zumeist zuhanden ist und nicht
vorhanden. Die Fortsetzung dieser Überlegungen trachtet danach, noch eine andere
Verweisung in den Vordergrund zu rücken. Genauer geht es hier um das Worum-
willen. Dieser Verweisung kommt gewissermaßen eine besondere Funktion zu. Denn
sie zeigt den Zusammenhang der schon angesprochenen Verweisungsmannigfaltig-
keit mit der Seinsverfassung des Daseins an, weshalb Heidegger sie erst im Nachhi-
nein thematisiert.
Am Anfang des §18 von Sein und Zeit versucht Heidegger, den Begriff der Verwei-
sung noch genauer zu erklären. Der Tatsache, dass sich das Zeug als verwendbar für
..., dienlich zu ... usw. erweist, folgt nicht, dass Verwendbarkeit und Dienlichkeit Ei-
genschaften des Seienden sind. Eigenschaften sind nämlich Charaktere des Vorhan-
denen. Charaktere des Zuhandenen sind hingegen Geeignetheiten und Ungeeigne-
theiten, welche ihrerseits nicht die Verweisung selbst ausmachen, sondern ihre jewei-
lige ontische Konkretion. In anderen Worten stellt die Verweisung die ontologische
Bedingung der Möglichkeit dafür, dass sich ein Zuhandenes ontisch als geeignet zu
... zeigt. Während die Charaktere der Vorhandenheit (Eigenschaften) die Unabhän-
gigkeit des Dings vom Menschen suggerieren, gibt der Begriff der Geeignetheit ein
gewisses Verhältnis zwischen Zeug und einem Seienden zu verstehen, das weder die
8 Auf die Unterscheidung zwischen „Erschließen“ und „Entdecken“ geht man später ausführlicher ein. Vorläufig sei nur darauf hingewiesen, dass das erste mit dem Begriff der Welt zusammenhängt, das zweite mit dem des innerweltlichen Seienden. Außerdem macht Heidegger hinsichtlich seiner termi-nologischen Auswahl Folgendes klar: „ ‚Erschließen‘ und ‚Erschlossenheit‘ werden im Folgenden terminologisch gebraucht und bedeuten ‚aufschließen‘ – ‚Aufgeschlossenheit‘. ‚Erschließen‘ meint demnach nie so etwas wie ‚indirekt durch einen Schluß gewinnen‘.“ (SuZ S. 75)
18
Seinsweise des Zuhandenen noch die des Vorhandenen hat, d.h. das Dasein. Die Er-
läuterung dieses Verhältnisses, und somit der angedeuteten neuen Verweisung, soll
anhand vom Begriff der Bewandtnis vorgenommen werden:
„Was soll aber dann Verweisung besagen? Das Sein des Zuhandenen hat die Struktur der Verweisung – heißt: es hat an ihm selbst den Charakter der Verwiesenheit. Seiendes ist daraufhin entdeckt, daß es als dieses Seiende, das es ist, auf etwas verwiesen ist. Es hat mit ihm bei etwas sein Bewenden. Der Seinscharakter des Zuhandenen ist die Bewandtnis.“ (SuZ S. 83-4)
Konstitutiv für den Seinscharakter der Bewandtnis ist der Bezug des „mit ... bei ...“.
Mit einem Seienden (z.B. dem Kugelschreiber) hat es beim Schreiben seine Bewand-
tnis. Beim ersten Anblick könnte man denken, dass dieser Bezug schon durch die
Verweisung des Um-zu beschrieben wurde und insofern nichts neues mit sich bringt.
In gewisser Hinsicht ist diese Beobachtung korrekt. Denn das Wobei der Bewandtnis
entspricht dem Wozu der Dienlichkeit, dem Wofür der Verwendbarkeit, die eben
Beispiele des Um-zu sind. Außerdem stimmen Verweisung und Bewandtnis deshalb
überein, weil sie die Bedingung der Entdeckbarkeit des Seienden ausmachen: Dieses
wird auf Bewandtnis hin freigegeben, um als Zuhandenes entdeckt werden zu kön-
nen. In anderer Hinsicht allerdings ermöglicht dieser neue Begriff, die Verwei-
sungsmannigfaltigkeit zu erhellen, von der im letzten Abschnitt die Rede war.
Bewandtnis als Sein des Zuhandenen darf natürlich nicht das Sein eines isolierten
Vorhandenen bezeichnen. Die Struktur des „mit ... bei ...“ soll hervorheben, dass die
Zuhandenen gleichsam aufeinander bezogen sind. Anders als die Verweisung zeigt
doch die Bewandtnis nicht nur einen einzigen Bezug (von Etwas auf Etwas) sondern
eine Kette von Bezügen: Mit Etwas hat es die Bewandtnis bei Etwas anderem, mit
diesem noch bei Etwas anderem. Das jeweilige Wobei einer Bewandtnis ist selbst ein
Womit, mit dem es seine Bewandtnis bei einem anderen Wobei haben kann. Mit dem
Kugelschreiber hat es beim Schreiben auf ein Papier seine Bewandtnis. Mit dem
Schreiben auf ein Papier hat es beim Verfassen eines Buches seine Bewandtnis usw..
Es ist offenbar, dass Heidegger Seiende und Handlungen nicht als separat betrachtet.
Und zwar deswegen, weil sie nicht zu zwei ontologischen Sphären (etwa Substanzen
und Tätigkeiten) gehören, sondern aus dem einheitlichen Phänomen des In-der-Welt-
seins untersucht werden müssen.
19
Die Kette der Bewandtnis geht letztendlich auf eine Möglichkeit des Daseins, mit der
es keine Bewandtnis mehr haben kann. Um willen dieser Möglichkeit existiert das
Dasein. Dieses ist dementsprechend kein Seiendes, dessen Sein Bewandtnis ist.
Genauso wie früher der Vorrang der Verweisungsganzheit vor der einzelnen Verwei-
sung zur Abhebung gebracht wurde, muss man nun darauf aufmerksam machen, dass
Bewandtnis nicht die primäre ontologische Charakteristik des Seienden ist. Sie ist
nämlich von der Zugehörigkeit zu einer Bewandtnisganzheit immer schon bestimmt:
„Welche Bewandtnis es mit einem Zuhandenen hat, das ist je aus der Be-wandtnisganzheit vorgezeichnet. Die Bewandtnisganzheit, die zum Bei-spiel das in einer Werkstatt Zuhandene in seiner Zuhandenheit konsti-tuiert, ist „früher“ als das einzelne Zeug, ungleichen die eines Hofes, mit all seinem Gerät und seinen Liegenschaften.“ (SuZ S. 84)
Die Bewandtnisganzheit bildet sich also nicht erst aus der Summe der „einzelnen
Bewandtnisse“. Umgekehrt: Sie zeichnet die Bewandtnis des jeweiligen Zuhandenen
vor, weshalb sie ursprünglicher als diese ist. Letztes Zitat gibt noch eine wichtige
Auskunft, welche man berücksichtigen muss. Die Bewandtnisganzheit bedeutet onto-
logisch eine formale Gliederung, somit (noch) nicht bestimmt. Insofern kann sie on-
tisch als Werkstatt für ein darin anwesendes Werkzeug konstitutiv sein, oder als Hof
ein Gerät begegnen lassen.
Die Bewandtnisganzheit ist keine selbständige Substanz, die für sich besteht. Sie ist
von Anfang an an einer Existenzmöglichkeit festgemacht, um derer Willen das Da-
sein existiert. Das Sein des Daseins ist nicht durch die Bewandtnis bestimmt, son-
dern, wie schon bemerkt wurde, durch das In-der-Welt-sein. Die Existenzmöglich-
keit des Daseins stellt folglich kein Wobei einer Bewandtnis dar, sondern ein Wo-
rum-willen: „Das ‚Um-willen‘ betrifft aber immer das Sein des Daseins.“ (SuZ S.
84)
Die Bewandtnis des Seienden ist demnach an einem „Bewendenlassen“ immer schon
festgemacht, das eben Seiendes auf Bewandtnisganzheit hin freigibt9. Dieses Bewen-
9 Das Freigeben, das gleichbedeutend mit „Bewendenlassen“ ist, bezieht sich wie das Entdecken auf das innerweltliche Seiende. Allerdings bedeutet beides nicht dasselbe. Man sah, dass ein Seiendes in seiner Zuhandenheit entdeckt ist. Diese Entdeckung geht aber nur vonstatten, wenn das Seiende schon auf sein Sein (auf seine Bewandtnis) freigegeben wird: „Wir können Zeug nur im Umgang mit ihm gebrauchen, wenn wir dieses Seiende zuvor schon auf Bewandtnisbezug entworfen haben. Dieses vor-gängige Verstehen von Bewandtnis, dieses Entwerfen des Zeugs auf seinen Bewandtnischarakter,
20
denlassen lässt sich vom ontologischen Gesichtspunkt nicht als bestimmte (ontische)
Leistung begreifen. D.h., das ontologische Bewendenlassen ist nicht eine Vollzugs-
möglichkeit, sondern die Bedingung a priori der Möglichkeit dafür, dass das Seiende
auf Bewandtnis hin freigegeben wird und in der Seinsart der Zuhandenheit begegnet.
Das Bewendenlassen charakterisiert schon immer die Seinsweise des Daseins. Des-
wegen kann es nicht als konkrete Tätigkeit betrachtet werden, sondern als existenzia-
les Begegnen-lassen des Seienden.
Durch die Bewandtnisanalyse tritt die als Bewendenlassen gefasste ontologische
Verbindung der Verweisungsmannigfaltigkeit mit dem Sein des Daseins hervor. Die-
se Verbindung war der Verweisungsanalyse noch verdeckt. Das Ganze der Verwei-
sungen als Bewandtnisganzheit verwahrt immer schon einen Bezug auf das Dasein.
Des Verweisungsganzen und der Bewandtnisganzheit hat man sich mehrfach be-
dient, um das anzugeben, woraufhin das jeweilige Seiende freigegeben ist. Genauer
wurde gesagt, dass dieses Ganze irgendwie schon da sein muss. Wie aber ist es schon
da? Es ist selbstverständlich, dass, wenn die Bewandtnisganzheit das ist, woraufhin
Seiendes freigegeben wird, sie nicht gleichermaßen wie dieses gedacht werden kann.
Weder ist sie also dasselbe wie Innerweltliches noch lässt sie sich als „entdeckbar“
bestimmen. Denn die Möglichkeit, entdeckt zu werden, charakterisiert das Sein des
Seienden. Die Bewandtinisganzheit als Bedingung der Möglichkeit für die Entde-
ckung des Seienden muss vor dieser schon immer erschlossen sein.
Inwiefern findet die Erschlossenheit dessen statt, woraufhin Seiendes begegnen
kann? Heideggers Antwort auf diese Frage lautet: Die Erschlossenheit, die hier in
Frage steht, ist das Verständnis von Welt. Diese Antwort scheint aber, das Problem
der vorgängigen Erschlossenheit der Bewandtnisganzheit nicht lösen zu können. Tat-
sächlich, wenn das, wonach gefragt wird, gerade das Phänomen der Welt ist, dann
kann das Verständnis von Welt nicht zur Ausarbeitung der Frage beitragen. Es wäre
gewissermaßen so, als würde man in der Beweisführung davon Gebrauch machen,
was man als Problemlösung stellt. Heidegger weist diesen Einwand zurück, und zwar
mit dem folgenden Argument. Dieser Einwand verkennt zwei getrennte (wenngleich
verwandten) Fakten. Der Begriff des Verständnisses des Seins überhaupt (das natür-
nennen wir das Bewendenlassen.“ (GA 24 S. 415) Ontologisch hat also die Freigabe einen Vorrang vor der Entdeckung.
21
lich auch das Weltverständnis mit einschließt) lässt sich nämlich auf zweierlei Weise
interpretieren. Zunächst meint man damit eine explizite Erforschung des Seins, die in
der Philosophie traditionell Ontologie genannt wird. Bei einer ontologischen Unter-
suchung (etwa die, die Heidegger in Sein und Zeit durchführt) versucht man, das Sein
begrifflich zu bestimmen. Mit der angesprochenen Wendung (Verständnis des Seins)
hebt Heidegger hingegen hervor, dass das Dasein wesenhaft über ein vages Seinsver-
ständnis verfügt. Dieses ist selbstverständlich kein philosophisches Wissen, sondern
ein vorontologisches Verständnis, worüber nämlich das Dasein auch vor jeder expli-
ziten Formulierung einer Ontologie verfügt. Dieses vortheoretische Verständnis, das
sich in der alltäglichen Existenz zeigt, ist ein Faktum, das die Philosophie immer
übersehen bzw. aus Angst davor, in einen circulus vitiosus zu geraten, weggelassen
hat.
Das Seinsverständnis, in dem sich das Dasein immer schon bewegt, hängt nicht vom
theoretischen Erkennen des Seins ab. Die explizite Frage nach dem Sein kann viel-
mehr nur deshalb gestellt werden, weil Sein selbst immer schon irgendwie verstan-
den ist. Dieses vage Seinsverständnis, welches dem Dasein zugehört, ist nach Hei-
degger ein unbegründetes Faktum.
Die Grundlosigkeit des Seinsverständnisses des Daseins ist ein auch für die Weltana-
lyse zentraler Grundsatz. Hierbei zielt man darauf ab, die Welt ontologisch (d.h.
theoretisch, philosophisch) zu untersuchen. Diese Untersuchung kann man vorneh-
men, da man immer ein Vor-verstehen der Welt hat. Dieses Vor-verstehen bedeutet
keineswegs ein theoretisches Erfassen, sondern ein vorphilosphisches Verhältnis zur
Welt, die Vertrautheit mit ihr. Genauso wie man den Begriff des Seins nur auf der
Grundlage eines vortheoretischen Verständnisses erforschen kann, stellt das Verste-
hen der Welt die Bedingung der Möglichkeit für eine ontologische Bestimmung des
Weltbegriffes dar. Als zum Seinsverständnis gehörend lässt sich dieses Vor-
verstehen der Welt nicht begründen.
Wenn man den Sinn des vortheoretischen Verstehens einmal aufgeklärt hat, kann
man auf das Problem der Bewandtnisganzheit zurückkommen. Damals erhob sich die
Frage, was die vorgängige Erschlossenheit dessen sei, woraufhin Seiendes freigege-
ben ist. Diese ergab sich als das Weltverständnis, welches das Dasein wesenhaft hat.
22
Bevor man mit der Beleuchtung des Weltverständnisses weitergeht, bedarf es einer
kurzen Zusammenfassung der wichtigsten Übergänge der Analyse, welche von der
Welterschlossenheit zum Begegnis des innerweltlichen Seienden führt: Das Dasein
hat immer ein gewisses Verständnis der Welt. Dieses existenziale Verstehen er-
schließt die Bewandtnisganzheit (in dieser Perspektive setzt Heidegger Verstehen
und Erschließen10 einerseits und Welt und Bewandtnisganzheit andererseits gleich).
Auf diese hin ist das bewandtnisbestimmte Seiende freigegeben. Aus der Freigabe
wird das Seiende allererst zugänglich und kann als entdecktes Zuhandenes im besor-
genden Umgang begegnen.
Die Bewandtnisganzheit, die das Seiende freigibt, ist die jeweilige Welt, in der das
Dasein existiert. Um nun ein tieferes Verständnis des Weltphänomens zu gewinnen,
muss man den Begriff des Verstehens von Welt zutage bringen. In folgender Text-
stelle erklärt Heidegger, worin dieses Verstehen besteht:
„Das vorgängige Bewendenlassen bei ... mit ... gründet in einem Verste-hen von so etwas wie Bewendenlassen, Wobei der Bewandtnis, Womit der Bewandtnis. Solches, und was ihm ferner zugrunde liegt, wie das Da-zu, als wobei es die Bewandtnis hat, das Worum-willen, darauf letztlich alles Wozu zurückgeht, all das muß in einer gewissen Verständlichkeit vorgängig erschlossen sein.“ (SuZ S. 86)
Die Verständlichkeit, von der hier die Rede ist, ist nichts anderes als das Verstehen
von Welt. Dieses steht jetzt im Blick als Verstehen eines Bezugszusammenhangs.
Dass das Dasein immer ein Weltverständnis hat, besagt, dass mit ihm ein Ganzes von
Bezügen immer schon erschlossen ist. In diesen hält sich das Dasein, und zwar so,
dass er sich aus einer Existenzmöglichkeit, d.h. aus seinem Worum-willen, an diesen
Bezügen verweist11.
Die letzte Beobachtung soll einen wesentlichen Punkt hervorheben: Die Welt als Be-
zugszusammenhang ist immer mit einer Existenzmöglichkeit erschlossen, um derer
willen das Dasein existiert. Diese Tatsache verweist noch einmal auf die ursprüngli-
che Einheit des In-der-Welt-seins: Die jeweilige Welt bekundet sich immer aus dem
In-Sein (der jeweiligen Möglichkeit der Existenz); Gleichzeitig entwirft das Dasein
10 Verstehen ist immer erschließend. 11 „Dasein verweist sich je schon immer aus einem Worum-willen [einer Existenzmöglichkeit] her an das Womit einer Bewandtnis, das heißt es läßt je immer schon, sofern es ist, Seiendes als Zuhandenes begegnen.“ (SuZ S. 86)
23
seine Existenz (versteht es sich) immer in einer erschlossenen Welt. Die Welt stellt
sich also sowohl als das heraus, woraufhin Seiendes begegnet (Bewandtnisganzheit)
als auch als erschlossenen Bezugszusammenhang (Verweisungsmannigfaltigkeit),
mit dem das Dasein vertraut ist und in dem es sich selbst versteht: „Das Worin des
sichverweisenden Verstehens als Woraufhin des Begegnenlassens von Seiendem in
der Seinsart der Bewandtnis ist das Phänomen der Welt.“ (SuZ S. 86)
Das Dasein ist mit diesem Bezugszusammenhang immer schon vertraut, weswegen
dieser nicht auffällt. In und von diesen Bezügen verweist es sich „selbstverständ-
lich“. Den Bezugscharakter des Verweisens fasst Heidegger noch als „be-deuten“.
Mit diesem Terminus vertritt er nicht die Ansicht, ein irgendwie bereits Gegebenes
habe eine Bedeutung. Auch wird damit nicht dasselbe wie „bezeichnen“ gemeint.
Diesbezüglich ist die Interpretation von Herrmanns richtig: „Die Bindestrichschrei-
bung des Wortes ‚be-deuten‘ soll darauf hinweisen, daß dieses Wort hier nicht ‚be-
zeichnen‘ heißt, sondern das ontologische Geschehen des bedeutungs-, sinnhaften
Verweisens anzeigt.“12
Zunächst ist das Dasein nicht mit einzelnen bedeutenden Bezügen vertraut, denn
„diese Bezüge sind unter sich selbst als ursprüngliche Ganzheit verklammert.“ (SuZ
S. 87) Es verhält sich vielmehr ursprünglicher mit dem Bezugsganzen des Bedeutens,
das Heidegger „Bedeutsamkeit“ benennt. Diese Überlegung legt wieder den Akzent
darauf, dass vorab nicht isolierte Innerweltliche da sind, deren Summe a posteriori
die (Um-)Welt bildet. Das Dasein ist zuallererst mit der Bedeutsamkeit vertraut, oder
besser: mit dem Dasein ist immer eine Welt in der Form der Bedeutsamkeit erschlos-
sen.
Die Gleichursprünglichkeit der Erschlossenheit der Welt und der Existenz des Da-
seins einerseits und die Tatsache, dass beides zu demselben Phänomen, dem des In-
der-Welt-seins, letztendlich gehöret, andererseits wurden in der metaphysischen Tra-
dition nie bemerkt. Das Verhältnis zwischen „Menschen“ und „Außenwelt“ wird
nämlich nach dem Subjekt-Objekt-Schema so gedacht, als würde es aus dem theore-
tischen Erkennen entstehen. Heideggers Meinung zufolge ist auch die Vorstellung
abzulehnen, nach welcher das „Ich“ die Welt setzen würde, und zwar aus dem Grun-
12 Von Herrmann, F. W., Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu „Sein und Zeit“, Band II, S. 185.
24
de, dass sie erneut eine Ursprungstrennung zwischen Dasein und eben Welt mit sich
bringt.
Wenn die Welt weder als dem Subjekt entgegengesetztes Objekt noch als Gesetztes
aufgefasst werden kann, dann, schließt Heidegger, ist sie ein Strukturmoment des
Seins des Daseins. Unter Welt versteht man hier nicht diese oder jene Welt, sondern
das Weltphänomen, nämlich die Weltlichkeit als Existenzial des Daseins.
Sowohl der Begriff der Weltlichkeit als auch der der Bedeutsamkeit beziehen sich
also auf das Phänomen der Welt. Mit dem ersten wird darauf aufmerksam gemacht,
dass die Frage nach dem Sein der Welt immer innerhalb der existenzialen Analytik
gestellt werden muss; d.h. Welt muss von der Explikation der zusammengesetzten
Struktur des In-der-Welt-seins als der Seinsverfassung des Daseins untersucht wer-
den. Mit dem Titel der Bedeutsamkeit gibt man hingegen die formale Struktur der
Welt an: „Die Verweisungen und Verweisungszusammenhängen sind primär Bedeu-
tung. Die Bedeutungen sind [...] die Seinsstruktur der Welt. Das Verweisungsganze
der Welt ist ein Ganzes von Bedeutungszusammenhängen, Bedeutsamkeit.“ (GA 20
S. 286-7)
Beide Begriffe erhellen somit die ontologische Verbindung zwischen dem Sein des
Daseins und dem der Welt. Wie am Anfang dieses Kapitels bemerkt wurde, darf das
Dasein nicht als „Substanz“ charakterisiert werden. Sein Sein weist dagegen ontolo-
gische Charaktere auf, die wesentlich anders sind als die der Vorhandenheit. Gemäß
diesen Strukturen entwirft es seine Existenz auf Möglichkeiten. Daraus folgt: Wäh-
rend das Sein des Daseins unveränderliche Strukturen aufweist, vollzieht sich die je-
weilige Existenz (immer als diese bestimmte Existenz) so oder so. Dieselbe Beo-
bachtung gilt für die Welt. Diese ist kein nicht daseinsmäßiges Seiendes, sondern, als
Weltlichkeit, ein Charakteristikum des Daseins. Dieser daseinsmäßige Charakter
zeigt sich immer so oder so bestimmt. Die jeweilige Welt ist natürlich immer mit der
jeweiligen Existenzmöglichkeit verbunden. Nun, genauso wie sich die jeweilige
Existenz nach den Seinsstrukturen vollzieht, erscheint die jeweilige Welt nach der
Struktur der Bedeutsamkeit.
Aus diesen Erwägungen heraus, kann endlich die ontologische Differenz auseinan-
dergelegt werden, die zwischen Welt als Bedeutsamkeit und innerweltlichem Seien-
25
den besteht. Es wurde im Laufe der Darlegung vielfach wiederholt, dass Welt nicht
als innerweltlich aufgefasst werden kann. Dieser selbstverständlichen Behauptung
fehlte dennoch die ontologische Aufklärung, welche nur gewonnen werden kann, in-
dem Innerweltlichkeit und Weltlichkeit überhaupt hinsichtlich ihres Fundaments
durchsichtig gemacht werden.
Die Welt als Bedeutsamkeit und das Dasein sind gleichursprünglich, oder genauer
gesagt ist die eine ein Seinscharakter des anderen. Es gibt keine Welt ohne Dasein
und umgekehrt. Daraus folgt: Ihr Verhältnis ist ontologisch unmittelbar. Das inner-
weltliche Seiende ist hingegen immer nichtdaseinsmäßig. Sein Begegnen ist dadurch
ausgezeichnet, dass es nur auf die schon erschlossene Bedeutsamkeit stattfinden
kann, und somit mittelbar:
„Das Dasein ist in seiner Vertrautheit mit der Bedeutsamkeit die ontische Bedingung der Möglichkeit der Entdeckbarkeit von Seiendem, das in der Seinsart der Bewandtnis (Zuhandenheit) in einer Welt begegnet.“ (SuZ S. 87)
Das Seiende ist immer im besorgenden Umgang des Daseins in einer Welt entdeckt.
Jeder philosophische Versuch, das Sein des Seienden unabhängig von seiner konsti-
tutiven Zugehörigkeit zur Welt zu untersuchen, verfällt unvermeidlich in die Ontolo-
gie der Vorhandenheit. Dabei wird das Seiende „an sich“ als Vorhandenes bestimmt
und die ontologische Differenz zwischen Welt und Seiendem verdeckt.
Durch die Bestimmung der Bedeutsamkeit als formale Struktur der Welt wird also
aufgezeigt, dass das Verhältnis zur Welt und der Umgang mit Seiendem zunächst
und zumeist nicht die Form des anschaulichen Erkennens einnehmen. Aber nicht nur
das. Denn die durchgeführte Analyse legt auch die ontologische Genese der Bestim-
mung der Welt und des Seienden als Vorhandenes frei. Wie erörtert wurde, kommt
das Seiende nämlich als Vorhandenes, als isoliertes Ding, nur im Rahmen einer be-
stimmten Möglichkeit des In-der-Welt-seins vor.
Zum Schluss der Bedeutsamkeitsanalyse setzt sich Heidegger mit einer Kritik ausei-
nander, die an seiner Darlegung zu Recht geübt werden könnte. Wenn tatsächlich die
Seinsstruktur der Welt als Bedeutsamkeit und das Sein des Seienden als Bewandtnis
bzw. Verweisung aufgefasst werden, wird dann nicht die spezifische Substantialität
26
der Dinge und der Welt selbst in einem „Relationssystem“ (SuZ S. 88) aufgelöst und
dabei als „Gebilde des Denkens“ begriffen?
Dieser Einwand verliert den phänomenalen Boden der Erforschung aus dem Auge.
Die Untersuchung, welche die Determination der Weltlichkeit als Bedeutsamkeit
zum Ergebnis hat, nimmt ihren Ausgang vom In-der-Welt-sein. Unser alltägliches
In-der-Welt-sein zeichnet sich nicht primär als Feststellung der Substantialität der
Dinge ab, und sekundär aufgrund dieser Feststellung als Umgang mit ihnen. Vorwie-
gend existiert das Dasein in der Weise des Besorgens. Das Studium der Dinge in ih-
rer Substantialität ist nur eine Möglichkeit (sicherlich nicht eine der direktesten) die-
ses Besorgens: „Das In-der-Welt-sein und sonach auch die Welt sollen im Horizont
der durchschnittlichen Alltäglichkeit als der nächsten Seinsart des Daseins zum
Thema der Analytik werden. Dem alltäglichen In-der-Welt-sein ist nachzugehen, und
im phänomenalen Anhalt an dieses muß so etwas wie Welt in den Blick kommen.“
(SuZ S. 66)
In anderen Worten ist ein Grundsatz von Sein und Zeit, dass die Existenz des Daseins
und die Anwesenheit der Welt nicht als zwei separate Momente gedacht werden
können. Auch wenn nur eines der genannten Momente im Blick steht, muss man sei-
ne ursprüngliche Bindung mit dem anderen präsent haben. Aus dieser Perspektive
enthüllt sich die Frage nach der Realität (im Sinne von der Unabhängigkeit vom Da-
sein) der „Außenwelt“ als sinnlos13.
1.4. Betrachtungen zum Begriff der Bedeutsamkeit
Bisher hat die vorliegende Untersuchung die Entwicklungsabschnitte der Analyse
Heideggers befolgt. Nun werden einige Betrachtungen vorgebracht, welche darauf
abzielen, Aspekte des Begriffes der Bedeutsamkeit hervorzuheben, die bis jetzt im-
plizit geblieben sind. Außerdem wird in diesem Abschnitt Gewicht darauf gelegt, wie
sich Heidegger dieses Begriffes bedient und wie „Bedeutsamkeit“ nicht zu verstehen
13 Vgl. SuZ §43.
27
ist. Wie es sich herausstellte, entspricht die Bedeutung dieses Wortes in Sein und Zeit
nicht seiner gewöhnlichen Bedeutung. Gerade gegenüber dem gewöhnlichen Signifi-
kat von „Bedeutsamkeit“ bedarf es sonach einer Abgrenzung um den ontologischen
Wert, der diesem Terminus im Werk zukommt, in den Vordergrund zu rücken.
Erstens. Das Begegnis mit dem Seienden findet immer auf der Grundlage einer er-
schlossenen Welt statt, in die es eben eingebettet ist. Dies bringt mit sich: Seiendes
erscheint nicht isoliert, bedeutet dagegen immer etwas anderes als sich selbst. Das
Seiende kann z.B. das Wozu der Dienlichkeit, das Wofür der Verwendbarkeit usw.
bedeuten. Dieses Bedeuten hat nur insofern Sinn, d.h. es kann nur insofern entdeckt
werden, als die Bedeutsamkeit, mit der das Dasein je vertraut ist, schon erschlossen
ist. Um die Bedeutsamkeit zu erschließen, d.h. um in der Welt zu sein, braucht das
Dasein nicht, jedes einzige Seiende in seiner Zuhandenheit zugänglich zu machen:
„Im Verstehen derselben [der Bedeutsamkeitsbezüge] halte ich mich beim zuhandenen Zeugzusammenhang auf. Ich stehe weder beim einem [Zuhandenen] noch beim anderen, sondern ich bewege mich im Um-zu. Daher haben wir Umgang mit den Dingen, nicht einen bloßen Zugang auf etwas Vorliegendes, sondern einen Umgang mit den Dingen, sofern sie als Zeug in einem Zeugzusammenhang sich zeigen.“ (GA 24 S. 416)
Kurios ist ein ähnlicher Gedanke auch Gegenstand der Überlegungen Wittgensteins.
In der folgenden Textstelle aus den Philosophischen Untersuchungen wird die Priori-
tät des Ganzen vor dem Einzelnen ausgedrückt:
„‚Indem ich die Stange mit dem Hebel verbinde, setze ich die Bremse in-stand.‘ – Ja, gegeben den ganzen übrigen Mechanismus. Nur mit diesem ist er der Bremshebel; und losgelöst von seiner Unterstützung ist er nicht einmal Hebel, sondern kann alles Mögliche sein, oder nichts.“ (PU § 6)
Der ganze Mechanismus zeichnet die spezifische Zuhandenheit des Hebels vor. Die-
ser, um Hebel zu sein, muss ein Wozu bedeuten (Zeug sein, zum Bremsen, welches
selbst seinerseits sich als solches nur innerhalb des Mechanismus erweisen kann),
somit auf etwas anderes als sich verweisen. Das dem Hebel eigene Bedeuten des
Wozu ist keine Eigenschaft, die dem Substanz-Ding zugesprochen würde. Diesen
Punkt betont Wittgenstein, indem er sagt, dass der Hebel auch nichts sein könnte.
Ontologisch gesprochen: Das spezifische Bedeuten des Hebels würde in dem Fall
vom besorgenden Umgang nicht entdeckt.
28
Zweitens. Die Erschlossenheit der Bedeutsamkeit ist keine Leistung des Daseins. Sie
geschieht nicht infolge eines Beschlusses, welcher seinerseits einem ausdrücklichen
Nachdenken folgen würde. Das Erschließen der Bedeutsamkeit ist vielmehr immer
gleichursprünglich mit (d.h. ontologisch gleichzeitig) dem faktischen Existieren in
dieser oder jener Möglichkeit. Da Beschlusse und Nachdenken nichts anderes sind,
als konkrete Existenzmöglichkeiten des Daseins, müssen sie als solche wesenhaft in
einer schon erschlossenen Welt ergriffen werden. Die Erschlossenheit der Bedeut-
samkeit bezeichnet folglich das Faktum des Immer-schon-in-einer-Welt-seins. Ein
Faktum, welches ontisch offen zutage liegt aber der ontologischen Forschung zu-
meist entgeht.
Drittens. Die Bedeutsamkeit als Struktur der Weltlichkeit ist ein seinsmäßiger Cha-
rakter des Daseins. Im Laufe der existenzialen Analytik treten die verschiedenen da-
seinsmäßigen Charaktere (die Existenzialien) hervor. Das Existenzial der Befindlich-
keit z.B. weist darauf hin, dass das Dasein immer gestimmt ist. Dass dieses noch
durch das Sein-zum-Tode ontologisch ausgezeichnet ist, heißt, dass der Tod immer
die Existenz bestimmt, nicht nur an seinem Ende. Gleichermaßen ist die Welt in der
Form der Bedeutsamkeit kein Vorhandenes, das einem anderen (dem Dasein) hinzu-
kommen würde. Mit dem Dasein ist immer schon auch ein Verweisungszusammen-
hang erschlossen, der seine Welt ausmacht.
Die Zugehörigkeit der Bedeutsamkeit zur Seinsverfassung des Daseins stellt den
Grund dessen dar, dass das Dasein mit der Welt immer schon vertraut ist. Die Ver-
trautheit der Welt, die zumeist nicht auffällt, ist ein wesentlicher Aspekt der Welt-
lichkeit. Da das Dasein konstitutiv in einer Welt ist, und diese stets Innerweltliches
begegnen lässt, ist das Dasein immer bei dem so oder so entdeckten Seienden.
Viertens. Im Laufe der Analyse ist man auf Termini („Erschließen“, „Bewendenlas-
sen“ bzw. „Freigeben“ und „Entdecken“) gestoßen, welche die Anwesenheitsmodali-
tät jeweils der Welt und des Zuhandnen nennen. Es wurde gezeigt: Zunächst ist die
Welt als Bedeutsamkeit erschlossen (verstanden), Seiendes wird auf diese hin freige-
geben und in seiner Zuhandenheit entdeckt. Wenn man sich nun durch den Terminus
„Bedeuten“ auf die „Begegnisstruktur überhaupt“ bezieht, gilt es, eine Unterschei-
dung durchzuführen: Das der Welt als Bedeutsamkeit eigene Bedeuten gibt den As-
29
pekt der Vertrautheit an, welcher mehrmals hervorgehoben wurde. Die Welt bedeutet
dem Dasein, dies heißt: das Dasein ist mit einem Verweisungszusammenhang ver-
traut, der meistens unausdrücklich bleibt. Das Bedeuten, welches dem Innerweltli-
chen zugehört, ist wesenhaft anders. Man sah, dass das Seiende dergestalt begegnet,
dass es als Zuhandenes (um zu ...) entdeckt wird. Es bedeutet (verweist auf) ein Um-
zu, das natürlich schon in der Bedeutsamkeit erschlossen sein muss. Z.B. der Kugel-
schreiber bedeutet das Schreiben. Genauso wie die Welt einen ontologischen Vor-
rang vor dem Innerweltlichen hat, stellt das Bedeuten der Bedeutsamkeit die Bedin-
gung der Möglichkeit dafür, dass das Seiende bedeutet.
Fünftens. Das Um-zu des Zeugs, d.h. seine Bewandtnis, ist keine dem Zeug selbst
innewohnende Eigenschaft. Das Zeug-sein, um zu trinken, des Glases z.B. ist keine
zum Glas selbst gehörende Eigenschaft. Umgekehrt: Verweisung (um zu trinken)
bzw. Bewandtnis (es hat mit dem Glas beim Trinken seine Bewandtnis) ermöglicht
das Begegnen des Zeugs. Das Glas kann sich nämlich auch aus einem anderen Um-
zu zeigen. Es könnte als etwas anderes begegnen, etwa als Briefbeschwerer. In dem
Fall würde es als Zeug entdeckt, um Unterlagen zu beschweren. Damit das Glas in
dieser bestimmten Zuhandenheit begegnen kann, muss aber dieses spezifische Um-
zu schon entdeckt sein. Man betrachte das folgende konkrete Beispiel: Ich bin im
Büro. Plötzlich weht der Wind meine Unterlagen vom Tisch. Die Notwendigkeit, die
Blätter zu beschweren, d.h. das „Um-die-Blätter-zu-beschweren“, wird von der be-
sorgenden Umsicht entdeckt. Auf diese Notwendigkeit hin (d.h. auf dieses entdeckte
Um-zu hin) begegnet das Glas als Zeug, um die Unterlagen zu beschweren. Die Ent-
deckung des Um-zu bzw. der Entwurf des Seienden auf seinen Bewandtnischarakter
und das Begegnis des Glases in dieser Zuhandenheit geschehen nicht in einem „abso-
luten Raum“, sondern aus meiner Vertrautheit mit dem Büro und der Tätigkeit, die
ich darin vollziehe.
Sechstens. Aus diesen Erwägungen heraus ergab sich, dass sich die Art und Weise,
wie sich Heidegger des Begriffes der Bedeutsamkeit bedient, von der üblichen Be-
deutung distanziert. Diesen Unterschied muss man ständig berücksichtigen. Denn
damit begeht man nicht den Fehler, die durch den Terminus „Bedeutsamkeit“ aus-
gedrückten Bezüge von der Idee von „bedeutsam“ her im Sinne von „wichtig“,
30
„wertvoll“ zu interpretieren. Warum solch eine Interpretation als falsch zurückzu-
weisen wäre, erklärt Heidegger in der folgenden Passage:
„Sofern wir Bedeutsamkeit formal durch Verweisung anzeigen, ist damit ein Mißverständnis abgewehrt, dem dieser Ausdruck immer wieder leicht unterliegt, als sollte mit diesem Titel ‚Bedeutsamkeit‘ so etwas gesagt werden wie: Die Umweltdinge, deren Sein in der Bedeutsamkeit liegen soll, seien nicht nur Naturdinge, sondern hätten auch eine Bedeutung, sie hätten einen gewissen Rang und Wert. In der natürlichen Rede wird mit ‚bedeuten‘ und ‚Bedeutsamkeit‘ in der Tat so etwas verstanden, und viel-leicht kehrt auch von diesem Sinne etwas im terminologischen Sinne des Ausdrucks wieder. Nur ist in Frage, ob das genannte Phänomen mit der Interpretation einer mit Wertprädikaten behafteten Naturdinglichkeit ge-troffen oder nicht eben verstellt ist. Es ist die Frage, ob überhaupt was man mit Wert bezeichnet, ein ursprüngliches Phänomen ist oder nicht vielleicht etwas, was wiederum nur unter Voraussetzung derjenigen On-tologie erwachsen ist, die wir als eine spezifische Naturontologie [der Vorhandenheit] bezeichnen, unter der Vorannahme, daß die Dinge zu-nächst Naturdinge sind und dann so etwas wie Wert haben – Wert also ontologisch genommen in einer spezifischen Rückweisung auf Natur-dinglichkeit. Vielleicht ist es unumgänglich, Werte dann als Werte anzu-sehen, wenn man in der Tat im vornherein das Sein als [vorhandene] Na-tur ansetzt. Bedeutsamkeit, so wie wir den Titel gebrauchen, besagt nega-tiv zunächst nichts über Bedeutung im Sinne von Wert und Rang.“ (GA 20 S. 274-5)
In dieser Textstelle fordert Heidegger dazu auf, über die ontologische Bedeutung des
Wertprädikats nachzudenken. Unter welchen Umständen kommt ein Seiendes als
wertbehaftetes Ding vor? Zunächst geht man im Alltag mit Zeug um zu ... um, mit
Stühlen, um sich hinzusetzen, mit Tischen, um darauf zu essen. Das Betrachten des
Werts eines Tisches erfordert sozusagen eine besondere Einstellung, welche man zu-
nächst und zumeist nicht annimmt. Selbst die „wertvollen“ Dinge (Ringe, Halsket-
ten) werden dem Dasein zumeist als Zeug, um sich zu schmücken, zugänglich. Um
den Wert eines Rings zu betrachten, muss man ihn beschauen. Dabei erweist sich der
Ring als isoliertes Vorhandenes; er wird Gegenstand meiner Wahrnehmung. Das be-
sinnliche Wahrnehmen, das das Seiende außerhalb der für es konstitutiven Verwei-
sungen erfasst, stellte sich allerdings als eine Seinsweise des In-der-Welt-seins he-
raus. Heidegger bezweifelt sonach natürlich nicht, dass im Besorgen wertbehaftete
Dinge begegnen können. Diese Anwesenheitsart darf aber nicht den Ausgangspunkt
einer ontologischen Untersuchung des Weltphänomens darstellen, da sie die Welt
selbst voraussetzt. Indem man also das im besorgenden Umgang nächstbegegnende
31
Seiende als wertbehaftetes Ding ansieht, setzt man sich in den Horizont, der als On-
tologie der Vorhandenheit bezeichnet wurde.
Siebtens. Bedeutsamkeit ist ein formaler Begriff. Unter ihm ist die formale Struktur
des Weltphänomens, der Weltlichkeit, zu verstehen. Das Dasein ist faktisch, ontisch
stets in dieser oder jener bedeutsamen Welt. Dementsprechend nie in der Bedeut-
samkeit überhaupt. Diese macht nur die Struktur aus, der gemäß sich die jeweilige so
oder so erschlossene Welt manifestiert. Die jeweilige Welt ist demzufolge immer ei-
ne Modifikation des Phänomens der Welt nach der formalen Struktur der Bedeut-
samkeit: „Die Weltlichkeit selbst ist modifikabel zu dem jeweiligen Strukturganzen
besonderer ‚Welten‘, beschließt aber in sich das Apriori von Weltlichkeit über-
haupt.“ (SuZ S. 65)
Die Ergebnisse der Weltlichkeits- und Bedeutsamkeitsanalyse ermöglichen, die Vor-
stellung der Welt als Summe von Seiendem ein für allemal zu verlassen. Die genann-
te Vorstellung entspringt der Annahme, die Welt sei ein Vorhandenes. Die Welt
würde in den Blick so kommen, dass man vom ursprünglichen Verhältnis zwischen
ihr selbst und dem Dasein absieht. Die Welt hört damit auf, ein starres Gerüst zu
sein, in dem der Mensch leben würde, oder ein bloßer Gegenstand der Erkenntnis,
wenn sie ausgehend von der Analyse des Phänomens des In-der-Welt-seins erforscht
wird.
1.5. Die Welt und die Anderen. Die Mitwelt
Die Frage nach der Welt wurde in vorherigen Reflexionen hauptsächlich in Bezug
auf zwei Aspekte herausgearbeitet. Man hat an erster Stelle aufgezeigt, dass die Be-
deutsamkeit die Struktur dessen ausmacht, worin das Dasein existiert. An zweiter
Stelle wurde die Tatsache erläutert, dass die vorgängige Erschlossenheit der Welt die
Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass das Innerweltliche begegnet. Sie repräsen-
tiert das, woraufhin Seiendes entdeckt ist.
32
Wenn sich die Entwicklung der Fragestellung auf die Veranschaulichung dieser zwei
Aspekte beschränken würde, könnte der Verdacht entstehen, das Dasein lebe in einer
„privaten Welt“. Durch diesen Ausdruck bezieht man sich auf die Auffassung, der
zufolge das Dasein seine Existenz in der Welt so vornehmen würde, dass es primär
mit nichtdaseinsmäßigen Seienden umgeht und sekundär die anderen Seienden trifft,
die selbst durch das Sein des Daseins charakterisiert sind. In anderen Worten würde
die Behauptung, die Welt des Daseins sei privat, Folgendes bedeuten: Die Wechsel-
wirkung mit den Anderen macht nur eine Möglichkeit aus, welche im Rahmen des
konkreten Existierens ergriffen bzw. nicht ergriffen werden kann. Als Möglichkeit
wäre sie also kein Charakteristikum, welches das Dasein immer schon ontologisch
kennzeichnet.
Man schicke schon jetzt voraus, dass sich die Vorstellung der privaten Welt, mit al-
len den Konsequenzen, die sie mit sich bringt, mit der gesamten Philosophie von
Sein und Zeit nicht vereinbaren lässt. Die Begründung ihrer Ablehnung wird sich im
Laufe der Mitweltanalyse, welcher dieser Abschnitt gewidmet ist, deutlich heraus-
stellen.
In den in dieses Kapitel einleitenden Vorbemerkungen wurde ganz explizit darauf
aufmerksam gemacht, dass die Momente, welche das In-der-Welt-sein zusammen-
setzen, nicht voneinander unabhängig sind, sondern einer ursprünglichen Einheit zu-
gehören. Aus diesem Grund muss die Beleuchtung jedes einzelnen Moments auch
die anderen berücksichtigen.
In der Tat wurde das Begegnis des anderen Daseins in der Erörterung des Umgangs
mit dem Zuhandenen, wenn auch nicht eingehend, schon thematisiert. Dabei wurden
Andeutungen über die „Anwesenheit“ der Anderen im faktischen Besorgen gemacht.
Diese Anwesenheit ist nicht unbedingt als physische körperliche Gegenwart anderer
Personen zu verstehen. Das Buch z.B., das ich im Moment verfasse, verweist auf die-
jenigen, die es lesen werden bzw. für die ich es schreibe. Die Anderen kommen nicht
zu meinem Existieren (Schreiben) hinzu, als wäre dieses anfangs ausschließlich ein
isoliertes Verhältnis zwischen dem Schreibzeug und mir.
Das Begegnen der Anderen ereignet sich nicht einmal als Leistung des Daseins, etwa
als Wahrnehmung seines eigenen „Ich“ und von diesem „Ich“ getrennten Subjekten.
33
Genauso wie das Dasein nie außerhalb der Welt, sondern in ihr seiner ontologischen
Verfassung nach existiert, ist das daseinsmäßige Sein immer Mitsein: „die Welt [ist]
je schon immer die, die ich mit den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt.
Das In-Sein ist Mitsein mit Anderen.“ (SuZ. S. 118)
Daraus, dass man die Interpretation ausschließt, der zufolge die Welt in ihrem Sein,
d.h. nicht nur in einigen ihrer Erscheinungen, privat ist, folgt, dass sie „wesenhaft
und nicht erst in Nachhinein durch einen Erkenntnisbezug, gemeinsam geteilte, in-
terexistentielle Welt [ist].“14
Die jeweilige Welt des Daseins ist eine Mitwelt, d.h. gemeinsam geteilt, interexisten-
ziell. Was besagt diese Einsicht auf ontologischer Ebene? Die zwei Bestandteile der
Mitwelt (eben „Mit“ und „Welt“) gründen in den zwei Existenzialien, Weltlichkeit
und Mitsein, welche die Untersuchung schon fokussiert hat. Diese Charaktere sind
ursprünglich miteinander verflochten. Darin liegt: Das Mitsein, welches das ontolo-
gische Fundament jeder „Beziehung mit den Anderen“ ausmacht, ist immer in einer
geteilten Welt. Und: Die Bedeutsamkeit, als Struktur eines Existenzials des Daseins,
muss immer in Verbindung mit dem für das Dasein selbst nicht weniger ursprünglich
konstitutiven Mitsein gedacht werden. Dieser zweite Aspekt muss zur Geltung ge-
bracht werden, um die Vorstellung zurückzuweisen, das Dasein existiere zunächst
allein in einer privaten Welt. Das originäre Verflechten der Bedeutsamkeit mit dem
Mitsein drückt Heidegger folgendermaßen aus:
Im Mitsein [...] sind diese [die Anderen] in ihrem Dasein schon erschlos-sen. Diese mit dem Mitsein vorgängig konstituierte Erschlossenheit der Anderen macht demnach auch die Bedeutsamkeit, d. h. die Weltlichkeit mit aus, als welche sie im existenzialen Worum-willen festgemacht ist. Daher läßt die so konstituierte Weltlichkeit der Welt, in der das Dasein wesenhaft je schon ist, das umweltlich Zuhandene so begegnen, daß in eins mit ihm als umsichtig Besorgtem begegnet das Mitdasein Anderer. In der Struktur der Weltlichkeit der Welt liegt es, daß die Anderen nicht zunächst als freischwebende Subjekte vorhanden sind neben anderen Dingen, sondern in ihrem umweltlichen besonderen Sein in der Welt aus dem in dieser Zuhandenen her sich zeigen. (SuZ S. 123)
Die Bedeutsamkeit ist also nicht isoliert erschlossen. Wie bereits früher festgestellt,
ist sie immer an eine Existenzmöglichkeit gebunden. Jetzt wird klargemacht, dass für
14 Von Herrmann, F. W., Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu „Sein und Zeit“, Band II, S. 296.
34
sie auch das Mitsein bestimmend ist. Insofern wird der Grund deutlich, warum man
die These ablehnt, das Dasein lebe zuerst „allein“, um erst danach die Anderen zu
treffen.
Doch einige Präzisierungen erweisen sich noch als notwendig, damit die Verbindung
der Bedeutsamkeit mit dem Sein des Daseins am besten definiert wird. Es wurde
pointiert, dass die Bedeutsamkeit die Struktur der Weltlichkeit ausmacht, die ihrer-
seits eine ontologische daseinsmäßige Bestimmung ist. Insofern geht sie auf das Sein
des Daseins zurück, zu dem sie letztlich gehört. Die Zugehörigkeit der Bedeutsam-
keit zur Seinsverfassung des Daseins darf folglich nicht mit der Idee der Privatheit
der Welt gleichgesetzt werden. „Privat“ und „zum Sein des Daseins gehörend“ gelten
keineswegs als Synonyme. Nur wenn man den Menschen ausgehend von der Onto-
logie der Vorhandenheit begreift, könnten die beiden Ausdrücke miteinander über-
einstimmen. Nachdem allerdings die existenziale Analytik deutlich gemacht hat, dass
die Existenz durch das Mitsein ausgezeichnet ist, tritt der Unterschied äußerst offen-
bar hervor zwischen dem Bild einerseits, nach dem der Mensch zunächst in seiner
privaten Sphäre lebt, und der Auffassung andererseits, die Weltlichkeit sei ein Exis-
tenzial.
Indem Heidegger die Bedeutsamkeit auf die existenziale Seinsverfassung des Da-
seins zurückführt, vertritt er also keineswegs die Ansicht, die Welt sei nur für den
einzelnen Menschen zugänglich. Dabei stellt sich der Grund, warum sich der ontolo-
gische Begriff der Bedeutsamkeit nicht ausgehend von der gewöhnlichen Bedeutung
von „bedeutsam“ nachvollziehen lässt, als noch offensichtlicher heraus15. In der ge-
wöhnlichen Sprache setzt der Gebrauch des Ausdrucks „bedeutsam“ immer jeman-
den voraus, für den etwas eben bedeutsam, wichtig ist. Der Zugang zur Bedeutsam-
keit, im Sinne von Wichtigkeit, ist persönlich, privat. Die existenziale Bedeutsamkeit
ist hingegen je schon vom Mitsein mitbestimmt.
Ein anderes Problem, auf das es aufmerksam zu machen gilt, besteht in der Unter-
scheidung der ontologischen Ebene von der ontischen. Anhand von von Herrmann
fasst man die Ausdrücke „privat“, „gemeinsam geteilt“ und „interexistentiell“ als on-
tologische Bestimmungsmodalitäten, welche sich als solche auf das Weltphänomen
15 Vgl. S. 29-30 des vorliegenden Texts.
35
beziehen. Und zwar wurde gezeigt, dass aus der Perspektive von Sein und Zeit nur
die letzten beiden dazu geeignet sind, die Weltlichkeit zu beschreiben. Auf diesem
Grundsatz kann sich dann die jeweilige Welt ontisch als eigen oder öffentlich zeigen.
Als Beispiel für die eigene Welt kann der Raum genannt werden, in dem ich schrei-
be. Das Stadion, in dem wir dem Fußballspiel beiwohnen, kann als Beispiel für die
öffentliche Welt gelten. Das Verwechseln der genannten Ausdrücke, etwa dadurch,
dass „eigen“ gleichbedeutend mit „privat“ betrachtet wird, oder „öffentlich“ gleich-
bedeutend mit „gemeinsam geteilt“, würde heißen, der ontisch-ontologischen Diffe-
renz nicht Rechnung zu tragen. Die jeweilige Welt, sei sie ontisch eigen oder öffent-
lich, „beschließt [...] in sich das Apriori der Weltlichkeit überhaupt“ (SuZ S. 65), ist
nämlich immer interexistentiell und bietet sich nach der Struktur der Bedeutsamkeit
dar.
Mit der Erläuterung der Weltanalyse Heideggers wurde das erste Ziel erreicht. Die
Bedeutsamkeit als Schlüsselbegriff der Weltauffassung wurde erst hinsichtlich ihrer
wesentlichen Züge und danach in Verbindung mit dem Existenzial des Mitseins hin-
terfragt. Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, den ursprünglichen
Zusammenhang zwischen Welt und Sprache aus der Perspektive der existenzialen
Analytik von Sein und Zeit aufzuzeigen. Bisher wurde nur die Seinsstruktur der Welt
erkundet. Bevor der Zusammenhang „an sich“ Gegenstand der Untersuchung aus-
drücklich wird, gilt es daher, die ontologischen Wurzeln der Sprache zu beleuchten.
36
2. Rede und Sprache
In diesem Kapitel geht es darum, sich mit zweierlei Aufgaben auseinanderzusetzen.
An erster Stelle muss die Explikation des dritten und letzten konstitutiven Moments
des Phänomens des In-der-Welt-seins in Angriff genommen werden. Die Welt und
das Mit-Sein wurden bereits thematisiert. Jetzt soll das In-Sein Gegenstand der Über-
legung werden.
Die Analyse des In-Seins visiert an, zu beschreiben, wie das Dasein in der Welt ist,
oder, anders ausgedrückt, wie das Dasein sein „Da“ ist. Das Dasein ist konstitutiv
sein Da. Dies besagt: Es existiert (in der Welt) gemäß zwei Grundweisen, und zwar
Befindlichkeit und Verstehen. Diese sind in der Erschlossenheit des Da wesenhaft
durch die Rede artikuliert und gegliedert. Die redende Artikulation vollzieht sich
gleichursprünglich mit dem Erschließen von Befindlichkeit und Verstehen, also nicht
erst danach. Schwerpunktthema der Darlegung des In-Seins ist die Rede. Das Ver-
stehen und die in ihm fundierte Auslegung werden nur kurz dargestellt, während das
Existenzial der Befindlichkeit nicht behandelt wird.
Nachdem die Verfassung der Rede in seinem Verhältnis zur Sprache erläutert wurde,
muss man auf eine in gewisser Hinsicht unterschiedliche Sprachdarstellung einge-
hen, die nämlich von Wittgenstein. Die Erläuterung mancher Grundsätze seines Ge-
dankens macht die zweite Aufgabe dieses Kapitels aus. Anhand von einigen Erwä-
gungen aus den Philosophischen Untersuchungen werden gewisse Aspekte der Rede
besser klargestellt. Die Klarheit des Phänomens der Rede ist nämlich von höchster
Wichtigkeit, um das Verhältnis der Rede selbst mit der Bedeutsamkeit beleuchten zu
können.
37
2.1. Verstehen und Auslegung
Das Verstehen ist ein Seinscharakter des Daseins. Als solcher ist es nicht mit dem
Wissen oder Erkennen von etwas Bestimmtem zu verwechseln. Auch ist es vom Ver-
stehen im ontischen Sinne, z.B. dem Verstehen dieser oder jenen Aussage bzw. Er-
klärung, fernzuhalten. Wissen, Erkennen und Verstehen von etwas Bestimmtem sind
ontische Möglichkeiten. Als solche machen sie abgeleitete Modi des existenzialen
Verstehens aus.
Das angesprochene Existenzial war schon Gegenstand der Überlegungen über die
Weltlichkeit der Welt. Dies zur Bestätigung der Grunderkenntnis, die Momente des
In-der-Welt-seins seien ineinandergreifend und nicht voneinander unabhängig. Bei
der Weltanalyse ergab sich, dass die Welt im Verstehen immer schon erschlossen ist.
Das Verstehen von Welt besteht darin, dass sich das Dasein an die in der Bedeut-
samkeit erschlossenen Bezüge immer schon verwiesen hat. Parallel wurde die Auf-
merksamkeit darauf gerichtet, dass gleichursprünglich mit der Welt eine Existenz-
möglichkeit (ein Worum-willen) erschlossen ist.
Die Gleichursprünglichkeit dieser zwei Strukturen bringt eine Tatsache mit sich,
welche bisher nur aus der Perspektive der Frage nach der Welt bemerkt wurde. Da-
mals stellte es sich heraus, dass das Verstehen von Welt, als Sich-Verweisen des Da-
seins an die erschlossene Bedeutsamkeit, nicht zu einem vorgängigen Existieren au-
ßerhalb der Welt hinzutritt. Jetzt sei Folgendes angemerkt: Das erschließende Ver-
stehen der Existenz ereignet sich nicht auf der Grundlage eines vorigen Subsistierens
(Vorhandenseins16) des Daseins in der Welt, als wäre dieses Vorhandensein die Be-
dingung des Existierens. Das Verstehen im ontologischen Sinne gibt mithin das exis-
tenziale Erschließen der Bedeutsamkeit und des Worum-willen an: „Das Verstehen
betrifft als die Erschlossenheit des Da immer das Ganze des In-der-Welt-seins. In je-
dem Verstehen von Welt ist Existenz mitverstanden und umgekehrt.“ (SuZ S. 152)
Die Struktur des Verstehens ist der Entwurf. Das bedeutet, dass im Verstehen das
Worum-willen und die Welt nach Möglichkeiten erschlossen sind. Dass das Worum-
willen gemäß Möglichkeiten erschlossen ist, besagt, dass das Dasein immer in dieser
16 Dieser Seinsmodus, wie mehrfach festgestellt, beschreibt keineswegs das Sein des Daseins.
38
oder jener Möglichkeit existiert. Es kann so oder so sein. Auf den Charakter der
Möglichkeit (des Sein-Könnens) der Welt ist man hingegen gestoßen, als erwähnt
wurde, dass die Welt kein starres Gerüst ist, sondern so oder so erschlossen sein
kann. Außerdem betrifft die Entwurfsstruktur des Verstehens auch die Entdeckung
des Innerweltlichen. Man erinnere sich daran, dass das Seiende auf dieses oder jenes
Um-zu hin entdeckt ist (das Glas kann sowohl als Zeug, um zu trinken, als auch als
Zeug, um die Unterlagen zu beschweren, begegnen).
Die möglichkeitsmäßige Erschlossenheit der Welt und des Worum-willen ist nicht
eine „Situation“, die unverändert verbleibt. Sie bildet sich vielmehr aus. Ontologisch
gesagt: Das Verstandene wird in der Auslegung artikuliert.
In der Weltlichkeitsanalyse z.B. hat sich die Tatsache herausgestellt, das Verhältnis
zur Welt beschränke sich nicht auf die Erschlossenheit der Bedeutsamkeit. Denn auf
diese hin, d.h. aus dem Weltverstehen, geht das Dasein immer (also nicht gelegent-
lich) mit dem Innerweltlichen um. Der besorgende Umgang mit Seiendem macht ein
Beispiel der Auslegung dessen aus, was bereits existenzial verstanden ist.
Die Auslegung vollzieht sich immer im Gebiet des Verstehens. Sie erfasst nicht
„Angaben“ außerhalb des existenzialen Verstandenen. Umgekehrt: Sie arbeitet die
erschlossenen (somit verstandenen) Möglichkeiten heraus. Die Auslegung als Mög-
lichkeit der Ausbildung des Verstehens, ist nicht von diesem getrennt bzw. unabhän-
gig, sondern in ihm ontologisch gegründet. Um das oben genannte Beispiel wiede-
raufzunehmen: Der Umgang mit Seiendem und das Weltverständnis sind nicht ge-
trennt, und zwar vollzieht sich jener in und ausgehend von diesem. Der besorgende
Umgang setzt die Erschlossenheit der Bedeutsamkeit voraus, wie die Auslegung das
im Verstehen Verstandene.
Als dem Verstehen eigene Ausbildungsmöglichkeit orientiert sich die Auslegung an
die Welt, wie auch an das Worum-willen. Sie wird jedoch hier, wie übrigens auch in
Sein und Zeit, ausschließlich im Hinblick auf das Weltverständnis thematisiert.
Das Verstehen von Welt macht die Bedingung der Möglichkeit jedes besorgenden
Umgangs aus. Denn dieser bewegt sich stets in der erschlossenen (verstandenen) Be-
deutsamkeit. Die Umsicht, welche das Besorgen führt, entdeckt ausdrücklich die je-
weilige Bewandtnis (als Sein des innerweltlichen Seienden), die schon in der Be-
39
wandtnisganzheit bzw. Bedeutsamkeit (wenngleich noch unausdrücklich) erschlos-
sen ist. Jede Entdeckung des Seienden aus seiner Bewandtnis ist eine Auslegung des
Verstandenen: „Die Umsicht entdeckt, das bedeutet, die schon verstandene ‚Welt‘
wird ausgelegt.“ (SuZ S. 148) Das „bedeutet“ (hier nicht im existenzialen Sinne)
verbindet die Weltanalyse („Die Umsicht entdeckt“) und die Verstehenanalyse
(„Welt wird ausgebildet“).
Auf die zuerst erschlossene und danach entdeckte Bewandtnis bzw. Verweisung hin
begegnet das Zuhandene, d.h. es wird „in seinem Um-zu auseinandergelegt und ge-
mäß der sichtig gewordenen Auseinandergelegtheit besorgt.“ (SuZ S. 149) Die Aus-
legung der verstandenen Welt zeichnet sich folglich als Auseinanderlegen des Zu-
handenen in seinem Um-zu ab, oder, was gleichbedeutend ist, als Herauslegen der
Bewandtnis: „Mit dem innerweltlichen Begegnenden als solchem hat es je schon eine
im Weltverstehen erschlossene Bewandtnis, die durch die Auslegung herausgelegt
wird.“ (SuZ S. 150)
In der Erläuterung des Verhältnisses zwischen dem Verstehen und der Auslegung
bewegt man sich ständig auf zwei Ebenen, und zwar der Unausdrücklichkeit und der
Ausdrücklichkeit. Das Weltverständnis ist stets unausdrücklich. Es ist ein Sich-
verweisen in den Verweisungen der Bedeutsamkeit, ohne „sich“ auf eine Verweisung
in erster Linie zu „konzentrieren“. Das vorgängige Verstehen der Welt hält sich tat-
sächlich weder bei einem Um-zu noch bei einem Zuhandenen ausdrücklich. In der
Auslegung kommt hingegen das Seiende ausdrücklich in die Umsicht. Seine Be-
wandtnis wird ausdrücklich herausgelegt; jetzt kann es als Zeug um zu ... begegnen.
Wenn das Seiende der Auslegung zugeht, gehört es nicht mehr nur dem unausdrück-
lichen Verständnis der Bedeutsamkeit an, sondern wird in seiner Zuhandenheit ent-
deckt.
Bevor es mit der Beleuchtung der spezifischen Struktur der Auslegung weitergeht,
muss der Begriff der Ausdrücklichkeit präzisiert werden. Denn er darf mit der Vor-
stellung der Auffälligkeit nicht verwechselt werden. Dass das Zuhandene ausdrück-
lich in die Umsicht kommt, heißt nicht, dass es irgendwie auffällt. Das alltägliche
Besorgen geht nämlich dergestalt vonstatten, dass sowohl das Sich-Bewegen in der
Bedeutsamkeit als auch der ausdrückliche Zugang zum Innerweltlichen selbstver-
40
ständlich geschehen, ohne dementsprechend aufzufallen. Ausdrücklichkeit deutet
deshalb hierin nicht einmal etwas wie thematisch-erkennendes Erfassen von etwas
an.
Die Auslegung ist wesenhaft ausdrückliches Verstehen gemäß der Struktur des Et-
was als Etwas. In der Auslegung z.B. der zuvor unausdrücklich verstandenen Welt
begegnet das Zuhandene als Zeug um zu ... : Dieses Seiende begegnet als Zeug, um
zu schreiben, dieses als Zeug, um zu trinken, jenes als Zeug, um die Papiere zu be-
schweren.
Diese Struktur zeigt, dass ein Seiendes für das Dasein immer auf etwas anderes hin
ausdrücklich zugänglich wird. Das zweite „Etwas“ aus der Formel „Etwas als Etwas“
muss in der Tat bereits erschlossen sein, sonst könnte das erste nicht durch das „Als“
in seinem Sein auseinandergelegt werden. Von dieser Beobachtung her könnte man
die Als-Struktur der Auslegung so deuten, dass das vorgängige Erschließen des zwei-
ten „Etwas“ ein Erfassen eines bloßen Vorhandenen ist. Aus der Perspektive dieser
Deutung würde das Dasein im Besorgen zunächst purem Stoff begegnen und danach
durch die Auslegung diesem vorhandenen Stoff eine Funktion (ein Um-zu) zuerken-
nen oder ihn als Glas, Kugelschreiber usw. beschreiben. Diese Deutung trifft aber
den Sinn der Auslegung nicht. Denn das Erfassen eines Vorhandenen ist selbst eine
in der Auslegung fundierte Entdeckung des Seienden, und zwar eben als Vorhande-
nes. Das beschauliche Wahrnehmen des Innerweltlichen ist ein Modus der Ausle-
gung, als solcher kann es nicht ihr Prinzip sein.
Das Existenzial der Auslegung schreibt also nicht den schon entdeckten Seienden
Bedeutungen, Funktionen usw. zu, sondern trägt zur Entdeckung selbst bei. Seiendes
wird für die Umsicht ausdrücklich zugänglich nur auf der Grundlage der herausge-
legten Bewandtnis. Das Herauslegen der Bewandtnis findet in der Auslegung einer
bereits verstandenen Welt statt. Da die Auslegung eine existenziale Entdeckungs-
funktion hat, ereignet sie sich immer schon mit dem Existieren des Daseins. Insofern
ist es von grundlegender Bedeutung, den Begriff der existenzialen Auslegung vom
gewöhnlichen Signifikat dieses Ausdrucks fernzuhalten. Denn ontisch bedeutet
„Auslegung“ einen Vollzug, eine Leistung des Daseins, während das angesprochene
Existenzial ein ontologisches Geschehen bezeichnet.
41
Durch die Auslegungsanalyse tritt die Wesenseinsicht hervor, jedes ausdrückliche
(Er-)Lernen sei nie voraussetzungslos, sondern immer eine Ausarbeitung des schon
unausdrücklichen Verstandenen. Jedes „neue Erfassen“ setzt ein bereits Verstande-
nes voraus, in welchem es sich hält. Insofern wird nichts als „vollständig neu“ er-
fasst. Das, worin sich das neue Erfasste (das Ausgelegte) hält und woraufhin die
Auslegung artikuliert, nennt Heidegger Sinn:
„Sinn ist das, worin sich Verständlichkeit von etwas hält. Was im verste-henden Erschließen artikulierbar ist, [...] nennen wir Sinn. Der Begriff des Sinnes umfaßt das formale Gerüst dessen, was verstehende Auslegung ar-tikuliert. Sinn ist das [...] Woraufhin des Entwurfs, aus dem her etwas als etwas verständlich wird.“ (SuZ S. 151)
Die Verständlichkeit, um welche es hier geht, nennt nicht das unausdrückliche Ver-
ständnis (der Welt und Existenz), sondern das ausdrückliche Auslegungsverständnis,
das sich in jenem bewegt und es artikuliert17. Im Falle des auslegenden Entdeckens
des Zuhandenen z.B. macht die jeweilige gemäß der Struktur der Bedeutsamkeit er-
schlossene Welt den schon verstandenen Sinn aus.
Diese Reflexionen haben die spezifische Erschließungsfunktion des Verstehens und
der Auslegung klargestellt. Die Stellung dieser Existenzialien im Rahmen der Analy-
se des In-der-Welt-seins nachzuvollziehen, ist von Belang auch in Hinsicht auf die
Darstellung der spezifischen Rolle der Rede, als ontologisches Fundaments der Spra-
che, und der Sprache selbst. Bevor aber die Rede in den Blick kommt, gehe man auf
einen „Grenzfall“ der Kundgebung der Sprache ein: Die Aussage.
Mit dem Ausdruck „Aussage18“ meint Heidegger das, was in der Philosophie tradi-
tionell unter „Urteil“ verstanden wird, z.B. „Der Hammer ist schwer“. Der Logik zu-
folge hat die Aussage seinen Sinn an sich. Aus dieser Perspektive macht das Urteilen
eine (direkte) Zugangsweise zum Seienden aus. Es könnte nämlich das Seiende urs-
prünglich (d.h. ohne Voraussetzungen) aufzeigen (erschließen). In anderen Worten
weist die Logik der Aussage die Erschließungsfunktion zu, welche sich in Sein und
17 Die Präzisierung ist notwendig, da Heidegger den Ausdruck „Verständlichkeit“ auf verschiedene Weisen gebraucht. Anders als hier, wo sich „Verständlichkeit“ auf das Auslegungsverständnis bezieht, verwendet Heidegger in anderen Stellen (Vgl. z.B. S. 22 des vorliegenden Texts bzw. SuZ S. 86) die-ses Wort, um das Verstehen der Welt zu bezeichnen. 18 Die Aussage steht im Blick bezüglich drei Bedeutungen: Aussage als Aufzeigung, Prädikation und Mitteilung. Hier erwägt man nur die erste Bedeutung. Das Aufzeigen entspricht nämlich der Erschlie-ßungsfunktion, um welche es hier geht. Aufzeigen der Aussage heißt: „Seiendes von ihm selbst her sehen lassen.“ (SuZ S. 154)
42
Zeit als Charakter des Verstehens und der Auslegung ergab. An dieser Stelle muss
sich die Untersuchung also mit der Frage auseinandersetzen, ob die Aussage wirklich
diese Funktion innehat.
Um diese Frage zu beantworten, fordert Heidegger wiederum dazu auf, zu prüfen,
wie sich die Aussage im besorgenden Umgang setzt. Anders formuliert: Was für eine
Rolle sie im alltäglichen In-der-Welt-sein spielt. Allein die Tatsache, dass sie als
„Grenzfall“ (SuZ S. 157) definiert wird, deutet bereits an, dass sie nur eine selten
vorkommende Erscheinung der Sprache darstellt und als solche nicht das Erschlie-
ßungsprinzip ausmachen kann. In der Tat erschließt das Aussagen: „Der Hammer ist
schwer“ den Hammer in seiner Unzuhandenheit nicht. Der Alltagsumgang kommt
vielmehr so zustande, dass sich das Zeug zunächst als ungeeignet zu ... zeigt und da-
bei ersetzt wird. Dies läuft ab, ohne Worte auszusagen.
Bevor dieser Gedanke präziser vorgebracht wird, sei auf Folgendes hingewiesen. Die
spezifische Anwesenheit der erwähnten Aussage wird hier in Bezug auf seine Auf-
zeigungsfunktion studiert. „Der Hammer ist schwer“ darf dementsprechend nicht als
Mitteilung verstanden werden. Mit „Aussage“ meint man nur das theoretische Urteil.
Dass der Handwerker den Hammer unabhängig von irgendeinem theoretischen Urteil
ersetzt, heißt, dass weder das Werkzeug noch seine „Eigenschaften“ erst in der Aus-
sage für die Umsicht zugänglich bzw. entdeckt sind. Wie begegnet denn dann der
Hammer? Zunächst einmal greift der Handwerker den Hammer, um zu hämmern. Die
Verweisung des Um-zu muss deshalb schon herausgelegt sein. Auf diese Verweisung
hin kann sich der Hammer als geeignet zum Hämmern oder nicht enthüllen. Dass er
schwer ist, besagt ontologisch: Das Seiende begegnet auf seine Verweisung hin in
seiner Unzuhandenheit. Die Schwere ihrerseits ist primär keine vom Seienden ge-
trennte Eigenschaft, keine Bestimmung also, die dem Hammer erst durch die theore-
tische Prädikation zugesprochen wird.
Man hat gesagt: Die Aussage „der Hammer ist schwer“ setzt schon gleichsam vor-
aus, dass das Seiende eben als Hammer entdeckt ist (insofern erschließt sie nichts).
Die Entdeckung des Seienden als Hammer setzt ihrerseits die Erschlossenheit des
Um-zu (des Hämmerns) voraus. Noch (ontologisch) früher müssen die dem Hand-
43
werker vertraute Werkstatt und die Existenzmöglichkeit des Handwerkers selbst er-
schlossen sein.
Die Vertrautheit mit der (Um-)Welt ist ein grundlegender Zug der im Verstehen statt-
findenden Erschlossenheit der Bedeutsamkeit. Das Herauslegen der Einzelverwei-
sung bzw. -bewandtnis vollzieht sich hingegen in der Auslegung. In der Auslegung
selbst begegnet der Hammer als Unzuhandenes. Daraus folgt: Das Urteil ist immer
im erschließenden auslegenden Verstehen eingebettet, kann dementsprechend das
Sein des Seienden nicht erschließen.
Bei dem Aussprechen der Aussage begegnet das Seiende nicht nach der vorhin be-
schriebenen Entdeckungsart. Im besorgenden Umgang begegnet der Hammer als auf
das schon erschlossene Um-zu hin Zuhandenes bzw. als das, womit es beim Häm-
mern Bewandtnis hat. In der Aussage kommt er hingegen als (vorhandener) Gegens-
tand eines theoretischen Urteils vor. Dieser Gegenstand seinerseits kann nur auf der
Grundlage eines zuerst in (dem Verstehen) der Bedeutsamkeit erschlossenen und
dann in der Auslegung herausgelegten Worüber der Aussage entdeckt werden.
Es liegt offenbar zutage, dass die Aussage dem Verstehen nicht zugrunde liegt, son-
dern zeigt das Seiende nach den drei Charakteren auf, welche die (im existenzialen
Verstehen fundierte) Auslegung charakterisieren. Erstens kommt das Seiende als
Gegenstand des Urteils vor. Zweitens setzt es eine schon herausgelegte Verweisung
(Worüber) voraus. Drittens ist diese Verweisung letztendlich in der vom Verstehen
erschlossenen Bedeutsamkeit. Die Aussage ist demnach in der verstehenden Ausle-
gung fundiert.
Wenn man das Aussagen als primäre Weise des In-der-Welt-seins betrachtet, vermag
man nicht:
1) die nächste Entdeckungsart des Innerweltlichen zu beschreiben. Denn diese ge-
schieht im gebrauchenden Umgang mit dem Zeug und nicht eben im theoretischen
Urteilen.
2) die Als-Struktur der Auslegung zu schildern. Denn sie (aus der Perspektive der
überlieferten Logik) beansprucht, das Seiende so unmittelbar zugänglich zu machen,
d.h. nicht als auf ein schon Verstandenes hin Begegnendes.
44
3) das ontologische Fundament des Aussagens über ein Seiendes zu erhellen, d.h. die
Tatsache, dass jede Aussage einen schon verstandenen (aufgeschlossenen) Sinn vor-
aussetzt.
Aus diesen Gründen stellt sich Folgendes als klar heraus: Die Aussage, genauso wie
das theoretische Erkennen, findet ihr Fundament im auslegenden Verstehen, somit
darf sie (die Aussage) nicht als ursprünglich erschließend gesehen werden. Ihr Auf-
zeigen ist, ontologisch gesehen, kein Erschließen:
„Das Aufzeigen der Aussage vollzieht sich auf dem Grunde des im Ver-stehen schon Erschlossenen bzw. umsichtig Entdeckten. Aussage ist kein freischwebendes Verhalten, das von sich aus primär Seiendes überhaupt erschließen könnte, sondern hält sich schon immer auf der Basis des In-der-Welt-seins. Was früher bezüglich des Welterkennens gezeigt wurde, gilt nicht weniger von der Aussage. Sie bedarf einer Vorhabe [d.h. eines Verständnisses] von überhaupt Erschlossenem, das sie in der Weise des Bestimmens aufzeigt.“ (SuZ S. 156-7)
2.2. Rede und Sprache in „Sein und Zeit“
Rede und Sprache wurden in dieser Arbeit schon angedeutet, und zwar in der Skizze
des In-Seins beziehungsweise während der Prüfung der Aussage. In der Skizze des
In-seins wurde erwähnt, dass die Rede mit dem Verstehen gleichursprünglich ist und
dass sie die ganze Erschlossenheit der Welt und des Worum-willen artikuliert. Was
hingegen die Sprache betrifft, wurde gezeigt, dass sich die Aussage als Grenzfall
eben der Sprache erwies. Sprache ist also aus der Perspektive von Sein und Zeit nicht
die Gesamtheit der Aussagen, weil diese lediglich seltene sprachliche Manifestatio-
nen sind.
Nun gilt es, den folgenden Problemen nachzugehen:
1) Wie verbindet sich die Rede- und Sprachuntersuchung mit der vollständigen Frei-
legung der Strukturen des In-der-Welt-seins als existenzialer Grundverfassung des
Daseins?
45
2) Was für ein Verhältnis besteht zwischen Rede und Sprache und warum überhaupt
ist es im Rahmen der existenzialen Analytik solch eine Unterscheidung vorzuneh-
men?
Am Anfang des §34, der eben dieser Problematik gewidmet ist, macht Heidegger so-
fort klar, dass die Sprache kein ursprüngliches Phänomen ist. Sie ist vielmehr eine
Erscheinung, welche in der Rede ihr ontologisches Fundament findet: „Das existen-
zial-ontologische Fundament der Sprache ist die Rede.“ (SuZ S. 160)
Bevor dieses Fundierungsverhältnis ausführlicher hinterfragt wird, ist es erforderlich,
eine erste bemerkenswerte Konsequenz, die die zitierte Behauptung mit sich bringt,
zur Geltung zu bringen. Der jetzigen Kenntnis des Phänomens der Rede zufolge ist
es bekannt, dass diese dem Da des Daseins zugehört, dessen Erschlossenheit sie arti-
kuliert und gliedert. Nun wird erklärt, der Sprache liege die Rede zugrunde, welche
eben ein Existenzial des Daseins ist. Aus diesen Prämissen folgt, dass die Sprachun-
tersuchung das thematische Terrain der existenzialen Analytik nicht verlässt.
In der bisherigen Darlegung wurde als Beispiel der Spracherscheinung nur die Aus-
sage in Erwägung gezogen. Da die Aussage in der Auslegung gründet, liegt sie nicht
außerhalb des existenzialen Verstehens und allgemeiner des In-der-Welt-seins. Bis
jetzt hätte man sich also der Ansicht zuneigen können, nur das Urteilen (eben als
Grenzfall der Sprache) sei in die Seinsverfassung des Daseins eingebettet. Durch die
Behauptung (das ontologische Fundament der Sprache sei die Rede), welche wenn
auch noch ohne Begründung das Verhältnis zwischen Rede und Sprache verdeutlicht,
wird allerdings die Meinung jetzt klar, jede sprachliche Manifestation habe ihre onto-
logische Herkunft in der Rede und mithin in der gesamten Erschlossenheit des Da.
Nimmt man an, Sprache sei kein Phänomen, so muss nun aufgeklärt werden, was
Heidegger unter diesem Begriff versteht. Eine erste Definition könnte folgenderma-
ßen lauten: Sprache ist das Ganze der Worte, die in bestimmten Situationen sinnlich
wahrnehmbar vorkommen. Das Wort ist nicht die Einheit eines Lautes mit einer Be-
deutung, sondern bloß ein vernehmbares Zeichen. In der Redeanalyse heißt also
„Wort“ so viel wie „Wortlaut“, da es meistens eben in Form von akustischen Zeichen
auftritt. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sich Worte auch in anderen
Gestalten zeigen können, z.B. als gedruckte Zeichen in einer Schrift. Aus dieser
46
Perspektive nennt die Sprache nicht das gesamte System aller worthaften Zeichen.
Sie ist dagegen immer konkretes „Sichaussprechen“ (GA 20 S. 288), sie ist immer
diese (meistens stimmliche) Verlautbarung.
Als Beispiele für ontische Verlautbarung können die Folgenden angeführt werden:
einen Befehl erteilen, jemanden vor einer Gefahr warnen, jemandem Vorwürfe ma-
chen, jemanden loben, eine Situation beschreiben, auf etwas fluchen, sich Mut ma-
chen.
Da die Sprache stets diese oder jene Verlautbarung ist, welche in einer bestimmten
Situation, d.h. in einem bestimmten In-der-Welt-sein, erscheint, ist sie immer „seien-
de“ (d.h. ausgesprochene, gedruckte usw.) Wortganzheit. Sie ist folglich nie „an
sich“, sondern stets Wortganzheit, mit der man hier und jetzt zu tun hat. Das Zu-tun-
haben mit der Sprache manifestiert sich, wie schon erwähnt wurde, im Sichausspre-
chen (Sprechen), aber auch im konkreten Hören und Schweigen. Die Tatsache, dass
in diesen Ausführungen das Adjektiv „konkret“ mehrmals verwendet wurde, ist ein
evidentes Zeichen dafür, dass sich die Sprache immer innerhalb der ontischen Di-
mension bewegt. Bevor man zu der Redeanalyse übergeht, gilt es also, eine Zwi-
schenbemerkung zu machen, um die gerade angesprochene Tatsache besser zu erläu-
tern.
Im Laufe der vorhergehend durchgeführten Analysen der Welt, des Verstehens und
der Auslegung wurde ständig auf zwei Stufen Bezug genommen: die existentiell-
ontische und die existential-ontologische. Einerseits ging es um die Schilderung der
seienden Erscheinungen; empirisch feststellbaren Tatsachen, die Modifikationen der
Phänomene sind. Andererseits wurden hingegen die Phänomene selbst beschrieben,
d.h. die unveränderbaren Seinsstrukturen etwa Weltlichkeit und existenziales Verste-
hen. Der zentrale Aspekt des Verhältnisses zwischen Phänomen und Erscheinung
bzw. Sein und Seiendem besteht darin, dass sich das erstere durch das zweite
enthüllt, welches seinerseits eine mögliche Manifestation seines starren Wesens ist.
Die Anwesenheit des Seins im Seienden ist nicht eine bloße Möglichkeit, sondern ei-
ne Notwendigkeit. Ebenso notwendig ist das Sich-Zeigen des Seins durch das Seien-
de.
47
Dieselbe Methode, nämlich die phänomenologische Methode, muss an dieser Stelle
auf die Erforschung der Sprache angewendet werden. Die Sprache ergab sich als
Seiendes. Dies bringt mit sich, dass ihr Wesen nicht in der Sprache selbst bestehen
kann. Das Wesen der Sprache ist nämlich die Rede. Durch diese Beobachtung kehrt
man zurück zur Anfangsbehauptung, das existenzial-ontologische Fundament der
Sprache sei die Rede, welche ein Seinscharakter des Daseins ist. Jetzt, da die Er-
scheinung (vorläufig) umrissen worden ist, kann es mit der Freilegung des Phäno-
mens weitergehen.
Genauso wie beim Studium aller übrigen Strukturmomente der Seinsverfassung des
Daseins muss im Rahmen des Studiums dieses Existenzials der folgende Hinweis
vergegenwärtigt werden: Der ontologische Begriff der Rede darf nicht ausgehend
von der üblichen Bedeutung von „Rede“ in der gewöhnlichen Sprache aufgefasst
werden. Existenziale Rede bedeutet dementsprechend nicht dasselbe wie etwa Ans-
prache; auch ist ihr der Sinn von „Redehalten“ fremd. Was ist denn dann die existen-
zial verstandene Rede? Oder genauer formuliert: Welche Rolle spielt die Rede in der
Erschlossenheit des ganzen In-der-Welt-seins? Das Bedürfnis nach der Umformulie-
rung der Frage entsteht nicht aus bloß formalen Gründen. Die erste Formulierung
suggeriert nämlich eine gewisse Art von Antwort. Fragt man: „Was ist ...?“, setzt
man nämlich die Suche in einen bestimmten Horizont. Gesucht wird in diesem Hori-
zont ein Seiendes, ein „Was“. Wie allerdings umfassend erklärt wurde, sucht die
Frage nach einem Existenzialen kein „Was“, kein Seiendes, sondern das Sein des
Seienden. Dies ist der Grund, warum die zweite Formulierung der Frage für eine sol-
che Untersuchung geeigneter scheint. Gewinnt man zuerst einmal die Lösung für
dieses Problem, kann man später auf die andere Aufgabe dieses Paragraphen einge-
hen, d.h. auf die Aufzeigung dessen, wie die Rede, als Wesen der Sprache, in die
stimmliche Verlautbarung eingeht.
Die Antwort auf die Frage, welche Funktion habe die Rede im Rahmen der Erschlos-
senheit des In-der-Welt-seins, ist in der Wirklichkeit schon bekannt, ihre Bedeutung
jedoch noch nicht. Denn es wurde schon erörtert, dass die Rede mit Befindlichkeit
und Verstehen, d.h. mit den Grundweisen des In-Seins, gleichursprünglich ist. Au-
ßerdem artikuliert und gliedert sie die gesamte Erschlossenheit (der Welt und Exis-
tenz): „Die Rede ist mit Befindlichkeit und Verstehen existenzial gleichursprünglich.
48
[...] Rede ist die Artikulation der Verständlichkeit19.“ (SuZ S. 161) Die folgenden
Reflexionen müssen also darlegen, worin diese artikulierende bzw. gliedernde Funk-
tion besteht.
Bei dem ersten Teil der Prüfung des In-Seins (d.h. in der Verstehenanalyse) wurde
aufgezeigt, dass die Auslegung das artikuliert, was im Verstehen bereits erschlossen
ist. Die Auslegung hält sich also konstitutiv in der Verständlichkeit der Welt und
Existenz20. Man erinnert an diese Passage, um hervorzuheben, dass die Artikulations-
funktion auch vor der Thematisierung der Rede Überlegungsgegenstand war, und
zwar als Charakter eines anderen Existenzials. Es erhebt sich also die Frage, ob Hei-
degger eine einzige Artikulation der Erschlossenheit vorschwebt, oder doch zwei.
Das redende Artikulieren ist mit dem erschließenden Verstehen gleichursprünglich.
Das auslegende Artikulieren, welches die schon verstandene Welt auslegt, befindet
sich hingegen auf einer ontologisch niedrigeren Stufe als der Verstehenstufe, weswe-
gen es auf dem Verstehen beruht. Daraus folgt logischerweise, dass es hier um zwei
ontologisch verschiedene Artikulationen derselben Erschlossenheit geht.
Das Artikulieren der Auslegung hat sich als zweistufiges Entdecken herausgestellt,
durch die Formel „Etwas als Etwas“ erschöpfend ausgedrückt. In der Auslegung
werden erstens die Bewandtnisse (bzw. die Verweisungen) herausgelegt und zwei-
tens die Seienden in ihrem Um-zu auseinandergelegt. In diesen beiden „Prozessen“
besteht das auslegende Artikulieren, welches wiederum die schon verstandene Er-
schlossenheit der Welt (als Bewandtnissganzheit bzw. Verweisungszusammenhang)
voraussetzt. Die Erschlossenheit, erfährt man nun in der Redeanalyse, ist vor der
Auslegung schon artikuliert und gegliedert. Diese vorgängige Artikulation geschieht
eben in der Rede: „Verständlichkeit [der Welt und Existenz] ist auch schon vor der
zueignenden Auslegung immer schon gegliedert. Rede ist die Artikulation der Ver-
ständlichkeit. Sie liegt daher der Auslegung und Aussage schon zugrunde.“ (SuZ S.
161) Die Gleichursprünglichkeit der Rede mit dem Verstehen zeugt von der Tatsa-
che, die Erschlossenheit des gesamten In-der-Welt-seins21 sei immer schon, somit
19 „Verständlichkeit“ bezieht sich hier auf das, was im Verstehen erschlossen ist. Also Verständlich-keit der Welt und des Worum-willen. 20 Dabei kam nur das Verstehen der Welt in den Blick. 21 Man beachte, dass auch in diesen Ausführungen die Erschlossenheit der Welt einen Vorrang hat, obwohl man sich manchmal auf die gesamte Erschlossenheit des In-der-Welt-seins bezieht.
49
nicht erst auf dem Niveau der Auslegung, artikuliert und gegliedert. Eine Erschlos-
senheit, die nicht redend gegliedert und artikuliert ist, lässt sich deshalb in der Pers-
pektive von Sein und Zeit nicht vorstellen.
Nun, da das Verhältnis der Rede mit den daseinsmäßigen Seinscharakteren des Ver-
stehens und der Auslegung geklärt wurde, gilt es, den Weg zu schildern, der vom
Wesen der Sprache (d.h. von der Rede) zu den konkret ausgedrückten Worten führt.
Dabei wird übrigens das deutlicher, was in der Rede gegliedert wird, und welche
Form das Gegliederte einnimmt. Leider beschreibt Heidegger diesen Schritt ziemlich
knapp, so dass sein Gedanke etwas dunkel bleibt. Wegen dieser Knappheit lässt die
betreffende Textstelle mehrere Interpretationen, aber auch Missverständnisse, zu.
Daher die Entscheidung, diese Textstelle zunächst einmal vollständig wiederzuge-
ben:
„Das in der redenden Artikulation Gegliederte als solches nennen wir das Bedeutungsganze. Dieses kann in Bedeutungen aufgelöst werden. Bedeu-tungen sind als das Artikulierte des Artikulierbaren immer sinnhaft. Wenn die Rede, die Artikulation der Verständlichkeit des Da, ursprüngli-ches Existenzial der Erschlossenheit ist, diese aber primär konstituiert wird durch das In-der-Welt-sein, muß auch die Rede wesenhaft eine spe-zifisch weltliche Seinsart haben. Die befindliche Verständlichkeit des In-der-Weltseins spricht sich als Rede aus. Das Bedeutungsganze der Ver-ständlichkeit kommt zu Wort. Den Bedeutungen wachsen Worte zu. Nicht aber werden Wörterdinge mit Bedeutungen versehen.“ (SuZ S. 161)
Aus der Perspektive der Rede bietet sich die artikulierte und gegliederte Erschlos-
senheit als ein Bedeutungsganzes dar. Man sah, dass die Erschlossenheit der Welt
immer der formalen Struktur der Bedeutsamkeit zufolge geschieht. Da die Rede die
ganze Erschlossenheit artikuliert, ist die Bedeutsamkeit auch ein Bedeutungsganzes.
Der Sinn dieser Behauptung kann jetzt vielleicht dunkel sein. Das Verhältnis zwi-
schen Bedeutsamkeit und Rede wird später vertieft. Momentan sei nur darauf hinge-
wiesen, dass eine gewisse (nicht: totale) Entsprechung zwischen eben Bedeutsamkeit
und Bedeutungsganzem besteht: Im Rahmen der Weltlichkeitsanalyse repräsentiert
die Welt, nach der Struktur der Bedeutsamkeit, die Bedingung der Möglichkeit für
das Begegnis des Innerweltlichen in seinem Um-zu; gleicherweise ermöglicht das
Bedeutungsganze das Sprechen, Hören und Schweigen der Worte in ihren Bedeutun-
gen.
50
Aus dem Bedeutungsganzen heraus, und zwar nur aus ihm heraus, werden einzelne
Bedeutungen herausgelegt. Der Terminus „Bedeutung“ gibt die Wortbedeutung an.
Nicht also die Einheit eines wahrnehmbaren Zeichens (z.B. eines Tons) mit dem, was
das Zeichen selbst bedeutet. Denn die Analyse ist noch nicht zur ontischen Stufe ge-
langt. Das Wort und die Sprache sind noch nicht getroffen.
Auf der Grundlage des Erschlossenwerdens, oder besser der Herauslegung der Ein-
zelbedeutung, welche je schon einem erschlossenen und gegliederten Bedeutungs-
ganzen zugehört, begegnen endlich das Wort (Wortlaut), d.h. die Sprache. Das Be-
gegnen der bedeutenden Worte bzw. die Erscheinung der Sprache vollzieht sich im
Sprechen, Hören und Schweigen. Diese Möglichkeiten gehören zur Erschlossenheit
der Welt und Existenz. Genauer haben sie ihre Wurzeln in der Rede, die die genannte
Erschlossenheit artikuliert. Dies besagt, dass sich die Worte im Sprechen, Hören und
Schweigen und diese Möglichkeiten selbst ausschließlich vom jeweiligen gesamten
In-der-Welt-sein als sinnvoll erweisen können. Ihre Bedeutung stammt nämlich vom
erschlossenen und gegliederten Bedeutungsganzen ab. Anders ausgedrückt: Die
Worte existieren nicht vor ihrer Bedeutung, welche aus dem Ganzen der Bedeutun-
gen erschlossen wird. Die Sprache also liegt nicht außerhalb der Rede, sondern ist
ihre „Hinausgesprochenheit“ (SuZ S. 161), diese bestimmte Konkretion des Phäno-
mens.
Im Anschluss an diese Betrachtungen definiert Heidegger deutlicher die spezifischen
Seinsweisen der in der sichaussprechenden Rede vorkommenden Worte. Diese, als
innerweltliche Seiende22, können als Zuhandene begegnen oder als vorhandener Ge-
genstand des Studiums, z.B. der Sprachwissenschaft: „Diese Wortganzheit [...] wird
so als innerweltlich Seiendes wie ein Zuhandenes vorfindlich. Die Sprache kann zer-
schlagen werden in vorhandene Wörterdinge.“ (SuZ S. 161)
Dies ist das, was Heidegger hinsichtlich des Fundierungsverhältnisses zwischen Re-
de und Sprache argumentiert. Ein bemerkenswerter Unterschied, der zwischen der
Erörterung der Rede und der der Weltlichkeit besteht, springt sofort ins Auge. Zu-
nächst einmal werden der Untersuchung der Weltlichkeit gut vier Paragraphen ge-
widmet, was eine detailliertere Erklärung der fundamentalen Aspekten des Begriffes 22 Das nächste Kapitel versucht, zu erklären, inwiefern Worte als Innerweltliche betrachtet werden können.
51
ermöglicht. Indes der Unterschied, auf dem man aufmerksam machen will, ist ein
anderer, und zwar folgender: Die Frage nach dem Phänomen der Welt wird so he-
rausgearbeitet, dass der Ausgang von der ontischen Stufe genommen wird. Der erste
Schritt jener Analyse besteht nämlich darin, die möglichen Seinsmodi des innerwelt-
lichen Seienden zu beschreiben. Das heißt, zuallererst wird erläutert, dass sich ein
innerweltliches Begegnendes zumeist als Zeug um zu ... zeigt, seltener als vorhande-
nes Ding. Ausgehend von dieser Beobachtung wird später das Sein des Zeugs er-
gründet. Die ontologische Sphäre wird also erst zu einem späteren Zeitpunkt zugäng-
lich. Dies ermöglicht demjenigen, der sich mit der Lektüre des Werkes auseinander-
setzt, die anfänglichen Betrachtungen der Erforschung ohne Schwierigkeiten nach-
zuvollziehen. Denn es ist überhaupt nicht schwierig, den Unterschied zwischen der
Anwesenheitsweise eines Werkzeuges und der eines vorhandenen Gegenstandes zu
erfassen. Etwas schwieriger erscheint hingegen die Redeanalyse. Denn diese beginnt
gerade mit dem, was das zu erzielende Ergebnis der Freilegung des Phänomens des
In-der-Welt-seins ausmachen sollte. Der erste Schritt besteht nämlich darin, die spe-
zifische Rolle der Rede im Rahmen der Erschlossenheit des Da zu erklären, ohne
vorher dieses existenziale Moment des Seins des Daseins bezüglich seiner wesentli-
chen Aspekten vorgestellt zu haben. Erst danach wird klargelegt, wie sich die Rede
ausspricht, d.h. wie das Wesen der Sprache durch konkrete Worte ontisch erscheint.
Darüber hinaus trägt die Knappheit, mit der der Weg vom Phänomen zur Erschei-
nung dargestellt wird, zur Dunkelheit bei, welche den Begriff der Rede umgibt.
Um ein klareres Verständnis des Begriffes der Rede und der Sprache gewinnen zu
können, wird nun der umgekehrte Weg gegangen, der nämlich, der von den seienden
Worten zu ihren phänomenalen Wurzeln gelangt.
Genau wie bei der Beleuchtung des Seins des Innerweltlichen nimmt diese Rekons-
truktion von den nächsten Umgangsweisen mit den Worten ihren Ausgang. Im all-
täglichen In-der-Welt-sein hat man zunächst nicht mit vorhandenen Worten zu tun,
als wären diese primär isolierte bedeutende Zeichen, die dann ausgesprochen wer-
den, um etwas mitzuteilen. Dagegen begegnet die Sprache, wie übrigens auch andere
innerweltliche Seiende, als Zuhandenes. Das Sprechen, Hören und Schweigen sind in
der Tat zumeist, um zu warnen, befehlen, empfehlen, erinnern, beschreiben, bestellen
usw.. Der Gebrauch der Worte setzt stets, wenngleich implizit, voraus, dass die Wor-
52
te selbst „bedeutend“ sind. Mit dem Wort „Aufhören“ z.B. könnte man keinen Befehl
erteilen, wenn dieses akustische Zeichen bereits vor dem jeweiligen konkreten Aus-
sprechen keine Bedeutung hätte. Die Wortbedeutung, die nicht dasselbe wie das
Wort ist, muss gewissermaßen schon verfügbar (erschlossen, herausgelegt) sein, da-
mit der Laut als sinnvoll erscheint.
Die Vorstellung, die Wortbedeutung habe einen gewissen ontologischen Vorrang vor
dem Wort selbst, schafft die notwendigen Bedingungen, um die Sprachontologie der
Vorhandenheit überwinden zu können. Genauer will Heidegger die Sprachauffassung
ablehnen, nach der das Wort seine Bedeutung „in sich“ hat. Diese Auffassung über-
sieht nämlich den Tatbestand, dass jedes Zeichen (sei es sprachlich oder nicht) seinen
Sinn nur aus der Gesamtheit der „Situation“, des faktischen In-der-Welt-seins erhält:
„Weil Welt anwesend ist, weil sie erschlossen ist und in irgendeinem Sinne für das
Dasein begegnet, das in ihr ist, deshalb gibt es überhaupt so etwas wie Zeichendinge,
sind sie zuhanden.“ (GA 20 S. 285)
Die Ontologie der Vorhandenheit birgt dennoch auch eine andere Interpretation der
Sprache in sich, welche sich phänomenologisch nicht belegen lässt. Sie kann folgen-
dermaßen formuliert werden: Man verfügt zunächst über sprachliche Zeichen, Worte,
die aber noch keine Bedeutung haben. Im konkreten Existieren werden dann diesen
Zeichen Bedeutungen zugewiesen. Dieses Bild ist ähnlich wie die Sprachauffassung,
die auch Wittgenstein kritisiert, der zufolge Worte Täfelchen sind, die den Dingen
angeheftet werden, damit diese einen Name bekommen können23. Doch wie hervor-
gehoben wurde, ist nach Heidegger die Wortbedeutung vor dem Zeichen ontologisch
vorrangig, nicht umgekehrt. Die Bedeutung kommt somit nicht zu einem bereits ver-
fügbaren Wort:
„Es ist nicht so, dass zuerst Wortlaute da wären, und daß nun mit der Zeit diese Wortlaute mit Bedeutungen versehen würden, sondern umgekehrt, das Primäre ist das Sein in der Welt, d.h. das besorgende Verstehen und Sein im Bedeutungszusammenhang, welchen Bedeutungen nun erst vom Dasein selbst her Verlautbarung, Laute und lautliche Mitteilung zu-wächst. Nicht Laute bekommen Bedeutung, sondern umgekehrt die Be-deutungen werden in Lauten ausgedrückt.“ (GA 20 S. 287)
23 Vgl. PU §15.
53
Die Bedeutungen werden in Lauten ausgedrückt, weshalb die Idee, jene würden die-
sen entspringen, wiedersinnig wäre. Dieses Zitat gibt allerdings nicht nur Auskunft
über die Beziehung des Wortes mit der Bedeutung. Denn es wird auch klargemacht,
dass das Primäre nicht die einzelnen Bedeutungen sind. Primär ist vielmehr „das Sein
in der Welt“, welches nur eine andere, wenngleich sehr ähnliche, Formulierung des
schon bekannten Phänomens des In-der-Welt-seins ist. Das Sein in der Welt, das im
ersten Kapitel als ein Sichhalten bei den Bedeutsamkeitsbezügen bestimmt wurde,
wird jetzt als „Sein im Bedeutungszusammenhang“ beschrieben.
Was folglich das Primäre im Hinblick auf die Sprachanalyse ausmacht, ist weder das
konkrete Sprechen bzw. Hören bzw. Schweigen der Wortlaute, noch die Einzelbe-
deutung, die in der Verlautbarung ihren Ausdruck findet. Die ontologische Priorität
kommt vielmehr dem Bedeutungsganzen zu. Zunächst hat das Dasein mit diesem
Ganzen von erschlossenen Bedeutungen eine gewisse implizite Vertrautheit, so dass
keine Einzelbedeutung zunächst explizit herausgelegt wird. Nur auf der Grundlage
dieser Ganzheit von Bedeutungen können dann die einzelnen Wortbedeutungen er-
schlossen und durch die Sprache ontisch ausgesprochen werden.
Der Vorrang des Ganzen dem Einzelnen gegenüber ist dieser Arbeit nicht neu. An-
lässlich der Weltanalyse wurde nämlich schon mal bemerkt, dass die Verweisungs-
ganzheit früher als die einzelnen Verweisungen ist. Analog liegt die Bewandtniss-
ganzheit vor der Bewandtnis des einzelnen Seienden. Die Sprachanalyse verdeutlicht
nun, dass es nicht so ist, als könnten isolierte Wortbedeutungen da sein. Sie hängen
dagegen immer schon von einem bereits erschlossenen und gegliederten Bedeu-
tungsganzen ab.
Zur Zeit der Vorlesung, aus der das letzte Zitat genommen wurde, hatte Heidegger
noch nicht die These entwickelt, die Rede artikuliere und gliedere die Erschlossen-
heit des In-der-Welt-seins. Zwar hatte er die Ansicht deutlich formuliert, die Rede
beschränke sich nicht auf die verlautbarte Sprache, sondern sei die Erscheinung eines
Phänomens, das letztendlich in der Seinsverfassung des Daseins seinen Ort hat. Dun-
kel war jedoch noch die spezifische Rolle der Rede in dem In-Sein. In Sein und Zeit,
hat man schon gesagt, wird die Rede als Artikulation der Verständlichkeit der Welt
und der Existenz charakterisiert.
54
Diese Überlegungen hatten zwei wichtige Ziele. Erstens zielten sie darauf ab, die der
Rede eigene existenziale Funktion im Rahmen der Erschlossenheit des Da zu erläu-
tern. Dabei wurde gezeigt, dass die Rede, die mit Befindlichkeit und Verstehen
gleichursprünglich ist, die Erschlossenheit der Welt und der Existenz gliedert. Zwei-
tens sollte die Verbindung der Rede mit der Sprache klargelegt werden. Dieses Ver-
hältnis wurde zwei Untersuchungsrichtungen gemäß erhellt, und zwar zuerst vom
Ontologischen zum Ontischen und dann umgekehrt. Mit den wesentlichen Aspekten
der Sprachauffassung Heideggers muss man sich allerdings im dritten Kapitel noch
umfassender auseinandersetzen. Doch einstweilen sei nur auf zwei Punkte hingewie-
sen, welche die Untersuchung ganz ausdrücklich zum Vordergrund gebracht hat. Die
zwei Züge, welche die in Sein und Zeit entwickelte Sprachvorstellung kennzeichnen
und auf die nun aufmerksam gemacht werden muss, lauten folgendermaßen:
1) Das Wort muss von einem konkreten In-der-Welt-sein, d.h. einer konkreten er-
schlossenen Welt und Existenz, untersucht werden, in welchem es vorkommt. Es
darf folglich nicht ausgehend von seinem isolierten Ausgesprochen- bzw. Gehört-
werden untersucht werden.
2) Wort und Sprache sind stets seiend. Sie machen kein ursprüngliches Phänomen
aus, sondern sind immer in etwas anderem fundiert.
Die Hervorhebung dieser beiden Charaktere ist natürlich nicht zufällig, sondern hat
eine bestimmte Bedeutung. Bevor man zum nächsten Kapitel übergeht, das die Stel-
lung der Sprache in Sein und Zeit noch schärfer erforscht, soll nämlich mit Rückblick
auf die eben beschriebenen Punkte, die Sprachauffassung Wittgensteins kurz ge-
schildert werden. Dadurch will man eine andere Perspektive für das Studium der
Sprache vorstellen. Eine Perspektive, in der Sprache und Worte in ihrer Ursprüng-
lichkeit betrachtet werden. Heideggers Begriff der Rede kann durch den Vergleich
mit einer unterschiedlichen Anschauung von Sprache verdeutlicht werden.
55
2.3. Sprache bei Wittgenstein. Bilder aus den „Philosophischen Untersu-
chungen“
Im vorherigen Paragraphen wurden die bedeutendsten Charakteristiken der Interpre-
tation der Rede in Sein und Zeit pointiert. Dabei ergab sich, dass die Sprache nicht
als ursprünglich, sondern in der existenzialen Rede gegründet, betrachtet wird. Der
Charakter der Nichtursprünglichkeit der Sprache hebt sich noch deutlicher ab, indem
eine andere Vorstellung, welche umgekehrt Worte und Sprache als ursprünglich
sieht, dargestellt wird. Hierzu wird auf die Sprachdeutung Wittgensteins Bezug ge-
nommen, und zwar nicht auf die Theorie des Tractatus sondern auf die Überlegun-
gen aus den Philosophischen Untersuchungen.
Bevor man sich dem Inhalt des genannten Werks zuwendet, muss auf die folgende
Vorbemerkung aufmerksam gemacht werden, welche das Ziel dieses Paragraphen
deutlicher definieren soll. Die anwesende Darlegung zielt nicht darauf ab, den Ge-
danken Wittgensteins in seiner Gesamtheit gewissenhaft und präzise zu veranschau-
lichen. Auch nicht will sie darauf hinaus, eine originelle Interpretation des oben ge-
nannten Textes und im Allgemeinen des Wittgensteinschen Spätphilosophierens dar-
zubieten.
Im Blick stehen vielmehr lediglich einige Betrachtungen aus den Philosophischen
Untersuchungen. Die in ihnen enthaltenen Ideen sollen die Perspektive ausmachen,
von der her die Rede- und Sprachauffassung Heideggers kritisch geprüft werden
muss. Um die Metapher Wittgensteins zu verwenden: man will aus dem „Album“
(PU Vorwort) der Philosophischen Untersuchungen einige Bilder entnehmen, welche
im Hinblick auf die Hinterfragung der Darstellung Heideggers als Maßstab dienen
sollen.
Die Beschreibung der Bilder dieses Albums erfordert zunächst einmal, dass man auf
den Begriff des Sprachspiels eingeht, der fürs Nachvollziehen des Gedankens Witt-
gensteins zentral ist. Aus folgendem Zitat gewinnt man eine erste Vorstellung dieses
Begriffes: „Das Wort ‚Sprachspiel‘ soll hier hervorheben, daß das Sprechen der
Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform.“ (PU §23) Ohne eine
scharfe Definition von „Sprachspiel“ geben zu wollen, könnte man diesen Begriff als
eine Verwendungssituation der Sprache beschreiben, in welcher auch Tätigkeiten
56
vorkommen. Das Sprachspiel ist also eine Situation, in der Worte und Handlungen
„verwoben“ (PU §7) sind.
Warum ist dieser Begriff so relevant, um den Sinn der Reflexionen Wittgensteins be-
greifen zu können? Denn seiner Meinung zufolge muss das Funktionieren der Spra-
che an den konkreten Umständen ihrer Verwendung, eben an den Sprachspielen stu-
diert werden.
Um den angesprochenen Begriff klarer zu bestimmen, könnte man einen Aspekt, den
er mit den Praktiken gemeinsam hat, welche man generell „Spiel“ nennt, in den Vor-
dergrund stellen. Inwiefern weisen Sprachspiele mit Fußball, Schachspiel, Karten-
spielen usw. Analogien auf? Diese Tätigkeiten werden nicht nur einmal verrichtet.
Sie sind vielmehr Gepflogenheiten, die wiederholt werden. Freilich hat jedes Fuß-
ballspiel seine Eigentümlichkeiten; es ist jedoch zweifelfrei, dass jedes Spiel so statt-
findet, dass es bestimmten Regeln folgt. Mit „Regeln“ werden nicht bloß die Vorga-
ben des Reglements gemeint, sondern auch Angewohnheiten, welche nicht unter die
offiziellen Regeln fallen, indes in allen Spielen regelmäßig vollgezogen werden. Die
Aufwärmgymnastik der Spieler wird nicht von dem Reglement auferlegt. Ebenso ist
es nicht explizit vorgeschrieben, dass man nach dem Tor jubelt. Trotzdem sind beide
(und zahlreiche andere) Beispiele des Verhaltens bei einem Fußballspiel Regelmä-
ßigkeiten.
Der Vergleich mit den Spielen soll hervorheben, dass ähnlich wie diese auch die all-
täglichen Situationen des Sprachgebrauchs dadurch gekennzeichnet sind, dass in ih-
nen, wenngleich implizit, Regeln befolgt werden. Gerade im ersten Paragraphen, wie
übrigens auch in vielen anderen Textstellen, seines Werkes fordert Wittgenstein den
Leser dazu auf, eine gewöhnliche Lebenslage, d.h. ein gewöhnliches Sprachspiel, zu
betrachten. Eine Person muss auf dem Markt Obst einkaufen. Diese Szene ist selbst
eine Gewohnheit, die als solche durch Regelmäßigkeiten charakterisiert ist. Worin
bestehen dabei die zu befolgenden Regeln? Man stellt sich hinten an, wartet, bis man
an der Reihe ist; dann bestellt man das, was man will; man bekommt das Obst, zahlt
und geht. Obwohl diese Handlungen nicht von offiziellen Normen vorgeschrieben
sind, handelt man in diesem Sprachspiel und in ähnlichen auf diese Weise, und zwar
regelmäßig. Die eben skizzierte Situation stellt ein Beispiel von Sprachspiel dar. Ein
57
regelfolgendes Verhalten ist mit Worten verwoben. Denn, um zu bestellen, zahlen,
grüßen, kurz, in den Handlungen, bedient man sich gewöhnlich der Sprache.
Die Untersuchung der Sprache muss von der Beschreibung der Sprachspiele ihren
Ausgang nehmen, also nicht von der Analyse der aus den faktischen Gebrauchssitua-
tionen entnommenen Einzelsätze bzw. -Worten. In diesem Zusammenhang sei auch
zu bemerken, dass man auf Schwierigkeiten stößt, wenn man eine rein grammatische
Analyse auf die sprachlichen Äußerungen des oben geschilderten Sprachspiels an-
wenden will. Eine erste Schwierigkeit könnte sein, die Äußerungen in Sätzen und
Worten einzuteilen. Denn es ist nämlich nicht immer eindeutig, ob Grüße, Bestellun-
gen, Bitten usw. „zusammengelegte Worte“ oder Sätze sind. Analog wäre es schwie-
rig zu bestimmen, ob es bei dem Ausdruck: „Ich hätte gerne vier..., besser noch, ma-
chen wir fünf, Äpfel!“ um einen Satz oder mehrere Sätze geht.
Wenn die Sprache also von den Sprachspielen her erforscht werden muss, erweist es
sich als nutzbringender, denjenigen Ansatz zu verabschieden, der primär den Sinn
der Sätze und der Bedeutung der Worte betrachtet. An seiner Stelle soll die Sprach-
untersuchung zunächst auf die Gebrauchsweise der sprachlichen Äußerungen in ih-
ren praktischen Verwendungen achten.
Indem dieser neuen Vorgehensweise gefolgt wird, veranschauliche man sich das
Sprachspiel, das Wittgenstein im §2 betrachtet:
Die Sprache soll der Verständigung eines Bauenden A mit einem Gehil-fen B dienen. A führt einen Bau auf aus Bausteinen; es sind Würfel, Säu-len, Platten und Balken vorhanden. B hat ihm die Bausteine zuzureichen, und zwar nach der Reihe, wie A sie braucht. Zu dem Zweck bedienen sie sich einer Sprache, bestehend aus den Wörtern: „Würfel“, „Säule“, „Plat-te“, „Balken“. A ruft sie aus; -B bringt den Stein, den er gelernt hat, auf diesen Ruf zu bringen.
Will man die Bedeutung des Wortes „Platte“ in diesem Kontext erklären, sollte man
also sagen, sie sei seine Gebrauchsweise. Was ist aber unter der Wendung „Gebrauch
eines Wortes im Sprachspiel“ genau zu verstehen? Wie werden die Worte in diesem
Beispiel gebraucht? Diese Frage kann beantwortet werden, indem man auf die konk-
reten Folgen hinweist, die das Aussprechen der Worte selbst hat. Die Bedeutung zu
schildern, die das Wort „Platte“ hier hat, heißt folglich, die „praktischen Folgen“24 zu
24 Von Savigny, E., Sprachspiele und Lebensformen: Woher kommt die Bedeutung?, S. 16.
58
schildern, welche das Vorkommen dieses Ausdrucks mit sich bringt: Wenn A „Plat-
te“ ausruft, muss B die Platte bringen.
Der Gebrauch (die Bedeutung) dieser Äußerung wird aber auch von anderen Fakto-
ren bestimmt. Für den Wortgebrauch relevant sind nämlich in diesem Sprachspiel
nicht nur die feststellbaren Konsequenzen des Ausrufs, sondern auch die „Vorbedin-
gungen“25 dieser Tätigkeit. In der zitierten Textstelle spezifiziert Wittgenstein z.B.,
dass B Gehilfe von A ist. Außerdem wird klargemacht, dass A die Worte ausruft und
B dementsprechend reagieren muss. Diese Auskünfte sind Vorbedingungen, die nicht
als irrelevant betrachtet werden können. Wenn z.B. B „Platte“ sagt, folgt dieser Aus-
sage nicht dieselbe Reaktion, die vorhin erklärt wurde. Analog hätte dieses Wort
nicht die angegebene Bedeutung, wenn es von einer dritten Person (C) ausgespro-
chen würde. Diese „Züge“ wären dem Sprachspiel fremd und würden somit nicht zur
vereinbarten Reaktion führen.
Das Wort „Platte“ muss nach den Regeln ausgesagt werden, die in diesem Spiel ge-
lten. Das heißt, es muss von A ausgesprochen werden und dazu führen, dass B die
Platte bringt. Wenn es nach anderen Modalitäten vorkommen würde, hätte es nicht
dieselbe Wirkung, denn die Regeln würden nicht beobachtet. Sollte dasselbe Wort
darüber hinaus in anderen Situationen auftauchen, könnte es auch der Fall sein, dass
es nicht dieselbe Bedeutung hat oder sogar keine.
Das Studium dieses Sprachspiels führt zu einem bedeutenden Ergebnis. Es zeigt
nämlich, dass den Worten nicht immer dieselbe Bedeutung entspricht. Sie haben kei-
ne „feste Bedeutung“, welche ihre faktische Verwendung transzendieren würde. Was
den Äußerungen Sinn verleiht, ist dagegen ihr Gebrauchtwerden in den Sprachspie-
len, wo sie eben mit den Handlungen verflochten auftreten.
Dieses Ergebnis war in der Anfangsbehauptung, das Sprechen einer Sprache sei ein
Teil einer Tätigkeit oder einer Lebensform, noch implizit. Jetzt wird aber offenkun-
dig, dass der Sinn der sprachlichen Äußerungen mit den praktischen Konsequenzen
und den Vorbedingungen, welche die verschiedenen durch Regeln bestimmten
Sprachspielen charakterisieren, untrennbar verbunden ist.
25 Von Savigny, E., Sprachspiele und Lebensformen: Woher kommt die Bedeutung?, S. 19.
59
Dieser Gedanke bringt die Anschauung mit sich, die Bedeutung der Worte lasse sich
außerhalb der Sprachspiele nicht untersuchen. Dies eben deshalb, weil die Sprache
stets in konkreten Situationen angewendet wird. Auf diesem Punkt weist die Beo-
bachtung aus dem §525 hin:
„‚Nachdem er das gesagt hatte, verließ er sie wie am vorigen Tage.‘ - Verstehe ich diesen Satz? Verstehe ich ihn ebenso, wie ich es täte, wenn ich ihn im Verlaufe einer Mitteilung hörte? Steht er isoliert da, so würde ich sagen, ich weiß nicht, wovon er handelt. Ich wüßte aber doch, wie man diesen Satz etwa gebrauchen könnte; ich könnte selbst einen Zu-sammenhang für ihn erfinden.“ (PU §525)
Dass ein Satz Sinn haben kann, heißt, dass er in den Mitteilungen, Befehlen, Be-
schreibungen, Fragen, Bitten usw. eingesetzt werden kann. Er macht ein wesentli-
ches (nicht sekundäres) Moment dieser Handlungsweisen aus. Das „bloße und iso-
lierte Dastehen“ des Satzes stellt allerdings noch keinen Zug im Sprachspiel dar. An-
ders gesagt, verwahren Worte und Sätze keine Bedeutung in sich. Mit einer Äuße-
rung kann man zwar etwas mitteilen, befehlen, beschreiben, fragen, bitten; wesent-
lich dafür ist jedoch, dass die Sprache mit den Handlungen verwoben und in die
Sprachspiele eingebettet ist.
Hierbei, wie bei dem im ersten Kapitel angeführten Beispiel, tritt der Grundsatz, das
Ganze bestimme seine Teile, wieder in den Vordergrund. Das Wort zeigt sich in die-
sem Zusammenhang ähnlich wie der Hebel, der Bremshebel nur im Ganzen des Me-
chanismus ist, außerhalb dessen er aber etwas anderes oder sogar nichts sein könnte.
Ein sprachlicher Ausdruck kann nur dann eine Mitteilung ein Befehl usw. sein, d.h.
kann sich nur dann als sinnvoll erweisen, wenn er in das Ganze des Sprachspiels ein-
gebettet ist.
Die Einsicht, das Ganze bestimme den Teil, verweist auf die Sprachvorstellung Hei-
deggers. Es wurde erörtert, dass in Sein und Zeit die Sprache ein Zuhandenes ist. Als
solches erscheint sie stets im erschlossenen In-der-Welt-sein und lässt sich nur aus
der Perspektive des konkreten Existierens des Daseins in der Welt erforschen. Obg-
leich das Ziel dieser Arbeit nicht im Vergleich der ausgeführten Theorien besteht, ist
es wert, die Analogie zur Geltung zu bringen, die die betreffenden Werke aufweisen.
Wie nach den Philosophischen Untersuchungen die Äußerungen immer in den
60
Sprachspielen verwendet werden, gleicherweise erscheint die Sprache Heidegger zu-
folge stets in der Erschlossenheit des jeweiligen faktischen In-der-Welt-seins.
Damit ist nicht gesagt, dass der Begriff des In-der-Welt-seins in Sein und Zeit diesel-
be Rolle spielt, wie das Sprachspiel beim späteren Wittgenstein. Man beschränkt sich
vielmehr darauf, einen Aspekt festzustellen, der sowohl in der These Heideggers als
auch in der Theorie der Bedeutung als Gebrauch eines Wortes in der Sprache anwe-
send ist. Dieser Punkt ist insofern wichtig, als er mit der Herausarbeitung des nach-
stehenden Problems verbunden ist, die umgekehrt einen grundlegenden Unterschied
zwischen beiden Sprachvorstellungen erblicken lässt.
Das Sprechen einer Sprache ist ein Teil einer Tätigkeit. Die bisherige Ausführung hat
deutlichgemacht, dass diese Betrachtung die Idee in sich birgt, die sprachlichen Äu-
ßerungen, als Moment einer Praxis, würden sich ausgehend von der „übersichtlichen
Darstellung“ (PU §122) der Praxis selbst untersuchen lassen, von welcher sie ein Teil
sind. Die Betrachtung allerdings, von der die Darlegung ihren Ausgang genommen
hat, impliziert noch eine andere Erkenntnis, die nun erläutert werden muss. Vorste-
hend hat man sich mit der wesentlichen Rolle des Sprachspiels bei der Bestimmung
der Bedeutung des Wortes beschäftigt. Jetzt nimmt man einen Perspektivwechsel vor
und geht auf die Zentralität der sprachlichen Ausdrücke für das Sprachspiel ein.
Bevor man sich dem erwähnten Problem widmet, muss der Grund geklärt werden,
warum die Ausarbeitung der Frage nach der für die Sprachspiele determinierenden
Funktion der Sprache im Rahmen der vorliegenden Untersuchung von Belang ist.
Hierzu muss das noch zu erzielende Fazit der nachstehenden Überlegungen kurz an-
gedeutet werden. Im Folgenden sei aufzuweisen, dass die Sprachspiele von Worten
und, im Allgemeinen, von sprachlichen Ausdrücken von Anfang an geprägt sind. Die
Sprachspiele wären nicht so beschaffen, wenn die Sprache, die in ihnen vorkommt,
mit den praktischen Handlungen schon immer verwoben wäre. Insofern macht sie
kein „Nebenmoment“ aus, welches zu einer bereits geformten Situation hinzukommt.
Die Rolle der Sprache ist wesentlich, da sie mit dem Verhalten gleichursprünglich
das Sprachspiel bildet. Die Vorstellung der Ursprünglichkeit der Sprache soll dann
das Vergleichsobjekt repräsentieren, um die Meinung Heideggers, der Sprache würde
61
die Erschließungsfunktion des In-der-Welt-seins nicht beigemessen26, verständlicher
machen zu können.
Es wurde gesagt: Die Sprache und das Wort sind ursprüngliches Wesen. Es ist nicht
so, als würden sie bloß Vollzüge „beschreiben“, welche ohne Worte gleichermaßen
stattfinden würden. Um diese These aufzuzeigen, betrachte man noch eine andere
Textstelle aus dem Werk, deren Thema das Erlernen der Tätigkeit (des Sprachspiels)
ist, die schon beschrieben wurde. Der Gehilfe B muss die folgende Aufgabe erlernen:
Jedesmal, wenn er A, „Würfel“, „Säule“, „Platte“, „Balken“ ausrufen hört, muss er
die Steine bringen, die diese Worte bezeichnen. Man nehme an, wie Wittgenstein es
selbst im §6 macht, dass B ein Kind ist, das dieses Spiel noch nicht beherrscht. Er
weiß auch nicht, welchen Stein „Platte“ bezeichnet, welchen „Würfel“ usw.. Was in
dieser Szene von Interesse ist, ist zu verstehen, ob zum Verfahren des Erlernens der
Bedeutung dieser Worte, d.h. zum Verfahren des Erlernens der richtigen Reaktion
auf den Ausruf, die Worte (Wortlaute) selbst beitragen. Anders ausgedrückt: Be-
stimmen „Platte“, „Würfel“, „Säule“ usw. das Erlernen des Sprachspiels oder werden
sie Teil von ihm a posteriori?
Man achte darauf, wie Wittgenstein dieses Verfahren beschreibt:
Die Kinder werden dazu erzogen, diese Tätigkeiten zu verrichten, diese Wörter dabei zu gebrauchen, und so auf die Worte des Anderen zu rea-gieren. Ein wichtiger Teil der Abrichtung wird darin bestehen, daß der Lehrende auf die Gegenstände weist, die Aufmerksamkeit des Kindes auf sie lenkt, und dabei ein Wort ausspricht; z. B. das Wort „Platte“ beim Vorzeigen dieser Form.
In dieser Szene wird betont, dass es in dem Erlernungsverfahren eines Sprachspiels
zwei wichtige Aspekte gibt. Einerseits ist es wesentlich, zu erlernen, die Worte so zu
gebrauchen bzw. zu verstehen. Andererseits müssen die Kinder erlernen, die Tätig-
keiten so zu verrichten bzw. auf die Worte so zu reagieren. Das hinweisende Lehren
macht ein wichtiges Moment des Erlernens aus. Allein kann es aber nicht dafür aus-
reichen, dass die Kinder das Sprachspiel erlernen. Deswegen merkt Wittgenstein an:
Versteht nicht der den Ruf „Platte!“, der so und so nach ihm handelt? - Aber dies half wohl das hinweisende Lehren herbeiführen; aber doch nur zusammen mit einem bestimmten Unterricht. Mit einem anderen Unter-
26 Dieser Frage widmet man sich im dritten Kapitel.
62
richt hätte dasselbe hinweisende Lehren dieser Wörter ein ganz anderes Verständnis bewirkt.
Das Lernen des Wortes ist nur ein Teil der Abrichtung. Damit es im Sprachspiel
richtig angewendet und verstanden wird, muss die Erziehung auch die Vorzeigung
des Unterrichts (d.h. des praktischen Verhaltens) mit einschließen. Wittgenstein
macht in dieser Passage auf die Gleichursprünglichkeit von Worten und regelfolgen-
dem Verfahren aufmerksam, um die These zu bestreiten, die Bedeutung der Worten
komme nur aus dem hinweisenden Lehren her. Die Art und Weise, wie ein sprachli-
cher Ausdruck verwendet wird, kann nicht ausschließlich aus dem Lernen des reinen
Wortlauts gelernt werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit will man zwar das
gleichursprüngliche Verhältnis von Sprache und Vollzug hervorheben, aber in der
Absicht, die These zu bezweifeln, die Worte würden keine Funktion in der Erlernung
ihrer Bedeutung haben. Um zu dem Beispiel zurückzukommen: Die Art und Weise,
wie das Wort „Platte“ gebraucht werden muss, kann nicht definiert oder gelehrt wer-
den, indem man vom Aussprechen des Wortes selbst absieht.
Davor ginge es darum, zu zeigen, dass das Wort seine Gebrauchsweise in den
Sprachspielen nicht in sich enthält. Nun ist zu erklären, dass der Unterricht allein
nicht die Wortbedeutungen lehren kann. Wenn den Kindern lediglich ein praktischer
Unterricht gezeigt würde, würden sie wahrscheinlich erlernen, dem Unterricht gemäß
zu handeln. In diesem neuen Sprachspiel (es geht um ein anderes Sprachspiel als das
beschriebene, genauer geht es um ein nichtsprachliches Spiel) spielt aber der Ruf
„Platte“ gar keine Rolle. Denn es ist nicht so, dass die Kinder lernen, so und so zu
reagieren und erst danach das Wort lernen. Der Ruf ist ein wesentliches Moment des
Sprachspiels und folglich auch der Abrichtung. Das impliziert, dass das bloße Han-
deln allein nicht die notwendigen Bedingungen der Möglichkeit für die Verwendung
der Sprache schaffen kann.
Wenn dieser Gedanke nachvollzogen wurde, dann leuchtet es ein, dass das Erlernen
(aber selbst das Entstehen) des ganzen Sprachspiels im Wort, genauso wie im Unter-
richt, einen fundamentalen Teil hat. Dies bringt die folgende Einsicht mit sich: Die
Situationen, in denen man lebt (d.h. in denen man spricht und handelt), sind nicht nur
vom Vollzug geprägt, sondern gleichursprünglich von der Sprache. Die Sprache wird
also nicht einem schon „fertigen“ Sprachspiel nachträglich hinzugefügt. Worte und
63
Handlungen werden nur in der Sprachuntersuchung, d.h. wenn man philosophiert,
getrennt gedacht. Denn das Sprachspiel macht eine ursprüngliche Einheit aus, in der
Worte und Tätigkeiten verwoben sind.
Um die Gleichursprünglichkeit von Worten und Verhalten noch besser zu erläutern,
soll ein anderes Bild aus den Philosophischen Untersuchungen betrachtet werden.
Auch in diesem Fall wird zuerst gezeigt, wie man mit der Sprache operiert und da-
nach wie Wort und Bedeutung bzw. Satz und Sinn sich miteinander verhalten. Der
letzte Schritt besteht hingegen darin, aufzuzeigen, dass die Situationen der Sprach-
verwendung durch die ursprüngliche Mit-Anwesenheit von Sprache und Vollzug
kennzeichnet sind. Hierzu bezieht man sich auf die folgende Textstelle:
„Ich möchte sagen: du siehst es für viel zu selbstverständlich an, daß man Einem etwas mitteilen kann. Das heißt: Wir sind so sehr an die Mitteilung durch Sprechen, im Gespräch, gewöhnt, daß es uns scheint, als läge der ganze Witz der Mitteilung darin, daß ein Andrer den Sinn meiner Worte - etwas Seelisches ˗ auffaßt, sozusagen in seinen Geist aufnimmt. Wenn er dann auch noch etwas damit anfängt, so gehört das nicht mehr zum un-mittelbaren Zweck der Sprache. Man möchte sagen ‚Die Mitteilung be-wirkt, daß er weiß, daß ich Schmerzen habe; sie bewirkt dies geistige Phänomen; alles Andere ist der Mitteilung unwesentlich.‘“ (PU §363)
Wie operiert man mit der Sprache? Wie gebraucht man z.B. die Äußerung „Ich habe
Schmerzen“? Dieser Satz hat selbstverständlich Sinn. Dies besagt aber nichts ande-
res, als dass er verwendet wird. Und zwar nicht nur in einem Sprachspiel, sondern in
mehreren und einander unterschiedlichen; und darüber hinaus: Man bedient sich die-
ses Ausdrucks nicht immer zu demselben Zweck. Wollte man den Satz betrachten,
indem man von seinem jeweiligen Zweck absieht, dann würde man den Fehler ma-
chen, zu denken, dass die Äußerung nur dazu dient, dass der Andere „den Sinn mei-
ner Worte ̠ etwas Seelisches ˗ auffasst.“ (PU §363) Dagegen ist das Relevante das,
was mein Gesprächspartner mit diesem Satz anfängt. Der Sinn meiner Äußerung, die
Art und Weise, wie man sich des Satzes bedient, ist mit den praktischen Folgen bzw.
mit der Reaktion der Anderen eng verbunden. Außerdem ist die Äußerung „Ich habe
Schmerzen“ nicht mit einer einzigen Art von Reaktion verbunden. Welche konkrete
Konsequenzen dieser Satz hat, hängt mit dem Sprachspiel, in dem er vorkommt, zu-
sammen. Und dies heißt wiederum: die Verknüpfung eines Satzes mit einem Sinn ist
nur innerhalb der Sprachspiele möglich.
64
Es gilt, eine Zwischenbemerkung zu machen, um festzustellen, dass auch nach Hei-
degger eine Äußerung nicht im reinen Weiterleiten von Informationen besteht: „Mit-
teilung ist nie so etwas wie ein Transport von Erlebnissen, zum Beispiel Meinungen
und Wünschen aus dem Inneren des einen Subjekts in das Innere des anderen.“ (SuZ
S. 162) Würde man Mitteilung derart verstehen, dann würde man sie als Vorhande-
nes begreifen. Dagegen setzt jede Mitteilung die vorgängige Erschlossenheit der
Welt und des faktischen Existierens voraus. Sätze und Worte sind nur insofern sinn-
voll, als sie in die Erschlossenheit des In-der-Welt-seins eingebettet sind.
Nachdem diskutiert wurde, dass Sinn und Sätze nur im Sprachspiel Einheit finden,
gehe man jetzt auf das Problem, wie die Assoziation der Äußerungen mit ihrer Be-
deutung entsteht. Darüber äußert sich Wittgenstein folgendermaßen:
„Wie wird die Verbindung des Namens mit dem Benannten hergestellt? Die Frage ist die gleiche wie die: wie lernt ein Mensch die Bedeutung der Namen von Empfindungen? Z.B. des Wortes ‚Schmerz‘. Dies ist eine Möglichkeit: Es werden Worte mit dem ursprünglichen, natürlichen, Ausdruck der Empfindung verbunden und an dessen Stelle gesetzt. Ein Kind hat sich verletzt, es schreit; und nun sprechen ihm die Erwachsenen zu und bringen ihm Ausrufe und später Sätze bei. Sie lehren das Kind ein neues Schmerzbenehmen. ‚So sagst du also, daß das Wort ‚Schmerz‘ ei-gentlich das Schreien bedeute?‘ - Im Gegenteil; der Wortausdruck des Schmerzes ersetzt das Schreien und beschreibt es nicht.“ (PU §244)
Ähnlich wie Heidegger, fordert Wittgenstein den Leser dazu auf, weder den Schmerz
noch das Wort „Schmerz“ für isolierte Vorhandene zu halten. Dagegen verschmelzen
sie sich stets (nicht also gelegentlich) mit einem bestimmten Benehmen. Das Kind,
das noch keine Sprache erworben hat, druckt seinen Schmerz aus, indem es schreit.
Sein Schmerzbenehmen besteht eben im Weinen und Schreien. Langsam lehren ihm
die Eltern bestimmte Sätze, in ähnlichen Situationen wie diesen zu äußern, z.B. „Ich
habe mir wehgetan“. Verwoben mit dem Lehren der Worte ist aber auch das Lehren
bestimmter Vollzüge. Die Eltern bringen dem Kind also neue Worte und parallel ein
neues Schmerzbenehmen bei. Keines der beiden Momente hat vor dem anderen Vor-
rang, genauso wie im vorstehenden Beispiel sich das Erlernen des Rufes „Platte“
gleichzeitig mit dem Erlernen der richtigen Reaktion vollzieht. Dies ist der Grund,
warum es in demselben Paragraphen heißt: „der Wortausdruck des Schmerzes ersetzt
das Schreien und beschreibt es nicht.“ (PU §244) Würde der sprachliche Ausdruck
einfach das Schreien beschreiben, hieße es, dass die neuen Worte kein neues Verhal-
65
ten mit sich bringen. Mit den Worten entsteht vielmehr ein neues Benehmen. Man
muss mithin die Vorstellung ablehnen, man lerne ein Wort unabhängig vom Verhal-
ten, das mit dem Wort selbst (in den Sprachspielen) assoziiert ist. Gleichermaßen
muss die Idee zurückwiesen werden, man lerne die Art und Weise, wie die Äußerun-
gen gebraucht werden müssen, d.h. ihre Bedeutung, vor (und abhängig von) der Er-
lernung der Wortlaute27.
Das Sprachspiel des Schmerzbenehmens bzw. -ausdrückens besteht aus der Einheit
von Sprache und Verhalten, die als zwei verwobene und gleichursprüngliche Teile
des Ganzen betrachtet werden müssen. Dies soll erneut die Ansicht hervorheben, die
Situation sei nicht auch vor der Sprache aufgeschlossen, was gleichbedeutend mit
Folgendem ist: Das Sprachspiel kann ohne Hilfe der Sprache weder gelehrt bzw. er-
lernt werden noch überhaupt entstehen.
Bei der Beschreibung der Bilder aus den Philosophischen Untersuchungen hat man
von der Betrachtung aus dem §23, das Sprechen einer Sprache sei ein Teil einer Tä-
tigkeit, ihren Ausgang genommen. Man hat gezeigt, dass diese Betrachtung drei für
diese Arbeit relevante Punkte hervortreten lässt, die folgendermaßen schematisch
aufgelistet werden:
1) Wörter und Sätze, als Äußerungen verstanden, haben ihre Bedeutung nur inner-
halb der Sprachspiele. Außerhalb der Sprachspiele liegt kein Sinn.
2) Im Aufschließen einer Wortbedeutung (etwa im Lernen der Bedeutung eines Wor-
tes) in einem Sprachspiel spielt das Aussprechen des Wortlauts eine wesentliche Rol-
le. Die Anwesenheit der Sprache ist dabei ein zentrales Moment. Ebenso zentral ist
die Durchführung der praktischen Handlungen.
3) Das Sprachspiel existiert nicht vor den Worten (im Sinne von Wortlauten), die in
ihm auftreten. Es ist vielmehr schon immer durch die Anwesenheit der Sprache cha-
rakterisiert.
Der erste Punkt war bereits von Heidegger bemerkt worden, indem dieser die Mei-
nung vertritt, das Wort (Wortlaut) und Sprache (stimmliche Verlautbarung) würden
ihren Sinn aus dem In-der-Welt-sein bekommen. Der zweite und der dritte Punkt
weisen hingegen auf den ursprünglichen Charakter der Sprache hin. In dieser Hin- 27 Diese zweite zurückzuweisende These, wird von Heidegger vertreten, was im nächsten Kapitel noch zu zeigen ist.
66
sicht distanziert sich die Sprachvorstellung Wittgensteins von der von Sein und Zeit.
Die Nichtursprünglichkeit der Sprache und Worte soll anhand von diesen zwei Punk-
ten (den zweiten und dritten der oben genannten) vertieft werden.
67
3. Sprache und Erschließungsfunktion
In diesem Kapitel beschäftigt man sich mit vier Fragen, welche nicht voneinander
unabhängig sind. Zunächst einmal muss, das Verhältnis zwischen Wort und Sprache
in Sein und Zeit beleuchtet werden. Dies soll zu einer besseren Klarheit des nichturs-
prünglichen Charakters der Sprache beitragen. Diesem Problem ist der erste Parag-
raph gewidmet.
An zweiter Stelle muss noch die Rolle der Rede schärfer definiert und die Gleichurs-
prünglichkeit dieses Existenzials mit dem Verstehen (d.h. der Erschlossenheit der
Bedeutsamkeit und Existenzmöglichkeit) aufgehellt werden. Hierzu muss man von
der Beschreibung der ontischen Tatsachen, welche letztendlich auf die genannten on-
tologischen Charaktere zurückzuführen sind, den Ausgang nehmen. Die ontologi-
schen Strukturen dienen nämlich dazu, ontische Begebenheiten zu erklären. Warum
also ist die Herausarbeitung der existenzialen Rede notwendig? Welche ontische Tat-
sachen bzw. Seiende können durch sie ontologisch transparent gemacht werden?
Danach muss man klarstellen, welche Folge auf der ontologischen Stufe das be-
schriebene Verhältnis des Wortes mit seiner Bedeutung hat. In diesem Zusammen-
hang kann man auch auf die Frage eingehen, was es bedeutet, dass der Sprache keine
Erschließungsfunktion zukommt.
Zum Schluss ist zu verstehen, welche fundamentale Prämisse Heidegger dazu führt,
Sprache als nichtursprüngliche Instanz darzustellen. Dabei enthüllt sich die Interpre-
tation Lafonts28 als hilfreich. Die drei letztgenannten Fragen werden im zweiten Pa-
ragraphen herausgearbeitet.
28 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers.
68
3.1. Wort und Bedeutung
Im letzten Kapitel wurden zwei teilweise ähnliche teilweise unterschiedliche Sprach-
vorstellungen dargelegt. Die Analogie besteht darin, dass beide Theorie das Wort
ausgehend von seiner konkreten Verwendungssituation untersuchen. Nun zielt man
darauf ab, zu verstehen, inwiefern die Sprache nach Heidegger nicht ursprünglich ist.
Hierzu muss man zuerst die Grundcharaktere seiner Auffassung kurz wiederaufneh-
men.
Das Begegnis der Worte ist nicht unmittelbar. Das konkrete Sprechen, Hören und
Schweigen der Äußerung setzt voraus, dass die stimmlichen Zeichen schon bedeu-
tend sind. Die Bedeutungen müssen folglich irgendwie schon erschlossen sein, und
zwar nur aus dem erschlossenen und gegliederten Bedeutungsganzen.
Diese Beschreibung erinnert gewissermaßen an die Analyse des besorgenden Um-
gangs mit dem innerweltlichen Seienden. Der Hammer ist vom Besorgen aufgrund
einer schon erschlossenen Verweisung entdeckt. Das Herauslegen der Verweisung
geschieht nur aus der Erschlossenheit der Verweisungsmannigfaltigkeit heraus. Aus
der Verstehenanalyse wird klar, dass
1) die Mannigfaltigkeit der Bedeutsamkeitsverweisungen im Verstehen erschlossen
ist
2) das Herauslegen der Einzelverweisungen in der Auslegung vonstattengeht und
3) dieselbe Auslegung das Innerweltliche als Zuhandenes begegnen lässt.
In der eben beschriebenen Analyse steht man vor einer dreistufigen Gliederung, an-
hand derer auch die ontologische Verfassung des Phänomens der Rede zu erhellen
möglich ist. Anhand von der Struktur der Explikation des Verstehens, wird also jetzt
versucht, die Struktur der Redeanalyse klarzustellen29.
1) Ontologisch primär ist das in der Rede gegliederte Bedeutungsganze. Rede und
Verstehen spielen in der Erschlossenheit des Da unterschiedliche Rollen. Als gleich-
ursprünglich aber gehören sie zu derselben ontologischen Stufe.
29 Die folgende Behandlung stützt sich auf die Interpretation des §34 von Sein und Zeit durch von Herrmann (vgl. von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 92 ff.), der in der Argumentation Heideggers drei ontologische Stufen erkennt: Rede (bzw. Bedeutungs-ganze), Bedeutung und Wort (bzw. Sprache). Es sei aber festgestellt, dass von Herrmann nie eine Ent-sprechung der Redeanalyse mit der Freilegung des Phänomens des Verstehens andeutet.
69
2) Das zweite Moment der gezeigten Gliederung besteht im Herauslegen der Einzel-
verweisungen. Nach der vorliegenden Interpretation entspricht dieses Moment dem
Abheben der Einzelbedeutungen, was Heidegger folgendermaßen beschreibt: „Die-
ses [das Bedeutungsganze] kann in Bedeutungen aufgelöst werden“ (SuZ S. 161)
3) Aufgrund der herausgelegten Verweisung begegnet zum Schluss das Innerweltli-
che. Gleichermaßen wird, nachdem die Einzelbedeutung zur Abhebung gebracht
wurde, der Wortlaut ausgesprochen bzw. verstanden: „Den Bedeutungen wachsen
Worte zu.“ (SuZ S. 161)
Man merke noch an, dass sich die beiden letzten Momente (d.h. Herauslegen der
Einzelverweisungen und Begegnis des Seienden) in der Auslegung vollziehen.
Was den ersten Punkt betrifft, bestehen keine Einwände, denn die Entsprechung des
ontologischen Status von Rede und Verstehen bzw. Bedeutungsganzem und Bedeut-
samkeit erscheint ziemlich evident. Viele Zweifel entstehen jedoch bei der Parallele
zwischen den zwei Aufgaben der Auslegung einerseits und den beiden Sätzen ande-
rerseits („Dieses [das Bedeutungsganze] kann in Bedeutungen aufgelöst werden“ und
„Den Bedeutungen wachsen Worte zu“), die den Begriff der Bedeutung und des
Wortes einfügen. Ist diese Parallele gerechtfertigt, obwohl Heidegger in den zitierten
Passagen keinen Bezug auf die Auslegung nimmt?
Für die Beantwortung dieser Frage kann sich eine Beobachtung aus der Bedeutsam-
keitsanalyse als nützlich erweisen:
„Die Bedeutsamkeit selbst aber, mit der das Dasein je schon vertraut ist, birgt in sich die ontologische Bedingung der Möglichkeit dafür, daß das verstehende Dasein als auslegendes [Hervorhebung von F. C.] so etwas wie „Bedeutungen“ erschließen kann, die ihrerseits wieder das mögliche Sein von Wort und Sprache fundieren.“ (SuZ S. 87)
Hier wird explizit klargemacht, dass das Dasein insofern Bedeutungen erschließen
kann (man achte darauf, dass es sich hier um die Wortbedeutungen handelt), als es
auslegend ist30. Anhand von von Herrmann lässt sich also sagen, dass die Bedeutun-
gen auf derselben ontologischen Stufe wie die Verweisungen liegen, da eben beide in
der Auslegung erschlossen werden: „Einzelbedeutungen [stehen] im verstehenden
Blick, wenn die auslegende Gliederung aus der [...] Bedeutungsganzheit diese und 30 Diese Textstelle ist auch deshalb von Belang, weil sie Auskunft über eine noch zu erhellende Ver-bindung zwischen Erschlossenheit der Bedeutsamkeit und Wortbedeutungen gibt. Diese Verbindung soll Thema des nächsten Paragraphen sein.
70
jene Bedeutung herauslegt [...]. Die Bedeutungen, die die verstehende Auslegung he-
rauslegt, [...] gehören hinein in die [...] gegliederte Bedeutungsganzheit des ganzen
In-der-Welt-seins31.“ Als weiterer Beleg für diese Lesart könnte der folgende Auszug
aus der Marburger Vorlesung des Sommersemesters 1925 angeführt werden: „Die
Rede hat [...] eine ausgezeichnete Funktion: Sie legt aus, d.h. sie bringt die Verwei-
sungsbezüge aus der Bedeutsamkeit in der Mitteilung zur Abhebung.“ (GA 20 S.
370)
Die Wortbedeutung, als in der Auslegung herausgelegt, ist auf demselben ontologi-
schen Niveau wie die Verweisung zu denken. Wie kommt aber die erschlossen-
herausgelegte Bedeutung zum Wort? Was heißt der Satz „den Bedeutungen wachsen
Worte zu“? (SuZ S. 161) Auch für die Beantwortung dieser Frage stellt es sich als
hilfreich heraus, die bereits zitierte Passage aus der Bedeutsamkeitsanalyse in den
Blick zu nehmen, und zwar wo die Rede von den Bedeutungen ist, „die ihrerseits
wieder das mögliche Sein von Wort und Sprache fundieren.“ (SuZ S. 87)
Die in der Auslegung herausgelegten Bedeutungen würden Worte und Sprache (d.h.
die konkrete stimmliche Verlautbarung) fundieren. Dies besagt, dass die Wortlaute
nicht ursprünglich sind, sondern auf etwas beruhen. Im konkreten Existieren in der
Welt erschließt das Dasein die Bedeutungen, die dann in Lauten ausgedrückt werden.
Wenn die Bedeutungen nicht schon erschlossen wären, wären die sprachlichen Äuße-
rungen sinnlos. Aus dieser Perspektive enthüllen sich die Bedeutungen als daseins-
mäßige Charaktere, während Worte und Sprache als Zuhandene zu fassen sind.
Warum wurde die Relation zwischen Bedeutung und Wort so ausführlich erläutert?
Aus dieser Illustration ergibt sich ein „Fundierungsverhältnis“32, das, wie Lafont be-
obachtet, ziemlich fragwürdig erscheint. Es leuchtet nämlich nicht ein, inwiefern das
Dasein Bedeutungen herauslegen würde, welche danach in Tönen ausgedrückt wür-
den. Beim Studium des besorgenden Umgangs mit dem Zeug entstehen keine Un-
klarheiten hinsichtlich dessen, was es bedeutet, dass im Besorgen die Verweisung er-
schlossen werden. Denn sie heißt nichts anderes, als dass sich das Dasein immer
schon „an einem Um-zu verwiesen [hat].“ (SuZ S. 386) Das Dasein existiert nie als
31 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 128-9 32 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers. S. 102 ff..
71
Vorhandenes. In seinem Alltagsumgang verweist er sich vielmehr an eine Möglich-
keit, d.h. an ein Um-zu-schreiben, -kaufen,- arbeiten, -essen usw.. Es erschließt die
Um-zu Verweisungen, auf die hin Seiende begegnen.
Indem man diese Vorstellung auf die Sprachanalyse überträgt, könnte man Folgendes
bemerken: Jedes Mitteilen, Befehlen, Bitten, Beschreiben usw. ist Erschließen von
Bedeutungen, die dann sprachlich ausgedrückt werden. Der seienden Verlautbarung
bedient man sich so, als wären die Wortlaute Zuhandene. Diesbezüglich äußert sich
Heidegger wie folgt: „Diese Wortganzheit [...] wird so als innerweltlich Seiendes wie
ein Zuhandenes vorfindlich.“ (SuZ S. 161)
Von höchster Wichtigkeit ist es nun, eine mögliche Interpretation des eben erwähn-
ten Gedankens abzulehnen, welche man an dieser Stelle machen könnte. Der Aus-
druck der Bedeutungen ist keineswegs Ausdruck innerer Vorgänge. Die Deutung der
Relation der Worte mit ihren Bedeutungen muss ständig präsent haben, dass diese
stets dem ganzen In-der-Welt-sein zugehören, d.h. dem konkreten Existieren in einer
Welt mit den Anderen. Insofern sind die Bedeutungen, wie übrigens auch die Welt,
immer interexistentiell.
Nach dieser Zwischenbemerkung gehe man auf die Frage nach dem angedeuteten
Fundierungsverhältnis zurück. Beschreibt diese Sprachauffassung korrekt die Er-
scheinung der Sprache? Einerseits ermöglicht sie die Konzeption zu überwinden, die
Sprachuntersuchung müsse von den vorhandenen Worten bzw. Sätzen ihren Ausgang
nehmen, und zwar indem man von den konkreten Verwendungssituationen der Spra-
che absieht. Andererseits lässt sie die Frage offen, ob die Bedeutung „früher“ als die
Wortlaute und von diesen unabhängig erschlossen werden könnten. Dass Heidegger
diese Vorstellung vorschwebt, bestätigt auch von Herrmann:
„Die Bedeutungen sind früher als die Worte, als der Wortlaut, als das wortmäßige Lautzeichen. Die Bedeutungen sind aber insofern früher, als sie primär zu einer Bedeutungsganzheit gehören, die als solche [...] ge-gliedert und als solche erschlossen ist. Als so erschlossen ist die Bedeu-tungsganzheit und sind die Bedeutungen nicht schon worthafte Bedeu-tungen, nicht schon Bedeutungen des seienden Wortes. Denn der Wort-laut ist das Seiende an der Sprache, ist die Weise, wie die Sprache seiend ist.“ 33
33 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 130.
72
Damit deutet Heidegger nicht auf die Möglichkeit hin, ohne Worte mitzuteilen. Be-
deutung und sprachliches Zeichen sind nur ontologisch getrennt. Ontisch, d.h. im
konkreten Erscheinen, zeigen sich immer bedeutende Worte. Nun, da erklärt wurde,
dass das pointierte Verhältnis ontologisch zu verstehen ist, erhebt sich die folgende
Frage: Kann eine Bedeutung unabhängig vom Wort, welches sie ausdrückt, erschlos-
sen werden? Obwohl Heidegger kein Beispiel vom Erschließen von Bedeutungen an-
führt, lässt sich aus den bisherigen Erwägungen heraus vermuten, dass er diese Frage
bejahen würde34.
So muss man jetzt aufzeigen, dass Heidegger mit dem geschilderten Fundierungsver-
hältnis irregeht. Oder, anders formuliert, man visiert an, zur Geltung zu bringen, dass
die These, die Bedeutungen könnten sich unabhängig von der Sprache bilden, un-
haltbar ist.
Doch diesem Geschäft ist die Untersuchung schon im letzten Kapitel nachgekom-
men. Die Beschreibung der Bilder aus den Philosophischen Untersuchungen hatte
nämlich zwei Grundziele. Eines der beiden bestand gerade darin, die Gleichurs-
prünglichkeit von Sprache und praktischem Handeln bei der Untersuchung der
Wortbedeutung klarzulegen35. Die Darlegung hat sich auf Reflexionen konzentriert,
welche das Erlernen neuer Äußerungen und neuen Benehmens zum Thema haben. In
diesen Situationen enthüllt sich nämlich als ausgesprochen evident, dass die sprachli-
chen Ausdrücke keinen nebensächlichen Aspekt ausmachen, sondern einen unerläss-
lichen Teil der Abrichtung. Damit der Gehilfe die Art und Weise lernt, wie das Wort
„Platte“ gebraucht, aber auch verstanden werden muss, muss man ihm sowohl die In-
struktion vorzeigen, wie er handeln muss, als auch das Stimmzeichnen mitteilen
bzw. lehren. Beide Momente sind wesentlich. Keines kann die Funktion des anderen
übernehmen.
Heidegger scheint hingegen dem Moment des Benehmens größeren Wert beizumes-
sen, indem er dem konkreten Existieren in der Welt den Vorrang einräumt. Dadurch
erkennt er dem Existieren die Fähigkeit zu, Wortbedeutungen vor dem Begegnenlas-
sen der Sprache zu erschließen.
34 Diesbezüglich nimmt von Herrmann keine Position ein. Er beschränkt sich vielmehr darauf, die on-tologische Unterscheidung festzustellen. 35 Vgl. den zweiten Punkt auf S. 65 des vorliegenden Texts.
73
Die Nichtvertretbarkeit dieser Sprachauffassung, die sich im Fundierungsverhältnis
ausdrückt, erkennt Heidegger selbst viele Jahre nach der Veröffentlichung seines
Hauptwerkes an. In einer Randbemerkung, die er in seinen Exemplar von Sein und
Zeit gesetzt hat, äußert er sich bezüglich der Textstelle, wo es eben um die Relation
zwischen Wort und Bedeutung geht, folgendermaßen aus: „Unwahr. Sprache ist
nicht aufgestockt, sondern ist das ursprüngliche Wesen der Wahrheit als Da.“ (SuZ
S. 442 ‚87 c‘)
Diese Randbemerkung ist deswegen von Belang, da sie davon zeugt, dass Heidegger
die Tatsache anerkannt hat, die Sprache könne nicht als fundiert betrachtet werden.
Durch sie festigt sich außerdem die Interpretation von Herrmanns, welcher auch im
vorliegenden Text gefolgt wird.
Die tiefere Auseinandersetzung mit der Sprachauffassung Heideggers ließ zum Vor-
schein kommen, worin der Charakter der Nichtursprünglichkeit des Wortes genau
besteht. Dabei hat man sich des Vergleiches mit Wittgenstein bedient, der dagegen
die Gleichursprünglichkeit der Sprache mit der Tätigkeiten für einen unumgängli-
chen Aspekt hält. Nun ist es zu verstehen, welche Folgen im Rahmen der Problema-
tik der Erschlossenheit des in-der-Welt-seins dieses Fundierungsverhältnis hat.
3.2. Sprache und Erschlossenheit
Anhand von Lafont wurde das Verhältnis zwischen Wort und Bedeutung als „Fun-
dierungsverhältnis“36 definiert. Die Sprache ist nämlich nach Heidegger ein Inner-
weltliches und somit Nichtdaseinsmäßiges: Die Bedeutungen, auf die hin die sprach-
liche Verlautbarung begegnet, sind dagegen daseinsmäßig. Heidegger versucht mit
dieser Vorstellung die Idee, das Subjekt drücke durch die Laute seine inneren Vor-
gänge aus, zu überwinden. Der Meinung Lafonts nach erzeugt dieses Fundierungs-
verhältnis eine Widersprüchlichkeit hinsichtlich der Seinsart der Sprache. Diese Wi-
dersprüchlichkeit würde sich im folgenden (tatsächlich nicht sehr klaren) Satz zei-
36 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers. S. 102 ff..
74
gen: „Diese Wortganzheit [d.h. die Sprache], als in welcher die Rede ein eigenes
‚weltliches‘ Sein hat, wird so als innerweltlich Seiendes wie ein Zuhandenes vorfind-
lich.“ (SuZ S. 161)
Worin würde die Widersprüchlichkeit bestehen? Heidegger würde nicht klarmachen,
ob der Sprache eine „ ‚weltliche‘ “ oder „innerweltliche“ Seinsart zukommt. Denn im
Satz kommen beide mögliche Seinsarten vor. Diesbezüglich äußert sich Lafont fol-
gendermaßen:
„Die Unhaltbarkeit des von Heidegger ins Auge gefasst Fundierungsver-hältnisses läßt sich allerdings bereits an seiner doppelsichtigen Charakte-risierung der Seinsart der Sprache (als ‚weltlich‘ und zugleich „innerwelt-liches Seiendes“) ablesen.“37
Dass Sprache und Wort als Innerweltliche begriffen werden, ist nichts Neues. Im
vorherigen Paragraphen wurde nämlich erläutert, dass die Worte als Zuhandene be-
gegnen. Sie haben denselben ontologischen Status des innerweltliches Seienden und
sind mithin eben innerweltlich und nichtdaseinsmäßig. Was in diesem Satz im Kont-
rast zu der Vorstellung des Fundierungsverhältnis stehen würde, wäre also die Be-
stimmung der Sprache als ‚weltlich‘. Dieses ist ein Adjektiv, das sich selbstverständ-
lich auf die Welt bezieht. Die Welt stellte sich in der Bedeutsamkeitsanalyse als ein
daseinsmäßiger Charakter heraus, denn sie lässt sich letztendlich auf die Grundver-
fassung des Daseins zurückführen. Deswegen heißt „weltlich“ (nicht in Anführung-
szeichen38) in der Terminologie von Sein und Zeit dasselbe wie „daseinsmäßig“39.
Dass die Sprache sowohl als innerweltlich bzw. nichtdaseinsmäßig als auch als
‚weltlich‘ bzw. daseinsmäßig aufgefasst wird, ist ein Anzeichen dafür ̠ schlussfol-
gert Lafont ̠, dass Heidegger in seinem Hauptwerk eine noch unscharfe Vorstellung
der Sprache vorschwebte.
Diese Lesart scheint aber insofern ungenau, als sie ein wichtiges Detail der angesp-
rochenen Behauptung nicht berücksichtigt, worauf hingegen von Herrmann40 auf-
merksam macht. Er weist darauf hin, dass im betreffenden Passus das Adjektiv
37 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers. S. 102. 38 Wie es gleich aufgezeigt wird, kreisen die Interpretationsschwierigkeiten dieses Satzes um die An-wesenheit der Anführungszeichen. 39 „Die Abwandlung ‚weltlich‘ meint dann terminologisch eine Seinsart des Daseins und nie eine sol-che des ‚in‘ der Welt vorhandenen Seienden.“ (SuZ S. 65) 40 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 129 ff..
75
„weltlich“ in Anführungszeichen vorkommt. Dies ist kein irrelevantes Detail, son-
dern grundlegend für das richtige Verständnis dieses Gedankens. Im §14 zeigt Hei-
degger vier Bedeutungen des Wortes „Welt“ an und macht dabei klar, dass wenn es
durch die Anführungszeichen markiert wird, es nicht die Welt als daseinsmäßigen
Charakter bezeichnet, sondern das All des innerweltlichen Seienden41. Dementspre-
chend bedeutet „‚weltlich‘“ keine Seinsweise des Daseins (also keine weltliche und
daseinsmäßige Seinsart), sondern den Seinsmodus des Innerweltlichen.
Was meint also Heidegger mit dem vorhin zitierten Satz? Er hebt hervor, dass die on-
tische Seinsweise des Existenzials der Rede die seiende (‚weltliche‘) Sprache ist, die
demnach „als innerweltlich Seiendes wie ein Zuhandenes vorfindlich [wird].“ (SuZ
S. 161) Dieser Gedanken wurde allerdings schon in der Illustrierung des Fundie-
rungsverhältnisses betont, weswegen sich die These Heideggers zwar aus den im
letzten Paragraphen erwähnten Gründen als unkorrekt, nicht aber als inkohärent
enthüllt.
In dem fraglichen Satz gibt es aber noch einen Hinweis, den von Herrmann für zent-
ral hält. Es wird nämlich nicht nur gesagt, dass die Rede in der Sprache ein ‚weltli-
ches‘ Sein hat, sondern dass sie ein „eigenes [Hervorhebung von F. C.] ‚weltliches‘
Sein hat.“ (SuZ S. 161) Die Eigentümlichkeit der Sprache wird auch in einer anderen
Passage betont, wo es heißt, dass die Rede eine „spezifisch“ (SuZ S. 161) ‚weltliche‘
Seinsart hat. Diese Wendungen sollen hervorheben, dass die Sprache ja ein inner-
weltliches Seiendes ist, aber nach ihrer spezifischen und eigenen Art.
Worin besteht die Spezifizität und Eigenart der Sprache? Wodurch unterscheidet sie
sich, in anderen Worten, von den anderen innerweltlichen Seienden, welche im be-
sorgenden Umgang entdeckt werden? Auf diese Fragen gibt es in Sein und Zeit leider
keine Antwort. Wie schon erwähnt wurde, widmet sich die Sprache- und Redeanaly-
se zumeist dem ontologischen Aspekt, und zwar dem Problem, welche Rolle die Re-
41 „1. Welt wird als ontischer Begriff verwendet und bedeutet dann das All des Seienden, das inner-halb der Welt vorhanden sein kann. [...] 3. Welt kann wiederum in einem ontischen Sinne verstanden werden, jetzt aber nicht als das Seiende, das das Dasein wesenhaft nicht ist und das innerweltlich begegnen kann, sondern als das, ‚worin‘ ein faktisches Dasein als dieses ‚lebt‘. Welt hat hier eine vorontologisch existenzielle Bedeutung. [...] Wir nehmen den Ausdruck Welt terminologisch für die unter n. 3 fixierte Bedeutung in Anspruch. Wird er zuweilen im erstgenannten Sinne gebraucht, dann wird diese Bedeutung durch Anführungszeichen markiert.“ (SuZ S. 64-65)
76
de in der Erschlossenheit des In-der-Welt-seins spielt. Die Frage nach dem ontischen
konkreten Umgang mit den Worten wird hingegen nicht herausgearbeitet.
Was jedoch naheliegt, ist die Tatsache, dass die ontische Seinsweise der Worte nicht
mit der konkreten Seinsart der Dinge zusammenfällt. Obwohl, ontologisch betrach-
tet, Sprache und Zeug denselben Status haben (beide sind nämlich als innerweltliche
nichtdaseinsmäßige Seiende aufgefasst), weist die ontische Umgangsweise mit den
Worten Unterschiede mit der Art und Weise auf, wie man mit dem Zeug umgeht.
Das Dasein verhält sich zu der Sprache nicht so, wie es mit Tischen, Kugelschreibern
und Gläsern zu tun hat. Dieser Gedanke ist von der Verwendung der beiden genann-
ten Adjektive ausgedrückt. Doch gibt es eine wichtigere Angabe, welche bestätigt,
dass die Sprache, wie das Dasein, nicht unter anderen Seienden vorkommt. Für die
folgende Erläuterung muss allerdings von dem ontischen Bereich Abschied genom-
men und dieselbe Frage vom ontologischen Gesichtspunkt aus berücksichtigt wer-
den.
Man stelle sich vor, dass es keinen ontischen Unterschied zwischen Sprache und
Zeug bzw. Dingen gibt. In dem Fall werden die Worte, analog zu den anderen In-
nerweltlichen, als bewandtnis- bzw. verweisungsbestimmt begegnen. Die Verwei-
sung (als vermutliches Sein des Wortes) wird aus der Verweisungsmannigfaltigkeit,
d.h. aus der Bedeutsamkeit, herausgelegt. Die Bedeutsamkeit ist immer im Verstehen
erschlossen. Das besagt: Worte und andere innerweltliche Seiende können nur be-
gegnen, weil eine Welt in der Form der Bedeutsamkeit im Verstehen schon immer
erschlossen ist. Heidegger macht indes explizit, dass Sprache in den Bedeutungen
fundiert ist. Das Wort erscheint nicht auf Verweisung hin, so wie das bei anderen
Zuhandenen der Fall ist, sondern als bedeutungsbestimmt. Aus dem ontischen Sach-
verhalt, Worte hätten eine eigene und spezifische Seinsart, ergibt sich auf einer tiefe-
ren ontologischen Stufe Folgendes: Die nach der Struktur der Bedeutsamkeit er-
schlossene Welt darf nicht nur Seiende auf Bewandtnis bzw. Verweisung hin freige-
ben. Bedeutsamkeit muss vielmehr so strukturiert sein, dass in der Welt auch bedeu-
tungsbestimmte Seiende (d.h. Worte) begegnen können. Daher die Notwendigkeit,
ein anderes Existenzial zu entwickeln, das als ontologisches Fundament für die Er-
scheinung der Sprache fungieren kann. Die Rede, als existenzialer Charakter des Da-
seins, macht das ontologische Fundament der Sprache aus.
77
Bevor es weitergeht, gilt es, zwei Einwände vorzustellen. Der erste kann folgender-
maßen formuliert werden: Warum ist es notwendig, die ganzen Erscheinungen der
Sprache auf ein vermutliches Sprachwesen zurückzuführen? Die Antwort lautet wie
folgt: In jeder Situation der Sprachverwendung (im Sprechen, Hören und Schweigen)
können sich die Laute nur als sinnvolle Worte manifestieren, wenn gleichsam schon
festgelegt ist, dass jene Töne eine Bedeutung haben. Das Begegnen der jeweiligen
Verlautbarung ist nicht direkt, sondern setzt die Bedeutungen als seine Bedingung
voraus. Die vorgängige Erschlossenheit der Bedeutungen macht das Wesen bzw. das
ontologische Fundament der Sprache aus. Das Bedeutungsganze ist, in anderen Wor-
ten, die für die Worte konstitutive Größe. Die Sprache ihrerseits ist immer durch die
Rede konstituiert.
Aus dieser Überlegung heraus folgt aber nicht, dass die Gesamtheit der Bedeutungen,
welche die Erschlossenheit des jeweiligen In-der-Welt-seins charakterisiert (nicht al-
so die Gesamtheit der Bedeutungen aller vorstellbaren Worte), in der Grundverfas-
sung des Daseins liegen muss. Der zweite Einwand ist der folgende: Aus der Tatsa-
che, die Rede sei das Wesen der Sprache, folgt nicht unbedingt, dass dieses ontologi-
sche Fundament auch als existenzial, d.h. zum Sein des Daseins gehörend, begriffen
werden muss. Es könnte nämlich der Fall sein, dass das Wesen der Sprache nicht zur
Seinsstruktur des Daseins gehört. In solch einem Fall wäre die Rede als ontologi-
sches Fundament der Sprache kein Existenzial. Würde sich eine solche Stellung im
Rahmen der existenzialen Analytik vertreten lassen? Um diese Frage zu beantworten
muss zuerst auf eine Grundprämisse von Sein und Zeit hingewiesen werden. Die
existenziale Analytik zielt darauf ab, die Seinsstruktur desjenigen Seienden freizule-
gen, das dadurch ausgezeichnet ist, dass es Seinsverstehen hat. Da das Sein aus-
schließlich in ihm erschlossen ist, gehören dann alle Sein-erschließenden Instanzen,
d.h. alle konstitutiven Größen, zu seiner Grundverfassung. Die Erschließungsfunkti-
on gehört ausschließlich zu den existenzialen Charakteren. Dies, wie bereits im ers-
ten Kapitel unterstrichen wurde, ist ein Faktum. Nun, da diese Grundprämisse vor
Augen geführt wird, bestehen bei der Beantwortung der Frage, ob die Rede als nicht-
daseinsmäßiger Charakter verstanden werden kann, keine Schwierigkeiten mehr. Die
Rede muss daseinsmäßig sein, weil die sie die Erschlossenheit des In-der-Welt-seins
(und des Seins überhaupt) mit-erschließt. Als konstitutiver erschließender Charakter
78
darf sie (die Rede) nichts anderes sein als ein Existenzial. Dieses Problem kann mo-
mentan als gelöst betrachtet werden, jedoch wird man später noch einmal darauf zu-
rückkommen.
Nach der Auseinandersetzung mit diesen Einwänden, kann man auf die Frage nach
der spezifischen Seinsweise der Sprache zurückkommen. Es wurde erklärt: Da die
Umgangsweise mit dem Zeug anders ist als das Verhalten zu den Worten, muss ein
Existenzial gedacht werden, das als ontologische Wurzel der Sprache gelten kann.
Als Phänomen der Sprache fasst Heidegger also die Rede auf. Trotzdem bleibt noch
unklar, in welchem Zusammenhang dieses Existenzial mit den anderen beiden er-
schließenden Charakteren, d.h. der Befindlichkeit und des Verstehens, steht. Ontisch
gesehen muss Heidegger eine Lösung auf die folgenden Probleme finden. Erstens ist
die Sprache zwar seiend in eigener Art, aber der Umgang mit ihr stellt kein vom
Umgang mit Dingen getrenntes Moment dar. In der Welt existiert das Dasein so,
dass das Sprechen, Hören und Schweigen der Worte und das Zu-tun-haben mit dem
Zeug stets miteinander verflochten sind. Zweitens beobachtet Heidegger, dass das
Dasein die innerweltlichen Dinge nicht nur im hantierenden besorgenden Umgang
entdecken kann, sondern auch dadurch, dass es redet. Der Mensch macht die Seien-
den offenbar, d.h. entdeckt die Dinge, durch den Logos: „Der Mensch zeigt sich als
Seiendes, das redet. Das bedeutet nicht, daß ihm die Möglichkeit der stimmlichen
Verlautbarung eignet, sondern daß dieses Seiende ist in der Weise des Entdeckens
der Welt und des Daseins selbst.“ (SuZ S. 165) Was dies in concreto bedeutet, wird
nicht erklärt. Eine Textstelle aus der Vorlesung des Sommersemesters 1925 kann
aber diesen Gedanken klären:
„Faktisch ist es auch so, daß unsere schlichtesten Wahrnehmungen und Verfassungen schon ausgedrückte, mehr noch in bestimmter Weise inter-pretiert sind. Wir sehen nicht so sehr primär und ursprünglich die Ge-genstände und Dinge, sondern zunächst sprechen wir darüber, genauer sprechen wir nicht das aus, was wir sehen, sondern umgekehrt wir sehen, was man über die Sache spricht.“ (GA S. 75)
Hier wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung immer in der Auslegung
gründet. Das Dasein erfasst nämlich nicht zunächst durch die Wahrnehmung Subs-
tanzen und Eigenschaften, welche sich erst danach als Zeug um zu ... erweisen. In
der Auslegungsanalyse wurde gezeigt, dass das Seiende als Zeug um zu ... begegnet,
79
weil eine Verweisung bzw. Bewandtnis schon erschlossen ist. In dieser Passage
macht Heidegger aber deutlich, dass sich Dinge auch auf das hin zeigen, was man
über die Sache spricht. Nicht also auf die konkreten Wortlaute hin, sondern das, was
in der Sprache ausgedrückt wird, nämlich die Bedeutungen. Als redendes Lebewesen
macht der Mensch Seiende durch das Reden und zwar auf Bedeutungen hin offenbar.
Diese Entdeckungsart ist nicht sprachlich. Denn die Bedeutungen sind eben vor-
sprachlich. Das besagt: Das Reden entdeckt sowohl die worthafte Verlautbarung als
auch Seiende.
Einerseits kommen die Worte immer im Umgang mit dem Seiendem (obwohl sie ei-
ner anderen Seinsart als die Dinge sind) vor. Andererseits entdeckt das Dasein die
innerweltliche Seiende auch dadurch, dass es redet, d.h. nicht nur auf Bewandtnis
hin, sondern auch als bedeutungsbestimmt. Wie können diese zwei ontischen Tatsa-
chen ontologisch erklärt werden? Man muss verstehen, wie sich die Rede zu den an-
deren zwei erschließenden Charakteren verhält. Oder noch: Wie muss Bedeutsamkeit
von der Rede bestimmt sein, damit in ihr, in der Welt,
1) Worte und andere Zuhandene nicht getrennt begegnen können und
2) Innerweltliche als bewandtnisbestimmt und zugleich bedeutungsbestimmt ent-
deckt werden können42?
Die Antwort auf diese Frage findet Heidegger darin, dass die Rede die ganze Er-
schlossenheit ursprünglich artikuliert und gliedert. Ursprünglich insofern, als die Er-
schlossenheit immer schon gegliedert und artikuliert ist. Es ist folglich nicht so, als
würden Verstehen und Befindlichkeit zuerst die Bedeutsamkeit erschließen, welche
erst später durch die Rede ihre Gliederung bekommen würde. Die Welt des Daseins
bietet sich nicht nur als Mannigfaltigkeit von Bedeutsamkeitsbezügen dar, sondern
auch gleichursprünglich als Bedeutungsganzes. Die Vertrautheit mit der Welt ist zu-
gleich eine Vertrautheit mit einer bedeutungsmäßig artikulierten Welt. Erst jetzt kann
man endlich Verständnis dessen gewinnen, was diese gliedernde Funktion der Rede
bezeichnet. 42
Diese Frage wird in der o.g. Vorlesung explizit formuliert: „Ich gesteh offen, dieser Ausdruck [(d.h. ‚Bedeutsamkeit‘)] ist nicht der beste, aber ich habe seither, seit Jahren, keinen anderen gefunden, vor allem keinen solchen, der einen wesentlichen Zusammenhang des Phänomens [der Bedeutsamkeit] mit dem, was wir als Bedeutung, im Sinne von Wortbedeutung, bezeichnen, Ausdruck gibt, sofern grade das Phänomen in innerem Zusammenhang mit Wortbedeutung, Rede steht. Dieser Zusammen-hang zwischen Rede und Welt wird vielleicht jetzt noch ganz dunkel sein.“ (GA 20 S. 275)
80
Wie bereits gesagt wird in der Redeanalyse zumeist der ontologische Aspekt be-
schrieben, während es dem Leser zukommt, die „ontischen Folgen“ abzuleiten. Inso-
fern hält man wiederum die Interpretation von von Herrmann für angemessen, der
den Weg von dem ontologischen Phänomen der Rede zur Entdeckung des Seienden
folgendermaßen erläutert:
„Wenn die Gliederung (Rede) wesenhaft konstitutiv ist für die Erschlos-senheit, und wenn Seiendes nur offenbar ist in der und aus der Erschlos-senheit des In-der-Welt-seins, dann bestimmt die redende Gliederung on-tologisch auch die Offenbarkeit von Seiendem.“43
Dass die Rede auch die Offenbarkeit, d.h. die Entdecktheit, des Seienden bestimmt,
heißt Folgendes:
„Weist sich das Dasein aus dem gegliedert erschlossenen In-der-Welt-sein an auf das Seiende eines erschlossenen Weltbezuges [d.h. einer er-schlossenen Bewandtnis bzw. Verweisung] dann legt es darin diesen Weltbezug [...] heraus und läßt das Seiende dieses herausgelegten Welt-bezuges, dieser herausgelegten weltmäßigen Bedeutung oder Bewandtnis, in die Offenbarkeit seines Innerweltlichseins einrücken.“44
Und umgekehrt: „Im Sprechen, Hören und Lesen der Worte, der Wortfügungen bin
ich verstehend bei dem in der Wortfügungen angesprochenen und besprochenen of-
fenbaren, entdeckten Seienden.“45
Die Rede artikuliert und gliedert die Welt in einem Bedeutungsganzen. Diese ist in-
sofern eine bedeutende Intuition, als sie ermöglicht, eine ontologische Erklärungen
für zwei ontische Probleme zu geben. Ontisch gesehen bedeutet nämlich die Artiku-
lation der Rede diese zwei Tatsache: Jede Entdeckung des Wortes, im Sprechen, Hö-
ren und Schweigen, ist gleichzeitig ein Sein-beim-Seienden. Gleichermaßen ge-
schieht jede Entdeckung des Seienden sowohl auf Bewandtnis als auch Bedeutung
hin.
Trotz der ausgezeichneten Intuition hinsichtlich der Rolle der Rede, vermag diese
Sprachauffassung, einen wesentlichen Aspekt der Sprache nicht zu erfassen. Die Be-
stimmung des Wortes als innerweltliches Seiendes, wenngleich einer spezifischen
und eigenen Seinsart, hat nämlich Konsequenzen auch auf der ontologischen Ebene.
43 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 155. 44 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 156. 45 Von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, S. 157.
81
Man kehre auf das oben angeführte Zitat zurück, wo die Wichtigkeit der Bedeutung
im Rahmen der Entdeckung des Seienden thematisiert wird: „Wir sehen, was man
über die Sache spricht.“ (GA 20 S. 75) Die Entdeckung des Seienden geschieht nach
diesem Satz auf der Grundlage einer herausgelegten vorprädikativen und vorsprach-
lichen Bedeutung. Doch im vorherigen Paragraphen wurde durch den Rückgriff auf
Wittgenstein deutlich klargelegt, dass die Wortbedeutungen nicht vor der Sprache
entstehen bzw. erschlossen werden. Das, was man über die Sache spricht, d.h. die
Bedeutung, aufgrund derer Seiendes begegnet, ist somit zwar vorprädikativ, da es
eben dem jeweiligen Aussprechen bzw. Hören der Worte vorangeht, aber nicht vor-
sprachlich. Denn die Bedeutung der Worte, wie Wittgenstein betont, kann nicht
unabhängig von den Worten selbst festgesetzt werden. Wenn also den Bedeutungen
die Entdeckungsfunktion zukommt, sie aber nicht vorsprachlich gedacht werden
können, dann hat auch Sprache Entdeckungsfunktion. Um zur vorstehenden Überle-
gung zurückzukommen, kann man Folgendes erwähnen: Es ist zwar wahr, dass jedes
Wahrnehmen in der Auslegung gründet, welche Seiendes auch auf Bedeutungen hin
entdeckt. Es ist aber auch wahr, dass Bedeutungen immer schon sprachliche Bedeu-
tungen sind. „Wir sehen, was man über die Sache spricht“, aber das, was man über
die Sache spricht ist nicht vorsprachlich, wenngleich ja unabhängig von dieser oder
jener Prädikation. Die Bestimmung der Sprache als bloßes Innerweltliches hält Hei-
degger davon ab, die Entdeckungsfunktion in der Sprache zu sehen.
Auf einer tieferen ontologischen Stufe findet man das Ganze der erschlossenen Be-
deutungen. Dieses hat vor den einzelnen herausgelegten Bedeutungen einen ontolo-
gischen Vorrang und macht die Gliederung der Bedeutsamkeit, d.h. der erschlosse-
nen Welt, aus. Wenn das Dasein mit der Welt vertraut ist, diese allerdings immer in
einem Bedeutungsganzen gegliedert ist, ist das Dasein dann, als in der Welt existie-
rendes Seiendes, immer mit der Bedeutungsganzheit vertraut. Dies wird in Sein und
Zeit richtig bemerkt. Das Bedeutungsganze, wie übrigens die einzelnen Bedeutun-
gen, sind die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die seiende Sprache begegnet.
Als Bedingung der Möglichkeit aller Spracherscheinung kann es selbstverständlich
nicht durch die Sprache bestimmt sein. Die Gesamtheit der noch nicht herausgeleg-
ten Bedeutungen, mit der das Dasein vertraut ist und welche die ursprüngliche Glie-
derung der Welt darstellt ist vorsprachlich. In-der-Welt-sein des Daseins heißt also,
82
in einer bedeutungsmäßig artikulierten, nicht aber wortmäßig gegliederten Welt zu
existieren.
Die Auffassung der Sprache als entdeckbares Zuhandenes führt Heidegger allerdings
in diesem Zusammenhang dazu, noch eine andere bedeutende Funktion der Sprache
zu ignorieren, und zwar ontologisch betrachtet sogar bedeutender als die Entde-
ckungsfunktion. Wenn die Sprache als entdeckbares innerweltliches Seiendes begrif-
fen wird, kann logischerweise, keine entdeckende Instanz sein, was schon beobachtet
wurde. Jede Entdeckung setzt die Erschließung von etwas anderem voraus. Das
bringt mit sich: Ein entdeckendes Existenzial (wie die Auslegung) gründet in einem
erschließenden Existenzial (z.B. dem erschließenden Verstehen) und kann seinerseits
nicht erschließen. Wenn die Sprache, als zu entdeckendes Seiendes, nur durch die
Auslegung offenbar wird, dann kann sie keine erschließende Rolle spielen.
Es liegt nahe, dass das Fundierungsverhältnis des Wortes in der Bedeutung ein we-
sentliches Moment der ganzen ontologischen Konstruktion der Redeanalyse ist.
Wenn also die Falschheit dieses Modells erwiesen wird, muss die genannte Kons-
truktion revidiert werden. Es wurde aufgewiesen, dass die Bedeutungen die Sprache
nicht fundieren. Diese und jene sind vielmehr gleichursprünglich. Wenn keine Be-
deutung ohne Worte und Sprache entstehen kann, dann ist das Bedeutungsganze
selbst, das die Gliederung der Erschlossenheit der Bedeutsamkeit repräsentiert, durch
die Sprache bestimmt. Mit einer Welt und gleichursprünglich mit einem Bedeu-
tungsganzen vertraut zu sein, bedeutet dementsprechend, eine Vertrautheit mit der
Sprache, d.h. mit der Wortganzheit, welche ursprünglich die jeweilige Erschlossen-
heit des ganzen In-der-Welt-sein charakterisiert. Dies besagt allerdings nichts ande-
res, als dass der Sprache neben der Entdeckungsfunktion auch die Erschließungs-
funktion zusteht.
Die Sprache ist nicht nur eine Erscheinung. Wenn sie dergestalt aufgefasst wird, wird
ihre spezifische erschließende Rolle verdeckt. Damit ist nicht gesagt, dass eine Un-
terscheidung, wie die, die sich Heidegger durchzuführen vornimmt, vollständig sinn-
los wäre. Wohl kann man nämlich die Erscheinung der Sprache von ihrem Phänomen
unterscheiden. Die Erscheinung würde dann in der konkreten Sprachverwendung be-
stehen, was Heidegger Sprache nennt. Das Phänomen wäre aber nicht früher als die
83
Sprache, Wortganzheit, sondern würde nur der jeweiligen Erscheinungen vorange-
hen. Anders formuliert: Das Wort ist nicht ein „bloßer“ konkreter Laut, beschränkt
sich nicht auf seine jeweilige Erscheinung, sondern kennzeichnet immer schon die
jeweilige Erschlossenheit der Bedeutsamkeit. Sprache ist nicht nur in der Welt als
Innerweltliches, als stimmliche Verlautbarung. Sie prägt (erschließt) vielmehr von
Anfang an, d.h. ursprünglich, die Welt.
Auf diesen Gedanken ist man schon gestoßen, als man die Beobachtungen Wittgens-
teins geschildert hat. Damals wurde ein wesentlicher Aspekt der Untersuchungen ak-
zentuiert46, nämlich dass die Worte nicht in einem bereits „fertigen“ und völlig be-
stimmten Sprachspiel ihren ersten Auftritt haben. Umgekehrt bestimmt die Sprache
von Anfang an das Sprachspiel. Der sinnvolle (d.h. richtige) Wortgebrauch und -
verstehen setzt eine gewisse Vertrautheit mit dem Sprachspiel voraus. Die Vertrau-
theit mit dem Sprachspiel bezeichnet auch ein Beherrschen der Sprache des Sprach-
spiels selbst. Mit dem Sprachspiel und der Sprache vertraut zu sein, macht also die
Bedingung für die konkrete Verwendung der Worte aus, was diese Betrachtung
klarmacht: „Einen Satz verstehen, heißt, eine Sprache verstehen. Eine Sprache ver-
stehen, heißt, eine Technik beherrschen.“ (PU §199)
Heideggers Unterscheidung einer ontologischen Stufe (d.h. der Rede, der Artikulati-
on der Erschlossenheit) von einer ontischen (d.h. dem Sichaussprechen in Lauten) ist
demzufolge völlig berechtigt. Das, worin er indes irregeht, ist, zu denken, dass die
bedeutungsmäßige Artikulation der Welt, d.h. des Bedeutungsganzen, vorsprachlich
bzw. nicht durch die Sprache konstituiert ist.
Die Erläuterung der Sprache als nichtursprünglich bringt Heidegger dazu, in der
Sprache keine Entdeckungs- und, noch wichtiger, keine Erschließungsfunktion anzu-
sehen. Warum aber hat Heidegger zu der Zeit seines Hauptwerkes die Ansicht vertre-
ten, die Sprache sei nur ein Innerweltliches? Warum, in anderen Worten, sieht er in
der Sprache keine erschließende Rolle, keine Ursprünglichkeit? Eine glänzende
Antwort auf diese Fragen findet Lafont, deren Interpretation demzufolge im diesem
Fall verteidigt wird. Bevor man sich auf die Antwort zuwendet, muss an einige we-
sentliche Prämissen von Sein und Zeit erneut erinnert werden. Vorstehend wurde er-
46 Vgl. den dritten Punkt auf Seite 65 des vorliegenden Texts.
84
klärt, dass für Heidegger die erschließenden Instanzen als existenziale Charaktere des
Daseins begriffen werden müssen. Das Dasein, als seinsverstehendes Seiendes, ist
der einzige ontologische „Ort“ der Erschlossenheit des In-der-Welt-seins und des
Seins überhaupt. Die Sprache, die erscheinende Wortganzheit, ist klarerweise ein
Nichtdaseinsmäßiges. Als nichtdaseinsmäßig kann sie nichts anderes sein, als ein
entdeckbares innerweltliches Seiendes. Diesen Gedanken erklärt Lafont sehr deut-
lich:
„Die Befangenheit Heideggers in der bewußtseinsphilosophischen Auf-fassung der Sprache als Werkzeug hat ihre Wurzel in seinem ungebro-chenen Festhalten am transzendentalphilosophischen Standpunkt, der sich in der Privilegierung des ins ‚Dasein‘ transformierten Subjekts [...] als einziger möglicher konstitutiver Größe zeigt. Dadurch kann der Sprache dann keine ähnliche Rolle mehr zukommen.“47
Wenn das Dasein die einzige konstitutive Größe ist, wenn es also der einzige Ort der
Welterschließung ist, dann verwundert es nicht mehr, dass der Sprache keine Er-
schließungsfunktion zugesprochen wird. Diese Prämisse, das Sein sei im Dasein, und
zwar nur in ihm, erschlossen, ist, wie schon angedeutet, keine These, sondern ein un-
begründetes Faktum, das außer Frage steht. Sie ist also eine Überzeugung, die ihren
Ursprung in der „Grundeinstellung [hat], die Heidegger mit Husserl teilt, daß es eine
Fundamentalontologie geben könne, die die Bedingung der Möglichkeit aller ande-
ren Ontologien wäre.“48 Als Beleg für diese Lesart führt Lafont eine Textstelle aus
Sein und Zeit an, wo es eben heißt, dass die Ontologie der Sprache, wie übrigens jede
andere Ontologie, in der Seinsverfassung des Daseins seine Wurzel hat: „Die Bedeu-
tungslehre ist in der Ontologie des Daseins verwurzelt.“ (SuZ S. 166)
Heidegger kann also keine Instanz denken, die einerseits nichtdaseinsmäßig ist, da
sie eben nicht nur zur Seinsverfassung des einzelnen Daseins gehört, und anderer-
seits daseinsmäßig ist, da sie zur Erschlossenheit des In-der-Welt-seins beiträgt.
Solch eine Instanz wäre gegen seine Grundprämisse, das Sein sei nur im Dasein er-
schlossen.
47 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers. S. 107. 48 Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers. S. 112.
85
Schlussbemerkungen
Diese Arbeit hat sich zunächst vorgenommen, einen Überblick über das Denken
Heideggers zu geben, genauer über die existenziale Analytik, die den ersten Teil von
Sein und Zeit ausmacht. Ausgehend von der Analyse der Alltäglichkeit des Daseins,
wurde gezeigt, dass die Welt nicht etwas ist, was zur Existenz des Menschen a poste-
riori hinzukommt. Das Dasein existiert vielmehr immer schon in der jeweiligen
Welt. Diese ihrerseits stellt nicht ein dem Subjekt entgegengesetztes Objekt dar, son-
dern manifestiert sich immer als Verweisungsmannigfaltigkeit. Die formale Struktur
der Weltlichkeit ist die Bedeutsamkeit.
Die Vorstellung der Welt als Ganzheit der Bedeutsamkeitsbezüge, die letztendlich
ihre ontologischen Wurzeln in der Seinsverfassung des Daseins hat, darf nicht als
Beitrag zur Erkenntnistheorie begriffen werden, sondern als Abschied von diesem
philosophischen Paradigma. Denn das Erkennen stellt sich in der existenzialen Ana-
lytik bloß als eine mögliche Seinsweise des Daseins heraus, und ist insofern im In-
der-Welt-sein fundiert. Die Analyse des In-Seins hat diese Einsicht bestätigt, indem
sie zwei existenziale Charaktere erwogen hat, aus denen die Erschlossenheit der Be-
deutsamkeit geschieht: Verstehen und Rede. Die letztgenannte ergab sich als existen-
zial-ontologisches Fundament der Sprache.
Der Charakter der Nichtursprünglichkeit der Sprache wurde am Vergleich mit der
Sprachauffassung Wittgensteins eingehender verdeutlicht. In den Philosophischen
Untersuchungen werden nämlich die Sprache und das Wort als ursprüngliche Phä-
nomene vorgestellt, welche, als solche, das Sprachspiel immer schon bestimmen.
Wie es deutlich hervorgetreten ist, ging es in der Arbeit nicht darum, zwei unter-
schiedliche Sprachkonzeptionen zu vergleichen. Ziel der Untersuchung war keines-
wegs, Analogien und Unterschiede zwischen den Sprachauffassungen zu finden,
welche in den angesprochenen Werken formuliert sind. Und dies aus einem trivialen
Grunde: es ist nicht Heideggers Absicht, eine neue Theorie der Sprache zu entwi-
86
ckeln. Wie Liptow richtig bemerkt, ist es vergeblich, überhaupt die Frage zu stellen,
ob Heidegger auf eine pragmatische Sprachvorstellung oder eine transzendentale
zielt:
„Wenn aber Heidegger in Sein und Zeit keine Gebrauchstheorie der Be-deutung vertritt, was für eine Bedeutungstheorie vertritt er dann? Tat-sächlich scheint die plausibelste Antwort auf diese Frage zu lauten: keine. Die Überlegungen zur Sprache, die wir in Sein und Zeit finden, erheben gar nicht den Anspruch, auf die aus heutiger Perspektive zentralen bedeu-tungstheoretischen Fragen eine Antwort zu geben.“49
Es ist zwar wahr, dass sich Heidegger zur Sprache und zum Sprachwesen äußert und
dabei auch Stellung einnimmt, wie übrigens im Text ausführlich diskutiert wurde.
Man darf aber nicht den thematischen Kontext übersehen, in den die Redeanalyse
eingebettet ist. Es ist nicht so, dass Heidegger zuerst die Seinsverfassung des Daseins
untersucht und sich danach mit dem Wesen der Sprache auseinandersetzt. Die Über-
legung zur Rede ist dagegen ein Teil der Analyse des In-Seins. Sie verlässt nicht den
Boden der Untersuchung des In-der-Welt-seins, sondern wird im Rahmen der exis-
tenzialen Analytik durchgeführt, welche das Thema des ersten Teils von Sein und
Zeit darstellt.
Heidegger stellt also in seinem Hauptwerk keine explizite Frage nach der Sprache
„an sich“. Die Untersuchung der Sprache ist vielmehr ein Teil des allgemeinen Pro-
jekts der Explikation der Seinsstrukturen des Daseins. Heidegger selbst macht klar,
dass der Paragraph 34 das Ziel hat, aufzuzeigen, welche Stellung Rede und Sprache
im Sein des Daseins haben, wenn er am Ende des betreffenden Paragraphen Folgen-
des schreibt: „Die vorliegende Interpretation der Sprache sollte lediglich den ontolo-
gischen ‚Ort‘ für dieses Phänomen innerhalb der Seinsverfassung des Daseins auf-
zeigen.“ (SuZ S. 166)
Der Schwerpunkt des letzten Teils der Arbeit lag hingegen auf der Rolle der Sprache
im Rahmen der Erschlossenheit der Bedeutsamkeit. Dabei wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass der Sprache in Sein und Zeit weder die Entdeckungs- noch die Er-
schließungsfunktion zukommt.
Anhand von Lafont hat man zum Schluss gesehen, welche Gründe Heidegger dazu
führen, die Sprache als entdeckbares innerweltliches Seiendes zu bestimmen und
49 Liptow, Jasper, Zur Rolle der Sprache in Sein und Zeit, S. 10
87
nicht als konstitutive Größe. Eine erschließende Instanz, die zugleich kein daseins-
mäßiger Charakter wäre, würde nicht mit dem Faktum übereinstimmen, von wel-
chem die Herausarbeitung der ganzen existenzialen Analyse ihren Ausgang nimmt.
Gerade das Faktum, das Sein überhaupt sei nur im Dasein erschlossen, was die Über-
zeugung nach sich zieht, alle Ontologien würden letztendlich in der Fundamentalon-
tologie des Daseins wurzeln, hält Heidegger gleichsam noch an der Bewusstseinsphi-
losophie und somit am Subjekt-Objekt Modell fest. Ein Modell, welches gerade das
ausmacht, was er sich durch die Wiederholung der Frage nach dem Sinn des Seins
überhaupt und die Ausarbeitung der existenzialen Analytik zu überwinden vornimmt.
88
Bibliographie
Apel, K. O., Wittgenstein und Heidegger. Die Frage nach dem Sinn von Sein und der Sinnlo-sigkeitsverdacht gegen alle Metaphysik, Erschienen in: Pöggeler, O. (Hgg.), Heidegger: Perspektive zur Deutung seines Werkes, Königstein/Ts. 1984.
Demmerling, C., Hermeneutik der Alltäglichkeit und In-der-Welt-sein, erschienen in: Rentsch, T. (Hgg.), Martin Heidegger. Sein und Zeit, 2. Aufl., Berlin 2007.
Dreyfus, H. L., In-der-Welt-sein und Weltlichkeit: Heideggers Kritik des Cartesianismus, er-schienen in: Rentsch, T. (Hgg.), Martin Heidegger. Sein und Zeit, 2. Aufl., Berlin 2007.
Fabris, A., Essere e Tempo di Heidegger. Introduzione alla lettura, Roma 2005.
Figal, G., Heidegger zur Einführung, Hamburg 1992.
Figal, G., Martin Heidegger. Phänomenologie der Freiheit, Frankfurt am Main 1988.
Heidegger, M., Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen, 1986.
Heidegger, M., Der Begriff der Zeit. Vortrag vor der Marburger Theologenschaft Juli 1924. Tübingen 1989.
Heidegger, M., Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Marburger Vorlesung Som-mersemester 1925. Gesamtausgabe Band 20, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1988.
Heidegger, M., Die Grundprobleme der Phänomenologie. Marburger Vorlesung. Sommer-semester 1927. Gesamtausgabe Band 24, Frankfurt am Main 1975.
von Herrmann, F. W., Subjekt und Dasein. Grundbegriffe von „Sein und Zeit“, 3. Aufl., Frankfurt am Main 2004.
von Herrmann, F. W., Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu „Sein und Zeit“. Band 2. „Erster Abschnitt: Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Da-seins“, Frankfurt am Main 2005.
von Herrmann, F. W., Hermeneutische Phänomenologie des Daseins. Ein Kommentar zu „Sein und Zeit“. Band 3. „Erster Abschnitt: Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Da-seins“, Frankfurt am Main 2008.
Jahraus, O., Martin Heidegger. Eine Einführung, Stuttgart 2004.
Jean, G., Die Wiedererweckung der Seinsfrage auf dem Weg einer phänomenologisch-hermeneutischen Destruktion erschienen in: Erschienen in: Rentsch, T. (Hgg.), Martin Hei-degger. Sein und Zeit, 2. Aufl., Berlin 2007.
Kienzler, W., Ludwig Wittgensteins ‚Philosophische Untersuchungen‘, Darmstadt 2007.
89
Lafont, C., Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Hei-deggers, Frankfurt am Main, 1994.
Lange, E. M., Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen - Eine kommentierende
Einführung, Paderborn u.a. 1998.
Liptow, J., Zur Rolle der Sprache in Sein und Zeit, erschienen in: Merker, V. B. (Hgg.), Ver-stehen nach Heidegger und Brandom, Hamburg 2008.
Luckner, A., Martin Heidegger: ‚Sein und Zeit‘, 2. Aufl., Paderborn, München, Wien, Zürich 2001.
Perissinotto, L., Wittgenstein - Una Guida, Milano 2008.
Mulhall, S., Heidegger and Being and Time, Oxon 1996.
Puhl, K., Regelfolgen, erschienen in: von Savigny, E. (Hgg.), Ludwig Wittgenstein. Philoso-phischen Untersuchungen, 2. Aufl., Berlin 2011.
Rentsch, T., Heidegger und Wittgenstein. Existenzial- und Sprachanalysen zu den Grundla-
gen philosophischer Anthropologie, Stuttgart 2003.
Romano, P., Die Weltlichkeit der Welt und ihre abgedrängte Faktizität, erschienen in: Rentsch, T. (Hgg.), Martin Heidegger. Sein und Zeit, 2. Aufl., Berlin 2007.
von Savigny, E., Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“: Ein Kommentar für Le-ser, Band 1, Frankfurt am Main 1988.
von Savigny, E., Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“: Ein Kommentar für Le-ser, Band 2, Frankfurt am Main 1989.
von Savigny, E., Der Mensch als Mitmensch. Wittgensteins ‚Philosophischen Untersuchun-gen‘, München 1996.
von Savigny, E., Sprachspiele und Lebensformen: Woher kommt die Bedeutung?, erschie-nen in: von Savigny, E. (Hgg.), Ludwig Wittgenstein. Philosophischen Untersuchungen, 2. Aufl., Berlin 2011.
Spinicci, P., Lezioni sulle Ricerche Filosofiche di Ludwig Wittgenstein, Milano 2002.
Vattimo, G., Heidegger e la filosofia della crisi, Roma 2011.
Vicari, D., Lettura di Essere e Tempo di Heidegger, Torino 1998.
Volpi, F., Der Status der Existenzialen Analytik, erschienen in: Rentsch, T. (Hgg.), Martin Heidegger. Sein und Zeit, 2. Aufl., Berlin 2007.
90
Volpi, F. (Hgg.), Guida a Heidegger, Roma-Bari 2005.
Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Werkausgabe Band 1, Frankfurt am Main 1984.
Wittgenstein, L., Das Blaue Buch. Eine Philosophische Betrachtung, Werkausgabe Band 5, Frankfurt am Main 1984.
91
Siglenverzeichnis
Werke von Heidegger:
SuZ: Sein und Zeit, 16. Aufl., Tübingen, 1986.
GA 20: Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Marburger Vorlesung Sommer-
Semester 1925, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1988.
GA 24: Die Grundprobleme der Phänomenologie. Marburger Vorlesung. Sommersemes-
ter 1927, Frankfurt am Main 1975.
Werke von Wittgenstein:
PU: Philosophische Untersuchungen, Werkausgabe Band 1, Frankfurt am Main 1984.
92
Eidesstattliche Erklärung zur selbstständigen Verfassung der Masterarbeit
Hiermit erkläre ich, Francesco Castorina, geboren am 12.01.1990, in Catania (Italien), dass
die vorgelegte Masterarbeit mit dem Titel „Bedeutsamkeit und Sprache in Heideggers „Sein
und Zeit““ durch mich selbstständig verfasst wurde. Ich habe keine anderen als die angege-
benen Quellen sowie Hilfsmittel benutzt und die Masterarbeit nicht bereits in derselben
oder einer ähnlichen Fassung an einer anderen Fakultät oder einem anderen Fachbereich
zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht.






























































































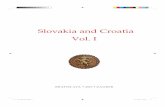




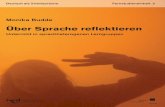


![Grammatik und Methodik der deutschen Sprache [Almanca Dilbilgisi ve Öğretimi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/630be91db4b18c456404d462/grammatik-und-methodik-der-deutschen-sprache-almanca-dilbilgisi-ve-oegretimi.jpg)