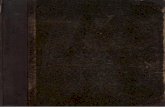Die Konstitution der Zeit
Transcript of Die Konstitution der Zeit
Gregor van Dülmen
Technische Universität Berlin
Die Konstitution der Zeit
Eine Analyse von Edmund Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins
2
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Husserls phänomenologische Methode und die Herausforderungen der Zeit-
problematik
2.1 Husserls Methodik der Phänomenologie
2.2 Die Zeitanalyse als „das schwierigste aller phänomenologischen Prob-
leme“
3. Reduktion und Abstraktion des Zeitphänomens
3.1 Reduktion und Auseinandersetzung mit Brentano
3.2 Abstraktion der Zeitwahrnehmung
4. Eine Analyse des inneren Zeitbewusstseins
4.1 Urimpression und Gegenwartsbewusstsein
4.2 Retention und die Herstellung immanenter Zeitobjekte
4.3 Husserls Konzept der Protention
4.4 Zeitfeld der Wahrnehmung und Immanenz des Bewusstseinsflusses
5. Schluss
Seite 3
Seite 4
Seite 7
Seite 8
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 15
Seite 16
Seite 17
3
1. Einleitung
Was ist Zeit? In naturwissenschaftlichen Betrachtungen führt die Auseinandersetzung mit dieser
Frage häufig zu Forschungen über Messbarkeit, Teilbarkeit und Objektivität der Zeit. Die ursprüng-
liche Fragestellung gliedert sich dabei auf verschiedene Ansätze zur Betrachtung der Eigenschaften
von Zeit auf, die oft in pragmatischen Kontexten, etwa zur Berechnung zeitlicher Abläufe, Verwen-
dung finden. Dass diese Ansätze in ihren Kontexten zwar sinnvoll sind, aber der an und für sich
philosophischen Frage nicht gerecht werden, erkennt nicht zuletzt Edmund Husserl (1859-1935). Er
wirft die Frage auf, wie sich angesichts von Erkenntnissen physikalischer und psychologischer For-
schungen seiner Zeit dem Phänomen der Zeitlichkeit philosophisch annähern ließe. Zentral wird für
ihn eine Hinterfragung des Verhältnisses, in dem objektive Zeit, der sich die Physik annähert, zur
inneren Zeitwahrnehmung steht. Als Ausgangspunkt seiner Forschung fasst er im ersten Teil seiner
Vorlesungen über das innere Zeitbewußtsein von 1905 zunächst „die Zeitauffassungen, die Erleb-
nisse, in denen Zeitliches im objektiven Sinne erscheint“1, als phänomenologische Data auf. Als
reflektierte, konstituierte Zeit stellen sie für Husserl die primäre Erkenntnisquelle zum Phänomen
der eigentlichen Wahrnehmung dar. Er folgt damit einer Beobachtung des Augustinus (354-430),
der in seinen Confessiones festhält, dass vermeintliche Messungen der Länge bestimmter Zeitobjek-
te nur Messungen in der Zeit, nicht Messungen der Zeit selbst sind, sondern sich der eigentlichen
Frage nach der Zeit selbst nur in der Weise ihrer Erscheinung nähern lasse.2 Die Frage, was Zeit ist,
kann letztlich mit diesem Ansatz zwar ebenfalls nicht beantwortet werden, gleichwohl lässt sich ihr
nach Husserls Auffassung auf keine Weise stärker annähern als mittels der Phänomenologie. Zwar
könne der Ursprung des Phänomens nicht erfasst werden, wohl aber die Weisen seiner Erscheinung.
Bei seiner Betrachtung der Zeit ist Husserls Anliegen also das folgende:
„Das Apriori der Zeit suchen wir zur Klarheit zu bringen, indem wir das Zeitbewußtsein durchforschen, seine we-
sentliche Konstitution zutage fördern und ev. die der Zeit spezifisch zugehörigen Auffassungsinhalte und Akte her-
ausstellen, zu welchen die apriorischen Zeitgesetze essentiell gehören.“3
In dieser Arbeit soll versucht werden, Husserls Ausführungen zur Phänomenologie des inneren
Zeitbewusstseins nachzuvollziehen. Hierzu soll zunächst in Kapitel 2 sein Entwurf einer phäno-
menologischen Methode rekonstruiert werden, mit dem dieser eine philosophische Wissenschaft zu
begründen sucht. Dabei findet in erster Linie eine Betrachtung seiner Werke Phänomenologie als
strenge Wissenschaft4, Die Idee der Phänomenologie
5 und Logische Untersuchungen (vornehmlich
Teil II/1)6 statt. Mittels der Herausstellung seiner Forschungskonzeption soll somit die Grundlage
1 Husserl, Edmund: „Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins“. Hamburg: Meiner 2013, S. 6.
2 Vgl. Augustinus, Aurelius: „Confessiones / Bekenntnisse. Lateinisch/Deutsch“. übers. von Kurt Flasch und Burkhard
Mojsisch. Stuttgart: Reclam 2012, S. 605 ff. 3 Husserl 2013, S. 10.
4 Husserl, Edmund: „Philosophie als strenge Wissenschaft“. Hamburg: Meiner 2009.
5 Husserl, Edmund: „Die Idee der Phänomenologie“. Hamburg: Meiner 1986.
6 Husserl, Edmund: „Logische Untersuchungen II/1. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis“.
6. Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1980.
4
für den eigentlichen Hauptteil der Arbeit in den Kapiteln 3 und 4 geschaffen werden, in denen seine
explizit auf die Phänomenologie es inneren Zeitbewusstseins ausgerichteten Arbeiten auf folgende
Fragen hin untersucht werden: Inwiefern wird das resultierende Modell Husserls methodologischen
Vorgaben gerecht? Wie weit gelingt es ihm, eine vollständige Phänomenologie der Zeitwahrneh-
mungsproblematik aufzustellen? Welchen Gehalt haben die Ergebnisse seiner Analyse?
Hierbei wird versucht, seine verschiedenen im Sammelband Zur Phänomenologie des inneren
Zeitbewußtseins7 kompilierten Vorlesungen und Schriften von 1893 bis 1911 in seinem Konzept zu
verorten und zu formalisieren, um schrittweise sein phänomenologisches Vorgehen nachzuvollzie-
hen. Im Zentrum von Husserls Schriften bezüglich der Zeitproblematik steht seine Analyse von
Konstitutionsbedingungen der Wahrnehmung. Um diese kritisch betrachten zu können, ergibt sich
die Notwendigkeit, ihre Bedingungen zu hinterfragen. Hierzu wird auch ein Bezug zu verschiede-
nen Forschungstexten über Husserls Phänomenologie im Allgemeinen und seine Arbeiten über das
Bewusstsein der Zeit im Speziellen gesucht. Ein Teil der hierzu betrachteten Arbeiten, etwa der
Autoren Hans-Joachim Pieper8 und Sven-Eric Knudsen
9, sind Vergleichswerke zwischen späteren
phänomenologischen Autoren und Husserls Grundsätzen und Forschungen, die nicht zuletzt not-
wendige Aufschlüsse über den Forschungskontext geben. Als explizit auf Husserls Untersuchungen
des inneren Zeitbewusstseins fokussierte Analyse wird darüber hinaus eine Arbeit Gui Hyun
Shins10
betrachtet.
Um eine kritische Betrachtung von Husserls Analyse vorzubereiten, sollen im folgenden Kapitel,
wie bereits beschrieben, Idee und Konzept seiner phänomenologischen Methodologie beleuchtet
werden. Damit soll nachvollzogen werden, was Husserl unter „Phänomenologie“ versteht und wel-
che Struktur phänomenologischer Forschungen er aufstellt.
2. Die phänomenologische Methode und die Herausforderungen der Zeitproblematik
2.1 Husserls Methodik der Phänomenologie
Ein wesentliches Anliegen in Edmund Husserls Werk ist es, eine philosophische Methode aus-
zuprägen, die einen Zugang zu den originären Erscheinungsformen der Welt gewähren soll: eine
Phänomenologie. In seinem Entwurf Philosophie als strenge Wissenschaft argumentiert er dafür,
dass Fortschritte in der Philosophie nur durch die Einführung einer einheitlichen Herangehensweise
erzielt werden können. Gleichzeitig kritisiert er damit die philosophische Tradition, indem er sämt-
7 Husserl 2013.
8 Pieper, Hans-Joachim: „Zeitbewußtsein und Zeitlichkeit. Vergleichende Analysen zu Edmund Husserls Vorlesungen
des inneren Zeitbewußtseins (1905) und Maurice Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung (1945)“.
Frankfurt am Main: Peter Lang 1993. 9 Knudsen, Sven-Eric: Luhmann und Husserl. Systemtheorie im Verhältnis zur Phänomenologie, Würzburg: Königs-
hausen & Neumann 2006. 10
Shin, Gui Hyun: „Die Struktur des inneren Zeitbewußtseins. Eine Studie über den Begriff der Protention in den veröf-
fentlichten Schriften Edmund Husserls“. Bern: Peter Lang 1978.
5
liche bisher vorgebrachten Werke zu „Stellungnahmen individuelle[r] Überzeugung, der Schulauf-
fassung, des ‚Standpunktes‘“11
degradiert. Zwar erkennt er die bisweilen in philosophischer Weltli-
teratur hervorgebrachte Arbeit als Geistesleistungen an, nur wird für ihn durch das Fehlen einer
festen Methodik die Möglichkeit vergeben, durch die Philosophie einen Beitrag zum wissenschaft-
lichen Diskurs zu leisten.12
Mit dem Versuch einer voraussetzungslosen Betrachtung von Phänome-
nen könnte sich diesem Ziel angenähert werden.
Einer solchen Betrachtung wiederum müsste, wie Husserl erkennt, zunächst eine Reduktion
vermeintlich hinderlicher Voraussetzungen des Zugangs im Denken vorausgehen. Eine solche Re-
duktion, in der ein „Ausschluß jeglicher faktischer Kontingenz bzw. kontingenter Faktizität“13
statt-
finden soll, stellt daher die erste Stufe einer phänomenologischen Betrachtung dar. Entscheidend
hierfür ist eine Unterscheidung zwischen immanenter und transzendenter Erkenntnis. Zu letzterer
zählt Husserl „die Erkenntnis der objektiven Wissenschaften, der Natur- und Geisteswissenschaften,
aber näher besehen auch der mathematischen […]“14
. Es gilt folglich, in einer phänomenologischen
Reduktion, den „Ausschluß aller transzendenten Setzungen [zu] vollziehen“15
, um in den Bereich
(reeller) Immanenz einzutreten. Diesen Bereich erfasst er in Rückgriff auf die cartesianische Zwei-
felsbetrachtung:
„[Das] Sein der cogitatio, des Erlebnisses während des Erlebens und in schlichter Reflexion darauf, ist unzweifel-
haft; das schauende direkte Erfassen und Haben der cogitatio ist schon ein Erkennen, die cogitationes sind die ersten
absoluten Gegebenheiten.“16
Die so gefassten „cogitationes“ (deutsch: „Gedanken“) beziehen sich zwar auf eine „Sphäre von
absoluter Gegebenheit“17
, auf die Husserls Philosophie aufbaut. Er warnt gleichwohl vor einem
falschen Verständnis des Begriffs „cogitatio“: Auf die Weise, wie Descartes ihn etwa in seinen Me-
ditationes verwendet, gehe darin bereits eine Reflexion des eigentlich phänomenal originären
Wahrnehmens auf. Um eine Phänomenologie der „cogitationes“ aufzustellen, bedürften diese im
Verständnis Descartes‘, wie er schreibt, ebenfalls einer Reduktion, denn das „erlebende Ich, das
Objekt, der Mensch in der Weltzeit, das Ding unter Dingen etc. ist keine absolute Gegebenheit, also
auch nicht das Erlebnis als ein Erlebnis“18
. Ein Schluss aus den Logischen Untersuchungen erhellt
Husserls weiteres Vorgehen in einer Annäherung an absolute Gegebenheiten:
„Die Dingerscheinung (das Erlebnis) ist nicht das erscheinende Ding (das uns vermeintlich in leibhaftiger Selbstheit
‚Gegenüberstehende‘). Als dem Bewußtseinszusammenhang zugehörig, erleben wir die Erscheinungen als der phä-
nomenalen Welt zugehörig, erscheinen uns die Dinge. Die Erscheinungen selbst erscheinen nicht, sie werden er-
lebt.“19
11
Husserl 2009, S. 5. 12
Vgl. ebd., S. 5 f. 13
Pieper 1993, S. 23. 14
Husserl 1986, S. 5. 15
Ebd., S. 5. 16
Ebd., S. 4. 17
Ebd., S. 32. 18
Ebd., S. 7. 19
Husserl 1980, S. 350.
6
Husserls Folgerung, dass erscheinende Dinge hinsichtlich ihres Erscheinens im Bewusstseinszu-
sammenhang zu betrachten sind, da sie in ihm für die Wahrnehmung originär gegeben sind, bietet
letztlich ein gedankliches Fundament seiner Phänomenologie als Wissenschaft: das der Evidenzen.
In einem zweiten Schritt an die phänomenologische Reduktion anknüpfend, muss Husserl zufol-
ge eine „ideierende Abstraktion“20
stattfinden, deren Ziel es ist, von reeller Immanenz auf absolute
Gegebenheiten zu schließen. Das „reine Phänomen, das reduzierte“21
liegt, wenn es dem Bewusst-
seinszusammenhang zugehörig ist, vor jeder Reflexion, weshalb es eben erst durch Abstraktion lo-
gisch greifbar wird. Nunmehr wird eine besondere Erscheinung zur überzeitlich identisch bleiben-
den Geltungseinheit erhoben und von der konkret wahrgenommenen Erscheinung auf die Weise
seines Erscheinens in der Wahrnehmung geschlossen. Die Grundfrage dieses Vorgehens könnte
etwa lauten: Was sind die wesenhaften Strukturen bestimmter Erscheinungen? Wenn Phänomene
originär im Bewusstseinszusammenhang zu finden sind, wird die geistige Intuition ihnen gegenüber
zum Untersuchungsgegenstand. Hierzu hält Shin fest:
„Diese [die Intuition] beinhaltet folgenden Sachverhalt: Die Phänomenologie nimmt die ‚originäre Gegebenheit‘
hin, und zwar nur in ihren Phänomenen; sie muss aber für eine wissenschaftstheoretisch fundierte Erkenntnis in der
Intuition ‚geschaut‘ werden.“22
Durch ein solches Abstrahieren auf ein Ideal wird also eine Wesensschau als das Kernanliegen
der Phänomenologie möglich. Die Intuition stellt sich dabei für Husserl als das zweite Fundament
einer phänomenologischen Wissenschaft heraus.23
Um den dritten Schritt nachzuvollziehen, ist es notwendig, die Doppeldeutigkeit des Begriffs
„Phänomen“ zu erfassen, die für Husserl „vermöge der wesentlichen Korrelationen zwischen Er-
scheinen und Erscheindendem“24
besteht. Eine umfassende Erforschung dieser Korrelation in zwi-
schen Erkenntnisphänomen und -objekt stellt für ihn eine Herausforderung dar:
„[Es] ist leicht, allgemein von der Korrelation zu sprechen, aber sehr schwer, die Art, wie ein Erkenntnisobjekt sich
in der Erkenntnis konstituiert, zur Klarheit zu bringen. Und die Aufgabe ist nun doch die, innerhalb eines Rahmens
reiner Evidenz oder Selbstgegebenheit allen Gegebenheitsformen und allen Korrelationen nachzugehen und an allen
die aufklärende Analyse zu betreiben.“25
Es gilt somit die „Komplexionen, ihre Zusammenhänge der Einstimmigkeit und Unstimmigkeit
und die daran zutage tretenden Teleologien“26
zu bestimmen, die Husserl als gegenständliche Er-
kenntniseinheiten ansieht, als welche sie Teil der Erkenntnisakte sind.27
Die Frage nach der Korre-
lation ist die nach den Konstitutionsbedingungen für die Wahrnehmung von Phänomenen, also eine
Weiterführung des zweiten Schrittes.
„Es gilt nun, schrittweise den Gegebenheiten in allen Modifikationen nachzugehen, den eigentlichen und uneigentli-
chen, den schlichten und synthetischen, den sozusagen mit einem Schlage sich konstituierenden und den sich ihrem
20
Husserl 2009, S. 8. 21
Ebd., S. 7. 22
Shin 1978, S. 40. 23
Vgl. hierzu ebd. 24
Husserl 1986., S. 14. 25
Ebd., S. 12 f. 26
Ebd., S. 13. 27
Vgl. ebd.
7
Wesen nach nur schrittweise aufbauenden, den absolut geltenden und den eine Gegebenheit und Geltungsfülle sich
im Erkenntnisprozeß in unbegrenzter Steigerung zueignenden.“28
Da die Phänomenologie die Untersuchung von immanenter Erkenntnis ist, kann sich Erschei-
nungen nur in der Weise ihres Erscheinens angenähert werden; die Weise ihres Erscheinens selbst
wird zum Untersuchungsgegenstand. Ihr Erscheinen muss also als Konstituierendes des Erschei-
nenden gesetzt und als Gegenstand betrachtet werden, um immanente Erkenntnis über die Weise
seines Herantretens und das Wesen des Erscheinenden zu erhalten. Für die Phänomenologie ist es
dabei unerheblich, wie sich das Erscheinende außerhalb der Wahrnehmung konstituiert.
Wird das Erscheinen als Korrelation des Erscheinenden und des Bewusstseins betrachtet, lässt
sich aus der analytischen Reflexion eines Erscheinenden die darin aufgehende geistige Konstituti-
onsleistung erforschen. Ziel ist es also, die Vermögen zu erfassen, die das Erscheinen des Erschei-
nenden im Geiste ermöglichen, da dies für Husserl die einzig immanente Erkenntnis ist, die vom
Erscheinenden möglich ist. Hieraus ergibt sich für Shin:
Die ‚Wesensschau‘ der ‚Sachen selbst‘ ist das Hauptanliegen der Phänomenologie. Aufgrund dieses Prinzips aller
Prinzipien, wie Husserl es nennt, verliert die Was-Frage in der Phänomenologie Relevanz. Demgegenüber wird die
Wie-Frage, nämlich wie die Erkenntnis dieser „originären Gegebenheit“ möglich ist, zur Grundfrage.“29
Die Frage nach der Zeit etwa kann von der Phänomenologie nur hinsichtlich der Weise unseres
Bewusstseins von ihr beantwortet werden. Denn was Zeit als äußere Weltzeit ist, ist eine Frage nach
transzendentem Wissen; doch über die Frage nach der Konstitution der Zeitlichkeit im Bewusstsein
lassen sich gemäß der Argumentation sehr wohl immanente Erkenntnisse gewinnen. Hierzu nähert
sich Husserl in mehreren Schriften einer vollständigen Phänomenologie des inneren Zeitbewusst-
seins an.
2.2 Die Zeitanalyse als „das schwierigste aller phänomenologischen Probleme“
Der Begriff „Phänomen“ stellt sich in Husserls Terminologie also als zweidimensional heraus
und bezeichnet sowohl das eigentlich Erscheinende als auch dessen Erscheinen selbst „als Korrela-
tion zwischen Erkenntnisakt und Erkenntnisgegenstand“30
. Es wurde gezeigt, dass nur letztere Di-
mension für ihn Untersuchungsgegenstand der Phänomenologie sein kann, nämlich indem durch
eine Betrachtung der Weisen des Erscheinens Konstitutionsleistungen logisch erfassbar werden.
Dadurch lässt sich im Falle des Zeitphänomens eingrenzen, inwiefern das, was wir etwa objektive
Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nennen, vom Geiste ausgehend für unser Bewusstsein
konstituiert wird, oder wie sich Zeitobjekte, wie zum Beispiel einzelne Töne oder ganze Musikstü-
cke, im Bewusstsein entfalten. Die Frage, der Husserl nachgeht, ist also die nach dem ursprüngli-
chen inneren Bewusstsein der Zeit, in dem „sich alle Impressionen, die primären Inhalte wie die
28
Ebd. 29
Shin 1978, S. 40. 30
Ebd., S. 41.
8
Erlebnisse [konstituieren], die ‚Bewußtsein von …‘ sind“31
. Dies wird durch Piepers Auseinander-
setzung mit Husserl deutlich:
„Als allem Bewußtsein im Sinne von Akten zugrundeliegend und deren konstitutive Leistung ermöglichend muß
demnach die ursprüngliche Schicht des ‚inneren Bewußtseins‘ angesehen werden, in dem sich gleichermaßen ‚Emp-
findungsinhalte‘ […] und ‚intendierende Erlebnisse‘ als potentielle Gegenstände der Reflexion konstituieren […],
und zwar hinsichtlich ihres zeitlichen Charakters.“32
Betrachtet man Zeitobjekte und zeitliche Akte also als Reflexionsgegenstände, und erkennt man
das ursprünglich konstituierende Bewusstsein als Quelle immanenten Wissens über ihre Konstituti-
on an, so ergibt sich eine notwendige Setzung:
„Es selbst, das ‚zeitkonstituierende Bewußtsein‘, muß so als außerhalb der Zeit, als die jeglicher Konstitution von
Zeitlichem den Grund gebende ‚Urspontaneität‘ […] verstanden werden, die – als sie die Zeit hervorbringt – nicht
selbst in der Zeit, nichts zeitlich ‚Objektives‘ […] mehr sein kann.“33
Daraus folgt für Husserl, dass nicht mehr „[von] einer Zeit des letzten konstituierenden Bewußt-
seins […] gesprochen werden [kann]“34
. Die Anerkennung des konstituierenden geistigen Bewusst-
seins als Absolutes und Zeitloses mag als fragliche Bestimmung anmuten, zumal das menschliche
Bewusstsein durchaus eine reflexive Zeitlichkeit hat. Aus dieser Problematik heraus kommt Husserl
zu der Erkenntnis die Zeitanalyse als „das schwierigste aller phänomenologischen Probleme“35
an-
zuerkennen. Dennoch sie diese drastische Festsetzung für sein Vorgehen unerlässlich. Denn ist es
Husserl in seinem Forschungsanliegen nur an immanenter Erkenntnis gelegen, wird diese zum not-
wendigen Paradigma. Da Husserl die Weisen des Bewusstseins von Zeitlichkeit erforscht, stellt er
letztlich den Versuch an, Konstitutionsleistungen des Zeitbewusstseins zu benennen. Und als bloße
Vermögen, als Intuitionen, lassen sie sich als nicht-zeitlich auffassen. Die Zeitlichkeit des Bewusst-
seins selbst kann allerdings nicht phänomenologisch und damit auch nicht immanent erfasst wer-
den, sodass dessen Ausklammerung an dieser Stelle bereits ein Vorgriff auf die Reduktion als erste
Stufe der Betrachtung darstellt.
3. Reduktion und Abstraktion des Zeitphänomens
3.1 Reduktion und Auseinandersetzung mit Brentano
In seinen Vorlesungen von 1905 stellt Husserl eine solche Reduktion an, um den Forschungsge-
genstand einer Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins freizusetzen und zu dessen „absoluten
Gegebenheiten“ zu gelangen. Diese vollzieht er in Auseinandersetzung mit den Abhandlungen des
Philosophen und Psychologen Franz Brentano über den Ursprung der Zeit. Brentano gelangte zu
dem Schluss, der Ursprung des Zeitbewusstseins liege in der „Entstehung der unmittelbaren Ge-
dächtnisvorstellungen, […] die sich nach einem ausnahmslosen Gesetz an die jeweiligen Wahrneh-
31
Husserl 2013, S. 97. 32
Pieper 1993, S. 53 f. 33
Ebd., 54. 34
Husserl 2013, S. 85. 35
Ebd., S. 307.
9
mungsvorstellungen ohne jede Vermittlung anschließen“36
. Damit wird die Leistung beschrieben, in
der ein Eindruck über eine kurze Zeitspanne hin gegenwärtig bleibt, als das erschaffende Element
des Zeitphänomens. Dass eine solche Vergegenwärtigung trotz ihrer Unmittelbarkeit stets eine Mo-
difikation des Eindrucks im Geist einschließt, verdeutlicht das Beispiel des Musikhörens, das
Husserl in seiner Rekonstruktion aufgreift: Dass beim Hören einer Melodie der bereits gehörte Teil
in einer bestimmten Zeitlichkeit bewusst bleibt, also zeitlich modifiziert und nicht in bloßer Gleich-
zeitigkeit aller Töne erinnert wird, ermöglicht das ästhetische Erlebnis des Musikhörens.37
Durch
die Vergegenwärtigung der Töne und ihrer geistigen Abfolge entsteht letztlich die abstrakte Vor-
stellung einer Melodie im Geist, deren einzelnen Töne ihre bestimmten Plätze und Zeitmaße haben.
Und die stetige Anknüpfung zeitlich modifizierter neuer Vorstellung an die gegebenen nennt
Brentano, wie Husserl herausstellt, „ursprüngliche Assoziation“38
. Da Brentano ausnahmslos alle
vergegenwärtigenden Akte als Tätigkeiten der Phantasie definiert39
, fällt für ihn der Untersu-
chungsgegenstand des Zeitbewusstseins in das Feld der Phantasie. Und da er nur den Punkt der Ge-
genwart als Reales setzt, sind für ihn die Modifikation von Zeitobjekten oder auch ein Bewusstsein
der Zukunft reine Setzungen der Vorstellung.40
Damit gehen für ihn radikale Rückschlüsse auf die
Wahrnehmung einher:
„In der Konsequenz seiner Theorie kommt Brentano dazu, die Wahrnehmung von Sukzession und Veränderung zu
leugnen. Wir glauben eine Melodie zu hören, also auch eben Vergangenes noch zu hören, indessen ist die nur
Schein, der von der Lebhaftigkeit der ursprünglichen Assoziation herrührt.“41
Husserl erkennt ebenfalls an, dass die abstrakte Vorstellung eines Zeitobjekts, wie etwa einer
Melodie, eine eigentümliche Leistung der Phantasie ist, die einem allgemeinen Gesetz zu folgen
scheinen.42
Dennoch sieht er Brentanos Darstellungen in grundlegenden Punkten als fehlerhaft und
damit ungültig an, denn für ihn ist das Phänomen der inneren Zeitwahrnehmung keineswegs bloß in
der Phantasie zu betrachten. Zunächst weist er darauf hin, dass eine essenzielle Unterscheidung in
Brentanos Modell keine Verwendung findet:
„Es ist nun höchst auffallend, daß Brentano den […] Unterschied von Zeitwahrnehmung und Zeitphantasie, den er
unmöglich übersehen haben kann, in seiner Theorie der Zeitanschauung gar nicht berücksichtigt.“43
Letztlich ist der Schritt, alles Vergangene wie auch Zukünftige in das Feld der Phantasie zu ver-
lagern, ein Schritt Brentanos, den Husserl nicht nachvollzieht, da für ihn die „Einheit des Gegen-
wärtiges und Vergangenes umspannenden Bewußtseins […] ein phänomenales Datum“44
ist. Daher
erscheint es ihm fraglich, „ob wirklich, wie Brentano es behauptet, das Vergangene in diesem Be-
36
Unveröffentlichter Vorlesungstext Brentanos, zitiert nach Husserl 2013, S. 11. 37
Vgl. ebd., S. 11 f. 38
Vgl. ebd., S. 14. 39
Vgl. ebd., S. 17. 40
Vgl. ebd., S. 14 ff. 41
Ebd., S. 14. 42
Vgl. ebd., S. 12. 43
Ebd., S. 17. 44
Ebd., S. 16 f.
10
wußtsein in der Weise der Phantasie erscheint“45
. Auf die Weise der Gegebenheit von Vergange-
nem im Bewusstsein kommt er an späterer Stelle, in seiner Analyse, zu sprechen. Doch zunächst
scheint es für ihn nicht notwendigerweise zu folgen.
Darin deutet sich eine zweite unerlässliche Unterscheidung an, die Brentano in Husserls Augen
übersieht, nämlich diejenige zwischen Auffassungsinhalt, Akt und aufgefasstem Gegenstand des
Zeitbewusstseins.46
Es ist für ihn unschlüssig, worauf sich die Vorstellungen der ursprünglichen
Assoziationen beziehen, wenn nicht auf zeitliche Akte. Demnach gäbe es nur ein untrennbares
Wahrnehmungsphänomen, innerhalb dessen jede Unterscheidung, also bspw. verschiedene Farben
oder Töne, geistigen Ursprungs ist und auf Assoziationen zurückgeht; und das zeitliche Element der
Wahrnehmung hätte seinen einzigen Ursprung in der Phantasie.47
Dem jedoch widerspricht Husserl
grundlegend, indem er schreibt:
„Zeitcharaktere, Sukzession und Dauer finden wir nicht bloß an den primären Inhalten vor, sondern auch an den
aufgefaßten Objekten und den auffassenden Akten.“48
Was er hier „aufgefasste Objekte“ und „auffassende Akte“ nennt, bezeichnet gemäß der in Kapi-
tel 2.1 angestellten Definition die zwei Dimensionen des Zeitphänomens. Die hier vorgenommene
Unterscheidung lässt sich wiederum am Beispiel des Hörens eines Tons nachvollziehen:
„Der Ton fängt an und hört auf. Die Einheit dieses Vorganges ist ein Fluss mit vergangenen, gegenwärtigen und
zukünftigen Phasen, die wiederum im Fluss des Zeitbewusstseins mit vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen
Phasen wahrgenommen werden.“49
Sofern sich im Bewusstsein der Zeit, wie es durch die auffassenden Akte gebildet wird, Zeitcha-
raktere, Sukzession und Dauer finden, lassen diese sich also phänomenologisch untersuchen. Und
dies ist für Husserl die Ursache dafür, warum Brentanos Ausführungen das Phänomen der Zeit-
wahrnehmung verfehlen, wenn sie primäre Inhalte nur im Geist annehmen. Denn er schreibt:
„Ist schon die originäre Zeitanschauung ein Geschöpf der Phantasie, was unterscheidet dann diese Phantasie von
Zeitlichem von derjenigen, in welcher ein früher vergangenes Zeitliches bewußt ist […]?“50
Es gilt somit, positiv ausgedrückt, immanente Kenntnisse der als reell erfassten Zeitformen zu
analysieren. Der immanente Ursprung der Zeit verschiebt sich auf die eigentliche Erfahrung der
Zeit, die Brentano in seinen Ausführungen letztlich völlig ausgeklammert hat. Für Husserl bildet sie
jedoch den eigentlichen Untersuchungsgegenstand einer Phänomenologie des inneren Zeitbewusst-
seins. Er zieht somit den Schluss, dass aufgrund der nachgewiesenen Fehler in Brentanos Ansatz die
Frage, wie ein Zeitbewusstsein möglich und zu verstehen ist, noch völlig offen ist. Ein Zugang ist
für Husserl jedoch hiermit geschaffen. Er vollzieht die phänomenologische Reduktion letztlich
rückwärtsgewandt, indem er Brentanos Schlüsse als zu weit gehend erfasst. Den Ursprung der Zeit
45
Ebd., S. 17. 46
Ebd., S. 18. 47
Vgl. ebd., S. 18 48
Ebd., S. 18. 49
Shin 1978, S. 49. 50
Husserl 2013, S. 17.
11
in der Phantasie zu betrachten, ist für ihn fehlerhaft. Er verdeutlicht dies, indem er betont: „Bewußt-
sein ist nichts ohne Impression“51
.
3.2 Abstraktion der Zeitwahrnehmung
Ein, wie Shin festhält, im psychologischen Diskurs nicht unumstrittener Ansatz Brentanos, den
Husserl dagegen aufnimmt, ist der, das Bewusstsein als einen Strom zu erfassen.52
Für Husserl ist
die Betrachtung eines fließenden Bewusstseins ein notwendig Gegebenes sowohl für die Kontinui-
tät des Gedächtnisses als auch für die Einheit des Ichs. Hieraus folgt für Shin:
„Bewusstseinsstrom ist für Husserl keine metaphysische Konstruktion, sondern ein originäres phänomenologisches
Datum.“53
Der Bewusstseinsstrom ist, dem folgend, für Husserl nach Reduktion und Ausschluss jeglicher
Kontingenz als das reduzierte und reine Phänomen anzusehen, von dem ausgehend Zeiterfahrungen
konstituiert werden. Um die Weise dieses Vorgangs nachzuvollziehen und seine Analyse vorzube-
reiten, stellt er zunächst eine Abstraktion des Zeitbewusstseins an, die das Verhältnis von Bewusst-
seinsfluss und Zeit nachvollzieht. Damit versucht Husserl, sich dem Betrachtungsfeld objektiver
Zeitwahrnehmung anzunähern, wozu er zunächst eine Analogie der Farbwahrnehmung wählt:
„Das empfundene Rot ist ein phänomenologisches Datum, das, von einer gewissen Auffassungsfunktion beseelt, ei-
ne objektive Qualität darstellt; es ist nicht selbst eine Qualität. Eine Qualität im eigentlichen Sinne, d. h. eine Be-
schaffenheit des erscheinenden Dinges, ist nicht das empfundene, sondern das wahrgenommene Rot.“54
Die Frage, der er nachgeht, ist also diejenige nach der Qualität zeitlichen Wahrnehmens. Dies
macht für ihn eine Unterscheidung zwischen Empfinden und Wahrnehmen von Zeit notwendig:
„Nennen wir empfunden ein phänomenologisches Datum, das durch Auffassung als leibhaft gegeben ein Objektives
bewußt macht, das dann objektiv wahrgenommen heißt, so haben wir in gleichem Sinne auch ein ‚empfundenes‘
Zeitliches und ein wahrgenommenes Zeitliches zu unterscheiden. Das letztere meint die objektive Zeit.“55
Husserl sieht es also als notwendig an, subjektives Empfinden der Zeit aus seiner phänomenolo-
gischen Betrachtung auszuklammern und lediglich von ihm ausgehend auf ein zugrundeliegendes
objektives Wahrnehmen zu abstrahieren. Auf Grundlage dieses Schlusses kommt er auf ein dreistu-
figes Modell.
Dessen erste Stufe umfasst eben den „Fluß des Bewusstseins“56
als immanente, reduzierte Ober-
fläche des Phänomens. Die zweite Stufe bildet die „präempirische ‚Zeit‘ mit Vergangenheit, ‚Jetzt‘,
Nachher; und das präempirisch ‚Seiende‘, das dauernde und sich verändernde […]“57
. Diese Set-
zung geht aus seiner Kritik an Brentano hervor, aus der dieser seine Theorie der präempirischen,
reellen Gegebenheit der Zeitformen entwickelt hat, auf die in dieser Arbeit in der Auseinanderset-
51
Knudsen 2006, S. 38. 52
Vgl. Shin 1978, S. 45. 53
Shin 1978, S. 46. 54
Husserl 2013, S. 7. 55
Ebd. 56
Vgl. ebd., S. 319. 57
Vgl. ebd.
12
zung mit Urimpression und Gegenwartsbewusstsein erneut eingegangen wird. Die letzte der Stufen
ist für Husserl vielmehr als eine mehrgliedrige Gruppe gleichrangiger Stufen zu betrachten, und
umfasst die „Stufen des empirischen Seins, des Seins der Erfahrung, das erfahrungsmäßig Gegebe-
ne und Gedachte, das Sein, das wir reale Wirklichkeit nennen“58
, also die Konstitution des Realen
im Vorrealen.
Letztlich wird durch dieses Modell nachvollzogen, wie sich der Bewusstseinsstrom zu Zeitobjek-
ten, Zeiterfahrungen und zu durch Messungen nachvollzogener objektiver Zeit verhält. Damit lässt
sich der Frage annähern, welches die konkreten Konstitutionsleistungen des Zeitbewusstseins sind.
Dieser geht er letztlich im analytischen Teil seiner Phänomenologie nach, die in Kapitel 4 betrachtet
wird. Indem er bestimmte Leistungen grundlegend als für die Konstitution des Zeitphänomens not-
wendig betrachtet, stellt Husserl letztlich den Versuch an, diese zu konzeptualisieren, was im Fol-
genden gezeigt werden soll.
4. Analyse des inneren Zeitbewusstseins
4.1 Urimpression und Gegenwartsbewusstsein
Husserl knüpft in seiner Analyse zunächst an eine Erkenntnis des Augustinus an:
„Im strengen Sinne müsste man wohl sagen: Es gibt drei Zeiten, die Gegenwart von Vergangenem, die Gegenwart
von Gegenwärtigem und die Gegenwart von Zukünftigem. Denn diese drei sind in der Seele in einem gewissen Sin-
ne, und anderswo finde ich sie nicht […].“59
Es fällt auf, dass in dieser Passage der Confessiones das, was als „strenger Sinn“ einer philoso-
phischen Betrachtung benannt wird, durch eine moderne Lesart sehr wohl mit Husserls Konzeption
der Phänomenologie vereinbar ist, auch wenn die philosophischen Absichten des Augustinus in
keiner Weise vorurteilsfrei phänomenologisch waren. Hierzu schreibt Shin:
„Augustinus vermochte Husserl […] keinen direkten Anlass zur Auseinandersetzung mit dem Zeitbewusstsein zu
geben, vermutlich deswegen, weil die Augustinische Thematisierung der Zeit unmittelbar deren Geschaffensein vo-
raussetzt und dem Motiv unterstellt ist, die Vergänglichkeit des Geschöpfes zu bekennen und die Ewigkeit Gottes zu
lobpreisen.“60
Doch Husserl erkennt in den Passagen der Confessiones zur Zeitproblematik eine unüberholte
Aktualität und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Wahrnehmungsphänomen der Zeitlich-
keit. Denn Augustinus stellt fest, dass, wenngleich sich in der Alltagssprache „Vergangenheit“,
„Gegenwart“ und „Zukunft“ als Namen für die drei Zeitformen festgesetzt haben, dies nur Konzep-
te sind und das Phänomen der eigentlichen Zeitwahrnehmung selbst ein anderes ist. Er spezifiziert
die drei Zeitformen weiter zur „Gegenwart des Vergangenen als Erinnern, [der] Gegenwart des
Gegenwärtigen als Anschauen [und der] Gegenwart des Zukünftigen als Erwarten“61
.
58
Vgl. ebd. 59
Augustinus 2012, S. 599. 60
Shin 1978, S. 42. 61
Augustinus 2012, S. 599.
13
Auch Husserl erkennt, dass eine Phänomenologie der Zeitwahrnehmung von der unmittelbaren
Erscheinung der Zeit in der Gegenwart auszugehen hat, und stellt fest: Dem Bewusstsein der Suk-
zession, einer Reflektion der Vergangenheit oder der Entwicklung einer Erwartung an die Zukunft
geht stets eine ursprüngliche Wahrnehmung voran. Diese erfasst Husserl als „Urimpression“, wel-
che für ihn den eigentlichen Kern des Phänomens der Zeitwahrnehmung ausmacht:
„Die Urimpression ist der absolute Anfang dieser Erzeugung, der Urquell, das, worauf alles andere stetig sich er-
zeugt. Sie selber wird nicht erzeugt, sie entsteht nicht als Erzeugtes, sondern durch genesis spontanea, sie ist Urzeu-
gung. Sie erwächst nicht (sie hat keinen Keim), sie ist Urschöpfung.62
Von der Urimpression aus entfaltet sich also die Wahrnehmung von Zeitlichkeit. Sie ist das fort-
laufend gegenwärtige Wahrnehmen selbst und damit die Schnittstelle zwischen der eigentlich er-
scheinenden Zeit und dem Geist. Wenn Bewusstsein immer gleich ein Eindruck von etwas und da-
mit nie unbezüglich ist, konstituiert sich ein Bewusstsein der Zeitlichkeit durch fortlaufende Verän-
derungen im Wahrgenommenen. Beispielsweise ein Gegenwartsbewusstsein ist nicht ein ausdeh-
nungsloses Jetzt, als welches Husserl die Urimpression fasst; sondern es ist ein bereits aus Urimp-
ressionen heraus konstituiertes Bewusstsein, etwa davon, gegenwärtig einen bestimmten Moment
zu erleben. Knudsen findet Beispiele für Ausdehnungen des Gegenwartsbewusstseins:
„Die Gegenwart erfahre ich konkret als den Zeitpunkt eines Fußballspiels, der Abfassung eines Briefes, der Anhö-
rung einer Melodie usw.“63
Von der Gegenwart aus wird vergangenen Ereignissen, wie er aus Husserls Ausführungen, eine
unverrückbare Stelle im Bewusstseinsstrom zugewiesen, und sie erlangen ein erstes, der objektiven
zeitlichen Verortung von Wahrnehmungsgegenständen noch vorgelagertes „Ansichsein“. Das Ge-
genwartsbewusstsein ist somit zwar das ursprünglichste Bewusstsein der Zeit, da Zukunft und Ver-
gangenheit im Bewusstsein, wie Augustinus bereits erkannte, nur durch Vergegenwärtigung existie-
ren. Doch Husserl erkennt, dass auch ihm bereits eine Konstitutionsleistung vorausgeht, die ihren
Quellpunkt in der Urimpression hat.64
4.2 Retention und die Herstellung immanenter Zeitobjekte
Um in zeitlich wahrgenommenen Abläufen eine Kontinuität zu erkennen, bedarf es, wie Husserl
ausführt, einer Befähigung zur Retention. Diese ist nicht als bloße Wiedererinnerung zu verstehen,
sondern als eine Art der sich-erinnernden Vergegenständlichung und Aktualisierung eines Aspekts,
der zwar vergangen ist, aber in die Gegenwart hineinreicht. Der Begriff „Retention“ bezieht sich
also auf das Phänomen, einen Ton als eine Einheit und ein Musikstück als ein Ganzes wahrnehmen
zu können. Dieses ließe sich wie folgt fassen: Solange ich einen vergangenen Ton „in einer ‚Re-
tention‘ [habe], und solange sie anhält, hat er seine eigene Zeitlichkeit, ist er derselbe, seine Dauer
62
Knudsen 2006, S. 38. 63
Knudsen 2006, S. 38. 64
Ebd.
14
ist dieselbe. Ich kann die Aufmerksamkeit richten auf die Weise seines Gegebenseins.“65
Dadurch
also, dass ich die Zeitlichkeit vergangener Töne für meine Gegenwart zugänglich machen und re-
produzieren kann, setze ich die Töne, die meine Gegenwart durchlaufen, zu einem Lied zusammen,
bzw. allgemeiner: verschiedene Eindrücke zu einem kontinuierlichen Geschehen. Durch Retention
entsteht ein Bewusstsein von Dauer. Die Retention nimmt für Husserl innerhalb der Gedächtnisleis-
tungen eine Sonderstellung ein, weshalb er sie gegenüber anderen reproduktiven Erinnerungsleis-
tungen, die er als sekundär setzt, als primäre Erinnerung erfasst.66
Die Charakteristika der Retention
als primäres Erinnerungsvermögen verdeutlicht ein von Husserl erstelltes Diagramm des Ab-
laufsphänomens, das im Folgenden erläutert wird.67
Mit seinem Konzept der Retention begründet Husserl das Phänomen gleichmäßig und fließend
herunterrückender, vergehender Zeitpunkte in der zeitlichen Wahrnehmung. Denn mittels der Re-
tentionsleistung werden die ursprünglichen Impressionen aufeinanderfolgender Jetztpunkte zu ei-
nem Kontinuum geschlossen. Dieses gleicht einem „Kometenschweif“68
aus vergangenen, abklin-
genden Impressionen in der gegenwärtigen Wahrnehmung, der einen Bezug zwischen vergangenen
Punkten und einer neuen Urimpression herstellt. So enthält die Retention die vom Start- bzw.
Quellpunkt eines immanenten Zeitobjekts (im Diagramm Punkt A) bis zum Endpunkt (P) erfasste,
fortlaufende Kontinuität desselben.69
Von einem beliebigen Jetztpunkt nach dem Endpunkt des
Zeitobjekts aus (E ≥ P) bleibt diese Kontinuität erhalten.70
Auf diese Weise der ständigen Modifika-
tion vergangener Impressionen und Modifikationen konstituiert sich für unser Gedächtnis eine ge-
schlossene Zeitlichkeit von Zeitobjekten, die diese auch in der Vergegenwärtigung eines späteren,
sekundären Erinnerns besitzen.
Dem liegt nach Husserl eine grundlegende Betrachtung des Zeitfelds der ursprünglich realen
Zeitwahrnehmung zugrunde. Der Bewusstseinsstrom wird durch die gleichzeitige Gegebenheit von
Impression und rententionalem Bewusstsein in der wahrnehmenden Gegenwart erzeugt. In jenem
Kometenschweif retentionalen Bewusstseins, der als Modifikation des soeben Vergangenen einer
Urimpression der realen Zeit anhängt, scheint das Vergangene in einer steten Schwächung auszu-
klingen. Das länger Vergangene ist also im Jetztbewusstsein weniger präsent als das weniger lange
Vergangene. Dadurch entsteht mithilfe der retentionalen Modifikation eine im Geiste ausgedehnte
Zeitwahrnehmung, die in die Unmerklichkeit reicht und von ihr begrenzt zu sein scheint. Damit ist
eine der Grenzen des von Husserl erfassten originären Zeitfelds der Wahrnehmung benannt, das
„sich gleichsam über die wahrgenommene und frisch erinnerte Bewegung und ihre objektive Zeit
65
Husserl 2013, S. 26. 66
Vgl. ebd., S. 38 ff. 67
Das Diagramm hängt dieser Arbeit als „Anhang 1: Diagramm des Ablaufsphänomens“ an. 68
Husserl 2013, S. 38. 69
Vgl. ebd., S. 31. 70
Vgl. ebd.
15
[verschiebt], ähnlich wie das Gesichtsfeld über den objektiven Raum“71
. Um es in seiner Ganzheit
nachzuvollziehen, muss zunächst eine weitere Konstitutionsleistung betrachtet werden: die Pro-
tention.
4.3 Husserls Konzept der Protention
Dass Husserl der Retentionsleistung in seinen Vorlesungen weit mehr Aufmerksamkeit schenkt
als der der Protention, kann darin begründet liegen, dass ersterer in der von Husserl analysierten
Konstitution eine stärkere Bedeutung zukommt. Während sie sich nunmehr als das „Bewußtsein
vom eben Gewesenen“72
verstehen lässt, bildet die Protention ihr zukunftsgerichtetes Pendant: das
Bewusstsein davon, „daß überhaupt etwas kommen wird“73
. Sie ist der zukunftsgerichtete „Kome-
tenschweif der Wahrnehmung“74
und bildet als solcher ebenfalls einen Teil der Extension des
wahrnehmenden Zeitfelds. Da er sich als primäres, unmittelbares Zukunftsbewusstsein verstehen
lässt, gelangt Pieper zu der Einsicht, dass, was Husserl in der Kontrastierung zwischen Retention
und sekundärer Erinnerung herausarbeitet, ebenfalls mutatis mutandis Aufschluss über die Protenti-
on gibt.75
Diesem Ansatz wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.
Während in der Retention als Zeitobjekte aus Urimpressionen konstituiert werden, ist es Leis-
tung der Protention, eine mehr oder weniger bestimmte Erwartung an die unmittelbare Zukunft her-
anzutragen, die zum einen die allgemeine Erwartung sein kann, dass sich der Wahrnehmung über-
haupt eine Zukunft anschließen wird, die die Urimpression durchlaufen wird. Zum anderen können
der Protention konkrete Erwartungen an die Zukunft immanent sein, für die die Erfahrung eine
wichtige Rolle spielt. Für die Konstitution von Zeitobjekten ist dies eine entscheidende Leistung, da
das Anhören einer Melodie das Bewusstsein voraussetzt, dass sie sich bis zu ihrem Ende fortsetzt
und die einzelnen Töne oder Harmonien eine bestimmte Länge verwirklichen, bevor sie ausklingen.
Dies ist dem Bewusstsein, das auf die bestimmte Erscheinung eines Liedes ausgerichtet ist, nur
durch protentionale Zukunftsgerichtetheit möglich. Die Bedeutung, die der Erfahrung und Konven-
tionen hierbei zukommt, illustriert Husserl mit folgender Passage:
„Ein halb ausgeschriebenes Wort, ein unvollständiger Vordersatz oder gar ein Satzstück, ein Wort […] erregt die
Erwartung, die es nicht befriedigt, so wie wenn wir uns zum Mittagessen setzen und nach der Suppe kommt nichts
weiter.“76
Doch rein phänomenologisch lässt sich die Leistung der Protention zunächst als ungedeckte Aus-
richtung des Wahrnehmens auf das ihr zeitlich unmittelbar bevorstehende fassen, denn, wie Husserl
schreibt, ist „[jeder] ursprünglich konstituierende Prozeß […] beseelt von Protentionen, die das
71
Ebd., S. 34. 72
Ebd., S. 35. 73
Ebd., S. 116. 74
Vgl. hierzu Kapitel 4.2. 75
Vgl. Pieper 1993, S. 61. 76
Husserl 2013, S. 158 f.
16
Kommende als solches leer konstituieren und auffangen, zur Erfüllung bringen.“77
Indem ich wäh-
rend meiner zeitlichen Wahrnehmung Erwartungen an eine bevorstehende Zeitphase habe, werden
die Inhalte meiner Wahrnehmung zukunftsgerichtet konstituiert. Erst durch die Frage, welches in
einer bestimmten Situation die Inhalte sind, die konstituiert werden, wird letztlich die Anschlussfra-
ge nach Konventionen aufgeworfen, die den Inhalt der protentionalen Konstitution beeinflussen und
damit ebenfalls die Frage nach einer Orientierung in der Welt freilegen. Für die Phänomenologie
bleibt eine Beschreibung der Weise protentionaler Konstitution völlig ausreichend, die phänomeno-
logisch erfassbar wird, indem sie von einer Reihe primärer Wahrnehmungen abstrahiert wurde.
4.4 Zeitfeld der Wahrnehmung und Immanenz des Bewusstseinsflusses
Mit dem aus dem Nichts protentional anklingenden Zukunftsbewusstsein und dem retentional ins
Unmerkliche abklingenden Bewusstsein der Vergangenheit ist das Zeitfeld realer Wahrnehmung
begrenzt. Es bildet um den Punkt der Urimpression herum das, was sich etwa als Schwelle der Zeit
bezeichnen ließe: den immanenten Bewusstseinsstrom. Mit diesem liefert Husserl eine plausible
Erläuterung des Phänomens der Sukzession, die den Wahrnehmungsstrom in den Bereich der ge-
genwärtigen Wahrnehmung rückt. Fraglich ist dennoch seine daran anknüpfende Behauptung, die-
ses Zeitfeld habe zu jedem Zeitpunkt realer Zeitwahrnehmung dieselbe Ausdehnung.78
Letztlich
würde dies voraussetzen, dass der ablaufenden Zeit immer dieselbe Aufmerksamkeit entgegenge-
bracht würde, was eine Frage aufwirft, die von Husserl in der ideierenden Abstraktion ausgeklam-
mert wird, nämlich jene nach subjektivem Zeitempfinden. Sie ließe sich wie folgt formulieren: Be-
gegne ich der als real ablaufend empfundenen Zeit stets mit derselben Aufmerksamkeit? Ange-
nommen, meine Wahrnehmung der Zeitlichkeit würde beispielsweise durch die Unterschiedlichkeit
von Zeitobjekten beeinflusst, auf die ich meine Wahrnehmung lenke: Hätte dies nicht einen Einfluss
auf die Extension des Zeitfelds? Zwar erfordert Husserls Phänomenologie die Setzung objektiver,
außerzeitlicher Leistungen, doch – als Schluss auf bloße, abstrakte Vermögen verstanden – knüpft
daran nicht zwangsläufig die Erkenntnis an, dass diese stets dieselbe Realisierung erfahren, welcher
Husserl zu folgen scheint. Der Schluss auf die bedingungslos permanent identische Ausdehnung des
Zeitfelds scheint nicht bloß eine ideierende Abstraktion, sondern die transzendente Konstruktion
einer konstanten Bewusstseinsoberfläche zu erfordern, die erst ein Ideal schafft, und als solche dem
Anspruch einer phänomenologischen Untersuchung nicht gerecht werden kann.
Doch Husserls Schluss auf eine konstante Extension des Zeitfelds ist weniger zentral als sein
Schluss auf die Gegebenheit des Vergangenen und Zukünftigen im Gegenwärtigen, der an Augusti-
nus anknüpfend aus seiner Analyse der Retention und Protention folgt. Auf die Gegebenheit der
77
Ebd., S 57. 78
Vgl. ebd., S. 34.
17
Vergangenheit kommt er in einer Betrachtung der Art der Modifikation, die die Retention darstellt:
In dieser bestärkt er die Wesensverschiedenheit der primären (retentionalen) auf der einen und der
sekundären (vergegenwärtigen) Erinnerung auf der anderen Seite. Retendierte Vergangenheit fasst
er dabei als Vergangenheitsanschauung, vergegenwärtigte Erinnerung als Vergangenheitsvorstel-
lung.79
Zwar stellt die Retention eine primäre Modifikation dar, durch die bildliche Vorstellungen
erzeugt werden, dennoch ist in ihr, so Husserl, in eigentümlich vergegenständlichter Weise das
Vergangene bewusst.
„[Es] gehört […] zum Wesen der Zeitanschauung, daß sie in jedem Punkt ihrer Dauer (die wir reflektiv zum Gegen-
stand machen können) Bewußtsein vom eben Gewesenen ist, und nicht bloß Bewußtsein vom Jetztpunkt des als
dauernd erscheinenden Gegenständlichen.“80
Daraus folgt für Husserl, dass die Vergangenheitsanschauung selbst nicht Verbildlichung sein
kann: „Sie ist ein originäres Bewußtsein“81
. Die Vergangenheit ist also in der wahrgenommenen
Zeit evident und geht nicht erst, wie Brentano annimmt, aus Assoziationen hervor. Hier manifestiert
sich also nicht zuletzt für Husserl die Notwendigkeit, den Ursprung des inneren Zeitbewusstseins in
der eigentlichen Zeitwahrnehmung festzusetzen.
Aufschluss über die Gegebenheit des Zukünftigen in der Wahrnehmung gibt ebenfalls der Ver-
gleich primärer mit sekundär erinnerter Wahrnehmung. Durch ihn zeigt Husserl die Veränderungen
der Weise der Gegebenheit des Bevorstehenden, das im erneuten Durchlaufen eines Moments einen
wesentlich anderen Charakter besitzt, denn:
„[Wenn] die ursprüngliche Frage Protention der Ereigniswahrnehmung unbestimmt war und das Anderssein oder
Nichtsein offen ließ, so haben wir in der Wiedererinnerung eine vorgerichtete Erwartung, die all das nicht offen läßt,
es sei denn in Form ‚unvollkommener‘ Wiedererinnerung, die eine andere Struktur hat als die unbestimmte Pro-
tention“82
.
Wahrnehmen ist das Streben in ein Unbekanntes, und durch die Protention ist dem Zeitfeld mei-
ner Wahrnehmung stets ein unbekanntes Element immanent. Denn auch wenn ich die Zukunft bis
zu einem gewissen Grad aus meiner Erfahrung berechnen kann, wohnt einer bevorstehenden Zeit-
phase ein Unbekanntes im Sinne eines Noch-nicht-erlebt-habens inne. Durchläuft meine Wahrneh-
mung nun einen bestimmten Zeitpunkt, wird dessen besondere Erscheinung durch die Modifikati-
onsleistungen meines Bewusstseins von etwas Unbekanntem zu etwas Bekanntem konstituiert.
5. Schluss
Dass in der Zeitwahrnehmung eben genau diese Modifikation des Wahrnehmungsinhalts von
einem Unbekannten, Unerlebten, in etwas Bekanntes, Erlebtes stattfindet, schließt Husserls argu-
mentativen Kreis. Während Augustinus die identisch erfasste Modifikation der Zeitwahrnehmung
79
Vgl. ebd., S. 35. 80
Ebd. 81
Ebd. 82
Ebd., S. 57 f.
18
als Beweis für die Unvollkommenheit des Menschen betrachtet83
, gelingt es Husserl, aus demselben
Schluss eine Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins aufzustellen. Durch die Hinterfragung
der dazu notwendigen Leistungen ist er zu einem Konzept gelangt, das eine plausible Erklärung
liefert. Eine phänomenologische Untersuchung kann, wie in der in Kapitel 2.1 dargestellten Metho-
dik der Phänomenologie gezeigt wurde, nicht in den Anspruch gestellt werden, zu beantworten, was
wahrgenommene Zeit ist.
Auch wenn sich eine vollständige, auf die Zeit angewandte Phänomenologie bei Husserl weniger
systematisch auf mehrere Arbeiten und Texte verteilt, von denen die wesentlichen seine Vorlesun-
gen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins sind, lässt sich seine dreigliedrige phäno-
menologische Methode formal geschlossen darin nachvollziehen. Durch die Reduktion des Unter-
suchungsgegenstands auf den Punkt reeller Zeitwahrnehmung und die Abstraktion auf die sich darin
verwirklichenden Konstitutionsstufen gelingt es, eine Analyse des inneren Zeitbewusstseins vorzu-
bereiten. Dabei resultiert ein Konzept, das der Weise des zeitlichen Wahrnehmens Rechenschaft
leistet, indem das betrachtete Phänomen hinsichtlich der Geistesleistungen hinterfragt wird, die
notwendigerweise darin aufgehen. Die Setzung des Geistes und seiner Konstitutionsvermögen als
Außerzeitliches ist hierzu notwendig, da jede weiterführende Benennung eine phänomenologische
Untersuchung übersteigen würde.
Das eigentlich Konstituierende und damit das Phänomen der inneren Zeitwahrnehmung ist der
Bewusstseinsstrom. Und Husserls Analyse richtet sich an die Weise, in der dieser Zeitpunkte durch-
läuft und Wahrgenommenes modifiziert. Unter Ausschluss jeglicher faktischer Kontingenz verblei-
ben dabei drei Vermögen, die Husserl systematisch voneinander trennt: Urimpression, Retention
und Protention. Während Brentano einzig die Urimpression als der eigentlichen Wahrnehmung im-
manent ansieht und weitere Leistungen in die Phantasie verlegt, gelangt Husserl zu der Erkenntnis,
dass schon der Wahrnehmung von Inhalten selbst deren Zeitlichkeit immanent ist. Nicht zuletzt
Pieper erkennt diesen Schluss als zentralen Punkt in Husserls Analyse an, indem er schreibt:
„Die grundlegende Einsicht der von Husserl in Angriff genommenen Analyse des Zeitbewußtseins liegt in der Ein-
sicht, daß Wahrnehmung […] sich grundsätzlich nie in der zeitlich-punktuellen Auffassung eines singulären Emp-
findungsdatums erschöpft, daß vielmehr […] stets sowohl die vormals aktuell gewesene Vergangenheit desselben
oder eines sein anderen Empfindungsinhalts als auch die dereinst aktuell werdende Zukunft einer bestimmten oder
noch unbestimmten Empfindung ‚mitwahrgenommen‘ sind.“84
In seinem Konzept des Zeitfelds aus Protention, Urimpression und Retention verdeutlicht sich
das Wesen des Bewusstseinsstroms. Ersichtlich wird hierbei, dass der Ablaufscharakter der Zeit der
Wahrnehmung von Inhalten innewohnt, sodass eine weitere Annäherung an die darin verwirklichten
Vermögen die Herausarbeitung immanenten Wissens über das Phänomen der Zeit ist.
Anhand einer Hinterfragung von Husserls Behauptung, der zufolge die Extension des Zeitfelds
als konstant anzunehmen ist, wurde in dieser Arbeit die Frage aufgeworfen, inwiefern Husserl in
83
Augustinus 2012, S. 619. 84
Pieper 1993, S. 58.
19
seinen Ausführungen eine idealisierte Wahrnehmungssituation voraussetzt. Die Frage nach subjek-
tivem Zeitempfinden spielt in Husserls Analyse keine Rolle, zumal sie keinen Teil des Diskurses
bildet, in dem seine Arbeiten stehen. Husserl erkennt es daher als notwendig an, sie für eine phä-
nomenologische Untersuchung auszugrenzen. Fraglich ist hierbei vor allem, ob seine Abstraktion
auf eine ideale Wahrnehmungssituation im Falle der Zeit ein legitimer logischer Schritt ist: Denn
bildet die Relativität der Wahrnehmung von subjektivem Empfinden in diesem Fall ebenfalls nicht
einen Teil des Phänomens? Es ist schwerlich als phänomenologischer Schluss anzuerkennen, dass
real ablaufende Zeit in ständig identischer Weise wahrgenommen wird und es etwas wie objektive
Zeit in der Wahrnehmung überhaupt gibt. Zwar ist Husserls Modell offen und auf verschiedene
Situationen realer Zeitwahrnehmung zutreffend formuliert, doch sie wirkt hinsichtlich ihres Gel-
tungsanspruchs gegenüber dem Phänomen statisch. Inwieweit kann und muss eine Phänomenologie
der inneren Zeitwahrnehmung der Relativität der Zeitwahrnehmung vom subjektiven Empfinden
der Zeit gerecht werden? Fraglich ist nicht zuletzt, ob man sich bei der Wahrnehmung von Zeitob-
jekten sicher sein kann, dass diese real sind, wie Husserl es annimmt. Einer Imagination ist man
sich letztlich nicht immer zwangsläufig bewusst. Hilfreich könnte es sein, in der Frage nach dem
Ursprung des Zeitbewusstseins die Frage nach realer Zeit weiter auszuklammern. Husserl hat sie
aus seiner Auseinandersetzung mit Brentano heraus als notwendig empfunden, doch diese reicht
unweigerlich in die Frage nach dem „Was-der-Zeit“ hinein. Die Frage nach einem offeneren und
reduzierteren Modell kann in dieser Arbeit nicht zu genüge thematisiert und beantwortet werden,
könnte aber in direkter Anknüpfung an Husserl einen weiten Forschungshorizont eröffnen.
Unabhängig von diesem Ausblick gelingt es Husserl jedoch, ein schlüssiges Konzept zu entwi-
ckeln, das eine wichtige Annäherung an jenes „schwierigste aller phänomenologischen Probleme“85
liefert. Es gelingt ihm das eigentliche Anliegen der Phänomenologie zu erfüllen: eine Wesensschau
der Zeit, die Erforschung ihres Apriori. Durch seine Analyse setzt er notwendige Grundsätze einer
phänomenologischen Betrachtung der wahrgenommenen Zeit frei, deren wichtigster Beitrag sein
Plädoyer für die Immanenz des Zeitflusses in der eigentlichen Wahrnehmung ist. Letztlich stellt
sein Schluss auf die Gegebenheit von Urimpression und retentionalen sowie protentionalen Leis-
tungen in der Wahrnehmung die notwendige Folge weitgehend kohärenter Prämissen dar, die ein
Modell bilden, das der Herausforderung gerecht wird, die Konstitutionsweise objektiver Zeit von
der inneren Wahrnehmung aus nachzuvollziehen.
85
Vgl. Kapitel 2.2.
20
Anhang
Anhang 1: Diagramm des Zeitphänomens86
86
Husserl 2013, S. 30, Ausgabe und Grafik online verfügbar unter: http://bit.ly/Zef8O7 (Stand: 8.9.2014).
21
Literaturverzeichnis
AUGUSTINUS, AURELIUS: „Confessiones / Bekenntnisse. Lateinisch/Deutsch“. übers. von Kurt
Flasch und Burkhard Mojsisch. Stuttgart: Reclam 2012.
HUSSERL, EDMUND: „Die Idee der Phänomenologie“. Hamburg: Meiner 1986.
HUSSERL, EDMUND: „Logische Untersuchungen II/1. Untersuchungen zur Phänomenologie und
Theorie der Erkenntnis“. 6. Auflage. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1980.
HUSSERL, EDMUND: „Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins“. Hamburg: Meiner 2013.
HUSSERL, EDMUND: „Philosophie als strenge Wissenschaft“. Hamburg: Meiner 2009.
KNUDSEN, SVEN-ERIC: Luhmann und Husserl. Systemtheorie im Verhältnis zur Phänomenologie.
Würzburg: Königshausen & Neumann 2006.
PIEPER, HANS-JOACHIM: „Zeitbewußtsein und Zeitlichkeit. Vergleichende Analysen zu Edmund
Husserls Vorlesungen des inneren Zeitbewußtseins (1905) und Maurice Merleau-Pontys Phä-
nomenologie der Wahrnehmung (1945)“. Frankfurt am Main: Peter Lang 1993.
SHIN, GUI HYUN: „Die Struktur des inneren Zeitbewußtseins. Eine Studie über den Begriff der Pro-
tention in den veröffentlichten Schriften Edmund Husserls“. Bern: Peter Lang 1978.