Archivobjekt öffnen - Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Die Innovationstätigkeit der deutschen Softwareindustrie
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Die Innovationstätigkeit der deutschen Softwareindustrie
1 Einleitung
Der Umsatz mit Software hat sich in denletzten Jahren massiv erhoht, ein Ende desWachstums ist nicht abzusehen. Der deut-sche Markt fur Software und IT-Servicessoll laut Angabe des European InformationTechnology Observatory im Jahr 2001 umrund 12 Prozent auf EUR 34 Mrd. wach-sen [EITO01]. Dabei wird der Markt furStandardsoftware weitgehend von ame-rikanischen Unternehmen wie Microsoft,Oracle und CA Computer Associates be-herrscht, wahrend sich nur wenige deut-sche Unternehmen (z. B. die SAP AG oderdie Software AG) in diesem Bereich spezia-lisiert haben. Die meisten Anbieter habensich vielmehr auf die kundenindividuelleSoftwareentwicklung bzw. -anpassung undauf Softwaredienstleistungen konzentriert.In Deutschland wird nach einer jungerenUntersuchung [FKZS00] in mindestens19.200 Unternehmen Software entwickeltbzw. angepasst, die uberwiegend klein-und mittelstandisch gepragt sind.
Es ist ein gangiges Klischee, dass die Soft-warebranche neben der Bio- und Gentech-nologie heute der innovativste und sichtechnologisch am schnellsten entwickelndeWirtschaftszweig ist. Dabei wird in der Re-gel auf die kurzen Zeitraume zwischen derAuslieferung neuer Versionen eines Soft-wareprodukts verwiesen. Dieses Bild be-zieht sich allerdings auf die massenhaft ver-triebenen Standardprodukte der großen(amerikanischen) Softwarekonzerne, nichtaber auf das Betatigungsfeld typischerdeutscher Softwareunternehmen. Im Fol-genden soll deshalb der Frage nachgegan-
gen werden, wie das Innovationsverhaltendieser Unternehmen eigentlich aussieht.Dabei wird berucksichtigt, dass Softwareheutzutage in allen Wirtschaftsbereichennicht nur als Arbeitsmittel von Bedeutungist, sondern auch zunehmend Bestandteilvon Produkten und Dienstleistungen wird.Da folglich nicht nur Softwarehauser, son-dern Unternehmen aus fast allen Wirt-schaftsbereichen Software entwickeln, wirdim Folgenden (grob) zwischen der so ge-nannten primaren und sekundaren Soft-warebranche unterschieden. Fur die Unter-nehmen der Primarbranche stellt dieHerstellung von Software den Haupt-gegenstand der Geschaftstatigkeit dar,wahrend die Sekundarbranchen im Rah-men ihrer Geschaftstatigkeit auch Softwareherstellen. Innerhalb der Primarbranchewerden gelegentlich die Entwickler vonquelloffener und nichtkommerzieller Soft-ware gesondert betrachtet. Unter quelloffe-ner (Open Source) Software versteht manProgramme, deren Quellcode (haufig kos-tenlos) Dritten zur Nutzung und Weiter-entwicklung zur Verfugung gestellt wird(z. B. das Betriebssystem Linux). Betrach-tet werden im Folgenden Produkt- undDienstleistungsinnovationen. Innovatorensind dabei solche Unternehmen, die inner-halb des vergangenen Jahres mindestensein Innovationsprojekt erfolgreich abge-schlossen haben, unabhangig davon, ob einanderes Unternehmen die Innovation be-reits eingefuhrt hat. Prozess- bzw. Verfah-rensinnovationen wie neue Methoden desSoftware Engineering und des Projektma-nagements sind nicht Gegenstand derUntersuchung [vgl. hierzu DHPS99;SFBJ00].
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
Die Autoren
Michael FriedewaldKnut BlindJakob Edler
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing.Michael Friedewald,Dr. rer. pol. Knut Blind,Dr. rer. pol. Jakob Edler,Fraunhofer-Institut fur Systemtechnikund Innovationsforschung,Breslauer Straße 48,D-76139 Karlsruhe,Telefon: (07 21) 6 80 91 46,E-Mail: {fri | kb | je}@isi.fhg.de
Die Innovationstatigkeitder deutschen Softwareindustrie
WI – State-of-the-Art
�ber den Softwaremarkt und die Strukturder deutschen Softwareindustrie liegenschon wegen seiner dynamischen Entwick-lung wenig aktuelle Daten vor. In deramtlichen deutschen Wirtschaftsstatistik istdieser Bereich nicht als eigenstandig erfasst.�ber die Situation in den Sekundarbran-chen gibt es fast uberhaupt keine Daten,zumal es dort problematisch ist, die Be-deutung von selbst entwickelter Softwarefur die Unternehmen geeignet zu quantifi-zieren. Lediglich die damalige Gesellschaftfur Mathematik und Datenverarbeitung(GMD) hat zwischen 1976 und 1989 re-gelmaßige Studien uber den deutschenSoftwaremarkt durchgefuhrt, um den An-wendern und Anbietern von Informations-technik und Software Informationen uberden Status Quo und die Entwicklung desSoftwaremarkts zur Verfugung zu stellen.Diese regelmaßige Marktuntersuchungwurde nach 1989 nicht mehr fortgesetztund hat heute allenfalls historischen Wert[BFNO89]. Das Innovationsverhalten derEDV- und Telekommunikationsbranchewird seit einigen Jahren durch das Mann-heimer Innovationspanel erfasst, allerdingsohne auf die Binnenstruktur oder moglicheBesonderheiten der Branche eingehen zukonnen [JEGH01a]. Das hinter quelloffe-ner Software stehende Entwicklungs- undGeschaftsmodell hat seit kurzem das Inte-resse der Wirtschaftsinformatik gefunden[NuTe00a-c], dennoch liegen bislang nochkeine breiten Untersuchungen vor, die dieokonomische Bedeutung quelloffener Soft-ware valide quantifizieren.
2 Methodik
Grundlage der Analyse sind zwei empiri-sche Untersuchungen, die das Fraunhofer-Institut fur Systemtechnik und Innovati-onsforschung (ISI) in den Jahren 2000 und2001 im Auftrag des Bundesministeriumsfur Bildung und Forschung bzw. fur dasBundesministerium fur Wirtschaft undTechnologie durchgefuhrt hat. In Erman-gelung amtlicher Unternehmenszahlenmusste fur die Primarbranche zunachst dieGrundgesamtheit ermittelt werden. Dazuwurden die Zahlen der Umsatzsteuerstatis-tik fur die dienstleistungsorientierten Teil-branchen (WZ-Code 72 Datenverarbeitungund Datenbanken) herangezogen unddurch Zahlen des Statistischen Bundes-amtes und der Bundesanstalt fur Arbeiterganzt. Auf dieser Grundlage ergab sicheine Zahl von insgesamt 35.797 Unterneh-men in der Primarbranche. Innerhalb desproduzierenden Gewerbes und des Dienst-leistungssektors wurden funf exemplari-sche Sekundarbranchen selektiert (Maschi-nenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugbau,Telekommunikation und Finanzdienstleis-tungen), die einen besonders hohen Anteilan Softwareentwicklung aufweisen und furdie umfangreiche offizielle Statistiken vor-liegen.
Durch eine telefonische �berprufung von1.494 Adressen in der Primar- und 3.863Adressen in den Sekundarbranchen wurdefolgende Zusammensetzung der deutschenSoftwareindustrie ermittelt (Tabelle 1):
Aus dieser Grundgesamtheit wurde einedisproportionale Zufallsstichprobe gezo-gen, die bei Befragungen im Unterneh-menssektor notwendig ist: Große Unter-nehmen mussen in den Stichprobenuberreprasentiert werden, damit auch fursie statistisch valide Aussagen getroffenwerden konnen. Im Sommer 2000 wurdeninsgesamt N ¼ 920 Vertreter der Primar-branche (nP ¼ 249) und der Sekundarbran-chen (nS ¼ 671) telefonisch zur Software-entwicklung in ihrem Unternehmenbefragt. Interviewpartner war in der Regelder Leiter der Softwareentwicklung, inkleineren Unternehmen haufig auch derInhaber oder Geschaftsfuhrer. Die anhandeines standardisierten Fragebogens erhobe-nen Daten wurden in einer Datenbank er-fasst und nach Branchen und Unterneh-mensgroße ausgewertet [FKZS00]. DieErgebnisse dieser Befragung sind im fol-genden Abschnitt dargestellt.
Die in Abschnitt 4 bis 6 vorgestellten Er-gebnisse basieren auf einer im Fruhjahr2001 durchgefuhrten reprasentativen Inter-net-basierten Befragung. Dabei wurde sovorgegangen, dass die Adressaten in einerE-Mail oder einem Fax die Internetadressedes Fragebogens sowie das fur die jeweiligeGruppe des Samples zutreffende Passwortmitgeteilt bekamen und dann die Fragenonline beantworteten. Die Antworten wur-den unmittelbar uber das Internet in eineDatenbank eingetragen. Die Branchenein-teilung sowie die Stichprobenziehung ori-entierten sich an der oben dargestelltenSystematik zur Ermittlung der Grund-gesamtheit. Von 417 in der Primarbrancheund 303 in der den Sekundarbranchen ver-schickten Fragebogen waren 187 bzw. 67verwertbar. Im Rucklauf der Primar-branche waren auch 38 freiberufliche Soft-wareentwickler enthalten. Eine Analyse inBezug auf Umsatz, Mitarbeiter und Pro-duktpalette ergab eine weitgehende �be-reinstimmung in der Zusammensetzungbeider Erhebungen, sodass auch eine Ver-gleichbarkeit der Ergebnisse angenommenwerden kann [BEFF01].
Neben der gewollten �berprasentationgroßerer Unternehmen in der Stichprobekommt es vor allem durch die Beschran-kung auf nur funf Sekundarbranchen zuVerzerrungen. Diese Beschrankung waraus zweierlei Grunden notwendig. Wegendes aufwandigen Verfahrens zur Ermitt-lung der Grundgesamtheit verbot sich al-lein aus forschungsokonomischen Grun-den eine reprasentative Erhebung uber alle
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
Tabelle 1 Struktur der Softwareindustrie in Deutschland
Branche Unternehmeninsgesamt
Unternehmenmit Softwareentwicklung
Primarbranche 35.797 10.568
Sekundarbranchen 147.857 8.660
– Maschinenbau 22.340 2.295
– Elektrotechnik 25.053 2.482
– Fahrzeugbau 2.635 124
– Telekommunikation 1.300 229
– Finanzdienstleistungen 96.529 3.530
Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesanstalt fur Arbeit, Umsatzsteuerstatsitik, eigene Berech-nungen
152 Michael Friedewald, Knut Blind, Jakob Edler
Sekundarbranchen. Andererseits ist ins-besondere im Dienstleistungsbereich dieGrenze zwischen Softwareentwicklung imengeren Sinne und anderen Tatigkeiten(z. B. Erstellung von interaktiven Websei-ten) kaum zu bestimmen. In diesem Sinnesind die Ergebnisse nur fur die betrachtetenBranchen reprasentativ.
Alle monetaren Großen basieren aufSelbsteinschatzungen der Befragten, Ein-schatzungsfragen wurden auf einer funf-stufigen Skala gemessen. Im Folgendenwerden im Fließtext Circa-Angaben ver-wendet, in einigen Fallen sind genauereWerte in den Abbildungen zu finden.
3 Forschung undForschungskooperationim BereichSoftwareentwicklung
Die rasche Weiterentwicklung von Anwen-dungen und Entwicklungstechnologienwird stark von Forschungsaktivitaten vo-rangetrieben. In Anlehnung an eine Defini-tion des Stifterverbandes fur die DeutscheWissenschaft [GrMa01] werden unter demBegriff „Forschung“ in Abgrenzung zur(Vor-) Entwicklung alle Arbeiten im Be-reich der Softwareentwicklung subsum-miert, deren Losung nicht alleine mit Hilfevon allgemein bekannten Methoden mog-lich ist. Die Befragung der Unternehmenhat ergeben, dass insgesamt 22 Prozent,d. h. nur 4.200 der Software entwickelndenUnternehmen der Primarbranche und derSekundarbranchen, derzeit Forschung imBereich Softwareentwicklung betreiben(Bild 1). Bei einer differenzierten Betrach-tung zeichnet sich die Primarbranche imVergleich zu den Sekundarbranchen durcheine deutlich intensivere Forschungstatig-keit aus: Insgesamt 3.400 Unternehmen(32 Prozent) der Primarbranche betreibenForschung im Bereich Softwareentwick-lung. Der Vergleichswert in den Sekundar-branchen liegt mit 9 Prozent deutlichniedriger. In der Primarbranche ist ein ein-deutiger Zusammenhang zwischen Unter-nehmensgroße und Forschungsaktivitatfestzustellen: Mit zunehmender Mitarbei-terzahl steigt der Anteil der Unternehmen,die Forschung im Bereich Softwareent-wicklung betreiben. Innerhalb der Sekun-darbranchen fuhren insbesondere in denSoftware-intensiven Branchen Elektrotech-nik (21 %) und Telekommunikation (18 %)
uberproportional viele Unternehmen For-schung durch.
Fur Forschung investieren die Unterneh-men der Primarbranche und der Sekundar-branchen jahrlich rund EUR 766 Mio.,d. h. durchschnittlich rund EUR 179 Tsd.je Unternehmen. Mitarbeiterstarke Unter-nehmen haben dabei erwartungsgemaß ho-here Budgets als kleinere Unternehmen.Die Forschungsausgaben verteilen sichentsprechend der Forschungsaktivitat derSektoren: 91 Prozent des gesamten For-schungsaufwandes (EUR 697 Mio.) wer-den von Unternehmen der Primarbrancheinvestiert. Die Unternehmen der Sekundar-branchen geben nach den Ergebnissen derBefragung jahrlich nur ca. EUR 69 Mio.fur Forschung im Bereich Softwareent-wicklung aus.
Ein Drittel aller Software entwickelndenUnternehmen unterhalt Kooperationenmit Hochschulen und offentlichen For-schungseinrichtungen (Bild 1). DerSchwerpunkt dieser Kooperationen liegtauf der Zusammenarbeit mit Hochschulen:96 Prozent der kooperierenden Unterneh-men bieten Praktika fur Studenten an(ca. 5.000 Unternehmen), 72 Prozent ver-geben Diplomarbeiten (ca. 4.500 Unter-nehmen), 43 Prozent investieren Zeit in dieTeilnahme an universitaren Vortragsreihen(ca. 2.700 Unternehmen). Alle drei genann-
ten Aktivitaten sind auch deshalb so be-liebt, da sie den Unternehmen Moglichkei-ten bieten, neue Mitarbeiter zu rekrutieren.Studentische Mitarbeiter und Praktikantenbieten außerdem verhaltnismaßig gunstigZugang zu neuem Fachwissen (vgl. Bild 2).
Intensivere Formen der Kooperation wieForschungsprojekte (37 %, 2.300 Unter-nehmen) oder Beratung bezuglich neuerSoftwaretechnologie-Trends (33 %, 2.100Unternehmen) werden deutlich wenigerhaufig genutzt.
In der Primarbranche unterhalten rund5.000 der Software entwickelnden Unter-nehmen Kooperationen mit Hochschulenund offentlichen Forschungseinrichtungen(45 %). Dabei steigt mit wachsender Unter-nehmensgroße auch die Kooperations-bereitschaft: Wahrend lediglich 40 Prozentder kleinen Unternehmen mit Hochschu-len und offentlichen Forschungseinrich-tungen zusammenarbeiten, wird dieseForm des Erfahrungs- und Know-how-Austausches bei 70 Prozent der großenUnternehmen der Primarbranche genutzt.
In den Sekundarbranchen pflegen lediglich1.600 (19 %), vorwiegend großere Unter-nehmen, Kooperationen im Bereich derSoftwareentwicklung mit Forschungsein-richtungen. Dabei werden im Gegensatzzur Primarbranche uberdurchschnittlich
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
Kernpunkte fur das Management
Der Beitrag befasst sich mit der Struktur, dem Umfang und den Besonderheiten der Innovati-onstatigkeit der deutschen Softwareindustrie und differenziert dabei nach der primaren(Kern-IT-Branche) und sekundaren Softwarebranchen. Die Kernaussagen sind:
& Nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der Unternehmen betreibt eigene Forschungen im Soft-warebereich, dennoch ist die Branche durch eine Vielzahl von innovativen Entwicklungengekennzeichnet.
& Entwicklungen im Bereich der Software sind von einer sehr hohen Dynamik auf der Ange-bots- wie auch auf der Nachfrageseite gekennzeichnet.
& Im Vergleich gibt es im Softwarebereich zwar nicht haufiger Marktneuheiten, aber deut-lich haufiger inkrementelle Weiterentwicklungen. Die Sequenzialitat von Innovationenkann bestatigt werden.
& Quelloffene Software hat eine stark zunehmende Bedeutung fur die Softwarebranche,Unternehmen folgen aber nur bedingt der klassischen Open-source-Philosophie
Stichworte: Innovation, Softwareindustrie, sequentielle Innovationen, quelloffene Software,Interoperabilitat
Die Innovationstatigkeit der deutschen Softwareindustrie 153
haufig auch intensivere Kooperationsfor-men unterhalten. So vergeben 26 Prozentder kooperierenden Unternehmen For-schungsauftrage an Universitaten oder For-schungseinrichtungen.
Ein Nicht-Zustandekommen jeglicher Zu-sammenarbeit wird aus Sicht der Unter-nehmen der Primarbranche vor allem mitmangelndem Handlungsbedarf begrundet(22 %). Die gegenwartige Auftragslage ver-fuhrt Unternehmen zu kurz- und mittel-fristiger Auftragsbearbeitung (10 %), was
zu Lasten langfristiger Innovationsaktivita-ten geht. Andere Unternehmen der Primar-branche erachten sich selbst als „zu klein“und unterhalten deshalb keine Kooperatio-nen mit Hochschulen oder offentlichenForschungseinrichtungen (15 %). Geradediese Unternehmen, die sich keine eigeneForschung leisten konnen, hangen langfris-tig von der Kooperation mit externen For-schungseinrichtungen ab. Hemmend fureine konkrete Zusammenarbeit mit exter-nen Forschungseinrichtungen in Form vonAuftragsforschungsprojekten ist u. a. die
verbreitete Unwissenheit bei den betroffe-nen Unternehmen uber die notwendigenSchritte zur Initialisierung einer Zusam-menarbeit (10 %).
Dagegen beklagen Unternehmen der Se-kundarbranchen, dass Hochschulen undStudenten ihre Art der Softwareentwick-lung haufig fur wenig attraktiv erachtenund deswegen geringes Interesse an For-schungskooperationen zeigen (12 %). Eini-ge Unternehmen im Maschinenbau oderaus der Elektrotechnik beurteilen ihre An-forderungen an die Softwareentwicklungals zu speziell und deswegen nicht fur Ko-operationen mit Forschungseinrichtungengeeignet.
Der vergleichsweise geringe Forschungs-anteil der Sekundarbranchen muss aller-dings differenziert bewertet werden. Ob-wohl tatsachlich nur ein geringer Anteilder Unternehmen im Bereich der grund-legenden Forschung tatig sind, werden invielen Unternehmen hochst innovativeVerfahren und Produkte entwickelt. Ob-wohl diese Tatigkeiten meist als Vorent-wicklung bezeichnet werden, handelt essich vielfach um hochkaratige angewandteForschung. So entfallen mittlerweile in denSekundarbranchen durchschnittlich etwa15 Prozent der Neuentwicklungskostenvon Produkten und Dienstleistungen aufdie Software. Besonders hoch liegt dieserAnteil wiederum in den Branchen Tele-kommunikation (23 %) und Elektrotech-nik (25 %).
4 Charakteristika deutscherSoftwareprodukte
Die Unternehmen wurden auch danach be-fragt, wie sich ihr Umsatz auf verschiedeneTypen von Software verteilt. Eine erste Di-mension ist hierbei die Eigenstandigkeitder entwickelten Produkte, die sich zwi-schen Stand-alone-Losungen und vollkom-mener Einbindung in andere Software bzw.Hardware erstreckt. Bild 3 zeigt hier deut-liche Unterschiede zwischen der Primar-und Sekundarbranche. Der durchschnitt-liche Umsatzanteil mit eigenstandigenSoftwareprodukten belauft sich in der Pri-marbranche auf etwas uber 58 Prozent, inder Sekundarbranche auf etwas mehr als35 Prozent. Beim Umsatzanteil mit so ge-nannter „Embedded Software“, also Soft-ware, die fester Bestandteil von Hardwareist und nur im Zusammenspiel mit dieser
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
8660
10568
799 (=9 %)
3400 (=32 %)
1603 (=18 %)
4765 (=45 %)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Sekundärbranchen
Primärbranche
Unternehmen insgesamt
... mit Forschungskooperationen
... mit eigener Forschung
Bild 1 Unternehmen mit eigener Softwareforschung und Forschungskooperationen
22%
34%
37%
43%
72%
96%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sonstiges
Beratung
Forschungsprojekte
Vortragsreihen
Diplomarbeiten
Praktika 6000 Unternehmen
4500 Unternehmen
2700 Unternehmen
2300 Unternehmen
2100 Unternehmen
1400 Unternehmen
Bild 2 Art der Kooperation zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungsein-richtungen. Anteil an der Gesamtheit der Unternehmen mit Kooperationen
154 Michael Friedewald, Knut Blind, Jakob Edler
funktioniert (z. B. Steuerungssoftware imMaschinen- und Fahrzeugbau, Software inMobiltelefonen), ist dieses Verhaltnis er-wartungsgemaß umgekehrt.
Bei der Primarbranche liegt der durch-schnittliche Umsatzanteil von EmbeddedSoftware bei lediglich 7 Prozent, wahrender bei der Sekundarbranche nahezu 36 Pro-zent ausmacht und damit dem Anteil dereigenstandigen Software weitgehend ent-spricht. Diese Verteilung bedeutet, dass diebesondere Problematik der EmbeddedSoftware fur die Primarbranche keine we-sentliche Rolle spielt, wahrend fur die Se-kundarbranche sowohl die Besonderheiteneigenstandiger Software als auch der Em-bedded Software relevant sind.
Daruber hinaus wurden die Unternehmennach der Funktionalitat bzw. den Einsatz-bereichen ihrer Softwareprodukte befragt(Bild 4).
Es zeigt sich, dass die Sekundarbrancheden großten Umsatzanteil mit systemnaherSoftware erwirtschaftet, gefolgt von etwagleichen Anteilen an Anwendersoftwareaus den Bereichen Betriebswirtschaft, tech-nische Anwendungen, Steuerungs- undRegeltechnik und Multimedia. In der Pri-marbranche hingegen spielt die Anwender-software eine großere Rolle (angefuhrt vonbetriebswirtschaftlicher Software), system-nahe Software nimmt hier mit 11 Prozentnur den dritten Platz ein.
Eine weitere Differenzierung der Unter-nehmen bezuglich ihrer Produkte un-terscheidet danach, inwieweit sie ihreProdukte als individuell zugeschnitteneSoftwarelosungen fur einzelne Kundenbzw. kleine Kundengruppen entwickeln.Es zeigt sich, dass in der Sekundarbrancheam haufigsten Kleinserien fur bestimmteKundenkreise entwickelt werden (46 %),wahrend die Primarbranche starker polari-siert ist und jeweils deutlich mehr als einDrittel ihres Umsatzes entweder aus derkundenspezifischen Einzelentwicklung(35 %) oder aus Produkten des Massen-marktes (38 %) stammt.
5 Innovationsdynamik
Die Softwareentwicklung ist gepragt vonsehr kurzen Zyklen und hoher Dynamik.In beiden Teilbranchen geben ca. 90 Pro-zent der Unternehmen an, dass sie im Jahr
2000 neue Softwareprodukte entwickelthaben. Dies ist ein sehr hoher Wert, wieder Vergleich mit dem Anteil der Innova-toren bei unternehmensnahen Dienstleis-tungen zeigt. Dieser liegt gemaß der jung-sten Innovationserhebung bei 64 Prozentund ist damit uber 20 Prozent niedriger alsim Softwarebereich [JEGH01b].
Ein Unterschied zwischen den Branchenzeigt sich bei der Betrachtung, inwieferndie Innovationen echte Marktneuheitendarstellen. Hier geben die Unternehmen
der Sekundarbranche in großerem Umfangan, fur den Markt neue Software zu ent-wickeln, wahrend in der Primarbrancheviele Unternehmen Software entwickeln,die zwar fur ihr Unternehmen, nicht je-doch fur den Markt neu sind. Im Vergleichzum Gesamtbereich der unternehmens-nahen Dienstleistungen, wo der Anteil vonUnternehmen mit Marktneuheiten bei37 Prozent liegt [JEGH01a, JEGH01b],erzielt die Softwarebranche nur Durch-schnittswerte (34 %). Damit werden dierelativ hohen Innovatorenanteile wieder
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
58%
19%
16%
7%
36%
15%
14%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Software als eigenständiges Endprodukt
Software, die nur in funktionaler
Verbindung mit bestehender Software
Dritter Kundennutzen stiftet (z.B. Treiber,
Plug-Ins, Bibliotheken)
Softwareentwicklungen zur
kundenspezifischen Individualisierung
bestehender Software
Embedded Software
Primär (n = 178) Sekundär (n =59 )
Bild 3 Umsatzanteile verschiedener Typen von selbst entwickelter Software
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Betriebswirtschaftliche
Anwendersoftware
Anwendersoftware im Bereich
Multimedia/Internet
Systemnahe Software
Technische Anwendersoftware
Software für Steuerungs- und
Regeltechnik
Finanz- und Handels-Software
Software-Entwicklungswerkzeuge
Büroautomation und Grafik
Programm-Bibliotheken
Sonstige Software
Primär (n = 172) Sekundär (n = 49)
Bild 4 Umsatzanteile mit Software unterschiedlicher Funktionalitat
Die Innovationstatigkeit der deutschen Softwareindustrie 155
relativiert und konnen dahingehend inter-pretiert werden, dass die Softwarebranchezwar uberdurchschnittlich viele inkremen-telle, aber nur durchschnittlich viele ra-dikale Innovationen hervorbringt. Dieuberdurchschnittliche Innovativitat der Se-kundarbranchen hat offenbar seine Ursa-che darin, dass viele der Unternehmen ausdem produzierenden Gewerbe und derDienstleistungsbranche erst vor wenigenJahren begonnen haben, Software als wett-bewerbsentscheidenden Faktor zu erken-nen. Ausgehend von einem niedrigen Ni-
veau sind die Unternehmen deshalb nochin der Lage, eine Vielzahl von Produkt-innovationen hervorzubringen. Diese Ent-wicklung wird durch den Trend zu pro-duktbegleitenden Dienstleistungen weiterverstarkt [PKTG00].
Ein weiteres in der Innovationsforschungubliches Maß zur Erfassung der Innovati-onsdynamik ist der Umsatzanteil mit Pro-dukten, die in den vorangegangenen12 Monaten erstmalig angeboten wurden.Fur das Jahr 2000 zeigt sich eine typisch
linksschiefe U-Verteilung. Die Mehrzahlder Unternehmen hat zwischen 0 und30 Prozent des Umsatzes mit neuen Pro-dukten gemacht. Dabei machen die Unter-nehmen der Sekundarbranche einen signifi-kant geringeren Umsatz mit neuenProdukten als diejenigen aus der der Pri-marbranche. Hier geben 15 Prozent derUnternehmen an, uber 50 Prozent ihresUmsatzes mit vollig neuen Produkten ge-macht zu haben, fur immerhin ein Viertelder Unternehmen liegt der Wert bei uber30 Prozent (Bild 5). Im Vergleich zumGesamtbereich der unternehmensnahenDienstleistungen liegen diese Werte wie-derum leicht unter dem Durchschnitt, dadort der Umsatzanteil mit neuen Produk-ten 29 Prozent betragt.
Die hohe Dynamik spiegelt sich auch inden Entwicklungszyklen wider. In beidenBranchen dauert die Entwicklung von Pro-dukten in uber 40 Prozent der Unterneh-men nicht langer als ein halbes Jahr. Dage-gen hat weniger als ein Drittel allerProdukte eine Entwicklungszeit von uber12 Monaten (Bild 6).
Die sehr kurzen Zyklen entsprechen demvon den befragten Unternehmen wahr-genommenen Nachfrageverhalten im Soft-warebereich. �ber 75 Prozent der Kundenin der Primarbranche (Sekundarbranchen:ca. 66 Prozent) ersetzen nach Aussage derbefragten Unternehmen ihre Softwaredurch verbesserte Produkte innerhalb einesJahres. 40 Prozent der Kunden in der Pri-marbranche ersetzen im Durchschnitt in-nerhalb von 2 Jahren ihre Software sogardurch vollig neue Produkte. In der Sekun-darbranche ist das Nachfrageverhalten et-was weniger dynamisch, aber auch hierwollen 22 Prozent der Kunden innerhalbvon zwei Jahren vollig neue Produkte.
Als Fazit kann festgehalten werden, dassEntwicklungen im Softwarebereich sowohlin der Primar- als auch in der Sekundar-branche von einer sehr hohen Marktdyna-mik gekennzeichnet sind. Die durch-schnittliche Entwicklungsdauer in beidenBranchen ist mit etwa sechs Monaten ent-sprechend gering. Dies fuhrt zu einer wett-bewerbsentscheidenden Bedeutung vonschnellen Innovationen und effektivenEntwicklungsprozessen. Hemmnisse beider Durchfuhrung von Entwicklungsarbei-ten sind deshalb im Bereich der Softwarenoch schwerwiegender als in anderen Be-reichen der Industrie.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0 - 5 % 6 - 10 % 11 - 20 % 21 - 30 % 31 - 40 % 41 - 50 % über 50 %
Primär (n = 159) Sekundär (n = 46)
Bild 5 Umsatzanteile mit neuen Produkten im Jahr 2000
0% 10% 20% 30% 40% 50%
1 - 6 Monate
7 - 12 Monate
13- 24 Monate
mehr als 24 Monate
Primär (n = 195) Sekundär (n = 70)
Bild 6 Durchschnittliche Entwicklungsdauer von Softwareprodukten
156 Michael Friedewald, Knut Blind, Jakob Edler
6 Besonderheiten derEntwicklungsaktivitatenim Softwarebereich
6.1 Sequenzialitat
Software ist ein unkorperliches undwissensintensives Produkt und damit einbeispielhaftes Wirtschaftsgut der sich ent-wickelnden Informationsgesellschaft. Viel-fach wurde angenommen, dass die Ent-wicklung von Software anderen Regelnunterliegt als die korperlicher Produkte inanderen Wirtschaftsbereichen. Dies wirdu. a. damit begrundet, dass in der Software-branche Innovationen sowohl sequenziellals auch komplementar sind. Mit sequen-ziell ist gemeint, dass jede Erfindung aufeiner vorhergehenden aufbaut. Komple-mentar bedeutet, dass jeder potenzielleInnovator einen etwas anderen Losungs-ansatz wahlt und damit die Wahrschein-lichkeit einer erfolgreichen Innovationerhoht. Die Sequenzialitat und Komple-mentaritat von Innovationen ist in den ver-gangenen Jahren intensiv untersucht wor-den [GoKl82, GrSc95, Jaff96]. Bessen undMaskin [BeMa00] haben gezeigt, dass Se-quenzialitat und Komplementaritat einenerheblichen Einfluss auf die Wirkung vongewerblichen Schutzrechten und damitauf die Innovativitat eines Wirtschafts-zweiges haben konnen. Ihre Analysen be-ziehen sich vor allem auf den Ruckgangder FuE-Investitionen und der Produkti-vitat in der amerikanischen Softwarebran-che nach der expliziten Einfuhrung vonSoftwarepatenten zu Beginn der 80er Jah-re. Jedoch standen neben diesen auf Sek-torebene aggregierten Daten keine empiri-schen Daten auf Unternehmensebene zurVerfugung.
Eine erste Dimension fur die Besonderhei-ten der Softwareentwicklung ist der Gradder Wiederverwendung bestehendenCodes fur die Entwicklung neuer Softwareals Indikator fur Sequenzialitat der Soft-wareentwicklung. Das Ergebnis der Befra-gung ist hier eindeutig: Bei fast einem Drit-tel aller Unternehmen ist uber 50 Prozentdes Inputs fur neue Entwicklungen bereitsbestehender Code. Fast zwei Drittel derUnternehmen geben einen Anteil von uber30 Prozent Codewiederverwendung an(Bild 7). Die Bedeutung der Sequenzialitatin der Softwareentwicklung ist damit be-statigt.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
5%
6 - 10 %
11 - 20 %
21 - 30 %
31 - 40 %
41 - 50 %
über 50 %
Primär (n = 167) Sekundär (n = 59)
Bild 7 Anteil der Codewiederverwendung bei eigener Software
Bild 8 Anteil fremder Bestandteile an neu entwickelter Software(oben: Primarbranche nP ¼ 177, unten: Sekundarbranchen nS ¼ 64)
Die Innovationstatigkeit der deutschen Softwareindustrie 157
Um die Bedeutung der Sequenzialitat furdie Innovativitat der ganzen Branche ab-schatzen zu konnen, ist nicht nur dasAusmaß der Code-Wiederverwendung,sondern vor allem die Herkunft der Pro-grammbestandteile, die in die Entwicklun-gen der Unternehmen einfließen, von Rele-vanz. Dabei zeigt sich zunachst, dass deruberwiegende Anteil des Codes, der wie-der verwendet wird, aus eigener Entwick-lung stammt und damit von AktivitatenDritter oder gewerblichen Schutzrechtennicht tangiert wird. Dies trifft fur beide
Branche zu, ist in der Sekundarbrancheaber mit 70 Prozent noch ausgepragter alsin der Primarbranche.
6.2 Die Bedeutungvon quelloffener Software
Ein weiteres wichtiges Ergebnis liefert dieAnalyse der fremden Bestandteile in eige-nen Entwicklungen (Bild 8). Danach machtquelloffene Software (Open-source-Soft-
ware) in der Primarbranche mittlerweilefast 20 Prozent des Inputs aus und damitfast doppelt so viel wie zugekaufte Stan-dardsoftware und drei Mal so viel wie spe-ziell in Auftrag gegebene Software. Vonallen fremden Bestandteilen in den Soft-wareentwicklungen der Primarbranche istquelloffene Software mit Abstand derwichtigste. Im Vergleich dazu hat diese inder Sekundarbranche mit 3,5 Prozent amgesamten Input fur Softwareentwicklungenzurzeit noch eine signifikant geringere Be-deutung, wahrend sich die Anteile anderefremder Bestandteile in ahnlichen Großen-ordnungen bewegen.
Die große Bedeutung, die quelloffene Soft-ware schon heute fur die Primarbranchespielt, wird allerdings dadurch relativiert,dass innerhalb der Primarbranche die Nut-zung der quelloffener Software (noch) ingroßem Maße von den freien Entwicklernbestimmt ist. Lasst man in der Primarbran-che die freien Entwickler außer Acht, dannergibt sich ein differenziertes Bild bezug-lich der Verwendung von Software ausdem Open-source-Bereich. Wahrend letz-tere bei der Erstellung von Software uber70 Prozent aus diesem Umfeld entnehmen,liegt dieser Wert bei den ubrigen Unter-nehmen der Primarbranche ahnlich wie beiden Unternehmen der Sekundarbranchenbei etwa 6 Prozent.
Bedeutsam ist die Bewertung der kunftigenEntwicklung. �ber 60 Prozent der Unter-nehmen in der Primarbranche geben an,dass in Zukunft die Bedeutung von quell-offener Software weiter steigen wird. Da-gegen wird die Bedeutung der Eigenent-wicklung nach der Einschatzung derbefragten Unternehmen deutlich abneh-men. In der Sekundarbranche erwarten so-gar 70 Prozent der Unternehmen, dass dieBedeutung quelloffener Software als Inputfur eigene Entwicklung steigen wird. Undauch fur die Sekundarbranche gilt, dass dieAbhangigkeit von externen Quellen steigenund damit der Austausch von Software-bestandteilen zwischen Unternehmen zu-nehmen wird.
Neben der Inanspruchnahme und der Ver-wendung von quelloffener Software inte-ressieren auch die Praktiken und Bedin-gungen fur die eigene Offenlegung vonQuellcode. Hier sind verschiedene Modizu unterscheiden. Der Quellcode wird ent-weder unentgeltlich und fur die Allgemein-heit zur Verfugung gestellt oder gegen Ent-gelt fur die Allgemeinheit oder nur fur
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
ja, generell
ja, häufig
gelegentlich
in Einzelfällen
nie
Primär (n = 177) Sekundär (n = 58)
Bild 9 Verbreitung der Praxis, Code ohne Entgelt fur die Allgemeinheit offenzulegen
1 2 3 4 5
schnelle Marktdurchdringung erreichen
Verbesserung eigener Systemsoftware durch Dritte zulassen
Um im Gegenzug auch frei auf andere Quellcodes zugreifen zu können
Ideen für komplementäre Produkte von Kunden, Lieferanten fördern
Eigene Entwicklung zum Standard machen
Sicherung der Interoperabilität meines Produktes zu anderen
Entwicklung komplementärer Produkte durch Dritte erleichtern
Weiterentwicklung meines Produktes durch Dritte ermöglichen
Ausweitung und Verbesserung von Kooperationsmöglichkeiten
Qualitätsausweis/Transparenz zum Kunden (Signalling)
Freie Entwickler (n=37) Sekundärbranche (n=64) Primärbranche ohne freie Entwickler (n=140)
Bild 10 Motivation zur Offenlegung von Code(1¼ sehr geringe Bedeutung, 5 ¼ sehr große Bedeutung)
158 Michael Friedewald, Knut Blind, Jakob Edler
spezifische Kunden. Die einzige Kategoriedieser drei Ausgestaltungsformen, in denenes signifikante Unterschiede zwischen derPrimar- und der Sekundarbranche gibt, istdie unentgeltliche Abgabe an die All-gemeinheit (Bild 9). Zwar ist in beidenBranchen die Mehrzahl der befragten Un-ternehmen nie zu einer solchen bedin-gungslosen Offenlegung bereit. Jedoch istdiese Weigerung in der Sekundarbranchemit 84,5 Prozent signifikant großer als inder Primarbranche. In Letzterer geben im-merhin 13 Prozent an, generell den Codefreizugeben (Sekundarbranche 1,7 %) undca. 10 Prozent tun dies haufig (Sekundar-branche 3,4 %).
Dieses Charakteristikum der Primarbran-che wird allerdings durch die freien Ent-wickler hervorgerufen. So gibt die Halfteder freien Entwickler an, Code grundsatz-lich an die Allgemeinheit ohne Entgelt ab-zugeben. Mit anderen Worten, die Mehr-zahl der freien Entwickler, aber auch eineReihe von Unternehmen der Primarbran-che folgen einem Geschaftsmodell, in demCode unentgeltlich offen gelegt wird unddessen okonomische Anreize offensichtlichnicht in der alleinigen Bereitstellung vonSoftware bestehen. Verbreiteter ist die Pra-xis, Code gegen Entgelt fur die Allgemein-heit freizugeben: Lediglich 16 Prozent derUnternehmen in der Primar und 13 Pro-zent in den Sekundarbranchen legen mehroder weniger regelmaßig ihren Quellcodeoffen.
Die Bereitschaft zur Offenlegung desQuellcodes fur den Kunden ist allerdingsdeutlich hoher, wenn die Software im Rah-men eines Kundenprojekts entwickeltwird. In diesem Fall geben nur noch etwa20 Prozent der Unternehmen an, auch insolchen Fallen nicht offen zu legen, etwasmehr als ein Drittel in beiden Branchen legtin Einzelfallen offen. Etwa 17 Prozent derUnternehmen der Sekundarbranche undetwas uber 20 Prozent der Unternehmender Primarbranche legen generell ihrenCode im Rahmen von Kundenbeziehun-gen offen.
Die Offenlegung von Quellcode be-schrankt sich nicht auf bestimmte Formenvon Software, sondern ist uber die gesamtePalette von Software ublich. Bedeutsam er-scheint, dass gerade fur die Systemsoftwaredie Werte insbesondere in der Primarbran-che und hierbei vor allem bei den freienEntwicklern recht hoch sind, was tenden-ziell die Bedeutung der Offenlegung fur
das Funktionieren von Systemen mit gene-rischem bzw. Infrastruktur-Charakter er-hoht.
Um die okonomische Bedeutung der Of-fenlegung von Quellcode zu verstehen,muss man genau deren Motivation betrach-ten (Bild 10). Hier zeigt sich eindeutig, dassdie Masse der freien Entwickler quelloffeneSoftware nach dem klassischen Musternutzt: Die vier wichtigsten Grunde ent-sprechen der Open-source-Philosophie,wonach durch die Offenlegung das eigeneProdukt weiterentwickelt bzw. das eigene
Systeme verbessert, der Zugang zum Codeanderer eroffnet sowie die Qualitat der ei-genen Arbeit demonstriert werden soll[Raym01; NuTe00a-c]. Im Gegensatz zuden freien Entwicklern fuhren Unterneh-men selten altruistische Motive an, warumsie Quellcode offen legen [LeTi01]. DieMotive der Primarbranche und der Sekun-darbranchen, die allerdings bis auf einzelneAusnahmen nur fur durchschnittlich wich-tig gehalten werden, unterscheiden sichnur wenig in ihren Werten, weisen aller-dings eine etwas andere Reihenfolge auf.Der wichtigste Grund der Unternehmen in
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
1 2 3 4 5
... Ihrer Kunden
... Ihres Zulieferers
... von Anbietern von
Konkurrenzprodukten
... von Anbietern komplementärer
Produkte
Primär (n=177) Sekundär (n=62)
Bild 11 Bedeutung der Interoperabilitat zu Software verschiedener Akteursgruppen(1¼ sehr gering, 5 ¼ sehr groß)
10%
13%
14%
14%
21%
31%
12%
13%
10%
14%
31%
11%
16%
10%
10%
22%
10%
13%
13%
13%
21%
35%
18%
34%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Offenlegung des Codes
Orientierung am Standard des
Marktführers
Durchsetzung des eigenen Standards
vertraglich vereinbarte Kooperationen
Verwendung von
Branchenarchitekturen
Offenlegung der Schnittstellen
Interoperabilität... zu komplementären Produkten
... zu Konkurrenzprodukten
...zur Software der Kunden
... zur Software der Zulieferer
Bild 12 Strategien zur Sicherung der Interoperabilitat (N¼ 238)
Die Innovationstatigkeit der deutschen Softwareindustrie 159
der Primarbranche ist der Qualitatsaus-weis, wahrend die Unternehmen der Se-kundarbranche die Offenlegung am starks-ten zur Anbahnung und Verbesserung vonKooperationen nutzen. Interessanterweisegeben die Unternehmen beider Branchenals relativ wichtigen Grund die Moglich-keit an, dass das eigene Produkt weiterent-wickelt wird, wahrend die Aussicht aufNutzung fremden Codes keine wesentlicheRolle spielt. Mit anderen Worten, die Nut-zung von quelloffener Software folgt nurbei den freien Entwicklern der umfassen-den Logik des von Raymond beschriebe-nen „do ut des“.
6.3 Interoperabilitat
Eine letzte Besonderheit der Softwareent-wicklung im Vergleich zu anderen Produk-ten ist die notwendige Interoperabilitatzwischen Systemen und Anwendungenbzw. zwischen verschiedenen Anwendun-gen. Hinsichtlich der Interoperabilitat sindvier Dimensionen zu unterscheiden.Bild 11 zeigt, dass fur beide Branchen dieInteroperabilitat zur Software der Kundenmit weitem Abstand am wichtigsten ist.Die Interoperabilitat zu Zulieferproduktennimmt einen mittleren Wert ein und ist inetwa gleich bedeutend wie die Interopera-bilitat zu Produkten komplementarer An-bieter. Der signifikant hohere Wert der Pri-marbranche bei der Interoperabilitat zuKonkurrenzprodukten zeigt die Bedeu-tung, die der funktionalen Vertraglichkeitdes eigenen Produktes mit anderen aufdem Markt befindlichen Produkten bei-gemessen wird. In der Sekundarbranche istdieses strategische Motiv dagegen nichtausgepragt.
Insbesondere Software, die als Bestandteilanderer Software gedacht ist (Bibliotheken,Treiber), ist maßgeblich auf Interoperabili-tat angewiesen. Deshalb messen Unterneh-men, die Softwarekomponenten produzie-ren, der Interoperabilitat zu Software vonKunden, Zulieferern und Wettbewerbernim Vergleich zu den ubrigen Unternehmeneine besonders hohe Bedeutung bei.
Zusatzlich muss gefragt werden, wie dieInteroperabilitat uberhaupt hergestelltwird. Mit weitem Abstand ist das am hau-figsten genannte Instrument die Offenle-gung von Schnittstellen, gefolgt von derVerwendung von standardisierten Bran-chenstrukturen. Eine durchweg hohe Be-
deutung haben zudem vertragliche Koope-rationen, wahrend die Offenlegung vonCode in der Primar- und Sekundarbrancheeine eher untergeordnete Rolle einnimmt.Fur die freien Entwickler ist die Code-offenlegung jedoch – gleichrangig mit derOffenlegung der Schnittstellen – die be-deutendste Strategie, die Interoperabilitatsowohl zu Kunden und Zulieferern alsauch zu konkurrierenden und komplemen-taren Produkten herzustellen.
7 Fazit
Die Analyse der Innovationstatigkeit derdeutschen Softwareindustrie hat eine Reihevon Eigenschaften, Verhaltensweisen undEinstellungen bei den Software ent-wickelnden Firmen der Primar- und derSekundarbranche deutlich werden lassen.Entwicklungen im Bereich der Softwaresind sowohl in der Primar- als auch in derSekundarbranche von einer sehr hohenDynamik auf der Angebots- als auch aufder Nachfrageseite gekennzeichnet. So istdie durchschnittliche Entwicklungsdauerfur neue Produkte mit sechs Monatendeutlich geringer als in anderen Wirt-schaftsbereichen. Im Vergleich gibt es imSoftwarebereich zwar nicht haufigerMarktneuheiten, aber deutlich haufiger in-krementelle Weiterentwicklungen. Dies be-deutet, dass schnelle Innovationen und ef-fektive Entwicklungsprozesse noch starkerals in anderen Dienstleistungsbranchenwettbewerbsentscheidende Bedeutung be-sitzen.
Bestatigt werden konnte, dass Softwareent-wicklung durch eine Reihe von Besonder-heiten gekennzeichnet ist. Der hohe Gradan Codewiederverwendung legt nahe, dassSoftwareinnovationen sequenziellen Cha-rakter haben. Daruber hinaus sind die Ent-wicklungsaktivitaten zunehmend auf dieVerfugbarkeit passender externer Inputsangewiesen, und die unternehmensuber-greifende Verschrankung von Softwareent-wicklungen nimmt stetig zu.
Quelloffene Software ist in der Primar-branche schon jetzt die wichtigste externeQuelle bei der Softwareentwicklung. DieseBedeutung wird allerdings eindeutig vonden freien Entwicklern getragen. Betrach-tet man die Primarbranche ohne die freienEntwickler, so ist die Verwendung vonquelloffener Software in der Primarbranchenur noch geringfugig großer als in der Se-
kundarbranche. Ihre Bedeutung wird aller-dings nach der Einschatzung der Befragtenin beiden Teilbranchen stark zunehmen.Dabei hat quelloffene Software haufig ge-nerischen Charakter, d. h. es ist in vielenFallen ein funktionaler Input, der die Ent-wicklung eigener Software effektiviert.
Die Offenlegung des Quellcodes hat furdie Unternehmen vor allem eine Informati-onsfunktion fur die eigene Leistungsfahig-keit: Qualitatsausweis und Transparenzzum Kunden bzw. Signale fur Koopera-tionspartner. Demgegenuber bleibt derklassische Open-source-Modus, d. h. diePraxis, Code ohne Entgelt fur die All-gemeinheit offen zu legen und damit zueiner breiten Diffusion von neuem Codebeizutragen, die Domane der freien Ent-wickler.
Interoperabilitat ist fur beide Branchen einzentraler Aspekt, wobei die Interoperabili-tat zur Software der Kunden mit weitemAbstand am wichtigsten ist. Interoperabili-tat zur Software der Kunden und Zuliefe-rern und zu konkurrierenden und komple-mentaren Produkten wird vor allem durchdie Offenlegung von Schnittstellen her-gestellt, Offenlegung von Code spielt einenachgeordnete Rolle.
Literatur
[BeMa00] Bessen, James; Maskin, Eric: SequentialInnovation, Patents, and Immitation. WorkingPaper 00-01. Massachusetts Institute of Tech-nology, Department of Economics, Cambridge,Mass. 2000.
[BEFF01] Blind, Knut; Edler, Jakob; Friedewald,Michael; Frietsch, Rainer; Straus, Joseph, Nack,Ralph; Knappe, Wolfgang: Mikro- und makro-okonomische Implikationen der Patentierbarkeitvon Softwareinnovationen: Geistige Eigentums-rechte in der Informationstechnologie im Span-nungsfeld von Wettbewerb und Innovation. ISI,Karlsruhe 2001.
[BFNO89] Buschmann, Elke; Frerk, Gisela; Neu-gebauer, Ursula; Otremba, Gertrud;Schwuchow, Werner; Sippel, Frank: Der Soft-ware-Markt in der Bundesrepublik Deutschland.GMD-Studien Nr. 167. Gesellschaft fur Mathe-matik und Datenverarbeitung, St. Augustin1989.
[DHPS99] Deifel, Bernhard; Hinke, Ursula; Paech,Barbara; Scholz, Peter; Thurner, Veronika: DiePraxis der Softwareentwicklung: Eine Erhebung.In: Informatik Spektrum 22 (1999), S. 24–36.
[EITO01] European Information Technology Ob-servatory 2001. Eurobit, Frankfurt am Main2001.
[FKZS00] Friedewald, Michael; Kimpeler, Simone;Zoche, Peter; Stahl, Petra; Rombach, H. Dieter;
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
160 Michael Friedewald, Knut Blind, Jakob Edler
Wucher, Robert; Hartkopf, Susanne; Kohler,Kirstin; Broy, Manfred; Kruger, Ingolf: Analyseund Evaluation der Softwareentwicklung inDeutschland. GfK Marktforschung, Nurnberg2000.
[GoKl82] Gort, Michael; Klepper, Steven: TimePaths in the Diffusion of Product Innovations.In: The Economic Journal 92 (1982), S. 630–653.
[GrMa01] Grenzmann, Christoph; Marquardt, Ru-diger: Der Elan halt an! In: FuE Info 1/2001,S. 2–9.
[GrSc95] Green, Jerry; Scotchmer, Suzanne A.: Onthe Division of Profit in Sequential Innovation.In: RAND Journal of Economics 26 (1995),S. 20–33.
[JEGH01a] Janz, Norbert; Ebling, Gunther; Gott-schalk, Sandra; Hempell, Thomas; Peters, Betti-na: Innovationsreport: EDV und Telekommuni-kation. In: ZEW Branchenreport 8 (2001) 17.
[JEGH01b] Janz, Norbert; Gottschalk, Sandra;Hempell, Thomas; Peters, Bettina; Ebling, Gun-ther; Niggemann, Hiltrud: Innovationsverhaltender deutschen Wirtschaft. Indikatorenberichtzur Innovationserhebung 2000. Zentrum fur Eu-ropaische Wirtschaftsforschung, Mannheim2001.
[Jaff96] Jaffe, Adam B.: Technological Opportunityand Spillovers of R & D: Evidence from Firms’Patents, Profits and Market Value. In: AmericanEconomic Review 76 (1996), S. 984–1001.
[LeTi01] Lerner, Josh; Tirole, Jean: The OpenSource Movement: Key Research Questions. In:European Economic Review 45 (2001),S. 819–826.
[NuTe00a] Nuttgens, Markus; Tesei, Enrico: OpenSource – Konzepte, Communities und Institu-tionen. IWi-Heft 156. Universitat des Saarlandes,
Institut fur Wirtschaftsinformatik, Saarbrucken2000.
[NuTe00b] Nuttgens, Markus; Tesei, Enrico: OpenSource – Produktion, Organisation und Lizen-zen. IWi-Heft 157. Universitat des Saarlandes,Institut fur Wirtschaftsinformatik, Saarbrucken2000.
[NuTe00c] Nuttgens, Markus; Tesei, Enrico: OpenSource – Marktmodelle und Netzwerke. IWi-Heft 158. Universitat des Saarlandes, Institut furWirtschaftsinformatik, Saarbrucken 2000
[PKTG00] Pfeifer, Stefan; Korfur, Inger; Tschey,Alexander; Giertz, Jan: Multimedia im Maschi-
nenbau. ISA Consult GmbH, Bochum Mai2000.
[Raym01] Raymond, Eric S.: The Cathedral andthe Bazaar: Musings on Linux and Open Sourceby an Accidental Revolutionary. O’Reilly, Cam-bridge, Mass. 2001.
[SFBJ00] Schatz, Bernhard; Fahrmair, Michael;von der Beeck, Michael; Jack, Peter; Kespohl,Hans; Koc, Ali; Liccardi, Benito; Scheermesser,Sandra; Zundorf, Albert: Entwicklung, Produk-tion und Service von Software fur eingebetteteSysteme in der Produktion. VDMA, Frankfurt2000.
WIRTSCHAFTSINFORMATIK 44 (2002) 2, 151–161
Abstract
Innovation Activities of the German Software Industry
In this article we present the results of two empirical studies focusing on the structure andextent of the innovation activities of the German Software Industry and analyze distinctivefeatures of Software Innovations. We distinguish the activities of the primary (core) SoftwareIndustry and secondary industries such as Mechanical and Electrical Engineering, MotorIndustry and Telecommunications. A special focus is put on the question if innovations inSoftware are sequential, on the role of Open Source Software and the importance of inter-operability.
Keywords: innovation, software industry, sequential innovations, open source software,interoperability
Es handelt sind um eines der ersten aktuellenBücher zum Thema Supply Chain Management.Momentan ist der Markt zu diesem aktuellenThema kaum besetzt, in der US-amerikanischenLiteratur gibt es dagegen einen Boom. In diesemBuch schreiben erfahrene Praktiker für Praktikerund geben ihr Wissen weiter. Zielgruppe sind Ent-scheider und Projektleiter im Umfeld Logistik, SCM,Einkauf/Vertrieb.
JJaa,, ich bestelle hiermit
__ Expl. Lawrenz u. a., SSuuppppllyy CChhaaiinnMMaannaaggeemmeenntt,, 2. Aufl.€ 49,00 ISBN 3-528-15742-9
Firma
Abteilung
Vorname, Name
Straße (bitte kein Postfach)
PLZ, Ort
321 02 005
Bestell-CouponVon Profisfür Profis!
Änderungen vorbehalten.Abraham-Lincoln-Str. 46 · 65189 WiesbadenFax 0611.7878-439
Die Innovationstatigkeit der deutschen Softwareindustrie 161





















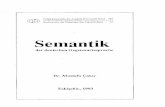







![Grammatik und Methodik der deutschen Sprache [Almanca Dilbilgisi ve Öğretimi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/630be91db4b18c456404d462/grammatik-und-methodik-der-deutschen-sprache-almanca-dilbilgisi-ve-oegretimi.jpg)


