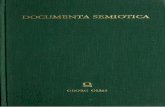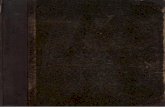Die Rückkehr der toten Seelen - Die 68er Studentenbewegung und Auschwitz
Die Aussenräume der Gropiusstadt (Berlin)
Transcript of Die Aussenräume der Gropiusstadt (Berlin)
Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Kulturwissenschaft Prof. Dr. Anke te Heesen Dr. Anna Echterhölter Forschungsseminar „Dokument und Zeugnis“ Verschriftlichung eines Referats vom 2. Juli 2013 Antonia Steger [email protected]
Die Außenraume der Gropiusstadt Die Gropiusstadt ist ein Stadtteil Berlins mit turbulenten Imagewechseln. Der riesige Stadtteil
wurde in den 1960er Jahren vom Bauhaus-Architekten Walter Gropius als Siedlung mit
hohem Standard geplant, das Projekt wurde in euphorischen Tönen gefeiert. In den 1970er
Jahren wandelte sich die Gropiusstadt jedoch zum Sinnbild einer Problemsiedlung. Für diese
Entwicklung gibt es viele Gründe, die hier aus Platzgründen nicht erläutert werden können1.
Das Leben in der Gropiusstadt war jedoch keineswegs von Passivität und Resignation
geprägt, vielmehr gab es auf vielen Seiten lebendige Diskussionen um die ideale Gestaltung
einer lebenswerten Stadt und die Bewohner gestalteten das Leben in ihrem neuen Stadtteil
aktiv mit. Meine Recherche konzentrierte sich nun auf die Außenräume der Gropiusstadt und
wie diese in den 1970er Jahren sozialkritisch aufgeladen wurden.
Die Archivsituation für die Gropiusstadt ist leider schlecht. Seit das umfassende Archiv der
Wohnungsbaugesellschaft GEHAG einer Überschwemmung zum Opfer fiel, sind Dokumente
nur ziemlich verstreut aufzufinden. Das Ziel meiner Recherche war es also auch, das
verstreute Restarchiv zusammenzusuchen. Der Startpunkt der Recherche war im Archiv
Neukölln, wo sich noch ein größerer Bestandteil an Dokumenten befindet. Ein ehemaliger
Mitarbeiter des Gemeinschaftshauses Gropiusstadt konnte mir noch einige Kontakte
vermitteln, sodaß ich Amateuraufnahmen in Film und Fotos fand und ein Gespräch mit dem
Pfarrer der evangelischen Gemeinde der Gropiusstadt führte. In Bibliotheken lagern
Aufarbeitungen und Studien aus den 1970er Jahren. Für eine Vertiefung der Recherche wäre
1 Über Mängel in der Bauplanung und –phase sei empfohlen: Hand Bandel/Dittmar Machule, „Die Gropiusstadt: Der städtebaul. Planungs- u. Entscheidungsvorgang. Eine Untersuchung im Auftr. d. Senators für Bau- u. Wohnungswesen Berlin“, 1974. Für die soziale Situation in der Gropiusstadt sei empfohlen: Heidede Becker/Dieter Apel, „Gropiusstadt: soziale Verhältnisse am Stadtrand: soziologische Untersuchung einer Berliner Großsiedlung“, 1977.
1
ein Besuch im Evangelischen Zentralarchiv Berlin interessant, davon mußte hier jedoch aus
Zeitgründen abgesehen werden. Eine Anfrage beim Gartenbauamt ergab leider keine Spur.
Das auf diese Art zusammengesuchte Archiv gibt nicht nur inhaltlich interessanten Aufschluß
über die Diskurse rund um die Gropiusstadt, sondern besteht auch aus ganz unterschiedlichen
Dokumenttypen. Jeder Dokumenttyp verlangt dabei eine eigene Herangehensweise und erfüllt
jeweils ganz andere Aussagenwerte.
Abbildung 1: Berliner Morgenpost, 8.11.1962
Meine Recherche begann mit Zeitungsartikeln aus dem Archiv Neukölln. Ihr Wert bestand
vor allem darin, einen Überblick über den öffentlichen Diskurs zu gewinnen und öffentliche
Meinungsverschiebungen zu beobachten. So wurde deutlich, daß die Gropiusstadt zu
Baubeginn ein Projekt mit hohem Prestige war, Schlagzeilen wie „rauchlose Mustersiedlung
im Grünen“, „Stadt für Fußgänger“ waren die Regel (vgl. Abb. 1). Doch Mitte der 1960er
Jahre setzte Kritik ein, die unter anderem am öffentlichen Raum ansetzte: „[A]uch BBR ist
ohne wahrhaft städtische Plätze, auf denen man sich treffen und verweilen kann“
(Gropiusstadt 132, 28.8.1966, vgl. Anhang 1). Ebenso wurde das Fehlen von geeigneten
Spielplätzen kritisiert und auch die rigorose Haltung der Hauswarte, welche den Kindern
vieles verboten und den Außenraum somit zwanghaft eingrenzen. Die Anfänge dieser Kritik
waren jedoch sehr stark geprägt von der unfertigen Stadt, die noch optimiert werden muß.
2
Wichtig war dabei die Semantik des „noch“ (vgl. Abb. 2), der Stadtteil wurde im Werden
begriffen, dessen Unfertigkeiten an Ausspracheabenden diskutiert wurden. Erst später setzte
eine Semantik ein, die von grundsätzlichen und auch irreversiblen Fehlern in der Planung
berichtet.
Abbildung 2: Berliner Morgenpost, 15.2.1969
Der Dokumenttyp des Zeitungsartikels ist dabei besonders aufschlußreich, um die
verschiedenen Interessenspositionen zu beobachten. Daß es dabei auch Konflikte gab, sollte
nicht weiter verwundern. Besonders interessant ist jedoch der Konflikt, in den die objektiv
berichtenden Zeitungen selbst gerieten: Einerseits wollten sie ihre Auflage an die Bewohner
der Gropiusstadt verkaufen, andererseits müssen sie in ihrem Auftrag nach möglichst
objektiven Berichten auch Gegenpositionen zu den Mieterinteressen wahrnehmen. Dies
kulminiert in einem interessanten Werbeprospekt der Berliner Morgenpost aus den 1970er
Jahren. Die Morgenpost berichtete sehr oft und ausführlich über die Gropiusstadt und
benutzte diese Tätigkeit auch als Werbeplattform. Im besagten Werbeprospekt stellt sie sich
gleichzeitig als Sprachrohr dieses neuen Stadtteils dar, das jedoch „einen kritischen Maßstab
anlegen und ein objektives Bild abgeben“ muß (vgl. Anhang 2). Zwischen Bürgervertretung
und objektivem Bericht schien sich jedoch ein unauflösbares Paradox zu ergeben, sodaß sich
die Bewohner nicht genügend von dieser Plattform repräsentiert fühlten. 1973 gründeten sie 3
darum ihre eigene Zeitschrift „Der kritische Bürger“ (vgl. Anhang 3). Diese Zeitschrift
erzeugte einen öffentlichen Diskussionsraum für die Stimmen der Bewohner und bündelte
verschiedene Initiativen und Bestrebungen zur Verbesserung der Siedlung. Der als tot erlebte
Außenraum der Stadt wurde damit ergänzt mit einem virtuellen Raum, in dem das
gemeinschaftliche Leben stattfand und eine Gegenöffentlichkeit erzeugt wurde. Die
gesammelten Ausgaben des „Kritischen Bürgers“ (später „Gropiusstadt“) liegen momentan
bei Herrn Pfarrer Helm in der evangelischen Kirchengemeinde Martin Luther King und wären
eine eigene, ausführliche Analyse wert.
Überhaupt bildeten sich in den 1970er Jahren viele Mieterinitiativen, die von zu teuren
Mieten über die Gestaltung des Alltagslebens bis zur Umfeldverbesserung für Kinder und
Jugendliche reichten. Dabei gab es ein verzweigtes Netz von Gegnerschaften: Bekämpft
werden mußten die Wohnungsbaugesellschaften, dann die Ämter und die Politik und nicht
zuletzt auch andere Mieterinitiativen, die gegensätzliche Interessen verfolgten.
Interessanterweise wurden diese Initiativen aber kaum dokumentiert. Es ging vielmehr um das
Erreichen von Zielen, was zu einer Art a-dokumentarischen Haltung führte. Bloß eine längere
Arbeit eines Sozialpraktikanten aus dem Jahr 1974 dokumentiert die Vielfalt der Initiativen
und stellt jede kurz vor. Drei Exemplare dieser Arbeit liegen ebenfalls in der Evangelischen
Kirchengemeinde Martin Luther King in der Gropiusstadt.
Abbildung 3: Ausschnitt aus "Bürgerinitiativen in der Gropiusstadt" von Peter Boltz, 1974
An sonstigen Dokumenten bezüglich Mieterinitiativen habe ich nur ein paar Flyerkopien im
Archiv Neukölln gefunden2. Einen davon fand ich jedoch besonders spannend (vgl. Abb. 4).
Einerseits sieht man hier, wie bestimmte Themen immer wieder auftauchen und fester
Bestandteil des Diskurses sind. So z.B. die gezeichneten Verbotsschilder auf der Wiese, die
Höhe der Häuser und Probleme mit Fahrstühlen. Diese Initiative für die Errichtung eines
Abenteuerspielplatzes spricht die Probleme direkt an: „Ärgert es Sie auch, wenn Kinder alle
Knöpfe im Fahrstuhl drücken, sie die spärlichen Anlagen zertrampeln, Jugendliche
Fensterscheiben kaputt machen und Feuer im Keller gelegt wird?“.
22 Gerade für die vertiefende Recherche zu den Mieterinitiativen würde sich ein Besuch im Evangelischen Zentralarchiv Berlin vermutlich lohnen.
4
Abbildung 4: Vorder- und Rückseite eines Flyers von drei Mieterinitiativen der Gropiusstadt, 1974
Obwohl diese Initiative laut ihrem eigenen Text die Situation von Kindern und Jugendlichen
verbessern möchte, ist ihre Forderung eines Abenteuerspielplatzes jedoch eher an Kinder
gerichtet. Jugendliche wurden viel stärker noch als „Gegner“ wahrgenommen, die es aber sehr
schwierig hatten, sich Gehör zu verschaffen. Dies leitet direkt über zum Roman „Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo“, der 1978 erschien. Er portraitiert Jugendliche, die in der Gropiusstadt
aufwuchsen und u.a. deswegen in die Heroin-Szene gelangten. Spätestens ab dem Zeitpunkt
dieser Buchpublikation wurde die Gropiusstadt auch über Berlin hinaus als Problemsiedlung
wahrgenommen3.
Es ist sehr interessant, diesen Roman unter der Perspektive des Dokumentarismus zu
betrachten. Der Roman wird im Vorwort explizit als „Dokument“ bezeichnet. Verschiedene
Stilmittel wie Jugendsprache, eingestreute Berichte von Christiane F.‘s Mutter sowie
Betreuern und Fotografien wollen Authentizität erzeugen, obwohl der Roman auch
hochgradig auf seine Verkaufbarkeit hin gestaltet ist. Die Darstellung der Gropiusstadt
3 Pfarrer Helm berichtet von einer Flut von Anfragen in den 1980er Jahren, bei denen Lehrer ganze Schulklassen durch die Gropiusstadt führen wollten um ihnen „die Originalschauplätze“ zu zeigen. Letztere waren zu dieser Zeit jedoch bereits nicht mehr wiederzuerkennen, da in den 1980er Jahren noch einmal eine große Umgestaltung der Außenräume vorgenommen worden war und auch das im Roman oft genannte „Haus der Mitte“ nicht mehr existierte.
5
übernimmt in diesem Roman viele Diskursfäden, die mir schon in früheren Dokumenten
aufgefallen sind – so z.B. die Semantik um die „Betonwüste“ und die defekten Fahrstühle und
die sadistischen Hausmeister. Das kulminiert in einem symbolischen Bild, das diese
beschriebene Misère der Gropiusstadt unter einem düsteren, bedrückenden Wolkenhimmel
stilisiert. Das Verhältnis von Wirklichkeit zum Dokument ist hier also auf vielfache Weise
stilisiert, Authentizität wird zum Verkaufsargument.
Abbildung 5: Stilisierte Gropiusstadt in "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", 1978
Begeistert hat mich schließlich ein Fachartikel4, der die fertiggestellte Gropiusstadt kritisch
hinterfragt. Er ist mit wissenschaftlichen Ansprüchen geschrieben und zitiert „Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo“ als Dokument für das Alltagsleben in der Siedlung: „Zum Alltag in der
Gropiusstadt sei verwiesen auf die Autobiographie einer 15jährigen Drogensüchtigen (…), in
der der ,Zusammenklang‘ von Gebäudekonzeption, Freiraumgestaltung und bürokratischer
Reglementierung seitens Wohnungsbaugesellschaften und Stadtverwaltung in seiner Wirkung
auf Kinder und Jugendliche drastisch zu Tage tritt“ (Fussnote 7 im besagten Artikel). Damit
wird der Roman plötzlich zur wissenschaftlichen Quelle. Gleichzeitig verwendet der Artikel
4 Gerhard Fehl, „Die Legende vom Stadtbaukünstler. Stadtgestalt und Planungsprozess der Gropiusstadt in Berlin“. In: Bauwelt 1979, Heft 36. S. 275-285.
6
ästhetisierende Verfahren, um den Außenraum scharf zu kritisieren. Der Autor wirft der
Gropiusstadt vor, nur zerstückelte und sinnlose Grünflächen aufzuweisen, die höchstens als
Müllkippe verwendet werden. Das, was er kritisiert, reproduziert er dann selbst in seinem
Text (vgl. Anhang 4): Den längeren Lauftext, mit dem er gerade die Zerstückelung der
Außenräume kritisiert, ist selbst durch eingestreute Fotos ständig durchbrochen. So ist es für
den Leser ebenso wie für den Gropiusstadt-Bewohner sehr anstrengend, sich zu orientieren.
Der wissenschaftliche Artikel verwendet damit ästhetisierende Verfahren, wie sie sonst dem
Paradigma der Fiktion angehören.
Ein letzter Dokumenttyp betrifft die private Sammelleidenschaft von Bewohnern der
Gropiusstadt. Erstes Zeugnis solcher Tätigkeiten fand ich in einem Zeitungsartikel der
Berliner Morgenpost vom 18.6.1970 (vgl. Anhang 5). Dieser erzählt von Frau Koči, einer
Bewohnerin von Gropiusstadt, welche jeden Artikel über diese neue Siedlung ausschneidet,
auf weißes Papier aufklebt und einordnet. Weiterhin liegen im Gemeinschaftshaus
Gropiusstadt einige Fotos eines Amateurfotografen sowie ein Amateurfilm eines anderen
Bewohners der Gropiusstadt. Die Fotos sind stets vom selben Balkon aus aufgenommen und
zeigen die rasante Entwicklung der Gropiusstadt während der Bauphase.
Abbildung 6: Amateurfotografien zum schnellen Wachstum der Gropiusstadt
Der Amateurfilm von Herrn Bredow aus dem Jahr 1970 kann hier aus medientechnischen
Gründen nicht wiedergegeben werden, ist jedoch ein äußerst spannendes Dokument, das
semi-professionell zusammengeschnitten und mit Kommentaren sowie Musik versehen ist.
Interessant wäre es, die Motivation für diese nicht selten aufwendigen Arbeiten zu ergründen:
Hatten die Bewohner das Bedürfnis, in einem aus dem Nichts entstehenden Stadtteil eine
Identifikation zu finden? Geben sie sich damit eine eigene Geschichte?
7
In meiner Recherche, die mich an viele Orte und zu vielen verschiedenen Dokumenten führte,
faszinierte mich auf inhaltlicher Ebene besonders die sozialkritische Bedeutungsaufladung der
Außenräume der Gropiusstadt. Sie fungieren als die öffentliche Zone dieses Stadtteils und
werden damit von vielen Interessen beansprucht. Die ursprüngliche architektonisch-
ästhetische Gestaltung des Architektenteams widerspricht der funktionalen Besetzung der
Grünzonen (so wurde extra stachliges Gebüsch gepflanzt, um ein Grünstreifen zwischen Weg
und Haus frei zu halten) und das daraus entstehende Ergebnis entsprach wiederum nicht den
Bedürfnissen der Bewohner, die im Außenraum vor allem auch Gestaltungsraum und
Entwicklungsraum für ihre Kinder sahen. Gerade ein Stadtteil wie die Gropiusstadt, die aus
dem Nichts aus dem Boden gestampft wurde, bot eine Möglichkeit, die Grundlagen des
Zusammenlebens von Grund auf zu hinterfragen und zu gestalten. Die gefundenen
Dokumente legen Zeugnis von dieser diskursiven Aufladung ab, mit der die verschiedenen
Interessenspartien immer wieder den Außenraum für sich beanspruchen und gemäß ihren
Interessen gestalten wollten.
Auf formaler Ebene faszinierte mich die Bandbreite verschiedener Dokumenttypen, die
auftauchten. Jedes Dokument hat wieder einen anderen Aussagenwert, so zum Beispiel die
Tageszeitung, welche den öffentlichen Diskurs möglichst objektiv darstellen möchte, während
die Bürgerzeitung in eigener Sache die interne Wahrnehmung viel parteiischer darstellt und
vor allem einem Aktionismus verpflichtet ist. Doch keines dieser Dokumente war bloß
Dokument. Das Dokumentarische überschnitt sich immer auch mit anderen Kulturtechniken:
in den Zeitungsartikeln mit dem möglichst objektiven Bericht, im Roman mit der Fiktion und
in den Amateuraufnahmen mit der Leidenschaft des privaten Sammelns. So ermöglichte die
Recherche zur Gropiusstadt nicht nur ein Eintauchen in die bewegte Vergangenheit eines
ganzen Stadtviertels, sondern machte auch die Wichtigkeit eines differenzierten Umgangs mit
Dokumenten deutlich.
8