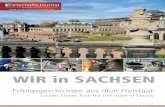Die Deutsche Glaubensbewegung als ideologisches Zentrum der völkischreligiösen Bewegung [2012]
Bewegung in Sachsen. Ein Beitrag zur Emanzipation der deutschen Tonpfeifenforschung
Transcript of Bewegung in Sachsen. Ein Beitrag zur Emanzipation der deutschen Tonpfeifenforschung
SCHWERPUNKTTHEMA'TONPFEIFEN IN SACHSEN"Auswohl der wichtigsten im Bond behondelten Orte
Zum Titelblatt: Tonpfeifenfunde in Einbeck, wo der sagenhafte Till Eulenspiegel seine Späße getrieben hat und ihm dafärein Denkmal gesetzt wurde, ist eines der Hauptthemen dieses Bandes.
Dresden Bernstadt
Tonpfeifenprodulctions- und -fu ndorte
Tonbergbau
rt
!
d
,9
d
Fd
d
a
k
fi
N
L
N
-d
a
-a
-d
3
!
d
d
d
*v
*.
BEWEGUNG IN SACHSENEIN BEITRAG ZUR EMANZIPATION DERDEUTSCHEN TONPFEIFENFORSCHUNG
RALF KLUTTIG-ALTMANN/MARTIN KÜGLER
r Einführung
Die Tonpfeifenforschung hat sich in Deutschland bekann-
termaßen erst in den späten 198oer Jahren langsam etab-
liert. Die wichtigsten Schritte waren die Vorlage einer
Terminologie (1987) und die Gründung eines Arbeitskrei-
ses (1988) sowie das Erscheinen des "Knasterroer" (seit
1989) als Publikationsorgan für die Ergebnisse der Unter-
suchungen. Das Besondere an der Tonpfeifenforschung in
Deutschland von Beginn an ist die enge Zusammenarbeit
von Archäologen und historisch orientierten Wissenschaft-
lern wie Historikern, Volkskundlern und Kunsthistoriker
sowie engagierten Sammlern.
Wie bei jedem neuen Zweig kulturhistorischer Wissen-
schaften orientierle man sich anfangs an dem, was an
Wissen und Kenntnissen im eigenen Land bereits vorhan-
den war - im Hinblick auf Tonpfeifen und Pfeifenbäcker
fiel die Bilanz Ende der rgSoer Jahre sehr nüchtern aus.
Der Blick über, die Grenzen zeigte aber rasch, dass es in
Großbritannien und - für Deutschland noch viel relevan-
ter - in den Niederlanden eine engagierte Forschungs- und
Publikationstätigkeit gab (und gibt). Die Orientierung
deutschsprachiger Pfeifenforscher an niederländischen
Arbeiten, deren Methodik und Terminologie wird aber
nicht nur durch den damaligen Forschungsvorsprung
erklärt, sondern ist sachlich auch in der Bedeutung der
dortigen Tonpfeifenproduktion für den deutschen Markt
begründet. Gouda war unbestreitbar seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts der maß-
gebliche Herstellungsort für Tonpfeifen - sowohl quantita-
tiv wie vor allem auch qualitativ. Von hier ging die grund-
legende Entwicklung der Kopfformen und Modelle aus,
hier wurden Kopfdekore und Stielverzierungssysteme ent-
wickelt, hier wurden im Laufe der Jahrzehnte Millionen
von Tonpfeifen hergestellt, die bei den Käufern in den
Niederlanden wie in Deutschland sehr beliebt waren.
Beide Faktoren - die Bedeutung Goudas für den europä-
ischen Tonpfeifenmarkt und der Forschungsstand in den
Niederlanden - haben bei deutschen Forschern jedoch
rasch dazu geführt, die Provenienz von Funden fast grund-
sätzlich mit "Gouda" anzugeben und sich mit einer groben
Datierung nach Jahrhunderlen zu begnügen. Deutsche
Produktionsorte waren weitgehend unbekannt und noch
viel weniger \,!'usste man über die Produkte, die dort herge-
stellt r.r'r-rrden. Im Zweifelsfall tendierle man eher zu einer
Zuschreibung nach Gouda, so dass sich die Annahme ver-
festigte, die Pfeifenlieferungen von dort wären fast allein in
der Lage gewesen, die deutschen Raucher zu versorgen und
einheimische Produkte hätten kaum einen Markt gehabt.
Erschwert wurde - und wird - die Forschungsarbeit
nicht nur wegen der Übernahme der Modelle aus Gouda
durch deutsche Pfeifenbäcker, sondern vor allem durch die
hemmungslose Nachahmung speziell Goudaer Marken
und Herstellernamen, worauf schon 1987 am Beispiel von
Pfeifen aus dem Westerwald hingewiesen wurde.' Ande-
rerseits stellte jedes nachgewiesene Plagiat einer nieder-
ländischen Pfeife durch deutsche Produzenten einen wich-
tigen Schritt dar, die scheinbare absolute Dominanz der
Importe zu relativieren, den Blick auf das tatsächliche
Mengenverhältnis von niederländischen und deutschen
Tonpfeifen an einem Verbrauchsort zu schärfen und sich
auch über verändernde Marktanteile klar zu werden.
Gerade die Tagung des Arbeitskreises Tonpfei;fen 2oo2 im
sächsischen Grimma zeigte, welche enormen Fortschritte
insgesamt zu verzeichnen sind. Hierbei kann man gegen-
wär1ig in der Bearbeitung von Funden und Produktions-
orten regional jedoch noch gravierende Unterschiede fest-
stellen. Kurzum lässt sich sagen - wie auch im vorliegenden
Band in vielen Beiträgen nachzulesen ist - dass in Sachsen'
wie in keinem anderen deutschen Bundesland die Ton-
pfeifenforschung seit zwei Jahren in Bewegung geraten ist
und einen Stand erreicht hat, der v.a. dazu Anlass gibt, die
Bedeutung Goudas für die Pfeifenforschung in Deutsch-
land grundsätzlich zu überdenken. Dies gilt einerseits für
die Frühzeit der Tonpfeifenproduktion im 17. Jahrhunderl
und die Frage des Technologietransfers. Zu fragen ist aber
auch, wie die allerorten ständig wachsende Zahl von
Tabakrauchern ausreichend mit Tonpfeifen versorgt wer-
den konnten - waren Importe möglich oder entstand durch
die Nachfrage eine Produktion vor Ort? Andererseits ist für
das r8. und r9. Jahrhundert die Frage nach der Unter-
scheidung der einheimischen Produkte und Plagiate von
2 Kügler: Tonpfeifen, S. 78, Kat.Nr. 86, 89 u.ö.
3 Im Folgenden wird mit "Sachsen" stets das heutige Bundesland
bezeichnet, historische Gebietsveränderungen bleiben dabei unbe-
rücksichtigt.
-*,,*,r r . , i , , , . , r . , : . , . . .
':::...,i.:. :,r,:, ::, ;,,.. :;t:.
den niederländischen Importen sowie die nach einer
eigenständigen Formentwicklung zu stellen. Vorausge-schickt sei ein Überblick über die Tonpfeifenproduktion inSachsen nach dem neuesten Stand der Forschune.
z Produktionsorte in Sachsen und die
Marktposition
Bisher waren im Bundesland Sachsen ra Produktions-stätten bekannt.' Das von den Verfassern dieses Beitrags
angelegte Verzeichnis deutscher Tonpfeifenproduktions-
orte weist nach aktuellem Standjedoch zo Orte in Sachsen
auf, in denen Tonpfeifen hergestellt w-urden. Die Infor-
mationen über den jeweiligen Produktionszeitraum, dieAnzahl der Werkstätten und die wirtschaftliche Bedeutung
fallen dabei sehr verschieden aus, was auf den lokal sehrunterschiedlichen Forschungsstand zurückzuführen ist.
Gibt es für manche Orte wie z.B. Ostritz an der Neiße nur
einen einzigen vagen Beleg, liegen für Grimma oder
Waldenburg (Altstadt) bereits intensive Untersuchungen
vor (s.u.). Die vorhandenen Angaben erlauben aber eineerste Charakterisierung der Gesamtentwicklung, wobeizwei Gruppen zu unterscheiden sind: Orte mit einerProduktion im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert sowie
solche, wo erst ab r75o oder noch später Tonpfeifen herge-
stellt wurden.
Mit denjüngst entdeckten Belegen fär einen spätestens
ab 1656 tätigen Pfeifenbäcker in Leipzig'zählt Sachsen zu
den frühesten belegten Produktionsgebieten in Deutsch-
land. Weitere Orte, in denen die Herstellung nach der
schriftlichen Überlieferung schon im t7. Jahrhundert
begann, sind Grimma (belegt ab 168Z) und Leisnig (ab
t697)u. Die Anfänge in Waldenburg bleiben noch im
Dunkeln, doch setzt die r7z5 erfolgte Gründung einerPfeifenbäckerinnung voraus, dass das Gewerbe bereits län-gerc Zeit ansässig war.' Zeitlich ebenso unklar bleibt der
4 Weinhold: Meister, S. 235 f., nannte 1982 rB Orte, von denen
aber heute einer in Sachsen-Anhalt (Bitterfeld) und drei in Polen
liegen; Seeliger: Bereich, nannte rg8g aufgrund seiner zufälligen
Materialsammlung zehn Orte, wobei es sich bei Chemnitz um eine
Verwechslung mit Schemnitz/Bafrska Star,rrica in der Slowakei
handelt.
5 Vgl. den Abschlussbericht über die Fundaufnahme in Leipzig
von Kluttig-Altmann: Tonpfeifen, in diesem Band.6 Vgl. fä. Angaben über Grimma und Leisnig die Beiträge von
Pesenecker: Tonpfeifenproduktion, und Mattuschka: Pfeifen-
bäckerei, in diesem Band.
7 Vgl. fü. Angaben über Waldenburg (Altstadt) den Beitrag von
Standke: Tonpfeifenbäckerei, in diesem Band.
Beginn der Produktion in fünf nahe beieinanderliegenden
Orten in der Oberlausitz südöstlich von Görlitz, von denen
Christian Gerber rTzo berichtet: "In denen kleinen
Städtlein, als Ostriz lOstritz], Hirschfelde, Seidenberg,Reichenau, Bernstädtlein sind die Thone tueifiIich, dahero
uiel Tabacks-Pfeffin allhier gemache| und uerf'ühret
werden."t Auch hier wäre ein Beginn um oder sogar langevor 17oo möglich, wie nicht zuletzl archäologische Fundevon Tonpfeifen in Görlitz, ZiIta\ Bernstadt und Freiberg(s.u.) sowie in Breslau (WrocIaw/PL)" vermuten lassen. Für
eine Produktion vor 17oo in vermutlich mindestens einemder genannten Herstellungsorte sprechen vor allem tlpolo-gische und technologische Besonderheiten, auf die weiter
unten noch intensiv eingegangen wird. Über Belgern heißtes, dort seien um r77o in großem Umfang Tonpfeifen her-gestellt worden, weitere Nachrichten sind nicht vorhan-
den."' Als letzter Ort ist Königsbrück zu nennen, wo 7729
eine Innung der Pfeifenbäcker gegründet wurde, was
wiederum auf einen schon länger zurückreichenden An-
fangszeitraum schließen lässt, und das Gewerbe bis in die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderls ausgeübt rurde." Meißen
mit seiner kurzfristigen Produktion durch Johann Müller(r7to-t713) kann als Sonderfall betrachtet werden, da hier
späterhin keine Tonpfeifen mehr hergestellt wurden."
Die zweite Gruppe von Produktionsorten bilden solche,
wo erst ab der Mitte des r8. Jahrhunderts Pfeifenbäcker
ansässig wurden oder sogar erst nach r8oo fassbar sind. Zu
nennen sind hier Dresden mit der "Fabrik" von Prevot (ab
r77il," oder Görlitz mit der erst durch die Zuwanderung
von Johann Conrad Wille t777 gegründeten Werkstatt.'*
Die bisher z.T. nur sehr vereinzelten Belege für Meuselwitz(belegt um t8oo),'u Muskau (ab 1763?),'" Borna (belegt um
18oo)," Pirna und Wermsdorf (belegt um rSro)'8 sowie
B Gerber: Wohltaten, S. 325. Zwei der fünf Orte liegen heute in
Polen: Seidenberg (Zawidöw) und Reichenau (Bogatynia).
9 Witkowska: Fajki; Lisowa: Zbiör.
10 Vgl. Morgenroth: Böttger, in diesem Band.
tt Vgl. Kubasch: Bedeutung.
" Wle Anm. 1c).
13 Schumann: Staats-Post- und Zeitungs-Lexikon, Bd. z, S. t76 f.
14 Kügler: Schönhof, S. 93; ausfährlicher zur Pfeifenbäckerei in
Görlitz und der Familie Wille demnächst von dems.: Tonpfeifen-
funde.
15 Ludovici: Akademie, Sp.3r.
16 weinhold: Meister, S. r75 f. u. 235.
17 Schumann: Staats-Post- und Zeitungs-Lexikon, Bd. 1, S. 454.tB vg1. weinhold: Meister, S. 235 f.
N
fr
qa
-w.
?s
F
a
ad
d
Ft
,P
I
aP
N
k
a
-
@
@@
a
L
F
d
a
'oL
-(d
N
-L
N
L
d
a
ad
d
3
ii
V
V
*.
Neukirch in der Oberlausitz (belegt r8zo)'' lassen erken-
nen, dass es sich jeweils um eine zeitlich wie quantitativ
eng begrenzte Produktion gehandelt haben muss. Für
Kötzschenbroda'" ist belegt, dass dort von 1828 bis nach
1863 produziertlmrrde. Als sehr fraglich ist noch die Ton-
pfeifenproduktion in Herrnhut um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts "u.rennen."
Von den genannten zo sächsischen Orten liegen nur in
wenigen Fällen nähere Angaben über die Anzahl der
Meister und die Dauer sowie den Umfang der Produktion
vor. Pfeifenbäckerorte mit überregionaler Bedeutung
waren im 18. und beginnenden r9. Jahrhundert Grimma
und Waldenburg. Noch unklar ist die Bedeutung von Leis-
nig und Königsbrück, ebenso wie von Muskau, Görlitz oder
Dresden, denn die vereinzelt genannten Produktions-
zahlen sind quellenkritisch problematisch.'= Weiterge-
hende lokale Forschungen stehen hier noch aus.
Dennoch lässt sich fär das 17. Jahrhundert aufgrund der
Funde an Verbrauchsorten wie Leipzig erkennen, dass die
Versorgung aus dem eigenen Land einen hohen Anteil ein-
nahm und nicht weiter von der Annahme ausgegangen
werden kann, niederländische Produkte hätten den Markt
überschwemmt." Tatsächlich ist der Anteil der eindeutig
als niederländische Importe zu identifizierenden Tonpfei-
fen sehr gering. Kommt im Falle Leipzigs neuerdings ein(oder mehrere?) Pfeifenbäcker in der Stadt selbst als
Hersteller in Frage (s.o.), so ist auch zunehmend von einer
Versorgung aus anderen sächsischen oder thüringischen
Orten auszugehen. Diese Beobachtung gilt in noch größe-
rem Maße für das 18. Jahrhundert, wo der prozentuale An-
teil der mit Sicherheit aus Gouda stammenden Tonpfeifen
in den untersuchten Fundkomplexen im Verlauf des Jahr-
hunderts nur langsam anwächst. Aber auch in diesen Zei-
ten kann von einer marktbeherrschenden Stellung der Im-
pofte keine Rede sein, vielmehr sind es Pfeifen aus Grim-
ma oder Waldenburg, die bevorzugt gekauft wurden. För-
19 Schumann: Staats-Post- und Zeitungs-Lexikon, Bd. 7,5.7g.
=' Vgl. den Beitrag von Standke: Tonpfeifenbäckerei, in diesem
Band sowie Schubert: Chronik. S. r8z u. zz6.
zr Den einzigen Hinweis liefert Walker: Origins, S. 15 f., zr u. 24.
Walker weist ab 1755 einen Töpfer und Pfeifenbäcker in Penn-
sylvania nach, der aus Herrnhut stammte und dort beide Hand-
werke gelernt haben sol1.
" Vgl. hierzu grundsätzlich Seeliger: Pfeifenmacher , S. 2r-27.
23 VCl. hierzu Kluttig-Altmann: Tonpfeifen, in diesem Band, so-
wie den grundlegenden Ürberblick von dems.: Rauch, wie auch die
weiteren im Literaturverzeichnis aneeführten Titel von dems.
dernd für den Verkauf war es in jedem Fall, die spezifi-
schen Kennzeichen einer echten Goudaer Pfeife fast per-
fekt zu imitieren, und den sächsischen Pfeifenbäckern
gelang es, sich damit gegen die - wegen des weiten Trans-
portweges teureren - Importe durchzusetzen.
Daneben gibt es auch zahlreiche Beispiele für eine
individuelle und korrekte Kennzeichnung der Pfeifen aus
sächsischen Orten. Künftige genaue Untersuchungen der
Produkte aus den Herstellungssorten werden es besser
möglich machen, die Plagiate von den Importen zu unter-
scheiden und nachvollziehbare Kriterien für diese Diffe-
renzierung zu entwickeln. Die schon bekannten Aussagen
schriftlicher Quellen etwa aus Grimma über die Imitation
von Marken, Dekoren und Stielaufschriften machen es
aber nahezu unwahrscheinlich, dass etwa in der zweiten
Hälfte des r8. Jahrhunderts Importe aus Gouda den säch-
sischen Markt hätten dominieren können. Ihr Marktanteil
dürfte vielmehr stets geringer als der sächsischer/deut-
scher Tonpfeifen gewesen sein. Daher muss bei der Inter-
pretation von Tonpfeifenfunden in umgekehrter Weise
stärker als bisher davon ausgegangen werden, dass es sich
um sächsische Produkte handelt und nicht a oriori um
niederländische Importe.
Dies ftillt bei Tonpfeifen des r8. Jahrhunderts zugegebe-
nermaßen schwer. Bei der oben bereits genannten Gruppe
von Funden aus dem 17. Jahrhundert sindjedoch nicht nur
die typologischen Unterschiede augenfällig, deren Inter-
pretation das von der Forschungsmeinung bisher postu-
lierte niederländische "Versorgungsmonopol" untergräbt,
sondern sogar das "Dogma" von der einzig möglichen Me-
thode, Tonpfeifen seriell herzustellen, völlig in Frage stellt.
3 Terra incognita Sachsen. Die Bntdeckung
neuer alter Tonpfeifen-Technologien
Eine höchst erstaunliche Seite an den in letzter Zeit ent-
deckten frühen Funden in Sachsen sind Merkmale bisher
für Tonpfeifen unbekannter bzw. nicht für möglich gehal-
tener Technologien. Die folgende Darstellung beruht auf
der Untersuchung der Fundstücke aus Görlitz sowie weite-
rer unpublizierter Funde aus Bernstadt und Freiberg'"
sowie aus ZitIar,'u die aufgrund der zahlreichen Arbeits-
24 Ygl. für Görlitz Kügler: Schönhoi S. gz ff.; die Fragmenre aus
dem Heimatmuseum Bernstadt u'urden freundlicherweise von
Peter Schoene zur Verfügung gestellt; auf den Fund aus Freiberg
wies dankenswerterweise Bernd Standke/Freiberg hin.
25 Der unpublizierte Fund aus der Grabung am Salzhaus in
Zittav 2ooof2oor (Grabungsnummer Zi-o5) *rrrde den Ver-
fassern im Februar zooz bekannt und konnte aufeenommen und
spuren viel von ihrem Entstehungsprozess preisgeben.
Dabei offenbaren sich gravierende Abweichungen zum"üblichen" Ablauf bzw. völlig neue produktionstechnische
Wege. Die einzelnen neuen Technologien hängen eng
zusammen und treten teilweise an den gleichen Objekten
auf; der besseren Übersicht halber werden sie hier nach-
einander beschrieben. Vorab ist zu bemerken, dass der/dieProduktionsort/e noch nicht bekannt sind, eine Entste-hung in der Region Ostsachsen aber sicher ist. Auch eineFein- bzw. Einzeldatierung ist erst nach genauer Bearbei-
tung möglich. Als Grobdatierung kann jedoch schon jetzt
die Zeit ab ca.64o/5o bis ca. 168o genannt werden.
3.1 Manuelle Verzierungen an Tonpfeifen-
köpfen
An Funden aus Görlitz, die M. Kügler unlängst vorstellte,
fällt neben der für sich schon ungewöhnlichen, zylindri-
schen Kopfform und dem ansetzenden rund gebogenen
Stiel auch die Art der Kopfiierzierung auf, die in zwei ähn-
Iichen Varianten auftritt (Abb. r)." Der aus horizontal um-
laufenden Rillen und anderen Motivbändern bestehendeDekor wurde, wie sonst auf Stielen, nach dem Ausformen
der Pfeife manuell abgerollt, was die Art des Dekors selbst
sowie die individuellen Unterschiede zwischen den gleich
fotografiert werden; eine detaillierte Bearbeitung steht noch aus.Frau Dr. Judith Oex1e, Landesamt für Archäologie Dresden, sei fürihre freundliche Unterstützung dieser ersten Untersuchung sehrnachdrücklich gedankt.
26 Kügler Schönhof, S. 93 f., Variante 1: Kat.Nr. S-Z &ier abgebil-det Kat.Nr. 6), Variante z: Kat.Nr. B.
verzierten Pfeifen verraten. Wie sonst bei manuellen
Stielverzierungen überlappen sich die Ansätze der Motiv-
bänder oder diese verlaufen leicht schräg zur Kopfachse.
Der ausgeformte und angetrocknete Kopfwrrrde bei der
häufiger vorkommenden Variante r an seiner Ansatzstelle
mit drei oder vier parallelen Ritzlinien versehen,'- darüber
folgt ein Motivband aus alternierenden stehenden und
hängenden Dreiecken. Direkt darüber ist eine
Art Tannenzweigmotiv abgerollt, zuletzt (etwa
auf der Kopfmitte) folgen eine breite und eine
schmale Furche. Die Furchen können jeweils mit
einem relativ unspezifischen Werkzeug ausge-
führt worden sein, die Motivbänder mussten,
wie auf Stielen auch, mit einem speziellen
Rollrädchen o.ä. angebracht werden, in die dasjeweilige Motiv eingeschnitten war.
Für diese markanten Typen, die eine seltene
Kopfform mit einem ungewöhnlichen Dekor
kombinieren, liegen inzwischen zwei weitere
Parallelen aus Sachsen vor. Nahezu identische
Stücke zur Görlitzer Variante r wurden in Frei-
berg und Bernstadt (Abb. z) gefunden. Die
Exemplare der einzelnen Fundorte zeigen stets
den gleichen Verzierungskanon, weichen aber
in der Ausführung und in der Kopfform gering-
fügig voneinander ab, so dass von einem in meh-
reren Werkstätten produzierten, überregional bekannten
Pfeifentlp ausgegangen werden kann. Dass die "Familie"
27 Nle beschriebenen Verzierunqen verlaufen horizontal um denKopf.
f,
d
aq
?6
Föd.
a!
?a
g
tr!
,/.,?'
h
@
N
Y!
a
d
v
:.{,:,.:,'.:i,
Abb. z: Pfeife Görlitzer Variante 1 aus Bernstadt bei Zittau.
Görlitzer Variante z (a) und Variante r (b).
@
I
@
a
qk
-tq
d
a
I
N
-d
L
N
L
q
a
-
-
3
L
V
V
dieses Grundtlps größer gewesen sein muss, belegt ein
Fragment aus Zittau, welches auf einem sich nach unten
allmählich verjüngenden Kopf Rillen der Görlitzer
Variante r mit dem Dreieck/Rillen-Motiv der Görlitzer
Variante z kombiniert (Abb. g).'"
Für manuell eingedrückte Kopfuerzierungen an Ton-
pfeifen konnte nur eine einzige publizierte Parallele aus
Breslau ausfindig gemacht werden,'" wenn man von
Marken und von der Kopfränderung absieht, welche auch
eine manuelle Verzierung darstellt und an manchen
Köpfen nicht nur "regulär" randständig, sondern weiter
unten, schräg oder mehrmals angebracht wurde'" und
nicht selten auch als einfachste Stielverzierung diente.
Die Neufunde aus Zittau und Bernstadt weisen jedoch
ebenfalls verschiedene Varianten manueller Verzierungen
auf. Zwischen dem Material aus Zittau, Bernstadt und
Breslau bestehen zudem große Ahnlichkeiten in den ver-
wendeten Motiven, welche verstärkt an kleinen, meist dop-pelkonischen oder trichterförmigen Köpfen des mittleren
und späten r7. Jahrhundefis auftreten. Die große Vielfalt
dieser anderen manuellen Kopfuerzierungen muss zu
einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.
28 wi" Anm.27.
29 Witkowska: Fajki, die auch das schon zuvor bei bei Lisowa:Zbiör, vorgestellte Material berücksichtigt.
30 Kluttig-Altmann: Erster Vorbericht, S. ZS Abb. r; ders.: Be-obachtungen, S.+Z f., Kat.Nr. 20.
J.z Nachträgliches Biegen des Stieles (nach dem
Durchstechen des Rauchkanals)
Wird an einer im Ganzen ausgeformten Tonpfeife der sog.
Weierdraht durch den Stiel bis in den Kopf hinein durch-gestoßen, um einen Rauchkanal mit Verbindung zurn Kopf
herzustellen, entsteht an der gegenüberliegenden Innen-
wandung des Kopfes meist eine Einstichstelle, da Kopf
und Stiel stets einen verschieden großen Winkel bilden(Abb. +a). Bei ungewöhnlich vielen Kopffragmenten aus
Görlitz und Zittau füllt jedoch auf, dass die Wandunggegenüber dem Durchstoßloch keine derartigen Spuren
aufureist. Das Loch stößt direkt von unten durch den Kopf-
boden, entweder parallel zur Längsachse des Kopfes oder
leicht schräg, wie Einstichspuren zeigen, die von unten in
Richtung Rand zielen (Abb. S). Gleichzeitig sind außen an
der Verbindungsstelle zwischen Kopf und Stiel aufftillig
viele Fingerspuren zu bemerken.
Aus diesen Merkmalen lässt sich erschließen, dass bei
den Zittauer Funden Kopf und Stiel vor dem Durchstechen
Abb. 3: Evtl. zusammen gehörende Kopf- und Stielfragmenteeiner Pfei fe mit g le i tendem Kopf-St ie l -Übergang sowie ver-schiedener manueller Kopf- und Stielverzierungen. Zittau,Salzhaus.
(-\\\ \\\ \ \
\\ \!-_-_
-_ r
Abb.4: Durchstechen des Rauchkanals (Weiern) bei üblicher,komplett modelgeformter Pfeife (a), in flachem Winkel (b) undin einer Achse (c).
9.3 Zusarnmensetzeneinzelnhergestellter
Köpfe und Stiele
Die Herstellungsspuren an diesen Funden lassen aber noch
einen anderen, in seiner Bedeutung für die bisherige Sicht
auf die Tonpfeifentechnologie viel weitreichenderen
Schluss zu: Bei vielen Pfeifen der genannten Fundkom-
plexe kann zweifelsfrei erkannt werden, dass Kopf und
Stiel manuell zusammengefügt urrrden, nachdem man sie
vorher einzeln herstellte. Für die Herstellung des Kopfes
selbst konnten zwei Varianten entschlüsselt werden.
3.3.r Mit der Form hergestellte Köpfe
Anfänglich fäIlt auf, dass die betreffenden Pfeifenköpfe
überdurchschnittlich stark verdrückt sind, dass diese
Druck- und Wischspuren von Fingern herrühren, dass sie
bereits angebrachte Kopfverzierungen verwischen und
dass die ungewöhnlich kieinen und spitz zulaufenden
Fersen ebenfalls sehr unregelmäßig und degeneriert gestal-
tet sind (Abb. 6). Die Längsachse der Pfeifen ist oft ge-
krümmt, der ansetzende Stiel von unregelmäßiger Stärke.
Weder Kopf noch Stiel lassen auch nur die allergeringsten
Spuren einer Formnaht erkennen. Gerade am Kopfansatz,
noch in einem sehr flachen Winkel ausgerichtet gewesen
sein müssen (Abb. +b). Erst danach urrrde der Stiel per
Hand in die gewünschte Lage gebracht. Bei den Görlitzer
Funden kommt der Rauchkanal senkrecht aus dem Koof-
boden, und die
Wandung trägt
überhaupt kei-
ne Einstich-
spuren, so dass
sich Kopf und
Stiel beim Wei-
ern in einer
Achse befunden
haben müssen(Abb. 4c). Dem
kommt entge-qen r ] e qq r ]er
Stiel stets bo-
genförmig an-
setzt und die
Pfeife keine
Ferse besitzt.
In einem Fall
lässt sich durcheine "oi inst ioe"
Bruchstelle sogar
Biegen des Stieles(Abb. r).
Abb. 6: Tonpfeifen mit angarniertem Stiel. Zittau, Salzhaus.
d
d.
q
G
3
-.a!
q
-.d
F!. -
itr
!
N
I
!
a
v
erkennen, dass der Rauchkanal beim
leicht oval zusammengedrückt rtrrrde
wo er bei modelgeformten Pfeifen seinen größten Durch-
messer hat, ist der Stiel oft etwas eingeschnürl. Die Ober-
fläche der Pfeifen ist rau, überall von Fingerspuren be-
deckt und weist keine Anzeichen einer Glättung auf.
Zusammenfassend betrachtet widerspricht der ganze
Abb. 5: Einstichspuren des Weierdrahtes, von unten zurMündung verlaufend (vgl. Abb. 4b). Zittau, Salzhaus.
.n
-!
-.
F
@
il
!
N
F.i
N
H
d
qd
U)
k
bo
e.d.
?
Habitus der Pfeifen dem regulären Ursprung aus einer
Pfeifenform, denn dabei entsteht, trotz mancher zugestan-
dener Unregelmäßigkeiten, doch ein gewisser Standard in
der Oberflächenqualität, der Ausrichtung der Pfeife und
der Gestaltung einzelner Details.
Die wichtigste Beobachtung aber sind Abbruchstellen,
die bei anderen Pfeifen so noch nicht beobachtet werden
konnten, im Zittauer Material jedoch fast die Regel dar-stellen (Abb. Z). Die Pfeifen aus einer zweischaligen Form
behalten beim Zerbrechen meist einen kleinen Stielansatz,
weil der Stiel aufgrund der Materialhomogenität in der
Regel an einer dünneren Stelle brechen wird als direkt amKopf, und die entstehende Bruchstelie ist geklüftet. Stiele
des Zittauer Komplexes brachen überwiegend direkt am
Kopf ab. Dadurch entstand eine ovale, innen glatte Ab-
bruchstelle, außen von einem ringförmigen Grat umge-
ben - mit anderen Worten: innen die frei gelegte Kopf-
wandung, außen ein Rest des angarnierten Stieles. Solche
Bruchstellen sind qpisch für zusammengefügte Einzelteile,
wie sich häufig an Keramik erkennen lässt, wenn einschlecht angefügter Henkel oder Fuß abgefallen ist. Bei
einer (nachlässigen) Angarnierung geht das Material keine
sehr feste Bindung ein und bildet bei Druckbelastungen diegrößte Schwachstelle.
Die Beobachtungen an den Fundstücken lassen denSchluss zu, dass nur die Köpfe dieser Pfeifen in einer Formgefertigt wurden. Die Stiele wurden handgerollt, durch-
bohrt (s.o.) und dann an den Kopf angefügt, wobei man
den Kopf-Stiel-Übergang manuell verstrich. Die Fersen
wurden bei diesem Vorgang wahrscheiniich per Hand aus
dem Stiel herausgedrückt oder extra angesetzt, worauf ihre
unregelmäßige Form, mehr aber noch ihr Sitz weit auf dem
Stiel, in einem größeren Abstand vom Kopf als üblich, hin-
deutet (Abb.6).
Die Beschädigung vorhandener Kopfverzierung durch das
Anbringen des Stieles offenbart, dass die Köpfe bei den
Zittauer/Bernstädter Funden vor dem Montagevorgang
verziert w.urden (s.u.), obwohl dies im Sinne der End-qualität kontraproduktiv ist.
Diese Beobachtungen wurden erstmals an zahlreichen
Fragmenten des Zittauer Salzhaus-Komplexes gemacht.
Neue Funde mit ähnlichen Kopfformen und Dekoren aus
Bernstadt weisen die gieichen Merkmale auf. Bei einer
Rückschau auf bereits publiziertes Material können zwei
Leipziger Funde angeführt werden, die einige der beschrie-
benen Merkmale besitzen und möglicherweise ebenso her-gestellt nurden." Da beide mit Stielansatz erhalten sind
und so die aufFällige Bruchstelle am Kopf nicht gegeben ist,
schien es sich bisher nur um nachlässig gearbeitete, frühe
Funde zu handeln - auf der Grundlage der neuen Erkennt-
nisse aus Ostsachsen eröffnen sich jetzt viel weit reichen-
dere Interpretationsmöglichkeiten.
3.3.2 Auf der Drehscheibe produzierte Köpfe
Die eingangs genannten Görlitzer Pfeifen mit den zylindri-
schen Köpfen (Abb. r) halten noch eine andere überra-
schung parat. Da alle Köpfe beschädigt sind und genaue
Einblicke in das Innere erlauben, konnten trotz derVerfärbung durch Tabakkondensat bei zwei Fragmenten"
an der Innenwandung eindeutige Drehspuren festgestellt
werden! Das Kopfinnere weist im unteren Teil typische
Drehwülste auf, wie sie z.B. oft an Steinzeuggefäßen zu
31 Kluttig-Altmann: Zweiter Vorbericht, S. rB, Abb. 9; ders.:Beobachtungen, S. +Z f., Kat.Nr. zo. Letztgenanntes Vergleichs-stück besitzt im Zittauer Fundkomplex sogar eine frappierendähnliche Entsprechung.
32 Kügler: Schönhof, S. g: f., Kat.Nr. 6 f.
Tlpische Bruchstellen nach dem Abbruch eines angarnierten Stiels. Zittau, Salzhaus.
erkennen sind. Die ganze innere Kopfwandung ist darüber
hinaus mit feinen Drehrillen bedeckt. Diese Spuren sind
aufgrund der Kleinheit der Objekte und der Feinheit des
Tones nur schwach ausgeprägt, aber doch eindeutig zu
erkennen und sicher zu interpretieren. Sie verlaufen streng
horizontal und sind durch keinen anderen Arbeitsgang zu
erzeugen als einen formenden Finger bzw. ein Werkzeug
an dem schnell rotierenden Kopf. Der übliche Gestal-
tungsprozess des Kopfinneren, v.a. die Aushöhlung mit
dem Stopfer und ein manuelles Nacharbeiten des Rauch-
kanalloches, erzeugt andere Spuren, welche zwangsläufig
vertikal oder schräg verlaufen.
An den beiden anderen Fragmenten aus Görlitz waren
diese Spuren nicht so sicher, aber ansatzweise zu beobach-
ten." Bei einer Überprüfung der anderen Funde dieses
Kopfllps aus Bernstadt gelang der Nachweis von Dreh-
spuren ebenfalls an zwei von drei in Frage kommenden
Fundstücken. Zusätzlich lassen sich dort vertikale Nach-
bearbeitungsspuren erkennen, als ob man zuletzt mit
einem dicken Draht von oben nach unten an der inneren
Kopfwandung herunter gefahren sei. Durch diese Nach-
bearbeitung u.urde an den Bernstädter Funden auch das
Austrittsloch des Rauchkanals geglättet, während bei den
Görlitzer Funden der beim Durchstoßen entstehende cha-
rakteristische Grat unverändert erhalten ist. Der Freiber-
ger Fund entspricht ebenfalls dieser Beschreibung.
Es kann mit weitgehender Sicherheit geschlussfolgert
werden, dass der Kopft1p mit der beschriebenen Roll-
stempelverzierung (Abb. r f.), der bis jetzt an drei Fund-
orten in Sachsen nachgewiesen ist, auf der Drehscheibe
entstand. Abgesehen von den beschriebenen Spuren
kommt auch die zylindrische Kopfform dieser Herstel-
lungsmethode entgegen. Zu,l,etzt soll erwähnt werden, dass
bei zwei Fragmenten, bei denen dies aufgrund des Erhal-
tungszustandes noch festgestellt werden kann, der Innen-
durchmesser des Kopfes an der Mündung enger ist als
unten. Dieses Verhältnis wäre bei der Aushöhlung mit
einem Stopfer nicht möglich.
Im Gegensatz zu den weiter oben beschriebenen
Zittauer/Bernstädter Funden wurde bei den Köpfen des
Görlitzer Tlps der Kopfdekor nach dem Anbringen des
Stieles abgerollt, wie die Überlagerung der Druck- und
Wischspuren der Stielausrichtung durch die Verzierungen
zeigt.
Im Zusammenhang mit dieser neu entdeckten Tech-
nologie, Pfeifenköpfe auf der Drehscheibe herzustellen und
danach den Stiel anzufügen, wird eine Quelle interessant,
welche Martin Kügler bereits 1995 erwähnte. In der"Trunckenen Trunckenheif", einer zeittypischen Anti-
Tabak-Schrift, schreibt Sigmund von Birken 1658: 'Zasset
uns doch auch betrachten, die Tabakninkgeschirre; die
RauchJlöten, die Werkzeuge dieses tollen Gesäuffi! die
gemeAnsten werden aus Toon, die besten aus Englischer
I?eide, zubereitet. AIIe Töpfer-Scheiben, sind do:rnit
bernüssigt, und alle Kramlöden damit angefiillet."'o
Leider bleibt offen, wo Birken dies gesehen hat. Musste M.
Kügler diese Beschreibung damals noch als falsch kolpor-
tierte Beobachtung auffassen, weil sie wirklich der gesam-
ten bekannten Tonpfeifentechnologie widersprach und
derartige Aussagen oft nicht wörtlich zu nehmen sind,
bekommt sie im Lichte der neuen Funde eine große
Bedeutung. Wenn es sich um eine realistische Beobachtung
handelt, ist das Drehen von Pfeifenköpfen in zwei weit von-
einander entfernt liegenden deutschen Regionen nachge-
wiesen - von einem vermutlich süddeutschen Ort (Nürn-
berg?) schriftlich und in Ostsachsen durch Funde. Es wird
ein sehr spannendes Kapitel künftiger Forschung sein, die-
sen ersten Hinweisen nachzugehen und gezielt nach weite-
ren Belegen für diese unvermutet aufgetauchte alternative
Technologie zu suchen.
J.4 Schlussfolgerungen zurTechnologie
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es zur
gängigen Technologie der zweischaligen Pfeifenform bis-
her unbekannte Alternativen gab, welche v.a. um die
Mitte/in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Ost-
sachsen und angrenzenden Regionen verbreitet waren.
Diese ersten Beobachtungen sind ein Anfang und mit
Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs weiterer ähnlicher
Beobachtungen - regional wie überregional. Abschließend
seien einige Gedanken über die Motivation, diese z.T. selt-
sam anmutenden (Behelfs-)Technologien zu verwenden,
erlaubt.
Pfeifenköpfe zu drehen kann mit dem Nicht-Kennen
oder Nicht-Erwerben-Können von Pfeifenformen zusam-
menhängen, ferner mit der starken Verwurzelung des
Pfeifenmacherhandwerks im Töpfergewerbe. Töpfer konn-
ten so einen Teil ihrer Erfahrung und ihres Könnens in die
Pfeifenherstellung einbringen und sich einen neuen
Absatzmarkt erschließen. Das Endprodukt ist attraktiv und
steht der Qualität "normal" produzierter Pfeifen nicht
6l
d
d
d
a@
d
op?
Fd
d
aF
vd
d
d
d
F!
!d
a
Nd.
'-XL
a
34 Birken: Trunkenheit, S. zr (bzw. S. zo des Nachdrucks),
Biografie ebd., S. z3r ff.; vgl. Kügler: Pfeifenbäckerei, S.+g.33 Ebd., Kat.Nr. 5 u. ro.
zLlf
Umfange vorauszusetzen als es bisher postuliert wurde.Vielmehr muss stärker als bisher von lokaler/regionaler
Produktion ausgegangen werden. Diese Produkte heben
sich im r7. Jahrhundert teilweise deutlich tlpologisch vonden importierten Pfeifen ab, während sie im 18. und 19.
Jahrhundert die goudischen Vorbilder bis zur Perfektionimitieren. Somit sind einerseits noch ortsspezifische Tlpen
und Entwicklungen herauszuarbeiten, und andererseitsCharakteristika zu benennen, die Plagiate von echtenniederländischen Pfeifen unterscheiden lassen. Hierbei
arbeiten Archäologie und historische Wissenschaften engzusammen, indem Funde und schriftliche Quellen von denProduktionsorten gemeinsam interpretierl werden.
Die hier an sächsischen Verhältnissen aufgezeigteEmanzipation der deutschen Tonpfeifenforschung betrifftsomit archäologische, historische, technologische, typolo-gische und methodische Bereiche. Statt der reinen Fund-
vorlage und pauschalen Zuweisung der Fragmente ist esheute möglich, die Fundstücke differenziert und im regio-nalen wie auch im übergeordneten Kontext zu betrachten.Die nunmehr ftir Sachsen grundsätzlich zu revidierende
Forschungsmeinung von der Dominanz der niederländi-
schen Tonpfeifenbäckerei und vom "Versorgungsmonopol"
ist auch für andere Bundesländer in Frage zu stellen. Im
Hinblick auf die eigenständigen Entwicklungen bei Tech-
nologie und Modellen im r7. Jahrhundert in Sachsen seivergleichend nur auf die bisherige Vorlage von Funden aus
Bayern oder Baden-Württemberg verwiesen." Ahnliche
Ergebnisse sind auch für Niedersachsen und Nordhessen
zu postulieren, doch fehlen hier noch Funde aus frühen
Produktionsorten des r7. Jahrhunderts wie Braunschweig
oder Großalmerode.'u Die Relativierung der angenomme-
nen Dominanz goudischer Pfeifen auf deutschen Märktenim r7. wie auch im 18. Jahrhundert zeigt sich mittlerweile
allenthalben, wie z.B. Andreas Heege eindrucksvoll fürEi nbeck nachweisen kann.'-
Natürlich kann und soll diese Emanzipation der sächsi-
schen wie generell der regionalen deutschen Tonpfeifen-
forschung, die in den nächsten Jahren sicher weitere
Schritte machen wird, keine "Abnabelung" von der nieder-ländischen wie der internationalen Pfeifenlandschaft
bedeuten. Gerade wenn man eine stärkere Rolle der regio-
nalen deutschen Produktion anerkennt, muss man sich der
35 Vg]. Szill: Tonpfeifenfunde; und den Beitrag vondecke: Pfeifen, in diesem Band.
36 vs]. Seeliger: Pfeifenmacher, S. z9 ff.
37 YCl. Heege: Tonpfeifen, in diesem Band.
engen historischen Abhängigkeit von Gouda, was Modelle
und Verzierungen zumindest im r7. und 18. Jahrhundertangeht, belmsst bleiben. Mit nur wenigen Jahren Yerzö-gerung haben die sächsischen Produzenten, die ihre Kun-
den mit Goudaer Qualität zufrieden stellen wollten, stilis-
tische Anderungen von dort aufgegriffen. Die Dominanz
Goudas ist in qualitativer Hinsicht.unangefochten und
bleibt unbestritten, wenn auch weniger absolut zu sehenals bisher. In quantitativer Hinsicht ist siejedoch grundle-
gend zu revidieren. Der zunehmende internationale Aus-
tausch von Forschungsergebnissen zeigt, dass deutsche
und niederländische Produkte nicht nur in Deutschland,
sondern auch auf anderen europäischen Märkten undsogar in Übersee miteinander konkurrierlen.
Abbildungsnachweis:Alle Zeichnungen und Fotos: Ralf Kluttig-Altmann;Maßstab ca. 1:1.
LITERATURBirken, Sigmund von: Die Trunckene Trunkenheit.Eine, aus Jacobi Balde P.Soc.J. Lateinischem gedeutschteSatga oder Straff-Rede wider den Missbrauch des Tabaks.... [Textausgabe der r. Aufl. Nürnberg 1658]. In: Sigmundvon Birken: Die Trunckene Trunkenheit. Mit Jacob Baldes"Satyra Contra Abusum Tabaci". Mit einem ausführli-chen Nachwort, hg. von Karl Pörnbacher. München 1976,S. 5-r58.Gerber, Christian: Die unerkannten Wohltaten Gottes ...Dresden und Leipzig r7zo.fleege, Andreas: Tonpfeifen aus Einbeck, Nieder-sachsen. In: Knasterkopf. Bd. r6f2oog, S. rr-68.Kluttig-Altmann, Ralf: Beobachtungen zur Techno-logie manueller Stielverzierungen an Tonpfeifen. Miteinem Beitrag von Martin Kügler. In: Knasterkopf. Bd. r4/2OOL, s. 32-49.Ders.: Tonpfeifen in Leipzig - Erster Vorbericht über dieNeufunde seit r99o. In: Knasterkopf.H. tzltggg,S.74-82.Ders.: Tonpfeifen in Leipzig - Zweiter Vorbericht überdie Neufunde seit r99o. In: Knasterkopf. H. rglzooo,S. ro-28.Ders.: "Hirdurch zihet man den rauch ins Maull". Ton-pfeifen aus Leipziger Stadtkerngrabungen 1992-2ooo imKontext ihrer tlpologischen und kulturhistorischen Ent-wicklung. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsi-schen Bodendenkmalpflege t4/zoog, S. 239-263.Ders.: Tonpfeifen in Leipzig - (vorläufiger) Abschlusseiner Fundaufnahme. Ein sehr früher Pfeifenbäcker inLeipzig. In: Knasterkopf. Bd. 16/2oo3, S. 113-116.Ders.: Tonpfeifenfunde von einer innerstädtischenParzelle Leipzigs. In: Knasterkopf. H. tr/r998, S.+g-SS.Kubasch, Irene: Bedeutung und Stellung der Königs-brücker Töpferei. In: Heimatkundliche Blätter für die
q@
d
0)
?
F
d.
a,a
-
tr
6
F!
,-.
L
a
N,q
V!
a
d
v.
Schmae-
@
a
k
t id
d
q
L
d
Cd
Nd
rtl
N
LP
IJI
".iG)ad
a
3
!q)
?I
H
V
"t/.
Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt, Leipzig. 3. Jg.lr9S7,s.3o-39.Kügler, Martin: Bericht über das erste Treffen zur Er-forschung des Tonpfeifen-Vorkommens (Produktion undFunde) in Deutschland am 3. September 1988 in Soltau.In: Die Keramik vom Niederrhein und ihr internationalesUmfeld. Internationales Keramik-Synnposium in Duisburg,Düsseldorf und Neuss 1988. Hg. von Joachim Naumann.(= Beiträge zur Keramik, Heft g). Düsseldorf 1989, S. ro5 ff.Ders.: Pfeifenbäckerei im Westerwald. Die Geschichteder Pfeifenbäckerei des unteren Westerwaldes von denAnfängen um l7oo bis heute. (Werken und Wohnen, Bd.zz). Köln 1995.Ders.: Tonpfeifen aus dem Schönhof zu Görlitz. In:Knasterkopf. Bd. 15/zooz, S. 9o-9S.Ders.: Tonpfeifen. Ein Beitrag zur Tonpfeifenbäckerei inDeutschland. Quellen und Funde aus dem Kannenbäcker-land. Höhr-Grenzhausen 1987.Ders.: Tonpfeifenfunde aus dem Schönhof zu Görlitz.Zur Pfeifenbäckerei in Görlitz und der Geschichte derFamilie Wille. In: Görlitzer Magazin. 18. Jg./zoo4 fimDruckl.Lisowa, Eleonora: Zbifu fajek odkrytych podczas badaratowniczych na trasie W-Z we Wroclawiu [Die im Laufevon Rettungsarbeiten auf der O-W Trasse in Wroclawexplorierte Tabakpfeifensammlungl. In: Silesia Antiqua.Tom XXV. Wroclaw, Warszawa u.a. 1983, S. rz5-136.Ludovici, Carl Günther: Eröffnete Akademie der Kauf-leute, oder vollständiges Kaufmanns-Lexicon ... Teil 5,2. verm. und verb. Auflage Leipzig 1768.Mattuschka, Gerhart: Pfeifenbäckerei in Leisnig. In:Knasterkopf. Bd. 16/zoo3, S. rr7.Morgenroth, Walter: Johann Friedrich Böttger und dieErrichtung seiner Meißner Tabakspfeifenfabrik. In:Knasterkopf. Bd. 16lzoo3, S. 13r-136.Pesenecker, Marita: Tonpfeifenproduktion in Grim-ma. In: Knasterkopf. Bd. t6lzoo3, S. ro5-rrz.Schmaedecke, Michael: Floral verzierte Pfeifen mitHerstellerangaben aus Fundkomplexen des südlichenOberrheins. In: Knasterkopf. Bd. 16/zoog, S.6g-82.Schubert, Gustav Wilhelm: Chronik und Topographieder ... Parochie Kötzschenbroda, nebst historischen allge-meinen Notizen. z Bde Dresden 1864 und t865.Schumann, August: Vollständiges Staats-Post- undZeitungs-Lexikon von Sachsen. Bd. r Zwickau r8r4;Bd. z ebd. r8r5; Bd. 7 ebd. r8zo.Seeliger, Matthias: Pfeifenmacher im Bereich der heuti-gen DDR. In: Knasterkopf. H. r/r989, S. t7-zg.Ders.: Pfeifenrnacher und Tonpfeifen zwischen Weserund Harzvorland. Geschichte der Handwerker und ihrerErzeugnisse. (Schriftenreihe der Volkskundlichen Kom-mission für Niedersachsen e.V., Bd. 7; Beiträge zur Volks-kunde in Niedersachsen 6). Göttingen 1993.Standke, Bernd: Zur Tonpfeifenbäckerei in Walden-burg (Altstadt). In: Knasterkopf. Bd. 16/2oo3, S. u8-r3o.
Szill, Helmut: Tonpfeifenfunde aus Erding. In:Knasterkopf. Bd. t4/zoor, S. r3-zo; Bd. 15fzooz, S. 5r-64.Walker, Iain C.: The Central European origins of theBethabara, North Carolina, clay tobacco pipe industry. In:The Archaeology ofthe clay tobacco pipe, vol. IV: Europe,vol. I. Hg. von Peter Davey. (British ArchaeologicalReports, International Series, Nr. 9z). Oxford 1980, S. 11-69.Weinhold, Rudolf: Meister - Gesellen - Manufakturier.Zur Keramikproduktion und ihren Produzenten in Sachsenund Thüringen zwischen rTSo und r83o. In: Volkslebenzwischen Zunft und Fabrik. Studien zu Kultur und Lebens-weise werktätiger Klassen und Schichten während des; i rUbergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus. (Veröf-fentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd.69). Berlin 1982, S. 165-25o.Witkowska, Teresa: Fajki Badan archeologicznych naplacu Dominikanskim we Wroclawiu. [Pfeifen aus denarchäologischen Untersuchungen auf dem Dominikaner-platz in Breslaul. In: Silesia Antiqua. Tom. XXXIX.Wroclaw 1998, S. 283-336.
:: .$rir*,r&*:












![Die Deutsche Glaubensbewegung als ideologisches Zentrum der völkischreligiösen Bewegung [2012]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6340808b5a150e6dd70b25aa/die-deutsche-glaubensbewegung-als-ideologisches-zentrum-der-voelkischreligioesen.jpg)













![Die ›Bewëgung der Sprache‹. Überlegungen zum Primat der Bewegung bei Heidegger und Hölderlin [full text]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315f0ad5cba183dbf083a2f/die-bewegung-der-sprache-ueberlegungen-zum-primat-der-bewegung-bei-heidegger.jpg)