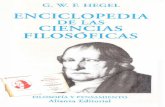Grenzfiguren. Kultur, Geschlecht und Subjekt bei Hegel und Nietzsche
Transcript of Grenzfiguren. Kultur, Geschlecht und Subjekt bei Hegel und Nietzsche
Inhalt
Vorwort von Judith Butler.................................................................................... 7
Danksagung...........................................................................................................11 Einleitung...............................................................................................................13
Hegel: Grenzfiguren der Subjektformation
1. Der Anfang des Subjekts und die Grenze der Geschichtlichkeit ..........33
Das Subjekt und die Figur der Rückwendung...........................................35 Der Anfang des Subjekts ..............................................................................38 Landkarten des Geistes .................................................................................47 Geschichte des aufgeschobenen Anfangs..................................................60 Regsamkeit und Reflexion ............................................................................68 Der falsche Zauber Afrikas und die Zauberkraft der Negation.............71
2. Der Tod des Subjekts und die Grenzen der sittlichen Welt ...................77
Der Tod und die Wiederkehr des Außen...................................................78 Die Bedeutung der Familie...........................................................................84 Eine andere Grenze der sittlichen Männlichkeit.......................................91 Die Familie und das Recht der Begierde....................................................97 Der Krieg und die Sittlichkeit ....................................................................107 Die Arbeit der Familie.................................................................................115
6 G R E N Z F I G U R E N
Nietzsche: Grenzfiguren der Subjektkritik
1. Die Entmännlichungsmoral .......................................................................123
Das Subjekt der Verinnerlichung ..............................................................125 Selbstvergewaltigung und Subjektformation ...........................................127 Hysterie und Dekadenz...............................................................................135 Das schlechte Gewissen und die Logik der Unterwerfung...................146 Die Kastratenmoral .....................................................................................149 Homoerotik und Moralkritik......................................................................157
2. Die Vervielfältigung des Anfangs und die Tropen.................................163
Die Frage des Anfangs ................................................................................164 Die genealogische Kritik .............................................................................167 Die tropische Wendung ..............................................................................174 Wildnis und Melancholie ............................................................................179 Der Mensch und die konstitutive Differenz zum Tier ..........................183 Das Leiden der Moderne ............................................................................192
Nachwort .............................................................................................................199 Literatur................................................................................................................203
Vorwort von Judith Butler
Im Bereich von Philosophie und Feminismus werden immer wieder neue Richtungen eingeschlagen und neue Formen entwickelt. Mit der vorliegen-den Arbeit werden wir in eine Lektürepraxis eingeführt, die gleichzeitig textlich aufmerksam und philosophisch scharfsinnig ist. Nicht länger be-trachten wir nur die Frauenbilder in diesem oder jenem Text, sondern hier erfahren wir, dass manche »Grenzfiguren« geradezu das Feld der philo-sophischen Intelligibilität konstituieren. So definiert das Bild �– das nicht immer ein Bild sein muss, sondern in einer Art Grenze des Denkens bestehen kann �– auf negative Weise den Bereich des Denkbaren. Und Patricia Purtschert zeigt uns, wie das vor sich geht.
Ihre Argumentation geht davon aus, dass die verschiedenen Figuren, die sich in den von ihr behandelten philosophischen Schriften Hegels und Nietzsches tummeln, philosophisch bedeutsam sind, und dass die Argu-mentation, insbesondere zum Menschen- und Subjektbegriff, von diesen Figurenkonstellationen genauso erhellt wird wie von den explizit vorge-brachten Argumenten der beiden Denker. Während einige feministische Philosophinnen diese Philosophen (neben anderen) mit neuem Blick gele-sen haben, um männliche Vorurteile oder ethnozentrische Mängel heraus-zuarbeiten, macht Purtschert etwas anderes: Ihr Argument lautet, dass der Text seine eigenen Begrenzungen genau an der Stelle seiner Grenzfiguren »anzeigt«. Dementsprechend kann sie bei einer immanenten Analyse der Texte bleiben, nicht nur um zu zeigen, dass diese Texte Frauen ausschlie-ßen, die Überlegenheit einer europäischen Menschheit behaupten und Unterscheidungen zwischen Mensch und Tier einführen, die bestenfalls fragwürdig sind. Vielmehr macht sie auch deutlich, wie diese Texte an der Grenze ihrer jeweiligen theoretischen Befugnis gewisse Figuren ausarbeiten und bekräftigen, und dabei Vorstellungen von Frauen, rassisch gekenn-zeichneten Anderen und Tieren produzieren, die ihre expliziten philoso-phischen Ansprüche oft Lügen strafen. Die Autorin muss sich nicht au-
8 G R E N Z F I G U R E N
ßerhalb des Textes stellen, um dessen Ansprüche zu kritisieren, denn diese Ansprüche werden von Figuren begleitet, die diese selbst in Frage stellen.
So nimmt Purtschert Hegels explizite Darstellung der Subjektformation und prüft nach, ob die Art von zeitlicher Entwicklung, die in der Phänome-nologie des Geistes entfaltet wird, eine bestimmte Vorstellung von histori-schem Fortschritt enthält, der einen »primitiven« Anfang postuliert und erfordert, welcher zugleich überwunden und bewahrt wird. Der »Fort-schritt« dieses Geistes, der immer größere Komplexität gewinnt, wird »heimgesucht« von Figuren der Vergangenheit und eines elementaren Le-bens, die er angeblich überwunden oder aufgehoben hat. Diese Figuren las-sen Hegel jedoch keine Ruhe, sondern sie tauchen für ihn weiterhin auf und legen so nahe, dass sie diese Fortschrittsgeschichte als ihr nicht voll-ständig assimiliertes »Außen« begleiten. Dies bedeutet, dass Geschichte für Hegel nur unter der Bedingung stattfindet, dass manche Bevölkerungen effektiv als vor-historisch postuliert werden. Dieses Postulat tilgt jedoch nicht ihre Präsenz in der logischen Darstellung der historischen Entwick-lung. Im Gegenteil, sie tauchen entweder als jene Figuren auf, die den vorhistorischen Beginn der Geschichte eingrenzen, oder als ihr »Außen«.
So entwickelt Purtschert eine immanente Kritik, die zeigt, dass sogar der »Beginn« des Subjekts und der »Beginn« der Geschichte eine »Vor-Geschichte« haben, und dass diese unmögliche Zeit des Vor- oder Außer-halb-der-Geschichte-Seins zentral für die Argumentation ist, die Hegel zu entfalten versucht. Was als klarer Widerspruch zu seinen Behauptungen über die Entstehung des Subjekts, der Familie und des Staates erscheinen könnte, erweist sich als wesentlich für die Argumentation. Mehr noch: Dieses wesentliche »Außen« erscheint durch Figuren, die außerhalb der von Hegel explizit vertretenen Methode logischer Darstellung wirksame philosophische Arbeit leisten. Mit anderen Worten: Die semantische Ope-ration seines Textes erweitert die expliziten Aussagen und bietet die Mög-lichkeit für deren Kritik. Im Ergebnis überschreitet der Bereich philoso-phisch signifikanter Textualität in Hegels Text seine vorsätzlichen Argu-mente. In diesem Sinn offenbart der Text seine eigene Ressource für eine Kritik der Argumentation und erweitert so den Bereich und die Bedeutung der immanenten Kritik.
In den Kapiteln zu Nietzsche wird die Entstehung des Subjekts aus ei-nem anderen Blickwinkel betrachtet. Hier liefert Purtschert eine überzeu-gende Analyse von Nietzsches Erklärung der Entstehung des Gewissens, indem sie zeigt, wie die verschiedenen Vorstellungen von Tieren, rassisch
V O R W O R T V O N J U D I T H B U T L E R 9
markierten Völkern und Frauen auftauchen, um seine Argumente zu illu-strieren und erweitern. Der Moment des reflexiven Bewusstseins, der Akt, durch den ein Subjekt sich selbst zum Objekt nimmt, wird von Nietzsche als Akt der Selbstverachtung oder Selbstverstümmelung beschrieben. Eine ursprünglich nach außen gerichtete Aggression wird nach innen gekehrt und produziert in ihrem Gefolge die beiden inneren Phänomene der »Seele« und des »Gewissens«. Die Figuren, durch die diese Reflexivität konstitutiv für die innere Moral wird �– und so zur »Grundlage« für die Zivilisation im Subjekt �–, sind gelegentlich die der Selbstmisshandlung und der Selbstvergewaltigung. Der unwahrscheinliche Begriff der Selbstverge-waltigung macht nur Sinn, wenn es eine verinnerlichte Weiblichkeit gibt, die regelmäßig misshandelt wird, damit das männliche Subjekt entstehen kann. Diese Sichtweise legt nahe, dass das männliche Subjekt bei Nietzsche nicht nur vom Weiblichen differenziert wird, sondern das Weibliche erfor-dert als das wieder und wieder gewaltsam Verstoßene �– als Gründungs-moment des männlichen Subjekts.
Purtschert denkt mit beeindruckender Aufmerksamkeit über Nietz-sches eigenen sich überschlagenden Unterdrückungsbegriff nach und weist darauf hin, dass das, was für die Psyche in Nietzsches Werk »verdrängt« ist, lebendig bleibt und in figuraler Form weiter zirkuliert. Die Grenzen des Subjekts sind die Stellen, die wir heranziehen sollten, um herauszufinden, worin die Geschichte von Unterdrückung und Gewalt besteht, die in den expliziten Entwicklungsnarrativen des Textes nur teilweise erzählt wird. Purtscherts Deutung lässt sich als Erweiterung einer genealogischen Kritik verstehen, welche Nietzsche und Foucault verwendet, die Probleme ge-schlechtlicher Differenz und rassischer Normen jedoch auf eine Weise thematisiert, die keiner von beiden hätte antizipieren können. Mehr noch: Es wird eine Betrachtung des tierischen Lebens einbezogen, die zeigt, dass die Begründung des Subjekts, des Menschen, des Begehrens, der Familie, Rasse und Nation auf eine Vor-Geschichte verweist, die die Basis für eine Kritik der Darstellung des Gründungsmoments bildet. Diese verleugnete Geschichte bildet eine Art von melancholischer Grundlage, um die Ent-wicklung zivilisatorischer Normen philosophisch zu erklären. Die ab-schließenden Überlegungen zum Leiden der Moderne deuten darauf hin, dass die Anstrengungen, durch die die Moderne sich und ihre eigene zivili-satorische Leistung definiert, einen Bereich wilder Figuren, verirrter und beklemmender unbewusster Gebote und semantisch überdeterminierter Textstellen hervorbringen. Die Grenzfiguren stellen philosophische Auto-
10 G R E N Z F I G U R E N
rität infrage, während sie gleichzeitig die semantische und textliche Reich-weite philosophisch bedeutsamen Schreibens erweitern.
Dieser Text ist wichtig für ForscherInnen, die sich für Hegel, Nietz-sche, feministische und Rassentheorie, sowie für neue kritische Lektüre-praktiken interessieren. Das Buch durchquert Philosophie ebenso wie Literatur und wird wichtige Debatten darüber auslösen, wie wir lesen, und was kulturell geschieht, wenn die Grenzfiguren im Text umfassendere kulturelle Logiken rekapitulieren. Auch wer nicht jeder Schlussfolgerung zustimmt, wird das Buch mit Gewinn lesen, denn es setzt einen neuen Standard für die philosophische und feministische Forschung.
Aus dem Englischen von Gustav Roßler
Danksagung
Ich danke Judith Butler, Andrea Maihofer und Annemarie Pieper für die intellektuelle und institutionelle Unterstützung, die sie mir während der Arbeit an diesem Buch gewährt haben, und für Gespräche, die mich mein Projekt immer wieder produktiv überdenken ließen. Meinen Eltern Jacqueline und Max Purtschert-Joss danke ich dafür, dass sie meine Wege fernab von Goldau mit Anteilnahme begleiten. Für wegweisende Kom-mentare danke ich Emil Angehrn, Susanne Brauer, Marianne Hänseler, Cornelia Klinger und Dominique Zimmermann. Mein Dank geht ferner an Antonia Bertschinger, Serena Dankwa, Jörg De Bernardi, Mei Yan Grie-benow, Dominique Grisard, Annette Hug, Ulle Jäger, Anelis Kaiser, Christoph Keller, Katherine Lemons, Stephan Meyer, Karen Phillips, Katharina Pühl, Lena Rérat, Brigitte Röder, Maja Ruef, Annika Thiem, Kylie Thomas und Leonore Wigger für Denkanstöße, gemeinsame Lek-türen und unzählige Diskussionen, die mir stets aufs Neue dazu verholfen haben, dieses Projekt in der Gegenwart zu situieren. Mein besonderer Dank gilt denen, ohne die dieses Buch undenkbar wäre: Katrin Meyer, Beat Röllin und Yves Winter.
Beim Schweizerischen Nationalfonds, der Max Geldner-Stiftung, der Janggen-Pöhn-Stiftung, der Freien Akademischen Gesellschaft Basel und dem Dissertationenfonds der Universität Basel bedanke ich mich dafür, dass sie meine Forschung in Basel und Berkeley unterstützt und die Publi-kation dieser Arbeit ermöglicht haben.
Das vorliegende Buch ist die leicht überarbeitete Version meiner Dis-sertationsschrift »Grenzfiguren. Zum Eurozentrismus und Androzentris-mus bei Hegel und Nietzsche«, mit der ich am 1. Februar 2005 an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel im Fach Philo-sophie promoviert habe.
Einleitung
Das Erlernen einer wissenschaftlichen Disziplin gestaltet sich immer auch als Prozess der Disziplinierung. In der Philosophie gehört dazu das Erwer-ben der Fertigkeit, Textstellen zu übersehen und zu überlesen, die für eine philosophische Interpretation �›zu historisch�‹, �›zu exemplarisch�‹, �›zu anek-dotisch�‹ oder schlicht �›zu unbedeutend�‹ sind. Das Einüben dieses selektiven Blicks wird dabei kaum je zum Thema; er wird vielmehr stillschweigend vermittelt und erlernt. Mein Problem bestand darin, dass gerade diese un-bedeutenden Passagen, die narrativen Einschübe, die eigenartigen und bisweilen bizarren textuellen Figuren nicht aufgehört haben, meine Neu-gierde zu wecken und mein Interesse auf sich zu ziehen. Die Intuition, dass es dabei nicht nur um textuelle Ausschmückungen und historische Remi-niszenzen, sondern um eine Art �›Politik zwischen den Zeilen�‹ geht, fand ich bestätigt in den Ansätzen der feministischen Philosophie, der postko-lonialen Theorie, der Dekonstruktion und des Poststrukturalismus. Sie zeigen Möglichkeiten auf, philosophische Texte auch von ihren Rändern her zu erschließen, und eröffnen auf diese Weise neue Lektürerouten. Unter einer solchen Perspektive werden auch die gängigen Vorstellungen des Subjekts fragwürdig: Indem diese Theorien nicht von der Geschlos-senheit, Autonomie und Selbstgenese des Subjekts ausgehen, wird dieses auf eine andere Weise denkbar gemacht. Das Subjekt entsteht, so wird vorgeschlagen, durch Inklusion und Exklusion, durch performative Grenz-ziehungen, in einem Spiel von Differenzen, durch ein konstitutives Außen, über Bereiche des Verworfenen, vermittels Figuren der Alterität und in einem Feld von Macht.
Diese alternativen Versuche, das Subjekt zu denken, sind in bestimm-ten Diskussionskontexten noch nicht angekommen, in anderen sind sie bereits zu grundlegenden Theoremen geronnen. Dass dekonstruktive und poststrukturalistische Konzepte als theoretische Fundamente vorausgesetzt werden, obgleich sie unter anderem eingeführt worden sind, um die Fun-
14 G R E N Z F I G U R E N
dierung von Wissen kontinuierlich in Frage zu stellen, stellt ein bedeutsa-mes, beunruhigendes und zuweilen paradoxes Moment in der Geschichte ihrer Verwendung dar. Das Nachdenken über diese partielle Sedimentie-rung kritischer Begriffe und subversiver Denkbewegungen stellt einen der vielen Anfänge des vorliegenden Buches dar. Die Annahme, dass das Sub-jekt durch Andere entsteht, wird darum in den nachfolgenden Lektüren erneut zur Frage, wie dies denkbar gemacht werden kann und wie es im Rahmen der modernen Philosophie zu denken ist. Wie strukturiert das Verworfene die Entstehung des Subjekts, wo kommt die Alterität ins Spiel, wie nimmt sich das Spiel der Differenzen aus, wie weit tragen diese dekon-struktiven und poststrukturalistischen Konzepte, was können sie erklären und wo werden sie selbst erklärungsbedürftig? Wie kann, mit anderen Worten, die Vorstellung eines Subjekts, das durch den Ausschluss, durch das Andere und durch die Differenz entsteht, in einer eingehenden Text-lektüre produktiv gemacht und gleichzeitig auf ihre Grenze hin befragt werden? Diese Fragen stehen am Beginn meines Versuchs, Texte von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Friedrich Nietzsche �›gegen den Strich�‹ zu lesen. Ausgerichtet habe ich die Lektüre an zwei Differenzen, die für die Entstehung des modernen Subjekts grundlegend sind: an der Geschlech-terdifferenz und an der Unterscheidung zwischen Wildheit und Zivilisa-tion.
Vom Eurozentrismus und Androzentrismus in der Philosophie
Im deutschsprachigen Raum wird der Eurozentrismus in der Philosophie kaum problematisiert. Eine der wenigen Monographien zu diesem Thema stellt Hinrich Fink-Eitels 1994 erschienenes Werk Die Philosophie und die Wilden dar. Darin macht er in der neuzeitlichen Philosophie zwei Strö-mungen aus, die er als �›Mythos des Bösen und des Edlen Wilden�‹ bezeich-net. Der Begriff des Bösen Wilden, dessen Herkunft Fink-Eitel mit der gewalttätigen europäischen Eroberung Südamerikas verknüpft, sei zu ei-nem Begriff für alles Deviante der Kultur geworden. »Der Böse Wilde war das minderwertige Andere der eigenen, überlegenen Kultur, handle es sich nun um äußere oder innere Feinde, um fremdartige Völker oder Rassen, um �›unzivilisierte�‹ oder �›staatsfeindliche�‹ Aufrührer (�›Anarchisten�‹) oder einfach um diejenigen, die auffällig wurden und Anstoß erregten, weil sie
E I N L E I T U N G 15
von der gegebenen Norm abwichen.«1 Parallel dazu entsteht die Figur des Edlen Wilden, die Fink-Eitel mit einer spezifischen Form der zivilisierten Melancholie verbindet, mit einem Leiden also an der Zerstörung der �›na-türlichen�‹ Lebensweise. Die Figur des Edlen Wilden steht für das Gefühl des Verlusts und wird zur Folie für eine Kritik, welche in Kultur und Zivi-lisation die Entfremdung des Menschen von seiner Natur ausmacht.2 Der Autor hält dabei fest: »In dieser Gestalt formierte sich der Komplemen-tärmythos des Bösen und des Edlen Wilden zu einer kontinuierlichen Un-terströmung der gesamten europäischen Geistesgeschichte [�…]. Die bis in die Gegenwart reichende Kontinuität der hier verhandelten Problematik wurde bislang noch nicht bemerkt.«3 Fink-Eitels Feststellung, dass die Bedeutung des Wilden, Fremden und Nicht-Europäischen für die Philoso-phie kaum untersucht ist, hat bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren. Al-lerdings ist die Absenz der postkolonialen Theorie in Fink-Eitels Darstel-lung symptomatisch für ihre stark verzögerte und noch immer zögerlich erfolgende Rezeption im deutschsprachigen Raum. Encarnación Gutiérrez Rodríguez hält fest, dass die »geographische, politische und theoretische Relevanz [der postkolonialen Theorie] hauptsächlich im anglophonen Raum oder in den ehemaligen Kolonien [ansetzt]. Der deutschsprachige geographische Kontext taucht in dieser Diskussion als postkoloniales Ge-bilde nicht auf.«4 Auch Shalini Randeria und Sebastian Conrad weisen darauf hin, dass die eigene koloniale Vergangenheit und postkoloniale Gegenwart in Deutschland �– und das gilt auch für die Schweiz oder Öster-reich �– im Unterschied zu England, Frankreich, Spanien, Portugal oder Holland kaum thematisiert wird.5 Die Vorstellung, dass Länder, die über keine oder nur während kurzer Zeit über Kolonien verfügt haben, nicht am kolonialen Projekt beteiligt waren und damit auch keinen postkolonia-len Raum darstellen, lässt sich allerdings nicht halten. Zum einen machen die sozialen, ökonomischen und politischen Verknüpfungen innerhalb Europas und im transatlantischen Bereich deutlich, dass der Kolonialismus nicht (nur) ein nationalstaatliches Projekt war und dass auch Staaten ohne Kolonien Kolonialpolitik betrieben haben. Zudem zeigt die postkoloniale �—�—�—�—�—�— 1 Fink-Eitel, Die Philosophie und die Wilden, S. 9 2 Fink-Eitel schreibt dazu: »Der Edle Wilde ist das fiktive Idealbild gewaltlos gelungenen
Lebens, von der her eine Kritik der eigenen Kultur normativ [�…] ausweisbar wird.« (Ebd.)
3 Ebd., S. 10 4 Gutiérrez Rodríguez, »Fallstricke des Feminismus«, S. 14 5 Conrad/Randeria, »Einleitung. Geteilte Geschichten«, S. 39ff.
16 G R E N Z F I G U R E N
Theorie die Wechselwirkungen zwischen Wissensformationen und kolo-nialen Praktiken auf: Die moderne Episteme hat die kolonialen Unterneh-mungen einerseits mit ermöglicht, andererseits hat deren Logik die Wissen-schaften mit hervorgebracht. Eine postkoloniale Perspektive auf die Philo-sophie untersucht darum nicht nur, ob und wie sich diese zur Sklaverei, zum transatlantischen Handel oder zur Kolonialpolitik äußert. Sie fragt vielmehr, wie das moderne Verständnis von Zeit und Raum und die Art und Weise, sich selbst und Andere darin zu situieren, mit der Eroberung, Kartographierung und Kategorisierung der Welt und ihrer BewohnerInnen verbunden ist. Die Philosophie in diesem diskursiven Kontext zu verorten, bedeutet, sie nach ihrem spezifisch modernen Eurozentrismus zu befragen.
Diese postkoloniale Fragestellung wird in der vorliegenden Arbeit mit einer zweiten Thematik verbunden, die in den letzten Jahrzehnten von der feministischen Theorie und der Geschlechterforschung in die deutschspra-chige Philosophie hineingetragen worden ist. Parallel zur Erkenntnis, dass der Unterschied zwischen Wildheit und Zivilisation den philosophischen Diskurs der Neuzeit mitbegründet, zeigt die feministische Theorie, dass die Geschlechterdifferenz für die Philosophie bedeutsam ist, von ihr aber weitgehend unberücksichtigt bleibt. Annemarie Pieper weist darauf hin, dass die Vernunft in der Philosophie als geschlechtsneutrale Instanz er-scheint, eigentlich aber auf ein männliches Erkenntnisinteresse zurückgeht: »Während man in der Philosophie davon ausging, daß die vielfältigen For-men der Reflexion auf menschliches Wissen und Handeln geschlechtsneu-tral sind, haben die Wegbereiterinnen der feministischen Philosophie zei-gen können, dass die vorgebliche Neutralität der Vernunft erschlichen ist, insofern sie sich als Konstrukt spezifisch männlicher Erkenntnisinteressen erweist, die unhinterfragt als allgemeinmenschliche ausgegeben werden.«6 Eine feministische Kritik kann sich darum nicht nur auf jene Texte richten, in denen Geschlecht und die Geschlechterverhältnisse explizit thematisiert werden. Sie muss auch, wie Herta Nagl-Docekal schreibt, Lektüreverfahren entwickeln, welche implizite Formen des Androzentrismus in der Philoso-phie ausweisen können. Die »Zielsetzung einer solchen kritischen Relek-türe [liegt] nicht allein in der Auseinandersetzung mit explizit frauenfeind-lichen Theoremen, sondern auch und vor allem darin, androzentrische
�—�—�—�—�—�— 6 Pieper, Aufstand des stillgelegten Geschlechts, S. 7
E I N L E I T U N G 17
Denkmuster kenntlich zu machen, die sich wegen ihres inexpliziten Cha-rakters als besonders folgenreich erwiesen haben«.7
Eine wichtige Herausforderung für die feministische Beschäftigung mit dem Androzentrismus stellt seit den 1990er Jahren die Queer-Theorie dar. So zeigt Judith Butler in Das Unbehagen der Geschlechter, wie die Herstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit mit der Annahme eines heterosexuel-len Begehrens verbunden ist: Die erfolgreiche Negation nicht-heterosexu-eller Begehrensformen wird zur Bedingung dafür, als �›richtige�‹ Frau oder als �›richtiger�‹ Mann erscheinen zu können.8 Die Vorstellung eines solchen �›authentischen�‹ und �›wahren�‹ Geschlechts ist allerdings keine stabile Idee; sie stellt eine gesellschaftliche Norm dar, die nur durch ihre ständige Be-kräftigung am Leben erhalten werden kann. Bei dieser kontinuierlichen Herstellung hegemonialer Geschlechtsidentitäten bleiben andere Begeh-rensformen als Bedrohliches und Verwerfliches im Spiel: »Innerhalb der heterosexuellen Ökonomie schließt daher der Überschuß die Homosexua-lität implizit ein, also jene dauernde Bedrohung durch eine Unterbrechung, die durch eine verstärkte Wiederholung überwunden wird.«9 Eve Kosofsky Sedgwick zeigt in ihren queeren Lektüren literarischer und philosophischer Werke außerdem, dass das Begehren zwischen Männern in diesen Texten nicht nur als Verworfenes erscheint, sondern auch ihre homoerotischen Subtexte bildet.10 In der jüngeren deutschsprachigen feministischen Dis-kussion werden solche queeren Perspektiven vermehrt aufgegriffen und weiterentwickelt. Dies ergibt sich, wie Antke Engel betont, auch aus der Sache selbst, da »zwischen hierarchischer Geschlechterdifferenz und nor-mativer Heterosexualität ein gegenseitiges Konstituierungsverhältnis be-steht«.11 Philosophische Texte feministisch und queer lesen bedeutet damit beides, die Relevanz von Geschlecht und Begehren aufzuzeigen und sie wechselseitig durch einander zu explizieren.
In der Analyse der Bedeutung, welche einerseits das Wilde, Fremde, Nicht-Europäische und andererseits das Weibliche, Androgyne, Homose-xuelle für den Diskurs der Moderne haben, zeigen sich strukturelle Ähn-lichkeiten.12 Sowohl der Wilde als auch die Frau treten in Positionen der �—�—�—�—�—�— 7 Nagl-Docekal, Feministische Philosophie, S. 14. Zur Entwicklung der feministischen Philo-
sophie vgl. auch Klinger, »Zwei Schritte vorwärts, einer zurück«. 8 Vgl. Butler, Das Unbehagen der Geschlechter. 9 Butler, »Imitation und die Aufsässigkeit der Geschlechtsidentität«, S. 161 10 Sedgwick, Epistemology of the Closet, S. 15 11 Engel, Wider die Eindeutigkeit, S. 10 12 Vgl. dazu Weigel, »Die nahe Fremde«; Maihofer, »Dialektik der Aufklärung«.
18 G R E N Z F I G U R E N
Alterität auf. Sie kursieren in einem Diskurs, der die Formation des Sub-jekts organisiert, und repräsentieren jene Differenzen, die es ermöglichen, das Subjekt implizit als männliches und europäisches zu markieren. Figu-ren der Alterität bilden auf diese Weise, wie Homi Bhabha schreibt, Orte des Anderen, durch die sich das Subjekt formiert: »Das Subjekt des Dis-kurses [�…] konstituiert sich durch den Ort des Anderen, was sowohl be-deutet, daß das Objekt der Identifikation ambivalent ist, als auch, und das ist noch bedeutsamer, daß der aktive Vorgang der Identifikation [�…] aus einem Prozeß der Substitution, De-plazierung oder Projektion besteht.«13 Ein solches Spiel der Differenzen zwischen dem Subjekt und den Figuren der Alterität, welche seine Grenzen markieren, ist nicht abschließbar. Vielmehr werden diese Grenzen fortwährend reproduziert, stabilisiert und resignifiziert. Zwischen einer androzentrischen und einer eurozentrischen Logik bestehen damit nicht nur Ähnlichkeiten. Es muss zudem untersucht werden, wo sie sich gegenseitig verstärken und erklären, aufheben und negieren. Denn zwischen den verschiedenen Figuren der Alterität finden kontinuierliche Überblendungen statt: Der Wilde wird feminisiert, die Wilde vermännlicht, die zivilisierte Frau erscheint einmal als verwildert und ein andermal als Repräsentantin der Kultur.14 Wie kann dieses Spiel von Verschiebungen und Ersetzungen zwischen dem Subjekt und den Figuren der Alterität analysiert werden, wenn es sich abseits der Routen ereignet, welche sowohl die Lektüreanweisungen philosophischer Texte als auch die Lesarten ihrer Rezeption vorgeben? Diese Frage steht am Anfang meiner Lektüre von Texten Hegels und Nietzsches.
Hegel und Nietzsche: Zwei Positionen einer ungleichen Moderne
Hegel und Nietzsche gelten als bedeutsame Vertreter der Moderne, deren Schriften gleichsam eine Klammer um das 19. Jahrhundert bilden.15 Hegel, der die Phänomenologie des Geistes während der napoleonischen Kriege ver-fasst, ringt mit der Hoffnung auf ein neues Zeitalter, das sich philoso-phisch in seinem Entwurf eines Systems der Wissenschaft niederschlägt. �—�—�—�—�—�— 13 Bhabha, Die Verortung der Kultur, S. 242 14 Vgl. dazu McClintock, Impertial Leather. 15 Vgl. Löwith, Von Hegel zu Nietzsche.
E I N L E I T U N G 19
Nietzsche hingegen veröffentlicht Zur Genealogie der Moral im wilhelmini-schen Deutschland als Streitschrift, in der er die Errungenschaften der Moderne angreift und radikal in Frage stellt. Obwohl sich beide Texte kritisch gegen die eigene Zeit wenden, lässt sich bei Hegel eine Emphase für die Neuerungen seiner Zeit ausmachen, die bei Nietzsche einer radika-len Kritik weicht. Jürgen Habermas bezeichnet Hegel als den ersten Philo-sophen, »der einen klaren Begriff der Moderne entwickelt hat«.16 Für Habermas initiiert Hegel die kritische Selbstreflexion, welche die Moderne auszeichnet: »Hegel hat den Diskurs der Moderne eröffnet. Er hat das Thema eingeführt �– die selbstkritische Vergewisserung der Moderne; und er hat die Regeln angegeben, nach denen das Thema variiert werden kann �– die Dialektik der Aufklärung.«17 Nietzsche hingegen sei aus dieser Dia-lektik herausgesprungen und habe die außerordentliche Stellung, die sich die Moderne selbst zugesprochen hat, nivelliert.18 Gleichwohl gehört auch diese Haltung der Moderne an �– gerade durch die Radikalisierung des kriti-schen Gestus, welcher die Moderne auszeichnet. Nietzsche markiert damit jene Zäsur, in der die kritische Selbstvergewisserung der Moderne in eine radikale Selbstkritik umschlägt.
Die Entscheidung, Hegel und Nietzsche als Philosophen der Moderne zu bezeichnen, lässt sich aber auch durch den spezifischen gesellschaftli-chen Kontext begründen, in den sie eingebunden sind und der sich gerade durch die Neuordnung der Geschlechterverhältnisse und das Projekt der europäischen Zivilisation auszeichnet. Mit dem bürgerlichen Familienmo-dell werden die Geschlechtersegregation und eine rigide Trennung von Öffentlichem und Privatem eingeführt. Die Unterschiede zwischen Män-nern und Frauen, die, wie Andrea Maihofer festhält, zuvor eher graduell bestimmt waren, werden im Verlaufe des 18. Jahrhunderts in ein dichoto-mes Konzept der Geschlechterdifferenz überführt. »Zentrales Kennzei-chen dieses Geschlechterdiskurses ist, daß nun behauptet wird, es gäbe zwei biologisch qualitativ verschiedene Geschlechtskörper, deren Unter-schiede nicht nur in einzelnen körperlichen Details bestehen, sondern die gesamte körperliche Anatomie und Physiologie [�…] betreffen.«19 Die Ent-�—�—�—�—�—�— 16 Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 13 17 Ebd., S. 65 18 Ebd., S. 108 19 Maihofer, »Dialektik der Aufklärung«, S. 124. Mit dieser Geschlechterordnung wird, wie
Maihofer ausführt, der Körper gänzlich neuen Bezeichnungspraktiken ausgesetzt. »Der hegemoniale bürgerliche Geschlechtskörper (mit seiner Konzeption biologisch distinkter Geschlechter) umfaßt eine sehr komplexe historisch spezifische Verbindung von wis-
20 G R E N Z F I G U R E N
stehung der modernen Geschlechterordnung ist somit eng verknüpft mit der Entwicklung der modernen Wissenschaften. Claudia Honegger spricht von einer �›weiblichen Sonderanthropologie�‹, die im Verlaufe des 19. Jahr-hunderts entsteht: »Die Frau ist ein Wesen für sich, mit einer eigenen Kör-perlichkeit, eigenen Krankheiten, eigenen Sitten, eigener Moral und eige-nen kognitiven Fähigkeiten.«20
Parallel zur Durchsetzung dieser modernen Geschlechterordnung ent-steht das Konzept einer europäischen Zivilisation, das auf der hierarchi-sierten Differenz zu anderen, �›unzivilisierten�‹ Kulturen beruht. Die wichtig-sten Rassentheorien, so schreiben Léon Poliakov, Christian Delacampagne und Patrick Girard, sind »im Schoße einer neuen bürgerlichen Gesellschaft [aufgestellt worden], die, egalitär in der Theorie, anscheinend das Bedürfnis hatte, sich von den �›Wilden�‹ abzusetzen«.21 Diese Absetzungsbewegung von den �›Unzivilisierten�‹ stellt allerdings keinen Nebeneffekt, sondern vielmehr ein konstitutives Moment der bürgerlichen Gesellschaft dar. Andrea Maihofer spricht im Anschluss an Theodor W. Adorno und Max Horkheimer von einer dialektischen Struktur der bürgerlichen Gleichheits-vorstellung, welche »die Gleichheit in Ungleichheit, Anerkennung in Aus-grenzung umschlagen läßt«.22 Diese Kehrseite des bürgerlichen Gleich-heitsverständnisses, die Festschreibung qualitativer Unterschiede, schlägt sich in der Konstitution der Geschlechterverhältnisse und der kulturellen und rassischen Ordnung nieder. Die Entstehung von Rassentheorien ist zudem, wie Valentin Mudimbe festhält, mit dem Projekt des Kolonialismus eng verbunden. Die Machtverhältnisse, welche die Kolonialpolitik herstellt, und diejenigen, die der wissenschaftliche Diskurs über die Wilden und Primitiven festschreibt, durchdringen sich gegenseitig. »The novelty resides in the fact that the discourse on �›savages�‹ is, for the first time, a discourse in which an explicit political power presumes the authority of a scientific knowledge and vice-versa. Colonialism becomes its project and can be thought of as a duplication and a fulfillment of the power of Western dis-
�—�—�—�—�—�— senschaftlichen und alltäglichen Wissensformen, Wahrnehmungs- und Erfahrungswei-sen des Körpers, sowie eine Vielzahl �›weiblicher�‹ und �›männlicher�‹ Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen, Körperformen, Habitus und Sensibilitäten.« (Maihofer, Geschlecht als Existenzweise, S. 92f.) Die moderne Geschlechterordnung zeichnet sich, wie Thomas Laqueur ausführt, insbesondere durch den Wechsel vom Eingeschlechts- zum Zweige-schlechtsmodell aus. Vgl. Laqueur, Auf den Leib geschrieben.
20 Honegger, Die Ordnung der Geschlechter, S. 166 21 Poliakov/Delacampagne/Girard, Rassismus, S. 203f. 22 Maihofer, »Dialektik der Aufklärung«, S. 114
E I N L E I T U N G 21
courses on human varieties.«23 Die Kolonialpolitik beruft sich auf die Au-torität wissenschaftlicher Diskurse, während diese sich auf die Erfahrungen und das �›empirische Material�‹ des Kolonialismus beziehen.
Im Zuge der Formation moderner Wissenschaften werden �›Rasse�‹ und �›Geschlecht�‹ im 19. Jahrhundert somit zu zentralen szientistischen Katego-rien. Die Entstehung moderner Wissenschaften und die Entwicklung von Rassen- und Geschlechtertheorien bedingen sich dabei wechselseitig: Ei-nerseits bringen die Wissenschaften ein spezifisches �›Wissen�‹ von Rasse und Geschlecht hervor, andererseits formieren sie sich durch die Produk-tion, Organisation und Archivierung rassischer, geschlechtlicher und sexu-eller Differenzen. Philipp Sarasin hält fest, dass »seit mindestens der zwei-ten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa und in den USA die �›Degene-rierten�‹ oder �›Entarteten�‹ in einer durchaus unscharfen und daher um so wirkungsvolleren Weise mit den �›niederen Rassen�‹ �– und diese wiederum mit der �›Frau�‹ [�…] in Verbindung gebracht und ähnlichen selektorischen Diskursen und später auch Praxen ausgesetzt werden konnten«.24 Wie lässt sich diese Verknüpfung von �›Frauen�‹, �›niederen Rassen�‹ und �›Entarteten�‹ und wie lassen sich die diskursiven Bedingungen, die diese Verknüpfung ermöglichen, in der Philosophie ausmachen? Wenn es, wie Sarasin schreibt, ein »rassistische[s] Imaginäre[s]«25 gibt, das sich in der Moderne heraus-bildet und sich in ihren Diskurs einschreibt, wie schlägt sich dieses in den philosophischen Texten der Moderne nieder, wie überkreuzt es sich mit dem �›sexistischen Imaginären�‹ (kann das eine ohne das andere gedacht werden?), wie artikuliert es sich in der Philosophie und wie wird es von ihr reformuliert? Wie können Hegels und Nietzsches Schriften als diskursive Momente einer solchen Moderne gelesen werden, die sich durch die bürgerliche Geschlechterordnung, das koloniale Projekt der europäischen
�—�—�—�—�—�— 23 Mudimbe, The Invention of Africa, S. 16. Paul Gilroy weist darauf hin, dass die Entstehung
wissenschaftlicher Rassendiskurse mit dem Übergang vom transatlantischen Sklaven-handel zu moderneren Formen von Imperialismus und Kolonialismus zusammenfällt. »In other words, the modern, human sciences, particularly anthropology, geography, and philosophy, undertook elaborate work in order to make the idea of �›race�‹ epistemologi-cally correct. This required novel ways of understanding embodied alterity, hierarchy, and temporality. It made human bodies communicate the truths of an irrevocable other-ness that were being confirmed by a new science and a new semiotics just as the struggle against Atlantic racial slavery was being won.« (Gilroy, Against Race, S. 58)
24 Sarasin, »Zweierlei Rassismus?«, S. 63 25 Ebd., S. 67
22 G R E N Z F I G U R E N
Zivilisation und die Entstehung der modernen Wissenschaften aus-zeichnet?
Umstrittener Bereich des Menschlichen
Postkoloniale und feministische KritikerInnen haben auf das Paradox hingewiesen, dass zentrale Begriffe wie �›das Subjekt�‹, �›der Mensch�‹ oder �›das Selbst�‹ in der europäischen Philosophie mit einem universalistischen Anspruch auftreten, während sie sich gleichzeitig durch den Ausschluss bestimmter Menschen und Existenzweisen formieren. Butler spricht von einem �›konstitutiven Außen�‹, einem Bereich verworfener Positionen, die es möglich machen, das Subjekt und seine Grenzen zu bestimmen. »Deshalb müssen wir daran erinnern, daß sich die Subjekte durch Ausschließungen konstituieren, d.h. durch die Schaffung eines Gebiets von nichtautorisier-ten Subjekten, gleichsam von Vor-Subjekten, von Gestalten des Verworfe-nen«.26 Ein Subjekt stellt demnach keine klar umgrenzte Figur dar. Es formiert sich vielmehr in der kontinuierlichen Setzung jener Unterschiede, die es von seinem Außen trennt; ein konstitutives Außen also, das in der Theorie gerade nicht als solches ausgewiesen wird. In den Vorstellungen davon, wer als Subjekt gelten kann und wer nicht, wer in der Position des Subjekts erscheint und wer als Quasi-, Prä- und Grenzsubjekt bestimmt wird, verdichten und überkreuzen sich gesellschaftliche Machtansprüche. Die Vorstellung, dass sich der philosophische Diskurs nicht von bestehen-den Machtkonstellationen trennen lässt, dass er diese vielmehr reprodu-ziert, aber auch verschiebt und subvertiert, bringt auch die Unterscheidung zwischen normativen und deskriptiven Ansätzen ins Wanken. Der An-spruch des Beschreibens selbst wird zu einem möglichen Gestus von Herr-schaft. Ein angeblich deskriptiver Text kann durch die Annahme, dass er keine Werte setzt und verteidigt, sondern natürliche oder ontologische Zustände beschreibt, eine hegemoniale Ordnung und ihre Normen stabilisie-ren und legitimieren. Dies gilt gerade für Konzepte des Menschen und des Menschlichen.
Die philosophische Frage, wer ein Subjekt ist und wer und was nicht, eröffnet einen bedeutsamen Schauplatz von Kämpfen um den Bereich des
�—�—�—�—�—�— 26 Butler, »Kontingente Grundlagen«, S. 46
E I N L E I T U N G 23
Menschlichen, auf dem bestehende Machtstrukturen reproduziert und verfestigt, aber auch angegriffen und verschoben werden. So schreibt Paul Gilroy, dass die Frage nach den Grenzen des Menschlichen in der europäi-schen Moderne über die Vorstellung von Rassen und Rassenunterschieden ausgehandelt wird. »[I ]mportant insight can be acquired by systematically returning to the history of struggles over the limits of humanity in which the idea of �›race�‹ has been especially prominent«.27 Und Luce Irigaray legt dar, dass die Frau in der Philosophie als Bedingung eines Subjekts fungiert, das implizit immer ein männliches Subjekt ist. Die Frau erscheint als »Überbleibsel oder Ausfälle eines Spiegels, der vom (männlichen) �›Subjekt�‹ besetzt wird, um sich darin zu reflektieren, sich selbst zu verdoppeln«.28 Das Subjekt bedarf demnach der Reflexion im weiblichen Anderen, das immer nur in dieser, auf die männliche Subjektposition hin bezogenen Alterität erscheinen kann.29 Die Frage ist damit nicht nur, inwiefern das Wilde, Primitive, Fremde, Weibliche, Androgyne oder Homosexuelle einen bestimmten Außenbereich desjenigen markiert, was als Norm gilt. Die Frage ist vielmehr, inwiefern es diese Ausschlüsse erst möglich machen, einen Bereich des Normierten zu erstellen. Edward Said erinnert daran, dass der Aufbau einer europäischen Kultur im Angesicht von Menschen stattfand, die für diese Kultur als ungeeignet galten. »[W]e must remember that for nineteenth-century Europe an imposing edifice of learning and culture was built, so to speak, in the face of actual outsiders (the colonies, the poor, the delinquent), whose role in the culture was to give definition to what they were constitutionally unsuited for«.30 Auf philosophische Sub-jekttheorien übertragen bedeutet dies, dass der Ausschluss bestimmter Figuren zugleich Aufschluss über die Beschaffenheit des hegemonialen Subjekts gibt. Untersucht werden im Folgenden deshalb nicht nur die pre-kären Positionen dieser Grenzfiguren. Gefragt wird nicht nur, wer keinen �—�—�—�—�—�— 27 Gilroy, Against Race, S. 18. Gayatri Chakravorti Spivak weist darauf hin, dass philosophi-
sche Definitionen des Menschlichen im neuzeitlichen Europa von den Achsen des Im-perialismus durchkreuzt werden. »We find here the axiomatics of imperialism as a natu-ral argument to indicate the limits of the cognition of (cultural) man.« (Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, S. 26)
28 Irigaray, »Das Geschlecht, das nicht eins ist«, S. 29 29 Auch Butler weist darauf hin, dass der Bereich des Verworfenen häufig weiblich konno-
tiert wird. Das Subjekt bilde sich »durch Differenzierungsakte, die das Subjekt von sei-nem konstitutiven Außen scheiden, einem Gebiet verworfener Andersheit, das gewöhn-lich, wenn auch nicht immer, mit dem Weiblichen verbunden wird« (Butler, »Kontin-gente Grundlagen«, S. 44).
30 Said, Orientalism, S. 228
24 G R E N Z F I G U R E N
oder nur einen limitierten Zugang zum Bereich des Menschlichen erhält, sondern auch, wie sich das Subjekt �›im Zentrum�‹ durch solche Ausschlüsse konstituiert.
Methodische Anmerkungen: Close Reading und Mimesis
Eine breit angelegte Diskursanalyse würde es möglich machen, spezifische Denkformationen der modernen Wissenschaften, deren Selbstverständnis die Philosophie sowohl übernommen als auch mit hervorgebracht hat, zu untersuchen. Mein Projekt fällt sehr viel bescheidener aus. Anstatt den Blick auf weitflächige Diskursfelder zu lenken, habe ich ihn in einige Text-passagen versenkt. Die Close Readings von Texten Hegels und Nietzsches bewegen sich zwischen Exemplarität und Singularität. Die Ergebnisse dieser Lektüre lassen sich nicht einfach generalisieren; sie können weder von den beiden Autoren noch von deren spezifischen Werken gelöst wer-den. Gleichzeitig aber reihen sie sich in eine Serie von Analysen ein, die das Tableau der Moderne anders zu zeichnen versuchen. Dabei geht es darum, den Blick auf dasjenige zu lenken, was als Fremdes und Randständiges der Moderne erscheint, nicht um dieses erneut als ihren Rest zu bestimmen, sondern um zu fragen, wie es die Konstitution des modernen Subjekts erst ermöglicht hat. Die vorliegende Arbeit ist deshalb nicht ein Versuch, die historischen Dimensionen von Geschlecht, Sexualität, Rasse und Ethnizität für die Philosophie aufzuzeigen. Vielmehr geht es darum, in einer phi-losophischen Analyse freizulegen, wie die Figuren der Alterität die Kon-stitution einer textuellen Ordnung ermöglichen, in deren Zentrum das Subjekt der Moderne erscheinen kann. Dazu aber bedarf es eines spezi-fischen Lektüreverfahrens.
Das Close Reading philosophischer Texte, das ich in der vorliegenden Arbeit vornehme, konzentriert sich auf die Frage, wie geschlechtliche und sexuelle, kulturelle, ethnische und rassische Differenzen innerhalb philoso-phischer Texte operieren, wie sie sowohl die Konstitution des Subjekts als auch seine Kritik ermöglichen und wie sie dadurch selbst produziert und reifiziert werden. Die �›Biegsamkeit�‹ der Begriffe, die in meiner Lektüre zur Anwendung kommen, stellt dabei ein wichtiges strategisches Moment dar. So ist es nicht möglich, nur nach den �›Wilden�‹ oder �›Primitiven�‹ zu fragen oder nur nach einer geographisch und kulturell verorteten Figur des unzi-
E I N L E I T U N G 25
vilisierten Menschen. Zwar nehmen diese Figuren des Fremden ähnliche Funktionen im Text ein; sie zeichnen sich aber auch durch ständige be-griffliche und konzeptuelle Verschiebungen aus, die den Versuch einer am Begriff orientierten Analyse kontinuierlich unterlaufen.
Meine Praxis des Close Readings lehnt sich an Irigarays mimetische Lektüre an; eine Lektüre, die der Argumentation des Textes folgt und seine Be-grifflichkeit aufnimmt.31 Irigaray zeigt, dass die Wiederholung von Argu-menten, die ein Text entwickelt, aber auch die Analyse von �›Szeno-graphien�‹, die er eröffnet, Bedingungen des Textes freilegen können, die sich einer �›klassischen Lektüre�‹ entziehen. Gerade die �›Distanzlosigkeit�‹ dieser Lektüre vermag es, Widersprüche herauszustellen, die dem distan-zierten Blick verborgen bleiben würden. Obwohl die Mimesis nahe am Text bleibt, widersetzt sie sich seinen impliziten Leseanweisungen, setzt mit Fragen an Stellen an, wo sie nicht eingeplant sind, und hält bei Thesen inne, die vorausgesetzt, aber nicht begründet werden. Indem sie von innen heraus versucht, verborgene Grundlagen des Textes aufzuzeigen, hat die mimetische Lektüre eine quasi-transzendentale Stoßrichtung. Sie fragt allerdings nicht nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, welche wiederum einen Anspruch auf Letztgültigkeit erheben, sondern vielmehr nach den wechselnden Bedingungen der Repräsentation und Inszenierung von Wissen und nach den »Bedingungen der Möglichkeit von Systematizität«.32 Dazu gehören das Imaginäre, das ein Text eröffnet, oder die zeitlich-räumlichen Verhältnisse, die er konstituiert. Durch eine solche Herangehensweise wird es möglich, Aspekte der Bedeutungskonstitution herauszuarbeiten, die unter einer anderen Perspektive als peripher gelten oder als bedeutungslos erscheinen. Jacques Derrida exemplifiziert dies etwa an einem Text von Martin Heidegger. Dieser analysiert einen Aphorismus
�—�—�—�—�—�— 31 Für Irigaray ergibt sich die Mimesis aus der Rolle der Frau, die bereits auf die mimeti-
sche Wiederholung, Nachahmung und Verdoppelung der männlichen Subjektposition festgeschrieben wird. Die mimetische Praxis ist also in gewissem Sinne die Mimesis der Mimesis. »Es existiert, zunächst vielleicht, nur ein einziger �›Weg�‹, derjenige, der histo-risch dem Weiblichen zugeschrieben wird: die Mimetik. Es geht darum, diese Rolle frei-willig zu übernehmen. Was schon heißt, eine Subordination umzukehren in Affirmation, und von dieser Tatsache aus zu beginnen, jene zu vereiteln. [�…] Mimesis zu spielen be-deutet also für eine Frau den Versuch, den Ort ihrer Ausbeutung durch den Diskurs wiederzufinden, ohne sich darauf reduzieren zu lassen [�…], um durch einen Effekt spielerischer Wiederholung das �›erscheinen�‹ zu lassen, was verborgen bleiben mußte: die Verschüttung einer möglichen Operation des Weiblichen in der Sprache.« (Irigaray, »Macht des Diskurses«, S. 78)
32 Ebd., S. 76
26 G R E N Z F I G U R E N
von Nietzsche eingehend, ohne der Geschlechterthematik Beachtung zu schenken. »Alle Elemente des Textes werden ohne Ausnahme analysiert, außer dem Weib-Werden der Idee, das also übergangen wird, ein wenig wie man ein sinnliches Bild [une image sensible] in einem philosophischen Werk überspringen würde, auch wie man eine Illustration oder eine allego-rische Darstellung aus einem ernsthaften Buch herausreißen würde.«33 Heideggers Lektüre folgt einer impliziten Trennung zwischen philosophi-scher Bedeutung und rhetorischem Zusatz; einer Trennung, die sie zu-gleich aufruft und reproduziert. Die weiblich kodierten Figuren gelten dabei, wie Derrida ausführt, als Bilder, Allegorien, Beispiele und Anekdo-ten, die vom eigentlichen Gedankengerüst ohne Verlust abgezogen werden können.34
Die Verweigerung einer solchen Trennung stellt einen wichtigen Aus-gangspunkt feministischer und postkolonialer Kritik dar. Die klassische philosophische Unterscheidung zwischen bedeutungsgenerierenden Ele-menten und rhetorischen Zusätzen erscheint aus dieser Perspektive als Strategie, die es möglich macht, geschlechtliche, sexuelle, ethnische, kultu-relle und rassische Differenzen gleichzeitig zu mobilisieren und sie aus dem Bereich des Bedeutsamen zu verweisen. Gayatri Chakravorty Spivak weist darauf hin, dass sich das Auftauchen und Verschwinden solcher Differen-zen gerade an den so genannten Rändern des Texts ereignen. »I am sug-gesting that a revised politics of reading can give sufficient value to the de-ployment of rhetorical energy in the margins of the texts acknowledged to be central.«35 Ein Denken, das die Unterscheidung zwischen rhetorischer Form und philosophischem Inhalt in Frage stellt, kann auch im Anschluss an Hegel und Nietzsche stark gemacht werden. Beide Denker wenden sich gegen die Formalisierung der Philosophie und stehen für die Prozessualität des Denkens ein. Werner Stegmaier hält fest, dass »für beide [�…] die Un-trennbarkeit von Sache und Methode ein Grundsatz ihres Philosophie-rens«36 darstellt. Diese These der Interdependenz von Form und Inhalt, die
�—�—�—�—�—�— 33 Derrida, »Sporen«, S. 146 34 Auf ein offenkundiges �›Überlesen�‹ der kulturellen Differenz weist Spivak hin: Kant stellt
in der »Kritik der Urteilskraft« die Notwendigkeit der menschlichen Existenz durch das Beispiel des Feuerländers und des Neuholländers in Frage. Gayatri Chakravorty Spivak hält fest: »Und das eigenartige ist, daß dies vom Großteil der Kantforschung, die über diesen Moment schreibt, nicht einmal bemerkt wird.« (Spivak, »Achtung: Postkolonia-lismus!«, S. 126)
35 Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, S. 13 36 Stegmaier, »Hegel, Nietzsche und Heraklit«, S. 110
E I N L E I T U N G 27
Hegel vertritt und praktiziert, wird in Nietzsches Attacken gegen die Tren-nung von Rhetorik und Philosophie radikalisiert. Seine Formulierung von der Wahrheit als einem beweglichen Heer von Metaphern, Metonymien und Anthropomorphismen, deren rhetorische Herkunft vergessen ging, liest sich wie eine Kurzformel für diesen anderen Blick auf die Bedeu-tungsproduktion.37 Nietzsche geht, wie Linda Simonis ausführt, von der Untrennbarkeit von philosophischem Inhalt und rhetorischer Form aus: »Es gibt, mit anderen Worten, für Nietzsche keine sprachunabhängige Be-deutung oder Wahrheit, letztere wird vielmehr durch die sprachlich-stilis-tischen Figuren der Rede hervorgebracht und konstituiert. Entsprechend stellen auch die sinnlichen und performativen Ausdrucksformen der Rhe-torik keine Zutat dar, von der man abstrahieren könnte, sondern sie sind identisch mit der Sprache bzw. dem in ihr konstituierten Gehalt.«38 Wenn der philosophische Inhalt von seiner Darstellung nicht getrennt werden kann und in den Werken von Hegel und Nietzsche die Figur der Frau, des Weiblichen und Homosexuellen, des Fremden, Nicht-Europäischen und Wilden erscheinen, dann stellt sich die Frage, welche Bedeutung solchen Figuren für die Konstitution dieser Texte zukommt.
Grenzfiguren der Moderne
Im Kontext solcher Überlegungen ist der Begriff der Grenzfigur zu einem wichtigen Vehikel meiner Lektüre geworden. Er stellt kein scharf abge-grenztes Konzept, sondern vielmehr einen strategischen Term dar, der es mir ermöglicht, die Frage nach der Funktion von Geschlecht und Kultur in den Texten Hegels und Nietzsches zu untersuchen. Die Grenzfigur mar-kiert eine Position an den Rändern desjenigen, was als Subjekt bestimmt wird, eine Position also, welche nicht mit dem Subjekt zusammenfällt, aber dennoch auf eine bedeutsame Weise mit ihm verbunden ist. Die Figuren des Wilden und Weiblichen, die in den Texten Hegels und Nietzsches erscheinen, werden deshalb nicht als Tropen untersucht, welche eine origi-nale Bedeutung verschieben oder übertragen. Von ihnen lässt sich sagen, was Derrida über das Weibliche in Nietzsches Texten festhält, dass näm-lich ihre »Notwendigkeit [�…] zweifellos weder die einer metaphorischen �—�—�—�—�—�— 37 Vgl. Nietzsche, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, S. 880f. 38 Simonis, »Der Stil als Verführer«, S. 66
28 G R E N Z F I G U R E N
oder allegorischen Illustration ohne Begriff, noch die eines reinen Begriffs ohne Schema der Phantasie [schème fantastique]«39 ist. Die Bedeutung der Grenzfiguren erschöpft sich weder darin, reiner Begriff, noch darin, meta-phorische Ersetzung zu sein. Sie sind keine vernachlässigbaren Aus-schmückungen, bilden aber auch nicht eine neue fundamentale Kategorie, deren Funktion unabhängig vom textuellen Geschehen, in dem sie erschei-nen, festgelegt werden kann. Diese wird vielmehr in einer Lektüre er-schlossen, die nach der Bedeutung dieser Figuren für die Konstitution der textuellen Ordnung fragt. Eine solche Untersuchung bringt keine eindeuti-gen Ergebnisse hervor; sie ist mit der Mehrdeutigkeit dieser Figuren kon-frontiert und mit den wechselnden Positionen, die sie im Text einnehmen. Dabei ist es bedeutsam, dass die Grenze selbst polyvalent ist: Sie kann als Innen und als Außen gedacht werden und sowohl räumliche als auch zeitli-che Trennungen markieren. Die Grenze repräsentiert das �›Noch-nicht�‹, das �›Immer-noch�‹, das �›Nicht mehr�‹, das �›Beinahe�‹ und das �›Quasi�‹. Der Bezug zwischen dem Subjekt und den Grenzfiguren oszilliert darum zwischen Bewegungen der Identifikation und der Desidentifikation, zwischen Pro-ximität und Verwerfung. Meine Lektüre folgt den Orten, an denen Grenz-figuren erscheinen, zeichnet auf, wie sie ineinander übersetzt, aufeinander bezogen und auf das Bedeutungszentrum ausgerichtet werden.
Dabei rückt auch die Performativität des Textes in den Blick. Gefragt wird, wie die Grenzen zwischen dem Subjekt und seinem Außen, zwischen dem Selbst und den Anderen in diesen Texten performativ erzeugt, und das heißt: wiederholt, verschoben, bekräftigt und aufgelöst werden. Von Bedeutung ist auch, wie Sedgwick schreibt, »to attend to performative aspects of texts, and to what are often blandly called their �›reader relations�‹, as sites of definitional creation, violence, and rupture in relation to par-ticular readers, particular institutional circumstances«.40 Untersucht wird, welche Adressierungen dem Text eingeschrieben sind, wie er sich an die Lesenden richtet, wer angesprochen wird und wer dabei ausgeschlossen bleibt. Meine Lektüre zeichnet einige dieser Bewegungen nach und fragt nach ihrer Bedeutung für die Möglichkeit, das moderne Subjekt zu denken und es als ein Subjekt zu denken, das kontinuierlich die Markierungen europäischer Männlichkeit erhält. Die Beschäftigung mit der Perfor-mativität von Grenzen, die den Bereich des Subjekts und des Mensch-
�—�—�—�—�—�— 39 Derrida, »Sporen«, S. 146f. 40 Sedgwick, Epistemology of the Closet, S. 3
E I N L E I T U N G 29
lichen umfassen, verweist somit unweigerlich und beständig ins Feld des Politischen.41
Aus Lektüren, die sich solchen Grenzen entlang bewegen, entstand der folgende Text. Er stellt dabei kontinuierlich die Fragen, die ihn zugleich antreiben und hervorbringen: Inwiefern beruht Hegels Konzeptualisierung des Subjekts, inwiefern Nietzsches Kritik des Subjekts auf geschlechtlich und kulturell kodierten Figuren der Alterität? Wie und auf welche Weise gehen die Figur der (europäischen) Frau und des (männlichen) Wilden ineinander über, wo markieren sie unterschiedliche Differenzen, wie er-möglichen sie es, den Bereich desjenigen zu umgrenzen, was als �›Subjekt�‹ erscheint? Zirkulieren in diesen Texten auch Figuren der weiblichen Wil-den und der nicht-europäischen Frau oder stellen diese eine diskursive Leerstelle dar? Kann das Subjekt, wenn es sich in der Differenz zur Frau und zu den Wilden konstituiert, als impliziter Entwurf einer europäischen, bürgerlichen Männlichkeit gelesen werden? Wie und wo taucht dasjenige, was mit dem Wilden oder dem Weiblichen ausgeschlossen wird, im Inne-ren des Subjekts wieder auf, wo erweisen sich seine Grenzen somit als widersprüchlich, instabil und porös?
�—�—�—�—�—�— 41 An den Grenzen manifestiert sich, wie Nikita Dhawan und María do Mar Castro Varela
schreiben, die Politik der Repräsentation: »Grenzziehungsprozesse und Subjektivie-rungsdynamiken werden zum Politikum. [�…] Die Grenze selbst wird zum Zentrum des Forschungsinteresses.« (Castro Varela/Dhawan, »Postkolonialer Feminismus und die Kunst der Selbstkritik«, S. 276)
1. Der Anfang des Subjekts und die Grenze der Geschichtlichkeit
»Da ich soeben von einem dergleichen Traum aufwache, so läßt er in mir nichts anders recht zum Worte kommen; ich muß ihn daher wohl erzählen, um seiner
loszuwerden. Es schien mir ganz lebhaft, daß ich in großer Gesellschaft einer Dissertation beiwohnte, die 2 Physiologen [�…] über den Vorzug der Affen oder
der Schweine gegeneinander hielten. Der eine bekannte sich als Anhänger des Philanthropismus [�…] und machte den bekannten physiologischen Satz geltend,
daß die Schweine von allen Tieren den Verdauungsorganen und übrigen Eingewei-den nach am meisten Aehnlichkeit mit den Menschen haben. Der andere gab sich für einen Freund des Humanismus aus, setzte jene Aehnlichkeit nach den Verdau-
ungswerkzeugen herab, dagegen die Affen wegen ihrer Possierlichkeit, humanem Aussehen, Manieren, Nachahmungsfähigkeit u.s.f. hinauf.«
Hegel an Immanuel Niethammer, 6. Januar 1814
Hegels Philosophie gründet auf der Annahme, dass sich der Geist in der Zeit entfalte und damit einerseits die Weltgeschichte und andererseits Ge-stalten der Subjektformation hervorbringt. Diese gehen sukzessive ausein-ander hervor, indem sie ihre Vorformen gleichzeitig überwinden und be-wahren. Hegels Texte lassen sich demnach als Versuch lesen, mit dem An-spruch auf Systematizität umzugehen, den sie sich selbst aufgeben. Ohne davon auszugehen, dass dieser eingelöst wird �– vielmehr könnte untersucht werden, wie sich die Grundannahme der teleologischen Entwicklung des Geistes in Hegels Texten kontinuierlich in der Krise befindet �– soll in die-sem Kapitel nach den Grenzfiguren gefragt werden, die in Hegels Darstel-lung der Subjektformation am Werk sind.42 Grundlegende Texte für diese Lektüren sind Hegels Phänomenologie des Geistes und die Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.43 Der Blick richtet sich dabei auf Gestalten, die in
�—�—�—�—�—�— 42 Die Annahme, dass Hegel ein System entwerfen wollte, wurde in jüngerer Zeit vermehrt
in Frage gestellt. Vgl. etwa Nancy, Hegel: L�’inquiétude du Négatif, oder das Vorwort zur Neuauflage (1999) von Butler, Subjects of Desire.
43 Für die Lektüre der Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte �– im Folgenden kurz Geschichtsvorlesungen genannt �– greife ich auf die Werkausgabe von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel (Frankfurt a. M. 1970) zurück. Zur editorischen Problematik der Geschichtsvorlesungen bemerkt Heinz Kimmerle, dass, auch wenn sich ihr Wortlaut nicht rekonstruieren lässt, sie doch sehr wahrscheinlich Hegels Vorstellungen von Afrika wie-dergeben. »Daß Hegels Afrika-Bild von solchen [editorischen] Veränderungen betroffen ist, halte ich jedoch für unwahrscheinlich: es scheinen feste Topoi, nahezu stereotypi-
34 G R E N Z F I G U R E N
Hegels System auftauchen, ohne einen systematischen Ort darin zu er-halten, die erscheinen, ohne je zum Protagonisten oder zur Protagonistin des sich entwickelnden �›Geistes�‹ zu werden, und verschwinden, ohne darin �›aufgehoben�‹ zu sein. Es sind Figuren, welche an der Peripherie des Geistes auftauchen, ohne in sein Werden einzugehen, und die man mit Derrida als �›Reste�‹ der Dialektik bezeichnen könnte.44
Eine bedeutsame Figur dieser Lektüre ist der �›Afrikaner�‹ und das �›afrikanische Bewusstsein�‹. Afrika erscheint in Hegels Geschichtsvorlesungen als geschichtsloser Kontinent; eine Position, die zugleich das Außen und die Grenze der Geschichte markiert und damit die Geschichte denkbar macht.45 �›Afrika�‹, so werde ich argumentieren, ist auch in der Phänomenologie am Werk, jenem Text also, der sich nicht den �›empirischen�‹ Manifestatio-nen des Geistes widmet, sondern seinen von der Kontingenz ihrer Er-scheinungen abgelösten Gestalten. Für die Ausführungen der Phänomenolo-gie nämlich ist das Konzept des �›natürlichen Bewusstseins�‹ von großer Bedeutung. Im Versuch, die systematische Entwicklung des Geistes dar-zulegen, stellt die Figur des �›natürlichen Bewusstseins�‹ den Anfang des Geistes und sein Hervorgehen aus der Natur dar. Es erscheint damit an derselben Stelle des Übergangs wie das �›afrikanische Bewusstsein�‹ der Ge-schichtsvorlesungen. Indem diese unterschiedlichen Figuren des Anfangs in einer �›verschränkten Lektüre�‹ miteinander in Bezug gesetzt werden, zeigen sich implizite Verbindungen zwischen dem �›natürlichen Bewusstsein�‹ und den Vorstellungen des kulturell Anderen. Der Anfang des europäischen Subjekts und die zeitliche Differenz, die sich zwischen ihm und der Ge-genwart auftut, werden denkbar gemacht durch die anthropologischen, kulturellen und geographischen Unterschiede, welche diese Figuren der Alterität eröffnen. Diese Zusammenhänge enststehen in komplexen und nicht selten paradoxen textuellen Differenzierungsprozessen, die in der vorliegenden Lektüre nachgezeichnet werden: Prozesse, in denen die Grenzen zwischen Geschichte und Geschichtslosigkeit, Geist und Natur, Mensch und Tier beständig umgeschrieben werden. Indem sie die konsti-tutiven Grenzen dessen denkbar machen, was als Menschliches erscheint, erweisen sich die Figuren der Alterität dabei stets von neuem als Bedin-
�—�—�—�—�—�— sche Vorstellungen zu sein, auf die sich Hegel in diesem Zusammenhang beruft.« (Kimmerle, Die Dimension des Interkulturellen, S. 91)
44 Vgl. Derrida, Glas, S. 2f. des Beiblattes zum Buch. 45 Für eine afrozentrische Kritik an Hegels Konzept von Afrika siehe Kuydendall, »Hegel
and Africa«.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 35
gung der Möglichkeit, das Subjekt zu denken �– und es implizit als europäi-sches Subjekt zu denken.
Das Subjekt und die Figur der Rückwendung
Der Geist, so schreibt Hegel in der Vorrede der Phänomenologie, ist »nie Ruhe, sondern in immer fortschreitender Bewegung begriffen«.46 Zwei Aspekte werden dem Geist, und damit dem menschlichen Subjekt als indi-viduelle Gestalt des Geistes, zugeschrieben: Er ist bewegt und er schreitet fort. Was für eine Bewegung aber stellt dieses Werden dar und wie ereignet sich ihr Fortschreiten? Hegel beschreibt sie als »nichts anderes als die sich bewegende Sichselbstgleichheit, oder sie ist die Reflexion in sich selbst«.47 Gleichzeitig aber muss diese Bewegung durch ein Anderes vermittelt sein: Das Subjekt formiert sich in einer Bewegung, die es ständig aus sich her-austreibt und über das Andere wieder zu sich selbst führt. Aus dieser Be-wegung der Rückwendung geht das Subjekt kontinuierlich als neues her-vor. Beide Elemente, die Bewegung und das Fortschreiten, ereignen sich durch die Reflexion des Selbst im Anderen. Das Subjekt erscheint als die »sich wiederherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Andersseyn in sich selbst«.48 Diese Grundbewegung des Subjekts kann als Denken beschrie-ben werden; als Denken, welches von einem Begehren, sich und das An-dere zu denken oder sich durch das Andere zu denken, angetrieben wird. Das Subjekt entsteht dadurch, dass es seine Gewissheiten beständig aufs Spiel setzen, sich von ihnen entfremden und durch ein Anderes wieder aneignen muss. Es entwickelt sich in der Spannung zwischen der Notwen-digkeit, Gewissheit über sich selbst zu erhalten, und derjenigen, sie wieder aufzugeben. Das Subjekt stellt damit nicht ein Wesen dar, dessen Reflexi-vität von außen initiiert wird, sondern es bringt sich selbst kontinuierlich durch die Bewegung der Reflexion hervor. Was als das Sein des Subjekts erscheint, erweist sich immer von neuem als Beginn eines Werdens, in dem das Subjekt das, was ihm gewiss ist, hinter sich lassen muss, um ein Ande-res und dadurch erneut es selbst zu werden. Das Subjekt ist »sich selbst
�—�—�—�—�—�— 46 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 14 47 Ebd., S. 19 48 Ebd., S. 18
36 G R E N Z F I G U R E N
Werden«.49 In diesem Sinne gibt es kein essentielles, sondern nur ein pro-zessuales Subjekt, das sich immer im Begriff seiner Formation befindet.
Wenn das Subjekt ein Werden beschreibt, welches sowohl durch die Bewegung als auch durch sein Fortschreiten bestimmt ist, dann zeichnen sich zwei Grenzen dieses Werdens ab: einerseits durch den Stillstand und ande-rerseits durch eine Bewegung ohne Fortschritt, das heißt durch eine Bewe-gung, der die Vermittlung durch das Andere fehlt. Ein Subjekt, welches in seinem Sein verharrt und die Negation nicht auf sich nimmt, befindet sich außerhalb der Bewegung des Denkens und es stellt, mehr noch, seinen Status als Subjekt in Frage. Auch ein Subjekt, das ständig um sich kreist, ohne durch ein Anderes vermittelt zu sein, befindet sich in einer solchen Immanenz. Als »Kreis, der in sich geschlossen ruht, und als Substanz seine Momente hält«,50 ist es vom Werden ausgenommen. Mit der Bestimmung des Subjekts als fortschreitende Bewegung kommen damit Figuren ins Spiel, welche dieses Werden nicht oder nicht gänzlich vollziehen. Ihr Status als Subjekt ist fragwürdig, weil sie außerhalb der fortschreitenden Bewe-gung stehen, die Hegel voraussetzt. Sie unterscheiden sich von den Ge-stalten des Geistes, die im Zuge seiner Entwicklung überschritten und aufgehoben werden. Von diesen Formen des Geistes heißt es in der Phä-nomenologie, dass sich im allgemeinen Individuum »jedes Moment [zeigt], wie es die concrete Form und eigne Gestaltung gewinnt«,51 während sie im besonderen Individuum in »verwischten Zügen«52 erhalten sind.
Die Entwicklung des Geistes beschreibt damit eine Bewegung der Auf-hebung, die alle Formen des Geistes, die vergangenen und zukünftigen, in sich schließt: In jeder aktualisierten Gestalt des Geistes sind sie als Spur, in der allgemeinen Form des Geistes in seiner Gesamtheit vorhanden. Wo aber befinden sich jene Figuren, welche nicht in diese Bewegung der Refle-xion eintreten und nicht in ihr aufgehoben sind? Wie verschiebt sich der für die Phänomenologie zentrale Begriff der Grenze, wenn sich der Blick nicht auf das Andere des Subjekts richtet, das stets wieder zum Eigenen wird, sondern auf jene Figuren der Alterität, die an den Rändern der Subjekt-formation erscheinen und nicht die fortschreitende Bewegung des Denkens, sondern vielmehr seine Stagnation markieren? Während Hegel Möglichkei-ten an die Hand gibt, die konstitutive Bedeutung der Differenz für das
�—�—�—�—�—�— 49 Ebd., S. 19 50 Ebd., S. 27 51 Ebd., S. 24 52 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 37
Subjekt zu denken, bleibt die Frage nach der Differenz, welche die dialekti-sche Differenz konstituiert, offen. Die dialektische Bewegung überwindet und erhält das negierte Andere, indem es dieses aufhebt. Was aber ist die Bedingung der Möglichkeit der Aufhebung und was bleibt dabei zurück? Gibt es einen Unterschied zwischen den Anderen, welche aufgehoben wer-den, und den anderen Anderen, die außerhalb der Dialektik verbleiben? Wer sind jene Anderen, denen die Aufhebung versagt bleibt und denen es ver-sagt ist, in die Bewegung des Werdens einzutreten? Welche Grenze und welches Außen konstituieren sie?
In der Vorrede der Phänomenologie unterscheidet Hegel die Bewegung der Reflexion von der Immanenz eines Zustandes, der in den Gefühlen stehen bleibt und nicht auf Andere hin überschritten wird. Ein Wesen, das sich der Vernunft verschließt und sich stattdessen auf den gemeinen Men-schenverstand bezieht, kann, weil dies den Gebrauch der Vernunft voraus-setzen würde, seine Erfahrungen nicht an Andere vermitteln. Es ist damit »gegen den, der nicht übereinstimmt, fertig; er muß erklären, daß er dem weiter nichts zu sagen habe, der nicht dasselbe in sich finde und fühle; �– mit andern Worten, er tritt die Wurzel der Humanität mit Füssen«.53 Die Natur der Humanität sei es nämlich, »auf die Uebereinkunft mit andern zu dringen [�…]. Das widermenschliche, das thierische besteht darin, im Ge-fühle stehen zu bleiben und nur durch dieses sich mittheilen zu können«.54 An dieser Stelle erscheint die �›Natur�‹ des Menschlichen als grundsätzlich vom Tier unterschieden; sie ist als Überwindung des Tierischen definiert. Beide, der Mensch und das Tier, teilen die Immanenz der Gefühle. Was den Menschen aber als Menschen auszeichnet, ist sein Vermögen der Transzendenz, durch das er die Geschlossenheit seiner Gefühlswelt auf-bricht, seine Erfahrungen vermittels der Vernunft Anderen mitteilt und mit ihnen um ein gemeinsames Verständnis ringt. Erst dadurch entsteht die Humanität, denn »ihre Existenz [liegt] nur in der zu Stande gebrachten Gemeinsamkeit des Bewußtseyn«.55 Derjenige aber, der sich nur auf seine Gefühle und den gemeinen Menschenverstand beruft, stellt ein eigenartiges �›Quasi-Subjekt�‹ dar, welches die Bedingungen der Subjektformation nicht erfüllt und dennoch als mögliches Subjekt erscheint. Es tritt in der Nähe des Tieres auf, ohne Tier zu sein, weil es im Gegensatz zu diesem, über die Möglichkeit der Vernunft verfügt. Indem es in die Nähe des �›Widermensch-
�—�—�—�—�—�— 53 Ebd., S. 47 54 Ebd., S. 48 55 Ebd.
38 G R E N Z F I G U R E N
lichen�‹ und Tierischen rückt, markiert es nicht eine notwendige Vorform des Subjekts, das in der Bewegung der Reflexion erst negiert und dann aufgehoben worden ist, sondern eine Art �›Stillstand�‹. Es stagniert, dreht sich um sich selbst und erreicht das Andere nicht. Expliziert wird es nicht als Teil der dialektischen Bewegung, sondern durch andere Figuren der Alterität, denjenigen des �›Widermenschlichen�‹ und �›Tierischen�‹. Sie alle zeigen, ohne dass sie ganz ineinander übersetzbar wären �– denn der Mensch, der sich der Vernunft verweigert, entspricht nicht dem Tier, dem die Vernunft verwehrt bleibt �– Momente des Stillstands und des Leerlaufs der Reflexion an. Die Frage, die meine Lektüre im Folgenden beschäftigt, betrifft das Verhältnis zwischen den Anderen, zu denen das Subjekt im Verlaufe seiner Formation beständig wird, und jenen Anderen, die am Rande dieser Bewegung, gleichsam als deren �›dialektische Resten�‹ erschei-nen. Hat ein Quasi-Subjekt, das im Gefühl stehen bleibt, in Hegels Logik von Grenzziehung und Grenzaufhebung einen Ort? Tritt es als Störung der dialektischen Bewegung auf? Oder macht es diese Bewegung erst mög-lich, auf eine Weise, über die uns die Dialektik keine Rechenschaft gibt?
Der Anfang des Subjekts
Wenn das Subjekt das Werden in der Reflexion ist, dann stellt der Anfang ein Problem dar. Wo nimmt die Bewegung des Subjekts ihren Anfang? Wo beginnt der Geist sich selbst zu erkennen und damit in die Reflexion ein-zutreten, welche seine spezifische Weise des Seins und Erkennens aus-macht? Wo wird der Anfang jenes Werdens lokalisiert, das sich für alle Bereiche des Menschlichen als grundlegend erweist: für die Erkenntnis, den Staat, die Gesellschaft, die Religion und für die Formation des Sub-jekts? Das Problem, diesen Anfang zu denken, besteht darin, dass das Bewusstsein vor der Reflexion nicht als werdendes Subjekt gedacht werden kann, da sich das Subjekt gerade durch dieses Werden auszeichnet. Eine solche Figur bezeichnet vielmehr das �›noch nicht�‹ Werdende und damit ein Bewusstsein, das sich außerhalb der Reflexionsbewegung befindet. Es ist die statische Darstellung des Geistes als Bewegung vor der Bewegung oder als Bewegung, die noch keine Vermittlung erfährt. Diese Figur des An-fangs, welche gleichzeitig die Figuration einer Grenze (und ihrer Übertret-barkeit) darstellt, taucht in der Phänomenologie in verschiedenen Gestalten
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 39
auf. Sie wird als �›sinnliches Bewusstsein�‹ bezeichnet, als �›natürliches Be-wusstsein�‹ oder auch als �›unmittelbarer Geist�‹. Diese Gestalten erscheinen als eine Form des Subjekts, welches erst im Begriffe steht, die Bewegung der Reflexion zu vollziehen. Sie stehen für ein Prä-Subjekt, das nicht Sub-jekt ist, aber Subjekt werden kann. »Das Wissen, wie es zuerst ist, oder der unmittelbare Geist ist das geistlose, oder ist das sinnliche Bewußtseyn. Um zum eigentlichen Wissen zu werden [�…] hat er durch einen langen Weg sich hindurch zu arbeiten.«56 Der Beginn des Wissens erscheint in dieser Be-schreibung als eine paradoxe Figur. Er ist �›unmittelbarer Geist�‹ und zu-gleich �›geistloses Bewusstsein�‹ und stellt einerseits eine frühe Form des Geistes dar und andererseits ein Bewusstsein, das (noch) ohne Geist ist. Dieses Paradox scheint unumgänglich. Wenn das Subjekt als Werden ge-dacht wird, dann erscheint es im Moment vor dem Eintritt in dieses Wer-den zugleich als werdendes Werden und als Nicht-Werden und ist damit durch das charakterisiert und dessen beraubt, was es als Subjekt ausmacht. Dieses frühe Subjekt oder �›Prä-Subjekt�‹ ist Geist, dem das, was den Geist als Geist ausmacht, die Bewegung der Reflexion, (noch) abgeht. Dies lässt die Schwierigkeiten erahnen, welche eine solche Figur dem Denken auf-gibt. Das, was diese Figur zum Geist macht, ist ihre Möglichkeit, �›eigentli-ches Wissen�‹ und damit Geist zu werden. Was sie aber �›geistlos�‹ macht, ist ihr Zustand der Umittelbarkeit, in der das Denken seinen Anfang noch nicht genommen hat.
Das natürliche Bewusstsein erscheint damit als Überlagerung zweier Zeitlichkeiten, welche beide seine Bestimmung ausmachen. Als aktuelles Bewusstsein ist es unbewegt, unreflektiert und damit geistlos �– oder gänz-lich unreflektierter Geist. Es unterscheidet sich von der Natur nur durch das Potential der Reflexion. In seinem Verhältnis zur Zukunft ist es Geist und damit von der Natur unterschieden. Was das natürliche Bewusstsein zum Subjekt macht, ist die Prämisse, dass es in die Bewegung des Denkens eintreten kann. Damit nimmt es eine andere Position zum Menschlichen ein als das Tier. In den Geschichtsvorlesungen erscheint das Tier, wie in der Vorrede der Phänomenologie, ebenfalls in seiner Differenz zum Menschen. »Denn der Mensch ist denkend; dadurch unterscheidet er sich vom Tier.«57 Das Tier beginnt, wo der Mensch aufhört, und es ist das, was jener nicht
�—�—�—�—�—�— 56 Ebd., S. 24 57 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 557. Dieser Satz stammt nicht aus
Vorlesungsnotizen von Hegels Hörern, sondern aus dem Anfang seines zweiten Ent-wurfs der Einleitung zur philosophischen Weltgeschichte von 1830.
40 G R E N Z F I G U R E N
(mehr) ist. Der Mensch aber ist nicht unabhängig von dieser Grenze; er wird vielmehr durch diese Grenze bestimmt. Wenn der Mensch das den-kende Wesen im Unterschied zum Tier ist und dieses Denken einen An-fang nimmt, der außerhalb des Denkens liegt, dann muss dieser Anfang an der Grenze zwischen Tier und Mensch angesiedelt werden, und zwar auf eine Weise, in der er sowohl vom Tier als auch vom Menschen unterschie-den ist.58 Diese Differenz kann im Verhältnis zur Reflexion gefasst werden, welche für das Tier verschlossen bleibt, während sie dem natürlichen Be-wusstsein nur in der Gegenwart versagt ist, in der Zukunft aber offensteht. Im Gegensatz zum Tier also, welches nicht denkt, ist das natürliche Be-wusstsein das noch nicht Denkende. Damit wird ein Quasi-Subjekt, das nie-mals Subjekt werden kann, von einem Prä-Subjekt unterschieden, dem die Möglichkeit des Menschlichen eingeschrieben ist. Das Tier manifestiert die Grenze zum denkenden Menschen, während das natürliche Bewusstsein diese Grenze in ihrer Überschreitbarkeit markiert. Tier und natürliches Bewusstsein befinden sich nicht in einem Verhältnis von Identität, sondern von Proximität. Das natürliche Bewusstsein stellt das Subjekt in der Nähe zum Tier dar, ohne mit ihm in eins zu fallen. Diese Nähe entsteht einzig dadurch, dass das Bewusstsein seine Differenz zur Natur noch nicht be-greifen und als Differenz setzen kann. Es erscheint im Unterschied zum Tier nicht nur als Markierung der Grenze zwischen Natur und Geist, son-dern zugleich als möglicher Beginn einer Bewegung, in der es zum Subjekt werden wird. Es ist das �›Nicht�‹ und das �›Noch nicht�‹ des Subjekts und damit sowohl eine Repräsentation der Grenze zwischen Natur und Geist als auch das Zeichen ihrer möglichen Überschreitung. Bedeutet dies, dass das natürliche Bewusstsein in der Dialektik des Geistes aufgehoben wird, während das Tier als Rest dieser Dialektik zurückbleibt, als dasjenige, wel-ches als Grenze des Denkens erscheint, ohne je Denken werden zu kön-nen? Wie aber müssen wir uns das natürliche Bewusstsein denken, wenn es die gelungene Aufhebung des Anfangs darstellt? Wie überschreitet es sei-nen Status als �›natürliches Bewusstsein�‹, wie lässt es die �›Natürlichkeit�‹ zurück und wie wird es zum Bewusstsein der Reflexion?
�—�—�—�—�—�— 58 Die Differenz zum Tier wird auch im ersten Kapitel der Phänomenologie aufgemacht. Den
Tieren ist die einfachste Form der Einsicht, die sinnliche Gewissheit, zwar zugänglich, sie können aber nicht über sie hinausgehen (Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 69). Das Moment aber, das über die sinnliche Gewissheit hinausführt, ist die Sprache (ebd., S. 70).
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 41
In der Vorrede der Phänomenologie wird der Eintritt des Bewusstseins in die Bewegung der Reflexion inszeniert. Sie findet als Begegnung zwischen dem natürlichen Bewusstsein und der Wissenschaft statt, in der beide mit-einander ringen, denn »[j]eder von diesen beyden Teilen scheint für den andern das Verkehrte der Wahrheit zu sein«.59 Das natürliche Bewusstsein wird als einfacher, unvermittelter Gegensatz von Gegenstand und Selbst beschrieben, und damit als Bewusstsein, welches bereits die Dualität einer ersten Negation aufweist, ohne diese erkennen und damit negieren zu können. Der »Standpunkt des Bewußtseyns [ist] von gegenständlichen Dingen im Gegensatze gegen sich selbst, und von sich selbst im Gegen-satze gegen sie zu wißen«.60 Das natürliche Bewusstsein befindet sich damit im unbewegten Unterschied von Selbst und Gegenstand. Es stellt die ein-gefrorene Bewegung der Negation dar oder die Negation vor der Bewegung der Aufhebung. Indem es bereits als Negation erscheint, hat es einen ers-ten Schritt der Reflexion vollzogen, ohne jedoch den Zirkel der Rückwen-dung vollführt zu haben.61 Die Wissenschaft fordert von diesem Bewusst-sein die Ablösung aus seiner unmittelbaren Gewissheit, um die Bewegung des »reine[n] Selbsterkennen[s] im absoluten Andersseyn«62 zu werden. Die unbewegte Gespaltenheit des natürlichen Bewusstseins erscheint der Wis-senschaft als »Verlust des Geistes«63, in dessen �›Aether�‹ das natürliche Be-wusstsein erst erhoben werden muss. Dem natürlichen Bewusstsein aber ist das »Element der Wissenschaft eine jenseitige Ferne, worin es nicht
�—�—�—�—�—�— 59 Ebd., S. 23. Diese Szene kann als Überblendung verschiedener Inaugurationsmomente
gelesen werden. Einerseits geht es dabei um den Übergang des natürlichen Bewusstseins in die Bewegung der Reflexion und damit um die Initiation des Subjekts. Andererseits wird mit dem Begriff der Wissenschaft die historisch spezifische Konstellation des Geis-tes in Hegels Zeit beschrieben. Die Wissenschaft ist dasjenige, was »erst beginnt« (ebd., S. 16) und zugleich die komplexeste Form des werdenden Geistes darstellt: Sie ist die Meta-Reflexion auf die notwendige Entwicklung des Wissens.
60 Ebd., S. 23 61 Hegel unternimmt in der Enzyklopädie einen Versuch, den ungewissen Status dieser
Vorformen des Geistes zu klären, indem er den Begriff der �›Seele�‹ einführt. Diese ist der Geist an sich im Gegensatz zum Geist für sich oder zum vermittelten Geist, der Be-wusstsein ist. Die Seele stellt einen Zustand des Erwachens dar und ist zugleich durch die Potentialität der Reflexionsstufen definiert, als deren Beginn sie erscheint. (Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, S. 386f.) Die Seele ist also der eigenartige Zustand des Geistes, dem noch all das fehlt, was ihn ausmachen wird, nämlich das Ver-mögen, sich durch die Reflexion aus sich selbst hervorzubringen.
62 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 22 63 Ebd., S. 23
42 G R E N Z F I G U R E N
mehr sich selbst besitzt«.64 Wir müssen uns in der Tat fragen, wie das na-türliche Bewusstsein den �›Verlust des Geistes�‹ erkennen kann, wenn die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis in jener Reflexion besteht, welche es noch nicht vollzogen hat. Muss es zum reflektierten Bewusstsein werden, um den �›Verlust des Geistes�‹ im Nachhinein, wenn es diesen Ver-lust bereits rückgängig gemacht hat, erkennen und betrauern zu können? Warum sollte das natürliche Bewusstsein die Unmittelbarkeit seines Seins, das es für die Wirklichkeit hält, verlassen, solange es den Verlust des Geis-tes nicht erkennen kann? Diese Frage erhält noch mehr Gewicht dadurch, dass sich die Wissenschaft dem natürlichen Bewusstsein als »ein Verkehr-tes«65 darstellt, und seine Forderung als der Versuch, »auf dem Kopf zu gehen«.66 Der Zwang, sich in die ungewohnte Position der Reflexion zu begeben, ist für das natürliche Bewusstsein eine »unnöthig scheinende Gewalt«.67 Die Wendung des natürlichen Bewusstseins hin zur Reflexion wird darum auch als »Weg des Zweifels [�…], oder eigentlicher Weg der Ver-zweiflung«68 beschrieben. Der Unterschied zwischen Zweifel und Ver-zweiflung, so führt Hegel aus, besteht darin, dass das natürliche Bewusst-sein auf dem Weg der Verzweiflung sich demjenigen nicht wieder zuwen-den kann, von dem es sich im Zweifel abgesetzt hat. Es muss vielmehr lernen, dass es keine Rückkehr zu dem gibt, was zuvor als seine Wahrheit galt.
Der Eintritt in die Reflexionsbewegung des Denkens ist damit nicht nur äußerlicher Zwang, sondern zugleich die notwendige Einsicht und Verinnerlichung der Unmöglichkeit einer Rückkehr. In der Tat wird es an späterer Stelle (und gegen Rousseau) heißen, dass es der Vernunft nicht darum gehen könne, dass sie
»den ausgebreiteten Reichthum ihrer Momente in die Einfachheit des natürlichen Herzens zurückversenke, und in die Wildniß und Nähe des tierischen Bewußtseyns [�…] zurückfalle; sondern die Foderung [�…] kann nur an den Geist der Bildung selbst gehen, daß er aus seiner Verwirrung als Geist zu sich zurückkehre, und ein noch höheres Bewußtseyn gewinne«.69
�—�—�—�—�—�— 64 Ebd. 65 Ebd., S. 22 66 Ebd., S. 23 67 Ebd. 68 Ebd., S. 56 69 Ebd., S. 285; Hervorhebung PP
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 43
Diese wichtige Unterscheidung zwischen der Wildnis und der Verwirrung, so scheint es, muss das Subjekt von Beginn an zu treffen lernen. Wenn der Eintritt in das Werden des Geistes durch eine Bewegung ohne Rückkehr erfolgt, dann steht ihm jener zurückgelassene Ort des Eintritts, die Wildnis und das Tierische also, nicht mehr offen. Das Subjekt setzt sich zur Wild-nis in eine Distanz und wird Subjekt in der Distanzierung zur Wildnis. Die Differenz zur Wildnis wird zum Signum des Subjekts, das in die Bewegung der Reflexion eintritt. Es muss lernen, jene Verwirrung, die es als ein Be-gehren zurück nach der Wildnis deuten könnte, als Übergang zu verstehen, der von der Wildnis immer nur wegführt. Das Subjekt wird nicht nur durch das fortschreitende Werden in der Reflexion zum Subjekt, sondern auch durch seine wachsende Distanz zur Wildnis �– und zu den Quasi- und Prä-Subjekten, die mit dieser Wildnis assoziiert sind.
Die Selbstreflexion wird somit als Bedingung von der Wissenschaft an das Bewusstsein herangetragen. »Die Wissenschaft von ihrer Seite verlangt vom Selbstbewußtseyn, daß es in diesen Aether sich erhoben habe, um mit ihr und in ihr leben zu können und zu leben.«70 Was für eine Rolle aber kommt dieser Wissenschaft zu, die verlangt, dass das Bewusstsein sich in den »Aether«71 der Reflexion erhebe, welche gleichzeitig den »Grund und Boden«72 der Wissenschaft darstellt? Wie transformiert sich der �›Aether�‹ an dieser Stelle zum �›Grund und Boden�‹, wie wird eine Bewegung zur Bedin-gung? Wie werden die Forderungen der Wissenschaft an das Bewusstsein, sich in die Reflexion zu begeben, zu einer Grundlage des Bewusstseins, welche fortan als sein �›eigener�‹ Boden gilt? Es könnte an dieser Stelle ge-fragt werden, ob diese erste Aufwärtsbewegung des Bewusstseins, dieses �›Erheben�‹, das noch nicht ein Aufheben darstellt, weil das Subjekt erst auf den Boden gehoben wird, von dem aus die Aufhebung möglich wird, ob mit diesem Erheben also auch die Richtung angelegt und fixiert wird, welche dem Bewusstsein von nun an als �›Höheres�‹ gelten muss; eine Richtung, welche mit dem Höheren auch das Niedrigere ansetzt, und damit den Ort, zu dem es unter keinen Umständen eine Rückkehr gibt. Welche territoriale Ordnung wird damit in Kraft gesetzt? Wird, mit anderen Worten, mit dem �›Grund und Boden�‹ der Wissenschaft auch ein anderes Gebiet markiert, welches später als Wildnis erscheinen kann? Und welche kulturellen und
�—�—�—�—�—�— 70 Ebd., S. 23 71 Ebd., S. 22 72 Ebd.
44 G R E N Z F I G U R E N
geographischen Vorstellungen sind mit dieser Territorialisierung des Wis-sens verbunden?
Das Bewusstsein, das der Gewalt der Wissenschaft ausgesetzt wird, ver-fügt allerdings auch über ein Recht: »Umgekehrt hat das Individuum das Recht zu fodern, daß die Wissenschaft ihm die Leiter zu diesem Stand-punkt reiche.«73 Wer verleiht dem Individuum dieses Recht, was setzt es in Kraft und wer stellt sicher, dass es eingehalten wird? Dieses Recht, so wird deutlich, besteht nicht darin, die Gewalt abzulehnen, die das Bewusstsein auf den Boden der Wissenschaft zwingt. Sein Recht besteht darin, Hilfe von der Wissenschaft anzufordern, welche es ihm ermöglicht, sich ihrem Zwang zu ergeben, dem Zwang, »diese ungewohnte Stellung anzunehmen und sich in ihr zu bewegen [und sich] eine so unvorbereitete als unnöthig scheinende Gewalt, die ihm angemuthet wird, [�…] anzuthun«.74 Erst mit dem Zwang und der Gewalt, welche das natürliche Bewusstsein durch die Wissenschaft erfährt, wird ihm ein Recht verliehen. Dieses schützt das Bewusstsein nicht vor der Gewalt, die es durch die Wissenschaft erfährt, weil das Recht erst durch diese Gewalt in Kraft tritt.
Dieses Recht gründet sich, so heißt es weiter, darauf, dass es in jeder Gestalt des Wissens, »sey sie von der Wissenschaft anerkannt oder nicht«,75 Anerkennung erfahren muss. Damit ist von möglichen Gestalten des Wis-sens die Rede, die von der Wissenschaft nicht anerkannt sind. Wie aber wird etwas zu einem Wissen, wenn nicht durch die Anerkennung der Wissen-schaft? Wie kann etwas als ein Wissen bestehen bleiben, wenn es nicht auf dem �›Boden der Wissenschaft�‹ angesiedelt ist und dort gedeiht? Um welche Gestalten des Wissens könnte es sich hierbei handeln? Sind es jene Formen des Wissens, von denen es in der Enzyklopädie heißt, dass sich
»[u]nter dem Aberglauben der Völker und den Verirrungen des schwachen Ver-standes [�…] bei Völkern, die weniger in der geistigen Freiheit fortgeschritten und darum noch mehr in der Einigkeit mit der Natur leben, auch einige wirkliche Zu-sammenhänge und darauf sich gründende wunderbar scheinende Voraussehungen von Zuständen und den daran sich knüpfenden Ereignissen [finden]«?76
Von dieser Einsicht in �›einige wirkliche Zusammenhänge�‹ heißt es jedoch, dass sie nicht genützt und nicht einmal erinnert werden kann, denn »mit der tiefer sich erfassenden Freiheit des Geistes verschwinden auch diese �—�—�—�—�—�— 73 Ebd., S. 23 74 Ebd. 75 Ebd. 76 Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, S. 391
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 45
wenigen und geringen Dispositionen, die sich auf das Mitleben mit der Natur gründen«.77 Einzig das Tier und die Pflanze bleiben darunter gebun-den und eben jene Völker, welche �›noch mehr in der Einigkeit mit der Natur leben�‹ (und, so möchte man anfügen, sofern diese nicht zu den Pflanzen und Tieren gehören). So wie die �›wirklichen Einsichten�‹ dieser Völker in der Entwicklung des Geistes �›verschwinden�‹ und ihren unsiche-ren Erkenntniswert verlieren, so geht auch jenes Wissen, das von der Wis-senschaft nicht anerkannt wird, im weiteren Verlauf der Phänomenologie vergessen, weil es, befinden wir uns einmal auf dem �›Boden der Wissen-schaft�‹, keine Rückkehr mehr zu jenem Ort gibt. (Es ist allerdings zu fragen, ob es eine Rückkehr der �›Wildnis�‹ in die Wissenschaft gibt; eine Rückkehr, die sich immer wieder oder jederzeit ereignen könnte?) In der Phänomenologie jedenfalls wird die Notwendigkeit hervorgehoben, mit der das Wissen Wissenschaft werden soll: »Die innere Nothwendigkeit, daß das Wissen Wissenschaft sey, liegt in seiner Natur«.78 Im Wissen selbst, und damit im Subjekt, insofern es die Tätigkeit dieses Wissens ist, wird eine Strebung entdeckt, welche keine Geschichte oder Herkunft zu haben scheint, sondern reine �›Natur�‹ ist, eine �›innere Notwendigkeit�‹, Wissen-schaft zu werden. Damit fällt das �›andere Wissen�‹ wieder aus dem Bereich, der dem Wissen in der Phänomenologie zugeschrieben wird. Die Möglichkeit eines nicht-wissenschaftlichen Wissens verschließt sich dadurch, dass es in der Natur des Wissens liegt, Wissenschaft zu werden.
Das bedeutet auch, dass das natürliche Bewusstsein im Übergang zur Reflexion nicht nur aus der Natur herausgelöst wird, sondern gleichzeitig zu einer anderen Natur zurückkehrt, welche als innere Notwendigkeit in ihm angelegt ist. Aus dieser Perspektive wird das �›natürliche�‹ im Nachhi-nein zum �›unnatürlichen�‹ Bewusstsein, und die Bewegung zur Wissenschaft bedeutet die Hinwendung aus der uneigentlichen zur eigentlichen �›Natur�‹ des Bewusstseins. Ist es diese �›innere Notwendigkeit�‹ des Wissens, Wissen-schaft zu werden, welche dazu führt, dass sich das natürliche Bewusstsein trotz seiner Verzweiflung »der Wissenschaft unmittelbar anvertraut«?79 Und dass es die Umkehrung all dessen, was ihm gewiss ist, auf sich nimmt, in einem »Versuch, den es, es weiß nicht von was angezogen, macht«?80 Das natürliche Bewusstsein weiß nicht, wovon es angezogen wird, aber wie
�—�—�—�—�—�— 77 Ebd. 78 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 11 79 Ebd. 80 Ebd., S. 23
46 G R E N Z F I G U R E N
kann es dies wissen, solange es sich außerhalb des Wissens befindet? Leis-tet es darum der Forderung der Wissenschaft, welche ihm wie eine �›unnö-tige Gewalt�‹ erscheint, Folge? Oder findet die Begegnung zwischen dem natürlichen Bewusstsein und der Wissenschaft womöglich immer schon auf jenem Boden statt, welcher die Wissenschaft dem Bewusstsein anzu-bieten scheint? Hat sich, wenn das natürliche Bewusstsein mit der Wissen-schaft in einen Dialog darüber tritt, ob es die Schwelle zur Reflexion über-schreiten soll, diese Passage vielleicht bereits ereignet? Stellen die Zweifel des natürlichen Bewusstseins an dem Vorschlag der Wissenschaft die Ge-lenkstelle einer Dialektik dar, in die es sich bereits hineinbegeben hat? Kann die Angst des Bewusstseins vor dem Selbstverlust als erste Ver-zweiflung über die Irreversibilität einer Bewegung gedeutet werden, die ohne Rückkehr sein wird und in deren Vollzug es sich bereits befindet? Erscheint das natürliche Bewusstsein damit bereits auf dem �›Grund und Boden�‹ der Wissenschaft, auf den es erhoben werden soll?
Um den Übergang vom natürlichen zum reflektierten Bewusstsein dar-stellen zu können, wird mit dem Subjekt der Wissenschaft ein Prä-Subjekt hervorgebracht, das sich sowohl in einem zeitlichen als auch räumlichen Außen befindet; es ist noch nicht in die Reflexion eingetreten, und es befin-det sich noch nicht auf dem Boden der Wissenschaft. Die Darstellung dieses Außen gründet aber auf denselben Bedingungen, welche für sein Innen gelten. Die zeitlichen und räumlichen Verhältnisse zwischen dem Subjekt und dem Prä-Subjekt, die mit dieser Szenographie in Kraft gesetzt werden, operieren gleichzeitig als Bedingungen des Übergangs, den das Prä-Subjekt zu vollziehen hat. Dieses Paradox manifestiert sich an der widersprüchli-chen Darstellung des natürlichen Bewusstseins, das einerseits außerhalb der Reflexion steht, sich aber andererseits der Reflexion bedienen muss, um die Wissenschaft und ihre Forderungen (an)erkennen zu können. In-dem es das Angebot der Wissenschaft als »jenseitige Ferne [erachtet], worin es nicht mehr sich selbst besitzt«,81 hat es sich bereits in die vermit-telnde Bewegung des Denkens begeben. Das natürliche Bewusstsein, das uns in der Phänomenologie begegnet, hat den Übergang zur Reflexion bereits hinter sich; es ist die paradoxe Repräsentation eines Bewusstseins vor der Reflexion, das sich bereits in der Reflexion befindet.
Aber bleibt an diesem Übergang nicht die Imagination eines anderen natürlichen Bewusstseins zurück? Gibt es im Unterschied zum natürlichen
�—�—�—�—�—�— 81 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 47
Bewusstsein, das in die Reflexion eintritt, ein Bewusstsein, das weiterhin das Außen und die Grenze der Reflexion repräsentiert? Wer oder was begeg-net dem Bewusstsein, das nun bereits unzählige Stufen zwischen sich und den Beginn seiner Reflexion geschoben hat, wenn es davor gewarnt wird, sich »in die Einfachheit des natürlichen Herzens [�…] und in die Wildniß und Nähe des thierischen Bewußtseyns, welche Natur, auch Unschuld genannt wird«,82 zurückzuversenken? Wird es dabei an seinen eigenen Anfang gemahnt oder an eine Figur des natürlichen Bewusstseins, welche sich noch immer an der Grenze zwischen Natur und Geist aufhält? Bleibt mit der ersten Aufhebung des natürlichen Bewusstseins in die Reflexion ein erster Rest zurück, ein natürliches Bewusstsein, das nicht zur Reflexion drängt oder sie nicht vollziehen kann? Und wird eine solches Bewusstsein, das an der Grenze zur Reflexion angesiedelt ist, wird eine solche Grenzfi-gur es möglich machen, den Bezug zu jenem Anfang wieder herzustellen, den das Bewusstsein von nun an immer schon hinter sich gelassen hat? Welche raum-zeitliche Übersetzung kommt ins Spiel, wenn das Subjekt seinen eigenen Anfang imaginiert? Welche imaginären Geographien wer-den erstellt, um das Außerhalb des �›Bodens der Wissenschaft�‹ zu denken, auf dem das moderne Subjekt erscheinen kann?
Landkarten des Geistes
In den Geschichtsvorlesungen wird die Entwicklung des Geistes auf Bedingun-gen zurückgeführt, welche in der Phänomenologie keine Erwähnung finden. Dennoch, so lässt die territoriale Metaphorik beider Texte vermuten, ist die geographische Grundlage der Geschichtsvorlesungen mit dem »Grund und Boden der Wissenschaft«83 verbunden:
»Diese Naturunterschiede müssen nun zuvörderst auch als besondere Möglichkei-ten angesehen werden, aus welchen sich der Geist hervortreibt, und geben so die geographische Grundlage. Es ist uns nicht darum zu tun, den Boden als äußeres Lokal kennenzulernen, sondern den Naturtypus der Lokalität, welcher genau zu-sammenhängt mit dem Typus und Charakter des Volkes, das der Sohn solchen Bodens ist.«84
�—�—�—�—�—�— 82 Ebd., S. 285 83 Ebd., S. 22 84 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 106
48 G R E N Z F I G U R E N
Der �›Naturtypus der Lokalität�‹ führt uns an dieser Stelle in eine andere Szenographie des Geistes, welche sich mit der vorhergehenden zu überla-gern scheint. Die Reflexion als Boden der Wissenschaft, auf welchem sich der Geist entwickelt, bedarf nun einer �›geographischen Grundlage�‹. Nicht der geologische Boden interessiert dabei, sondern sein Zusammenhang mit dem Geist, den er als Volk �›hervortreibt�‹, und mit dem er auf implizite, ja verwandtschaftliche Weise verbunden ist. Denn es wird ein intrinsischer Zusammenhang zwischen dem �›Naturtypus�‹ der Lokalität und dem �›Typus und Charakter des Volkes�‹ vorausgesetzt; eine hereditäre Verknüpfung zwischen der Lokalität und dem Volk, das auf dem Boden als �›Sohn�‹ lebt und damit männlichen Geschlechts zu sein scheint.
Bevor die Weltgeschichte als Abfolge jener Völker beschrieben werden kann, welche auf dem Boden der Geschichte erscheinen und die verschie-denen Gestalten des Weltgeistes entfalten, umreißt Hegel den Bereich der Geschichtslosigkeit. So wie es das natürliche Bewusstsein in der Phänomenologie möglich macht, den Boden der Wissenschaft zu bestimmen, sind es die Ausführungen zur Geschichtslosigkeit, mit deren Hilfe der �›Boden�‹ der Weltgeschichte markiert wird: »Zunächst ist hier nun auf die Natürlichkei-ten Rücksicht zu nehmen, die ein für allemal von der weltgeschichtlichen Bewegung auszuschließen wären: in der kalten und in der heißen Zone kann der Boden weltgeschichtlicher Völker nicht sein.«85 Damit wird eine Bedingung für den Eintritt in die Bewegung des Geistes angeführt, welche in der Phänomenologie keine Erwähnung findet: die Einwirkung der Natur als Gegenkraft des Geistes. Hegel zeigt auf, wie diese natürlichen Bedingun-gen wie Hitze und Kälte mit der Entwicklung des Geistes verbunden sind: »Denn das erwachende Bewußtsein ist anfänglich nur in der Natur, und jede Entwicklung desselben ist die Reflexion des Geistes in sich, gegen die natürliche Unmittelbarkeit.«86 Wenn das natürliche Bewusstsein in die Bewegung der Reflexion eintritt, wenn es beginnt, seine Umgebung und sich selbst durch diese Umgebung wahrzunehmen, findet es sich in der Natur als von ihr Unterschiedenes wieder. Die Reflexion beginnt mit der Erfahrung des Unterschiedes zur Natur, durch den sich das Bewusstsein als von der Natur Unterschiedenes setzt. Dieses Denken, das gleichzeitig der Beginn des Denkens darstellt, ist allerdings nur möglich, wenn die Aufmerksamkeit des Bewusstseins nicht von der Kraft der Natur absor-biert wird. Wenn Kälte und Hitze das Bewusstsein bedrohen, kann seine �—�—�—�—�—�— 85 Ebd. 86 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 49
Wahrnehmung der Natur nicht in die Wahrnehmung seiner selbst als von der Natur Unterschiedenes umschlagen. Die erste Differenz, die das Be-wusstsein setzt, die Differenz zur Natur, wird buchstäblich eingefroren oder weggeschmolzen. Ein solches Bewusstsein verliert sich in der Natur, ohne aus ihr zurückzukehren, denn es ist gezwungen, »seine Aufmerksam-keit auf die Natur zu richten, auf die glühenden Strahlen der Sonne und den eisigen Frost«.87 Im Unterschied zum Eintritt in die Reflexion, welche sich dem Bewusstsein anfänglich als »unnöthig scheinende Gewalt«88 prä-sentiert, tritt dem Bewusstsein an dieser Stelle die Gewalt der Natur in Form von Hitze und Kälte entgegen, welche die Reflexionsfähigkeit des Geistes verhindert. Das Bewusstsein der Menschen �– sind es Menschen oder vielmehr Prä-Menschen? �– außerhalb der gemäßigten Zone vermag darum nicht, den Zirkel der Reflexion zu durchlaufen. Fokussiert auf die harsche Umgebung, in der sie leben, erweisen sie sich als unfähig, die Aus-richtung auf die Natur zu durchbrechen und die Rückwendung auf sich selbst zu vollziehen. Dies bedeutet andererseits, so können wir rückschlie-ßen, dass das natürliche Bewusstsein in der Phänomenologie in jener geogra-phischen Gegend verortet ist, welche als �›gemäßigte Zone�‹ gilt; in jenem Gebiet also, in dem der Einfluss der Natur gering genug ist, um die Ent-wicklung des Geistes zu ermöglichen. »Der wahre Schauplatz für die Welt-geschichte ist daher die gemäßigte Zone«,89 hält Hegel fest. Mit der Sphäre, in der sich Weltgeschichte ereignet, werden auch jene Bereiche festgelegt, die sich außerhalb der Geschichte befinden.
Als Manifestation dieses geschichtslosen Bereichs führt Hegel Afrika an, das, »soweit die Geschichte zurückgeht, für den Zusammenhang mit der übrigen Welt verschlossen geblieben«90 ist. Afrika kann, nachdem Nordafrika zu Europa »herübergezogen« worden ist, so »wie dies die Fran-zosen jetzt eben glücklich versucht haben«,91 d.h. in einer Bewegung, in welcher die Entwicklung des Geistes mit dem Vordringen der europäi-schen Kolonialmächte einhergeht, »bloß an der Schwelle der Weltge-schichte vorgeführt werden«.92 Wiederholt sich an dieser Stelle die Tren-
�—�—�—�—�—�— 87 Ebd., S. 107 88 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 23 89 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 107 90 Ebd., S. 120 91 Ebd., S. 121 92 Ebd., S. 129. Heinz Kimmerle bemerkt zu Hegels Darstellung des Kolonialismus: »In
keinem Fall bildet das Schicksal der dort bereits ansässigen Bevölkerung oder deren Recht auf das Land auch nur einen Punkt der Diskussion. Die Kolonien sind �– wie das
50 G R E N Z F I G U R E N
nung eines natürlichen Bewusstseins, das zurückbleibt, von einem natürli-chen Bewusstsein, das in die Bewegung des Geistes eingehen kann? Ist Nordafrika jene Wildnis, welche zu Europa übergehen und damit in die geschichtliche Bewegung eintreten kann, während das subsaharische Afrika den Rest darstellt, der von dieser Bewegung des Werdens ausgenommen bleibt? Bevor Hegel zur eigentlichen Weltgeschichte übergeht, erstellt er eine Differenz zwischen Geschichtslosem und Geschichtlichem, welche sowohl zeitlich als auch räumlich funktioniert. Der geographische Unter-schied zwischen Afrika und den �›gemäßigten Zonen�‹ repräsentiert den historischen Übergang vom Geschichtslosen zur Geschichte. Die räumli-che Differenz zur Geschichtslosigkeit der �›kalten und heißen�‹ Zonen macht es möglich, die Geschichtlichkeit der gemäßigten Zonen zu denken. Damit wird die Bewegung der Geschichte bereits in ihrem Anfang und anhand von Afrika als europäische Bewegung markiert. Indem Nordafrika von Afrika getrennt und zu Europa genommen wird, geht es in die Bewegung des Geistes ein, während der Rest Afrikas zurückgelassen und sowohl zum Nicht-Europäischen als auch zum Außen der Geschichte wird.
Welche Bedeutung aber kommt der Repräsentation des Geschichtslo-sen beim Versuch zu, die Weltgeschichte zu schreiben? Wie wird die Ge-schichtlichkeit durch den Ausschluss Afrikas konstituiert? Welche Szeno-graphie wird erstellt, um den Übergang der Geschichte mit und durch Afrika zu denken?
»Wir verlassen hiermit Afrika, um späterhin seiner keine Erwähnung mehr zu tun. Denn es ist kein geschichtlicher Weltteil, er hat keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen, und was etwa in ihm, das heißt in seinem Norden geschehen ist, gehört der asiatischen und europäischen Welt zu. Karthago war dort ein wichtiges und vorübergehendes Moment, aber als phönizische Kolonie fällt es Asien zu. Ägypten wird im Übergange des Menschengeistes von Osten nach Westen be-trachtet werden, aber es ist nicht dem afrikanischen Geiste zugehörig. Was wir eigentlich unter Afrika verstehen, das ist das Geschichtslose und Unaufgeschlos-sene, das noch ganz im natürlichen Geiste befangen ist und das hier bloß an der Schwelle der Weltgeschichte vorgeführt werden mußte.
Wir befinden uns jetzt erst, nachdem wir dieses von uns geschoben haben, auf dem wirklichen Theater der Weltgeschichte.«93
�—�—�—�—�—�— Meer �– Erweiterungsraum der bürgerlichen Gesellschaft, deren Dynamik sie über ihre Grenzen hinausdrängt.« (Kimmerle, Die Dimension des Interkulturellen, S. 93)
93 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 129
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 51
Diese Passage, welche von Afrika zur Weltgeschichte führt, inszeniert die Prämissen, die sie setzt und voraussetzt, zugleich auf theatralische Weise. Dabei wird ein �›wir�‹ postuliert, und es ließe sich spekulieren, wen dieses �›wir�‹ anspricht, wen es einschließt und wen nicht, ein �›wir�‹ also, das Afrika an dieser Stelle verlässt, und zwar auf eine Weise verlässt, die es möglich macht, Afrika nicht mehr zu erwähnen. Das Verlassen Afrikas ist eine Bewegung ohne Rückkehr, so wie der Eintritt des natürlichen Bewusstseins in die Bewegung der Reflexion ohne Rückkehr ist. Als Naturzustand ist Afrika kein geschichtlicher Weltteil, und das, was dennoch geschichtlich ist, muss Asien und Europa zugeschrieben werden. Diese Verschiebung wird es später möglich machen, auf Afrika zurückzukommen, �›ohne seiner Er-wähnung mehr zu tun�‹.
Doch bevor Afrika verlassen wird, so bemerkt Hegel, soll eine Lehre daraus gezogen werden. Diese besteht darin zu erkennen, »daß der Natur-zustand selbst der Zustand absoluten und durchgängigen Unrechts ist«;94 eine Erkenntnis, die sich, so heißt es, aus der afrikanischen Sklaverei ge-winnen lässt. Als Teil eines Staates, so führt Hegel aus, ist die Sklaverei ein Moment der sich entwickelnden Sittlichkeit. Im vor-staatlichen Zustand allerdings kommt der Sklaverei diese Bedeutung nicht zu. Da die Bewoh-ner Afrikas noch nicht in die Sittlichkeit eingetreten sind und damit auch noch über keinen Staat verfügen, dient die Sklaverei nicht der Entwicklung; sie zeigt einzig die zwecklose Grausamkeit des Naturzustandes auf:
»Die Lehre, die wir aus diesem Zustand der Sklaverei bei den Negern ziehen und welche die allein für uns interessante Seite ausmacht, ist die, welche wir aus der Idee kennen, daß der Naturzustand selbst der Zustand absoluten und durchgängi-gen Unrechts ist.«95
Die �›allein für uns interessante Seite�‹ Afrikas besteht also darin, dass es das Unrecht des Naturzustandes aufzeigt. Ist Afrika damit die nachgereichte Erklärung zur Warnung in der Phänomenologie, das moderne Subjekt solle nicht »in die Wildniß und Nähe des tierischen Bewußtseyns«96 zurückfal-len? Aber inwiefern kann dies als eine Lehre gelten, welche aus Afrika gezogen wird? Wird an dieser Stelle nicht eine Einsicht gewonnen, die wir, wie es heißt, �›aus der Idee des Naturzustandes kennen�‹? Wird nicht weniger
�—�—�—�—�—�— 94 Ebd. 95 Ebd. 96 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 285
52 G R E N Z F I G U R E N
aus Afrika eine Lehre gezogen, als vielmehr anhand von Afrika eine bereits bekannte Idee vorgeführt?
Die Annahme, dass �›wir�‹ die Idee des Naturzustandes als �›absolutes und durchgängiges Unrecht�‹ bereits kennen, stellt allerdings ein wichtiges rheto-risches Moment dar. Indem Hegel dieses Wissen bei seinem Publikum voraussetzt, verdeckt er eine Kontroverse, die an späterer Stelle explizit gemacht wird. Hegels �›Afrika�‹ stellt ein Gegenprojekt zu Rousseaus �›Ame-rika�‹ dar, mit dem das Verhältnis zwischen der europäischen Moderne und dem Naturzustand neu bestimmt werden soll. Für Hegel beruht die Vor-stellung, die Moderne könne sich partiell am Naturzustand orientieren, auf einem folgenreichen Fehlschluss. Die Erfahrungen des Wilden, mögen sie auf den modernen Menschen auch attraktiv wirken, lassen sich keineswegs normativ auf die Moderne anwenden:
»Wir können aber deswegen einen solchen Zustand der Wildheit nicht für einen hohen halten und etwa in den Irrtum Rousseaus verfallen, der den Zustand der Wilden Amerikas als einen solchen vorgestellt hat, in welchem der Mensch im Besitz der wahren Freiheit sei. Allerdings kennt der Wilde ungeheuer viel Unglück und Schmerz gar nicht, aber das ist nur negativ, während die Freiheit wesentlich affirmativ sein muß.«97
Die verminderte Wahrnehmung von Schmerz und Unglück beim Wilden lässt sich nicht auf eine positive Ausgestaltung der Freiheit zurückführen, sondern vielmehr auf ihren Mangel und damit auf einen Zustand, den der moderne Mensch nicht wollen kann. Die Rückkehr zur Wildnis würde eine Regression darstellen, die den Menschen seiner Freiheit und damit des höchsten Audrucks seiner Menschlichkeit berauben würde. Die geringere Schmerzfähigkeit des Wilden kann darum nicht als Errungenschaft des menschlichen Bewusstseins erachtet werden, sondern nur als Hinweis darauf, dass sich das Bewusstsein des Wilden noch nicht in jenem höheren Bereich des Menschlichen befindet, der von der Freiheit gestiftet wird. Nur weil ihm der Begriff von Freiheit fehlt, leidet er nicht an seiner Unfreiheit. Dieses Argument ermöglicht es Hegel auch zu behaupten, die Sklaverei sei für die Afrikaner erträglich, obgleich sie gegen die menschliche Freiheit und damit gegen das Menschliche an sich verstoße: »denn es ist die Grundlage der Sklaverei überhaupt, daß der Mensch das Bewußtsein seiner Freiheit noch nicht hat und somit zu einer Sache, zu einem Wertlosen herabsinkt. Bei den Negern sind aber die sittlichen Empfindungen voll-
�—�—�—�—�—�— 97 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 419
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 53
kommen schwach oder, besser gesagt, gar nicht vorhanden.«98 Die Lokali-sierung der Sklaverei in zwei verschiedenen Kontexten �– jenem der Sitt-lichkeit und jenem des Naturzustandes �– ermöglicht es Hegel, den Skla-venhandel zugunsten der europäischen Kolonialmächte zu rechtfertigen. Die transatlantische Sklaverei bedeutet demnach für Afrika nicht wirklich eine Veränderung, sondern die Fortsetzung des seit jeher bestehenden Zustandes der Verknechtung. Weil den Afrikanern der Begriff der Freiheit fehle, »sehen die Neger [in der Sklaverei] nichts ihnen Unangemessenes«,99 ganz im Gegensatz zu den Engländern, welche nicht nur den Begriff der Freiheit kennen, sondern auch »das meiste zur Abschaffung des Sklaven-handels und der Sklaverei getan haben« und dennoch von den Afrikanern »als Feinde behandelt werden«.100
Hegels Ausführungen zum Unrechtszustand in Afrika stehen in einem starken Kontrast zu Rousseaus Darstellung des edlen Wilden, aber sie stellen genauso wie jene die Fiktion eines Naturzustandes dar, der als kon-stitutives Moment moderner europäischer Selbstreflexion erkennbar wird.101 Die Prämisse des Naturzustands und seiner Verwirklichung in Afrika operiert in Hegels Ausführungen als Grundannahme, für die keine Erklärung gegeben wird. Geklärt werden muss vielmehr das streitbare Verhältnis des modernen Europas zu seinem Anfang. Die Vorstellung einer zeitgenössischen Variante des Naturzustandes leistet dabei eine wichtige Arbeit, indem sie diesen Anfang denkbar macht und den Ver-gleich eines vor-historischen europäischen mit einem gegenwärtigen außer-europäischen Dasein ermöglicht.
Eine solche historisch-kulturelle Übersetzung ereignet sich auch in Hegels Kritik an Rousseau. Hegel hält fest, dass »wir [�…] die Germanen nicht in ihre Wälder zurückverfolgen [wollen]«.102 Die Schwärmereien des Tacitus und anderer, welche diese Wälder als Wohnort freier Völker be-schrieben haben, weist Hegel genauso von der Hand wie Rousseaus Be-geisterung für die Wilden Amerikas. Im Gegensatz zu Tacitus und Rous-
�—�—�—�—�—�— 98 Ebd., S. 125 99 Ebd., S. 128 100 Ebd. 101 Kimmerle hält dazu fest: »Der Gegensatz von Barbarei und Zivilisation und der Ge-
danke des Fortschritts von der Wildheit zur gesitteten Lebensart sind in der Aufklä-rungsphilosophie allgemein anzutreffen. Sie setzt eine Werteskala voraus, die bei Rous-seau genau umgekehrt vorkommt und dadurch nicht wirklich außer Kraft gesetzt wird.« (Kimmerle, Die Dimension des Interkulturellen, S. 90)
102 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 419
54 G R E N Z F I G U R E N
seau, den Dialogpartnern für seinen Entwurf der Weltgeschichte, wendet er sich gegen die affirmative Darstellung �›wilder�‹ Völker. Wie diese über-nimmt er aber die Prämisse, dass es sich in beiden Fällen um �›Wilde�‹ han-delt und dass damit der Vergleich der zeitgenössischen Wilden Amerikas mit den �›wilden�‹ Germanen, in deren historischer Fluchtlinie er sich selbst ansiedelt, möglich wird. Die Germanen, die einen systematischen Ort in Hegels Weltgeschichte einnehmen, werden durch die Wilden Amerikas �– jene Grenzfiguren der Geschichte, die selbst als geschichtslos gelten �– in ihrem Verhältnis zur Gegenwart bestimmbar. Die Substitution des zeitge-nössischen �›Wilden�‹ mit dem Naturzustand ermöglicht es dem europäi-schen Subjekt, das die Distanz zu seinem Anfang kontinuierlich auslotet, sich in Beziehung zur eigenen Vergangenheit zu setzen. Die unbelegte Grundannahme dieser Operation ist die Austauschbarkeit der germani-schen Vergangenheit mit der Gegenwart der amerikanischen �›Wilden�‹, die eigentlich keine Gegenwart, sondern eine fortdauernde �›Ahistorizität�‹ dar-stellt. Die �›Wilden Amerikas�‹ verbleiben im Naturzustand und stellen damit einen Referenzpunkt der Geschichte, ihren �›Nullpunkt�‹, dar.103
Allerdings ist es Hegel selbst, der eine solche Kritik an der Fiktion des Naturzustandes exemplifiziert. Er weist auf die Willkür hin, mit der nicht-europäische Kulturen mit dem Naturzustand ineins gesetzt und für das eigene Argument verwendet werden:
»In diesem Sinne wird ein Naturzustand überhaupt angenommen, in welchem der Mensch als in dem Besitze seiner natürlichen Rechte, in der unbeschränkten Aus-übung und in dem Genusse seiner Freiheit vorgestellt wird. Diese Annahme gilt nicht gerade dafür, daß sie etwas Geschichtliches sei, es würde auch, wenn man Ernst mit ihr machen wollte, schwer sein, solchen Zustand nachzuweisen, daß er in gegenwärtiger Zeit existiere oder in der Vergangenheit irgendwo existiert habe. Zustände der Wildheit kann man freilich nachweisen, aber sie zeigen sich mit den Leidenschaften der Roheit und Gewalttaten verknüpft und selbst sogleich, wenn sie auch noch so unausgebildet sind, mit gesellschaftlichen, für die Freiheit soge-nannten beschränkenden Einrichtungen verknüpft. Jene Annahme ist eines von solchen nebulosen Gebilden, wie die Theorie sie hervorbringt, eine aus ihr flie-ßende notwendige Vorstellung, welcher sie dann auch eine Existenz unterschiebt, ohne sich jedoch hierüber auf geschichtliche Art zu rechtfertigen.«104
�—�—�—�—�—�— 103 Diese Repräsentation der Wilden setzt die Eliminierung all ihrer zeitlichen und lokalen
Referenzen voraus. Vgl. dazu Mbembe, On the Postcolony, S. 177. 104 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 58
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 55
Hegels Kritik richtet sich in erster Linie gegen die Vorstellung des Natur-zustandes als Ort menschlicher Freiheit. Die Wildheit, die �›nachgewiesen�‹ werden kann, zeige keine Menschen, die in Freiheit leben, sondern viel-mehr in Rohheit und Gewalttätigkeit. Diese Einschätzung deckt sich mit Hegels Ausführungen zu Afrika. Er wendet dann aber ein, dass eine solche Annahme schwerlich geschichtlich belegt werden könne, und dass es, �›wenn man mit ihr Ernst machen wollte�‹, kaum möglich sei, den Naturzu-stand in der Gegenwart oder Vergangenheit aufzufinden. Denn alle Zu-stände von Wildheit würden, �›wenn sie auch noch so unausgebildet sind�‹, gleichzeitig gesellschaftliche Einrichtungen vorweisen. Jede Verbindung von Menschen ist damit bereits Gesellschaft, verfügt über ein Minimum an regulativen Maßnahmen und kann nur als Annäherung an den Naturzu-stand verstanden werden. Die Wildheit erweist sich damit als Ort zwischen dem Naturzustand und der Gesellschaft. Sie ist immer schon von mensch-licher Entwicklung berührt, auch wenn sich die Grundzüge des Naturzu-stands noch an ihr erkennen lassen. An diese Feststellung knüpft sich eine bedeutsame epistemologische Kritik: Auch wenn es keinen Zustand gibt, in dem der Mensch noch ganz �›Natur�‹ ist, wird die Vorstellung dieses Zu-stands benötigt, um den Beginn des Menschen denkbar zu machen. Darum werde die Vorstellung des �›Naturzustandes�‹ von der Theorie als �›nebulöses Gebilde�‹ hervorgebracht. Der Zusammenhang zwischen dem Naturzu-stand und diesen Theorien ist aber nicht arbiträr, denn der Naturzustand �›fließt�‹ aus diesen Theorien als �›notwendige Vorstellung�‹: Der Naturzu-stand, den es nicht gibt, erweist sich als notwendige Annahme der Theorie. Genau diese Ableitung einer empirischen Realität aus einem theoretischen Erfordernis wird aber von Hegel kritisiert; die Tatsache also, dass der Na-turzustand mit derselben Notwendigkeit, wie er in der Theorie erscheint, in der Wirklichkeit vorausgesetzt wird. Was aber bedeutet es, dass sich die Vorstellung des Naturzustandes als �›notwendig�‹ erweist, obwohl dieser Naturzustand, wie Hegel bemerkt, nirgends aufgefunden werden kann? Wird der Naturzustand in bestimmten Theorien oder wird er in jeder Theorie notwendig hervorgebracht �– ist er eine notwendige Bedingung von Theo-rie? Leistet Hegel an dieser Stelle eine epistemologische Kritik, die auf seine eigene Theorie zurückgewendet werden kann: als Kritik an einem �›nebulösen Gebilde�‹ wie seinem Afrika, das als notwendige Vorstellung aus seiner Theorie �›fließt�‹ und der dann �›eine Existenz untergeschoben wird�‹?
Diese Fragen bleiben jedoch offen. Nachdem die �›einzig interessante�‹ Lehre aus Afrika gezogen wurde, diejenige des Unrechts im Naturzustand,
56 G R E N Z F I G U R E N
wird Afrika zum Ort, zu dem es keine Rückkehr gibt und der deshalb auch nicht mehr erwähnt wird. Vielmehr: Afrika vollzieht und begründet durch die Lehre vom Unrecht des Naturzustandes, die es dem modernen Men-schen erteilt, den eigenen Ausschluss aus der Geschichte. Es tritt als das »Geschichtslose und Unaufgeschlossene [auf], das noch ganz im natürli-chen Geist befangen ist«.105 Afrika wird zur undenkbaren Nähe von Natur und Geist, die sich am Anfang der Weltgeschichte sowohl berühren als auch teilen. Es ist das Geschichtslose, »das hier bloß an der Schwelle der Weltgeschichte vorgeführt werden mußte«.106 Der Auftritt Afrikas macht es möglich, den vorgeschichtlichen Geist in seiner Befangenheit und im Zustand der unreflektierten Natur betrachten zu können; andererseits scheint es gerade diese Betrachtung zu sein, welche die Eliminierung Afri-kas aus der Geschichte nötig macht. »Wir befinden uns jetzt erst, nachdem wir dieses von uns geschoben haben, auf dem wirklichen Theater der Weltgeschichte.«107 Was für eine Vorführung aber stellt dies dar, wenn die Bühne der Geschichte erst errichtet werden kann, nachdem Afrika wegge-schoben worden ist?
Die spektakuläre Vorführung des Geschichtslosen, in der Hegel nicht mit grotesken, bizarren und erschreckenden Einzelheiten spart, wird zur Überführung in die eigentliche Vorführung, zu der Afrika nicht gehört. Afrika wird paradoxerweise an der Schwelle zur Weltgeschichte vorgeführt, obwohl es sich außerhalb der Vorführung, außerhalb des �›wirklichen Theaters der Weltgeschichte�‹, befindet. Es ist das nicht Vorführbare, wel-ches vorgeführt wird, um den Übergang zur Vorführung zu ermöglichen. Am Übergang und als Übergang zur Geschichte kommt Afrika deshalb ein vergleichbarer Ort zu wie dem �›natürlichen Bewusstsein�‹ beim Übergang zum Selbstbewusstsein in der Phänomenologie. Beide Passagen werden thea-tralisch inszeniert und beide thematisieren einen Ausgang aus der natürli-chen Verfasstheit des Geistes. Wie der Ausschluss Afrikas die Bühne der Weltgeschichte eröffnet, so wird mit der Transformation des Bewusstseins ins Selbstbewusstsein der �›Vorhang�‹ vor dem Subjekt gezogen und seine Innerlichkeit dabei hervorgebracht.
»Dieser Vorhang ist also vor dem Innern weggezogen, und das Schauen des Innern in das Innere vorhanden; das Schauen des ununterschiedenen Gleichnamigen, welches
�—�—�—�—�—�— 105 Ebd., S. 129 106 Ebd. 107 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 57
sich selbst abstößt, als unterschiedenes Innres setzt, aber für welches ebenso unmit-telbar die Ununterschiedenheit beyder ist, das Selbstbewußtseyn.«108
Mit dem Übergang vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein generiert sich jene Innerlichkeit, durch welche das Subjekt sich selbst als Anderes und sein Selbst durch das Andere erkennen und in einem gewissen Sinne erst Subjekt werden kann. Mit dem Schritt zum Selbstbewusstsein konstituiert sich das Subjekt nicht nur als Bewegung, welche sich auf den Gegenstand ausrichtet, sondern, indem es sich als das Andere denkt, als Innerlichkeit, welche Differenz und Identität in sich schließt. Es etabliert einen Selbstbe-zug, der die Alterität in sich schließt und der durch die ständigen Auftren-nungen und Zusammenführungen zwischen Selbst und Anderem zustande kommt. Die Theatermetaphorik der Weltgeschichte, für welche Afrika »an der Schwelle [�…] vorgeführt werden mußte«,109 findet in der Vorstellung des Vorhangs seine Entsprechung, der mit dem Beginn des Selbstbewusst-seins gehoben wird. Während es aber im zweiten Fall das vormals natürli-che Bewusstsein ist, welches zum Inneren wird und sich zugleich als Inne-res erkennen lässt, bleibt Afrika die Möglichkeit dieser Aufhebung in der Geschichte versagt. Wie das Tier und die Wildnis bleibt Afrika als Rest einer Bewegung zurück, welche sich von ihm abstoßen muss, um Bewe-gung zu werden. Das natürliche Bewusstsein wird durch das Schauen des Inneren in das Innere selbst zum Theater des Geistes, während Afrika an der Schwelle zur Geschichte zurückgelassen wird. Es wird zur Grenzfigur, zum Ort ohne Rückkehr, der sich außerhalb der Bühne des Geistes befin-det, während sich das Bewusstsein selbst in diese Bühne verwandelt.
Wer aber ist das Publikum dieser Vorführungen? Hegel spricht in bei-den Textabschnitten von einem �›wir�‹, dessen Profil nur erahnt werden kann. Beide Passagen enthalten Anweisungen an dieses �›wir�‹, die sich in signifikanter Weise voneinander unterscheiden. Während der Betrachter �– es ist zu vermuten, dass es sich dabei um einen männlichen Betrachter handelt �– Afrika �›verlassen�‹ und �›wegschieben�‹, sich also, mit anderen Worten, dieses Afrikas entledigen muss, um zur Geschichte zu gelangen, wird er im anderen Fall dazu angehalten, mit der Bewegung des sich for-mierenden Selbstbewusstseins mitzugehen. Dass der Vorhang vor der Innerlichkeit weggezogen wird, führt Hegel aus, bedeute nicht, dass sich das Innere des Selbstbewusstseins dem beobachtenden Blick darbietet. Der
�—�—�—�—�—�— 108 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 102 109 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 129
58 G R E N Z F I G U R E N
Blick allein genügt nicht, vielmehr verlangt Hegel vom Bewusstsein, dass es mit der Bewegung des Zu-Erkennenden mitgeht, um erkennen zu können. Die Innerlichkeit des Selbstbewusstseins erfordert, der Bewegung des Be-wusstseins hinter den Vorhang zu folgen, um �›selbst dahintergehen�‹ zu können.
»Es zeigt sich, daß hinter dem sogenannten Vorhange, welcher das Innre verde-cken soll, nichts zu sehen ist, wenn wir nicht selbst dahintergehen, ebensosehr damit gesehen werde, als daß etwas dahinter sey, das gesehen werden kann. Aber es ergibt sich zugleich, daß nicht ohne alle Umstände geradezu dahinter gegangen werden könne; denn dieß Wissen, was die Wahrheit der Vorstellung der Erschei-nung und ihres Innern ist, ist selbst nur Resultat einer umständlichen Bewe-gung«.110
Obwohl die Innerlichkeit des Selbstbewusstseins sich in diesem Abschnitt herausbildet und die Sicht auf sie wie durch einen weggeschobenen Vor-hang möglich wird, scheinen die Implikationen dieses Bildes zugleich ange-fochten zu werden. Der Leser muss in die Inszenierung eintreten und selbst auf der Bühne stehen, um ihre Bedeutung erkennen zu können. Die Erkenntnis, dass das Selbstbewusstsein Bewusstsein von sich selbst ist, kann nicht nur erblickt, sondern muss auch als Bewegung erfasst werden. �›Gesehen�‹ werden kann nur in der Bewegung, denn das Gesichtete ist »selbst nur Resultat einer umständlichen Bewegung«.111 Die Handlungs-anweisungen für die unterschiedlichen Erkenntnisvorgänge sind damit gänzlich verschieden: Während sich der Betrachter in das Theater des Geis-tes begibt, indem er der Bewegung des unreflektierten Bewusstseins folgt und damit Zeuge seiner Transformation zum Selbstbewusstsein wird, muss er das Geschichtslose �›wegschieben�‹, um sich auf dem Theater der Weltge-schichte wieder zu finden. Das natürliche Bewusstsein der Phänomenologie verwandelt sich in den Protagonisten der nächsten Stufe: das Selbstbe-wusstsein �– ganz im Gegensatz zu Afrika, welches im Übergang zur Ge-schichte zurückgelassen wird, um ohne Entwicklung zu bleiben. Im einen Fall ereignet sich die Negation als konstitutives Moment der Dialektik: Der Vorhang des Bewusstseins hebt sich durch den Unterschied, den das Be-wusstsein in sich selbst setzt, und das Theater des Selbstbewusstseins be-ginnt. Im anderen Fall wird die Verwerfung des Restes zum konstitutiven Moment, das �›vergessen�‹ gehen muss: Die Bühne der Geschichte eröffnet
�—�—�—�—�—�— 110 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 102 111 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 102
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 59
sich mit dem Wegschieben Afrikas, das nicht erinnert werden wird. Die beiden Bewegungen unterscheidet, dass sich die erste als Aufhebung, die zweite als Abstoßung ereignet und die eine eine frühe Figur des Bewusst-seins in sich aufnimmt, die andere einen dialektischen Rest zurücklässt.
Diese Differenz zwischen einem Bewusstsein, das in der Bewegung der Aufhebung bleibt, und einem Bewusstsein, dem diese gerade versagt bleibt, wird auch in W.E.B. du Bois�’ Analyse der nordamerikanischen Segregation verwendet. Seine Beschreibung des afro-amerikanischen Subjekts, die sich auf Hegels Phänomenologie bezieht, kann als eine Antwort auf die unmögli-che Subjektposition des Afrikaners gelesen werden.112 In du Bois�’ Darstel-lung wird der Vorhang [the veil] darum nicht zum Zeichen dessen, was sich hebt, wenn das Bewusstsein durch die Vermittlung des Anderen zum Selbstbewusstsein wird. Der Vorhang wird vielmehr zur Trennlinie zwi-schen dem �›schwarzen�‹ Subjekt und der �›weißen�‹ Welt; eine Trennung, die für dieses Subjekt zugleich konstitutiv und unüberschreitbar ist. Der ame-rikanische Schwarze formiert sich durch sein weißes Gegenüber, das zu-gleich bestimmend und unerreichbar bleibt. Um sich als Selbst erkennen zu können, muss er sich aus jener weißen Position betrachten, die ihm ver-weigert wird, die sich ihm mit Verachtung zuwendet, und von der er wie durch einen Schleier getrennt bleibt. »[T]he Negro is a sort of seventh son, born with a veil, and gifted with second-sight in this American world. It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always look-ing at one�’s self through the eyes of others, of measuring one�’s soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels this two-ness, �– an American, a Negro; two souls, two thoughts, two un-reconciled strivings; two warring ideals in one dark body«.113 Wenn das Selbstbewusstsein in der Phänomenologie dadurch entsteht, dass es sich durch den Anderen als Anderen, in dieser Andersheit aber wiederum als Selbst erfährt, dann stellt die Andersheit des Schwarzen im Kontext des segre-gierten Amerikas einen Widerspruch dar, der nicht dialektisch aufgelöst werden kann. Die zwei Aspekte seiner Existenz �– dass er Amerikaner und
�—�—�—�—�—�— 112 Auch Frantz Fanon wendet sich gegen Hegels Darstellung der Subjektformation, indem
er aufzeigt, dass sich die Szene zwischen Herr und Knecht in der kolonialen Situation nicht dadurch auflöst, dass sich der Knecht der Arbeit zuwendet. Fanon schreibt: »Der Neger will sein wie der Herr. Daher ist er weniger selbständig als der Hegelsche Sklave. Bei Hegel wendet sich der Sklave vom Herrn ab und dem Objekt zu. Hier wendet sich der Sklave dem Herrn zu und gibt das Objekt auf.« (Fanon, Schwarze Haut, weiße Masken, S. 262)
113 Du Bois, The Souls of Black Folk, S. 9
60 G R E N Z F I G U R E N
Schwarzer ist �– bleiben unvermittelt und unvermittelbar. Shamoon Zamir schreibt dazu: »Where the veil is lifted in Hegel, it descends in Du Bois, and what is primarily a natural history of consciousness in the Phenome-nology is transformed into a social history in Souls.«114 Gerade dieses (Selbst-)Verständnis der Phänomenologie als �›natürliche�‹ Geschichte des Geis-tes aber wird in Frage gestellt, wenn die Lektüre der Geschichtsvorlesungen mit derjenigen der Phänomenologie verbunden wird. Die Unterscheidung zwi-schen Figuren, die aufgehoben, und solchen, die verworfen werden, er-möglicht es vielmehr, die kulturelle Verortung des Textes zu entziffern.
Geschichte des aufgeschobenen Anfangs
Hegels Dialektik hebt im Prozess des Werdens nicht nur vorhergehende Zustände des Geistes auf. Sie produziert auch konstitutive Reste, die über keinen systematischen Ort verfügen, während sie die systematische Ent-wicklung der Geschichte vorantreiben. Von diesem Rest stößt sich die Bewegung des Geistes ab, ohne ihn dabei zu transformieren, ohne ihn aufzuheben und selbst zur Geschichte zu machen. So stellt das vorreflexive Bewusstsein der Phänomenologie die vergangene Kontur des Selbstbewusst-seins dar und ist derart in ihm aufgehoben �– Afrika aber verbleibt außer-halb der Geschichte. Es ist nicht die Vergangenheit Europas, sondern eine aktuelle Repräsentation der europäischen Vergangenheit. Afrika kann nicht aufgehoben werden, weil es, anders als der Beginn des Geistes, in die Be-wegung der Reflexion nie eingetreten ist. Es ist der Rest eines Naturzu-standes, welcher in der Gegenwart verbleibt, obwohl er der Vergangenheit angehört. Gleichzeitig ermöglicht es die Präsenz dieses Restes, die Vergan-genheit Europas zu denken.
Was bedeutet dies für Hegels Perspektive auf den afrikanischen Men-schen? Was stellt der Afrikaner als �›natürlicher Mensch�‹115 dar, der ohne Bewegung und Entwicklung ist, wenn doch der Geist als Bewegung und Entwicklung definiert wird? Wie kann er Geist sein, der �›noch ganz in der Natur befangen�‹ ist, wenn doch der Geist als Herauslösung aus der Natur bestimmt wird? Ist er die Manifestation des natürlichen Bewusstseins, wie
�—�—�—�—�—�— 114 Zamir, Dark Voices, S. 136 115 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 122
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 61
es in der Phänomenologie erscheint, oder eine Vorlage, nach der dieses ent-worfen wurde?
»Der Neger stellt, wie schon gesagt worden ist, den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und Unbändigkeit dar; von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl heißt, muß man abstrahieren, wenn man ihn richtig auffassen will: es ist nichts an das Menschliche Anklingendes in diesem Charakter zu fin-den.«116
In dieser Beschreibung tritt das Paradox, welches Hegels Figur des �›Negers�‹ auszeichnet, zutage. Er ist einerseits der natürliche Mensch und anderer-seits weist er nichts an das �›Menschliche Anklingende�‹ auf. Er stellt einen Menschen dar, dessen menschliches Potential noch gänzlich unerkennbar ist. Diese Schwierigkeit, einen Menschen vor der Aktualisierung seiner Menschlichkeit zu beschreiben, zeigt sich bei Hegels Ausführungen zum �›afrikanischen Charakter�‹. Dieser sei »schwer zu fassen«,117 weil man »ganz auf das Verzicht leisten [muss] [�…], was bei uns in jeder Vorstellung mit unterläuft«.118 Zwischen dem Subjekt, dem modernen (europäischen) Men-schen, und dem Objekt seiner Betrachtung, dem natürlichen (afrikani-schen) Menschen, steht ein epistemologisches Problem. Die Schwierigkeit, den Afrikaner zu �›fassen�‹, besteht darin, dass er dem Europäer als Mensch erscheint, die Prämissen des Menschlichen aber nicht erfüllt. Er erscheint als Grenzfigur, die den Bereich des Menschlichen zugleich bestimmt und in Frage stellt. Darum weist Hegel auf die Gefahr hin, dem �›Neger�‹ menschliche Züge zu unterstellen, welche bei ihm gerade nicht aufzufinden sind: »von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl heißt, muß man abstrahieren«.119
Diese Vorstellung, dass der Afrikaner ohne Ehrfurcht und Sittlichkeit ist, lässt sich mit dem systematischen Ort erklären, den Hegel dem natürli-chen Menschen zuweist. Durch die Annahme, dass der Afrikaner in einer vorstaatlichen Gesellschaft lebt und eine früheste Phase der Religion prak-tiziert, werden Sittlichkeit und Ehrfurcht ausgeschlossen. Die Vorstellung aber, dass der Afrikaner ohne Gefühl ist, dass man »von dem, was Gefühl heißt [�…] abstrahieren [muss], wenn man ihn richtig auffassen will«,120 entfernt ihn nicht nur vom Menschen, sondern auch vom Tier, das in der
�—�—�—�—�—�— 116 Ebd. 117 Ebd. 118 Ebd. 119 Ebd. 120 Ebd.
62 G R E N Z F I G U R E N
Vorrede der Phänomenologie mit der Immanenz der Gefühlswelt identifiziert wird. Es stellt sich in der Tat die Frage, wo der �›Neger�‹, der über keine Gefühle zu verfügen scheint, anzusiedeln ist, wenn »das widermenschliche, das thierische [darin] besteht [�…], im Gefühle stehen zu bleiben und nur durch dieses sich mittheilen zu können«.121 Der �›Neger�‹ befindet sich au-ßerhalb des Tieres, welches in den Gefühlen stehen bleibt, und des Men-schen, der seine Gefühle mit Hilfe der Vernunft vermitteln und kommuni-zieren kann. Diese Position eines Afrikaners, der weder Tier noch Mensch ist, wird erneut in Frage gestellt durch die These, dass der �›Neger�‹, da er in der absoluten Sklaverei lebt, das Bewusstsein von »Freiheit noch nicht hat«.122 Damit wird der Afrikaner nicht mehr außerhalb von Tier und Mensch, sondern vielmehr zwischen Tier und Mensch situiert. Der Mangel an Freiheit rückt ihn in die Nähe des Tieres, von dem es in der Einleitung zu den Geschichtsvorlesungen heißt: »Wie nicht das Tier, sondern nur der Mensch denkt, so hat auch nur er und nur, weil er denkend ist, Freiheit«.123 Dass der Afrikaner die Freiheit aber noch nicht hat, weist auf seine Mög-lichkeit hin, Mensch zu werden, die ihn wiederum vom Tier unterscheidet. Auch an anderen Stellen räumt Hegel den Afrikanern die Möglichkeit der Entwicklung ein. So wird in den Geschichtsvorlesungen behauptet, »die Neger [seien] weit empfänglicher für europäische Kultur als die Indianer«,124 und in der Enzyklopädie heißt es, die Fähigkeit der Bildung sei den Afrikanern nicht abzusprechen.
»[S ]ie haben nicht nur hier und da das Christentum mit der größten Dankbarkeit angenommen und mit Rührung von ihrer durch dasselbe nach langer Geistes-knechtschaft erlangten Freiheit gesprochen, sondern auch in Haiti einen Staat nach christlichen Prinzipien gebildet.«125
Im Gegensatz zum Naturzustand, in welchem Afrika sich immer befunden zu haben scheint, wird an dieser Stelle ein Entwicklungspotential erkenn-bar, welches die Position Afrikas an der Schwelle der Weltgeschichte ver-ändert. Allerdings scheint die Möglichkeit der Entwicklung an dieser Stelle davon abzuhängen, dass der afrikanische Boden verlassen wird. Befindet
�—�—�—�—�—�— 121 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 48 122 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 125; Hervorhebung PP 123 Ebd., S. 95 124 Ebd., S. 109 125 Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dritter Teil: Die Philosophie
des Geistes (Werkausgabe Moldenhauer/Michel, Frankfurt a. M. 1970), S. 60. Diese Stelle ist nur als sogenannter (mündlicher) »Zusatz« überliefert.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 63
sich Afrika also auf dieser Schwelle, um sie zu überschreiten, wie dies, bezeichnenderweise auf nicht-afrikanischem Boden, in Haiti geschehen ist?126 Oder ist Afrika in einer Repräsentation, die Ranajit Guha als »politics of statism«127 bezeichnet, für immer an diese Schwelle des Menschlichen gebunden? Solches impliziert etwa eine Aussage aus den Geschichtsvorlesun-gen, wo es heißt: »Dieser Zustand [der Neger] ist keiner Entwicklung und Bildung fähig, und wie wir sie heute sehen, so sind sie immer gewesen.«128 Hegels Darstellung des Afrikaners ist widersprüchlich und inkonsistent; sein Ort am Rande des Menschlichen oszilliert, ohne dass dies Gegenstand einer Reflexion wird. Die Figur des Afrikaners wandert den Grenzen zwi-schen dem Menschlichen und dem Unmenschlichen, zwischen Mensch und Tier, zwischen Entwicklungsfähigkeit und Stagnation entlang und bringt diese Grenzen dabei zugleich hervor.
Allerdings erscheint nicht nur das �›afrikanische Bewusstsein�‹ als Grenz-figur. Neben dem Tier, welches zu Beginn als geschichtslose Figur er-scheint, und der dramatischen Eröffnung der Geschichte durch den Aus-schluss Afrikas, werden später auch die Kulturen Chinas, Indiens und Persiens als Beispiele vorhistorischer Zustände aufgeführt. Zwischen dem erklärten Beginn der Geschichte und ihrem wirklichen Beginn schieben sich verschiedene Versionen der Vorgeschichte. Guha beschreibt das Zusammenspiel dieser wechselnden Ausschlüsse: »Those who are lucky enough to qualify as the object of World-history are thus categorally distin-guished from those who are not. Henceforth the excluded will be settled in a space called Prehistory with World-history reserved solely for the chosen nations. The line separating Prehistory and World-history �– the upper case used to indicate their status as strictly demarcated areas of history �– is drawn at consciousness.«129 Die These von Guha, dass das Bewusstsein (und damit einhergehend Selbstbewusstsein, Vernunft, Staat und Religion als dessen innere und äußere Gestalten) die Grenze zwischen Ungeschichtli-chem und Geschichtlichem markiert, macht es möglich, die Relationen zwischen der Entwicklung des Bewusstseins und derjenigen der Ge-schichte zu erkennen und die Verbindungen zwischen Afrika, Europa, dem
�—�—�—�—�—�— 126 Vgl. dazu Buck-Morss, »Hegel and Haiti«. 127 Guha, History and the Limit of World-History, S. 5 128 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 128 129 Guha, History and the Limit of World-History, S. 35
64 G R E N Z F I G U R E N
afrikanischen und europäischen Bewusstsein zu rekonstruieren.130 Dem-nach lässt sich das einzelne Bewusstsein ebenso sehr als Maßstab des Ge-schichtlichen verwenden, wie das Geschichtliche Aussagen über den Ent-wicklungszustand des Bewusstseins zulässt. Dies mag erklären, warum Hegel in seinen Ausführungen zu Afrika zwischen Geographie, Politik, Religion, Bewusstsein und Anekdotischem hin- und hergeht. Die Figur des Afrikaners erscheint, wie Derrida ausführt, sowohl als Undialektisierbares als auch als Widerstand der Geschichtsdialektik, immer aber ist sie ihr inhärent, gerade und besonders wenn es um die Schwelle der Geschichte geht. »C�’est-à-dire, si l�’on extrait le schéma logique de l�’analyse, à un in-conscient qui ne se laisse pas dialectiser en tant que tel, n�’a pas d�’histoire, se tient avec entêtement au seuil du procès historico-dialectique.«131 Die Figur des Afrikaners, der an der Grenze der Geschichte angesiedelt ist, wird zum konstitutiven Rest jener Bewegung der Geschichte, die Hegel systematisch zu erfassen sucht. Diese Grenze ist allerdings nicht statisch, sondern wird im Text beständig erzeugt. Die wechselnden Positionen des afrikanischen Bewusstseins markieren Punkte eines Anfangs, der sich, während er kontinuierlich als Anfang reinszeniert wird, beständig ver-schiebt.
Die Grenze der Geschichte, die mit Afrika gezogen werden soll, bleibt nicht nur im Hinblick auf Afrika widersprüchlich. Es erweist sich auch in den weiteren Ausführungen der Geschichtsvorlesungen als unmöglich, diese Grenze, und damit den Anfang der Geschichte, zu setzen. In gewisser Weise können die Vorlesungen zur Geschichte als das Aufschieben der Grenzziehung zur Geschichte gelesen werden, in dem Afrika immerzu präsent bleibt. Afrika wird zur Schwelle der Geschichte, die nicht wirklich überschritten wird, und die Geschichtsvorlesungen zum kontinuierlichen Ver-such, Afrika hinter sich zu lassen. So erfolgt einer der unzähligen Über-gänge zur Geschichte in Absetzung von Afrika, desjenigen Afrikas aber nun, das zuvor Europa und Asien zugeschlagen worden ist. Ägypten wird zum Moment der Grenze, an der sich Persien und Griechenland treffen, und an der die Vorgeschichte in Geschichte umschlagen soll. »Ägypten �—�—�—�—�—�— 130 Für Guha liegt Hegels Grenze der Geschichte zwischen dem Orient auf der einen Seite
und den Griechen, Römern und Germanen auf der anderen Seite (ebd., S. 36). Damit kommen Afrika und seine Bedeutung für die Konstitution dieser Grenze nicht in den Blick. Indem Guha Hegels Konzept von vier historischen Bereichen übernimmt und nur kritisiert, dass der erste Bereich, der Orient nämlich, nicht als historisch gilt, übersieht er die Ausschlüsse, die diesem Modell bereits zugrunde liegen.
131 Derrida, Glas, S. 232
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 65
aber ist eine Provinz des großen persischen Reichs geworden, und der geschichtliche Übergang tritt bei der Berührung der persischen und grie-chischen Welt ein.«132 Diese Passage aber bedarf erneut der Bezugnahme auf ein konstitutives Außen der Geschichte. Afrika kehrt an dieser Stelle durch Ägypten wieder und wird zum transformativen Moment für den �›orientalischen Geist�‹. Die »gediegene Substantialität«133 des Orients, die im Übergang nach Griechenland überschritten wird, verbindet sich in Ägypten mit der Unruhe, welche den Geist noch nicht zum Bewusstsein macht, ihn aber in jene Bewegung versetzt, die sich in Griechenland als Bewusstsein aktualisieren wird. Die Möglichkeit dieses Umschlags aber ergibt sich durch die �›afrikanische Natur�‹: »dem ägyptischen Geiste ist, obzwar ebenso noch in unendlicher Befangenheit, doch die Unmöglichkeit geworden, es in ihr auszuhalten. Die derbe afrikanische Natur hat jene Einheit auseinan-dergetrieben und hat die Aufgabe gefunden, deren Lösung der freie Geist ist.«134 Mit diesem Übergang erreicht die Geschichte, die noch nicht wirk-lich Geschichte ist, Griechenland, nachdem sie den Orient über China, Indien, Persien, Syrien, Judäa und Ägypten hinter sich gelassen hat; dabei die Frage nach ihrem Beginn vor sich herschiebend. In der Tat werden die Erläuterungen zu Griechenland wiederum mit der Frage des Anfangs eröffnet.
»Bei den Griechen fühlen wir uns sogleich heimatlich, denn wir sind auf dem Boden des Geistes, und wenn der nationale Ursprung sowie der Unterschied der Sprachen sich weiter hin nach Indien verfolgen läßt, so ist doch das eigentliche Aufsteigen und die wahre Wiedergeburt des Geistes erst in Griechenland zu suchen.«135
Indien wird als Ort eines Ursprungs, zumal der Nation und der Sprache, anerkannt, und dennoch fühlen �›wir�‹ uns erst hier, bei den Griechen, �›hei-matlich�‹. Obwohl eine politische und linguistische Kontinuität zwischen Indien und Europa hergestellt wird, bleibt �›uns�‹ Indien fremd. Mit den Griechen hingegen kommt ein Wiedererkennungseffekt der europäischen Moderne ins Spiel, der keine temporäre Verzögerung mit sich bringt; wir fühlen uns �›sogleich�‹ heimatlich, denn, so erklärt Hegel, Griechenland befin-det sich ebenso �›auf dem Boden des Geistes�‹, wie �– so wird impliziert �– �›wir�‹ auch. Der Begriff der Heimat erscheint in der Kartographie des Geis-�—�—�—�—�—�— 132 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 272f. 133 Ebd., S. 271 134 Ebd. 135 Ebd., S. 275
66 G R E N Z F I G U R E N
tes, sobald er in Europa ankommt: Das antike Griechenland befindet sich wie das zeitgenössische Deutschland auf dem �›Boden des Geistes�‹, der in Griechenland seine �›wahre Wiedergeburt�‹ erlebt. Mit der Entstehung einer menschlichen Welt in Griechenland wird aber nicht nur dasjenige, was �– sowohl historisch als auch geographisch �– außerhalb Griechenlands liegt, aus der Welt des Geistes ausgeschlossen. Vielmehr konstituiert sich Grie-chenland mit der Bewegung dieses Ausschlusses als Boden des Geistes. Die performative Arbeit der Grenzziehung produziert beides, den Ausschluss Asiens aus der Geschichte und Europas Einschluss.
Die Wanderung des Geistes von Osten nach Westen erfährt dadurch, dass der Geist nun auf seinen Boden gelangt, eine qualitative Veränderung. Der vorbewusste Zustand, in dem sich der Geist in Asien befindet, wird als eine Entfremdung lesbar, als das Dasein auf einem Boden, der nicht derje-nige des Geistes ist. Dieser Deutung unterliegt die Verschränkung zweier Zeitlichkeiten: dem Progress des Geistes in der Geschichte und dem Rückblick des entwickelten Geistes auf seine Anfänge. Die Vorgeschichte, die mit der Abstoßung von Afrika erfolgt, stellt einen vorläufigen Anfang dar, der sich durch die �›wahre Wiedergeburt�‹ in Griechenland erneut ereig-net und damit erst wirklich erfolgt. Durch die Wiederholung des Anfangs in Griechenland wird die Geschichte zur Vorgeschichte und das vom Geist durchquerte Territorium zu einem Gebiet, das dem Geist fremd ist. Unei-gentlicher und eigentlicher Anfang des Geistes scheiden sich in Griechen-land. Der Anfang, der eine Wiederholung ist, kann nur durch den Aus-schluss dessen, was ihm vorausgeht, als Anfang erscheinen.
Auch der Begriff der Heimat erhält an dieser Stelle eine doppelte Be-deutung. Im antiken Griechenland verortet Hegel die Entstehung der Sitt-lichkeit, in der sich das Selbst in der gegenständlichen Welt entgegentritt, die »alle Bedeutung eines Fremden«136 verloren hat. Mit der Vorstellung, dass der Grieche sich eine geistige Welt erschafft, wird eine historisch-geographische Grenze zwischen der modernen und der antiken Welt auf-gehoben: Das moderne Subjekt kann sich im Griechen, der sich als geisti-ges Wesen in der sittlichen Welt manifestiert, wiedererkennen. Mit dem Gefühl der Heimat, das den modernen Leser beim Gedanken an Grie-chenland erfasst, erfolgt die territoriale und temporale Einschreibung des reflektierten Geistes auf dem Boden, der als �›Europa�‹ definiert, und in der
�—�—�—�—�—�— 136 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 238
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 67
Zeit, die als Geschichte bestimmt wird.137 Damit verschiebt sich die Grenze des Geschichtlichen, die einst Afrika von den gemäßigten Zonen trennte, erneut. »China und Indien liegen gleichsam noch außer der Welt-geschichte, als die Voraussetzung der Momente, deren Zusammenschlie-ßung erst ihr lebendiger Fortgang wird.«138 China und Indien, aber auch die anderen Kulturen Asiens und des Mittleren Ostens erscheinen nun als vorgeschichtliche Sphären, in denen sich die Strukturen der staatlichen, familiären und gesellschaftlichen Ordnung erst abzuzeichnen beginnen.
Auch an dieser Stelle korrelieren Geschichte und Bewusstsein. Im Un-terschied zum Orient, so heißt es in den Geschichtsvorlesungen, geht der Cha-rakter des griechischen Geistes von einer selbständigen Individualität aus, »von einem Zustand, in dem die Einzelnen auf sich stehen und nicht schon durch das Naturband patriarchalisch von Hause aus vereint sind, sondern sich erst in einem anderen Medium, in Gesetz und geistiger Sitte, zusam-mentun«.139 Die sittliche Familienordnung der Griechen entsteht in Abset-zung von der patriarchalen Organisationsform des Orients, in welcher die Individualität des Einzelnen unterdrückt bleibt. Ich werde später auf die konstitutive Bedeutung des chinesischen Staates für die bürgerliche Ord-nung Europas zu sprechen kommen. Festgehalten werden soll an dieser Stelle, was im Folgenden genauer untersucht wird, dass sich mit der Nie-derlassung des Geistes in Europa, mit der Herausbildung einer Heimat und eines �›Heims�‹ des Geistes die Grenze zwischen Natur und Geist verschiebt: Sie erscheint nun im Inneren der sittlichen Welt, die sowohl das �›Naturband�‹ der Familie als auch das �›andere Medium�‹ des Gesetzes und der Sitte in sich vereint.140
�—�—�—�—�—�— 137 Byung-Chul Han weist auf das Paradox hin, dass Hegel die Bedeutung des Fremden für
die Entwicklung der Kultur anerkennt, zugleich aber die Heimat des Geistes in Europa zelebriert: »Hinsichtlich der europäischen Kultur hat Hegels �›Geist�‹ offenbar die �›Fremd-artigkeit in sich selbst�‹ abgeworfen, die ihm einst jene �›Kraft�‹ verlieh, �›als Geist zu sein�‹. Es gibt keine fremde Kultur, keine �›Ankunft der Fremden�‹ mehr, die sie aus ihrem be-glückenden �›nicht hinaus, hinüber�‹ herausrisse. So entwickelt die europäische Kultur eine Selbstgenügsamkeit. Sie ist zufrieden mit sich. Keine Fremdartigkeit in sich selbst beun-ruhigt sie. Nach Hegels eigener Theorie hätte das aber eine tödliche Erstarrung zur Folge.« (Han, Hyperkulturalität, S. 12)
138 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 147 139 Ebd., S. 278 140 Han bemerkt dazu, dass die �›Heimat�‹ des Geistes nicht nur die vor-griechische von der
griechischen Geschichte unterscheidet, sondern auch Hegels Darstellung der Geschichte von derjenigen der Philosophie: »In den Vorlesungen über die Geschichte der Philoso-phie, in denen es vor allem um den Geist, um den griechischen Geist, und nicht ums
68 G R E N Z F I G U R E N
Anzufügen bleibt noch, dass Griechenland den orientalischen Despo-tismus nicht nur durch eine neue Staatsorganisation überwindet, sondern auch durch die Besiegung �›orientalischer�‹ Armeen im Krieg. Die fort-schreitende Bewegung des Geistes geht daher auch mit der kriegerischen Überwältigung jener Kulturen einher, die hinter der Bewegung des Geistes zurückbleiben. In den Kriegen der Griechen gegen die Perser macht Hegel, �– obwohl er anmerkt, dass »unstreitig größere Schlachten geschlagen wor-den«141 sind �– den entscheidenden Kampf zwischen dem geistigen Prinzip der Freiheit und dem �›orientalischen Despotismus�‹ aus.142 Der Krieg wird zu einem Mittel, das die performative Grenzziehung vollzieht. Wiederho-lung und Anfang verschränken sich auch hier: Die doppelte Bedingung der Freiheit, ein individuiertes Bewusstsein und eine sittliche Ordnung, die in Afrika fehlt und im Orient sich abzeichnet, wird mit dem Feldzug der Griechen nach Europa geholt und gleichzeitig erst erschaffen.
Regsamkeit und Reflexion
Während die Grenze zwischen Geschichte und Geschichtslosigkeit in den Geschichtsvorlesungen zwischen Afrika und den gemäßigten Zonen gezogen wird, um sich dann Richtung Westen zu verschieben, wird die Geschicht-lichkeit des Geistes in der Phänomenologie vom Ungeschichtlichen der orga-nischen Natur unterschieden. Die Weltgeschichte ist, im Unterschied zur organischen Natur, das gegenständliche Dasein der vielfältigen Entwick-lungsformen des Bewusstseins:
»Aber die organische Natur hat keine Geschichte; sie fällt von ihrem Allgemeinen, dem Leben, unmittelbar in die Einzelnheit des Daseyns herunter, und die in dieser Wirklichkeit vereinigten Momente der einfachen Bestimmtheit und der einzelnen Lebendigkeit bringen das Werden nur als zufällige Bewegung hervor, worin jedes an seinem Theile thätig ist und das Ganze erhalten wird, aber diese Regsamkeit ist
�—�—�—�—�—�— Historische geht, spricht Hegel emphatisch von der �›Heimatlichkeit des Geistes�‹. Es gilt nun, ganz zu Hause zu sein, �›zufrieden im sich, nicht hinaus, hinüber�‹. Konstitutiv für die Lebendigkeit des Geistes ist nicht mehr die Fremdartigkeit in sich, sondern das Bei-Sich-zu-Hause-Sein, nicht die Fremde, sondern das Haus.« (Han, »Hegel und die Frem-den«, S. 220)
141 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 314 142 Ebd., S. 315
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 69
für sich selbst nur auf ihren Punkt beschränkt, weil das Ganze nicht in ihm vorhan-den, weil es nicht als Ganzes hier für sich ist.«143
Der Unterschied zwischen Geist und Geistlosigkeit wird an dieser Stelle nicht mit der Differenz zwischen Bewegung und Stillstand erklärt, sondern vielmehr mit der Differenz zwischen einer Bewegung, welche eine Ord-nung hervorbringt, und einer, welche zufällig und ziellos bleibt. Die orga-nische Natur bringt im Gegensatz zur Geschichte lediglich Bewegungen hervor, welche in Einzelheiten zerfallen. Die Ganzheit, welche darin er-halten bleibt, verdankt sich dem Wirken jedes einzelnen Teils, dem das Wissen des Gesamten allerdings fehlt. Darum kann die Natur, welche sich nicht in ihrer Allgemeinheit wahrnehmen kann, als Ganzheit nur vom Standpunkt des Bewusstseins aus erkannt werden. Das Werden der organi-schen Natur bleibt ohne Ausrichtung auf ein Ganzes, auch wenn die ein-zelnen Bewegungen ein Ganzes ergeben. Für die organische Natur bedeu-tet dies, dass sie sich, weil sie über kein Bewusstsein und damit über keine Möglichkeit der Erkenntnis ihrer selbst verfügt, nicht zum Ganzen verhal-ten kann. Damit wird neben der Differenz von Bewegung und Stillstand, die den Geist vom Geistlosen trennt, auch eine Qualität der Bewegung erkennbar, welche die Geschichte als »ein zum Ganzen sich ordnendes Leben des Geistes«144 von der orientierungslosen Regsamkeit der organi-schen Natur unterscheidet. Der Unterschied zwischen Natur und Geist lässt sich als Differenz zwischen der Bewegung der Reflexion und der Regsam-keit des Unreflektierten fassen. Die bewegte Natur als �›Regsamkeit�‹ ist eine zufällige und bewusstlose Bewegung. Als solche weist sie Veränderungen auf, die nicht den Fortschritt eines sich selbst erkennenden Geistes dar-stellen, sondern die Reproduktion von Bedingungen, welche das Leben und nur dieses garantieren. Die Natur erscheint, wie Guha bemerkt, als »a world trapped in its own particularity«.145
Die Regsamkeit der Natur steht sowohl im Gegensatz zur Bewegung des denkenden Subjekts als auch zu den geordneten Manifestationen des Geistes in der Geschichte. Sie weist aber Ähnlichkeiten auf mit den Bewe-gungen, welche die geschichtslosen Völker vollziehen.
»Ohne Geschichte ist sein [des Volkes] zeitliches Dasein nur in sich blind und ein sich wiederholendes Spiel der Willkür in mannigfaltigen Formen. Die Geschichte
�—�—�—�—�—�— 143 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 165f. 144 Ebd., S. 165 145 Guha, History and the Limit of World-History, S. 33
70 G R E N Z F I G U R E N
fixiert diese Zufälligkeit, sie macht sie stehend, gibt ihr die Form der Allgemeinheit und stellt eben damit die Regel für und gegen sie auf.«146
Wie die organische Natur bleiben die Ereignisse eines geschichtslosen Volkes ohne Ordnung; sie lösen sich nicht aus der Zufälligkeit und bringen sein Werden wie die organische Natur nur als »zufällige Bewegung«147 hervor. Beide Repräsentationen des �›Ungeschichtlichen�‹ weisen ein unzu-reichendes Verhältnis zum Allgemeinen auf; beiden fehlt die Möglichkeit, Besonderheiten unter ein Allgemeines zu subsumieren und umgekehrt einen Begriff des Allgemeinen zu entwickeln, der sich aus seinen Beson-derheiten ergibt. Während die organische Natur �›von ihrem Allgemeinen abfällt�‹ und es durch ihr fehlendes Bewusstsein nicht erfassen kann, fehlt dem geschichtslosen Volk die »Form der Allgemeinheit«148, welche die Zufälligkeit seiner Bewegungen regulieren könnte. Dieser Mangel eines Begriffs des Allgemeinen wird auch am individuellen Bewusstsein festge-macht. »Der eigentümlich afrikanische Charakter ist darum schwer zu fassen, weil wir dabei ganz auf das Verzicht leisten müssen, was bei uns in jeder Vorstellung mit unterläuft, die Kategorie der Allgemeinheit.«149 Ohne die Kategorie des Allgemeinen kann ein Bewusstsein allerdings zu keiner Aufhebung kommen; es kann nur um sich selbst kreisen. Es weist, wie die bewusstlosen Bewegungen der Natur, eine �›Regsamkeit�‹ auf, die aber nicht Reflexion werden kann. Jede Empfindung eines Höheren, von der es ge-streift werden könnte, fällt aufgrund der fehlenden Kategorie des Allge-meinen ins Leere. »Das Höhere, welches sie [die Neger] empfinden, halten sie nicht fest; dasselbe geht ihnen nur flüchtig durch den Kopf.«150
Der Gegensatz, den die organische Natur und die Weltgeschichte in der Phänomenologie bilden, wird in den Geschichtsvorlesungen in geographische und kulturelle Differenzen übersetzt. Der Unterschied zwischen der Bewusstlo-sigkeit der Natur und der Ordnung der Geschichte aber manifestiert sich in der Figur des Afrikaners, der als Grenzfigur des Geistes und der Natur auftritt. Er verkörpert das Paradox einer möglichen Grenze zwischen der Regsamkeit der organischen Natur und der Reflexion des Geistes, indem er als ein Bewusstsein auftritt, das ohne Entwicklung bleibt. Er teilt mit der Natur die Regsamkeit, die nicht Reflexion ist, und das fehlende Verständ-
�—�—�—�—�—�— 146 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 204 147 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 166 148 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 204 149 Ebd., S. 121f. 150 Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, S. 60
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 71
nis des Allgemeinen, aber mit dem Menschen teilt er das Bewusstsein und einen Status der Menschlichkeit, der ihm kontinuierlich zu- und abgespro-chen wird.151
Der falsche Zauber Afrikas und die Zauberkraft der Negation
Die Position eines Bewusstseins, das sich noch in der Regsamkeit der Na-tur und gleichzeitig an der Schwelle zur Reflexion befindet, wird von Hegel am Beispiel des afrikanischen Zauberers dargestellt. Der Zauberer verfügt über ein Bewusstsein, das die erste Negation vollzieht, indem es sich gegen die Natur setzt. In dieser ersten Bewegung, in der sich das Bewusstsein entzweit, der Kreis der Reflexion sich aber noch nicht schließt, bleibt sein Bewusstsein stehen. Er wird zur statischen Version eines Anfangs der Re-flexion, der Anfang bleibt. Hegels Ausführungen lassen es offen, ob der Zauberer eine bestimmte Figur in der afrikanischen Gesellschaft darstellt oder ob jeder Afrikaner als Zauberer zu gelten hat. Es heißt aber, dass schon Herodot die Afrikaner als Zauberer beschrieben habe.152 Mit der Vorstellung, dass Herodot in Afrika auf dieselbe Zauberei gestoßen ist, die auch Hegel vorfindet, wird die ahistorische Position des Afrikaners erneut reproduziert. Die Zeitspanne zwischen der griechischen Antike und der europäischen Moderne, die sich zwischen Herodot und Hegel auftut, fällt im Hinblick auf Afrika zusammen. Beide, Herodot und Hegel, stehen vor demselben unveränderten Phänomen der afrikanischen Zauberei. Diese besteht darin, dass »der Mensch die höchste Macht ist, daß er sich allein befehlend gegen die Naturmacht verhält«.153 Wie aber kommt der Zaube-rer zu seiner Vorstellung der Allmacht? Hegels Antwort erstaunt: Indem er seine Dependenz von der Natur erfährt und seine Abhängigkeit um-kehrt.154 Diese Umkehrung der Machtverhältnisse aber bestimmt Hegel als Zauberei.
�—�—�—�—�—�— 151 Allerdings bleibt auch diese Grenzbestimmung nicht ohne Wiederkehr. So wird etwa der
Inder als unfähig bestimmt »einen Gegenstand in verständigen Bestimmungen festzu-halten, denn dazu gehört schon Reflexion« (Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Ge-schichte, S. 197).
152 Ebd., S. 122 153 Ebd. 154 Derrida weist auf die Widersprüchlichkeit dieser Figur des Afrikaners hin, der erst als
natürliches Bewusstsein vorgestellt wird und dann von der Natur beherrscht werden
72 G R E N Z F I G U R E N
»Obgleich [die Neger] sich der Abhängigkeit vom Natürlichen bewußt sein müs-sen, denn sie bedürfen des Gewitters, des Regens, des Aufhörens der Regenzeit, so führt sie dieses doch nicht zum Bewußtsein eines Höheren; sie sind es, die den Elementen Befehle erteilen, und dies eben nennt man Zauberei.«155
Was für eine Bewegung des Bewusstseins stellt dies dar? Es kann keine Reflexion sein, denn dabei würde sich der afrikanische Zauberer durch die Vermittlung der Natur erkennen �– ein Schritt, den er gerade nicht voll-zieht. Ohne eine Kategorie des Allgemeinen kann er die Abhängigkeit von der Natur, die er erfährt, nicht in die Vorstellung einer höheren Macht übersetzen; weder Gott noch die Natur noch ein anderer allgemeiner Begriff stehen ihm zur Verfügung, um seine Dependenz begreifbar machen zu können. Dies führt dazu, dass der afrikanische Zauberer seine Abhängigkeit von der Natur umkehrt und der Natur Befehle zu erteilen beginnt. Wir erfahren nicht, wie es zu dieser Umkehrung kommt, und es bleibt in der Tat die Frage, ob die Erfahrung der Abhängigkeit und ihre Umkehrung nicht auf eine komplexere Operation des Bewusstseins hin-weisen. Wie kann der Zauberer seine Abhängigkeit von der Natur erken-nen und dieses Verhältnis radikaler Dependenz in einem Akt der Zauberei umkehren, ohne gleichzeitig den Gegensatz von Mensch und Natur zu transformieren?
Hegel führt an dieser Stelle, an der die eigenartige Beschaffenheit dieses Bewusstseins veranschaulicht werden soll, das nicht in die Reflexion ein-tritt und dennoch einen komplexen Bewusstseinsprozess zu vollziehen scheint, das Konzept des Fetischs ein. Der Begriff des Fetischs geht auf ein portugiesisches Wort zurück, das ab dem 16. Jahrhundert von europäi-schen Seefahrern zur Bezeichung sakraler Objekte in Westafrika benützt worden ist. Anfangs des 19. Jahrhunderts fand es weite Verbreitung in den aufgeklärten Zirkeln Westeuropas.156 William Pietz schreibt dazu: »The discourse of the fetish has always been a critical discourse about the false objective values of a culture from which the speaker is personally dis-tanced.«157 Mit der Distanz zwischen dem europäischen und dem afrikani-
�—�—�—�—�—�— soll. »Etrange interprétation: on vient de nous dire que le nègre se confond avec la na-ture et on va dans un instant nous apprendre que la nature le domine.« (Derrida, Glas, S. 232)
155 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 123 156 Für eine ausführliche Genealogie des Konzepts des �›Fetischs�‹ siehe Pietz, »The Problem
of the Fetish I«; ders., »The Problem of the Fetish II «; ders., »The Problem of the Fetish IIIa «; ders., »Fetishism and Materialism«.
157 Pietz, »The Problem of the Fetish I«, S. 14
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 73
schen Bewusstsein, die der Begriff des Fetischs erzeugt, gelingt es Hegel nicht nur, die �›Falschheit�‹ der afrikanischen Religion aufzuzeigen. Vielmehr wird der afrikanische Zauberer, der in der immergleichen Bewegung des Bewusstseins verharrt, zum impliziten Gegenstück jenes Bewusstseins, das in der Phänomenologie die Stufen der Reflexion durchschreitet und dabei die �›Zauberkraft der Negation�‹ erfährt. In gewissem Sinne tritt an dieser Stelle Zauberer gegen Zauberer an, wobei der Fetisch, der sich auf der Seite des Afrikaners befindet, die Zauberkraft des Europäers sicherzustellen scheint: Ist der afrikanische Fetisch in diesem Sinne Hegels (negierter) Fetisch?158
Der Fetisch wird von Hegel als Objekt bestimmt, mit dessen Hilfe der afrikanische Zauberer seine falsche Macht über die Natur aufrechterhalten kann. Ohne das Vorhandensein eines Gegenstandes, der diese Macht �›ma-terialisiert�‹, würde sie sich verflüchtigen. Weil die Natur sich nämlich nicht der Macht des Zauberers unterwirft, wird dieser ständig der Erfahrung ausgesetzt, dass sein Allmachtsanspruch scheitert. Dies könnte dazu füh-ren, dass er seine falsche Annahme aufgibt und in ein neues Verhältnis zur Natur tritt. Genau dieser Schritt aber bleibt ihm versagt, weil der Fetisch die Kraft des Geistes an die Materie zurückbindet. Dies entspricht, wie Pietz bemerkt, der Vorstellung der »untranscended materiality of the fetish: �›matter�‹, or the material object, is viewed as the locus of religious activity or psychic investment«.159 Der Zauberer lokalisiert also seinen mentalen Zu-stand der Allmacht in einem Objekt, dem Fetisch. Diese Ausrichtung des Bewusstseins auf einen materiellen Gegenstand könnte, führt Hegel aus, zur Folge haben, dass eine erste Selbständigkeit gegen das Individuum auftritt. Dies ereignet sich beim fortschreitenden, nicht aber beim stagnie-renden Bewusstsein:
»Hier im Fetische scheint nun zwar die Selbständigkeit gegen die Willkür des Indi-viduums aufzutreten, aber da eben diese Gegenständlichkeit nichts anderes ist als die zur Selbstanschauung sich bringende individuelle Willkür, so bleibt diese auch Meister ihres Bildes.«160
Der afrikanische Zauberer befindet sich vor dem Fetisch in einer Spiegel-situation. Denn das Objekt, vor dem er sich befindet, ist dadurch be-stimmt, dass sich seine Materialität nicht selbständig zeigen, sondern nur �—�—�—�—�—�— 158 Homi Bhabha deutet den Fetischismus als koloniale Strategie (Bhabha, Die Verortung der
Kultur, S. 109). Zum Begriff des Fetischs bei Hegel vgl. auch Gilman, »The Figure of the Black«, S. 142; Derrida, Glas, S. 232.
159 Pietz, »The Problem of the Fetish II«, S. 23 160 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 123
74 G R E N Z F I G U R E N
als Ausdruck eines individuellen Willens erscheinen kann, der sich im Ob-jekt erblickt. Der Fetisch dient dem Bewusstsein als Spiegel, diese Spiege-lung aber unterscheidet sich gerade von der Reflexion, durch die sich das Bewusstsein durch das Andere auf sich selbst hin transzendieren kann. Während der Gegenstand in der Phänomenologie sich dem Bewusstsein in seiner Selbständigkeit zeigen und es damit aus seiner Erstarrung lösen kann, wird dem Fetisch gerade diese Fähigkeit abgesprochen.
Damit bleibt Hegel Meister seiner Zauberei: Durch den Fetisch kann er dem afrikanischen Zauberer jene Transformation absprechen, die das Be-wusstsein in der Phänomenologie beim Anblick eines Gegenstandes erfährt. Das Verhältnis des Zauberers zum Fetisch manifestiert sich nämlich im Unterschied und als Unterschied zum Verhältnis, das zwischen Bewusst-sein und Gegenstand in der Phänomenologie entsteht.161 Dem Fetisch als Veräußerung der eigenen Allmacht wird die Kraft der Vermittlung ge-nommen, die dem Objekt-Anderen zukommt. Wenn der afrikanische Zau-berer seine Macht im Fetisch betrachtet, vollzieht er damit nicht die dia-lektische Bewegung, mit der er sich im Anderen verliert, um durch dessen Verlust wieder zu sich zurückzukehren. Vielmehr bleibt er, indem er �– ohne die Differenz eines Sich-im-Anderen-Erkennens �– im Anderen immer nur sich selbst erkennt und damit nicht zum Anderen und das Andere nicht zum Vermittelnden wird, in einer Kreisbewegung gefangen. Die negierende und vermittelnde Kraft des Objekts als Anderes kann sich nicht entfalten, weil das Andere auf das Selbst reduziert bleibt. Dieser geschlos-sene Zirkel wird nur unterbrochen, wenn sich die Macht des Zauberers erschöpft. Wird ein Befehl, welcher der afrikanische Zauberer an die Natur gibt, nicht befolgt, zerstört er den Fetisch, um sogleich einen neuen zu kreieren. Dabei verschiebt der Zauberer den Akt der Zerstörung, der sich an seiner Vorstellung ereignen müsste, auf die Außenwelt. Er tritt an die Stelle des Anderen, übernimmt dessen negierende Kraft, übersetzt sie vom Geistigen ins Physische und zerstört den Fetisch. Die Konfrontation des Zauberers mit einer Außenwelt, welche sich ihm als Anderes aufdrängt und seine Allmachtsvorstellung zerstören könnte, findet nicht statt. Sein Allmachtgefühl wird nicht negiert. Vielmehr wird der Fetisch vom Zeichen
�—�—�—�—�—�— 161 Vgl. z. B.: »Hiedurch also, daß wir die Bestimmtheit allgemeines Medium zu seyn, als
unsre Reflexion betrachten, erhalten wir die Sichselbstgleichheit und Wahrheit des Din-ges, Eins zu seyn.« (Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 76) Interessant an dieser Passage ist auch die Identifikation der erzählenden Position mit dem wahrnehmenden Bewusst-sein.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 75
der Allmacht zum Zeichen des Versagens, das an Stelle der Allmachtsvor-stellung vernichtet werden kann. Durch die Wiederholung dieses Vor-gangs, indem er Fetisch um Fetisch zerstört und ersetzt, bleibt der afrikani-sche Zauberer im Zirkel seiner Allmacht gefangen. Seine Unfähigkeit, etwas (an)zuerkennen, das sich außerhalb seiner Macht befindet, zwingt ihn zur Repetition des immergleichen Kreises. Hegels Ausführungen lassen allerdings viele Fragen offen: Warum glaubt das Bewusstsein des Zaube-rers, das sich doch seiner Abhängigkeit von der Natur bewusst ist, diese befehligen zu können? Was für ein Verhältnis erstellt der Zauberer zum Fetisch, damit dieser zum Zeichen der eigenen Macht werden kann? Er-scheint der Fetisch nicht zumindest dann, wenn er versagt, in einer gewis-sen Selbständigkeit gegen das Individuum: Wie sonst könnte er zerstört werden? Und: Worin besteht die Funktion eines solchen Bewusstseins, das die Erfahrung der Zerstörung verweigert, für Hegels Phänomenologie des Bewusstseins?
Als Bewusstsein, welches das »Selbsterkennen im absoluten Anders-seyn«162 nicht wagt und stattdessen an der �›Positivität�‹ seiner Vorstellung festhält, kann die Figur des afrikanischen Zauberers auch in der Phänome-nologie ausgemacht werden. In einer Passage, welche gerade die »Zauber-kraft«163 der Negation behandelt, taucht ein solches Bewusstsein als Ge-genfigur zum dialektischen Bewusstsein auf, als Kreis nämlich, der �›in sich geschlossen ruht�‹.
»Die Thätigkeit des Scheidens ist die Krafft und Arbeit des Verstandes, der verwun-dersamsten und größten, oder vielmehr der absoluten Macht. Der Kreis, der in sich geschlossen ruht, und als Substanz seine Momente hält, ist das unmittelbare und darum nicht verwundersame Verhältniß.«164
Die Negation, auf die die Arbeit des Verstandes zurückgeht, ist, so erfah-ren wir, die absolute und �›verwundersamste�‹ Macht. Sie ist, im Gegensatz zum falschen Glauben an die eigene Allmacht des afrikanischen Zauberers, diejenige Macht, die wirkliche �›Wunder�‹ hervorbringt. Der Zirkel aber, den der afrikanische Zauberer zwischen sich und dem Fetisch erstellt, erbringt falsche Wunder. Er entspricht dem �›verwundersamen Verhältnis�‹ eines Bewusstseins als Kreis, der in sich geschlossen ruht. Die Macht, die in der
�—�—�—�—�—�— 162 Ebd., S. 22 163 Ebd., S. 27 164 Ebd.
76 G R E N Z F I G U R E N
Selbstaffirmation verharrt, muss darum von der Macht der Negation unter-schieden werden.
»Diese Macht ist er [der Geist] nicht, als das Positive, welches von dem Negativen nur wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, diß ist nichts oder falsch, und nun, damit fertig, davon weg zu irgend etwas anderem übergehen; sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bey ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Seyn umkehrt.«165
Der afrikanische Zauberer wird zum ausgestalteten Bild jenes Bewusst-seins, das sich dem falschen Zauber des Positiven hingibt und damit in einen Gegensatz zum Bewusstsein der Reflexion tritt. Dieses schaut dem Negativen ins Angesicht, der afrikanische Zauberer hingegen erhält das Positive mit Hilfe des Fetischs. Er, der seine Allmachtsvorstellung nicht zerstören will, sieht �›vom Negativen nur weg�‹ und geht �›damit fertig, davon weg zu irgend etwas anderem [�– zu einem anderen Fetisch?] über�‹. Er vermag es nicht, im Negativen zu verweilen und dadurch in die Bewegung des Geistes einzutreten. Durch sein Verharren im Positiven bleibt er unbe-rührt von jener Zauberkraft, die ihn in das �›Sein umkehren�‹ würde. Diese Form der Zauberei und diese Weise des Seins bleiben demjenigen Bewusst-sein vorbehalten, das sich in die Reflexion begibt. In der Phänomenologie erscheinen beide Figuren des Bewusstseins, diejenige, welche im Positiven verharrt, und jene, welche die Zauberkraft der Negation erfährt, scheinbar ohne kulturellen und geographischen Bezug. Auf dem Hintergrund der Geschichtsvorlesungen aber lassen sie sich kontextualisieren. In der Bewegung des Bewusstseins, das sich vom statischen, natürlichen, um-sich-selbst-kreisenden Bewusstsein abstößt und in die Reflexion begibt, kann nicht nur die Initiation des Geistes, sondern auch seine Geo-graphie, sein Ein-schreiben in die Welt, ausgemacht werden.166
�—�—�—�—�—�— 165 Ebd. 166 Gayatri Chakravorti Spivak spricht von Geo-Graphie als dem imperialen Gestus des
»writing the world« (Spivak, A Critique of Postcolonial Reason, S. 30).
2. Der Tod des Subjekts und die Grenzen der sittlichen Welt »[E]in anderes Geschäfte wünschte ich auch endlich vorzunehmen und auszufüh-
ren, nämlich eine Frau zu nehmen oder vielmehr zu finden!! Was sagen Sie dazu? Wäre nur die beste Frau hier, ich würde nicht ruhen, sie zu bitten, daß sie sich dazu
verstünde, mir eine zu verschaffen; denn zu jemand anderem hätte ich dies Zu-trauen nicht, am wenigsten zu mir selber. �–« Hegel an Immanuel Niethammer, 4. Oktober 1809
Das vorhergehende Kapitel zeichnet nach, wie der Anfang des Subjekts mit Hilfe von Figuren gedacht wird, die als �›Rest�‹ der hegelschen Dialektik erscheinen; Figuren wie das Tier, das natürliche Bewusstsein oder der afri-kanische Zauberer. Mit Afrika erhält der Anfang der Menschheit einen Ort, und gleichzeitig wird die Menschheit von diesem Anfang unterschie-den. Hegels Afrikaner erinnert daran, dass der Mensch einmal beinahe Natur war, und er zeigt zugleich auf, dass ein Mensch, der noch in der Natur befangen ist, nicht als Mensch gelten kann. Er repräsentiert eine Figur des Anfangs, die im Unterschied zum eigentlichen Subjekt, das als �›europäisches�‹ Subjekt erkennbar wird, nicht über diesen Anfang hinweg-kommt. Er stellt dasjenige dar, was überwunden worden ist, was das mo-derne Subjekt nicht mehr ist und nicht mehr werden wird. Die Unmög-lichkeit, den Anfang des Geistes zu bestimmen, und die konstitutive Be-deutung desjenigen, was als Anfang zurückgelassen wird, führt allerdings zu seiner ständigen Rückkehr. Gerade weil das afrikanische Bewusstsein einen Rest der Dialektik darstellt, der aus der Systematik des Geistes her-ausfällt und diese zugleich mitkonstituiert, treffen auf ihn jene Kriterien nicht zu, welche für die �›Protagonisten�‹ des Geistes gelten. Während deren Entwicklungen im Text enfaltet werden, tauchen die Reste der Dialektik an unsystematischen Orten und in widersprüchlichen Konstellationen wieder auf.
Anders als die kulturelle Differenz wird die Geschlechterdifferenz in der Phänomenologie explizit thematisiert. In Hegels Ausführungen zur Sitt-lichkeit, welche den ersten Teil des Geist-Kapitels ausmachen, erscheint Geschlecht als strukturierendes Element der sittlichen Welt.167 Das schein-
�—�—�—�—�—�— 167 Alle folgenden Referenzen zur �›Sittlichkeit�‹ beziehen sich auf den Teil VI.A der Phäno-
menologie.
78 G R E N Z F I G U R E N
bar geschlechtslose Subjekt der Phänomenologie wird auf diese Weise als männliches Subjekt erkennbar.168 Welche Bedeutung aber kommt der europäischen Frau dabei zu? Welche Funktion hat sie für die Herstellung einer sittlichen Ordnung, welche für die Formation eines männlichen bür-gerlichen Subjekts? Ihre wichtigste Tätigkeit, so heißt es in der Phänomenolo-gie, leistet sie im Hinblick auf den Tod. Wenn der Tod, wie ich im Folgen-den vorschlage, die Wiederkehr desjenigen darstellt, was mit dem Beginn des Denkens zurückgelassen wird �– die Bewusstlosigkeit der geistlosen Natur �–, dann eröffnet die Frau die Möglichkeit, dieses gefährliche Außen zugleich zu kontrollieren und seine Grenze zur sittlichen Welt aufrechtzu-erhalten.
Der Tod und die Wiederkehr des Außen
In der Phänomenologie wird dargelegt, dass die Sittlichkeit aus dem Gegen-satz zwischen göttlichem und menschlichem Recht entsteht. Dieser mani-festiert sich innerlich als Unterschied zwischen der weiblichen und der männlichen Subjektposition und äußerlich als Gegensatz von Familie und sittlichem Gemeinwesen, einer frühen Form des Staates. Das sittliche Ge-meinwesen ist darauf ausgerichtet, individuelle Bedürfnisse und Besitzver-hältnisse mit dem Anspruch des Staates zu vermitteln. Die menschlichen Gesetze, die zu diesem Zweck aufgestellt werden, verbinden die Bedürf-nisse des einzelnen Bürgers mit dem Wohl des Allgemeinen. Sie legen
�—�—�—�—�—�— 168 Die männliche Bestimmung des Subjekts kommt auch in der Vorrede der Phänomenologie
zur Sprache: »So durchlaufft jeder einzelne auch die Bildungsstuffen des allgemeinen Geistes, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten, als Stuffen eines Wegs, der aus-gearbeitet und geebnet ist; wie wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in frühern Zeit-altern den reifen Geist der Männer beschäfftigte, zu Kenntnissen, Uebungen und selbst Spielen des Knabensalters herabgesunken sehen, und in dem pädagogischen Fortschrei-ten die wie im Schattenrisse nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen werden.« (Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 25) Der Knabe eignet sich das Wissen sei-ner Vorväter an, ohne mit den Schwierigkeiten zu ringen, welche jene beschäftigt hatte. Indem der Knabe das Dasein seiner Vorväter durchläuft, verinnerlicht er es: Die Ge-schichte wird zur kontinuierlichen Aufhebung des Vaters durch den Sohn. Die Ent-wicklung des Geistes folgt einer Substitutionslogik, in welcher der Sohn seinen Vater be-ständig überschreitet. Die Geschichte beschreibt, wie Derrida bemerkt, den kontinuierli-chen Tod des Vaters im Sohn: »La vie de l�’esprit comme histoire est la mort du père dans son fils.« (Derrida, Glas, S. 41)
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 79
verbindliche Regeln und Rechte fest, die der Einzelne zu befolgen hat, die aber gleichzeitig seinen Besitz schützen und garantieren.169 Während das sittliche Gemeinwesen als Bereich definiert wird, in dem die Ansprüche des Einzelnen mit denjenigen des Allgemeinen vermittelt und damit Grundlagen für die Freiheit des Einzelnen geschaffen werden, steht die Familie in einem negativen Bezug zum Sittlichen. Sie ist die Sphäre, in der die individuellen Bedürfnisse nach Macht und Besitz vorherrschen. »Der der Familie eigenthümliche, positive Zweck ist der Einzelne als solcher«.170 Ihre Bedeutung für das Sittliche erhält die Familie damit nur als Bereich, den das Subjekt überschreiten und verlassen muss, um sittlich zu werden. Der Eingang in die Sittlichkeit vollzieht sich als Ablösung von der Familie, aus der das Subjekt �›herausgesetzt�‹ wird. Das sittliche Gemeinwesen »besteht darin, den Einzelnen aus ihr [der Familie] herauszusetzen, seine Natürlich-keit und Einzelheit zu unterjochen, und ihn zur Tugend, zum Leben in und fürs Allgemeine zu ziehen«.171 Die Familie erscheint als interne Schwelle der Sittlichkeit, die vom Subjekt überschritten werden muss, bevor es Bür-ger und damit »wirklich und substantiell«172 werden kann.
Neben dieser negativen Funktion der Familie als Bereich des Vor-Sittli-chen ist in der Phänomenologie allerdings von einer einzigen sittlichen Tat der Familie die Rede.173 Eine einzige Handlung vollzieht die Familie nicht nur am Einzelnen, sondern am Einzelnen im Namen des Ganzen und darum als sittliche Handlung. Diese aber »betrifft nicht mehr den Lebenden, son-dern den Todten«.174 Der Tod nämlich erweist sich als die Arbeit der »natür-liche[n] Negativität [�…], worin das Bewußtseyn nicht in sich zurück-kehrt«.175 Es wird durch den Tod daran gehindert, jene formative Bewe-gung der Reflexion aufrecht zu halten, durch die es zur Existenz gelangt.
�—�—�—�—�—�— 169 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 245 170 Ebd., S. 243 171 Ebd. 172 Ebd., S. 244 173 Die Vorstellung, dass die einzige sittliche Tat der Familie im Totendienst bestehe, ist
spezifisch für die Phänomenologie. In späteren Werken, z. B. der Rechtsphilosophie, gibt Hegel der Familie eine umfassendere Bedeutung für die Konstitution des sittlichen Staates. Angelpunkt dieses späteren Konzepts ist die Liebe, welche in der Phänomenologie gerade nicht als sittlich erachtet wird (ebd., S. 243). Im Gegensatz dazu erhält die Liebe in den Grundlinien der Philosophie des Rechts eine vermittelnde Kraft, durch die sich das Subjekt nicht als vereinzeltes Wesen, sondern als Mitglied einer familiären Einheit er-fährt (vgl. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 149).
174 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 244 175 Ebd.
80 G R E N Z F I G U R E N
Mit dem Tod wird das Subjekt ins »reine Seyn«176 geholt, in dem die Ver-mittlung des Denkens zur Ruhe kommt und mit der bewusstlosen Natur zusammenfällt.177 Mit dem Tod tritt etwas ein, was der Staat nicht regeln kann; das Subjekt wird von einem Werden ergriffen, das nicht Bewusstsein, von einem Allgemeinen, das nicht sittlich, und einem Sein, das nicht ver-mittelt ist. Dieser Tod besteht nicht in der Negation des Seins durch das Denken, welche in ein anderes Sein umschlägt, sondern im reinen Sein, welches der Bewegung des Denkens Abbruch tut. Er nimmt das Subjekt aus der Tätigkeit des Bewusstseins, durch die es sich formiert, und reißt es in einen Zustand vor der Reflexion, vor dem Denken und vor der Mensch-lichkeit. Mit diesem Tod kommt die Gefahr eines Rückfalls in jenen be-wusstlosen Bereich ins Spiel, zu dem es keine Rückkehr geben darf. (Wir können uns an dieser Stelle und in Form eines kurzen Einschubes fragen, wie denn diejenigen Menschen sterben, welche niemals Bürger sein kön-nen, denn der Tod, so wie er von Hegel erläutert wird, bezieht sich nur auf den Bürger; er allein ist seiner Zerstörung ausgesetzt. Das führt zur Frage, ob die Frauen und die Kinder, aber auch die Wilden und natürlichen Men-schen, die über keine Sittlichkeit verfügen, oder Juden und Fahrende, die nicht Bürger des sittlichen Staates werden können, sich nicht für den Tod qualifizieren? Geht ihr Tod im hegelschen System vergessen, weil er keinen Unterschied macht, welcher für die Sittlichkeit von Bedeutung wäre, weil sie nicht tot sein können oder weil sie auf eine gewisse Weise immer schon tot sind?)
Die Gefahr des Rückfalls in die Bewusstlosigkeit, die der Tod mit sich bringt, kommt zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt ins Spiel, dann näm-lich, wenn der Mensch sich eine äußere, institutionelle und gegenständliche Welt erschafft, mit der er sich von der Natur absetzen kann. In der Sitt-lichkeit tritt sich der Geist als äußere Wirklichkeit gegenüber, welche »alle Bedeutung eines Fremden, so wie das Selbst alle Bedeutung eines von ihr getrennten, abhängigen oder unabhängigen Fürsichseyns verloren hat«.178
�—�—�—�—�—�— 176 Ebd. 177 Derrida betont die Verbindung zwischen dem Tod als Aufgabe der Familie und ihrer
Unmöglichkeit, an der dialektischen Produktivität teilzuhaben: »Si la chose de la famille, c�’est la singularité pure, on n�’appartient à une famille qu�’en s�’affairant autour du mort: toilette du mort, institution de la mort, veillée, monumentalisation, archive, héritage, généalogie, classification des noms propres, gravure sur les tombes, ensevelissement, sépulture, chant funèbre, etc. La famille ne connaît pas encore le travail producteur d�’universalité dans la cité, seulement le travail du deuil.« (Derrida, Glas, S. 162)
178 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 238f.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 81
Der Eintritt in die Welt bedeutet gleichzeitig die Herstellung einer dem Menschen vertrauten Welt. Hegels Ausführungen zur sittlichen Welt lassen sich an dieser Stelle mit Hannah Arendts Bestimmung der Welt als menschliches Zuhause in Verbindung bringen: »In dieser Dingwelt ist menschliches Leben zuhause, das von Natur in der Natur heimatlos ist; und die Welt bietet Menschen eine Heimat in dem Maße, in dem sie menschliches Leben überdauert, ihm widersteht und als objektiv-gegen-ständlich gegenübertritt.«179 Das von Arendt beschriebene Paradox des menschlichen Lebens, �›das von Natur in der Natur heimatlos ist�‹, liest sich wie eine Kurzformel für das anhaltende Ringen Hegels, Natur und Geist auseinander zu halten. Diesem Ringen liegt ein paradoxer Naturbegriff zugrunde, denn die Natur des Geistes zwingt diesen dazu, sich in der Natur fremd zu fühlen, und sich von ihr absetzen zu müssen (um sich, unter neuen Bedingungen, wieder mit ihr zu versöhnen). Die ersten Kapitel der Phänomenologie beschreiben mit der Entwicklung vom natürlichen Bewusst-sein zum vernünftigen Selbstbewusstsein interne Dimensionen dieses Kon-flikts. Mit der Sittlichkeit beginnt das Subjekt, die Welt als eine äußere �– von der inneren nicht zu trennende �– Wirklichkeit hervorzubringen, in der seine Beziehung zu anderen Subjekten und zu Objekten konstituiert und reguliert wird.
In diesem Prozess, in dem der Geist sich von der äußerlichen Natur absetzt, indem er sie sich in der sittlichen Welt aneignet, tritt der Tod als ein Problem auf. Wenn sich das Subjekt in der Reflexion des Bewusstseins formiert, dann bedeutet der Tod, der das »unmittelbare natürliche Geworden-seyn, nicht das Thun eines Bewußtseyns«180 darstellt, das Ende dieser Bewe-gung und damit das Ende des Subjekts. Die formative Kraft der Reflexion, als die sich das Subjekt hervorbringt, findet mit dem Tod ein jähes Ende. Das Subjekt wird vom bewusstlosen Werden der Natur ergriffen und droht, wieder zur Natur zu werden. Ein solcher Tod als die »natürliche Ne-gativität«181 unterscheidet sich radikal von jenem Tod, der als die Macht des Negativen bestimmt wird und den das Subjekt im Zuge des Denkens erfährt.182 Während die �›Macht des Negativen�‹ das Subjekt erneut in das Sein wendet, wird es durch die �›natürliche Negativität�‹ in die Regsamkeit der organischen Natur zurückgeworfen, und damit in jene bewusstlose
�—�—�—�—�—�— 179 Arendt, Vita Activa, S. 14 180 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 244 181 Ebd., S. 244 182 Ebd., S. 27
82 G R E N Z F I G U R E N
Bewegung, von der sich die Reflexion gerade unterscheidet. Die Welt, welche die Menschen geschaffen und gegen die unreflektierte Natur ge-stellt haben, droht mit einem Male dort zu enden, wo die Bewegung der Reflexion aufhört und der passive Körper des Subjekts nicht mehr von der vernunftlosen Natur unterscheidbar ist. Die Warnung an das Subjekt, nicht in die »Wildniß und Nähe des tierischen Bewußtseyns«183 zurückzufallen, fällt im Falle des Todes ins Leere, denn das Subjekt als Bewegung der Re-flexion verschwindet mit seinem Tod. Das Problem dieser Rückkehr in die Wildnis scheint nicht die Möglichkeit eines Begehrens nach der Wildnis zu sein, sondern im Gegenteil die Möglichkeit, dass das Subjekt durch den Tod dem »Thun bewußtloser Begierde«184 ausgesetzt wird.185
Der Tod des Subjektes destabilisiert damit eine für die sittliche Welt konstitutive Grenze. Wenn das Menschliche durch die stetige Bewegung der Reflexion entsteht, dann droht der Tote zum Einbruch des Un-menschlichen zu werden, der sich mitten in der Welt ereignet. In dieser Welt, welche für den Menschen »alle Bedeutung eines Fremden [�…] verlo-ren hat«,186 wird der tote Körper des Bürgers zum Inbegriff der Fremdheit, die gerade von der Welt ferngehalten werden soll. Er markiert die Gefahr einer bewusstlosen Natur, welche die Grenzen zwischen der menschlichen Welt und ihrem Außen niederzureißen droht. Indem es gänzlich aus der Bewegung des Denkens fällt, befindet sich das tote Subjekt jenseits des �›natürlichen Menschen�‹, dessen Bewusstsein dem Einzelnen verhaftet bleibt, und jenseits des Tieres, welches sich in der Immanenz der Gefühls-welt bewegt. Der Bürger des sittlichen Gemeinwesens wird im Tod zum Objekt jener Kräfte, die er mit dem Herstellen der Welt erfolgreich von sich fernhalten konnte. Er wird »ein passives Seyn für anderes, aller niedrigen vernunftlosen Individualität und den Kräfften abstracter Stoffe preisgege-ben, wovon jene um des Lebens willen, das sie hat, diese um ihrer negati-�—�—�—�—�—�— 183 Ebd., S. 285 184 Ebd., S. 245 185 Der Begriff der Begierde ist ein anderer Grenzbegriff Hegels, der zwischen der Trieb-
struktur von Lebewesen und der Bewegung der Reflexion angesiedelt ist. An dieser Stelle verweist er auf die Begierde von Wesen, die bewusstlos sind, an anderer Stelle, etwa beim Recht der Begierde, das der Mann in der Familie besitzt, erscheint es als Prinzip der Individualität, das in einem (wenn auch �›natürlichen�‹) Rechtskontext erscheint und damit bereits vermittelt ist. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass die Begierde ein sinnliches Begehren beschreibt, das eine (verschiebbare) Grenze der Reflexion markiert, immer aber im Gegensatz zum sittlichen Allgemeinen steht, das die Überwindung der Begierde erfordert.
186 Ebd., S. 238f.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 83
ven Natur willen itzt mächtiger ist als er«.187 Die �›niedrige vernunftlose Individualität�‹ verfügt über keine Vernunft, aber im Gegensatz zum toten Subjekt über �›Leben�‹. Und die �›Kräfte abstrakter Stoffe�‹ sind ihrer �›negati-ven Natur willen�‹ dem Subjekt überlegen, welches ohne die Kraft des Den-kens die Bewegung der Negation nicht mehr vollziehen kann. Beide, die niedrige Individualität und die Kräfte abstrakter Stoffe, gewinnen Macht über dieses Subjekt, welches weder über das Leben noch über die Kraft der Negation verfügt und schon gar nicht mehr über die Kombination, die es als menschlich ausgezeichnet hat: über das geistige Leben durch die Kraft der Negation.
Folglich scheint auch die Prämisse der Überlegenheit des Denkens und des Denkenden, auf der die Entwicklung des Geistes beruht, in Frage ge-stellt. Wenn die Reflexion eine fortschreitende Bewegung ist, die sich in der Geschichte niederschlägt und in der sittlichen Welt manifestiert, wie kann das Subjekt dann dieser Bewegung entrissen und in die Regsamkeit der organischen Natur zurückgenommen werden? Die Trennung zwischen der Welt und der Natur droht, kaum ist sie erstellt, durch den Einbruch des Todes erneut außer Kraft gesetzt zu werden. Vernunftlose Wesen und abstrakte Kräfte können den Menschen nicht nur überwältigen, sondern auch die Gültigkeit der Grenze zerstören, welche das Subjekt in seinem Tod nicht mehr denken kann. Der Bezug auf das Denken ist an dieser Stelle ein doppelter, und der Tod ein doppeltes Entwenden dieses Bezugs: Das Denken unterscheidet den Menschen vom Widermenschlichen und vom Tier, aber der Mensch muss das Widermenschliche denken, um sich als von ihm Unterschiedenes denken zu können. Ein solches Verständnis des Menschlichen hat den Vorteil, dass es nicht an Inhalten festgemacht wird, sondern am Vollzug des Menschlichen selbst, welches in der Bewe-gung des Bewusstseins besteht. Dies impliziert aber auch, und darin liegt das Problem des natürlichen Todes, dass der Anspruch des Menschlichen mit dem Ende der fortschreitenden Bewegung des Denkens verfällt. Das tote Subjekt, das diese Bewegung nicht mehr vollziehen kann, fällt aus dem Menschlichen heraus. Der Bürger, vorher der Inbegriff des wirklichen und freien Selbstbewusstseins in der sittlichen Welt, wird als Toter zu einem Sein, das nicht mehr Bewusstsein ist. Damit macht er die radikale Verletz-barkeit der menschlichen Welt und die Durchlässigkeit der Grenzen deut-lich, welche diese Welt umgeben. Der Tod zwingt dazu, inmitten der sittli-
�—�—�—�—�—�— 187 Ebd., S. 245
84 G R E N Z F I G U R E N
chen Welt ein Subjekt zu denken, das aufhört, Subjekt zu sein und von der Natur nicht mehr zu unterscheiden ist.
Irigaray weist allerdings darauf hin, dass die Familie den Toten nicht nur vor der bewusstlosen Begierde und der natürlichen Negativität schützt, sondern vielleicht auch »vor seinem Verlangen nach ihr« bewahrt.188 Der Tote wird in einer solchen Lektüre nicht nur zum Moment, an dem sich der Verlust der Welt an die Natur ereignet, sondern auch zur gefährlichen Möglichkeit, die passive Hingabe an die Natur zu denken; ein Moment, das auch die Sehnsucht nach der Wildnis erneut hervorbringen könnte? Mit der Integration des Toten in die sittliche Welt durch die Familie könnte demnach ein Begehren gebannt werden, das durch das Denken des Todes erst geweckt wird: das Begehren, von vernunftlosen Anderen begehrt zu werden. Die Familie verhindert, dass das männliche Subjekt zum »pas-sive[n] Seyn für anderes«189 und dem »Thun bewusstloser Begierde«190 ausge-setzt wird, und sie hält die Vorstellung dieses anderen Begehrens aufrecht. Sie bewahrt die sittliche Welt vor einem Begehren, das sie zugleich bannt und am Leben erhält.
Die Bedeutung der Familie
Das Subjekt verschwindet mit seinem Tod aus der Tätigkeit des politischen Lebens und geht in das reine Sein ein. Das sittliche Gemeinwesen aber ver-sagt, wenn es um den Tod des Subjekts geht, dessen Tod »ohne Trost und Versöhnung«191 mit sich selbst bleibt. An dieser Stelle bedarf es der Fami-lie. Sie muss dafür sorgen, dass die Bewegung des Bewusstseins nicht ab-
�—�—�—�—�—�— 188 Irigaray, Speculum, S. 267. Darauf weist auch Derrida hin. Der Totendienst der Frau, so
schreibt er, besteht nicht darin, dass der physische Zerfall des Mannes verhindert und die unbewusste Kraft des Todes bekämpft werden müsse. Vielmehr sorge sie für die Verdrängung eines unbewussten Begehrens, welche unter dem Namen des Todes er-scheint. »S�’agit-il simplement de lutter ainsi contre une décomposition matérielle, contre une simple dissociation qui fait retourner l�’organique à l�’inorganique? La force contre laquelle travaille la pompe funèbre, est-ce, sous le nom de mort, une extériorité mé-canique et anonyme, physique, non consciente? L�’analyse serait banale. L�’opération féminine de la sépulture ne s�’oppose pas à l�’extériorité d�’une matière non consciente, elle réprime un désir inconscient.« (Derrida, Glas, S. 163f.)
189 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 245 190 Ebd. 191 Ebd., S. 244
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 85
reißt und der Tote innerhalb der Grenzen der Sittlichkeit gehalten wird. Die Pflicht der Familie besteht darin, dem Toten die Bewegung des Be-wusstseins hinzuzufügen, welche er selbst nicht mehr vollziehen kann, »damit auch sein letztes Seyn, diß allgemeine Seyn, nicht allein der Natur angehöre und etwas unvernünftiges bleibe«.192 Was aber ist die Familie, die im Folgenden als Serie von Konstellationen zwischen Bruder und Schwe-ster, Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kindern erscheinen wird, und in der es �– mit der Ausnahme von Antigone und Kreon �– keine Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins, Neffen und Nichten, Enkel und Großel-tern, Stiefväter und Stiefmütter, Adoptiveltern und Adoptivkinder zu ge-ben scheint, oder keine, die für das sittliche Subjekt von Bedeutung wären. Hegel beschreibt die Familie als der »bewußtlose, noch innre Begriff, seiner sich bewußten Wirklichkeit«.193 Der bewussten Seite des Sittlichen ent-spricht das Gemeinwesen, dessen Sitten und Gesetze die Freiheit der ein-zelnen Bürger garantieren und das zugleich das Wohl des ganzen Staates bewahren soll.194 Dieser öffentlichen Macht des �›menschlichen Gesetzes�‹ tritt in der Familie »eine andere Macht, das göttliche Gesetz, gegenüber«.195 Die griechische Antigone repräsentiert für Hegel die ideale Vertreterin dieses Gesetzes der Familie.196 Antigone, die aus der inzestuösen Verbin-dung zwischen Ödipus und Iokaste hervorgeht, tritt in Sophokles�’ gleich-namigem Drama der Weisung ihres Onkels Kreon, König von Theben, entgegen. Dieser verbietet ihr, ihren Bruder Polyneikes, der im Kampf gegen seinen Bruder Eteokles gefallen ist, zu begraben. Der Kampf zwi-schen Kreon und Antigone, der mit Antigones Tod, aber auch mit dem Untergang Kreons endet, repräsentiert für Hegel den sittlichen Konflikt zwischen menschlichem und göttlichem Recht. Dieser Konflikt muss, wie
�—�—�—�—�—�— 192 Ebd. 193 Ebd., S. 243 194 Ebd., S. 242 195 Ebd. 196 Vgl. dazu Butlers Kritik an Hegels Antigone als idealer Vertreterin des göttlichen Geset-
zes: »Stellt man Antigone und Kreon als gegensätzliche Kräfte von Verwandtschaft und Staatsmacht einander gegenüber, so vernachlässigt man völlig, wie Antigone sich bereits von den Verwandtschaftsbeziehungen gelöst hat; man übersieht, wie Antigone, selber Kind aus einer inzestuösen Verbindung und ihrerseits einer unmöglichen und todge-weihten inzestuösen Liebe zu ihrem Bruder verfallen, mit ihrem Handeln andere zwingt, sie als �›männlich�‹ zu sehen, und wie damit die Art und Weise zweifelhaft wird, in der Verwandtschaftsbeziehungen Geschlechteridentitäten stützen können«. (Butler, Antigones Verlangen, S. 19)
86 G R E N Z F I G U R E N
Hegel in den Ausführungen zur sittlichen Handlung zeigt, vom Subjekt überwunden und als sittliche Gesinnung verinnerlicht werden.
Die Familie repräsentiert jenen Bereich, in dem die Sittlichkeit noch nicht zum Bewusstsein ihrer selbst gekommen ist; als »natürliches sittliches Gemeinwesen«197 steht sie im Gegensatz zum sittlichen Gemeinwesen des Staates. Besteht die sittliche Welt aber nur als Dualität von �›Staat�‹ und �›Fa-milie�‹ oder verweist sie nicht auch auf ein Außen, das sich in dieses Innen einschreibt und es mitkonstituiert? Ein Außen, das nicht die Welt ist, und das in Bezug auf die Sittlichkeit in einem zweifachen Verhältnis erscheint: einerseits als Natur, die vom Menschen (noch) nicht gestaltet worden ist, und andererseits als Natur, der der Mensch durch die Schaffung der Welt entkommen ist. Es scheint allerdings, dass die beiden sittlichen Sphären auf ungleiche Weise von diesem �›Außen�‹ unterschieden werden. Das sittliche Gemeinwesen hebt sich von der Natur ab, weil es von vernünftigen Geset-zen reguliert wird und einer menschlichen Regierung untersteht. Im Ge-gensatz dazu bleibt die Position der Familie sehr viel unbestimmter. Die Verwandtschaft wird, wie Butler schreibt, an der Grenze »dessen angesie-delt, was Hegel die �›sittliche Welt�‹ nennt«.198 Dass die Familie im Unter-schied zum �›Gemeinwesen�‹ des Staates als »natürliches sittliches Gemeinwe-sen«199 bezeichnet wird, weist auf diese Stellung zwischen menschlicher Welt und Natur hin. Das göttliche Recht der Familie lässt sich, so schreibt Ludwig Siep, damit erklären, »daß die Institution der Familie nicht auf rationale Vereinbarungen zurückgeht, sondern auf die Kräfte der Natur«.200 Wie aber ist dieses Verhältnis zur Natur beschaffen, wenn die Familie doch gerade zu jener Welt gehört, in der sich der Geist als von der Natur Unter-schiedenes manifestiert? Wie kann die Familie auf �›Kräfte der Natur�‹ zu-rückgehen und gleichzeitig jener sittlichen Welt angehören, durch die sich der Mensch von der Natur abhebt? In der Phänomenologie heißt es dazu, dass nicht die einzelnen Beziehungen zwischen den Mitgliedern die Familie ausmachen, sondern vielmehr das allgemeine Verhältnis, das sie zueinander als Blutsverwandte einnehmen, »und diß Verhältnis der Natur ist wesent-lich ebenso sehr ein Geist, und nur als geistiges Wesen sittlich«.201 Die Beziehungen, welche den Bereich der Familie stiften, scheinen damit so-
�—�—�—�—�—�— 197 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 243 198 Butler, Antigones Verlangen, S. 14 199 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 243 200 Siep, Der Weg der �›Phänomenologie des Geistes�‹, S. 269 201 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 243
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 87
wohl der Natur anzugehören als auch dem Geist; nur als Letzteres aber gelten sie als sittlich.
Wie kann die Natürlichkeit der familiären Beziehungen allerdings geis-tig werden, wenn die Familie den Bereich des Unbewussten darstellt? Wie kann die Familie zugleich Ort des Unbewussten und natürlicher Verhält-nisse und dennoch �›geistiges Wesen�‹ und nur als solches �›sittlich�‹ sein? Es scheint, dass die Unterscheidung zwischen Natur und Familie unbestimm-ter bleibt als jene zwischen Natur und Staat. Denn wenn die Welt den Niederschlag des sich reflektierenden Geistes darstellt, dann hebt sich die Sphäre des sittlichen Gemeinwesens durch ihre intelligible Ordnung von der unreflektierten Natur ab. Als Sphäre des �›Unbewussten�‹ zeichnet sich hingegen in der Familie die intelligible Struktur des Sittlichen erst ab, ohne dem Bewusstsein zugänglich zu sein. Die Familie als der »bewußtlose noch innre Begriff, seiner sich bewussten Wirklichkeit«202 markiert jene Grenze der Welt, an der sich der Geist nicht mehr in der unreflektierten Natur befindet, dieser seine neue Gestalt aber noch nicht erkennen und begreifen kann. Sie stellt einen Ort dar, an dem die Welt sich abzeichnet, ihre Struk-turen und Gesetze dem Bewusstsein aber noch nicht zugänglich sind. Als Unbewusstes der sittlichen Ordnung markiert sie eine Sphäre, die notwen-dig dem Bewusstsein entzogen bleibt, welches sich in der sittlichen Welt manifestiert. Das aber hält sie auch von der sittlichen Welt ab und lässt sie in die Nähe jener Natur rücken, welche von der Welt ausgegrenzt werden soll. Wo liegt dann die Differenz zwischen der unreflektierten Natur und der Familie als dem unbewussten Begriff des Sittlichen? Und ist es viel-leicht gerade die Position der Familie an der Grenze des Sittlichen, die es möglich macht, das sittliche Gemeinwesen von der unreflektierten Natur abzusetzen? Bedarf die durch Normen und Gesetze strukturierte Welt eines Bereichs des Unbewussten, welcher das, was durch die Erschaffung der sittlichen Ordnung überwunden werden soll: die Natur und die Be-gierde, sowohl auf Distanz hält, als auch auf kontrollierte Weise verfügbar macht? Die Familie, so scheint es, stellt die verräumlichte Form des zeitli-chen Übergangs dar, welche der Geist im Prozess seiner Bewusstwerdung vollzieht, und sie bewahrt das Überwundene auf diese Weise im Inneren der Kultur. Dass sie den bewusstlosen noch inneren Begriff der sich be-wussten Wirklichkeit manifestiert, weist auf die zeitliche Differenz hin, die in der Familie eingefroren wird. Das Unbewusste ist damit jene Gestalt der
�—�—�—�—�—�— 202 Ebd.
88 G R E N Z F I G U R E N
Sittlichkeit, die der Geist im Übergang zum Staat durchläuft und gleichzei-tig in der Institution der Familie aufbewahrt. Das Unbewusste der Familie repräsentiert den Übergang, durch den sich das sittliche Gemeinwesen formiert.
Privilegiert diese Position die Familie, deren Gesetzlichkeit »nicht am Tage des Bewußtseyns liegt«,203 dazu, den Toten in den Bereich des Be-wusstseins zurückzuholen? Ist es ihre größere Nähe zur Natur, die es ihr möglich macht, der Natur im Namen der Sittlichkeit entgegenzutreten und den Toten zurückzufordern? (Und wo �– diese Frage in Klammern �– trifft die Familie, die nicht am �›Tage�‹ des Bewusstseins liegt, auf Afrika, das »jenseits des Tages der selbstbewußten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist«?204) Woher stammt das göttliche Gesetz, welches die Familie vertritt? Wer oder was hat dieses Gesetz in Kraft gesetzt und wer überwacht seine Anwendung? »Les membres [de la famille], affirme Hegel, gardent le droit à la vie. Mais comment s�’exerce-t-il?«, fragt Irigaray.205 Wie kann ein Gesetz zur Anwendung gelangen, welches nicht bestimmt ist, dessen Status als Gesetz nicht verständlich ist und das dem Bereich des Unbewussten entstammt? In einer Passage der Philosophie des Rechts, die sich auf die Phänomenologie bezieht, nimmt sich Hegel dieser Frage an.
»Die Pietät wird daher in einer der erhabensten Darstellungen derselben, der Sophokleischen Antigone, vorzugsweise als das Gesetz des Weibes ausgesprochen, und als das Gesetz der empfindenden subjektiven Substantialität, der Innerlichkeit, die noch nicht ihre vollkommene Verwirklichung erlangt, als das Gesetz der alten Götter, des Unterirdischen, als ewiges Gesetz, von dem niemand weiß, von wan-nen es erschien, und im Gegensatz gegen das offenbare, das Gesetz des Staates dargestellt; �– ein Gegensatz, der der höchste sittliche und darum der höchste tragi-sche, und in der Weiblichkeit und Männlichkeit daselbst individualisiert ist«.206
Das göttliche Gesetz folgt nicht einer spezifischen Logik, sondern der Empfindung und der noch unvollkommenen Innerlichkeit. Der Inhalt dieses Gesetzes ist nicht offenbar, sondern �›unterirdisch�‹; es scheint damit ein Gesetz zu sein, das nicht lesbar und entzifferbar ist, dessen Inhalt, im Gegensatz zum �›offenbaren�‹ Gesetz des Staates, nicht zugänglich ist. »Um welche Art Gesetz soll es sich dabei auch handeln? Ein Gesetz, dessen Ursprung unauffindbar ist, ein Gesetz, dessen Spur keine Gestalt anneh-
�—�—�—�—�—�— 203 Ebd., S. 247 204 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 120 205 Irigaray, »L�’universel comme médiation«, S. 144 206 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 155
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 89
men kann und dessen Autorität durch die schriftliche Sprache nicht mit-teilbar ist.«207 Es ist ein Gesetz, dessen Urheberschaft wir nicht kennen und von dem wir nicht wissen, wann es in Kraft getreten ist, denn �›nie-mand weiß, von wannen es erschien�‹. Gleichzeitig ist es ein Gesetz, das mit göttlicher Autorität und einem Anspruch auf Ewigkeit auftritt. Die Legiti-mierungskraft dieses Gesetzes scheint gerade auf dem begründet zu sein, was nicht gänzlich verstanden werden kann: jene unbekannte, aber göttli-che Herkunft, eine dem Bewusstsein nicht zugängliche, aber es konstituie-rende Macht, sein nicht entzifferbarer, aber zur Anwendung gebrachter Inhalt. Kann dieses göttliche Gesetz, das der Familie und der Frau zuge-schrieben wird, überhaupt als Gesetz gelten, oder ist es vielmehr eine Grenze der Gesetzlichkeit, gegen welche sich die Gesetze des Staates als menschliche Setzungen abheben können? Ist es ein Gesetz, welches den Begriff der Gesetzlichkeit selbst in Frage stellt oder ihn erst möglich macht? Butler weist darauf hin, dass jenes unbewusste, nicht entzifferbare �›Gesetz�‹ für die Intelligibilität des öffentlichen Rechtes eine konstitutive Bedeutung hat: »Es [das göttliche Gesetz] steht im Gegensatz zum öffent-lichen Recht, zum Recht des Staates; als das Unbewußte des öffentlichen Rechts ist es das Gesetz, ohne das das öffentliche Recht nicht auskommt, dem es sich notwendig mit einer gewissen Feindseligkeit entgegenstellen muß.«208
Was bedeutet dies für die Frau, die als Hüterin des göttlichen Gesetzes auftritt und der der Zugang zum Gemeinwesen verwehrt bleibt? Wenn das, wie Butler bemerkt, »wofür Antigone steht, genau dasjenige ist, was im öffentlichen Recht unbewußt bleibt, dann existiert sie für Hegel an der Grenze des öffentlich Wißbaren und Kodifizierbaren«.209 Und wenn Anti-gone, wie Hegel schreibt, das �›erhabenste Beispiel�‹ der Frau verkörpert, kann die Grenzfigur der Frau als Bedingung des Staates betrachtet werden; als eine Bedingung, welche die Frau gleichzeitig auf ihre Funktion als Re-präsentantin des Unbewussten festschreibt und ihr den Zugang zur Öf-fentlichkeit verunmöglicht.210 Als Unbewusstes des Gesetzes stellt die Frau
�—�—�—�—�—�— 207 Butler, Antigones Verlangen, S. 67 208 Ebd., S. 67f. 209 Ebd., S. 69 210 Diese These einer konstitutiven Bedeutung der Familie für die sittliche Ordnung steht
im Gegensatz etwa zur Lektüre von Axel Honneth, der (in Bezug auf die Rechtsphilo-sophie Hegels) festhält, Hegels Äußerungen zur Familie besäßen zwar stark patriarchali-sche Züge, die »im Kern aber wohl durch einige entschiedene Korrekturen behebbar
90 G R E N Z F I G U R E N
dasjenige dar, »das von der öffentlichen Wirklichkeit vorausgesetzt wird, unter ihren Bedingungen jedoch nicht erscheinen kann«.211 Dazu gehört, dass die Logik, welche die Legitimität der sittlichen Ordnung erklärt und prüft, sich auf der Seite des Staates und des männlichen Subjekts befindet, eine Anordnung �– wie Irigaray bemerkt �–, welche es der Frau immer schon verunmöglicht, ihre eigene Position mit den Mitteln dieser Logik zu erfas-sen: »Das Männliche wird das Gesetz seines diskursiven Projekts immer aufs neue überprüfen können, aber es wird dabei immer noch das des Weiblichen vorschreiben, während das Weibliche weder das Gesetz noch sich kennt.«212 Wie aber werden diese geschlechterspezifischen Positionen begründet? Warum ist der Gegensatz zwischen göttlichem und menschli-chem Recht, wie Hegel schreibt, �›in der Weiblichkeit und Männlichkeit daselbst individualisiert�‹? Welche Übersetzung zwischen Natur und Geist findet statt, ohne als solche ausgewiesen zu werden, wenn es heißt, dass die Natur »das eine Geschlecht dem einen, das andere dem andern Gesetze«213 zuteile? Warum ist der Übergang vom natürlichen Geschlecht zur ge-schlechterspezifischen Position des sittlichen Subjekts keiner Erklärung bedürftig; warum erscheint er in einem Text, in dem die Passage zwischen Natur und Geist kontinuierlich thematisiert wird, nicht als Übergang, sondern als Kontinuität? Denn die Natur konstituiert im Falle der Ge-schlechterdifferenz nicht die Grenze des Geistes, die überwunden und transformiert werden muss, sondern die Vorlage, welche die Sittlichkeit strukturiert. Die �›natürliche�‹ Geschlechterdifferenz wird auf diese Weise zum Ausgangspunkt der sittlichen Dialektik, ohne selbst einer Vermittlung zu bedürfen:
»Das sittliche Bewußtseyn aber weiß, was es zu thun hat; und ist entschieden, es sey dem göttlichen oder dem menschlichen Gesetz anzugehören. Diese Unmittel-barkeit seiner Entschiedenheit ist ein ansich seyn, und hat daher zugleich die Be-deutung eines natürlichen Seyns«.214
Die unmittelbare Entschiedenheit, mit der sich das Subjekt dem einen oder dem anderen Gesetz zuwendet, scheint ihm durch sein natürliches Sein gegeben. Für die subtile Passage aber zwischen dem �›natürlichen Sein�‹ der
�—�—�—�—�—�— wären« (Honneth, Leiden an Unbestimmtheit, S. 108). Zu einer Kritik an dieser Position vgl. Young, »Anerkennung von Liebesmühe«, S. 418ff.
211 Butler, Antigones Verlangen, S. 69 212 Irigaray, Speculum, S. 278 213 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 252 214 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 91
Geschlechtlichkeit und der unmittelbaren Entschiedenheit, mit der sich das Subjekt dem einen oder anderen Gesetz zuwendet, gibt uns Hegel keine Begründung. Die �›natürliche�‹ Geschlechterdifferenz erscheint als eine Prä-misse der Sittlichkeit, deren Herkunft unausgewiesen bleibt. Die Zugehö-rigkeit zum männlichen oder weiblichen Geschlecht aber ist es, die das Subjekt unmittelbar, d.h. ohne dass dieses in ein reflektiertes Verhältnis zu seiner Geschlechtlichkeit tritt, jenem sittlichen Gesetz zuführt, das ihm oder ihr entspricht. Stellt das Geschlecht, das die Entscheidung bestimmt, aber nicht zugleich einen Effekt der Entschiedenheit dar, mit der sich das Subjekt dem einen oder anderen Gesetz zuwendet? Konstituiert sich das Subjekt nicht als männlich oder weiblich, indem es für das eine oder andere Gesetz eintritt?
Geschlecht erscheint an dieser Stelle als ein Zirkelschluss: Das Subjekt wird männlich oder weiblich, indem es das menschliche oder göttliche Gesetz vertritt. Die unmittelbare Entscheidung aber, mit dem es sich dem einen oder anderen zuwendet, bestimmt sein geschlechtliches �›An-sich-sein�‹, das zugleich �›die Bedeutung eines natürlichen Seins�‹ erhält. Das na-türliche Geschlecht ist damit sowohl ein Effekt als auch eine Vorausset-zung der performativen Tat, durch die das Subjekt als Mann oder Frau erkennbar wird. Die Entscheidung des Mannes für das sittliche Gemeinwe-sen beruht auf seiner Männlichkeit, die wiederum durch diese Entschei-dung gestiftet wird. Damit zeigt sich auch, dass das menschliche Gesetz, obwohl es die bewusste Seite der Sittlichkeit darstellt, selbst eine unbewusste Grundlage hat. Obwohl das �›An-sich-Sein�‹ des Geschlechts die entschei-dende Ausrichtung des Handelns hervorbringt, und die Männlichkeit damit Bedingung der Möglichkeit darstellt, das menschliche Gesetz zu vertreten, bleibt es dem Handelnden unbekannt. Das hat beim Bürger den paradoxen Effekt, dass er sich als Mann konstituiert, indem er sich für das menschli-che Gesetz und damit den bewussten Bereich der Sittlichkeit entscheidet, ihm dabei aber gerade die eigene Männlichkeit, die diese Hinwendung zum Bewusstsein möglich macht, unbewusst bleibt.
Eine andere Grenze der sittlichen Männlichkeit
Männlichkeit und die Zugehörigkeit zum Staat konstituieren sich gegensei-tig. Obwohl es das geschlechtliche �›An-sich-Sein�‹ des Mannes ist, das die-sen dazu bringt, sich dem menschlichen Gesetz zuzuwenden, wird er ande-
92 G R E N Z F I G U R E N
rerseits gerade durch diese Entscheidung und den damit einhergehenden Übertritt in den Staat als männliches Subjekt gekennzeichnet. Dem wird nicht nur die Differenz zur Frau gegenübergestellt, die im Bereich der Familie verbleibt. In den Geschichtsvorlesungen führt Hegel mit dem Chinesen die Figur eines Subjekts ein, das als Vorform des europäischen Bürgers �– und der europäischen Männlichkeit �– auftritt.
China ist gemäß Hegels Darstellung als kaiserliches Patriarchat organi-siert. Es verfügt über einen Staat, dessen Sittlichkeit aber gänzlich äußerlich bleibt. Als Patriarchat, so führt Hegel aus, gründet der chinesische Staat auf dem Familienverhältnis. Alle Bewohner sind der väterlichen Macht des Kaisers unterstellt.215 Dieser nimmt im Staat die Position des Familienva-ters ein, dem alle unterworfen sind. »Die Chinesen wissen sich als zu ihrer Familie gehörig und zugleich als Söhne des Staates.«216 Der chinesische Staat wird damit zu jener frühen Form des sittlichen Staates, in dem der Sohn noch nicht der Macht des Vaters entkommen ist. Familie und Staat fallen in eins und können nicht, wie in Europa, in einen Gegensatz zuein-ander treten. Die Familienzugehörigkeit der chinesischen Männer verdop-pelt sich im Staat, während sie beim europäischen Mann in einen Gegen-satz zu seiner Zugehörigkeit zum sittlichen Gemeinwesen tritt. Der Euro-päer verlässt die Familie, um im Staat zum freien Bürger zu werden. Wenn der Chinese hingegen aus dem Bereich der Familie tritt, wird er im patriar-chalischen Staat erneut zum Sohn. Sein Wechsel von der eigenen Familie zum Staat ist keine dialektische Bewegung; er bleibt im Bannkreis der Fa-milie, auch wenn er seine Familie verlässt. Im Staat untersteht er wie alle anderen Männer der väterlichen Macht des Kaisers, der über alle befehligt. Daraus folgt auch, dass China nicht über eine Verfassung verfügt, die indi-viduelle Rechte gewähren würde, sondern alleine über eine Verwaltung, die das Recht des Kaisers durchsetzt. Das staatliche Regelwerk dient der Or-ganisation der Menschen nach dem Willen des Kaisers, nicht aber der Freiheit des Individuums.
»Von einer Verfassung kann hier nicht gesprochen werden, denn darunter wäre zu verstehen, daß Individuen und Korporationen selbständige Rechte hätten, teils in Beziehung auf ihre besonderen Interessen, teils in Beziehung auf den ganzen Staat. Dieses Moment muß hier fehlen, und es kann nur von einer Reichsverwaltung die Rede sein. China ist das Reich der absoluten Gleichheit [�…]. Bei uns sind die Men-schen nur vor dem Gesetz und in der Beziehung gleich, daß sie Eigentum haben;
�—�—�—�—�—�— 215 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 136 216 Ebd., S. 153
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 93
außerdem haben sie noch viele Interessen und viele Besonderheiten, die garantiert sein müssen, wenn Freiheit für uns vorhanden sein soll.«217
Das Individuum kann seine Rechte im patriarchalen Staat nicht geltend machen, indem er als Einzelheit gegen die Allgemeinheit tritt. Bedeutet dies, dass es in einer familiären Organisation keine Rechte gibt? Oder be-sitzt nur der Kaiser, der in der Position des Vaters ist, ein Recht, dem alle anderen unterworfen sind? Und lässt sich das wiederum auf die europäi-sche Familie übertragen? Existieren in der Familie keine Rechte oder gibt es nur ein Recht des Vaters? Die chinesischen Subjekte jedenfalls sind vor der kaiserlichen Macht alle gleich. Im Gegensatz dazu garantiert die Gleichheit vor dem Recht bei �›uns�‹ (und es lässt sich fragen, welches �›wir�‹ sich an dieser Stelle von China absetzt, und ob es dasselbe �›wir�‹ ist, das Afrika zuvor von sich geschoben hat) die individuelle Freiheit, die durch diese Rechte garantiert wird. Die rechtliche Gleichheit der Bürger dient dazu, ihre Individualität zu ermöglichen. Bezeichnenderweise ist aber noch von einer anderen Form der �›Gleichheit�‹ die Rede, welche �›bei uns�‹ vor-handen ist: Sie besteht darin, dass die �›Menschen Eigentum haben�‹. Welche Bedeutung erhält das Eigentum an dieser Stelle für den Rechtsstaat und für den Begriff des Menschen �›bei uns�‹? Inwiefern wird die Gleichheit dieser Menschen (die durch ihre Zugehörigkeit zum Staat nur Männer sein kön-nen) durch ihr Eigentum generiert? Wie operiert das Eigentum in der rechtlichen Konstitution dieser Männer als Gleiche, und was bedeutet es für jene Männer, die über kein Eigentum verfügen?
In China jedenfalls ist es nicht die rechtliche oder die ökonomische Gleichheit, welche die Bürger auszeichnen. Vielmehr existiert eine Gleich-heit, die keine Differenzen zwischen den Individuen ermöglicht. Das Prin-zip der Einzelheit, welches die sittliche Familie garantiert, kann sich nicht entwickeln, weil Staat und Familie nicht auseinander treten. Der chinesi-sche Staat beruht auf einer Gleichheit, welche absolut ist, weil sie die Un-terwerfung unter den Kaiser bedeutet, und nicht auf der Gleichheit von Ver-schiedenen, wie dies im sittlichen Staat Europas der Fall ist. Die produktive Spannung zwischen Einzelnem und Allgemeinem, welche in der Phänome-nologie die Position des Subjekts zwischen Familie und Staat auszeichnet, kann sich nicht entwickeln. Die chinesischen Männer erscheinen als Prä-Subjekte der europäischen Sittlichkeit.
�—�—�—�—�—�— 217 Ebd., S. 157f.
94 G R E N Z F I G U R E N
Indem China eine gänzlich äußerliche Sittlichkeit aufweist, die sich nicht in den einzelnen Subjekten, sondern nur im hierarchischen System des Kaisers manifestiert, verfügen die chinesischen Subjekte weder über Innerlichkeit noch Reflexionsfähigkeit. Die Sittlichkeit Chinas besteht in der Existenz eines Staates, dem die Bürger unterworfen sind, ohne sich seine �›sittliche Substanz�‹ zu eigen machen zu können. Mehr noch als die europäische Frau bleibt der Chinese damit der Sittlichkeit äußerlich. An-ders als die Europäerin, welche über das göttliche Recht verfügt, kann er der Macht des Herrschers nichts entgegensetzen. »Der allgemeine Wille betätigt sich unmittelbar durch den einzelnen: dieser hat gar kein Wissen seiner gegen die Substanz, die er sich noch nicht als Macht gegen sich setzt«.218 Der Wille des väterlichen Oberhaupts wird durch seine Unter-worfenen ausgeführt, ohne dass diese sich dazu in ein Verhältnis setzen. Der Chinese erscheint als Sohn, der sich nicht gegen die väterliche Macht des Kaisers behaupten kann. Anders als der Afrikaner lebt er in einem sittlichen Staat, aber wie jenem fehlt ihm ein Bewusstsein, das Reflexion werden und die Innerlichkeit des Subjekts hervorbringen könnte. Beide stehen in einem Verhältnis zu einer höheren Macht, in einem Falle der Natur, im anderen des Kaisers, und beide können das Dilemma zwischen Abhängigkeit und Freiheit nicht in einen inneren Konflikt umwandeln, sondern nur als externe Allmacht erfahren. Beide Mächte �– in einem Fall ist es diejenige des Fetischs, im anderen des Vater-Kaisers �– sind als äußer-liche konzipiert und werden nicht als innerer Konflikt erfahrbar. Das Ver-hältnis zu dieser Allmacht ist allerdings gegensätzlich: Während der Afrika-ner glaubt, gegenüber der Natur allmächtig zu sein, und seine Macht im Fetisch repräsentiert, sieht sich der Chinese der Allmacht des Vaters ge-genüber, der er nichts entgegensetzen kann.
Da Hegel mit dieser Annahme an China herantritt, deutet er sowohl die Folgsamkeit als auch den Ungehorsam als äußere Bewegungen eines �›Sub-jekts�‹, das in beiden Fällen ohne Innerlichkeit bleibt:
»Der allgemeine Wille sagt hier in China unmittelbar, was der Einzelne tun solle, und dieser folgt und gehorcht ebenso reflexions- und selbstlos. Gehorcht er nicht, tritt er somit aus der Substanz heraus, so wird er, da dieses Heraustreten nicht durch ein Insichgehen vermittelt ist, auch nicht in der Strafe an der Innerlichkeit erfaßt, sondern an der äußerlichen Existenz.«219
�—�—�—�—�—�— 218 Ebd., S. 152 219 Ebd., S. 152f.; Hervorhebung PP
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 95
Auch im Falle eines Ungehorsams, und man mag sich wundern, wie ein solcher Ungehorsam zustande kommt, vermag der Chinese nicht, die Ab-weichung von der Norm als inneren Konflikt zu erfahren und damit pro-duktiv zu machen. Seine Unfolgsamkeit führt nicht, wie im Fall der Anti-gone, zu einer sittlichen Tat, weil seine Handlung gegen den Staat nicht auf einer anderen sittlichen Macht gründet. Sie verdankt sich, so scheint es, nur einem Moment äußerer Kontingenz. So wie der Ungehorsam des Chinesen durch eine Äußerlichkeit zustande kommen kann, so muss ihm auch die Strafe äußerlich bleiben. Die Züchtigung, so erklärt Hegel, beruht beim Chinesen nur auf der Angst vor der Strafe und nicht auf der »Innerlichkeit des Unrechts, denn es ist hier noch nicht die Reflexion über die Natur der Handlung selbst vorauszusetzen«.220 Ein solches Subjekt ohne Innerlich-keit, ohne Gewissen und Schuldbewusstsein, kann die Strafe nur äußerlich treffen. Sie hinterlässt ihre Spuren einzig auf dem Körper, und die Chine-sen unterliegen ihr »wie bei uns die Kinder«.221 Die Figur des Kindes �– und, so muss hinzugefügt werden, des �›europäischen Kindes�‹ �– operiert nun in einem doppelten Bezug zum Chinesen. Einerseits beschreibt sie sein Verhältnis zum Staat, andererseits dasjenige des Orients zu Europa, denn der Orient ist, wie Hegel ausführt, »das Kindesalter der Ge-schichte«.222 Im Unterschied zum europäischen Mann, der durch seine Zugehörigkeit zum sittlichen Gemeinwesen einer Allgemeinheit angehört, durch die er wiederum über individuelle Rechte verfügt, scheint der Chi-nese nicht als Mann aufzutreten. Er wird und bleibt, wenn er die Familie verlässt, Sohn des Staates. Im Staat wird er zum Kind des Kaisers, und es ist fraglich, ob er durch die fehlende Sphäre des Rechts nicht als Mann auf-treten kann oder ob er den Mann darstellt, welcher auch im Staate �›Sohn�‹ und damit Kind bleibt. Ein eigenartiger Effekt von Hegels China ist aller-dings, dass in einem Land, in dem vor dem Despoten alle gleich sind und die Männer sich nicht durch ihre Zugehörigkeit zum sittlichen Gemeinwe-sen von den Frauen unterscheiden, auch die Geschlechterdifferenz einge-ebnet zu sein scheint. Hegel hält �– mit Erstaunen? �– fest: »Die Mutter wird [in China] ebensosehr wie der Vater verehrt.«223
�—�—�—�—�—�— 220 Ebd., S. 162 221 Ebd. 222 Ebd., S. 135 223 Ebd., S. 154. Andererseits, so heißt es an anderer Stelle, führe die Äußerlichkeit des
Sittlichen dazu, dass der chinesische Mann seine Familie nur als Besitz erachte. »Jeder kann sich und seine Kinder verkaufen, jeder Chinese kauft seine Frau.« (Ebd., S. 162)
96 G R E N Z F I G U R E N
Es fragt sich an dieser Stelle, ob sich Hegels kritische Darstellung des chinesischen Staates nicht gegen seine eigene Konzeption der europäischen Familie wenden ließe. Hegels Kritik kulminiert in der Feststellung, dass es dem Chinesen weder in der Familie noch im Staat möglich ist, als Indivi-duum hervorzutreten.
»In der Familie selbst sind sie [die Chinesen] keine Personen, denn die substantielle Einheit, in welcher sie sich darin befinden, ist die Einheit des Bluts und der Natür-lichkeit. Im Staate sind sie es ebensowenig, denn es ist darin das patriarchalische Verhältnis vorherrschend, und die Regierung beruht auf der Ausübung der väterli-chen Vorsorge des Kaisers, der alles in Ordnung hält.«224
Die Einheit der Familie geht auf ihre Natürlichkeit zurück. Der Staat aller-dings, der in Europa in einen Gegensatz zur familiären Einheit tritt, bleibt in China eine Extension der Familie. Die Allgemeinheit der staatlichen Ordnung geht nur auf einen einzelnen Willen zurück. Damit wird die Un-möglichkeit, in der Familie zur �›Person�‹ zu werden, auch im Staat nicht durchbrochen. Der Staat, der in Europa die sittlichen und rechtlichen Be-dingungen der Anerkennung bereitstellt, in denen der Mann �›wirklich�‹ werden kann, bleibt in China ein hierarchisches Gefüge, in dem es nicht möglich ist, zur �›Person�‹ zu werden. Lässt sich mit dieser Kritik am chinesi-schen Subjekt, das nicht �›Person�‹ werden kann, nicht auch die Position der europäischen Frau kritisieren? Was in Hegels europäischer Geschlechter-ordnung unproblematisch erscheint �– die Beschränkung der Frau auf den Bereich der Familie und ihre Unmöglichkeit, dadurch eine �›Person�‹ zu werden �–, wird in der Darstellung Chinas zum kulturellen Unvermögen eines despotischen Staates, den Europa überwinden und aufheben wird. Mit der Zugehörigkeit des Chinesen zu einem Staat, der zwar sittlich und verständig, aber »ohne freie Vernunft und Phantasie«225 ist, beschreibt Hegel indirekt die eingeschränkte Position, auf welche die Frau im sittli-chen Staat Europas festgeschrieben wird.
Die an der Grenze der Sittlichkeit angesiedelte Figur des Chinesen er-füllt allerdings noch eine andere Funktion in Hegels System: Durch ihn, der die Bewegung aus der Familie heraus nicht vollziehen kann, wird die Notwendigkeit dieser Bewegung für das europäische Subjekt erkennbar. Erst durch diese Bewegung entsteht nämlich die Spannung zwischen All-gemeinem und Einzelnem, die zur treibenden Kraft sowohl des Staates als
�—�—�—�—�—�— 224 Ebd., S. 153 225 Ebd., S. 156
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 97
auch des individuellen Bürgers wird. Der produktive Konflikt zwischen Allgemeinem und Einzelnem, der in der politischen Sphäre ausgetragen wird und durch den das Subjekt erst zur �›Person�‹ werden kann, bleibt der europäischen Frau und dem chinesischen Mann versagt. Anders als die europäische Frau, die notwendig im Bereich der Familie bleiben muss, überschreitet der chinesische Mann die Grenze der Familie auf den Staat hin. Dieser Übertritt stellt aber, weil der Staat wiederum als Familie konzi-piert ist, keine dialektische Bewegung dar. Der Chinese überschreitet eine Schwelle, der die Kraft der Vermittlung fehlt. Er wird, was er schon war, ein Mitglied der Familie, deren Beschränkungen er weiterhin unterliegt. Die kulturelle Differenz zum Chinesen ermöglicht es, eine historische Diffe-renz zum sittlichen Anfang Europas zu schaffen, die gleichzeitig als Grenze zur Erwachsenheit und zur Männlichkeit fungiert. Der Chinese bleibt in dieser Dialektik, die den europäischen Sohn zum männlichen Bürger macht, in zweifachem Sinne Sohn: einerseits im patriarchalen Staat, wo er der Allmacht des Vater-Kaisers unterstellt bleibt, andererseits als Figur des orientalischen Kindes in Hegels Weltgeschichte. Der Chinese ist der Bürger, der Kind und Sohn bleibt. Er markiert die kulturell kodierte Grenze einer Männlichkeit, die noch nicht in der produktiven Spannung zwischen individuellem Anspruch und der Allgemeinheit des Staates steht. Kann der Chinese damit als Mann gelten? Oder stellt er einen Rest jener Dialektik dar, die an dieser Stelle als �›Dialektik der Männlichkeit�‹ erscheint: eine Figur, die an der Schwelle zwischen Familie und Staat scheitert und als unaufgehobener Rest einer sittlichen Männlichkeit zurückbleibt, die sich an anderer Stelle und zu einer anderen Zeit �– �›bei uns�‹ nämlich �– verwirkli-chen wird?
Die Familie und das Recht der Begierde
Nur kraft seiner Männlichkeit, indem es sich für das menschliche Gesetz entscheidet, kann das Subjekt in den Bereich des Staates eintreten. Die Frau hingegen bleibt in der Familie zurück. Die sittliche Ordnung ist damit auf asymmetrische Weise durch die Geschlechterdifferenz strukturiert, welche den beiden Sphären zugrunde liegt.226 Wie aber operiert die Ge-�—�—�—�—�—�— 226 Vgl. dazu Hegels Randbemerkungen in der Rechtsphilosophie: »Mädchen gibt ihre Ehre
auf, Mann nicht �– Denn Mann hat noch ein anderes Feld seiner sittlichen Wirksamkeit,
98 G R E N Z F I G U R E N
schlechterdifferenz im Bereich der sittlichen Familie, in der sich sowohl das männliche Subjekt als auch das weibliche �›Subjekt�‹ der Sittlichkeit be-wegen? In der Phänomenologie heißt es dazu:
»Der Unterschied seiner [des Weibs] Sittlichkeit von der des Mannes besteht eben darin, daß es in seiner Bestimmung für die Einzelnheit und in seiner Lust unmit-telbar allgemein und der Einzelnheit der Begierde fremd bleibt; dahingegen in dem Manne diese beyden Seiten auseinandertreten, und indem er als Bürger die selbstbe-wußte Krafft der Allgemeinheit besitzt, erkauft er sich dadurch das Recht der Begierde, und erhält sich zugleich die Freyheit von derselben.«227
Der Mann kann sich, weil er als Bürger �›die selbstbewusste Kraft der All-gemeinheit besitzt�‹, das Recht der Begierde und zugleich die Freiheit von ihr erkaufen. Woher aber stammt dieses �›Recht�‹, wer setzt es fest, und wer überprüft seine Anwendung? Wie muss man sich ein �›käufliches Recht�‹ vorstellen und was bedeutet dies für den Rechtsbegriff? Wer �›verkauft�‹ dieses Recht und wie geht sein Kauf vonstatten? Die Familie bietet dem Mann jedenfalls das Recht der Begierde, während der Staat ihn wiederum davor schützt, dieser Begierde zu verfallen. Die Freiheit von der Begierde, die der Staat dem Bürger ermöglicht, beruht darauf, dass er sie beim Ein-tritt in den Staat zurücklassen muss, denn der Staat ist der Raum der All-gemeinheit, in dem die Einzelheit der Begierde ausgelöscht wird. »Der Einzelne die Lust des Genusses seiner Einzelnheit suchend, findet sie in der Familie, und die Nothwendigkeit, worin die Lust vergeht, ist sein eignes Selbstbewußtseyn als Bürger seines Volks«.228 Im Übergang zum sittlichen Gemeinwesen muss der Mann sein �›Recht der Begierde�‹ aufgeben. Wäh-rend die Frau ihre Begierde immer schon in die Sorge für die Allgemeinheit der Familie umgewandelt hat, �›vergeht�‹ dem Mann die Lust erst beim Übergang von der Familie zum Staat. Dabei erhält seine Lust aber �– im Gegensatz zu derjenigen der Frau �– einen neuen Namen und einen neuen Genusswert: Die Anerkennung der staatlichen Ordnung ist nämlich »die Tugend, welche der Früchte ihrer Aufopferung genießt; sie bringt zustande, worauf sie geht, nemlich das Wesen zur wirklichen Gegenwart herauszu-heben, und ihr Genuß ist diß allgemeine Leben«.229 Indem das Subjekt sein Begehren mit den Gesetzen des Staates in Übereinstimmung bringt oder
�—�—�—�—�—�— im Staate �– Mädchen nicht �– sondern ihre Sittlichkeit existiert wesentlich im Verhältnis der Ehe« (Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 422).
227 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 247 228 Ebd., S. 249 229 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 99
das »Bewußtseyn des Selbsts als die anerkannte allgemeine Ordnung«230 weiß, verwandelt es sein individuelles Streben nach Macht und Reichtum in sittliche Tugend. Es opfert seine Begierde �– jenes Verlangen nach Macht und Besitz, das nur auf sich selbst und nicht auf die sittliche Allgemeinheit gerichtet ist �– und gewinnt die sittliche Wirklichkeit, welche es nur als Bürger erlangen kann. Die sittliche Ordnung erweist sich somit als repres-siv und produktiv: Sie zwingt das Subjekt zur Verdrängung seiner Begier-den und eröffnet ihm dabei einen neuen Bereich des Genusses. Die For-mation des Bürgers macht ein spezifisches Selbstverhältnis erforderlich, indem die erfolgreiche Befreiung von den eigenen Begierden zur Bedin-gung dafür wird, an der bürgerlichen Öffentlichkeit �– und ihren spezifi-schen Praktiken der Sublimation �– teilzuhaben.
Aber beruht die Transformation der Lust in die Tugend nicht gerade darauf, dass die Begierde in der Familie als ein �›Recht�‹ deponiert ist, das in diesem Bereich ausgeübt werden kann? Und wie, so könnte man weiter fragen, unterscheidet sich das Recht der Begierde in der Familie von der staatlichen Regelung von Macht und Besitz? Denn auch das sittliche Ge-meinwesen regelt das persönliche und dingliche Recht der Bürger: »Das Gemeinwesen mag sich also einerseits in die Systeme der persönlichen Selbstständigkeit und des Eigenthums, des persönlichen und dinglichen Rechts, organisiren«.231 Im Bezug zu den persönlichen Rechten des Bür-gers tritt der Staat aber in einer doppelten Rolle auf: Er garantiert sie einer-seits und begrenzt sie andererseits. Wenn sich die Bürger zu sehr auf ihre eigenen Geschäfte ausrichten, zwingt der Staat sie durch Krieg dazu, den fehlenden Bezug zum Sittlichen wieder herzustellen, und verhindert damit »das Versinken in das natürliche Daseyn aus dem sittlichen«.232 Der Staat tritt als Regulator des sittlichen Verhältnisses auf, und der Krieg erweist sich als Mittel, um die Grenzen des Sittlichen durch Gewalt aufrechtzu-erhalten.
In der Familie hingegen wird das �›Recht der Begierde�‹ des Mannes we-der an Bedingungen geknüpft noch beschränkt oder zu anderen Rechten in ein Verhältnis gesetzt. Die �›Freiheit von der Begierde�‹, welche der Mann im Staat genießt, indem der Staat seine Einzelheit unterdrückt und in den Dienst an der Allgemeinheit stellt, macht es ihm möglich, sein �›Recht der Begierde�‹ in der Familie einzufordern; ein Recht, das, ist es einmal erkauft,
�—�—�—�—�—�— 230 Ebd. 231 Ebd., S. 246 232 Ebd.
100 G R E N Z F I G U R E N
im Gegensatz zur rechtlichen Sphäre des Staates ohne Regulativ und Grenze bleibt. Der Bürger kann sich in einer solchen Ökonomie der Be-gierde ein Recht leisten, dessen Erwerb der Frau nicht offen steht. Sie verfügt nicht über jene Währung, welche ihr den Kauf dieses Rechts er-möglichen würde. Ohne das Recht der Begierde aber bleibt sie in ihrer Lust »unmittelbar allgemein und der Einzelheit der Begierde fremd«.233 Es ist unklar, ob sie damit über keine Begierde verfügt oder ob ihre Lust nach dem Allgemeinen auch eine Form der Begierde darstellt. Jedenfalls ist es nicht »dieser Mann, nicht dieses Kind, sondern ein Mann, Kinder überhaupt«,234 die sie begehren würde, denn die Lust der Frau richtet sich nicht auf den einzelnen Menschen, sondern auf die Gesamtheit der Familie. Ihre Be-gierde gilt niemals dem Körper, den sie hält oder streichelt oder pflegt, ihre Lust niemals dem Gegenüber, mit dem sie spricht oder das sie berührt. All diese einzelnen Tätigkeiten der Frau, auch wenn sie so aussehen, als ob sie sich mit Lust verbinden würden, bezeichnen nur immer ihre Lust an der Allgemeinheit der Familie.
Was aber ist dieses Allgemeine, auf das die Frau sich ausrichtet, wenn nur das sittliche Gemeinwesen, zu dem die Frau keinen Zugang besitzt, das »wahrhafft Allgemeine«235 darstellt?
»Das Sittliche scheint nun in das Verhältniß des einzelnen Familiengliedes zur ganzen Familie als der Substanz gelegt werden zu müssen; so daß sein Thun und Wirklich-keit nur sie zum Zweck und Inhalt hat. Aber der bewußte Zweck, den das Thun dieses Ganzen, insofern er auf es selbst geht, hat, ist selbst das Einzelne. Die Er-werbung und Erhaltung von Macht und Reichthum geht theils nur auf das Bedürf-niß und gehört der Begierde an; theils wird sie in ihrer höhern Bestimmung selbst etwas nur mittelbares. Diese Bestimmung fällt nicht in die Familie selbst, sondern geht auf das wahrhafft Allgemeine, das Gemeinwesen; sie ist vielmehr negativ gegen die Familie, und besteht darin, den Einzelnen aus ihr herauszusetzen, seine Natürlichkeit und Einzelnheit zu unterjochen und ihn zur Tugend, zum Leben in und fürs Allgemeine zu ziehen. Der der Familie eigenthümliche, positive Zweck ist der Einzelne als solcher.«236
Wenn ein einzelnes Subjekt, das, wie bald erkennbar wird, ein männliches Subjekt ist, seine Tätigkeit auf die gesamte Familie ausrichtet, indem es zum Beispiel Macht und Reichtum für sie erwirbt, gilt dies nicht als sittlich,
�—�—�—�—�—�— 233 Ebd., S. 247 234 Ebd. 235 Ebd., S. 243 236 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 101
denn »der bewußte Zweck, den das Thun dieses Ganzen, insofern er auf es selbst geht, hat, ist selbst das Einzelne«.237 Das bedeutet, dass die Familie, im Unterschied zum Staat, nicht über eine Allgemeinheit verfügt, die sich von der Einzelheit des Mannes unterscheiden ließe. Als Zweck der Tätig-keit, welche der Mann für die Familie ausübt, erweist sich wiederum der Einzelne. Die Allgemeinheit der Familie fällt mit der Einzelheit des Man-nes in eins, und was der Mann für die Familie tut, das tut er für sich selbst. Die �›Erwerbung und Erhaltung von Macht und Reichtum�‹ gehört darum innerhalb der Familie noch immer der �›Begierde�‹ des Mannes an. Erst im Bereich des sittlichen Gemeinwesens, wo er mit anderen Männern zusam-mentrifft, wird seine Tätigkeit einer Allgemeinheit unterworfen werden.
Wir haben es folglich mit zwei verschiedenen Begriffen des Allgemei-nen zu tun, von denen nur einer sittlich ist. Das Allgemeine der Familie ist noch immer dem männlichen Recht der Begierde untergeordnet, während erst das Allgemeine des Staates es erfordert, dass die Begierde des Mannes in den Dienst des Volkes gestellt wird. Kann das aber etwas anderes be-deuten, als dass der Dienst der Frau für das Allgemeine der Familie de facto ein Dienst an der Einzelheit des Mannes bleibt �– außer, und damit zeichnet sich wiederum die große Ausnahme des Sittlichen ab, außer wenn dieser Mann tot ist?
»Diese letzte Pflicht macht also das vollkommene göttliche Gesetz, oder die positive sittliche Handlung gegen den Einzelnen aus. Alles andere Verhältniß gegen ihn, das nicht in der Liebe stehen bleibt, sondern sittlich ist, gehört dem menschlichen Gesetz an, und hat die negative Bedeutung, den Einzelnen über die Einschließung in das natürliche Gemeinwesen zu erheben, dem er als wirklicher angehört.«238
Ihre positive sittliche Tat leistet die Frau damit nur und erst am toten Mann. Denn jedes �›andere Verhältnis gegen ihn�‹, das nicht in der Liebe stehen bleibt, sondern sittlich ist, gehört dem menschlichen Gesetz an�‹, das der Frau gerade verschlossen bleibt. Die Frau, die sich durch das �›An-sich-Sein ihres Geschlechts�‹ immer unmittelbar für das göttliche Gesetz ent-scheiden wird, kann, mit Ausnahme des Totendienstes, nicht in ein sittli-ches Verhältnis zum Mann treten. Ihr Verhältnis zu ihm verbleibt im Be-reich der Empfindungen. Wenn aber nur die Pflicht am Toten sittlich und jede andere Handlung in der Familie �›in der Liebe stehen bleibt�‹ und wenn, wie es in der Vorrede der Phänomenologie heißt, das »widermenschliche [�…]
�—�—�—�—�—�— 237 Ebd. 238 Ebd., S. 245
102 G R E N Z F I G U R E N
darin [besteht], im Gefühle stehen zu bleiben«,239 dann stellt sich in der Tat die Frage, ob die Familie überhaupt dem Menschlichen zugeordnet werden kann. Die Frau jedenfalls scheint das Widermenschliche nur verlassen zu können, wenn sie den toten Bruder, Ehemann oder Vater begräbt. Der Mann hingegen hat die Möglichkeit, über die �›Einschließung�‹ der Familie erhoben zu werden �– und wir müssen uns fragen, ob er damit auch dem Widermenschlichen entkommt, das der Familie anhaftet, um unter den Männern im sittlichen Gemeinwesen nicht nur wirklich, sondern auch menschlich zu werden.
Allerdings kennt das Recht des Bewusstseins, welches das männliche Subjekt als Toter, und das Recht der Begierde, welches er als Lebendiger von der Frau einfordert, eine Ausnahme. In der Beziehung zwischen Bruder und Schwester, von Hegel als reinste Form der sittlichen Verwandtschaft beschrieben, scheint der Bruder auf sein Recht der Begierde zu verzichten. Bruder und Schwester sind »dasselbe Blut, das aber in ihnen in seine Ruhe und Gleichgewicht gekommen ist. Sie begehren einander nicht [�…], sondern sie sind freye Individualität gegeneinander«.240 Die Blutsverwandtschaft von Bruder und Schwester gilt als Grund dafür, dass ihre Beziehung ohne das �›natürliche Begehren�‹ bleibt, das Hegel zwischen Mann und Frau vor-aussetzt. Auf dieses Moment verweist Irigaray, wenn sie schreibt, dass Hegel mit der Beziehung zwischen Bruder und Schwester das »Verlangen nach einer Beziehung [demonstriert], die zweifellos geschlechtlich ist, die ihm jedoch den Weg durch die Wirklichkeit des sexuellen Begehrens er-spart«.241 Die ideale Geschwisterbeziehung, welche, wie Derrida bemerkt, zwischen Bruder und Schwester, und nicht unter Brüdern oder unter Schwestern besteht, greift auf einen heterosexuellen Code zurück, den sie zugleich außer Kraft setzt.242 Auf der Folie der Beziehung zwischen Ehe-mann und Ehefrau, deren gegenseitiges Erkennen ein natürliches und nicht ein sittliches, und darum gerade nicht »rein und unvermischt mit natürlicher Beziehung«243 ist, heben sich Bruder und Schwester durch die Reinheit ihrer Beziehung ab. Das zwischen Mann und Frau als natürlich vorausge-setzte heterosexuelle Begehren wird von der Geschwisterbeziehung ex post �—�—�—�—�—�— 239 Ebd., S. 48 240 Ebd., S. 247 241 Irigaray, Speculum, S. 273 242 »Mais alors pourquoi frère/s�œur et non pas frères ou s�œurs? C�’est qu�’en vérité il faut
encore une différence sexuelle, une différence sexuelle posée comme telle et pourtant sans désir.« (Derrida, Glas, S. 169)
243 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 248
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 103
wieder abgelöst. Die Geschwisterbeziehung bleibt somit paradoxerweise, weil sie auf die Blutsverwandtschaft zurückgeht und damit �›natürlich�‹ ist, ohne �›natürliche Begierde�‹. Wie aber ist diese �›begierdelose�‹ Beziehung auf dem Hintergrund des �›Rechts der Begierde�‹ möglich, das in der Familie gilt?244 Hegels Feststellung, dass Bruder und Schwester einander nicht begehren, scheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Begierde ins Spiel zu bringen, die gleichzeitig immer schon ausgeschlossen ist. Mann und Frau können sich nicht gegenseitig begehren, weil das Recht der Begierde nur dem Mann zusteht, die Frau aber »der Einzelnheit der Begierde fremd bleibt«.245 Ist die Beziehung zwischen Bruder und Schwester aber nicht einzig darum �›rein�‹, weil es in ihr kein Verlangen des Bruders nach der Schwester gibt? Das bedeutet, dass die Reinheit der gegengeschlechtlichen Geschwisterbeziehung nicht auf die Schwester zurückgehen kann. Sie erfährt einzig, dass ihr Bruder, im Unterschied zu anderen Männern in der Familie, sein Recht der Begierde an ihr nicht erprobt, und, mehr noch, sie anerkennt. Versteht die Schwester diese Verbindung von Begierde und Anerkennung? Und: Traut sie dem Bruder?
Sie versteht jedenfalls, dass ihre »Pflicht gegen den Bruder die höchste ist und sein Verlust ihr unersetzlich«.246 Irigaray merkt an, dass die schein-bare Gleichheit zwischen Bruder und Schwester schon dadurch unmöglich ist, dass »der Bruder für die Schwester die Möglichkeit der Anerkennung ist, der Anerkennung, der sie als Mutter und Ehefrau beraubt ist«.247 Für den Bruder hingegen ist die Schwester nur der Übergang zur Anerken-nung; für ihn fungiert die Beziehung zur Schwester als Grenze, »an der sich die beschlossene Familie auflöst, und außer sich geht. Der Bruder ist die Seite, nach welcher ihr Geist zur Individualität wird [�…]. Er geht aus dem göttlichen Gesetz, in dessen Sphäre er lebte, zu dem menschlichen über. Die Schwester aber wird, oder die Frau bleibt der Vorstand des Hauses und die Bewahrerin des göttlichen Gesetzes.«248 Die Paradoxie der Schwes-ter, die in dieser dialektischen Vermittlung das Unvermittelte bleibt, schlägt sich in der Formulierung ihrer neuen/alten Position nieder: Die �›Schwester aber wird, oder die Frau bleibt der Vorstand des Hauses�‹. Die Schwester wird das, was sie bleibt, nämlich die Vorsteherin des Hauses. Die Schwes-
�—�—�—�—�—�— 244 Ebd. 245 Ebd., S. 247 246 Ebd., S. 248 247 Irigaray, Speculum, S. 270 248 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 248
104 G R E N Z F I G U R E N
ter bleibt als Grenzfigur, als Rest einer Dialektik zurück, die den Bruder zum Bürger erhebt, bei ihr jedoch einen �›dialektischen Stopp�‹ macht.249 Sie hütet das Haus und die Gesetze der Familie, wenn der Bruder zu Hause ist, ebenso, wie wenn er sein Zuhause für die Öffentlichkeit verlässt; sie ver-bleibt, wie Irigaray bemerkt, in einer »Quasi-Subjektivität«250 befangen.
Obwohl ihre Beziehung zum Bruder der Schwester die Möglichkeit der sittlichen Anerkennung eröffnet, bleibt diese eine Ahnung und wird nicht zu jener intersubjektiven Wirklichkeit, die der Bruder in der sittlichen Ge-meinschaft erlangt.
»Das Weibliche hat daher als Schwester die höchste Ahndung des sittlichen Wesens; zum Bewußtseyn und der Wirklichkeit desselben kommt es nicht, weil das Gesetz der Familie das ansichseyende, innerliche Wesen ist, das nicht am Tage des Bewußtseyns liegt, sondern innerliches Gefühl und das der Wirklichkeit enthobene Göttliche bleibt.«251
Die Schwester stellt das höchste sittliche Wesen dar; ihr Zugang zur Sitt-lichkeit erfolgt allerdings nicht über das Bewusstsein, sondern über die Ahnung des Sittlichen. Sie erlangt damit nicht jene bewusste Wirklichkeit des Sittlichen, die der Bruder als Bürger erfährt, sondern nur sein innerli-ches Gefühl. Fällt die Frau mit ihrer �›Ahnung des sittlichen Wesens�‹, die weder Bewusstsein noch Wirklichkeit werden kann, mit dem Wider-menschlichen und Tierischen zusammen, das sich, wie es in der Vorrede der Phänomenologie heißt, dadurch auszeichnet, im »Gefühle stehen zu blei-ben und nur durch dieses sich mittheilen zu können«?252 Die Frau bleibt dem innerlichen Wesen und dem der Wirklichkeit enthobenen Göttlichen verpflichtet. Tritt sie damit ebenso wie die Figur in der Vorrede, welche in den Gefühlen stehen bleibt, »die Wurzel der Humanität mit Füssen«?253 Warum aber wird die Unfähigkeit der Frau, ihre Ahnung zu transzendie-ren, zum �›Göttlichen�‹, während sie an anderer Stelle das �›Widernatürliche�‹ und �›Tierische�‹ beschreibt? Sind Göttliches und Tierisches ineinander über-setzbare Grenzen des Menschlichen? Oder liegt der Unterschied zwischen �—�—�—�—�—�— 249 Der Begriff des �›dialektischen Stopps�‹ stammt von Seyla Benhabib: »Was Hegel unable
to see that he made the �›dialectic�‹ stop at women and condemned them to an ahistorical mode of existence, outside the realms of struggle, work, and diremption that in his eyes are characteristic of human consciousness as such?« (Benhabib, »On Hegel, Woman and Irony«, S. 27)
250 Irigaray, Speculum, S. 279 251 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 247 252 Ebd., S. 48 253 Ebd., S. 47
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 105
dem Tier und der Frau im Verhältnis, das sie zum männlichen Subjekt einnehmen? Ist es also vielmehr so, dass die Humanität, die in der Sittlich-keit entfaltet wird, der Figur der Frau bedarf, und dass diese darum nicht in der Position des Widernatürlichen, sondern in derjenigen des Göttlichen erscheint?254 Wie das Tier verbleibt die Frau in der Ahnung und dem Gefühl, anders als dieses stellt sie aber nicht das Außen des Menschlichen dar, sondern eine notwendige Bedingung und Garantin der sittlichen Ordnung. Die Figur der Frau, die gleichzeitig sittlich und unbewusst, menschlich und göttlich ist, macht es möglich, dasjenige, was an anderen Stellen als Außen des Menschlichen konstituiert wird �– das Widermensch-liche und Tierische �– als Unbewusstes und Göttliches der sittlichen Ord-nung zu verinnerlichen.
Wenn das Menschliche aber erst durch die erfolgreiche Überwindung der Gefühle zustande kommt, kann dann die Frau als menschlich bezeich-net werden? Können ihre Ahnungen des Sittlichen nicht erst dann als menschlich gelten, wenn sie durch die Tätigkeiten des Mannes im sittlichen Gemeinwesen �›wirklich�‹ werden? Ohne ihn, so scheint es, bleiben die Ahnungen der Frau nicht als menschlich entzifferbar und ihr Status bleibt fraglich. Für den Mann hingegen zeichnet das �›begierdelose�‹ Verhältnis zur Schwester die Grenze einer Anerkennungsstruktur vor, welche im Staat zur Wirklichkeit wird. Indem in der Familie nur zwischen Bruder und Schwes-ter ein sittliches Anerkennungsverhältnis zustande kommt �– und man mag sich an der Stelle fragen, ob Vater, Sohn und Bruder die Familie verlassen und sich im Staat begegnen müssen, um sich sittliche Anerkennung entge-genbringen zu können �–, fungiert die Beziehung zwischen Bruder und Schwester als Übergang von der natürlichen zur sittlichen Anerkennung. Sie ist die »Gräntze, an der sich die in sich beschlossene Familie auflöst, und außer sich geht«.255 Die �›Reinheit�‹ der gegengeschlechtlichen Ge-schwisterbeziehung macht eine Anerkennung denkbar, von der die Familie ausgenommen bleibt, denn die �›natürliche Anerkennung�‹ ist, wie Hegel in
�—�—�—�—�—�— 254 Hegels kritische Worte in der Vorrede scheinen sich somit an ein männliches Subjekt zu
richten �– an eines nämlich, welches über die Möglichkeit verfügt, sich aus der Immanenz der Gefühle zu erheben und jene �›Natur der Humanität�‹ zu erlangen, deren »Existenz nur in der zu Stande gebrachten Gemeinsamkeit der Bewußtseyn« (ebd., S. 48) besteht. Eine solche Bestimmung des Humanen als intersubjektiver Austausch zwischen ver-nünftigen Subjekten wird nämlich gerade im sittlichen Gemeinwesen erreicht, das der Frau verschlossen bleibt.
255 Ebd., S. 248
106 G R E N Z F I G U R E N
Bezug auf Eheleute sowie Eltern und Kinder schreibt, »mit Empfindung vermischt« und »von Rührung afficirt«.256
Indem der Mann bei der Schwester auf sein �›Recht der Begierde�‹ ver-zichtet, erprobt er aber auch jene begierdelose Anerkennung, die sein Ver-hältnis zu anderen Männern im Staat ausmachen wird. Im Übergang zum homosozialen Raum des sittlichen Gemeinwesens zeigt sich dem Bruder in der Beziehung mit der Schwester, dass Anerkennung nicht mit Begierde vermischt sein muss, ja, dass sie nicht mit ihr vermischt sein darf, um wirk-liche Anerkennung zu sein �– eine Erfahrung, die seine Beziehung zu den männlichen Bürgern des Gemeinwesens strukturieren wird. Zur Schwester entwickelt der Bruder seine erste homosoziale Beziehung, mit ihr lernt er jene Anerkennung kennen, die er nur als Bürger unter Bürgern und niemals in der Familie erfahren wird. Die Beziehung zur Schwester bereitet jenen politischen Raum vor, in dem sich die Männer ohne gegenseitigen An-spruch auf Macht und Besitz und ohne sexuelles Begehren begegnen wer-den. Die Abwesenheit des Begehrens zwischen Bruder und Schwester, welche ihre Anerkennung ermöglicht, stellt sicher, dass auch der sittliche Raum frei von diesem Begehren bleibt �– dass die Homosozialität in keinem Fall in Homoerotik kippt. Die Abwesenheit des (homo)sexuellen Begeh-rens macht, mit anderen Worten, die Homosozialität der sittlichen Öffent-lichkeit erst möglich. Die Schwester hilft dem Bruder bei der Herstellung jener Ökonomie des Begehrens, in die er fortan eingebunden sein wird. Sie ermöglicht es ihm, an der Grenze von Familie und bürgerlicher Öffent-lichkeit jenes Selbstverhältnis zu entwickeln, das es ihm ermöglicht, sein Begehren beim Eintritt in die homosoziale Öffentlichkeit zurückzulassen und es in der Familie als sein Recht einfordern zu können. Die Familie reguliert das Begehren dabei in zwei Richtungen, indem sie einerseits das uneingeschränkte Recht der Begierde des Mannes in der Familie aufrecht-erhält, und andererseits die Transformation dieser Begierde an ihrer Grenze zur sittlichen Öffentlichkeit sicherstellt. So garantiert sie dafür, dass sich die Männer im sittlichen Gemeinwesen weder mit Empfindungen noch mit sexuellem Begehren noch mit dem Bedürfnis entgegentreten, einander zu unterwerfen und zu besitzen �– es sei denn, sie tun dies, wie im Falle des Krieges, im Namen der sittlichen Allgemeinheit.
�—�—�—�—�—�— 256 Ebd., S. 247
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 107
Der Krieg und die Sittlichkeit
Während die Frau in der Familie dem Recht der Begierde unterworfen wird, das nur dem Mann zusteht, erfährt dieser in der Sphäre des Staates die �›Unterjochung seiner Bedürfnisse�‹ unter die allgemeinen Erfordernisse des Staates. Das Verhältnis zwischen den einzelnen Bedürfnissen des Mannes, die durch die staatlichen Regelungen garantiert werden, und dem Vorrang des Staates über seine individuellen Bedürfnisse muss beständig neu ausgeglichen werden. Das stärkste Mittel aber, mit dem sich der Staat den ausschweifenden Bedürfnissen der Bürger �›von Zeit zu Zeit�‹ entgegen-stellt, ist der Krieg.
»Das Gemeinwesen mag sich also einerseits in die Systeme der persönlichen Selbstständigkeit und des Eigenthums, des persönlichen und dinglichen Rechts organisiren [�…]. Der Geist der allgemeinen Zusammenkunft ist die Einfachheit und das negative Wesen dieser sich isolirenden Systeme. Um sie nicht in dieses Isoliren einwurzeln und festwerden, hiedurch das Ganze auseinanderfallen und den Geist verfliegen zu lassen, hat die Regierung sie in ihrem Innern von Zeit zu Zeit durch die Kriege zu erschüttern, ihre sich zurechtgemachte Ordnung und Recht der Selbständigkeit dadurch zu verletzen und zu verwirren, den Individuen aber, die sich darin vertieffend vom Ganzen losreißen und dem unverletzbaren Fürsichseyn und Sicherheit der Person zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Herrn, den Tod, zu fühlen geben.«257
Die Bedeutung des Kriegs besteht zuerst darin, den Zusammenhalt im Inneren des sittlichen Gemeinwesens zu erhalten oder wiederherzustellen. Er zwingt die Bürger dazu, von ihrem individuellen Streben nach Ruhm und Besitz abzulassen und ihr Leben bedingungslos dem Staate zur Verfü-gung zu stellen. Der Krieg bringt die Bürger dazu, ihr Verhältnis zum Staat zu erneuern, weil durch ihn auch die Institutionen zerstört werden, welche die individuellen Rechte der Bürger gewährleistet und den Exzess ihres individuellen Strebens möglich gemacht haben. »Der Geist wehrt durch diese Auflösung der Form des Bestehens das Versinken in das natürliche Daseyn aus dem sittlichen ab, und erhält und erhebt das Selbst seines Be-wußtseyns in die Freyheit und in seine Krafft.«258 Der Krieg wendet sich damit gegen das Versinken in das natürliche Dasein, das sich ereignen kann, wenn die individuelle Begierde der Männer überhand nimmt. Ver-hindert der Krieg dadurch auch die mögliche Überwältigung des Staates
�—�—�—�—�—�— 257 Ebd., S. 246 258 Ebd.
108 G R E N Z F I G U R E N
durch die Familie, die das Recht der Begierde und der Individualität ver-tritt? Die Regierung jedenfalls, deren Staat von der Auflösung bedroht ist, gibt ihren Bürgern durch den Krieg »ihren Herrn, den Tod, zu fühlen«.259 Die Nähe des Todes, die der Bürger im Krieg erfährt, zwingt ihn dazu, den Vorrang des sittlichen Gemeinwesens vor seinen individuellen Bedürfnis-sen anzuerkennen. Ist der Tod aber zuvor nicht als dasjenige aufgetreten, was die Organisation des Staates stört und die göttliche Kraft der Familie auf den Plan ruft? Im Krieg, jener negativen Kraft des Staates, die zerstört, um zu erhalten, scheint der Tod nun zu einem Agenten des Staates zu werden; er wird zum �›Herrn�‹, der sich dem Individuum im Namen des Staates entgegenstellt. Die entfremdende Macht des Todes, die vorher als Bedrohung der sittlichen Ordnung auftritt, wird an dieser Stelle in ihren Dienst gestellt, um jenes Selbstverhältnis des Bürgers herzustellen, durch das er sein Begehren zurückdrängt und sich den Zwecken des Allgemeinen unterordnet. Indem der Bürger im Krieg die Macht des Todes �›fühlt�‹, wird er an die Pflicht erinnert, die er als Bürger des Staates hat.
»Das negative Wesen [des Krieges] zeigt sich als die eigentliche Macht des Ge-meinwesens und die Krafft seiner Selbsterhaltung; dieses hat also die Wahrheit und Bekräfftigung seiner Macht an dem Wesen des göttlichen Gesetzes und dem unterirdi-schen Reiche.«260
Nicht nur der Tod, sondern auch das göttliche Gesetz steht für die Wahr-heit des Gemeinwesens ein. Indem die Familie ihren Dienst am toten Sol-daten leistet, wird sie Teil jener Wahrheit, die der Staat durch den Krieg gewinnt. Die Familie, die den toten Soldaten begräbt, bekräftigt die Macht des Staates, der sich im Krieg als Einheit und Allgemeinheit erneuert.
Diese Bedeutung des Krieges verschiebt sich allerdings durch die Kon-frontation des menschlichen mit dem göttlichen Recht, was Hegel am Beispiel von Antigone und Kreon erläutert. Die Absolutheit, mit der beide ihr Gesetz vertreten, kennzeichnet die erste Phase der Sittlichkeit, die mit dem Konflikt der beiden Mächte zu Ende geht. Obwohl beide, Kreon und Antigone, dabei untergehen, setzt sich in der Folge das menschliche Gesetz durch, das Kreon vertreten hat.
»Das menschliche Gesetz also in seinem allgemeinen Daseyn, das Gemeinwesen, in seiner Bethätigung überhaupt die Männlichkeit, in seiner wirklichen Bethätigung die Regierung ist, bewegt und erhält sich dadurch, daß es die Absonderung der Pena-
�—�—�—�—�—�— 259 Ebd. 260 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 109
ten oder die selbstständige Vereinzelung in Familien, welchen die Weiblichkeit vorsteht, in sich aufzehrt, und sie in der Continuität seiner Flüssigkeit aufgelößt erhält.«261
Aus dem Konflikt der beiden Mächte geht, ohne dass die Gründe dafür erläutert werden, eine Hierarchie hervor, an deren Spitze die �›Männlichkeit�‹ steht. Diese verwirklicht sich einerseits als Regierung und andererseits durch die Einverleibung desjenigen, was zuvor die abgesonderten Bereiche der Hausgötter und die vereinzelten Domänen der Frauen darstellten. Wie hängt die Tätigkeit des Regierens mit der Aufzehrung und Verflüssigung des Häuslichen zusammen? Welche innere Logik verbindet diese beiden Seiten der Männlichkeit? Die Gefahr der Absonderung durch die Familie jedenfalls wird nun durch die Weiblichkeit repräsentiert und dadurch ge-bannt, dass der Staat dieses Prinzip der Vereinzelung zugleich verbietet und in sich erhält. Anders als im Falle Kreons steht diese Männlichkeit der Weiblichkeit nicht als Gegensatz gegenüber, sondern sie weiß, dass sie sich durch die Unterwerfung der Weiblichkeit konstituiert. Die Männlichkeit erzeugt sich derart
»an dem, was es unterdrückt und was ihm zugleich wesentlich ist, an der Weiblich-keit überhaupt seinen inneren Feind. Diese �– die ewige Ironie des Gemeinwesens �– verändert durch die Intrigue den allgemeinen Zweck der Regierung in einen Pri-vatzweck, verwandelt ihre allgemeine Thätigkeit in eine Werk dieses bestimmten Individuums, und verkehrt das allgemeine Eigenthum des Staats zu einem Besitz und Putz der Familie.«262
Die �›Weiblichkeit�‹ wird zum Unterdrückten, das beständig wiederkehrt, in den Staat eingreift und seine Ordnung stört; sie wird zum �›inneren Feind�‹ der Männlichkeit, die ihm zugleich wesentlich ist und zur ewigen �›Ironie des Gemeinwesens�‹. Was bedeutet es, dass dieser innere Feind der Männ-lichkeit wesentlich ist, und ihr zugleich �– in der Gestalt des Weiblichen �– als Äußeres erscheint? Die Frau repräsentiert nun die Begierde, die der Mann unterdrücken muss, um Bürger zu werden. Damit verschiebt sich die Bedeutung der Weiblichkeit. Sie versucht nun, ihre privaten Interessen in den Bereich des Staates einzuspeisen und diesen zum �›Besitz und Putz der Familie�‹ zu machen. Die Weiblichkeit nimmt, obwohl es der Mann war, der in der Familie das Recht der Begierde besaß, nun die Bedeutung der Indi-vidualität an. Nach der Konfrontation zwischen dem göttlichen und
�—�—�—�—�—�— 261 Ebd., S. 258 262 Ebd., S. 259
110 G R E N Z F I G U R E N
menschlichen Gesetz scheint die Männlichkeit gänzlich mit dem Staat identifiziert zu werden, während die Weiblichkeit das individuelle Begehren repräsentiert. Wenn wiederum vom Krieg die Rede ist, dann richtet sich dieser nicht mehr gegen den einzelnen Bürger, der Gefahr läuft, sein Be-dürfnis vor das Wohl des Staates zu stellen, sondern gegen die Weiblich-keit, die nun diese Begierde repräsentiert. So wie der Krieg zuvor darauf bedacht war, das »Versinken in das natürliche Daseyn«263 zu verhindern, indem er sich den individuellen Bedürfnissen der Männer entgegengestellt hat, so wird er nun dazu eingesetzt, die Gefahr der Weiblichkeit zu bannen, die die Privatinteressen der Familie im Staat durchsetzen will.
Die Weiblichkeit repräsentiert damit, nachdem sie durch den Staat un-terdrückt wird, das Prinzip der Individualität, das zuvor dem Mann in der Familie zugeschrieben worden ist. Oder erkennt die Frau nun, da beide Sphären ineinander übergehen, dass das Allgemeine der Familie, auf das sie ihre Tätigkeit ausgerichtet hat, immer schon mit dem individuellen Bedürf-nis des Mannes zusammengefallen ist? Und ist sie darum fähig, das Streben nach individuellem Erfolg an sich zu reißen und es sich zu eigen zu ma-chen? Sie scheint zu verstehen, dass sie das Recht der Begierde nicht selbst einfordern, dass sie es aber über den Mann ausüben kann. Wendet sie sich darum dem unerfahrenen Jüngling zu? Sie versucht jedenfalls die �›Kraft der Jugend�‹ zu nützen, »des Sohnes, an dem die Mutter ihren Herrn geboren, des Bruders, an dem die Schwester den Mann als ihres gleichen hat, des Jünglings, durch den die Tochter ihre Unselbständigkeit entnommen, den Genuß und die Würde der Frauenschaft erlangt«.264 Die Frau, die sich durch den Jüngling von der Familie, und der Jüngling, der sich durch die Frau vom Krieg abwendet, erscheinen, wie Carla Lonzi ausführt, als mögli-che UsurpatorInnen der bürgerlichen Ordnung: »The two colossal refuta-tions of Hegel�’s analysis are within our power: women in their rejection of the family, young men in their rejection of war.«265 In Hegels Narrativ allerdings wird dieses Moment der Subversion untergraben. Die Möglich-keit, dass die Frau mit Hife des unerfahrenen und jugendlichen Sohns, Bruders oder Ehemanns in das Staatswesen eingreift, bringt erneut den Krieg auf den Plan. Dieser ermöglicht es, die Kraft der männlichen Jugend, die zum Werkzeug weiblicher Intrigen zu werden droht, für den Erhalt des
�—�—�—�—�—�— 263 Ebd., S. 246 264 Ebd. 265 Lonzi, »Let�’s Spit on Hegel«, S. 281
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 111
Staates einzusetzen. Der unerfahrene und leichtsinnige Jüngling wird in den Dienst des Staates gestellt, der sich nun gegen andere Staaten richtet.
»Indem er [der Krieg] einerseits den einzelnen Systemen des Eigenthums und der persönlichen Selbstständigkeit wie auch der einzelnen Persönlichkeit selbst, die Krafft des negativen zu fühlen gibt, erhebt andererseits in ihm ebendiß negative Wesen sich als das erhaltende des Ganzen; der tapfere Jüngling, an welchem die Weiblichkeit ihre Lust hat, das unterdrückte Princip des Verderbens tritt an den Tag und ist das Geltende«.266
Die negative Kraft des Jünglings, der durch die Komplizenschaft mit der Frau zur Gefahr des Staates hätte werden können, wird durch den Krieg erneut in den Dienst des Staates gestellt. Auch die Gefahr der Intrige und Unterhöhlung des Staates durch die Weiblichkeit, die nun das �›System des Eigentums�‹ und der Individualität vertritt, wird dadurch gebannt. Ihr Stre-ben nach Macht, das sich gegen den Staat richtet, wird durch den Krieg zur Bewunderung für den jungen Soldaten, der für den Staat in den Krieg zieht. Die Frau wird zur Mutter, Schwester und Gattin des Soldaten, die am tapferen Jüngling ihre Lust hat, sich um ihn sorgt und den Verletzten pflegen und �– wir wissen es �– beerdigen wird. Die Befriedung der Weib-lichkeit als innerer Feind beruht, wie Butler bemerkt, auf der Konstitution eines äußeren Feindes, gegen den sich der Staat nun vereinen kann. »Die notwendige Aggression des Gemeinwesens gegen die Weiblichkeit (seinen inneren Feind) scheint verwandelt in die Aggression des Gemeinwesens gegen den äußeren Feind; der Staat greift in die Familie ein, um Krieg zu führen.«267 Der Krieg besiegt den �›inneren Feind�‹, den die Frauen und ihre Komplizenschaft mit den jungen Männern darstellen, und stellt die Einheit des Staates gegen den äußeren Feind her, der bekämpft und erobert wer-den kann.
In Kontrast zu diesem inneren Zusammenhang von Staat und Krieg steht die Vorstellung eines afrikanischen Staates, der in den Geschichtsvorle-sungen vorgestellt wird. Auf dem Hintergrund von Hegels Ausführungen zu Afrika mag dies erst einmal erstaunen: Wie ist Staatlichkeit überhaupt möglich, wenn Afrika über keine der Bedingungen verfügt, die Hegel für die Staatlichkeit als notwendig erachtet? Hegel hält fest, dass der Staat in Afrika nicht auf freien Gesetzen basieren könne, weil es keine Verfassung gebe und die Familiensittlichkeit keine Geltung besitze.268 Staatliche For-�—�—�—�—�—�— 266 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 259 267 Butler, Antigones Verlangen, S. 65 268 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 126
112 G R E N Z F I G U R E N
mationen würden darum über keine Dauer verfügen und nur durch Gewalt zusammengehalten. »Es gibt überhaupt kein Band, keine Fessel für diese Willkür. Was den Staat einen Augenblick bestehen lassen kann, ist daher lediglich die äußere Gewalt.«269 Es ließe sich an dieser Stelle fragen, was solche Staaten als Staaten auszeichnet und ob sie nicht vielmehr eine Grenze der Staatlichkeit denkbar machen, an der sich der Staat in Gewalt auflöst. Vielleicht aber gerät Hegels Theorie der Staatsentwicklung auch dadurch in eine Krise, dass er die scheinbar staatenlosen afrikanischen Gesellschaften doch nicht ohne die Kategorie des Staates denken kann? Als Beispiel eines afrikanischen Staates jedenfalls führt Hegel einen �›Wei-berstaat�‹ an, der weder geographisch noch historisch näher bestimmt wird, von dem wir aber erfahren, dass er �›berüchtigt�‹ war, in �›früherer Zeit�‹ exis-tierte und sich �›späterhin verloren�‹ hat (�– und an dieser Stelle müsste ge-fragt werden, wie eine �›frühere Zeit�‹ im außergeschichtlichen Afrika zu denken ist). Hegel beschreibt den Weiberstaat folgendermaßen:
»In früherer Zeit hat sich ein Weiberstaat besonders durch seine Eroberungen berühmt gemacht: es war ein Staat, an dessen Spitze eine Frau stand. Sie hat ihren eigenen Sohn in einem Mörser zerstoßen, sich mit dem Blut bestrichen und veran-staltet, dass das Blut zerstampfter Kinder stets vorrätig sei. Die Männer hat sie verjagt oder umgebracht und befohlen, alle männlichen Kinder zu töten. Diese Furien zerstörten alles in der Nachbarschaft und waren, weil sie das Land nicht bauten, zu steten Plünderungen getrieben. Die Kriegsgefangenen wurden als Män-ner gebraucht, die schwangeren Frauen mußten sich außerhalb des Lagers begeben und, hatten sie einen Sohn geboren, diesen entfernen. Dieser berüchtigte Staat hat sich späterhin verloren.«270
In welchem Verhältnis steht diese Darstellung eines Staates, der nur für einen kurzen, auf Gewalt beruhenden Augenblick als Staat erscheint, zum sittlichen Staat Europas? Und welchen Kontrast eröffnet der afrikanische �›Weiberstaat�‹ zu seiner sittlichen Geschlechterordnung? Dass ein Staat von einer Frau angeführt wird, ist im sittlichen Gemeinwesen, wo die Weib-lichkeit nur durch Intrigen »den allgemeinen Zweck der Regierung in einen Privatzweck«271 verwandeln und damit das »Eigenthum des Staats zu einem Besitz und Putz der Familie«272 machen kann, undenkbar. In Afrika aller-dings hat sich die Trennung zwischen Familie und Staat noch nicht heraus-
�—�—�—�—�—�— 269 Ebd. 270 Ebd., S. 127 271 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 259 272 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 113
gebildet. Der afrikanische Weiberstaat erscheint als ein vorsittliches Ge-bilde, in dem sich das verwirklichen kann, was im Bereich des Sittlichen unmöglich bleibt, dass nämlich eine Frau Regentin eines Staates wird.273 In der sittlichen Welt ist die Unfähigkeit der Frau, nach den Anforderungen des Allgemeinen zu handeln, in ihrer Position in der Familie festgeschrie-ben. Auch wenn sich diese verschiebt, indem die Frau erst das göttliche Gesetz gegen das menschliche vertritt, dann versucht, den Staat durch Intrigen zu unterwandern, und schließlich in der Sorge und Bewunderung für den jungen Krieger endet, bleibt es ihr versagt, die Anforderungen der Allgemeinheit zu vertreten. Sie kann (und muss) diese zwar durch ihre Beteiligung an den staatlichen Kriegsunternehmungen und durch ihren Dienst an den Toten unterstützen, aber sie kann sie weder durchführen noch für sie einstehen. Diese Unfähigkeit der europäischen Frau, sich zum Allgemeinen in einen Bezug zu setzen, rückt sie in die Nähe des Afrika-ners, der zu »dieser Unterscheidung seiner als des Einzelnen und seiner wesentlichen Allgemeinheit [�…] noch nicht gekommen«274 ist. Anders als die europäische Frau aber und obwohl ihr der Bezug zum Allgemeinen sowohl durch ihr Geschlecht wie auch durch ihre kulturelle Zuordnung verschlossen ist, steht die afrikanische Regentin an der Spitze ihres Staates. Wie ist das möglich?
Wie sich feststellen lässt, sind Familie und Staat in diesem �›Weiberstaat�‹ heillos verwirrt: Kriegsgegner werden gefangen genommen, um mit ihnen Kinder zu zeugen, das Blut der eigenen Söhne garantiert die politische Macht der Mütter, und Kriege werden geführt, ohne daraus Land und Eigentum zu gewinnen. Während der Krieger im sittlichen Staat als tapfe-rer Jüngling erscheint, »an welchem die Weiblichkeit ihre Lust hat«,275 wird der männliche Krieger im afrikanischen Weiberstaat zum Gefangenen, mit dessen Hilfe sich das weibliche Volk reproduziert. Die Unfähigkeit dieser Frauen, das Land zu bebauen, das sie erobern, zeigt ihre fehlende Verbin-dung zum Boden auf �– im Unterschied zur europäischen Frau, deren sittli-che Aufgabe darin besteht, ihre Männer in der Erde zu begraben. Was aber vielleicht am schwersten wiegt, ist die Umkehrung der Bedeutung des Blutes
�—�—�—�—�—�— 273 In den Randbemerkungen von Hegels Ausgabe der Rechtsphilosophie steht: »Wo Weiber
und die Jugend im Staate regieren, Staat verdorben. Geht auf Subjektivität �– diese Per-sonen �– Meinung vor dem Allgemeinen �– nicht das Objektive.« (Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. 423)
274 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 122 275 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 259
114 G R E N Z F I G U R E N
durch die afrikanische Regentin: Während die sittliche Blutsverwandtschaft dem Leben des Mannes dient, gründet sie im afrikanischen �›Weiberstaat�‹ auf seinem Tod. Die europäische Frau garantiert dafür, dass der Mann über seinen Tod hinaus in der sittlichen Welt erhalten wird. Die afrikani-sche Regentin hingegen nimmt ihrem Sohn das Leben, um ihre Stärke mit seinem Blut zu besiegeln. Das Blut der Verwandtschaft, das in der europäi-schen Sittlichkeit den Mann vor dem bewusstlosen Sein des natürlichen Todes bewahrt und damit sein geistiges Leben über den physischen Tod hinaus rettet, kehrt sich im afrikanischen Weiberstaat zum Blut des toten Sohnes, dessen Leben für die Macht der Mutter geopfert wird.
Kann Hegels Vorstellung des afrikanischen Weiberstaats damit als eine Art Horrorvision nicht nur der modernen Staatlichkeit, sondern auch der bürgerlichen Geschlechterordnung gelesen werden? Ist die afrikanische Kriegerin mit ihrem Ansinnen, jeden Mann zu töten, das Gegenbild zur sittlichen Frau, eine Gegenspielerin auch zu Hegels Antigone, welche bis zu ihrem Untergang das göttliche Recht verteidigt, und damit die Pflichten ihrer Weiblichkeit bis in den Tod erstreckt? Ermöglicht es der �›afrikanische Weiberstaat�‹ einen Staat denkbar zu machen, der nicht der Konstitution des männlichen Subjekts dient, sondern auf seiner Auslöschung beruht? Wird die Verknüpfung des Todes mit Angst und Begehren in der Vorstellung einer Frau erneuert, die den Tod des Mannes nicht aufhebt, sondern ihn vollstreckt? Wird in Afrika, das später weg geschoben wird, etwas denkbar, was als Undenkbares in Hegels Sittlichkeit angelegt ist? Ist die Vorstellung eines Staates, der auf reiner Gewalt und genauer: auf weiblicher Gewalt gegen Männer beruht, auf eigenartige Weise verknüpft mit Hegels Konzept des sittlichen Staates, der die Unterdrückung des Weiblichen verlangt? Erzeugt die Vorstellung, dass der sittliche Staat »an der Weiblichkeit über-haupt seinen innern Feind«276 herstellen muss, auch die undenkbare und im kulturellen und geschichtlichen Außen lokalisierte Vorstellung einer blut-rünstigen Weiblichkeit, die sich gegen den Männerstaat erheben und ihn zerstören könnte? Wird Hegels Konzeption des sittlichen Staates, der auf der Unterdrückung der Weiblichkeit gründet, an dieser Stelle von der Vor-stellung eines Staates gestört, durchkreuzt und gejagt, der auf der Unter-drückung und Zerstörung der Männlichkeit beruht �– einer Vorstellung, die als �›imaginärer Überschuss�‹ in Hegels Sittlichkeit angelegt ist und im exoti-schen Außen nur zum Vorschein kommen kann?
�—�—�—�—�—�— 276 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 115
Die Arbeit der Familie
Die Figur der afrikanischen Regentin, deren Staat auf dem Tod der Männer gründet, verstärkt in ihrer Differenz das Bild der europäischen Frau, wel-che die sittliche Ordnung im Dienste der Männer aufrechterhält. Worin aber besteht die Arbeit, welche die europäische Frau für die sittliche Ge-meinschaft erbringen muss? Die Tat, welche die einzige bedeutsame sittli-che Tat der Familie darstellt, besteht darin, die Grenze wiederherzustellen, welche durch den Tod niedergerissen wird, und die Bewegung des Be-wusstseins da hinzuzufügen, wo es innehalten muss:
»Die Pflicht des Familiengliedes ist deßwegen, diese Seite hinzuzufügen, damit auch sein letztes Seyn, diß allgemeine Seyn, nicht allein der Natur angehöre und etwas unvernünftiges bleibe, sondern daß es ein gethanes, und das Recht des Bewußtseyns in ihm behauptet sey«.277
Die Familie als bewusstloser Begriff der Sittlichkeit ist es, welche dem toten Subjekt die Bewegung des Bewusstseins hinzufügt. Wie kann sie dies aber als der bewusstlose Begriff der sittlichen Wirklichkeit tun? Oder kann sie es gerade darum tun, weil sie selbst zwischen dem Bewusstsein der Sittlichkeit und dem Unbewussten der Natur angesiedelt ist? Die Erhaltung der Bewegung des Bewusstseins, so heißt es weiter, ist ihre Pflicht gegen das �›Recht des Bewusstseins�‹. Was für ein Recht ist das �›Recht des Be-wusstseins�‹, das im Tod in Kraft tritt, und wie ist es mit dem �›Recht der Begierde�‹ verbunden, welches der (lebende) Mann in seiner Familie besitzt? Das Recht scheint, wie Irigaray bemerkt, zu fordern, dass der Tod in die Welt hinein genommen und der Tote in der Bewegung des Geistes erhal-ten wird. »Der Mann ist zweifellos noch dem (natürlichen) Tode unterwor-fen, aber was zählt, ist, diese Zufälligkeit in Bewegung des Geistes umzu-wandeln«.278 Wer oder was aber ist das Subjekt dieses Rechts? Wie kann das Bewusstsein sein Recht einfordern, wenn es in dem Moment in Kraft tritt, in dem das Bewusstsein aus der Reflexionsbewegung genommen wird und damit aufhört, Bewusstsein zu sein? Was lässt das Bewusstsein zurück, wenn seine Bewegung ein Ende nimmt, wie markiert es den toten Körper des Subjekts, der nun das Recht des Bewusstseins einfordert, obwohl er nicht mehr Bewusstsein und nicht mehr Subjekt ist? Wie ist das Recht des Bewusstseins diesem toten Körper, diesem nachgelassenen Zeichen des
�—�—�—�—�—�— 277 Ebd., S. 244 278 Irigaray, Speculum, S. 267
116 G R E N Z F I G U R E N
Bewusstseins, eingeschrieben: ein Recht, das scheinbar immer nur ex post und post mortem eingefordert werden kann? Wie kann die Familie sicher-stellen, dass der Tote »nicht allein der Natur angehöre und etwas unver-nünftiges bleibe«,279 wenn diese Aussage impliziert, dass er bereits etwas Unvernünftiges geworden ist? Wie kann er noch erkannt und zurückgefor-dert werden, wenn sich die Grenze zwischen der Bewegung des Bewusst-seins und der bewusstlosen Bewegung der Natur schon aufgelöst hat, wenn das Subjekt bereits unvernünftig geworden und damit nicht mehr als Sub-jekt erkennbar ist? Wie kann dieser Körper von einem anderen toten Kör-per unterschieden werden, welcher nicht einem Subjekt, sondern einer �›niedrigen vernunftlosen Individualität�‹ angehört?
Die Widersprüchlichkeit des Übergangs zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit, mit der sich die Familie konfrontiert sieht, scheint darin zu bestehen, dass er sich schon ereignet hat und gleichzeitig verhindert werden muss. Das Recht des Bewusstseins tritt somit in einer Passage in Kraft, in der verschiedene Zeitlichkeiten am Werk sind. Die Arbeit zwi-schen diesen zwei Zeitlichkeiten und die Umdeutung des Todes als Bewe-gung, die Bewusstsein bleibt, stellt die Arbeit der Familie dar; eine Arbeit, die, so scheint mir, auch in Hegels Text ausgemacht werden kann:
»Diese Allgemeinheit, zu der der Einzelne als solcher gelangt, ist das reine Seyn, der Tod; es ist das unmittelbare natürliche Gewordenseyn, nicht das Thun eines Bewußtseyns. Die Pflicht des Familiengliedes ist deßwegen, diese Seite hinzuzufügen, damit auch sein letztes Seyn, diß allgemeine Seyn, nicht allein der Natur angehöre und etwas unvernünftiges bleibe, sondern daß es ein gethanes, und das Recht des Bewußtseyns in ihm behauptet sey. Oder der Sinn der Handlung ist vielmehr, daß, weil in Wahr-heit die Ruhe und Allgemeinheit des seiner selbstbewußten Wesens nicht der Na-tur angehört, der Schein eines solchen Thuns hinwegfalle, den sich die Natur an-gemaßt, und die Wahrheit hergestellt werde.«280
Die Pflicht der Familie wird in dieser Passage als Tätigkeit beschrieben, dem Tod die Bewegung des Bewusstseins hinzuzufügen. Die Familie tritt damit an den Tod heran, der sich bereits ereignet hat. Ihr Auftritt ist nach-zeitig und ihr Tun ein Hinzufügen, welches zweierlei bewirken soll. Es sorgt dafür, dass der Tote nicht allein der Natur gehört und dass er nicht unvernünftig bleibt. Der Tote, so wird impliziert, gehört der Natur an und ist unvernünftig. Wie aber fügt die Familie dem Tod die Seite des Bewusst-seins hinzu? Die Tätigkeit der Familie scheint in einem Umdeuten des Todes �—�—�—�—�—�— 279 Hegel, Phänomenologie des Geistes, S. 244; Hervorhebung PP 280 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 117
zu bestehen, denn die Zugehörigkeit des Toten zur Natur wird im nächs-ten Satz von der Familie angefochten. Obwohl das �›oder�‹, das den Satz einleitet, eine andere Beschreibung desselben Vorgangs impliziert, wartet der Satz mit einer ganz anderen Interpretation des Todes auf:
»Oder der Sinn der Handlung ist vielmehr, daß, weil in Wahrheit die Ruhe und Allgemeinheit des seiner selbstbewußten Wesens nicht der Natur angehört, der Schein eines solchen Thuns hinwegfalle, den sich die Natur angemaßt, und die Wahrheit hergestellt werde«.281
Die Aufgabe, den Toten wenigstens partiell von der Natur zurückzufor-dern, weil er »nicht allein der Natur angehöre«,282 wird in diesem Satz zur Behauptung, er gehöre »nicht der Natur«283 an. Der Tod, der zuvor als das Werk der Natur beschrieben worden ist, die den Toten in das reine Sein überführt, wird nun zur »Ruhe und Allgemeinheit des seiner selbstbewuß-ten Wesens«284, die nur scheinbar von der Natur in Anspruch genommen wird. Der �›Sinn der Handlung�‹, welche die Familie ausübt, nämlich den Tod zu einer Bewegung des Bewusstseins zu machen, wird damit performa-tiv vollzogen. Die Familie eignet sich den Tod an, indem sie den Anspruch der Natur auf den Toten bestreitet; sie erklärt diesen Anspruch zu einem Schein, den sich die Natur anmaßt. An dessen Stelle soll nun »die Wahrheit hergestellt werde[n]«,285 welche sich als Wahrheit der Familie erweist. Die Verschiebung der Grundannahmen zwischen den beiden Sätzen zeigt auf, wie die Herstellung dieser Wahrheit durch die Familie vonstatten geht. Die Wahrheit der Natur wird zum Schein erklärt, »den sich die Natur ange-maßt«286 hat. Die Arbeit der Familie besteht in der Resignifizierung des Todes. Sie tritt gegen die Natur an, um den Toten für die sittliche Welt einzuklagen und ihre eigene Wahrheit gegen die Natur herzustellen.
Hegel gibt uns eine weitere Beschreibung der Tätigkeit, welche die Fa-milie am Toten vollzieht. Die Blutsverwandtschaft übernimmt »selbst die That der Zerstörung über sich«,287 indem sie den Toten in der Erde be-gräbt und ihn damit einerseits dem reinen Sein des Todes übergibt, ihn
�—�—�—�—�—�— 281 Ebd. 282 Ebd.; Hervorhebung PP 283 Ebd. 284 Ebd. 285 Ebd. 286 Ebd. 287 Ebd., S. 245
118 G R E N Z F I G U R E N
aber andererseits in der Geschichte und Kontinuität des Gemeinwesens erhält.
»Diß ihn entehrende Thun bewußtloser Begierde und abstracter Wesen hält die Familie von ihm ab, setzt das ihrige an die Stelle, und vermählt den Verwandten dem Schoße der Erde, der elementarischen unvergänglichen Individualität; sie macht ihn hierdurch zum Genossen eines Gemeinwesens, welches vielmehr die Kräffte der einzelnen Stoffe und die niedrigen Lebendigkeiten, die gegen ihn frey werden und ihn zerstören wollten, überwältigt und gebunden hält.«288
Die Familie muss den Toten vor dem �›entehrenden Tun bewusstloser Begierde und abstrakter Wesen�‹ schützen. Inwiefern �›entehrt�‹ dieses Tun den Toten? Welche Ehre wird ihm dabei genommen? Besteht das »enteh-rende Thun«289 darin, dass der Tote der bewusstlosen Begierde und den abstrakten Wesen ausgesetzt wird? Wird das sittliche Subjekt auf diese Weise zum passiven Objekt unbewusster Begierden, die vielleicht auch die Begierde anderer sind? Welche Transformation erfährt der Mann, welcher in der Familie das Recht der Begierde besitzt, dadurch, dass er im Tod anderen Begierden ausgesetzt wird? Tritt er damit in die Position des Kin-des oder gar der Frau? Gerät er damit selbst in die Nähe jener Grenzfigu-ren, von denen er sich als männliches Subjekt der Sittlichkeit gerade unter-scheidet? Oder besteht die Entehrung darin, dass sich das Subjekt auflöst, dass es zerfällt, dass mit der bewusstlosen Begierde, die sich seiner er-mächtigt, auch die sorgsam erstellte Ökonomie seiner Begierden an ein Ende kommt? Der Tod könnte demnach als Ent-Männlichung gelesen werden, die sich auf mehrfache Weise ereignet: Das Subjekt verliert mit dem Tod seine Zugehörigkeit zum sittlichen Gemeinwesen, das Recht der Begierde in der Familie, die Kontrolle über sein Begehren und auch über das Begehren Anderer, dem er nun ausgesetzt ist. Das Ende der Reflexion markiert auch das Ende jener performativen Handlungen, durch die es sich als männliches Subjekt konstituiert. Wie die Frau und Kinder in der Fami-lie der Begierde des Mannes ausgesetzt sind, droht der Mann nun im Tod der Begierde Anderer ausgesetzt zu werden. Besteht die sittliche Aufgabe der Frau also darin, den Mann im Tod davor zu bewahren, dass er ihre eigene Position einnehmen könnte? Besteht sie darin, den Mann davor zu bewahren, dass er (wie die Frau) der Begierde Anderer ausgesetzt ist, dass er der �›bewusstlosen Begierde�‹ und damit der Macht jener Figuren ausgesetzt ist
�—�—�—�—�—�— 288 Ebd. 289 Ebd.
H E G E L : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T F O R M A T I O N 119
(vielleicht des Tiers oder des �›Wilden�‹), die den Anfang und das Außen des Bewusstseins signifizieren, oder dass er selbst wieder zu dieser bewusstlo-sen Begierde wird, von der er sich in der sittlichen Welt abgesetzt hat?
Die Familie, so schreibt Hegel, nimmt die Zerstörung auf sich, indem sie den Toten dem Schoß der Erde vermählt. Sie zivilisiert die einbrechende Gewalt der Natur, indem sie diese zu einem kulturellen Akt transformiert. Sie vollzieht an ihm dasjenige Ritual, durch das sie sich als sittliche Ver-wandtschaftsordnung konstituiert: die Ehe. Das spezifische Mittel der Familie, durch das sie den Toten in der sittlichen Welt erhält, besteht in seiner Verheiratung, und das bedeutet auch, in der Wiederherstellung sei-ner geschlechtlich markierten Position. Die Tätigkeit, welche die Familie an die Stelle das Todes setzt, ist die Vermählung des Toten mit der Erde; eine Tätigkeit, welche nicht nur den Toten vor dem Rückfall in die Natur be-wahrt, sondern die Ordnung der Familie noch im Bereich des Todes re-produziert. Indem der Tote dem Schoße der Erde vermählt wird, überkreuzt sich die Heirat allerdings mit dem Ort von Geburt und Zeugung. Der Tote geht als Bräutigam, Sohn und Erzeuger in den �›Schoß der Erde�‹ ein; eine Bewegung, mit der seine Positionen in der Familie wiederhergestellt wer-den. Durch seine Vermählung wird er aber auch wieder zum �›Genossen eines Gemeinwesens�‹, welches die zerstörenden Kräfte der Natur von ihm abhalten wird. Er tritt in ein Gemeinwesen ein, in dem sich, so lässt sich vermuten, die anderen toten Männer befinden. Nicht nur seine Position in der Familie wird wiederhergestellt, auch jene als Mitglied der homosozialen Sphäre. Anders als das sittliche Gemeinwesen verfügen diese Genossen nun auch über die Fähigkeit, die destruktive Kraft des Todes zu überwälti-gen und zu binden. Gibt es, so bleibt zu fragen, schließlich eine Beziehung zwischen dem sittlichen Totendienst der Phänomenologie und Hegels Aus-führungen zum �›Boden�‹ in den Geschichtsvorlesungen? Ist der Schoß der Erde, mit dem der Tote vermählt wird, derselbe Boden, »welcher genau zusam-menhängt mit dem Typus und Charakter des Volkes, das der Sohn solchen Bodens ist«?290 Besteht die Arbeit der Familie darin, das Subjekt noch im Tod zum Vater zu machen, der seine Zeugungsarbeit in der Erde fortset-zen und sich im Volk reproduzieren kann? Verschränkt sich damit in der Beerdigung die Territorialität des Geistes erneut mit der Produktion einer europäischen Männlichkeit �– in einer Arbeit, die die europäische Frau im Namen der Familie für das sittliche Gemeinwesen erbringt?
�—�—�—�—�—�— 290 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 106
1. Die Entmännlichungsmoral
»Was muss ein Mann thun, um bei dem Bilde Ihres Lebens sich nicht der Unmännlichkeit zeihen zu müssen? �– das frage ich mich oft.«
Nietzsche an Malwida von Meysenbug, 14. April 1876
Hegel macht in der Gegenwart eine entscheidende Transformation des Geistes aus, der in die �›Wissenschaft�‹ und damit in eine neue und höhere Form der Selbstreflexion übergeht. Nietzsche hingegen leistet in der Ge-nealogie der Moral, die im Untertitel als �›Streitschrift�‹ ausgegeben wird, eine radikale Kritik dessen, was unter den Stichworten der Moderne, Kultur und Zivilisation als Verbesserung des Menschen gilt. Er tut dies, indem er die Subjektformation unter den Bedingungen der Moral untersucht. Sein Be-griff der Moral bezieht sich auf die normativen Vorgaben, die von der Religion, dem Recht, dem Staat und der Gesellschaft vertreten und durch-gesetzt werden. Sie umfasst aber auch jene spezifischen Formen der Macht, durch die sich der Mensch in einen Zirkel des �›schlechten Gewis-sens�‹ begibt und daraus als �›Subjekt�‹ hervorgeht. Nietzsche erachtet die Moral nicht als einen notwendigen und inhärenten Aspekt des Menschen, sondern vielmehr als ein Set von Strategien, welche der Ausbildung und Erhaltung eines Subjekts unter spezifischen Machtverhältnissen dient. Mit diesem Versuch, sich außerhalb der Moral �– �›jenseits von Gut und Böse�‹ �– zu stellen, kann Nietzsche nach dem Wert der moralischen Werte fra-gen.291 Moral gilt nicht als etwas Unbedingtes, welches nur in seiner jeweili-gen Ausgestaltung kritisiert werden kann. Vielmehr stellt die Moral selbst eine Spielart der Macht dar, die im weitesten Sinne im Dienste des Lebens steht.292 Nietzsches Kritik geht damit hinter den Anspruch der Unbedingt-
�—�—�—�—�—�— 291 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 253. Edmund Heller weist darauf hin, dass die
Konstruktion einer Perspektive jenseits von Gut und Böse die »ausdauernde, beschei-dene und unspektakuläre Arbeit diesseits von Gut und Böse voraussetzt.« (Heller, »Dies-seits und Jenseits von Gut und Böse«, S. 24) So wie Hegels Reflexion auf die entstehen-den Wissenschaften sich selbst als Teil dessen versteht, was sie beschreibt, kann auch Nietzsches Kritik zugleich als Diagnose und Symptom jener �›Krankheit�‹ gedeutet wer-den, die sie in der Moderne ausmacht.
292 Werner Stegmaier bemerkt dazu: »Moral wird zu einer Funktion des Lebens.« (Steg-maier, Nietzsches �›Genealogie der Moral�‹, S. 19)
124 G R E N Z F I G U R E N
heit von Moral zurück und fragt nach den Bedingungen und Möglichkeiten der Subjektformation, die durch die Moral hervorgebracht, und nach den-jenigen, die durch sie verhindert werden.
Ein Ansatzpunkt für Nietzsches Kritik des modernen Subjekts ist das schlechte Gewissen.293 Dieses wird durch die Disziplinierungspraktiken der Gesellschaft inauguriert; gleichzeitig stellt es aber mehr als die mechanische Verinnerlichung ihrer Normen dar.294 Das schlechte Gewissen bezeichnet den Ort, an dem der Wille in ein reflexives Selbstverhältnis tritt. Er setzt sich seiner eigenen Gewalt aus, bringt dadurch aber auch neue Formen der Existenz hervor. Beide Aspekte des schlechten Gewissens werden in einer Textpassage der Genealogie durch die sexualisierte Vorstellung der �›Selbst-vergewaltigung�‹ artikuliert. Diese bizarre Figur bringt sowohl die Zeu-gungskraft eines Willens zum Ausdruck, der sich selbst schafft, als auch die exzessive Gewalt, mit der diese Selbstproduktion einhergeht. Der Ge-schlechterdiskurs, der in diese kritische Darstellung des schlechten Gewis-sens eingelassen ist, kommt auch dann zum Tragen, wenn der moderne Mensch als verweichlicht, schwach und feminin dargestellt und mit dem aggressiven, starken und virilen Menschen einer vor-moralischen Zeit kontrastiert wird. Wie, so lässt sich fragen, operieren Geschlecht und Ge-schlechterdifferenz in der Genealogie? Inwiefern können sie als Bedingung der Möglichkeit von Nietzsches Subjektkritik gelten? Und lässt sich Nietz-sches Kritik der Subjektformation auch als Problematisierung der moder-nen Männlichkeit entziffern; oder ist die problematische Männlichkeit vielmehr das Vehikel, durch das die Kritik an der Moderne artikuliert wer-den kann?
�—�—�—�—�—�— 293 Das schlechte Gewissen wird in der Genealogie mit dem Begriff des Gewissens oder guten
Gewissens kontrastiert, welches die mögliche Überwindung der Moral anzeigt. In der Figur des �›souveränen Individuums�‹, das zu Beginn der zweiten Abhandlung erscheint, werden die von der Moral auferlegten Zwänge wieder zum Instinkt und das schlechte Gewissen zum Gewissen (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 294). Damit zeichnet sich die mögliche Transformation des schlechten Gewissens in ein Gewissen ab, in dem der sich verneinende Wille zu einer neuen Form der Selbstaffirmation findet.
294 Butler nimmt das �›leidenschaftliche Verhaftetsein�‹, welches das Subjekt mit den Normen verbindet, denen es unterworfen wird, zum Ausgangspunkt ihrer Reflexion über den Zusammenhang von gesellschaftlichen Normen und psychischer Subjektformation. Sie schreibt dazu: »Man ist zwar versucht zu behaupten, die soziale Reglementierung werde schlicht verinnerlicht, von außen aufgenommen und in die Psyche hineingetragen, aber das Problem ist doch komplexer, und es ist in der Tat tückischer. Denn die Grenze zwi-schen Innen und Außen entsteht ja erst durch die Reglementierung des Subjekts.« (Butler, Psyche der Macht, S. 66)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 125
Das Subjekt der Verinnerlichung
Wie Hegel greift auch Nietzsche die Vorstellung eines Subjekts auf, das sich in der Rückwendung auf sich selbst konstituiert: Das moderne Subjekt entsteht durch die Rückwendung des Willens als �›Verinnerlichung�‹ des Menschen. »Alle Instinkte, welche sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach Innen �– dies ist das, was ich die Verinnerlichung des Menschen nenne: damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später seine �›Seele�‹ nennt.«295 Das Subjekt, oder wie Nietzsche es auch nennt, die �›Seele�‹, wird somit von den Instinkten, die sich nach innen wenden, ge-schaffen.296 »Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Häute eingespannt, ist in dem Maasse aus einander- und aufgegangen, hat Tiefe, Breite, Höhe bekommen, als die Entladung des Menschen nach Aussen gehemmt worden ist.«297 Die Innerlichkeit ist anfänglich �›wie zwi-schen zwei Häute eingespannt�‹, und man muss sich fragen, ob sie, dünn wie sie ist, sich von den zwei Häuten, in die sie eingespannt ist, überhaupt unterscheidet. Erst die Hemmung der Instinkte, die sich nicht mehr nach außen entladen können �– ein Außen übrigens, das erst durch diese Rück-wendung des Willens entsteht, denn vor der Verinnerlichung ist die Unter-scheidung zwischen innen und außen bedeutungslos �–, dehnt die Häute aus und schafft jenen Zwischenraum, der als �›Seele�‹ gilt und vom Körper unterschieden werden wird.
In der Genealogie wird die Kraft, die auf sich selbst zurückgewendet wird, manchmal als Instinkt, dann wieder als Wille bezeichnet. Diese be-grifflichen Verschiebungen und Unentschiedenheiten deuten darauf hin, dass das Spiel der Kräfte, welches dabei beschrieben wird, sich nur be-helfsmäßig mit einem Begriff erfassen lässt. In Jenseits von Gut und Böse heißt es dazu: »Wollen erscheint mir vor Allem als etwas Complicirtes, Etwas, das nur als Wort eine Einheit ist«.298 Nur im Zug einer sprachlichen Reduktion lässt sich das Wollen auf eine Einheit reduzieren.299 Wie für Hegel beruht
�—�—�—�—�—�— 295 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 322 296 Die Seele ist, wie Nietzsche festhält, die �›populäre Bezeichnung�‹ für das Subjekt: »Das
Subjekt (oder, dass wir populärer reden, die Seele)« (ebd., S. 280f.). 297 Ebd., S. 322 298 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 32 299 Dies hält auch Wolfgang Müller-Lauter fest: »Die Qualität �›Wille zur Macht�‹ ist nicht
wirklich Eins; dies Eins besteht weder in irgend einer Weise für sich, noch ist es gar �›Seinsgrund�‹. �›Wirkliche�‹ Einheit gibt es allein als Organisation und Zusammenspiel von Machtquanten.« (Müller-Lauter, Über Werden und Wille zur Macht, S. 44) In diesem Zu-
126 G R E N Z F I G U R E N
die Figur der Rückwendung bei Nietzsche damit nicht auf einem Sein, das dieser Bewegung vorausgeht oder ihren Grund bildet. Vielmehr konstitu-iert sich das, was als �›Sein�‹ des Subjekts erscheint, durch sein ständiges Tun. »[E]s giebt kein solches Substrat; es giebt kein �›Sein�‹ hinter dem Thun, Wirken, Werden; �›der Thäter�‹ ist zum Thun bloss hinzugedichtet, �– das Thun ist Alles.«300 Wenn es kein Subjekt hinter der Tat gibt und die Rück-wendung des Willens auf sich selbst jene kontinuierliche �›Tat�‹ darstellt, welche das Subjekt hervorbringt, dann besteht das Subjekt nur in dieser Bewegung und als diese Bewegung des Willens.
Nietzsche schlägt vor, das Subjekt als reflexive Beziehung eines Willens zu denken, der sich selbst zum Objekt nimmt. Durch die Hemmung der Instinkte, sich nach außen zu entladen �– und es wird später zu zeigen sein, dass Nietzsche diese Hemmung mit der Sozialisierung des Menschen ver-bindet �–, werden sie dazu gezwungen, sich andere Wege zu bahnen. Dass sich der Wille, der sich nicht mehr nach außen richten kann, nun auf sich selbst entlädt, zeigt den transitiven Aspekt des Willens auf; er ist immer Handlung in bezug auf etwas und Aktion auf etwas hin. Die Formierung der Seele aber erfordert einen Willen, der von seiner Ausrichtung auf etwas, das außerhalb von ihm liegt, abgedrängt wird. Diese Hemmung des Willens bedeutet nicht seine Zerstörung, sondern seine Reorganisation, indem der transitive Charakter des Willens zum reflexiven wird. Der Wille, der sein Ob-jekt nicht mehr außerhalb seiner selbst findet, macht sich zum Objekt seines Tuns. Durch diesen Akt der Selbstobjektivierung �– und darin liegt das Paradox dieses Subjekts �– kann der zurückgedrängte und gehemmte Wille wiederum zum aktiven und tätigen Willen werden. Der Effekt dieser neuen Ökonomie des Willens aber ist seine Spaltung oder Verdoppelung in einen aktiven und einen passiven Teil. Er wird, wie Butler schreibt, zum Willen, der sich auftrennt und sich selbst gegenübertritt: »Um das Begeh-ren zu bändigen, macht man sich selbst zum Objekt der Reflexion; indem man seine eigene Alterität erzeugt, wird man zum reflexiven Wesen, das sich selbst als Objekt nehmen kann.«301 Die Erzeugung einer internen Alterität ist somit die Bedingung und der Effekt eines Selbstverhältnisses, das sein Begehren bändigt, kontrolliert, umleitet und reflexiv macht. Was
�—�—�—�—�—�— sammenhang stellt sich auch die Frage, ob der Wille als individuelles Kräftespiel oder als überindividuelles Konzept zu verstehen ist. Im Kontext der Genealogie könnte etwa ge-fragt werden, ob mit der Rückwendung des Willens auch seine Individuierung erfolgt.
300 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 279 301 Butler, Psyche der Macht, S. 27
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 127
für eine Alterität aber produziert dieser zurückgewendete Wille? Kann jener Teil des Willens, der zum Objekt gemacht wird, noch als Wille gel-ten? Oder wird der passive, zum Stoff des aktiven Willens gemachte Wille in etwas Anderes transformiert? Und was bedeutet dies für das Selbstverhält-nis des Subjekts? Wenn das Subjekt unter der Tätigkeit des Willens, der sich auf sich selbst wendet, �›heranwächst�‹, wird dann der passiv gemacht Wille zu einer Art �›Materie�‹ für die Formation der Seele? Wie aber ist dieser �›materialisierte�‹ Wille mit dem aktiven Willen verschränkt und wie geht das �›Psychische�‹ daraus hervor? Und wenn der passive Wille zum Objekt des aktiven Willens gemacht wird �– erscheinen dann nicht beide Aspekte des Willens in Positionen, die in der metaphysischen Tradition dem Männli-chen und dem Weiblichen zugeschrieben werden? Inwiefern ist in Nietz-sches Subjekt, das sich in der Rückwendung auf sich selbst konstituiert, ein Geschlechterdiskurs am Werk?
Selbstvergewaltigung und Subjektformation
Das schlechte Gewissen, so schreibt Nietzsche, entsteht dadurch, dass der transitive Wille, der sich nach außen richtet, zum reflexiven Willen wird. Seine Ausrichtung verschiebt sich damit von der äußeren auf die innere Welt, und von den anderen auf sich selbst:
»Im Grunde ist es ja dieselbe aktive Kraft, die in jenen Gewalt-Künstlern und Organisatoren grossartiger am Werk ist und Staaten baut, welche hier, innerlich, kleiner, kleinlicher, in der Richtung nach rückwärts, im �›Labyrinth der Brust�‹, um mit Goethe zu reden, sich das schlechte Gewissen schafft und negative Ideale baut, eben jener Instinkt der Freiheit (in meiner Sprache geredet: der Wille zur Macht): nur dass der Stoff, an dem sich die formbildende und vergewaltigende Natur dieser Kraft auslässt, hier eben der Mensch selbst, sein ganzes thierisches altes Selbst ist �– und nicht, wie in jenem grösseren und augenfälligeren Phänomen [des Staates], der andre Mensch, die andren Menschen.«302
Man hüte sich, wird man eingangs dieser Passage gewarnt, das schlechte Gewissen, nur weil es hässlich und schmerzhaft ist, zu unterschätzen. Es geht nämlich auf dieselbe Kraft zurück wie jenes andere Phänomen, der Staat, dessen Architektur so viel eindrücklicher und ausladender scheint.
�—�—�—�—�—�— 302 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 325f.
128 G R E N Z F I G U R E N
Zwei Aspekte, die mit der Sozialisierung des Menschen in Erscheinung treten, werden miteinander vergleichbar: das schlechte Gewissen und der Staat. Beide sind, wie Nietzsche schreibt, ein Werk derselben aktiven Kraft, desselben Willens zur Macht, mit dem Unterschied jedoch, dass dieser die �›formbildende und vergewaltigende�‹ Natur des Willens jeweils an einem anderen Stoff auslässt: Im Falle des schlechten Gewissens ist das �›ganze tierische alte Selbst�‹, im Falle des Staates aber der �›andere Mensch�‹ das Objekt des Willens. Die �›Gewalt-Künstler und Organisatoren�‹, die gleich-zeitig als Menschen vor dem schlechten Gewissen auftreten, benützen an-dere Menschen als »Rohstoff«303 für ihr Werk. Die Menschen, welche diese Staaten bilden, erscheinen damit als Bedingungen des schlechten Gewis-sens, ohne ihm selbst zu unterstehen. »Sie sind es nicht, bei denen das �›schlechte Gewissen�‹ gewachsen ist, das versteht sich von vornherein, �– aber es würde nicht ohne sie gewachsen sein«.304 Anders als die Staatsgrün-der können die Menschen, die zu Subjekten dieses Staates gemacht wer-den, die �›formbildende und vergewaltigende Natur�‹ ihres Willens nicht mehr einfach an anderen Menschen auslassen. Vielmehr schafft der Staat gerade jene Konstellation, in der die Ausrichtung des Willens auf den ande-ren Menschen durch die Moral und die Gesetze reguliert wird.
Die Verschiebung des Objekts vom anderen Menschen auf sich selbst hat zur Folge, dass der transitive Wille zu einem reflexiven Willen wird. Die Menschen, die von den Staatsgründern gewaltsam unterworfen und in eine staatliche Organisation gezwungen werden, mutieren zu �›Gewalt-Künstlern und Organisatoren�‹ ihrer eigenen Seele. Sie schaffen keine äuße-ren Werke, sondern bringen ihre innere Welt hervor. Der Stoff, �›an dem sich die formbildende und vergewaltigende Natur�‹ des Willens dabei aus-lässt, ist nicht mehr der andere Mensch, sondern das eigene Selbst. Die �›formbildende und vergewaltigende Natur�‹ des Willens aber, seine Ver-schränkung von Aggressivität und Gestaltungskraft, verändert sich nicht. Die �›Natur�‹ des Willens, nämlich zugleich produktiv und destruktiv, schöp-ferisch und grausam zu sein, bleibt bestehen. Sie stellt in jener bedeutsamen Transformation des Menschen, in der sich sonst alles verschiebt �– nicht anders als Wassertiere, die zu Landtieren werden müssen �– eine Konstante dar.305 Die Vorstellung, dass sich die menschlichen Existenzbedingungen unter der Moral verändern, wird an dieser Stelle vom Postulat einer gewalt-
�—�—�—�—�—�— 303 Ebd., S. 324 304 Ebd. 305 Vgl. ebd., S. 322.
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 129
sam schöpferischen �›Natur des Willens�‹ durchkreuzt, die mit der Durchset-zung der Moral unverändert bleibt.306 Die Unterwerfung des Menschen unter die Moral verändert diesen gänzlich �– und bedeutet zugleich nur, dass der Wille seine �›formbildende und vergewaltigende Natur�‹ auf sich selbst zurückwendet.
Diese Rückwendung wird in der nächsten Passage als Selbstvergewaltigung beschrieben:
»Diese heimliche Selbst-Vergewaltigung, diese Künstler-Grausamkeit, diese Lust, sich selbst als einem schweren widerstrebenden leidenden Stoffe eine Form zu geben, einen Willen, eine Kritik, einen Widerspruch, eine Verachtung, ein Nein einzubrennen, diese unheimliche und entsetzlich-lustvolle Arbeit einer mit sich selbst willig-zwiespältigen Seele, welche sich leiden macht, aus Lust am Leidenma-chen, dieses ganze aktivische �›schlechte Gewissen�‹ hat zuletzt �– man erräth es schon �– als der eigentliche Mutterschoss idealer und imaginativer Ereignisse auch eine Fülle von neuer befremdlicher Schönheit und Bejahung an�’s Licht gebracht und vielleicht überhaupt erst die Schönheit�…«307
Der Wille, der gezwungen wird, sich auf sich selbst zurückzuwenden, be-gibt sich in einen konstitutiven Selbstwiderspruch zu dem, was zuvor als seine �›Natur�‹ bestimmt worden war. Er muss sich gegen diese Natur zum passiven, formbaren �›Rohstoff�‹ machen, um seine �›formbildende und ver-gewaltigende�‹ Natur aufrechterhalten zu können. Indem er sich zu seiner eigenen Materie macht, gelingt es dem Willen, jene Natur zurückzugewin-nen, welche ihm durch die normativen Zwänge der staatlichen Organisa-tion abhanden zu kommen droht. Er bewahrt und zerstört seine �›vergewal-tigende und formbildende�‹ Natur, indem er sich partiell in etwas verwan-delt, was dieser �›Natur�‹ zuwider ist, etwas, das �›vergewaltigt�‹ und �›geformt�‹ wird. Das �›alte tierische Selbst�‹ �– und es wird noch zu fragen sein, was diese Figur repräsentiert �– wird zum Material, an dem der Wille seine schöpferi-sche Kraft unter neuen Bedingungen entfalten kann. Was aber erzeugt der Wille in diesem eigenartigen Selbstverhältnis? Er schafft, so heißt es, �›das
�—�—�—�—�—�— 306 Eva M. Knodt erachtet die Hinwendung Nietzsches zu einer quasi-metaphysischen
Theorie des Willens als Sprung aus dem epistemologischen Zirkel, den er sich auferlegt. »[T ]he most convenient entrance may well be through the back door, the door through which Nietzsche appears to exit the system in what could be read as a retrospective effort to close it off by �›grounding�‹ genealogy in a �›theory of power�‹.« (Knodt, »The Janus Face of Decadence«, S. 163) Sie betont aber auch, dass eine konsistente Theorie der Macht durch Nietzsches ständigen Perspektivenwechsel verunmöglicht würde (ebd., S. 165).
307 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 326
130 G R E N Z F I G U R E N
schlechte Gewissen und negative Ideale�‹. Das reflexive Selbstverhältnis des Willens bringt mit dem schlechten Gewissen eine Sphäre hervor, in der sich der Wille die normativen Vorgaben der Gesellschaft aneignen und seine eigenen �›Ideale�‹ erschaffen kann. Das schlechte Gewissen wird zum �›Mutterschoß idealer und imaginativer Ereignisse�‹, und es ist zu vermuten, dass die Vorstellung, ein Ich, ein Selbst, ein Subjekt zu sein, eines der Ideale darstellt, die diesem schlechten Gewissen entspringen.308
Wie kann nun der Begriff der Selbstvergewaltigung gelesen werden, durch den diese Verschränkung von Gewalt und Produktivität artikuliert wird?309 Welches Selbstverhältnis beschreibt, welche Introspektion ermöglicht der Begriff der Selbstvergewaltigung? Was ist eine Selbstvergewaltigung? Der Status des �›Selbst�‹ scheint vorerst ungewiss zu sein: Operiert es als Objekt oder als Reflexivpronomen? Wird ein Selbst vergewaltigt? Oder vergewal-tigt etwas sich selbst? Bedeutsam ist auch, dass sich die Selbstvergewalti-gung �›heimlich�‹ ereignet, in der Innerlichkeit, die der Wille unter den Be-dingungen der Gesellschaft hervorbringt. Die �›Heimlichkeit�‹ der Seele ist innerlich und versteckt, andererseits wird diese Innerlichkeit in Nietzsches Erzählung gerade als Effekt gesellschaftlicher Repression ausgewiesen. Zudem erfährt diese Grenze zwischen innen und außen, die dem Subjekt nicht vorausgeht, sondern aus der Verinnerlichung des Willens entsteht, eine Destabilisierung dadurch, dass die Selbstvergewaltigung in ihrer schrecklichen Mischung aus Gewalt und Lust dem lesenden Blick zugäng-lich gemacht wird. Die �›heimliche Selbstvergewaltigung�‹ des Subjekts scheint darauf angelegt zu sein, als �›unheimliche�‹ Vorstellung aufzutreten und dabei jene Mischung aus Faszination und Abscheu hervorzurufen, mit der dem modernen Subjekt �– und damit nicht zuletzt uns selbst �– in der Genealogie begegnet wird.310
�—�—�—�—�—�— 308 Butler schreibt dazu: »Wird das Subjekt als eine Art notwendige Fiktion verstanden,
dann ist diese auch eine der ersten von der Moral vorausgesetzten künstlerischen Leis-tungen.« (Butler, Psyche der Macht, S. 67)
309 Der Begriff der �›Vergewaltigung�‹ hatte im ausgehenden 19. Jahrhundert noch nicht ausschließlich die Bedeutung sexueller Gewalt angenommen; diese Bedeutung war aber bereits im Umlauf.
310 Auf diese metonymische Nähe zwischen dem Begriff des Heimlichen und des Unheimli-chen weist Sigmund Freud hin: »Also heimlich ist ein Wort, das seine Bedeutung nach einer Ambivalenz hin entwickelt, bis es endlich mit seinem Gegensatz unheimlich zu-sammenfällt. Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich.« (Freud, »Das Unheimli-che«, S. 237)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 131
Diese Ambivalenz findet sich aber bereits im Begriff eines Willens, des-sen Natur �›formbildend und vergewaltigend�‹ ist, in der sich also Schöp-fungskraft mit sexualisierter Gewalt verschränkt. In dieses Konzept eines Willens, der hervorbringt, indem er unterwirft, ist der Topos einer gewalt-samen Zeugung eingeschrieben. Unterwerfungslust und Zeugungskraft verbinden sich in der Vorstellung eines Willens, der auch an anderen Stel-len als ein »Überwältigen-Wollen, ein Niederwerfen-Wollen, ein Herrwer-den-Wollen«311 erscheint. Auch wenn es heißt, der Wille �›lässt sich an etwas aus�‹ und �›entlädt sich�‹ dabei, wird er mit einer männlich kodierten aggressi-ven Sexualität verknüpft.312 Im schlechten Gewissen macht der Wille nun sich selbst zum Objekt seines Begehrens, ein Objekt, das der Gewalt dieses Begehrens ausgesetzt wird und in der Position des Vergewaltigten er-scheint. Der viril kodierte Wille bringt, wenn er sich auf sich selbst zu-rückwendet, ein hierarchisches und sexualisiertes Selbstverhältnis hervor. Ist diese �›Selbstvergewaltigung�‹ des modernen Subjekts als homosexuelle oder heterosexuelle Figur zu lesen? Oder ist sie beides: Wird das �›alte tieri-sche Selbst�‹ durch seine Unterwerfung zu einem männlichen Selbst, das in eine feminisierte Position gezwungen wird? Und wie ereignet sich der Übergang von der Selbstvergewaltigung zum �›Mutterschoß idealer und imaginativer Ereignisse�‹?
Der reflexive Wille erfährt in dieser Textstelle mehrere Transformatio-nen; er wird zur Künstler-Grausamkeit, zur Lust, sich als Stoff zu gestalten, zur Arbeit der Seele und schließlich zum Mutterschoß. Mit der Verschie-bung von der Vergewaltigung zur Lust, sich selbst eine Form zu geben, verändert sich das Objekt des vergewaltigenden Willens; das vergewaltigte Selbst, das erst als Anderes erscheint, wird zum �›Stoff�‹ und damit gänzlich zum Objekt. Damit wird die interne Alterität ausgelöscht, die den Willen vom Selbst trennt. Das Selbst verschwindet als Gegenüber, das vergewal-tigt wird, um als Materie wieder zum Vorschein zu kommen, die gestaltet werden kann. Die Gewalt des Willens ist nicht mehr als Gewalt an einem Anderen erkennbar, sie wird zur Gewalt an Etwas. Damit verändert sich auch die Bedeutung der Gewalt; sie erscheint nun als instrumentelle Ge-walt, die der Künstler zur Anwendung bringt, um ein Werk zu schaffen. Der Wille, der erst als Vergewaltiger erscheint, wird zum Künstler. Das vergewaltigte Selbst hingegen wird zum Stoff, den der Wille im schlechten
�—�—�—�—�—�— 311 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 279 312 Vgl. ebd., S. 325.
132 G R E N Z F I G U R E N
Gewissen gestalten kann.313 Übernimmt der vergewaltigende Wille dabei die Macht der Interpretation? Manifestiert sich die Verknüpfung der �›ver-gewaltigenden�‹ mit der �›formbildenden�‹ Natur des Willens an dieser Stelle im Text? Ereignet sich in dieser Passage, was wenige Seiten zuvor fest-gehalten worden ist, dass nämlich Bedeutung entsteht, indem »ein Wille zur Macht über etwas weniger Mächtiges Herr geworden ist und ihm von sich aus den Sinn [�…] aufgeprägt hat«?314 Der Wille würde damit nicht nur über das �›alte tierische Selbst�‹ Herr, indem er es vergewaltigt, sondern auch, indem er diesem Gewaltakt seinen Sinn verleiht. Die Macht des gewaltsam zeugenden Willens wird, so scheint es, performativ vorgeführt. Mit der Umdeutung der Selbstvergewaltigung zum künstlerischen Akt geht die Auslöschung des Selbst einher, an dessen Stelle nun die gestaltbare Mate-rialität tritt. Der vergewaltigende Wille wird zum männlichen Künstler und das vergewaltigte Selbst zum weiblich kodierten Stoff seines Werks. Mit dieser Verschiebung verschwindet die Gewalt: Übrig bleibt alleine die Lust, sich selbst eine Form zu geben. Lässt sich diese Umdeutung als Teil eines Prozesses beschreiben, den man als Normalisierung der Subjektformation bezeichnen könnte? Verrät sie etwas über das sich herausbildende Selbst-verhältnis zivilisierter Männlichkeit? Wird die Gewalt der Selbstdisziplinie-rung, die zuerst als Nexus von Begehren und Verletzung erkennbar wird, normalisiert dadurch, dass sie nur noch als herstellende Gewalt und als Selbstschöpfung erscheinen kann?
Das Selbst jedenfalls, das zum Stoff wird, erhält auch die Trägheit und Passivität der Materie zugeschrieben. Es muss eine Frage bleiben, ob der �›schwere widerstrebende, leidende Stoff�‹ als Zeichen dafür gelesen werden kann, dass der Stoff sich wehrt, dass er sich sträubt oder Widerstand leistet. Der Wille jedenfalls formt den Stoff nicht nur, sondern brennt sich ihm ein;
�—�—�—�—�—�— 313 Seine Gewalt beansprucht jene Rechtfertigung, die Arendt als Logik des Herstellens
beschreibt: »Der Zweck rechtfertigt die Gewalt, die der Natur angetan wird, wenn man Material aus ihr gewinnen will, wie das Holz das Fällen des Baumes rechtfertigt« (Arendt, Vita Activa, S. 139f.).
314 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 314. Der Wille zur Macht erscheint auch als Wille zur Interpretation, und was er sich aneignet, wird mit seinem Namen gezeichnet: »[D]ass nämlich etwas Vorhandenes, irgendwie Zu-Stande-Gekommenes immer wieder von einer ihm überlegenen Macht auf neue Ansichten ausgelegt, neu in Beschlag ge-nommen, zu einem neuen Nutzen umgebildet und umgerichtet wird; dass alles Gesche-hen in der organischen Welt ein Überwältigen, Herrwerden und dass wiederum alles Über-wältigen und Herrwerden ein Neu-Interpretieren, ein Zurechtmachen ist, bei dem der bisherige �›Sinn�‹ und �›Zweck�‹ nothwendig verdunkelt oder ganz ausgelöscht werden muss.« (Ebd., S. 313f.)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 133
er verletzt, markiert und gestaltet ihn gleichzeitig. Wie aber bearbeitet der Wille, der sich zum Künstler gemacht hat, seinen Stoff, und was entsteht dabei? Die Antwort erstaunt: Das Selbst, das gewaltsam zum Stoff gemacht worden war, geht aus diesem Stoff erneut als Anderes hervor. Der Wille gestaltet den Stoff derart, dass dieser sich ihm erneut entgegenstellt: Er brennt ihm (s)ein Nein, (s)einen Widerspruch, (s)eine Kritik und (s)eine Verachtung ein. Die Markierungen, die der Wille auf dem Stoff hinterlässt, richten sich gegen ihn und fordern ihn heraus. Sie werden zu neuen Bedin-gungen für die Existenz eines Willens, der sich in der Verinnerlichung interessant machen und innere Feindschaften und Gegnerschaften schaf-fen muss. Der Wille bringt, nachdem er das Selbst ausgelöscht und zu seinem Stoff gemacht hat, eine neue Alterität hervor. Diese �›entsetzlich-lustvolle Arbeit�‹ nun ist die Tätigkeit der Seele, der Mutterschoß von Intel-lekt und Imagination, die als Bedingung der �›Schönheit�‹ und einer neuen Art der Selbstaffirmation gedeutet werden kann. Auf diese Weise macht das Subjekt den Nexus von Lust und Leiden produktiv. Die Seele, die �›sich leiden macht, aus Lust am Leidenmachen�‹ wird zum Mutterschoß, der ideale und imaginative Ereignisse hervorbringt. Der Mutterschoß operiert damit zwischen Aktivität und Passivität; er ist einerseits der Boden, dem die intellektuellen und imaginären Ereignisse entspringen, andererseits ist er der �›aktivische�‹ Ort, der diese aus sich hervorbringt. Als Verschränkung gebärender und zeugender Kräfte scheint der Mutterschoß sowohl männ-lich als auch weiblich konnotiert zu sein. Derrida schreibt, dass »das Her-vorbringen in den Augen Nietzsches und der gesamten Tradition männ-lich, und eine hervorbringende Mutter [�…] eine männliche Mutter« sei.315 Damit sind in der Passage zur �›Selbstvergewaltigung�‹ zwei gänzlich unter-schiedliche �›weibliche�‹ Positionen als Aspekte der männlichen Selbstfor-mation am Werk. Die eine ist die feminisierte Position des vergewaltigten Selbst, die andere diejenige der zeugenden Mutter.
In der Darstellung des schlechten Gewissens als Werk eines vergewalti-genden Willens einerseits und als Mutterschoß andererseits geht es, so scheint es, auch um das Dilemma eines Ursprungs, der nicht erzählbar ist. Zwei Erzählungen zum Ursprung des schlechten Gewissens überkreuzen sich; die eine führt das schlechte Gewissen auf die Figur des zeugenden
�—�—�—�—�—�— 315 Derrida, »Sporen«, S. 144. Die Mutter wird in der dritten Abhandlung auch für die
bedingungslose Liebe des Künstlers zu seinem Werk angeführt, wo der mütterliche In-stinkt für die »geheime Liebe zu dem [steht], was in ihm wächst« (Nietzsche, Zur Genealo-gie der Moral, S. 354; vgl. auch S. 343, 354f.).
134 G R E N Z F I G U R E N
Willens und die andere auf diejenigen des schöpferischen Mutterschoßes zurück. Die un/heimliche Narration des schlechten Gewissens kann als Schauplatz einer umkämpften Frage des Ursprungs gelesen werden; eines Kampfes aber, der auf dem Bedeutungsfeld der traditionellen Geschlech-termetaphysik ausgefochten wird. Der Mutterschoß der Imagination er-scheint als Produkt eines gewaltsamen Prozesses männlicher Selbstzeugung. Diese Darstellung wird aber von einer anderen durchkreuzt. Wenn der Mutterschoß nämlich den Ursprung der Imagination darstellt, dann ist er die Bedingung dafür, den Willen als Ursprung des schlechten Gewissens zu imaginieren. Das schlechte Gewissen als �›Mutterschoß idealer und imagi-nativer Ereignisse�‹ ist, wie Butler bemerkt, die Bedingung der Möglichkeit, seine eigene Entstehung zu denken: »In diesem Sinne scheint die Möglich-keitsbedingung von Nietzsches eigenem Schreiben jenes schlechte Gewis-sen zu sein, das in ihm erklärt werden soll.«316
Die Herkunft der Moral wird anhand zweier Geschlechterfiguren expli-ziert, deren widerstreitender Anspruch auf den Anfang unvereinbar ist. Der Fiktion der gewaltsamen männlichen Selbstzeugung, die der Wille noch unter den Bedingungen der sozialen Repression aufrechterhält, steht die Vorstellung des (männlich konnotierten) Mutterschoßes der Imagina-tion entgegen, welche als Bedingung dafür erscheint, den eigenen Anfang zu imaginieren. Diesen Vorstellungen der Produktivität ist, wie Derrida festhält, eine traditionelle Geschlechtermetaphysik eingeschrieben: »Nietz-sche bedient sich hier des uralten Philosophems, genannt Produktion [�…]. Er schreibt diesen mit Metaphysik verkrusteten Begriff in die von Aristo-teles und Kant bis zu Hegel [�…] traditionell vorausgesetzte Äquivalenz ein: zwischen der aktiven oder informativen Produktivität einerseits und der Männlichkeit andererseits, zwischen der unproduktiven und materiellen Passivität einerseits und der Weiblichkeit andererseits.«317 Es fragt sich allerdings, ob Nietzsches Ausführungen an dieser Stelle nicht auch anders gelesen werden können. Beschreibt seine Darstellung der Subjektformation nicht implizit auch die Produktion moderner Männlichkeit? Unter dieser Perspektive mobilisiert der Text nicht nur stereotype Geschlechtervorstel-�—�—�—�—�—�— 316 Butler, Psyche der Macht, S. 67 317 Derrida, »Sporen«, S. 144. Vgl. dazu Aristoteles�’ Schrift Über die Zeugung der Geschöpfe, in
der es heißt: »[E ]s spielt sich so ab, wie es vernünftig ist: da das Männchen Gestalt und Bewegungsquelle, das Weibchen Körper und Stoff hergibt, so ist die Arbeit geteilt für Männchen und Weibchen ähnlich wie beim Gerinnen der Milch, wo den Körper die Milch bildet während das Lab den Ursprung der Bewegung zum Gerinnen enthält.« (Aristoteles, »Über die Zeugung der Geschöpfe«, S. 62)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 135
lungen, um das schlechte Gewissen zu beschreiben. Aus Nietzsches aus-führlicher Darstellung des schlechten Gewissens lassen sich auch Einblicke in die Herstellung eines männlichen Selbstverhältnisses gewinnen; ein Selbstverhältnis, in dem sich gesellschaftliche Züchtigung und Selbstdiszi-plinierung in der Praxis kontinuierlicher Gewaltausübung gegen sich selbst verbinden. Diese Gewalt stellt nicht einen Nebeneffekt dieses Subjekts dar, sondern sein konstitutives Moment. Mit dieser Innenansicht des Subjektes wird seine gewaltsame Formation freigelegt; eine Darstellung, die sich kritisch gegen affirmative Vorstellungen zivilisierter Subjektformation wendet. Allerdings erscheint in dieser Darstellung nur die Rückwendung des Willens auf sich selbst als Effekt moderner Subjektivierungspraktiken. Die Vorstellung der grundsätzlichen und grundsätzlich schöpferischen Gewalttätigkeit des Willens wird nicht Gegenstand von Kritik. Nietzsches Text bleibt an dieser Stelle in den Prämissen des Diskurses befangen, den er gleichzeitig angreift. In seine Kritik der repressiven Subjektformation schreibt sich das Gegenbild eines Willens ein, der gewaltsam schöpferisch ist, ohne selbstdestruktiv zu sein, und der auf eine andere, vergangene und zukünftige Virilität verweist.
Hysterie und Dekadenz
Wenn der viril kodierte Wille in seiner Rückwendung ein Selbst her-vorbringt, das in der Position des Gestaltbaren, Materiellen, Weiblichen erscheint, dann stellt das moderne Subjekt eine Figur geschlechtlicher Ambivalenz dar. In der dritten Abhandlung der Genealogie wird der Effekt der Moral denn auch als Entmännlichung des Menschen (der, so muss geschlossen werden, immer schon ein männlicher Mensch gewesen ist) beschrieben:
»Will man damit ausdrücken, ein solches System von Behandlung habe den Men-schen verbessert, so widerspreche ich nicht: nur dass ich hinzufüge, was bei mir �›verbessert�‹ heißt �– ebenso viel wie �›gezähmt�‹, �›geschwächt�‹, �›entmuthigt�‹, �›raffinirt�‹, �›verzärtlicht�‹, �›entmannt�‹«.318
Die Schwächung des Menschen durch die Moral lässt sich damit an seiner Entmännlichung erkennen. Kastration und Virilität werden zu Chiffren für
�—�—�—�—�—�— 318 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 391
136 G R E N Z F I G U R E N
die Krankheit der Moderne und ihre (verlorene und wiederzugewinnende) Gesundheit: Dem kränklichen »Moral-Zärtling«319 wird der gesunde virile Mensch gegenübergestellt. In der Figur des »aggressive[n] Mensch[en], [der] als der Stärkere, Muthigere, Vornehmere, auch das freiere Auge, das bessere Gewissen auf seiner Seite«320 hat, verdichten sich Aggression, Kraft und Tapferkeit zu jener Selbstaffirmation, die das Subjekt unter den Be-dingungen der Moral verloren hat. So sollen, wie Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse ausführt, die Philosophen der Zukunft für die modernen Vor-stellungen von Wahrheit und Schönheit »nicht nur ein Lächeln, sondern einen ächten Ekel vor allem derartig Schwärmerischen, Idealistischen, Femininischen, Hermaphroditischen bereit« haben.321 Nicht nur die Ent-männlichung, auch das Weibliche, Zwitterhafte, Nicht-deutlich-Männliche steht an dieser Stelle für die Moderne, welche die �›Philosophen der Zu-kunft�‹ von sich weisen. Der Effekt der Moral wird als Feminisierung und Androgynisierung des Subjekts erkennbar, während sich ihre Überwindung durch Figuren ankündigt, die eine intellektuelle und körperliche Ablehnung solcher geschlechtlicher Ambiguitäten entwickeln; sie �›ekeln�‹ sich vor ih-nen. In der Vorstellung der Entmannung und Verweiblichung des moder-nen Subjekts verdichten sich allerdings mehrere Krankheitssymptome. Nietzsche geht es um eine Diagnostik der Moderne, welche ihre künstleri-schen von ihren selbstzerstörerischen Aspekten trennt �– eine Differenzie-rung, welche in der Genealogie anhand zweier unterschiedlicher Vorstellun-gen von Weiblichkeit vorgenommen wird: Die Schwangerschaft deutet auf die Überwindung der Moral hin, die Hysterie hingegen stellt eine Moderne dar, der die Produktivität und Zukunftsfähigkeit abgeht. Diese Differenz zwi-schen Schwangerschaft und Hysterie macht es möglich, den Gegensatz zu erfassen zwischen einer Krankheit, die auf eine neue Gesundheit hinführt, und einer, die sich in Selbstdestruktion verliert.
Die Vorstellung der Schwangerschaft tritt im Anschluss an die Figur des Mutterschoßes auf. Dabei wird das schlechte Gewissen als Krankheit beschrieben, die »wie die Schwangerschaft eine Krankheit ist«.322 Dieses Bild ermöglicht es, die Vorstellung einer Pathologie der Moderne zu reifi-
�—�—�—�—�—�— 319 Ebd., S. 254 320 Ebd., S. 311 321 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 143. Zu den sexualisierten Figuren von Nietzsches
Kritik an der Moderne gehören auch »die Species der moralischen Onanisten und �›Selbstbefriediger�‹« (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 370).
322 Ebd., S. 327
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 137
zieren und ihre Transformationsfähigkeit ins Spiel zu bringen: Die Schwangerschaft bezeichnet jenen textuellen Ort, an dem Nietzsches Kri-tik in Vision umschlägt. Schon in der Vorrede der Genealogie heißt es, dass die Moral eine Krankheit, aber auch Heilmittel und Stimulans sei.323 In Der Fall Wagner spricht Nietzsche von der anregenden Kraft der Krankheit: »Die Krankheit kann ein Stimulans des Lebens sein: man muss nur gesund genug für dies Stimulans sein!«324 Krankheit kann damit die Schwächung des Willens, sie kann aber auch einen anderen Begriff der Gesundheit bezeichnen. Im Lenzerheide-Fragment, einer Vorarbeit zur Genealogie,325 benützt Nietzsche das Bild der Katharsis, um die produktive Kraft der Krankheit zu beschreiben. Der Wert der nihilistischen Krise der Gegen-wart, heißt es da, bestehe darin, »daß sie reinigt, daß sie die verwandten Elemente zusammendrängt und sich an einander verderben macht«.326 Gesundheit bedeutet damit nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern, wie Thomas A. Long bemerkt, die Fähigkeit, sich im Leiden zu transfor-mieren.327 Stärker noch als die Vorstellung der Katharsis macht aber die Schwangerschaft dieses Potential der �›Krankheit�‹ deutlich. Der moderne Mensch geht demnach schwanger mit sich selbst; er befindet sich in der Hoffnung. Durch die Schwangerschaft kann das Leiden, das das Subjekt in seiner gewaltsamen Formation erfährt, als Anzeichen eines neuen Anfangs, einer neuen Geburt gedeutet werden: Das Weh des modernen Menschen mutiert zu seinen Wehen. Kann damit auch der Ekel der �›Philosophen der Zukunft�‹ vor allem �›Schwärmerischen, Idealistischen, Femininischen, Hermaphroditischen�‹ neu gedeutet werden? Ist es nicht so sehr der Ekel vor dem Weiblichen an sich als vielmehr der Ekel vor jenem Weiblichen, das nicht schwanger ist? (Und: Sind der Ekel und die Übelkeit vielleicht sogar Anzeichen und Effekt der Schwangerschaft?)
Vieles deutet jedenfalls darauf hin, dass Mutterschaft und Schwanger-schaft bei Nietzsche �›männliche�‹ Formen des Lebens bezeichnen. So er-scheint auch das Wesen, das sich mit dieser Schwangerschaft ankündigt, wiederum im Register einer kriegerischen Männlichkeit. Die Menschen von morgen sind »Geister, durch Krieg und Siege gekräftigt, denen die Erobe-rung, das Abenteuer, die Gefahr, der Schmerz sogar zum Bedürfniss ge-
�—�—�—�—�—�— 323 Ebd., S. 253 324 Nietzsche, Der Fall Wagner, S. 22 325Vgl. Stegmaier, Nietzsches �›Genealogie der Moral�‹, S. 49. 326 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 5[71], S. 217 327 Long, »Nietzsche�’s Philosophy of Medicine«, S. 119f.
138 G R E N Z F I G U R E N
worden ist«.328 Die Schwangerschaft markiert nicht den Übergang zur Androgynität, sondern zu einer neuen und gleichzeitig wiedererlangten Männlichkeit. Indem das Subjekt in einen �›durch Krieg und Siege gekräf-tigten Geist�‹ übergeht, scheint es mit der Schwangerschaft zugleich die Weiblichkeit abzustreifen, welche die Moderne kennzeichnet. Am Ende der Schwangerschaft steht nicht die Entbindung der Frau, sondern die Geburt einer neuen Männlichkeit, mit der die Feminisierung des modernen Mannes ein Ende nimmt. Die Schwangerschaft, von der in der Genealogie die Rede ist, wird damit zur Vision einer künftigen Selbstgeburt, mit der nicht nur die Krankheit der Moderne, sondern auch ihre Weiblichkeit und geschlechtliche Ambivalenz zurückgelassen wird. Die Schwangerschaft stellt eine Gelenkstelle zwischen Kritik und Vision dar, zwischen der aktu-ellen Krankheit und einer neuen Gesundheit, zwischen Gegenwart und Zukunft. Sie verweist auf ein Subjekt jenseits der Moral, dessen Konturen noch nicht ersichtlich sind, das sich erst am Horizont des Denkbaren ab-zeichnet. Die Figur der Schwangeren erscheint damit als Grenzfigur, die nicht das Außen des Subjekts markiert, sondern vielmehr durchquert wer-den muss, um ein anderes Subjekt jenseits dieser Grenze denkbar zu ma-chen. Sie stellt eine weiblich konnotierte Figur der Alterität dar, mit der sich das Subjekt paradoxerweise identifiziert, um seine Feminisierung hin-ter sich zu lassen.
Nietzsches Diagnostik der Gegenwart unterscheidet somit zwischen ei-ner Moderne, die auf eine neue Gesundheit verweist, und einer Moderne, die in Selbstdestruktion kippt. Während die Schwangerschaft für die Selbstüberwindung des modernen Menschen steht, verdichtet sich die Dekadenz in der Figur der �›Hysterikerin�‹:
»Vielleicht that damals �– den Zärtlingen zum Trost gesagt �– der Schmerz noch nicht so weh wie heute; wenigstens wird ein Arzt so schließen dürfen, der Neger (diese als Repräsentanten des vorgeschichtlichen Menschen genommen �–) bei schweren inneren Entzündungsanfällen behandelt hat, welche auch den bestorga-nisirten Europäer fast zur Verzweiflung bingen; �– bei Negern thun sie dies nicht. (Die Curve der menschlichen Schmerzfähigkeit scheint in der That außerordentlich und fast plötzlich zu sinken, sobald man erst die oberen Zehn-Tausend oder Zehn-Millionen der Übercultur hinter sich hat; und ich für meine Person zweifle nicht, dass gegen Eine schmerzhafte Nacht eines einzigen hysterischen Bildungs-Weib-chens gehalten, die Leiden aller Thiere insgesammt, welche bis jetzt zum Zweck
�—�—�—�—�—�— 328 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 336
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 139
wissenschaftlicher Antworten mit dem Messer befragt worden sind, einfach nicht in Betracht kommen.)«329
Anhand des Schmerzes wird an dieser Stelle eine eigenartige Bestimmung des modernen Menschen vorgenommen: Die Unempfindlichkeit der �›Ne-ger�‹ macht die Verweichlichung des Europäers deutlich, diese aber unter-scheidet sich wiederum vom Leiden der Hysterikerin. Ich werde auf den ersten Vergleich noch ausführlich zu sprechen kommen. An dieser Stelle soll gefragt werden, welche Grenzen die Hysterikerin markiert, und wie der (männliche) Europäer durch diese Grenze verortet wird. Die Hysterikerin ist, im Unterschied zu den feminisierten männlichen Figuren, eine der wenigen weiblichen Figuren, die in der Genealogie erscheinen. Sie markiert, zusammen mit den Tieren, eine Extremposition des Leidens. Rechnen wir Nietzsches eigenartige mathematische Gleichung des Schmerzes durch: Die Kurve der menschlichen Schmerzfähigkeit ist hoch, wo sie sich auf die �›oberen Zehntausend oder zehn Millionen der Überkultur�‹ bezieht, und fällt dann rapide ab. Die Grenzpositionen dieser Kurve werden von zwei Figuren dargestellt, welche sowohl die Geschlechterdifferenz als auch die anthropologische Differenz ins Spiel bringen. Das Leiden der Hysterikerin übersteigt während einer einzigen Nacht die Summe der Schmerzen, wel-che alle Tiere in wissenschaftlichen Versuchen je erlitten haben. Die schiere Unfassbarkeit der Relationen, derer sich dieser Vergleich bedient, macht deutlich, dass sich die Schmerzfähigkeit des �›hysterischen Bildungs-weibchens�‹ dem Unendlichen nähern muss. Wird diese Gegenüberstellung auf der Folie des ersten Vergleichs zwischen den �›Negern�‹ und dem Euro-päer gelesen, erscheint sie ungleich asymmetrischer. Das �›hysterische Bil-dungsweibchen�‹ und die Tiere übertreiben, übersteigern und parodieren die Differenz der Schmerzfähigkeit, die zwischen den �›Negern�‹ und dem euro-päischen Mann aufgetan worden ist.
Was aber stellt die Figur des �›hysterischen Bildungsweibchens�‹ dar? Welche Funktion kommt ihr in Bezug auf den Europäer zu, der sich im Zentrum dieses Vergleichs zu befinden scheint? Der �›Europäer�‹ und das �›hysterische Bildungsweibchen�‹ tauchen, im Gegensatz zu den �›Negern�‹ und den Tieren, beide auf der Seite der �›Kultur�‹ auf. Beide nehmen sie die Position der europäischen Moderne ein. Mit der Differenz zwischen dem potentiell �›bestorganisierten�‹ Europäer auf der einen und dem �›hysterischen Bildungsweibchen�‹ auf der anderen Seite scheint ein interner Unterschied
�—�—�—�—�—�— 329 Ebd., S. 303
140 G R E N Z F I G U R E N
der Moderne ausgelotet zu werden. Die Schmerzfähigkeit des Europäers, der gegenüber den �›Negern�‹ als wehleidig erscheint, wird durch den Kon-trast mit dem �›hysterischen Bildungsweibchen�‹ neu bestimmt. Er wird im Unterschied zu den �›Negern�‹ durch die Schmerzen einer schweren inneren Entzündung zur Verzweiflung gebracht, an was aber leidet sie? An der Nacht? An der Hysterie? Und ist die Hysterie Ursache oder Effekt ihres Leidens? Oder steht die Hysterikerin gerade für die Verwirrung von Ursa-che und Effekt, welche das Leiden in der �›Überkultur�‹ erfährt?330
Die versuchte Identifikation des �›Bildungsweibchens�‹ mit dem Bil-dungsmenschen jedenfalls führt zum Zusammenbruch beider Begriffe: Weiblichkeit wird zur Hysterie und Bildung zur Einbildung.331 Die intel-lektuelle und ästhetische Produktivität, die sich aus dem modernen Leiden, aus der Reflexivität des Willens ergibt, schlägt in die Reproduktion eines Leidens um, das nur noch sich selbst hervorbringt. Der Versuch der Hy-sterikerin, gebildet zu erscheinen, ist dabei noch nicht Ausdruck ihrer Deka-denz; hysterisch wird die Frau erst dadurch, dass ihr Spiel mit dem Schein als solches erkennbar wird. Die Frau, die von Natur aus Komödiantin ist, mutiert zur Hysterikerin, wenn sie die Kunst des Täuschens und Verstel-lens durch ihre Hinwendung zur Bildung aufgibt. Die Geschichte der Frauen in Nietzsches Text ist, wie Derrida bemerkt, »abwechselnd die Geschichte des Komödiantentums und der Hysterie«.332 In Jenseits von Gut und Böse wird die Frau als Lügnerin und Schauspielerin dargestellt, die dem wissenschaftlichen Glauben nicht angehört, sondern ihn vielmehr als männliche Torheit enthüllt. Das �›Weib�‹ beschäftigt sich unter gewissen Bedingungen mit der Wahrheit, aber es tut dies nie um der Wahrheit wil-len: »es will damit vielleicht Herrschaft. Aber es will nicht Wahrheit: was liegt dem Weibe an Wahrheit! Nichts ist von Anbeginn dem Weibe frem-der, widriger, feindlicher als Wahrheit �– seine grosse Kunst ist die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die Schönheit.«333 Die Frau
�—�—�—�—�—�— 330 Wird dem �›hysterischen Bildungsweibchen�‹ mit der Produktivität des Leidens auch die
Weiblichkeit abgesprochen? Sie ist nicht nur ein Weib, sie ist ein Weibchen. Verweist diese doppelte Versächlichung (und Verniedlichung) �– sie ist das Weib, und das Weibchen �– auf die Unfruchtbarkeit der Hysterikerin; und damit erneut auf ihre Differenz zur Schwan-geren?
331 Die Hysterie galt als Krankheit, in der das somatische Leiden durch die Wiederholung einer traumatischen Erfahrung kontinuierlich hervorgebracht und damit �›produziert�‹ wird. Vgl. Bronfen, The Knotted Subject, S. 177.
332 Derrida, »Sporen«, S. 141 333 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 171
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 141
verschafft sich als Schauspielerin einen Zugang zur Wahrheit, deren Re-gime sie nicht untersteht und die sie nicht versteht. Sie ist das Wesen, das die Wahrheit nicht wollen kann. Weil ihr Wollen darin besteht, unter kei-nen Umständen die Wahrheit zu wollen, ist sie Garantin einer anderen Logik, die nicht der Wahrheit verschrieben ist. Die Hinwendung des Weibs zur Wahrheit kann darum nur strategischen Charakter haben: Es ist entwe-der ein neues Schauspiel, in das sich das Weib einübt, oder der Versuch, sich dem Spiel der Wahrheit aus Gründen der Macht zu verschreiben. In beiden Fällen bleibt das Weib die Figur, in der die Kunst des Schauspiels zum Instinkt geworden ist. Warum aber erweckt dies die Ehre und Liebe der Männer? Was lieben sie an dieser Kunst und was am Weibe, das sich auf diese Kunst versteht?
Es scheint, als ob die Position der Alterität, welche die Frau eröffnet, Nietzsches Kritik an der Wissenschaft und am Glauben an die Wahrheit mit ermöglicht. Das bedeutet aber nicht, dass der männliche Kritiker zur Frau wird. Vielmehr gibt es eine signifikante Distanz zwischen dem Mann, der in das Regime der Wahrheit eingebunden ist, und der Frau, die diesem Glauben nie folgte. Sie macht ein mögliches Außen zur Wahrheit denkbar; ihr Blick auf die Wahrheit aber besitzt nicht die Tiefe desjenigen, der der Wahrheit verfallen war und sich nun über sie hinausbewegt. Wenn es in der Vorrede der Genealogie heißt, dass der Autor als dreizehnjähriger Knabe das Problem vom Ursprung des Bösen hatte lösen wollen, indem er Gott zum Vater des Bösen erklärt hatte, wird diese Verknüpfung von Wahrheit mit einer männlichen Genealogie, zu der die Frau nur ein Außen bilden kann, ersichtlich. Der frühere Knabe jedoch, der den Glauben an Gottva-ter verwirft und sich stattdessen anschickt, die lange Geschichte dieses Glaubens zu schreiben, findet dadurch »ein eignes Land, einen eignen Boden [�…], eine ganze verschwiegene wachsende blühende Welt, heimli-che Gärten gleichsam, von denen Niemand Etwas ahnen durfte�…«.334 Solche territorialen Bewegungen auf dem Gebiete der Wahrheit und ihrer Kritik kann die Frau nicht vollziehen. Der Mann überwindet die Wahrheit, indem er die Geschichte seines Glaubens an die Wahrheit erneut durch-quert. Die Frau hingegen kann die Wahrheit nur aus der Distanz als eine Torheit betrachten, der sie nie verfallen war und deren Welt ihr verschlos-sen bleibt.
�—�—�—�—�—�— 334 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 249
142 G R E N Z F I G U R E N
Was aber ist die Funktion der Frau für die Wahrheitskritik, die an eine männliche Position gebunden bleibt? Nietzsche schreibt:
»Gestehen wir es ein, wir Männer: wir ehren und lieben gerade diese Kunst und diesen Instinkt am Weibe: wir, die wir es schwer haben und uns gerne zu unsrer Erleichterung zu Wesen gesellen, unter deren Händen, Blicken und zarten Thorheiten uns unsrer Ernst, unsre Schwere und Tiefe beinahe wie eine Thorheit erscheint.«335
Ermöglicht die Frau den Männern damit, den Blick auf sich selbst umzu-kehren? Ermöglicht das Weib, wie Derrida schreibt, eine Beziehung zur Wahrheit, die zwischen Nähe und Distanz verharrt?336 Unter den �›Händen, Blicken und zarten Torheiten�‹ der Frauen kann der metaphysische Ernst der Männer als Schauspiel erkannt werden. Die Frau ist der Spiegel, der »vom (männlichen) �›Subjekt�‹ besetzt wird, um sich darin zu reflektieren, sich selbst zu verdoppeln«.337 Die imaginäre Perspektive der Frau macht es den Männern möglich, sich durch die Frau wie in einem Spiegel zu erblicken und dadurch einen anderen Selbstbezug herzustellen.338 Das Weib ist der
�—�—�—�—�—�— 335 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 171 336 Derrida schreibt dazu: »Die Verführung durch die Frau wirkt durch die Ferne, die
Distanz ist das Element ihrer Macht. Doch von diesem Gesang, von diesem Zauber muß man sich fernhalten, man muß sich von der Distanz auf Distanz halten, nicht nur, wie man glauben könnte, um sich vor dieser Faszination zu hüten, sondern ebenso, um sie zu empfinden. Die (fehlende) Distanz ist nötig, man muß sich auf Distanz halten (Di-stanz!) �– dies fehlt uns, dies versäumen wir zu tun; dies erinnert auch an einen Rat von Mann zu Mann: um zu verführen und sich selbst nicht verführen zu lassen.« (Derrida, »Sporen«, S. 135) Dieser entscheidende Gedanke, dass nämlich über die Figur der Frau und des Weiblichen verschiedene männliche Selbstverhältnisse hergestellt werden, wird in Derridas Aufsatz nicht weiter ausgeführt. Derrida konzentriert sich stattdessen auf das Paradox der Frau als undarstellbare Darstellung der Wahrheit. Damit wird, wie Spivak bemerkt, das verklärende Spiel der Distanzierung fortgeführt: »[P ]aradoxically, when Derrida follows Nietzsche�’s lead, it results not in an abolishment but in a dis-tanced embracing, of a doubly displaced woman.« (Spivak, »Displacement and the Dis-course of Woman«, S. 181)
337 Irigaray, »Das Geschlecht, das nicht eins ist«, S. 29 338 Auch in Also sprach Zarathustra erhält die Frau, wie Annemarie Pieper ausführt, eine
solche Funktion des Spiegels: »Auch sie [die Frau], obwohl sie nicht fähig oder nicht dazu prädestiniert ist, das Ideal des Übermenschen in concreto zu verwirklichen, steht dennoch im Dienst dieses Ideals bzw. stellt sich in seinen Dienst und macht sich selbst zu dessen Spiegel; sie veredelt sich selbst und macht sich dem Manne auf eine besondere Weise kostbar, indem sie in ihrem Verhältnis zu ihm Gefahr und Spiel bewußt so mit-einander kombiniert, daß dadurch in ihm jene Tugenden gefördert werden, die ihn zu Selbstüberwindung tauglich machen und zum Übermenschen hinführen.« (Pieper, »Ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch«, S. 307)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 143
Umweg, den der Blick und die Hände der Männer zurücklegen, um sich auf andere Weise zu berühren �– und vielleicht um sich überhaupt zu berühren? Der imaginierte taktile Blick des Weibs ermöglicht es ihnen, sich selbst auf den Leib zu rücken. Mit den Fingern der Frauen berühren sich die Männer selbst �– und ertasten dabei �›beinahe�‹ eine Torheit. Durch das Wort �›bei-nahe�‹, das das weibliche Urteil von der männlichen Selbstwahrnehmung trennt, wird die Distanz, bevor sie sich auflösen könnte, wieder eingeführt; die Distanz, die das männliche Spiel mit der weiblichen Dis/Identifikation aufrechterhält. Die Funktion der Frau erschöpft sich somit nicht darin, die Grenze zwischen der Wahrheit und ihrem Außen zu markieren. Sie be-zeichnet einen Ort am Rande des Wissbaren, der vom männlichen Kritiker (beinahe) eingenommen werden kann. Über die Grenzfigur des �›Weibes�‹, welche ein Außen der Wahrheit repräsentiert, eröffnet sich dem Subjekt jene Außenperspektive, welche für seine Kritik unterlässlich ist.
Dieses Spiel aber wird, wie Irigaray festhält, von der Hysterikerin un-terbrochen. »Sie [die Hysterikerin] schweigt und gleichzeitig mimt sie. Und �– wie könnte es anders sein? �–, indem sie eine Sprache, die nicht ihre ist, die männliche Sprache, mimetisch reproduziert, karikiert und verzerrt sie sie: Sie �›lügt�‹, sie �›betrügt�‹ �– Eigenschaften, die den Frauen immer zuge-schrieben werden.«339 Die Frau lügt sowieso, die Lüge der Hysterikerin aber besteht darin vorzugeben, dass sie nicht mehr lügt. Weil sie sich der Wahrheit zuwendet, vergisst das �›Bildungsweibchen�‹ die Kunst des Schau-spiels. Der Blick dieser Frau wendet sich von den Männern ab zur Wahr-heit, die sie zuvor als Torheit enthüllt hat. Ihr Blick spiegelt nicht mehr; er folgt dem Blick des Mannes, mimt und reproduziert ihn. Damit verschiebt sich der Blick des Mannes auf die Hysterikerin. Nun erscheint sie als Kari-katur jenes Glaubens an die Wahrheit, dessen sie ihn hätte überführen sollen.340
In der Genealogie wird die Hysterikerin unter dem Blick des Diagnosti-kers zum Symptom der Dekadenz; ein Symptom, das in seinem Bezug zum Leiden bestimmt wird. Während der Europäer (im Gegensatz zu den �›Ne-gern�‹) seinen physischen Schmerz ins Register des Psychischen übersetzt,
�—�—�—�—�—�— 339 Irigaray, »Fragen«, S. 142 340 Der männliche Blick, der sich in der Hysterikerin nicht (mehr) spiegeln kann, wird zum
beobachtenden Blick. »[M]an hat die hysterischen Frauenzimmer [�…] darauf hin zu beob-achten, wie regelmäßig Falschheit aus Instinkt, Lust zu lügen, um zu lügen, Unfähigkeit zu geraden Blicken und Schritten der Ausdruck von décadence ist.« (Nietzsche, Der An-tichrist, S. 233) Die Hysterikerin ist damit der �›verweigerte Spiegel�‹.
144 G R E N Z F I G U R E N
ist es bei der Hysterikerin die Psyche, welche nun körperliche Schmerzen hervorbringt. Die Bedeutung des Leidens wird damit erneut umgeschrie-ben. In der Hysterie wird das Leiden nicht mehr wie im schlechten Gewis-sen in »eine Fülle von neuer befremdlicher Schönheit und Bejahung«341 übersetzt und damit in neue Formen der Affirmation überführt. Das hyste-rische Leiden ist vielmehr das Leiden an sich selbst. Der Schmerz der Hys-terikerin bringt sich kontinuierlich selbst hervor, ohne jenen Mehrwert zu erzeugen, der sich in ein kulturelles oder intellektuelles Register übersetzen lässt. »This enigmatic of all psychosomatic disturbances is to Nietzsche such a useful trope for modernity because the hysteric uses her nervous illness, her �›belatedness and overexcitedness�‹, as stimulation«.342 Die hys-terische Ökonomie von Überreizung und Stimulation trifft sich mit Nietz-sches Kritik an einer Moderne, die nur noch damit beschäftigt ist, ihre eigenen Symptome zu vervielfachen. Damit fällt die notwendige Spannung zwischen Krankheit und Gesundheit, sozialer Disziplinierung und kultu-reller Produktivität zusammen. An die Stelle der Kultur tritt die Überkul-tur, an die Stelle des kranken Europäers tritt die hysterische Europäerin, an die Stelle des Bildungsmenschen die Pseudogebildete. Die produktive Am-bivalenz des �›schlechten Gewissens�‹, welches als Ort der Selbstrepression und Selbstformation sowohl das Leiden des modernen Menschen als auch die Möglichkeit seiner Selbstüberwindung hervorbringt, fällt in sich zu-sammen. Die Hysterie stellt die Gegenfigur zur Schwangerschaft dar; sie ist die Moderne, der das �›Zukunftsvolle�‹ abgeht. An den schmerzhaften Nächten des Bildungsweibchens haftet nur noch der schale Geschmack der Dekadenz.
Das �›hysterische Bildungsweibchen�‹ unterscheidet sich aber nicht nur vom bestorganisierten Europäer, sondern auch von jenen �›Zärtlingen�‹, an die sich der Text zugleich tröstend und verächtlich wendet: �›den Zärtlingen zum Trost gesagt�‹. Ist der Zärtling der �›bestorganisierte Europäer�‹? Oder droht er in die Nähe des �›hysterischen Bildungsweibchens�‹ zu geraten? Und was tröstet den Zärtling? Dass die früheren Menschen, die das Leiden Anderer als »Verführungs-Köder zum Leben«343 erachtet haben, am Leiden noch nicht so sehr gelitten haben? Dass die Grausamkeit, der sie sich aus-gesetzt haben, im Vergleich zu dem, was sich der moderne Mensch antut, kaum ins Gewicht fällt? Sind die Zärtlinge dieselben Männer, über die
�—�—�—�—�—�— 341 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 326 342 Bronfen, The Knotted Subject, S. 225 343 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 303
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 145
Nietzsche spottet wegen ihrer »fast weiblichen Unfähigkeit, Zuschauer dabei bleiben zu können, leiden lassen zu können«?344 Sind sie Ausdruck der »moralischen Versüsslichung und Falschheit, [des] innerlichsten Femi-nismus«345 alles Modernen? Führt der Text den �›Zärtlingen�‹, an die er sich wendet, die Hysterikerin als Beispiel einer Moderne vor, in der das Leiden seine produktive Kraft verliert?346 Die Hysterikerin markiert eine andere Grenze von Nietzsches Kritik als die Komödiantin. Während das Subjekt zu ihr ein Spiel der Dis/Identifikation aufrechterhält, steht die Hysterikerin für eine Grenze, an der die Moderne die Möglichkeit ihrer Selbstüberwin-dung einbüßt und zur Dekadenz wird. Diese Grenze erscheint nicht als Schwelle, die auf etwas anderes hin übertreten werden kann. Es ist eine Grenze, an der die Kritik, weil sie nicht mehr auf die Transformation des Subjekts hinarbeiten kann, das Interesse an ihrem Gegenstand verliert.
Diese, für Nietzsches Kritik entscheidende Differenz zwischen einer interessanten und einer dekadenten Moderne wird durch die Positionen der Schwangerschaft und der Hysterie artikuliert. Damit lassen sich auch bedeutsame Unterschiede zwischen der Figur der Frau bei Hegel und Nietzsche ausmachen. Hegels moderne Gesellschaftsordnung basiert auf der Trennung zwischen einer weiblichen Sphäre der Familie und einem männlichen Bereich des Staats. Er setzt die Frau mit der Familie gleich, welche die unbewusste Seite der Sittlichkeit und damit auch die konstitu-tive Grenze zwischen Natur und Welt darstellt. Diese Grenze, an der die Frau angesiedelt ist, wird bei Nietzsche, welcher die moderne Gesell-schaftsordnung nicht begründet, sondern angreift, ähnlich gezogen, aber strategisch anders eingesetzt. Auch bei Nietzsche steht die Frau an der Grenze zwischen Kultur und Natur, indem sie sich außerhalb von Wahrheit, Wissenschaft und Bildung befindet. Dadurch verkörpert sie eine Figur, die von den �›krankmachenden�‹ Aspekten der Moderne wenig berührt ist: »Das, was am Weibe Respekt und oft genug Furcht einflösst, ist seine Natur, die �›natürlicher�‹ ist als die des Mannes«.347 Trotz ihrer Präsenz in der Kultur ist die Natur der Frau nicht derart umgestaltet wie diejenige des Mannes; dies
�—�—�—�—�—�— 344 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 125 345 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 386 346 Mit der Hysterikerin wird eine Grenze markiert, die einzelne Männer (wie etwa Richard
Wagner) bereits überschritten haben. »Wagner�’s Kunst ist krank. Die Probleme, die er auf die Bühne bringt �– lauter Hysteriker-Probleme �–, das Convulsivische seines Affekts, seine überreizte Sensibilität [�…]: Alles zusammen stellt ein Krankheitsbild dar, das kei-nen Zweifel lässt. Wagner est une névrose.« (Nietzsche, Der Fall Wagner, S. 22)
347 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 178
146 G R E N Z F I G U R E N
aber nur, weil sie in einem gewissen Sinne im Außen der Kultur verbleibt.348 Im Zuge von Nietzsches Kritik am (männlichen) Glauben an die Über-windung der Natur durch Vernunft und Wissenschaft, rückt damit eine faszinierende Andersheit der Frau ins Zentrum. Sie verfügt über das Ver-mögen, ihre Instinkthaftigkeit in der Kultur zu bewahren und erscheint als eine Reminiszenz des Wilden in der Kultur. Versucht sie allerdings, sich die Logik der Bildung anzueignen, wird sie umgehend zur Figur für eine an-dere Grenze.349 Die Überreizung der Nerven, die Hypersensibilität, an welcher die Hysterikerin zu leiden beginnt, markiert dann für den femini-sierten Mann, den �›Zärtling�‹, eine Limite, die er nicht überschreiten darf. Damit wird auch deutlich, dass der moderne Mann nicht zur Frau werden soll. Die kulturelle Naivität der Komödiantin bleibt ihm versagt, und der destruktive Zirkel der Hysterikerin zerstört ihn. Sein Ziel kann nur sein, das Leiden in eine neue Produktivität zu überführen.350 Nicht der hysteri-sche, sondern der schwangere Mann ist es, der das Leiden an der Moral affirmiert und es dadurch überschreiten kann �– und mit ihm auch seine geschlechtliche Ambiguität.
Das schlechte Gewissen und die Logik der Unterwerfung
In der Genealogie wird ein Geschlechterdiskurs mobilisiert, in dem die Ef-fekte der Moral als �›Entmännlichung�‹ des Menschen erscheinen. Wie aber �—�—�—�—�—�— 348 Nietzsche mobilisiert an dieser Stelle die Vorstellung, dass die Überwindung der Natur
bei der Frau nur partiell erfolgt. »Die von ihm [dem Mann] überwundene Natur und Wildheit ist dabei in der Frau nur gezügelt; sie droht jederzeit auszubrechen.« (Weigel, Die nahe Fremde, S. 179)
349 Das bezieht sich nicht nur auf die Forderung von Frauen, Zutritt zur Wissenschaft zu erhalten, sondern auch auf die Forderung politischer und gesellschaftlicher Gleichstel-lung. Dadurch läuft die Frau, die der Natur noch näher steht als der Mann, Gefahr, des-sen �›Krankheit�‹ zu erwerben: »Freilich, es giebt genug blödsinnige Frauen-Freunde und Weibs-Verderber unter den gelehrten Eseln männlichen Geschlechts, die dem Weibe anrathen, sich dergestalt zu entweiblichen und alle die Dummheiten nachzumachen, an denen der �›Mann�‹ in Europa, die europäische �›Mannhaftigkeit�‹ krankt, �– welche das Weib bis zur �›allgemeinen Bildung�‹, wohl gar zum Zeitungslesen und Politisiren herunterbrin-gen möchten.« (Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 177)
350 Kelly Oliver schlägt in diesem Zusammenhang vor, zwischen Metaphern des Weiblichen und der Mutterschaft zu unterscheiden: »Some of the ambiguity in Nietzsche�’s relation to the feminine can be explained by separating the feminine from the maternal« (Oliver, Nietzsche�’s Abjection, S. 53).
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 147
wird diese begründet, wie wird sie erzählt, was geht ihr voraus? Eine Er-zählung führt die Entstehung des schlechten Gewissens auf eine doppelte Bewegung zurück: einerseits auf die Unterwerfung des Menschen unter den Staat und andererseits durch die Unterwerfung des Willens unter sich selbst:
»�– dass der älteste �›Staat�‹ demgemäss als eine furchtbare Tyrannei, als eine zer-drückende und rücksichtslose Maschinerie auftrat und fortarbeitete, bis ein solcher Rohstoff von Volk und Halbthier endlich nicht nur durchgeknetet und gefügig, sondern auch geformt war. Ich gebrauche das Wort �›Staat�‹: es versteht sich von selbst, wer damit gemeint ist �– irgend ein Rudel blonder Raubthiere, eine Eroberer- und Herren-Rasse, welche kriegerisch organisirt und mit der Kraft, zu organisiren, unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer überlegene, aber noch gestaltlose, noch schweifende Bevölkerung legte.«351
Der Anfang dessen, was Nietzsche als �›Staat�‹ beschreibt, die soziale Orga-nisation der Menschen, wird an dieser Stelle aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beschrieben. Für die Bevölkerung, welche in den Staat ge-zwungen wird, ist dieser eine �›zerdrückende und rücksichtlose Maschine-rie�‹, der die Menschen mit Gewalt gefügig macht. Für die Eroberer, welche �›unbedenklich ihre furchtbaren Tatzen auf die Bevölkerung legen�‹, ist die Formation des Staates eine ästhetische Tat, die Herstellung eines Werks, dem sie selbst äußerlich bleiben. Sowohl aus der Perspektive der Unter-worfenen wie auch der Unterwerfer kommen die Anderen nicht als menschliches Gegenüber zum Vorschein; in einem Falle werden sie als überwältigende �›Maschinerie�‹ wahrgenommen, im anderen als �›Rohstoff�‹ für das eigene Werk. Die Entstehung des Staates geht auf das gewaltsame Zusammentreffen von zwei Menschengruppen zurück, in dem die Alterität beider ausgelöscht wird.
Die Gewalt ist anfänglich einseitig, denn es gibt keinen Kampf und kei-nen Widerstand der Bevölkerung gegen ihre Eroberer. Sie ist den �›Gewalt-Künstlern�‹ ausgesetzt, ohne ihnen etwas entgegensetzen zu können. Die Staatsgründung kommt über sie wie ein Verhängnis, »gegen das es keinen Kampf und nicht einmal ein Ressentiment gab«.352 Die Bevölkerung, die in die Organisationsform des Staates gezwungen wird, kann ihre Eroberer nicht einmal mit den Waffen der Schwachen bekämpfen �– dem �›Ressenti-ment�‹, das die Starken zu Schlechten macht und sie mit den Mitteln der Moral angreift. Wie aber verhalten sich die Eroberer zur Gewalt, die sie der �—�—�—�—�—�— 351 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 324 352 Ebd.
148 G R E N Z F I G U R E N
Bevölkerung antun? Sie scheinen ganz von ihrem Werk eingenommen zu sein; von einem �›Künstler-Egoismus�‹ getrieben, legen sie ihre �›furchtbaren Tatzen�‹ �›unbedenklich�‹ auf die eroberte Bevölkerung. Ihr Zugriff auf die Bevölkerung entspricht der Gewalt des Herstellens; der Gewalt, die einem Material angetan wird, um es in eine Form zu bringen. Aus der Sicht der Eroberer scheint die Gewalt an den Anderen eine instrumentelle Gewalt zu sein, die auf den Zweck des Kunstwerks ausgerichtet bleibt. Dass die �›Ge-walt-Künstler�‹ kein Mitleid für die Bevölkerung empfinden, zeigt außer-dem, dass sie sich außerhalb der Bedingungen der Moral befinden. Sie ermöglichen die Entstehung des schlechten Gewissens ohne unter seinen Bedingungen zu stehen: »Sie wissen nicht, was Schuld, was Verantwort-lichkeit, was Rücksicht ist«.353
Was aber ist diese Bevölkerung, die den Gewaltskünstlern ausgeliefert wird, wer sind diese Menschen vor ihrer Unterwerfung unter die Gewalt des Staates? In der Erzählung treten sie nur als kollektive Einheit, als �›Bevölke-rung�‹ auf, die als �›gestaltlos und noch schweifend�‹, �›ungehemmt�‹ und �›unge-staltet�‹ beschrieben wird. Der Begriff der Bevölkerung scheint eine lose Gruppe von Menschen zu bezeichnen, die sich bewegt, ohne organisiert, geformt und strukturiert zu sein; Menschen vor ihrer Individualisierung, die erst mit der Entstehung der Gesellschaft einsetzen wird. Ist die gestal-terische Gewalt der Eroberer in der Narration dieser Eroberung bereits am Werk? Ist der Geschichte dieser Eroberung die Perspektive der Eroberer bereits eingeschrieben? Eine Perspektive, die es möglich macht, die unter-worfenen Menschen als Rohstoff für ein Werk, ihre Eroberung als künstle-rischer Akt und die Gewalt, die dabei zur Anwendung gelangt, als ästheti-sches Gestaltungsmittel zu betrachten? Denn muss die Bevölkerung nicht als �›gestaltlos�‹ erscheinen, um gestaltet werden zu können? Muss sie nicht als �›schweifend�‹ beschrieben werden, um organisiert werden zu können? Muss sie nicht zum Rohstoff gemacht werden, bevor sie als Rohstoff be-handelt werden kann? Die Logik der Eroberer scheint im Text in zweifa-cher Weise am Werk zu sein: Sie wird im Akt der Staatenbildung beschrie-ben und sie manifestiert sich in der Darstellung der Eroberten als gestalt-lose Bevölkerung, die zum Rohstoff für ein Werk, und in der Darstellung der Eroberer, die zu Künstlern werden.
Die Unterwerfung der Anderen und ihre Transformation zum �›Roh-stoff�‹ des eigenen Willens setzt sich im Inneren der Unterworfenen fort;
�—�—�—�—�—�— 353 Ebd., S. 325
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 149
das Unterwerfungsszenario, das sich zwischen den Eroberern und der ungestalteten Bevölkerung ereignet, wird zum Organisationsprinzip des schlechten Gewissens: »der Stoff, an dem sich die formbildende und ver-gewaltigende Natur dieser Kraft auslässt, [ist] hier eben der Mensch selbst, sein ganzes thierisches altes Selbst [�…] und nicht, wie in jenem grösseren und augenfälligeren Phänomen, der andre Mensch, die andren Menschen«.354 Die Unterwerfungsszene, mit der der Staat begründet wird, ereignet sich auch in der Innerlichkeit des Selbst, wo sie nun kontinuierlich wiederholt wird. Die Entstehung des schlechten Gewissens geht sowohl darauf zu-rück, von einer äußeren Macht unterworfen zu werden, als auch darauf, sich selbst zu unterwerfen. Die Vergewaltigung des alten tierischen Selbst und seine Verwandlung in eine Materie, die geformt werden kann, ist also bereits eine Wiederholung, eine Re-Inszenierung jener mythischen Unter-werfungsszene, mit der das Subjekt seinen Anfang nahm. Die Virilität eines Willens, der sich im schlechten Gewissen als �›Künstler�‹ seines Selbst eta-bliert, ist immer schon gebrochen; seine Selbstunterwerfung ereignet sich immer schon auf dem Hintergrund einer vorgängigen Unterwerfung, deren Effekt, die Rückwendung des Willens, zur neuen Bedingung seines Daseins wird.
Diese Entstehung des schlechten Gewissens aber wird in einer anderen Erzählung angefochten, in der es nicht der Sieg der Herrschenden über die Beherrschten ist, der den Willen dazu zwingt, sich auf sich selbst zurück-zuwenden. Vielmehr folgt die Moral dabei einer Logik der Kastration, die gerade von den Kastrierten entwickelt und angewendet wird.
Die Kastratenmoral
Die Vorstellung der Moral als Entmannung wird in einem nachgelassenen Fragment expliziert, das den Titel »Moral-Castratismus. �– Das Castraten-Ideal« trägt und vermutlich kurz nach der Niederschrift der Genealogie ent-standen ist. Nietzsche notiert darin: »Die Klugheit des Moral-Castratismus. Wie führt man Krieg gegen die männlichen Affekte und Werthungen? Man hat keine physischen Gewaltmittel, man kann nur einen Krieg der List, der Verzauberung, der Lüge, kurz �›des Geistes�‹ führen.«355 Der doppeldeutige �—�—�—�—�—�— 354 Ebd., S. 326 355 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 548
150 G R E N Z F I G U R E N
Begriff des Geistes, der sich sowohl auf den Intellekt wie auch auf den jü-disch-christlichen Gott bezieht, erscheint dabei als Instrument einer weibli-chen Strategie im Krieg gegen die männliche Lebensweise; ein Krieg, der sich gegen die Männlichkeit wendet, um sie zu kastrieren.356 Aber sind Feldzüge und Kriege nicht männliche Unternehmungen? Kann, wenn der Krieg männlich kodiert ist, ein Krieg der �›List, der Verzauberung, der Lüge�‹ überhaupt als Krieg gelten? Oder ist in diesem Begriff eines Kriegs des Geistes bereits die List, Verzauberung und Lüge am Werk? Täuscht der Geist einen Krieg gegen die männlichen Affekte und Wertungen vor? Wird durch die Vorstellung eines Kriegs des Geistes bereits vorgeführt, was sich mit den männlichen Affekten und Werten ereignet, dass sie nämlich umge-deutet, subvertiert, und parodiert werden?357
Dass die Moral dem Krieg entgegengesetzt ist, wird zu Beginn des Fragments festgehalten. Der Moralkastratismus geht demnach auf eine Gesellschaft zurück, die die Kriegsführung aufgegeben hat. Die entschei-dende Veränderung ereignet sich allerdings nicht mit der Absenz kriegeri-scher Handlungen, sondern dadurch, dass die �›feindliche Gesinnung�‹ ver-boten wird, die dem Krieg zugrunde liegt. Nicht nur die kriegerische Tat wird verboten, sondern auch die kriegerische Haltung, die eine solche Tat möglich macht.
»Nun tritt der Moral-Idealist auf und sagt �›Gott siehet das Herz an: die Handlung selbst ist noch nichts; man muß die feindliche Gesinnung ausrotten, aus der sie fließt�…�‹ Darüber lacht man in normalen Verhältnissen, nur in Ausnahmefällen, wo eine Gemeinschaft absolut außerhalb der Nöthigung lebt, Krieg für ihre Existenz zu führen, hat man überhaupt das Ohr für solche Dinge. Man läßt eine Gesinnung fahren, deren Nützlichkeit nicht mehr abzusehen ist. Dies war z. B. beim Auftreten
�—�—�—�—�—�— 356 Von einem Krieg der Moral ist auch in der Genealogie die Rede, wo es heißt, dass das
schlechte Gewissen aus einer »Kriegserklärung gegen die alten Instinkte« (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 323) hervorgegangen ist.
357 Ein Zusammenhang zwischen Geist und Kastration wird auch in der Genealogie bemüht. Die Kastration wird dabei zu einer Chiffre für die asketische Forderung der Wissen-schaft, den eigenen Willen zurückzuweisen: »Den Willen aber überhaupt eliminiren, die Affekte sammt und sonders aushängen, gesetzt, dass wir dies vermöchten: wie? hiesse das nicht den Intellekt castriren?�…« (Ebd., S. 365) An dieser Stelle wird nicht nur deut-lich, dass der Intellekt durch die asketische Forderung der Enthaltung entmannt wird, sondern auch, dass der Wille, indem er kastriert zu werden droht, mit der Männlichkeit gleichgesetzt wird. Von Kastration ist auch bei der Beschreibung der Mnemotechnik in der zweiten Abhandlung die Rede (ebd., S. 295).
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 151
Buddhas der Fall, innerhalb einer sehr friedlichen und selbst geistig übermüdeten Gesellschaft.«358
Die Bedingung für die Verinnerlichung eines moralischen Gesetzes, das jede Gewalt am Anderen verbietet, ist damit eine Gesellschaft, die sich vom Krieg abgewendet hat. Das Konzept des Friedens, das auch die mo-derne Politik Europas prägt, wird zum Symptom einer Lebensmüdigkeit und der Buddhist zum Zeichen einer Kultur des Nihilismus, die auch Eu-ropa ergreift.359 Die Vorstellung eines selbstzerstörerischen Willens, der sich gegen sich selbst wendet und sich damit seiner Kräfte beraubt, tritt an dieser Stelle als geistige Usurpation durch eine andere Kultur auf. Nietz-sche beschreibt das Europa, das sich selbst unheimlich wird, als ein Eu-ropa, das zum östlichen Anderen mutiert.
Der Verlust einer kriegerischen Gesinnung durch die »buddhistisch-christliche« Losung der Nächstenliebe und des Mitleids trifft in Europa aber auf eine Gegenkraft. Anders als die Buddhisten vollziehen die jüdisch-christlichen Europäer die Wendung zum Nihilismus (noch) nicht. Viel-mehr führt das Verbot des Kriegs zu einer neuen Art der Kriegsführung und die Absage vom Feind zu einer neuen Art der Feindschaft. Für diese Darstellung der Moral aber wird auf eine andere ethnisch-religiös kodierte
�—�—�—�—�—�— 358 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 545 359 In der Genealogie wird dieser Nihilismus ebenfalls am Buddhismus festgemacht: »ich
verstand die immer mehr um sich greifende Mitleids-Moral, [�…] als das unheimlichste Symptom unsrer unheimlich gewordnen europäischen Cultur, als ihren Umweg zu ei-nem neuen Buddhismus? zu einem Europäer-Buddhismus? zum �– Nihilismus?�…« (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 252) Benjamin A. Elman bemerkt, dass Nietz-sches Vorstellungen des Buddhismus vor allem auf seine Schopenhauer-Lektüre zurück-zuführen seien. Mit Nietzsches wachsender Kritik an Schopenhauer wird der Buddhis-mus zur Verkörperung desjenigen, was Europa durch den Nihilismus droht. »Nietzsche attacked Buddhism as if it were a spectre haunting Europe. His fear was that the rise of pessimism in Europe would culminate in the triumph of the weary and passive nihilism that Buddhism and Schopenhauer represented. [�…] The nihilist catastrophe, which ac-cording to Nietzsche had ruined Indian culture, would repeat itself in the West.« (Elman, »Nietzsche and Buddhism«, S. 680) Während der Buddhist die Kastrationsmoral des Ni-hilismus repräsentiert, erscheint an anderen Stellen der Chinese in der Position des Kas-traten. Der Chinese wird zur Figur für den durchschnittlich und berechenbar gemachten Menschen, dem mit der Männlichkeit auch die Individualität genommen wird. So heißt es in Ecce Homo, die Forderung, die Menschen müssten alle �›gut�‹ werden, »hiesse die Menschheit castriren und auf eine armselige Chineserei herunterbringen!« (Nietzsche, Ecce homo, S. 369) Vgl. dazu Hsia/Cheung, »Nietzsche�’s Reception of Chinese Culture«. In dieser Vorstellung des kastrierten Chinesen scheint jene Figur des unmännlichen Chinesen auf, die Hegel in den Geschichtsvorlesungen verwendet.
152 G R E N Z F I G U R E N
Figur zurückgegriffen. Es sind die Juden, welche die Voraussetzungen für die Entwicklung der christlichen Moral geschaffen haben sollen.360 »Dies war insgleichen bei der ersten Christengemeinde (auch Judengemeinde) der Fall, deren Voraussetzung die absolut unpolitische jüdische Gesellschaft ist.«361 Der »Europäer-Buddhismus«362 hat seinen Anfang längst genom-men; wo aber liegt sein Anfang? Ist es die erste Christengemeinde? Oder ist diese, wie die Klammer suggeriert, auch eine Judengemeinde, könnte man sie für eine halten oder sie mit ihr verwechseln? Betreten wir an dieser Stelle jenen �›Spiegelsaal der Projektionen�‹, der sich, so Eva M. Knodt, zwi-schen dem christlichen Subjekt und seinen Figuren der Alterität eröff-net?363 Das Christentum und seine Kastratenmoral jedenfalls, so legt Nietzsche dar, muss auf das Judentum zurückgeführt werden.
»Das Christenthum konnte nur auf dem Boden des Judenthums wachsen, d.h. innerhalb eines Volkes, das politisch schon Verzicht geleistet hatte und eine Art Parasiten-Dasein innerhalb der römischen Ordnung der Dinge lebte. Das Chri-stenthum ist um einen Schritt weiter: man darf sich noch viel mehr �›entmannen�‹, �– die Umstände erlauben es.«364
Die Verinnerlichung des Verbots also, der Schritt, nicht nur die kriegeri-sche Tat, sondern auch den Willen zu dieser Tat zu verbieten, haben nicht nur die Buddhisten außerhalb Europas, sondern auch die Juden innerhalb Europas vollzogen.365 Um diesen europäischen Anfang des Moralkastratis-mus zu erzählen, werden aber bereits neue, ethnisch markierte Figuren ins Spiel gebracht: »In praxi geht diese Species Mensch zu Grunde, sobald die Ausnahmebedingungen ihrer Existenz aufhören �– eine Art Tahiti und
�—�—�—�—�—�— 360 Sander L. Gilman weist darauf hin, dass die Konstitution des christlichen europäischen
Selbst bei Nietzsche mit der Figur des Juden eng verknüpft ist. Vgl. Gilman, »Heine, Nietzsche and the Idea of the Jew«. Zur Diskussion von Nietzsches Anti-Anti-Semitis-mus siehe Yirmiyahu Yovel, »Nietzsche and the Jews«.
361 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 545 362 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 252 363 Knodt bemerkt dazu: »any attempt to trace the mechanisms underlying Nietzsche�’s
projections of Otherness amounts to entering a hall of mirrors.« (Knodt, The Janus Face of Decadence, S. 163)
364 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 545f. 365 Wie Janet Ward ausführt, ist die antisemitische Vorstellung des jüdischen Parasitentums,
die Nietzsche an dieser Stelle mobilisiert, bereits von Johann Gottfried Herder verwen-det worden und fand insbesondere in den antisemitischen Schriften Eugen Dührings Verwendung, mit denen sich Nietzsche ausführlich auseinandergesetzt hat. Vgl. Ward, »Nietzsche�’s Transvaluation of Jewish Parasitism«.
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 153
Inselglück, wie es das Leben der kleinen Juden in der Provinz war.«366 Die speziellen Bedingungen, welche für die Juden in der Provinz geherrscht und die Entwicklung der Moral ermöglicht haben, werden durch die Vor-stellung des Südseeparadieses illustriert, in dem die Ausnahme eines kriegslosen Zustandes zur Regel werden konnte. Die dreifache Entfrem-dung der Moral durch die Buddhisten, die Juden und die Tahitianer macht es möglich, den Blick auf die europäische Geschichte der Moral umzukeh-ren. Die christliche Moral, die zur Norm erhoben wurde, kann durch diese dreifache Verschiebung als exotische Angelegenheit erscheinen, über die man »in normalen Verhältnissen lachen«367 würde.
Buddhisten und Juden stellen aber nicht nur eine inner- und eine au-ßereuropäische Version des Moralkastratismus dar. Ihre Unterschiedlich-keit macht es möglich, eine abgeklärte von einer gefährlichen Form der Moral zu unterscheiden. Es bleibt in Europa nicht bei der »mildmöglich-ste[n] Form des Moral-Castratismus«368, den die Buddhisten praktizieren. Die Abkehr vom Krieg wird vielmehr in eine neue Form der Kriegsfüh-rung überführt:
»Ihre [der kleinen Juden in der Provinz] einzige natürliche Gegnerschaft ist der Boden, aus dem sie wuchsen: gegen ihn haben sie nöthig zu kämpfen, gegen ihn müssen sie die Offensiv- und Defensiv-Affekte wieder wachsen lassen: ihre Gegner sind die Anhänger des alten Ideals«.369
Die jüdisch-christliche Moral entsteht als eine neue Form der Kriegsfüh-rung, die als Negation des Kriegs und als Krieg gegen den Krieg auftritt. Der Jude erscheint dabei als die Figur, die für die Verwandlung des männ-lichen aktiven in einen femininen reaktiven Willen steht. Der Verlust der männlichen Macht wird den Juden dabei selbst zugeschrieben, denn das Judentum hatte »politisch schon Verzicht geleistet«.370 Wird dies in die Logik der Kastrationsmoral übersetzt, dann stellt die selbstgewählte Machtlosigkeit der Juden einen Akt der Selbstkastration dar, der in der Folge umgekehrt und gegen die Mächtigen und Männlichen gewendet wird.
Auch in der Genealogie wird die Entstehung der Moral an einem histo-risch-mythologischen Gegensatz zwischen Römern und Juden festge-�—�—�—�—�—�— 366 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 547 367 Ebd., S. 545 368 Ebd., S. 548 369 Ebd., S. 547 370 Ebd., S. 545
154 G R E N Z F I G U R E N
macht.371 Diese Gegenüberstellung bezeichnet einen Anfang der Moral und umreißt zugleich den Schauplatz eines Kampfes, der sich bis in die Gegenwart zieht. »[S]o fehlt es doch auch jetzt noch nicht an Stellen, wo der Kampf unentschieden fortgekämpft wird.«372 Römer und Juden ermö-glichen es, den Kampf zwischen Ressentiment und aktivem Willen, zwi-schen Virilität und Kastration zu denken, der am Beginn der europäischen Männlichkeit steht. Beide, Jude und Römer, fungieren als historisierte Grenzfiguren einer modernen Männlichkeit, die sich auf seine zweifache Abstammung bezieht: auf die Klugheit des Kastrierten und auf die Stärke des Virilen. Das christliche Subjekt imaginiert sich als Schauplatz eines Kampfes, der jetzt noch �›unentschieden fortgekämpft wird�‹; erstellt und umgrenzt aber wird dieser Schauplatz durch die feminisierte Figur des Juden und die virilisierte Figur des Römers.
Die Kastration der männlichen Tugend, die im Fragment beschrieben wird, lässt sich mit dem Ressentiment vergleichen, das den Gegenstand der ersten Abhandlung der Genealogie darstellt. Wie das schlechte Gewissen gründet das Ressentiment auf einer reflexiven Bewegung, die sich gegen die Stärke des Anderen richtet. Die Gegenfigur zum Menschen des Ressen-timents ist der �›Vornehme�‹, welcher die Wendung gegen den Anderen noch nicht vollziehen muss: Der vornehme Mensch vermag es, seine Wertungen aus sich selbst zu schöpfen. Der vom Vornehmen unterdrückte �›Sklave�‹ hingegen erfindet, um sich trotz seiner Schwäche affirmieren zu können, die Moral. Sie ermöglicht es ihm, den Starken zum Bösen zu erklären und sich selbst im Unterschied zu diesem als guten Menschen zu setzen. Auf diese Weise wird das Ressentiment zum Mittel der Schwachen, mit dem diese sich in einem �›Sklavenaufstand der Moral�‹ gegen die Starken wenden. Entscheidend für diese »Umkehrung des werthesetzenden Blicks«373 ist, dass das Ressentiment schöpferisch wird. Die Moral macht es möglich, die Reaktion auf den starken Anderen in eine neue Form der Aktion zu wenden und das Gleichgewicht zwischen Stärke und Schwäche grundlegend zu verändern. Mit dem Ressentiment der Moral wird der Starke, der früher
�—�—�—�—�—�— 371 Die Verknüpfung von jüdischer Männlichkeit und Selbststigmatisierung findet sich auch,
wie Knodt schreibt, im Begriff des Ressentiments, der in der Genealogie die reaktive mo-ralische Handlung beschreibt: »[T ]he argument suggests that the notorious doubts con-cerning the masculinity of the Jew are rooted in self-stigmatization, the interiorization of hostile instincts which Nietzsche considered to be the essence of resentment.« (Knodt, The Janus Face of Decadence, S. 166)
372 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 286 373 Ebd., S. 271
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 155
überlegen war, mit einer gänzlich neuen und ihm fremden Logik bekämpft: Der Starke wird zum Bösen, der Schwache zum Guten.
Das Ressentiment und die Kastration werden zum Mittel der Schwa-chen, die eigene Defizienz im Kampf gegen die Starken einzusetzen. Als solches ist die Kastration produktiv: Sie stattet den Kastrierenden im Akt der Kastration mit der Kraft jener Männlichkeit aus, die er nicht (mehr) verkörpert. Indem sich der Kastrierte der Kastration bedient, erhält er etwas von jener virilen Kraft, an der es ihm gerade mangelt. Aber fehlt es dem Kastraten wirklich an Männlichkeit? Oder spielt der Kastrat, der die weiblichen Strategien des Kampfes, nämlich Täuschung, Lüge und List benützt, vielleicht ebenso wie das Weib? Spielt der Kastrat die Kastration? Die These von der Schwächlichkeit des moralischen Menschen gerät da ins Wanken, wo hinter dieser Schwäche eine andere Stärke zum Vorschein kommt. Wenn die Kultur der Moral nämlich als »Vergeistigung und Ver-göttlichung der Grausamkeit«374 entziffert werden kann, dann wird die Kraft des Willens nicht zerstört, sondern transformiert, umgeleitet und maskiert.375 Ist der Moralkastratismus somit ein Maskenspiel? Versteckt sich hinter den kastrierenden Kastraten eine andere Männlichkeit? Oder spielt die Kastration mit dem Verlust einer Männlichkeit, die sich ebenfalls nur als Maske erweist?376 Die starre Trennung zwischen vormoralischer Männlichkeit und moralischem Kastratentum beginnt sich an dieser Stelle unweigerlich aufzulösen. Dies zeigt sich auch da, wo die Wirkung der Kas-tratenmoral beschrieben wird:
»Woher kommt der Verführungsreiz eines solchen entmannten Menschheits-Ide-als? Warum degoutirt es nicht, wie uns etwa die Vorstellung des Castraten degou-tirt? �… Eben hier liegt die Antwort: die Stimme des Castraten degoutirt uns auch nicht, trotz der grausamen Verstümmelung, welche die Bedingung ist: sie ist süßer geworden �… Eben damit, daß der Tugend die �›männlichen Glieder�‹ ausgeschnitten �—�—�—�—�—�— 374 Ebd., S. 301 375 In der Vorrede der Genealogie erscheint die Moral denn auch als Maske (ebd., S. 253). Vgl.
des Weiteren folgende Stelle: »[U ]nd Eins weiss man hinfort, ich zweifle nicht daran �–, welcher Art nämlich von Anfang an die Lust ist, die der Selbstlose, der Sich-selbst-Ver-leugnende, Sich-selber-Opfernde empfindet: diese Lust gehört zur Grausamkeit.« (Ebd., S. 326)
376 Mit der Moral als Maskenspiel kommt auch die Schauspielkunst, welche die Frauen in Nietzsches Darstellung mit den Juden verbindet, erneut ins Spiel. Derrida weist auf diese Verbindung hin: »Durch das Lob der Verstellung, der �›Lust an der Verstellung�‹, des Komödiantentums, des �›gefährlichen Begriffs des Künstlers�‹ reiht die Fröhliche Wissen-schaft unter die Künstler, die immer Meister der Verstellung sind, die Juden und die Frauen ein.« (Derrida, »Sporen«, S. 141)
156 G R E N Z F I G U R E N
sind, ist ein femininischer Stimmklang in die Tugend gebracht, den sie vorher nicht hatte.«377
(Nur in Klammern soll gefragt werden: Wie muss ein Menschheits-Ideal beschaffen sein, damit es entmannt werden kann?) Der Moralkastrat jeden-falls, jene Figur eines �›entmannten Menschheits-Ideals�‹, schreckt nicht nur ab; er verführt auch, und er verführt mit den Mitteln der Frau. Seine Stimme erhält den �›femininischen Stimmklang�‹, der den Kastraten, obwohl er an eine �›grausame Verstümmelung�‹ erinnert, mit einem �›Verführungsreiz�‹ ausstattet. Wird der Kastrat damit zur Frau, der zugleich an eine verlorene Männlichkeit erinnert? Oder wird er vielmehr zum Mann, der die Frau spielt? Aber ist nicht die Frau bereits Schauspielerin? Spielt der Kastrat das Spiel der Weiblichkeit oder spielt er gar seine Kastration? Er tritt jedenfalls als Eunuch auf, dessen feminine Stimme �›uns�‹, obwohl �›wir�‹ �›uns�‹ vor ihm ekeln sollten, entzückt. Wer aber ist dieses �›uns�‹, das von der Kastration abgeschreckt und von ihrem Klang verführt wird? An wen ist dieser Text adressiert? Welche geschlechtliche Position nimmt dieses �›uns�‹ ein, das sich über die Verstümmelung der Kastration entsetzt und gleichzeitig von der Süße der Kastratenstimme verführt wird? Eine vom Kastraten verführte Männlichkeit? Ist es eine unversehrte Mänlichkeit, die die Kastration mit Erschrecken zur Kenntnis nimmt? Ist es eine Männlichkeit, die sich, ver-führt vom Eunuchen, selbst in Gefahr begibt, kastriert zu werden? Oder ist es eine Männlichkeit, die durch ihre Verführbarkeit bereits der Kastration anheimgefallen ist?
Die Kraft der Verführung, die vom Kastraten ausgeht, wirkt jedenfalls nicht nur auf die Erzählerposition, die in den Text eingeschrieben ist. Dass es umöglich ist, sich ihrer Verführungskraft zu entziehen, belegen vielmehr gerade die Figuren, welche für die Unversehrtheit der männlichen Tugend stehen.
»Denken wir andererseits an die furchtbare Härte, Gefahr und Unberechenbarkeit, die ein Leben der männlichen Tugend mit sich bringt �– das Leben eines Corsen heute noch oder das der heidnischen Araber (welches bis auf die Einzelheiten dem Leben des Corsen gleich ist: die Lieder könnten von Corsen gedichtet sein) �– so begreift man, wie gerade die robusteste Art Mensch von diesem wollüstigen Klang der �›Güte�‹, der �›Reinheit�‹ fascinirt und erschüttert wird�… Eine Hirtenweise�… ein Idyll�… der �›gute Mensch�‹: dergleichen wirkt am stärksten in Zeiten, wo der Gegen-
�—�—�—�—�—�— 377 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 546
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 157
satz schauerlich [ist] (der Römer hat das idyllische Hirtenstück erfunden �– d.h. nöthig gehabt)«.378
Die Verführbarkeit wird mit diesen Zeilen von �›uns�‹ auf die Repräsentan-ten der männlichen Tugend ausgeweitet; es sind nicht nur �›wir�‹, die der Süße der Moral erliegen; auch die virilsten Männer kennen die Faszination desjenigen, das kastriert ist und zu kastrieren droht. Bereits der Römer hat die idyllischen Hirtenstücke nötig gehabt. Er hat, noch bevor er vom Mo-ralkastratismus überwältigt worden ist, schon eine Affinität zu diesem �›feministischen Stimmklang�‹ aufgewiesen. Diesen Figuren einer überzeich-neten Männlichkeit ist, wie Eva M. Knodt bemerkt, bereits eine Verführ-barkeit eingeschrieben, die es unmöglich macht, Männlichkeit und Kastra-tion zu trennen. »[T]he �›sweet�‹ voice of the catrates cannot unfold its �›al-luring power�‹ (Verführungsreiz) unless it responds to a deeply buried desire within those who succumb to its effects«.379 Ein multiples homoerotisches Begehren scheint in diesem Text am Werk zu sein; einerseits durch die verführerische Kraft der Kastraten, die sowohl �›uns�‹ wie auch die männ-lichsten Männer affiziert, andererseits durch das Begehren nach der verlo-renen Virilität, die durch letztere verkörpert wird.
Homoerotik und Moralkritik
Obwohl sich die Homosexualität als diskursive Kategorie erst im ausge-henden 19. Jahrhundert formiert, geht, wie Eve Kosofsky Sedgwick be-merkt, die Vorstellung von �›Sodomiten�‹ als �›verweiblichten�‹ Männern der wissenschaftlichen Formation der Homosexualität um mindestens hundert Jahre voraus.380 Sedgwick weist darauf hin, dass die Begriffe, mit denen Nietzsche die Moderne als Krankheit beschreibt, gleichzeitig für die Dia-gnostik von Homosexuellen eingesetzt werden: »Nietzsche�’s writing is full and overfull of what were just in the process of becoming [�…] the most pointed and contested signifiers of precisely a minoritize, taxonomic male homosexual identity.«381 Insbesondere die Rückwendung des Willens, mit der Nietzsche das schlechte Gewissen kennzeichnet, wird in medizinischen
�—�—�—�—�—�— 378 Ebd., S. 546f. 379 Knodt, The Janus Face of Decadence, S. 168 380 Sedgwick, Epistemology of the Closet, S. 134 381 Ebd., S. 133
158 G R E N Z F I G U R E N
Diskursen über die Homosexualität in Anschlag gebracht. Homosexualität gilt als �›Umkehrung�‹ und widernatürliche Ausrichtung des Begehrens, als dessen �›Perversion�‹ und �›Inversion�‹.382 Mit den medizinisch-psychiatrischen Abhandlungen teilt die Genealogie auch die Pathologisierung dieser reflexi-ven Begehrensstruktur. Beiden ist die Vorstellung eines nach außen ge-richteten Triebes eingeschrieben, dessen Rückwendung zum Zeichen der Devianz wird. Dazu kommt, dass, wie Arendt festhält, die Salonkultur des Fin de Siècle den Juden und den (männlichen) Homosexuellen zu Figuren der Dekadenz erhebt. Sie kursieren in den Salons von Paris als »die Sensa-tion des Exotisch-Fremdartigen, Unnatürlich-Widernatürlichen, die Sensa-tion des Lasterhaften«.383 Beide werden als Fremde innerhalb der Gesell-schaft entdeckt, die zugleich für das Selbstgefühl der Dekadenz stehen. Sie gelten als exotische Wesen, »zu denen man nicht über die halbe Welt nach der Südsee zu segeln brauchte«.384 Nietzsches Figur des Juden, der in »eine[r] Art Tahiti und Inselglück«385 existiert, operiert mit diesem dop-pelten Exotismus, indem zwei Figuren kultureller Alterität zusammen-gebracht und mit dem Stereotyp des feminisierten Homosexuellen ver-bunden werden.
Sedgwick weist allerdings darauf hin �– und an dieser Stelle kommt das homoerotische Begehren nach den virilisierten Figuren der Korsen und des heidnischen Arabers ins Spiel �–, dass der Mann und der männliche Körper in Nietzsches Schriften auch affirmiert und zelebriert werden.386 »[M]any of Nietzsche�’s most effective intensities of both life and writing were di-rected toward other men and toward the male body. [�…] Nietzsche offers writing of an open Whitmanlike seductiveness, some of the loveliest there is, about the joining of men with men, but he does so in the stubborn, perhaps even studied absence of any explicit generalizations, celebrations,
�—�—�—�—�—�— 382 Bezeichnenderweise impliziert die Figur der Rückwendung in diesen wissenschaftlichen
Diskursen nicht die Ablenkung des Begehrens vom gegengeschlechtlichen zum gleichge-schlechtlichen Objekt, sondern sie unterstellt ein Begehren, das sich auf sich selbst richtet und damit auf das Problem der Selbstliebe zurückgeht. Sigmund Freud bringt denn auch die Homosexualität mit dem Narzissmus in Verbindung.
383 Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, S. 154 384 Ebd., S. 130 385 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 547 386 In einem Fragment aus dem Frühjahr 1888 erstellt Nietzsche nicht nur die Proximität
von Korse und Araber, die sich vom verweichlichten Europäer absetzen, sondern rückt sie auch in die Nähe des Tieres. »Der Mensch ist kein Fortschritt gegen das Thier: der Cultur-Zärtling ist eine Missgeburt im Vergleich zum Araber und Corsen« (Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1887�–1889, Fragment 15[8], S. 409).
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 159
analyses, reifications of these bonds as specifically same-sex ones.«387 Auch in der Genealogie erscheinen die Figuren des vormoralischen �›gesunden�‹ Menschen als Krieger und Kämpfer, die sowohl in der Einsamkeit als auch in losen Männerverbänden zu leben scheinen. Die Vornehmen sind ritter-lich-aristokratische Männer, die eine »mächtige Leiblichkeit [aufweisen], eine blühende, reiche, selbst überschäumende Gesundheit, sammt dem, was deren Erhaltung bedingt, Krieg, Abenteuer, Jagd, Tanz, Kampfspiele und Alles überhaupt, was starkes freies, frohgemuthes Handeln mit sich schliesst«.388 Diese Vorstellungen zelebrieren die menschliche �›Gesundheit�‹ als seine Hypervirilität. In der Beziehung zwischen solchen Figuren zeich-net sich zudem ein anderer Begriff von Freundschaft und Liebe ab, der jenseits der Moral angesiedelt werden kann. »Wie viel Ehrfurcht vor seinen Feinden hat schon ein vornehmer Mensch! �– und eine solche Ehrfurcht ist schon eine Brücke zur Liebe�… Er verlangt ja seinen Feind für sich, als einen solchen, an dem Nichts zu verachten und sehr Viel zu ehren ist!«389 Die Andeutung einer möglichen Liebe jenseits von Gut und Böse, die sich zwischen Männern ereignet, weist darauf hin, dass nicht nur Nietzsches Subjektkritik, sondern gerade auch seine Vision eines anderen Menschen einen homoerotischen Subtext enthält. Ansatzpunkt der Kritik ist nicht das Begehren zwischen Männern, sondern vielmehr die Feminisierung des Mannes durch die Moral. Der Kastrat schockiert nicht, weil er Männer verführt, sondern dadurch, dass er dies mit weiblichen Mitteln tut.
Die Darstellung der Moral als Kastration und Verführung der Männ-lichkeit ist nicht zu trennen von ihrer ethnischen Kodifizierung, die den mo-dernen Europäer in ein komplexes Kräftefeld einschreibt. Einerseits sind da der Korse und der heidnische Araber, zwei Figuren der Männlichkeit, die ineinander übergehen, weil das Leben des heidnischen Arabers »bis auf die Einzelheiten dem Leben des Corsen gleich ist«.390 Beide Figuren erin-�—�—�—�—�—�— 387 Sedgwick, Epistemology of the Closet, S. 133 388 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 266. Andrea Maihofer weist darauf hin, dass die
Selbststilisierung von Männlichkeit, die im 18. Jahrhundert entsteht, häufig mit Körper und Krieg in Verbindung gebracht wird. »Der gesamte Körper wird zum Inbegriff von Virilität, Stärke und Mut.« (Maihofer, »Dialektik der Aufklärung«, S. 126)
389 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 273 390 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 545. Caroline Joan S.
Picart argumentiert, dass Nietzsches �›Zarathustra�‹ Züge dieser Figur des exotisierten Arabers trägt: »Both Nietzsche and Delacroix had turned to the pristine exoticism of the Oriental as a symbol of revolt against the effeminate, prevailing liberal and Christian culture.« (Picart, Resentment and the �›Feminine�‹ in Nietzsche�’s Politico-Aesthetics, S. 83) Andere �›orientalische�‹ Figuren wie der Buddhist oder der Chinese hingegen fungieren als Reprä-
160 G R E N Z F I G U R E N
nern »an die furchtbare Härte, Gefahr und Unberechenbarkeit, die ein Leben der männlichen Tugenden mit sich bringt«,391 und bringen dennoch die Verführbarkeit dieser Männlichkeit ins Spiel.392 Andererseits ist da die Figur des Juden, der �– auf dem Hintergrund zeitgenössischer antisemiti-scher Vorstellungen, die in diese Figur eingelassen sind �– mit dem Anfang der Kastratenmoral in Verbindung gebracht wird und der sowohl die Klugheit des Geistes wie auch die männliche Schwäche desjenigen mar-kiert, dem es an Virilität fehlt.393
Wenn diese beiden Narrative zur Entstehung des schlechten Gewis-sens, das der Staatsgründung und das der Kastratenmoral, miteinander verglichen werden, dann lassen sich zwei unterschiedliche Anfänge der Moral erkennen. Im einen Fall sind es �›Herren�‹, welche eine ahnungslose Bevölkerung gewaltsam überfallen und unterwerfen. Die Verinnerlichung des Willens durch die Moral wird dann zum Nebeneffekt einer künstleri-schen Tat. Es sind die »unfreiwilligsten, unbewusstesten Künstler, die es giebt«,394 die den Staat als ihr Werk erschaffen und die Bevölkerung als Rohstoff für dieses Werk benützen. Diese Unterwerfungsszene aber setzt sich im Innern des Subjekts fort. Das schlechte Gewissen formiert sich als kontinuierliche Wiederholung dieser traumatischen Unterwerfung, die nun im Inneren der Psyche und durch einen gespaltenen Willen erfolgt, der sowohl Unterwerfer als auch Unterworfenes ist. Im zweiten Fall wird die Entstehung der Moral nicht auf die Starken, sondern auf die Schwachen zurückgeführt. Es ist die Müdigkeit und Friedfertigkeit der Gemeinschaft, die die Menschen dazu bringt, sich vom Krieg zurückzuziehen. Anders als bei den Buddhisten mutiert diese �›Selbstkastration�‹ bei den Juden und Christen zur Kriegsführung gegen die männliche Tugend. Die Starken, die
�—�—�—�—�—�— sentanten des Nihilismus bzw. der nivellierenden Gesellschaft und damit als Beispiele für die Krankheit der Moral.
391 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 545 392 In der Genealogie wird der arabische Adel als Beispiel einer kriegerischen Klasse von
Vornehmen angeführt, die dem Ressentiment noch nicht erlegen sind (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 275).
393 Eva M. Knodt geht von einer frühen, von Wagner beeinflussten Phase aus, in der Nietz-sche alle Aspekte der deutschen Kultur, die ihm verwerflich scheinen, als jüdisch be-zeichnet. Diese Haltung sei nach dem Zerwürfnis mit Wagner in den Anti-Anti-Semi-tismus des späteren Nietzsches überführt worden. Wie Knodt kritisch bemerkt, werden mit diesem Wechsel zwar die Vorzeichen, nicht aber der projektive Mechanismus verän-dert, der die Figur des Juden zum Mittel zur Bestimmung der christlichen Kultur macht. Vgl. Knodt, The Janus Face of Decadence, S. 161.
394 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 325
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 161
mit den weiblichen Strategien des �›Geistes�‹ �– List, Lüge und Verstellung �– bekämpft werden, weisen aber immer schon eine Affinität zu diesen auf. Die Gegenüberstellung einer starken und einer schwachen Männlichkeit gerät durch diese Verführbarkeit der Starken ins Wanken und droht sich aufzulösen.
Beide Geschichten führen den Beginn der Moral auf eine kriegerische Virilität zurück und scheinen dennoch zwei widersprüchliche und nicht zu vereinbarende Ursprungsgeschichten zu erzählen. Während es im einen Fall die starken, männlichen, von der Moral unberührten Krieger sind, die die Moral als Nebeneffekt ihres Werks hervorbringen, sind es im anderen Fall die Schwachen und Kastrierten, die die Moral erfinden, um sie gegen die Starken und Männlichen zu richten. Es scheint, als würde in den beiden Geschichten Ursache und Effekt vertauscht und damit eine metaleptische Wendung vorgenommen, die Paul de Man als rhetorische Eigenart von Nietzsches Texten beschreibt.395 Verschoben wird aber auch der Gegen-satz zwischen Starken und Schwachen. Die Schwachen sind in der ersten Erzählung dem Überfall der Starken wehrlos ausgesetzt. Anders in der zweiten Geschichte, in der sich die Kastrierten selbst kastrieren, um dann die Kastration gegen die Anderen zu richten. In der ersten Geschichte bleiben die Starken unberührt von der Moral, in der zweiten sind sie von der Ver-führung der Moral immer schon affiziert.
So wie die Frage nach dem Ursprung des schlechten Gewissens durch die Figuren des sich selbst zeugenden Willens und des sich selbst hervor-bringenden Mutterschoßes in einen unauflösbaren Chiasmus geführt wird, widersprechen sich die beiden Erzählungen zur Entstehung der Moral. Gleichzeitig zeigt sich, dass nicht nur geschlechtliche, sondern auch eth-nisch und religiös kodierte Figuren mobilisiert werden, um die Frage nach der Bedeutung und dem Anfang der Moral stellen zu können. Mehr noch, Geschlecht, Sexualität, Ethnizität und Rasse werden so miteinander ver-schränkt, dass sie sich gegenseitig explizieren. Die Unmännlichkeit der Buddhisten und Juden wird durch ihre Verbindung mit der Kastration behauptet und gleichzeitig hergestellt. Die Virilität des Römers, des Ara-bers und des Korsen wird durch ihren Einsatz als Vertreter einer �›gesun-den Männlichkeit�‹ aufgerufen und zugleich reproduziert. Zudem kursiert ein homoerotisches Begehren zwischen diesen Figuren, das sie auf vielfäl-tige Weise verbindet und trennt: Der Kastratierte erscheint als abstoßend
�—�—�—�—�—�— 395 Man, Allegories of Reading, S. 108
162 G R E N Z F I G U R E N
und verführerisch, der Virile stellt eine unversehrte Männlichkeit dar und ist bereits vom Kastraten verführt. Diese Struktur wird durchkreuzt vom Begehren des europäischen Kritikers, der seinen exotisierenden Blick auf den Anderen richtet, um beides, seine mögliche Gesundheit und den Ur-sprung seiner Krankheit imaginieren zu können. Diese Figuren der Alteri-tät ermöglichen es somit, die Frage nach dem Anfang zu stellen �– eine Frage, die in der Genealogie beständig vervielfältigt und in Widersprüche geführt wird.
2. Die Vervielfältigung des Anfangs und die Tropen
»Die letzten größeren Berichte, vom wahrhaft fürstlichen Einzug und Empfang meiner Angehörigen in der neuen Colonie, haben einen starken Eindruck auf mich
gemacht. Zuletzt habe ich Europa als Cultur-Museum absolut nöthig. Die Wildniß (�– und das Glück�…) ist für einen der keine Philosophie auf dem Gewissen hat!«
Nietzsche an Emily Fynn, 11. August 1888
Anders als in Hegels Phänomenologie stellt die Bewegung der Rückwendung, die der Wille im schlechten Gewissen vollzieht, in Nietzsches Genealogie nicht eine notwendige Bedingung des Menschen dar. Die Reflexivität des Willens ist nicht nur konstitutiv für die Formation des schlechten Gewis-sens, sie ist auch Ausdruck der Schwächung, die der Wille unter den Be-dingungen der Moral erfährt. Die Diagnose des modernen Subjekts beruht deshalb auf der Differenz zwischen dem Subjekt der Gegenwart, das sich im Zirkel des �›schlechten Gewissens�‹ befindet, und Vorstellungen des Vor-nehmen und Wilden, dessen Wille sich noch nicht auf sich selbst zurück-gewendet hat. Die historische Differenz, die sich zwischen dem vormorali-schen und dem moralischen Menschen eröffnet, wird, so zeigt sich, dabei auch in kulturelle Differenzen zwischen dem europäischen und dem nicht-europäischen Menschen übersetzt. Wie funktioniert diese Übersetzung und welche Prämissen liegen ihr zugrunde? Welche räumlich-zeitlichen Diffe-renzen sind zwischen dem modernen Subjekt und diesen verschiedenen Grenzfiguren der Moral am Werk; zwischen dem Subjekt und den Men-schen vor und außerhalb des schlechten Gewissens, die seine Konturen erst denkbar machen?
Wenn, wie Hinrich Fink-Eitel schreibt, in Nietzsches Texten »der Kontrast zwischen �›eigentlicher�‹ und �›uneigentlicher�‹ Existenz Anlaß zur Unterscheidung zwischen dem authentischen �›Wilden�‹ und dem mißglück-ten Zivilisierten«396 gibt, dann scheint die Figur des Wilden in Nietzsches Modernekritik eine andere Funktion einzunehmen, als sie dies in Hegels Schriften tut. Der Wilde wird zum Maßstab einer Gesundheit, Stärke und Männlichkeit, an dem der Mangel des modernen Menschen gemessen werden kann. Erst durch diese Figur des frühen, ungezähmten, tropischen Menschen lässt sich die eigentliche Natur des moralischen Menschen er-
�—�—�—�—�—�— 396 Fink-Eitel, Die Philosophie und die Wilden, S. 291
164 G R E N Z F I G U R E N
ahnen und Grad und Ausprägung seiner �›Krankheit�‹ bestimmen. Damit zeichnet sich sein Einsatz durch bedeutsame Ähnlichkeiten mit Hegels Figur des �›natürlichen Menschen�‹ aus: Wie dieser beruht Nietzsches Figur des Wilden auf stereotypen Vorstellungen des kulturell Anderen und wie dieser dient sie der Selbstdiagnose des europäischen Subjekts, indem sie es möglich macht, seinen Anfang �– und einen möglichen Neuanfang �– zu imaginieren.
Die Frage des Anfangs
Während Hegel den Anfang des Subjekts mit der Ablösung des Geistes aus der Natur und dem Beginn der Reflexionsbewegung bezeichnet, wartet Nietzsche mit unterschiedlichen Erklärungen zum Anfang des schlechten Gewissens auf; die Frage des Anfangs wird in der Genealogie kontinuierlich gestellt. Die �›wilden, freien, schweifenden Menschen�‹ markieren zwar einen möglichen Anfang des modernen Subjekts; nicht aber seinen einzigen Ursprung. Sie unterscheiden sich damit vom natürlichen Bewusstsein in Hegels Phänomenologie, das an derjenigen Stelle erscheint, an der das un-bewegte Bewusstsein in die Bewegung der Reflexion umschlägt. Das na-türliche Bewusstsein markiert als Anfang der Reflexion eine konstitutive Grenze des Denkens, die sich auch als Grenze des Menschlichen erweist. Die Figuren, die es repräsentieren �– das Tier, der natürliche Mensch, das afrikanische Bewusstsein �– stehen am Ort eines Übergangs, der die Be-deutung eines Ursprungs annimmt: Der Geist, und damit Hegels Erzählung dieses Geistes, beginnt mit dem Übergang einer bewusstlosen Bewegung in ein bewegtes Bewusstsein. Nietzsche hingegen problematisiert �– vor allem in der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Versuchen, die Herkunft der Moral zu erklären �– diese Vorstellung eines einzigen Ursprungs. Die Genealogie stellt derart auch eine Kritik der damaligen Geschichtsschreibung der Moral dar. Sie richtet sich gegen den »Aberglauben jener Moralgenea-logen«397, die den Ursprung der Moral mit den Denkweisen der Gegenwart erklären und damit implizit gleichsetzen. Seine Kritik an einer solchen Geschichtsschreibung legt Nietzsche am Beispiel der �›Strafe�‹ dar:
�—�—�—�—�—�— 397 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 260
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 165
»Jener so wohlfeile und scheinbar so natürliche, so unvermeidliche Gedanke [�…], �›der Verbrecher verdient Strafe, weil er hätte anders handeln können�‹ ist thatsäch-lich eine überaus spät erreichte, ja raffinirte Form des menschlichen Urtheilens und Schliessens; wer sie in die Anfänge verlegt, vergreift sich mit groben Fingern an der Psychologie der älteren Menschheit. Es ist die längste Zeit der menschlichen Ge-schichte nicht gestraft worden, weil man den Übelanstifter für seine That verant-wortlich machte, also nicht unter der Voraussetzung, dass nur der Schuldige zu strafen sei; �– vielmehr, so wie jetzt noch Eltern ihre Kinder strafen, aus Zorn über einen erlittenen Schaden, der sich am Schädiger auslässt, �– dieser Zorn aber in Schranken gehalten und modifiziert durch die Idee, dass jeder Schaden irgend worin sein Äquivalent habe und wirklich abgezahlt werden könne, sei es selbst durch einen Schmerz des Schädigers.«398
Als unhinterfragte Voraussetzung herkömmlicher Geschichtsschreibung erweist sich, dass die Bedeutung der Strafe im Verlaufe der Zeit unverän-dert geblieben ist, und, mehr noch, dass die Strafe zu demjenigen Zweck erfunden worden war, den sie in der Gegenwart erfüllt. Dieser Argumen-tation liegt eine unauflösbare Selbstreferentialität zugrunde. Der Historiker stößt in der Vergangenheit auf dieselben Formationsregeln, die er seiner Forschung bereits zugrunde gelegt hat. Ohne eine Selbstkritik, welche sowohl die eigene Perspektivität als auch die historische Veränderbarkeit von Bedeutung anerkennt, wird immer nur eine Vorstellung der Vergan-genheit hervorgebracht, die nach den Gesetzmäßigkeiten der Gegenwart strukturiert ist. Darum müssen gerade jene Annahmen, die selbstverständ-lich erscheinen, der Kritik ausgesetzt werden. Anstatt die �›Natürlichkeit�‹ eines Gedankenschlusses als Zeichen dafür zu nehmen, dass er richtig ist, wird sie zum Anzeichen einer möglichen historischen Differenz. Dies zeigt Nietzsche am Beispiel der Strafe: Der �›so unvermeidliche Gedanke�‹ besteht darin, im Falle der Strafe eine kausale Beziehung zwischen der Strafe und der Entscheidungsfreiheit des Verbrechers anzunehmen. Die Vorstellung, dass der Verbrecher bestraft wird, weil er sich für die falsche Handlung entschieden hat, lokalisiert den Ursprung der Tat im Täter und setzt voraus, dass dieser anders hätte handeln können. Dies aber entspricht einer spezi-fisch modernen Deutung des Verbrechens, die auf eine �›überaus spät er-reichte�‹ Form des Schließens zurückgeht und den modernen vom früheren Menschen gerade unterscheidet. Wird das moderne Verständnis der Strafe auf die Vergangenheit übertragen, erfährt man dabei nichts über die histo-risch Anderen, sondern reproduziert nur die eigenen Prämissen.
�—�—�—�—�—�— 398 Ebd., S. 298
166 G R E N Z F I G U R E N
Nietzsche ersetzt nun den �›spät erreichten�‹ Rückschluss von der Tat auf den Täter, der bereits die Verinnerlichung des Menschen voraussetzt, mit dem früheren Prinzip des Ausgleichs, das für die �›längste Zeit der mensch-lichen Geschichte�‹ gegolten hat. Die �›ältere Menschheit�‹ hat den Täter demnach nicht bestraft, weil er schuldig geworden ist, sondern weil er einen Schaden angerichtet hat, der nach Wiederherstellung verlangt. Die Strafe zielte nicht auf den Verantwortungssinn des Täters, der geweckt, verbessert und korrigiert werden soll, sondern sie beruhigt den Zorn des Beschädigten, indem sie einen Ausgleich der Beziehungen schafft, die durch die Tat verändert worden sind. Anstatt auf den Täter zielt dieses Verständnis von Strafe auf die Wiederherstellung eines intersubjektiven Kräfteverhältnisses. Die Grundannahme dieser �›älteren Menschen�‹, so heißt es, ist die Äquivalenz, d.h. die Vorstellung, dass es für jeden Schaden eine Gegenleistung geben muss. Als eigenartige und zentrale �›Währung�‹ in dieser ökonomischen Theorie des Ausgleichs aber führt Nietzsche den Schmerz des Täters ein. Der Schmerz wird zum privilegierten Mittel in ei-nem Tausch, in dem die Wut des einen durch den Schmerz des anderen gestillt werden kann.
Während die Historiker der Moral dafür gerügt werden, sich an der Psychologie der älteren Menschheit mit groben Fingern zu vergreifen, führt Nietzsche das »unerbittlich in gleicher Richtung weitergehende Den-ken der älteren Menschen«399 mit seinen ökonomischen Parametern von Ausgleich und Äquivalenz zwischen den Mächtigen vor. Doch müssen wir das Misstrauen, zu dem Nietzsche uns anhält, nicht auch auf Nietzsches eigene Erklärung anwenden? Läuft seine Erklärung nicht ebenfalls Gefahr, sich an der Psychologie der älteren Menschheit zu �›vergreifen�‹? Beruht nicht die �›Unvermeidbarkeit�‹, mit der Nietzsche seine eigene Erklärung der Strafe vorlegt, auf einem Schluss, welcher uns fragwürdig erscheinen muss? Stellen die �›älteren Menschen�‹ nicht einen Anfang dar, der zwar nicht als einziger Anfang dargestellt wird, der aber dennoch eine Bedingung der Narration von Nietzsches Geschichte der Moral darstellt?
Zwischen Nietzsches Kritik an der Geschichtsschreibung der Moral und seiner eigenen Erzählung scheint ein Sprung zu liegen, der nicht mehr reflexiv eingeholt wird. Zwischen der Kritik an den zeitgenössischen Ge-nealogen der Moral, die ihre eigenen Denkstrukturen in die Vergangenheit legen und sie darin wiederentdecken, und Nietzsches eigenen Entste-
�—�—�—�—�—�— 399 Ebd., S. 306
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 167
hungsgeschichten der Moral bleibt die unbeantwortete Frage, wie eine Geschichtsschreibung möglich ist, die sich nicht an der �›Psychologie der älteren Menschen vergreift�‹. Ist nicht die Figur des älteren Menschen immer schon ins Imaginäre der Gegenwart eingeschrieben? Und ließe sich daraus nicht eine Kritik an Nietzsches Darstellung dieser Vergangenheit formulieren, die auf diskursiven Bedingungen beruht, die nicht ins Blickfeld seiner Kritik gelangen? Erscheinen die kulturellen und an-thropologischen Differenzen, die Hegels Thematisierung des Anfangs er-möglicht haben, bei Nietzsche vielleicht als Bedingung der Kritik dieses Anfangsdenkens?
Die genealogische Kritik
In der Genealogie wird die Frage, ob und wie der Anfang erzählbar ist, stets aufs Neue aufgeworfen. Die Unmöglichkeit, den richtigen und einzigen Anfang zu erzählen, zeigt sich dadurch, dass sich die Frage des Anfangs beständig vervielfacht, den genealogischen Verzweigungen vergleichbar, die die Erforschung verwandtschaftlicher Beziehungen produziert. Die Entstehung der Moral wird auf das Ressentiment, das Gedächtnis, das Versprechen, die Strafe, das schlechte Gewissen, die Schuld und die As-kese zurückgeführt. Die Genealogie wartet derart mit einer Anzahl verschie-dener Narrative auf, die lose verknüpft sind und deren Verhältnis zueinan-der ungeklärt bleibt. Die Frage des Anfangs wird gestellt, aber niemals abschließend beantwortet; in der Tat verunmöglicht es die Struktur der Genealogie, eine einzige, konsistente Erzählung zur Entstehung der Moral auszumachen.400 Zeiten und Folgen geraten durcheinander: Was an einer Stelle für die Entstehung einer Sache vorausgesetzt wird, wird an anderer Stelle aus ihr abgeleitet. Dabei gehen historische Referenzen in Mythen
�—�—�—�—�—�— 400 Marco Brusotti bietet eine konsistente Lektüre der Genealogie an, wenn er behauptet, dass
das Ressentiment als Reaktion auf das schlechte Gewissen entsteht: »Das Ressentiment ist eine vergebliche Reaktion gegen die Aktivität des schlechten Gewissens« (Brusotti, »Wille zum Nichts, Ressentiment, Hypnose«, S. 126). In der Genealogie heißt es aber an einer Stelle, dass die Entstehung des schlechten Gewissens so plötzlich vor sich ging, dass die Bevölkerung nicht einmal mit Ressentiment reagieren konnte (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 324). Die Möglichkeit des Ressentiments wird an dieser Stelle be-reits vorausgesetzt. Außerdem wird das schlechte Gewissen in der Abhandlung zum Ressentiment nicht erwähnt.
168 G R E N Z F I G U R E N
und Geschichten über und unterwandern damit die Möglichkeit einer Lektüre, die klassischen historisch-wissenschaftlichen Kriterien folgt.
In seinem Aufsatz »Nietzsche, die Genealogie, die Historie« interpre-tiert Michel Foucault Nietzsches Kritik an der zeitgenössischen Moralge-schichtsschreibung als ein Grundproblem der Metaphysik: »Indem sie die Gegenwart in den Ursprung versetzt, erzeugt die Metaphysik den Glauben an die geheime Arbeit einer Bestimmung, die allmählich zutage tritt. Die Genealogie hingegen weist die verschiedenen Unterwerfungssysteme auf: nicht die vorgreifende Macht eines Sinnes, sondern das Hasardspiel der Überwältigungen.«401 Foucault bezieht sich dabei auf eine Stelle in der Genealogie, in der die Geschichte eines Dings als kontingente Folge von Umdeutungen beschrieben wird, die dieses im Laufe der Zeit erfährt. Der Wechsel dieser Bedeutungen folgt dabei nicht einer kausalen Verknüpfung. Vielmehr ist es der zufällige Verlauf von Überwältigungsprozessen, aus denen die wechselnden Bedeutungen einer Sache hervorgehen. »[D]ie ganze Geschichte eines �›Dings�‹, eines Organs, eines Brauchs kann derge-stalt eine fortgesetzte Zeichen-Kette von immer neuen Interpretationen und Zurechtmachungen sein, deren Ursachen selbst unter sich nicht im Zusammenhange zu sein brauchen«.402 Die Frage der Bedeutung lässt sich damit von derjenigen der Macht nicht trennen. Diese manifestiert sich gerade dadurch, dass sie einer Sache ihre Bedeutung aufprägt. �›Macht�‹ stellt dabei aber keine feste Größe dar. Sie muss vielmehr instabil und wechsel-haft gedacht werden: als ein sich ständig veränderndes Geflecht von Machtbeziehungen. Mit den wechselnden Machtverhältnissen verschieben und verändern sich darum auch die Interpretationen einer Sache. Ihre �›Bedeutung�‹ stellt den Niederschlag derjenigen Interpretationsmächte dar, die sich gegen andere, ältere und konkurrierende Deutungen durchsetzen können. Geschichtsschreibung bedeutet darum, die Kette von Umdeutun-gen zu beschreiben, die eine Sache im Verlaufe der Zeit erfahren hat.
Damit aber ist die Vorstellung eines ersten Anfangs nicht mehr mög-lich. Die Geschichte der Resignifizierungen einer Sache im Verlaufe der Zeit verästelt und verzweigt sich in der Vergangenheit, ohne dass dabei ein ontologisch privilegierter Ort entstünde, von dem aus die Gegenwart ge-deutet werden kann. Dieses �›genealogische�‹ Verständnis von Geschichte setzt Foucault dem traditionellen, �›metaphysischen�‹ Konzept der Historie entgegen, die sich auf die Suche nach dem einen und einzigen Ursprung �—�—�—�—�—�— 401 Foucault, »Nietzsche, die Genealogie, die Historie«, S. 76 402 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 314
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 169
einer Sache macht.403 Mit der metaphysischen Vorstellung des Ursprungs verbindet sich die Idee eines zeitlich und örtlich bestimmbaren Moments, mit dem etwas seinen Anfang findet, ohne je gänzlich von diesem Ur-sprung getrennt zu werden.404 Der Widerspruch, der sich zwischen dieser überzeitlichen Identität und der Veränderbarkeit einer Sache ergibt, wird durch die Unterscheidung zwischen Essenz und Akzidenz gelöst. Die Veränderungen, die eine Sache im Verlaufe ihrer Geschichte erfährt, be-treffen dann nur ihre äußeren Bestimmungen; ihr Wesen hingegen bleibt mit dem Ursprung identisch. Gemäß Foucault macht die Metaphysik darum den Ursprung einer Sache zum Schlüssel ihrer Interpretation; ist der Ursprung gefunden, kann das unveränderliche Wesen einer Sache erkannt und bestimmt werden.
Mit Nietzsche nun wird die Bedeutung von Ursprung und Interpreta-tion umgekehrt: Die Interpretation einer Sache geht nicht auf ihren Ur-sprung zurück, sondern die Vorstellung des Ursprungs ergibt sich vielmehr aus ihrer Interpretation: »Wenn Interpretation hieße, eine im Ursprung versenkte Bedeutung langsam ans Licht zu bringen, so könnte allein die Metaphysik das Werden der Menschheit interpretieren. Wenn aber Inter-pretieren heißt, sich eines Systems von Regeln, das in sich keine wesen-hafte Bedeutung besitzt, gewaltsam oder listig zu bemächtigen, und ihm eine Richtung aufzuzwingen, es einem neuen Willen gefügig zu machen, es in einem anderen Spiel auftreten zu lassen und es anderen Regeln zu un-terwerfen, dann ist das Werden der Menschheit eine Reihe von Interpreta-tionen.«405 Diese �›anti-platonische�‹ Vorstellung von Geschichte als Serie unterschiedlicher, nicht-kausal zusammenhängender und nur durch das Spiel von Überwältigungen aufeinanderfolgender Interpretationen versucht nicht mehr, mit dem Ursprung das Wesen einer Sache auszumachen. Sie versucht vielmehr, jene lange Reihe von Umdeutungen nachzuzeichnen, �—�—�—�—�—�— 403 Die Beschreibung Nietzsches als �›Genealoge�‹ und seines Verfahrens als �›genealogisch�‹
geht auf Gilles Deleuze zurück (vgl. Deleuze, Nietzsche und die Philosophie, S. 6). Jacqueline Stevens wendet sich gegen die These, dass Nietzsche sich als Genealoge verstand, viel-mehr habe er mit diesem Begriff die �›schlechten�‹ Historiker der Moral beschrieben und verspottet (vgl. Stevens, »On the Genealogy of Morals«). Meines Erachtens ist diese Frage nicht schlüssig zu beantworten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Nietzsche den Begriff der �›Genealogie�‹ in einer Ambivalenz belässt, auf die im übrigen sowohl Deleuze als auch Foucault hinweisen.
404 Derrida spricht davon, dass »jede Philosophie Einfachheit des Ursprungs, Kontinuität jeder Ableitung, jeder Produktion, jeder Analyse, Homogenität aller Ordnungen voraus-setzt.« (Derrida, »Signatur, Ereignis, Kontext«, S. 328)
405 Foucault, »Nietzsche, die Genealogie, die Historie«, S. 78
170 G R E N Z F I G U R E N
die eine Sache im Verlaufe der Geschichte erfährt. Diese Art der �›genealo-gischen�‹ Geschichtsschreibung postuliert weder eine überhistorische Iden-tität einer Sache noch die Kontinuität ihrer Geschichte und befindet sich damit, wie Annemarie Pieper schreibt, zwischen Metaphysik und Historie. »Der Genealoge erweist sich [�…] als Anwalt des Zufälligen, Zerstreuten, Differenten, für das weder der Metaphysiker noch der Historiker einen Blick hat, ersterer nicht, weil er auf die apriorischen Strukturen reinen Denkens und Seins fixiert ist, letzterer nicht, weil er die Geschichte als einen kontinuierlichen Zweckzusammenhang deutet.«406
Auf diesem Hintergrund lässt sich fragen, welche Bedingungen Nietz-sches eigene genealogische Kritik möglich machen.407 Geschlecht, so zeigte sich im vorhergehenden Teil, stellt eine Bedingung für Nietzsches Subjekt-kritik dar. Die geschlechtlich kodierten Figuren stehen im Dienst der Selbstkritik eines männlichen Subjekts, ohne selbst von dieser Kritik erfasst zu werden. Wie aber operieren das Fremde und Unbekannte, wie die kultu-
�—�—�—�—�—�— 406 Pieper, »Vorrede«, 17f. 407 Die Frage nach den unausgewiesenen Prämissen seiner Kritik ließe sich auch an Fou-
cault richten, wenn er die Zersetzungsbewegung des Subjekts beschreibt: »Die genealo-gisch aufgefaßte Historie will nicht die Wurzeln unserer Identität wiederfinden, vielmehr möchte sie sie in alle Winde zerstreuen; sie will nicht den heimatlichen Herd ausfindig ma-chen, von dem wir kommen, jenes erste Vaterland, in das wir den Versprechungen der Metaphysiker zufolge zurückkehren werden; vielmehr möchten sie alle Diskontinuitäten sichtbar machen, die uns durchkreuzen.« (Foucault, »Nietzsche, die Genealogie, die His-torie«, S. 86; alle Hervorhebungen PP) Bleibt diese Dekonstitution des Subjekts, seine Dezentrierung und Fragmentierung nicht auf ein Zentrum ausgerichtet? Wer ist dieses Subjekt, das einen privilegierten Bezug zur Metaphysik aufweist, von ihr umworben worden ist, dem sie sich als Heimat und Vaterland angeboten hat? Wer ist dieses Subjekt, das sich dem Versprechen der Metaphysiker nach einem ersten �›Vaterland�‹ entziehen will; wem wurde ein solches Vaterland je versprochen? Wenn die Genealogie �›unsere�‹ Wurzeln in alle Winde zerstreuen, und die Diskontinuitäten sichtbar machen will, die �›uns�‹ durchkreuzen: was und wer ist dieses �›uns�‹ und wie organisiert es das Schreiben, das dieses �›uns�‹ zersetzt, während es in seinem Bannkreis zu bleiben scheint? Wer befindet sich außerhalb dieses �›uns�‹ und wer an seinen Rändern? Und welche Figuren der Alteri-tät sind nötig, um die Zerstreuung und Auflösung dieses �›uns�‹ ermöglichen zu können? Auf die privilegierte Position männlicher (weißer, heterosexueller) Dekonstruktivisten weist Spivak hin, wenn sie in Bezug auf Derrida schreibt: »Yet, �›we-women�‹ have never been the heroes of philosophy. When it takes the male philosopher hundreds of pages (not to be able) to answer the question �›who, me?�‹, we cannot dismiss our double dis-placement by saying to ourselves: �›In the discourse of affirmative deconstruction, �›we�‹ are a �›female element�‹, which does not signify �›female person�‹.« (Spivak, »Displacement and the Discourse of Woman«, S. 173f.)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 171
relle und ethnische Differenz in Nietzsches Genealogie der Moral? Einen Hinweis darauf findet sich in der Vorrede der Genealogie, wo es heißt:
»Es gilt das ungeheure, ferne und so versteckte Land der Moral �– der wirklich dagewesenen, wirklich gelebten Moral �– mit lauter neuen Fragen und gleichsam mit neuen Augen zu bereisen: und heisst dies nicht beinahe so viel als dieses Land erst entdecken?�…«408
Die Darstellung der Historie als Entdeckungsreise setzt sich der Praxis der kritisierten Geschichtsschreibungen entgegen, die im Eigenen befangen bleiben. Dem Zirkel eines Denkens, das immer nur das Bekannte wieder-entdeckt und damit die »Rück- und Heimkehr in einen fernen uralten Ge-sammt-Haushalt der Seele«409 betreibt, wird die Reise in die Fremde entge-gengestellt. Dafür muss es möglich werden, das vertraute Objekt als frem-des und distanziertes wahrnehmen zu können; ein Prozess, der die Entwicklung anderer Wahrnehmungs- und Erkenntnisperspektiven erfor-dert und für den es �›gleichsam neuer Augen�‹ bedarf. Die tradierten Kon-zepte müssen verfremdet werden, damit die Moral als unbekanntes Gebiet entdeckt werden kann. Der Historiker ist nicht Verwalter des Bekannten, sondern ein Abenteurer, der unbekanntes Gebiet entdeckt: In die Ge-schichtsschreibung schreibt sich der Topos des kolonialen Abenteurers ein. Diese Figur des Entdeckers und Erforschers der Psyche taucht, wie Tho-mas Koebner bemerkt, in Analogie zum Entdeckungsreisenden der �›äuße-ren�‹ Welt auf, die das Selbstverständnis des neuzeitlichen Europas charak-terisiert: »Die terra incognita verlagert sich aus dem geographischen in den psychologischen Bereich.«410
Die Psyche muss allerdings als unbekanntes Territorium hervorgebracht werden, damit sie im Anschluss daran �›entdeckt�‹ werden kann. Die Moral als fernes Land zu bereisen bedeutet nicht nur, einen neuen Blick auf die Moral zu entwerfen. Es erfordert vielmehr eine neue Konstruktion der Moral unter dem aktiven, schöpferischen Blick des Historikers, der sich zugleich als Reisender hervorbringt. Nietzsches Anweisungen zur Geschichts-schreibung legen dar, dass die Perspektive des Vor- oder Außermorali-schen, die der Entdecker der Moral einnimmt, erst errungen werden muss. Die Vorstellung der Geschichtsschreibung als Entdeckungsreise in »das
�—�—�—�—�—�— 408 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 254 409 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 34 410 Koebner, »Geheimnisse der Wildnis«, S. 242
172 G R E N Z F I G U R E N
ungeheure, ferne und so versteckte Land der Moral«411 fordert die Ver-fremdung des Bekannten; es muss dafür aber auf ein bestehendes Imaginä-res zurückgreifen, mit dessen Hilfe das Bekannte als fremd erblickt werden kann. Wie aber wird dies ermöglicht? In den nächsten Sätzen scheint Nietzsche vom Bild des Entdeckungsreisenden vorerst abzukommen, um die Arbeit des Historikers anhand derjenigen des Philologen zu erläutern:
»Es liegt ja auf der Hand, welche Farbe für einen Moral-Genealogen hundert Mal wichtiger sein muss als gerade das Blaue: nämlich das Graue, will sagen, das Ur-kundliche, das Wirklich-Feststellbare, das Wirklich-Dagewesene, kurz die ganze lange, schwer zu entziffernde Hieroglyphenschrift der menschlichen Moral-Ver-gangenheit!«412
Der Abenteuerreisende wird zum Philologen, der ins Archiv steigt, sich über Dokumente beugt und sie in akribischer Arbeit entziffert, denn das Studium der Geschichte erfordert die Hinwendung zu den Spuren, die die Moral hinterlässt. Die Verfremdung der Moral durch den Reisenden und ihre Entzifferung durch den Philologen scheinen zwei gegensätzliche Be-wegungen darzustellen. Beide aber fallen im Begriff der Entdeckung zu-sammen: Die Vergangenheit der Moral wird wie ein fremdes Land aber auch in ihrer Zeichenhaftigkeit entdeckt. Beide Figuren, der Reisende und der Philologe, stehen für ein Verfahren, das über die Reproduktion bestehen-der Vorstellungen von Moral hinausgeht; der Reisende, weil er der Moral wie etwas Unbekanntem begegnet, das es neu zu entdecken gilt, und der Philologe, weil er das �›Hypothesenwesen ins Blaue�‹ beiseite lässt und statt-dessen die Zeichen der Vergangenheit entziffert. Wie aber treffen sich diese beiden Verfahren der Geschichtsschreibung? Wie können das Graue, die Dokumente, die Urkunden und die Hinterlassenschaft der Moral dem Auge des Philologen in der Fremdheit entgegentreten, die der Topos des Entdeckers erfordert? Wie muss das Objekt seiner Studien beschaffen sein, damit auch der Philologe zum Reisenden wird? Die Transformation des Historikers zum reisenden Philologen scheint sich dadurch zu ereignen, dass die Zeichen der Moral zur Hieroglyphenschrift werden; zur Schrift also, die für das europäische Auge zwischen einem ewigen Geheimnis und dem Versprechen oszilliert, entziffert zu werden. Die Hieroglyphenschrift er-möglicht die Übersetzung der Moral in jenes �›ferne Land�‹, das bereist wer-
�—�—�—�—�—�— 411 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 254 412 Ebd.
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 173
den kann. Erst damit wird die Distanz hergestellt, welche die �›Entdeckung�‹ der Moral als fremdes Land ermöglicht.
Diese Bedeutung der Übersetzung für Nietzsches Kritik der Moral wird auch in einem Aphorismus zur Sprache gebracht, in dem von der Aufgabe die Rede ist, den Menschen in seinen »schreckliche[n] Grundtext homo natura«413 zurückzuübersetzen. Damit wird einerseits die restauratorische Arbeit bezeichnet, die verlangt, dass die »schmeichlerische Farbe und Übermalung«414, mit der Moral und Metaphysik den Menschen bezeichnet haben, abgekratzt und jener »ewige[ ] Grundtext homo natura«415 freigelegt wird. Die Rückübersetzung des modernen Menschen bedeutet somit nicht seine Rückkehr zum �›homo natura�‹. Die Figur des Wilden gibt vielmehr eine Richtung an, auf die hin die Moderne überwunden werden soll.
Damit zeichnet sich eine andere Bedeutung des Wilden ab als in Hegels Text: Dieser führt die Bewegung der Reflexion auf den �›natürlichen Men-schen�‹ zurück, der als �›Abstoßungsspunkt�‹ für die Konzeptualisierung der späteren, �›historischen�‹ Menschen dient. Der Wilde tritt als Grenzfigur auf, die es möglich macht, den Anfang des Subjekts als Übergang zwischen Natur und Geist zu denken. Bei Nietzsche hingegen erscheint der natürli-che Mensch als Grundtext, auf dem der moderne Mensch, der durch die Moral entstellt und verfälscht wurde, ausgedeutet werden kann. Obwohl es keine letztgültige und einzige Entzifferung des �›homo natura�‹ gibt, fungiert dieser als Gegenbild zum modernen Menschen und damit als Konstituens von Nietzsches Kritik. Um den modernen Menschen als �›homo natura�‹ entziffern zu können, muss ihm aber erst die Vorstellung des �›natürlichen�‹ Menschen zugrunde gelegt werden. »Den Menschen nämlich zurücküber-setzen in die Natur«416: Diese Aufgabenstellung verdeckt, dass die Überset-zung durch eine imaginierte �›Natur�‹ ermöglicht und autorisiert wird, welche gemeinsam mit der Möglichkeit der Übersetzung produziert wird. Mit der Vorstellung eines �›homo natura�‹ und seiner Übersetzbarkeit wird sugge-riert, dass der Grundtext der Natur vor seiner Übersetzung entstanden ist. Nietzsches �›homo natura�‹, welcher der Moderne als Folie entgegengehalten wird, ist aber ebenso das Produkt des modernen Diskurses, als deren Ande-res er erscheint.
�—�—�—�—�—�— 413 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 169 414 Ebd. 415 Ebd. 416 Ebd.
174 G R E N Z F I G U R E N
Diese versteckte Hin-Übersetzung der Gegenwart in die Vergangenheit als Bedingung der Rück-Übersetzung von der Vergangenheit in die Gegen-wart findet sich auch im Versuch, die »Hieroglyphenschrift der menschli-chen Moral-Vergangenheit«417 zu entziffern. Die Moral muss dabei erst in die Hieroglyphen übersetzt werden, bevor sie wiederum als Hieroglyphen-schrift entdeckt und entziffert werden kann. Die Hieroglyphen leisten dabei eine doppelte Übersetzungsarbeit: Indem sich ihre zeitliche und örtliche Fremdheit in die Moral einschreiben, wird diese im Gegenzug dem Auge des modernen Europäers entfremdet. Die Tätigkeit dieses zweifachen Übersetzens scheint einmal laut und einmal leise zu erfolgen: Die Überset-zung der Moral in die Hieroglyphenschrift wird vorausgesetzt, während die Übersetzung der Moral als Hieroglyphenschrift Nietzsches Konzept der Historiographie artikuliert. Wird, indem die Moral zum fremden Land und ihre Zeichen zu ägyptischen Hieroglyphen gemacht werden, erneut Afrika in den Versuch einer europäischen Selbstbestimmung eingeschrieben?
Die tropische Wendung
Die Entzifferung des Grundtexts �›homo natura�‹ bedeutet nicht, dass die Rückkehr zum natürlichen Menschen angestrebt werden soll. Vielmehr beinhaltet der Begriff der Rückübersetzung zwei Bewegungen: zu etwas �›zurück�‹ und �›über�‹ etwas hinaus. In der Genealogie wird die Überwindung der Moral mit Hilfe von Figuren des Wilden und Tropischen angedeutet und damit erst ins Feld des Denkbaren geholt. Auf diese Weise stellen, wie Wolfram Groddeck bemerkt, der Urwald und die Tropen jene Tropologie her, »in der die Rede vom �›Übermenschen�‹ überhaupt erst möglich wird«.418 Sowohl die Kritik an der Moderne wie auch der Entwurf ihrer Überwindung bedürfen einer Perspektive, die sich außerhalb der Moral befindet und vom wilden und tropischen Menschen repräsentiert wird. Auch wenn, wie Gerd Kimmerle festhält, »Nietzsches genealogische Kritik der Moral [�…] nicht auf die Wiederkehr der archaischen Urzeit«419 zielt, scheint es doch die Folie dieser Urzeit und Vorzeit zu sein, welche seine Kritik an der Moral und den Gedanken ihrer Überwindung ermöglicht.
�—�—�—�—�—�— 417 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 254 418 Groddeck, Friedrich Nietzsche �›Dionysos-Dithyramben�‹, S. 22 419 Kimmerle, Die Aporie der Wahrheit, S. 113
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 175
Durch den anderen Blick auf die eigene Kultur kann, wie Fink-Eitel schreibt, die Philosophie zur Ethnologie der eigenen Kultur werden, die »aus der Perspektive der ihr immanenten �›Wilden�‹«420 verfasst wird. Einen solchen Perspektivenwechsel vollzieht Nietzsche im Fragment zum Moral-Castratismus. Der Verzicht auf eine kriegerische Gesinnung, welcher der jüdisch-christlichen Moral zugrunde liegt, erscheint darin als etwas, über das man »in normalen Verhältnissen«421 lachen kann. Indem diese Passage vorgibt, aus einer vormoralischen Perspektive verfasst zu sein, kann die Norm der Friedfertigkeit in den Bereich des Abnormalen gerückt und zum �›Ausnahmefall�‹ erklärt werden.
Wie aber funktioniert das Wilde und die Wildnis in Nietzsches Genealo-gie, und welche zeitlich-räumlichen Verhältnisse sind dabei am Werk? He-gels unausgewiesene Prämisse, dass die Vergangenheit Europas mit der Gegenwart Afrikas substituiert werden kann, findet sich auch bei Nietz-sche. Ein Aphorismus aus Menschliches Allzumenschliches mit dem Titel »Die Zonen der Cultur« legt diese Annahme der Übersetzbarkeit von Ge-schichte und Geographie dar:
»Man kann gleichnissweise sagen, dass die Zeitalter der Cultur den Gürteln der verschiedenen Klimate entsprechen, nur dass diese hinter einander und nicht, wie die geographischen Zonen, neben einander liegen. Im Vergleich mit der gemässig-ten Zone der Cultur, in welche überzugehen unsere Aufgabe ist, macht die vergan-gene im Ganzen und Grossen den Eindruck eines tropischen Klima�’s.«422
Was bedeutet �›gleichnisweise�‹ an dieser Stelle und auf was beruht ein sol-ches Gleichnis? Was wird verglichen, wer vergleicht und welche Annah-men machen den Vergleich möglich? Das gemäßigte Klima wird zum Zei-chen dessen, was dem Menschen unter den Bedingungen der Kultur ge-schieht: Er mäßigt sich und wird mäßig gemacht; regelmäßig, maßvoll, mittelmäßig. Aus der Perspektive der gemäßigten Zone macht die Vergan-genheit einen tropischen Eindruck. Wie aber funktioniert dieser Vergleich? Bedeutet die geographische Zuschreibung, dass die Menschen der gemä-ßigten Zonen immer schon gemäßigt waren? Müssten sich die Menschen nicht von einer Klimazone in die andere bewegen, um eine Geschichte der Mäßigung zu vollziehen? Im nächsten Satz wird der Vergleich zwischen den Tropen und den gemäßigten Zonen weiter ausgeführt:
�—�—�—�—�—�— 420 Fink-Eitel, Die Philosophie und die Wilden, S. 13 421 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, Fragment 10[157], S. 545 422 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, S. 197f.
176 G R E N Z F I G U R E N
»Gewaltsame Gegensätze, schroffer Wechsel von Tag und Nacht, Gluth und Farbenpracht, die Verehrung alles Plötzlichen, Geheimnissvollen, Schrecklichen, die Schnelligkeit der hereinbrechenden Unwetter, überall das verschwenderische Ueberströmen der Füllhörner der Natur: und dagegen, in unserer Cultur, ein heller, doch nicht leuchtender Himmel, reine, ziemlich gleich verbleibende Luft, Schärfe, ja Kälte gelegentlich: so heben sich die Zonen gegen einander ab.«423
Das tropische Klima ist widerspenstig, wild, unberechenbar, heiß, farbig, unergründlich, gewaltsam, üppig, das gemäßigte Klima, dessen Beschrei-bung kurz ausfällt, ist hingegen stetig, kühl und bisweilen kalt. Hegels An-nahme von der Bedeutung des Klimas für die Entwicklung der Menschen kehrt an dieser Stelle mit einem wichtigen Unterschied wieder: Die Tropen sind nicht nur der Ort der Natur, welcher der Kultur und Geschichte vor-ausgehen, sie aber implizit mitbegründen. Die Tropen verfügen gleichzeitig über etwas, das der gemäßigten Zone abhanden gekommen ist. Der Ver-lust dieser tropischen Kraft und Intensität wird bei Nietzsche zu einem Konstituens der Kultur. Die Moderne bleibt mit den verlorenen Tropen in einer melancholischen Wendung verbunden.
Die Produktion des Gegensatzes zwischen den Tropen und den gemä-ßigten Zonen, die dieser Aphorismus vorführt, ermöglicht es, eine �›tropi-sche Perspektive�‹ auf die eigene Kultur zu erstellen und ihren Verlust des Tropischen aufzuzeigen. In diesem Vorgang kommt die Doppeldeutigkeit der �›Tropen�‹ ins Spiel, denn die Gegend am geographischen Wendekreis stellt die Bedingung der sprachlichen Wendung dar, über die der Mensch der gemä-ßigten Zone mit seiner verlorenen Vergangenheit in Beziehung tritt. Die »Homonymie von �›Tropen�‹ als geographischem Terminus (�›Wendekreis�‹) und als rhetorischem Terminus (�›Wendungen�‹)«424 ermöglicht es, die Tro-pen als reflexives Moment der europäischen Selbstbetrachtung zu konsti-tuieren; als Ort, an dem der eigene zum anderen Blick wird, der auf sich selbst zurückgewendet werden kann. Obwohl die Tropen mit den gemä-ßigten Zonen verglichen zu werden scheinen, erweisen sie sich als Durch-gangsort, der von den gemäßigten Zonen über die Tropen zurück zu den gemäßigten Zonen führt. Im Zuge dieser außereuropäischen Rückwen-dung zu Europa kann eine innereuropäische zeitliche Differenz eingeholt, imaginiert und verräumlicht werden. Das Hintereinander der Geschichte wird in das Nebeneinander der Geographie überführt; die Tropen ermögli-chen eine räumliche Auslegeordnung europäischer Zeitenfolgen. Sie erwei-
�—�—�—�—�—�— 423 Ebd., S. 198 424 Groddeck, Friedrich Nietzsche �›Dionysos-Dithyramben�‹, S. 21
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 177
sen sich als differenzierendes Moment zwischen dem Europäer der Ge-genwart und demjenigen der Vergangenheit:
»Wenn wir dort sehen, wie die wüthendsten Leidenschaften durch metaphysische Vorstellungen mit unheimlicher Gewalt niedergerungen und zerbrochen werden, so ist es uns zu Muthe, als ob vor unsern Augen in den Tropen wilde Tiger unter den Windungen ungeheurer Schlangen zerdrückt würden; unserem geistigen Klima fehlen solche Vorkommnisse, unsere Phantasie ist gemässigt, selbst im Traume kommt uns Das nicht bei, was frühere Völker im Wachen sahen.«425
Die Übersetzung funktioniert: Was wir dort in den Tropen sehen, ist das, was die früheren Völker sahen und wir nicht mehr sehen �– oder nur noch sehen können, wenn wir den Umweg durch die Tropen nehmen. Der Mensch, der, wie es in der Vorrede der Genealogie heißt, sich anschickt, die Moral »gleichsam mit neuen Augen zu bereisen«,426 blickt mit Hilfe der Tropen auf die Gedankenwelten früher Völker, �›als ob vor seinen Augen in den Tropen wilde Tiger zerdrückt würden�‹. Die Tropen verleihen jene neuen Augen, die sich auf die eigene Geschichte richten und sie anders sehen können. Mit der Rückwendung zur eigenen Vergangenheit ermögli-chen die Tropen aber auch die Hinwendung zu dem, was der Gegenwart abhanden gekommen ist. Stellen Nietzsches Tropen den Versuch dar, das Undarstellbare des Verlusts aufzuzeigen, den der Mensch durch seine Zivi-lisierung erfahren hat? Wenn das schlechte Gewissen auf der melancholi-schen Verinnerlichung eines Verlusts gründet, der nicht dargestellt werden kann, dann hat Nietzsches Versuch, diesen Verlust mit Hilfe der Tropen zu repräsentieren, die unweigerliche Verschiebung des Undarstellbaren zur Folge �– eine Verschiebung, die sich auf dem kolonialen Imaginären der Moderne ereignet. Auch in Nietzsches Beispiel durchkreuzt die Melancho-lie dann, wie Butler schreibt, den Versuch ihrer Erklärung, »weil sie unsere Fähigkeit ans Licht bringt, uns auf die Psyche mittels Tropen der Inner-lichkeit zu beziehen, die ihrerseits schon Wirkungen der Melancholie sind. [�…] Solche Tropen �›erklären�‹ die Melancholie nicht: Sie gehören zu ihren erstaunlichen diskursiven Effekten.«427 Wenn nun die �›gemäßigte Phanta-sie�‹ des Europäers in den Tropen die Bilder erblickt, die sich ihm selbst �›im Traume�‹ nicht mehr zeigen, wird der undarstellbare Verlust dessen, was durch die Moderne zerstört wurde, in einen Bereich verschoben, der ge-meinsam mit der Moderne erzeugt wird. Die Trope der Tropen stellen �—�—�—�—�—�— 425 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, S. 198 426 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 254 427 Butler, Psyche der Macht, S. 161
178 G R E N Z F I G U R E N
nicht die Erklärung der modernen Melancholie dar, sondern sind �›ihrerseits schon als Wirkung der Melancholie zu lesen�‹, die der europäischen Mo-derne eingeschrieben ist.
In einem Aphorismus aus Jenseits von Gut und Böse, der für die Tropen und gegen die gemäßigten Zonen Stellung bezieht, werden die Tropen in den Kontext von Nietzsches Moralkritik verschoben:
»Man missversteht das Raubthier und den Raubmenschen (zum Beispiel Cesare Borgia) gründlich, man missversteht die �›Natur�‹, so lange man noch nach einer �›Krankhaftigkeit�‹ im Grunde dieser gesündesten aller tropischen Unthiere und Gewächse sucht, oder gar nach einer ihnen eingeborenen �›Hölle�‹ �– : wie es bisher fast alle Moralisten gethan haben. Es scheint, dass es bei den Moralisten einen Hass gegen den Urwald und gegen die Tropen giebt? Und dass der �›tropische Mensch�‹ um jeden Preis diskreditirt werden muss, sei es als Krankheit und Ent-artung des Menschen, sei es als eigne Hölle und Selbst-Marterung? Warum doch? Zu Gunsten der �›gemässigten Zonen�‹? Zu Gunsten der gemässigten Menschen? Der �›Moralischen�‹? Der Mittelmässigen? �– Dies zum Kapitel �›Moral als Furcht-samkeit�‹. �–«428
Die Tropen ermöglichen eine Wendung hin zu den Figuren, welche die Natur innerhalb der Kultur repräsentieren. Mit Cesare Borgia, einem �›Raub-menschen�‹, der in der Kultur auftritt, wird aber nicht nur die Anwesenheit tropischer Elemente in der gemäßigten Zone Europas bezeugt, sondern auch die mögliche Überwindung der Moral durch den tropischen Men-schen angekündigt.429 Die Tropen ermöglichen damit nicht nur die Wen-dung hin zur Vergangenheit, sondern auch jene zur Zukunft. Sie verbinden
�—�—�—�—�—�— 428 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 117. Im Jahre 1881 veröffentlicht Nietzsche in der
Morgenröthe einen Aphorismus, in dem die Differenz zwischen dem hellhäutigen und dem dunkelhäutigen Menschen auf den unterschiedlichen Umgang mit Wut zurückge-führt wird. Furcht wird dabei als Ursache von Intelligenz angeführt; eine Thematik, die in Jenseits von Gut und Böse und der Genealogie ausgearbeitet wird. Während die Ausführun-gen zum �›gesunden�‹ Raubmenschen der Tropen in Jenseits von Gut und Böse mit dem Satz »Dies zum Kapitel �›Moral als Furchtsamkeit�‹« (ebd.) enden, beginnt der Aphorismus in der Morgenröthe mit dem Titel �›Furcht und Intelligenz�‹. Beide Passagen führen die Ent-stehung der Intelligenz auf die Furchtsamkeit des Menschen zurück, der seine Aggres-sion dadurch nicht mehr nach außen richten kann. In beiden Passagen wird dieser Zu-sammenhang durch die Gegenüberstellung des europäischen Menschen mit einem kul-turell Anderen bewerkstelligt, im einen Fall ist dies der tropische, im anderen Fall der dunkelhäutige Mensch. Vgl. Nietzsche, Morgenröthe, S. 202.
429 Borgia wird denn auch in Nietzsches Werk mehrmals mit dem Übermenschen in Bezug gebracht. Vgl. Groddeck, Friedrich Nietzsche �›Dionysos-Dithyramben�‹, S. 22.
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 179
die �›Krankheit�‹ der Moderne mit der verlorenen und der wiederzuerlangen-den �›Gesundheit�‹.
Die Tropen fungieren in diesem Aphorismus aber auch als Mittel der Kritik: Sie ermöglichen es, die gemäßigten Zonen aus der Perspektive der Tropen zu problematisieren. Der tropische Mensch stellt darin jene Figur des Willens dar, der nicht auf sich selbst gewendet worden ist. Er erscheint als Mensch vor dem schlechten Gewissen, der die Rückwendung des Wil-lens als Abwendung von der Natur erkennbar macht; als Abwendung von einer Natur, die mit Gesundheit gleichgesetzt wird. Das Urteil des morali-schen Menschen, der tropische Mensch sei krank, wird darum als �›Hass gegen den Urwald und gegen die Tropen�‹ ausgelegt und zum Symptom der eigentlichen Krankheit erklärt, die sich aus dem Ressentiment gegen den �›gesunden�‹ tropischen Menschen speist. Indem das moralische Urteil über den tropischen Menschen zum Symptom mutiert, wird das Verhältnis von Krankheit und Gesundheit umgekehrt: Der gesunde Moralist erscheint als krank und der kranke tropische Mensch als gesund. Die Tropen werden damit zu einem bedeutsamen Moment von Nietzsches Kritik: Sie stellen einen Wendepunkt dar, an dem die �›Umwertung der Werte�‹ vorgenommen werden kann, auf der Nietzsches Moralkritik basiert.430
Wildnis und Melancholie
Die Figur des Wilden ermöglicht es, den Bruch zwischen dem vorgesell-schaftlichen Leben und dem gesellschaftlichen Dasein zu markieren, mit dem die Moral entstanden ist. So geht das schlechte Gewissen unter dem Druck von Veränderungen hervor, durch die der Mensch »sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand«.431 Und es entsteht durch die Verinnerlichung des Willens als Vergewaltigung des »thierische[n] alte[n] Selbst«.432 Für was aber steht dieses tierische alte Selbst? Ist es ein Rest, ein Überbleibsel der Wildnis, die der Mensch mit dem Eintritt in die Gesellschaft verlassen hat? Steht es für jene »der Wild-
�—�—�—�—�—�— 430 Vgl. folgende Fragen in der Vorrede der Genealogie: »unter welchen Bedingungen erfand
sich der Mensch jene Werturtheile gut und böse? und welchen Werth haben sie selbst?« (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 250)
431 Ebd., S. 321f. 432 Ebd., S. 326
180 G R E N Z F I G U R E N
niss, dem Kriege, dem Herumschweifen, dem Abenteuer glücklich ange-passten Halbthiere[ ]«433, die der Moral vorausgehen? Das alte tierische Selbst tritt dem Willen allerdings nicht als äußerliche Figur seiner Vergan-genheit gegenüber, sondern es erscheint in seinem Inneren als konstitutives Moment seiner Formation. Es speist sowohl die Differenz zwischen Mensch und Tier als auch jene zwischen Vergangenheit und Gegenwart in das Subjekt ein. Wenn das �›alte tierische Selbst�‹ als Chiffre für das Leben vor der Moral gelesen werden kann, wie ist dann die Entstehung des Sub-jekts mit dieser Vergangenheit verknüpft? In der Genealogie heißt es dazu:
Der Mensch, »dies an den Gitterstangen seines Käfigs sich wund stoßende Thier, das man �›zähmen�‹ will, dieser Entbehrende und vom Heimweh der Wüste Ver-zehrte, der aus sich selbst ein Abenteuer, eine Folterstätte, eine unsichere und gefährliche Wildniss schaffen musste �– dieser Narr, dieser sehnsüchtige und ver-zweifelte Gefangne wurde der Erfinder des �›schlechten Gewissens�‹«.434
Der Wille wendet sich im schlechten Gewissen auf sich selbst, weil er vom Verlust der Wildnis angetrieben ist. Der Mensch erscheint als das Tier, das von der Sehnsucht nach der Wildnis, vom �›Heimweh nach der Wüste�‹ geplagt ist. Das Vermögen der Imagination, das mit der Verinnerlichung des Willens entsteht, ist nun als Bedingung der Möglichkeit zu erkennen, die verlorene Wildnis in der Innerlichkeit aufrechtzuerhalten, oder viel-mehr: Die Innerlichkeit der Psyche entsteht aus der fiktiven Bewahrung der verlorenen Wildnis. Die Gefahren und Lockungen, die dem Menschen durch seine gesellschaftliche Normierung abhanden kommen, werden in der Psyche wieder erstellt. Das schlechte Gewissen formiert sich als innere Wildnis, die aus dem Verlust der äußeren Wildnis hervorgeht.
Diese Weigerung, den Verlust eines geliebten Objekts anzuerkennen, könnte man mit Sigmund Freuds Begriff der �›Melancholie�‹ beschreiben. Im Gegensatz zum Zustand der Trauer, in dem der Verlust verarbeitet wird, hält die Melancholie das Begehren nach einem Liebesobjekt aufrecht, in-dem sie es in den Bereich der Psyche verlegt. Mit dem Begehren nach dem Objekt wird aber auch die Aggression, die sein Verlust begleitet, nach in-nen gerichtet. Das Selbstverhältnis des Melancholikers ist darum von einer Ambivalenz gekennzeichnet, in der sich das Begehren nach dem verlore-nen Liebesobjekt mit der Aggression verbindet, die diesem gegenüber empfunden wird. Wird Freuds Darstellung der Melancholie mit dem
�—�—�—�—�—�— 433 Ebd., S. 322 434 Ebd., S. 323
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 181
schlechten Gewissen bei Nietzsche in Beziehung gesetzt, dann kann die Subjektformation als melancholischer Verinnerlichungsprozess der Wildnis gelesen werden.435 Die Rückwendung des Willens ist dann unweigerlich mit dem Versuch verbunden, den Verlust der Wildnis zu verleugnen und auf-zuheben. Die Figur der Rückwendung geht nicht nur auf einen äußeren hemmenden Effekt zurück, den die soziale Repression auf den Willen hat, sie geht mit dem inneren Versuch einher, die Psyche als Wildnis hervorzu-bringen.
Der Wille, der sich in der Passage zur �›Selbstvergewaltigung�‹ unterwirft, um sich als sein Widerspruch, sein Nein, seine Kritik und seine Verachtung hervorzubringen, lässt sich auf diesem Hintergrund als Wille lesen, der mit der Produktion seiner inneren Wildnis beschäftigt ist. Die Einschränkung des Willens erschafft den Bereich der Imagination, der es diesem wiederum ermöglicht, die verlorene Wildnis zu bewahren, indem er sich selbst zu ihr macht. Die Gefährlichkeit, die Abgründigkeit und die Unberechenbarkeit, die dem Menschen mit seiner Sozialisierung genommen sind, werden in sein Inneres verschoben und damit zu Bedingungen des psychischen Le-bens. Das schlechte Gewissen, das unter dem Druck der Gesellschaft zu-stande kommt, hält paradoxerweise jene Wildnis aufrecht, die es überwin-den soll. Der Mensch wird von der Wildnis getrennt und in die Gesell-schaft eingeschlossen, der Gegensatz zwischen Wildnis und Staat aber verschwindet nicht, sondern verschiebt sich in sein Inneres. Die Entste-hung des schlechten Gewissens ermöglicht einerseits die �›Normalisierung�‹ des Menschen durch den Staat: Der Mensch wird gefügig, gelehrsam und berechenbar gemacht. Andererseits führt die Disziplinierung des Menschen gerade zur Bewahrung der Wildnis im Subjekt und damit zum Aufrecht-erhalten jener Kräfte, die von der Gesellschaft als gefährlich und feindlich bestimmt worden sind.
Die Kultur stellt folglich nicht die Überwindung des Tieres durch den Menschen dar, sondern die Aufrechterhaltung des Tierischen unter den Bedingungen der Gesellschaft. Die Trennlinie verläuft bei Nietzsche nicht
�—�—�—�—�—�— 435 Melancholie und Gewissensbildung sind auch bei Freud eng verknüpft. Die affektive
Verfasstheit des Melancholikers, so betont Freud, ermöglicht Einsichten in die Konsti-tution des menschlichen Ich: »Wir sehen bei ihm [dem Melancholiker], wie sich ein Teil des Ichs dem anderen gegenüberstellt, es kritisch wertet, es gleichsam zum Objekt nimmt. [�…] Was wir hier kennen lernen, ist die gewöhnlich Gewissen genannte Instanz.« (Freud, »Trauer und Melancholie«, S. 433) Auf die Nähe dieser zwei Konzepte der Psy-che weist auch Butler hin: »In dieser Darstellung der Melancholie entsteht Reflexivität, genau wie für Nietzsche, als verwandelte Aggressivität.« (Butler, Psyche der Macht, S. 175)
182 G R E N Z F I G U R E N
zwischen Mensch und Tier, sondern zwischen dem wilden und dem domesti-zierten Tier, zwischen dem Tier also, das in der Wildnis lebt, und jenem, das die Wildnis in seiner Innerlichkeit erstellen muss. Was als Sozialisierung des Menschen gilt, seine Erziehung zum moralisch guten Subjekt, wird in der Genealogie auf einen Willen zurückgeführt, der sich unter den Bedingun-gen der Kultur »neue und gleichsam unterirdische Befriedigungen«436 sucht. Anders als in Hegels Phänomenologie unterscheidet die Figur der Rückwendung damit nicht den Menschen vom Tier. Vielmehr ist der Mensch das Tier, das sich gegen sich selbst wendet. Er entsteht als »Kriegs-erklärung gegen die alten Instinkte«437, eine Kriegserklärung allerdings, die dieser alten Instinkte bedarf, um sie gegen sich selbst zu richten. Indem aber die Formierung der Psyche als melancholische Verinnerlichung der Wildnis beschrieben und auf dieselben Instinkte zurückgeführt wird, die auch im Menschen vor der Sozialisierung am Werk sind, stellt Nietzsche auf bedeutsame Weise die Grenzen von Natur und Kultur, Tier und Mensch in Frage. Der Mensch erscheint als das Tier, das von der Sehnsucht nach der verlorenen Wildnis getrieben wird. Nietzsches Lektüre der zivilisierten Psyche lässt den �›Grundtext des homo natura�‹ erkennen und macht es dadurch unmöglich, den zivilisierten Menschen vom Tier und vom Wilden kategorisch zu trennen. Der Nexus von Aggression und Idealisierung, der die melancholische Verinnerlichung des verlorenen Liebesobjekts kenn-zeichnet, lässt sich derart in Nietzsches Darstellungen des schlechten Ge-wissens ausmachen: Einerseits entsteht es aus der Vergewaltigung des �›alten tierischen Selbst�‹, andererseits aus der Sehnsucht nach der verlorenen Wildnis. Die Opposition zwischen Wildnis und Gesellschaft trennt nicht nur den vormoralischen vom sozialisierten Menschen, sondern zieht sich durch dessen Psyche.
Die Grenzfiguren des Tiers und des Wilden erscheinen deshalb nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Subjekts. Was sie denkbar ma-chen, ist die Entfremdung, die Spaltung, die Grenzziehung, die das Subjekt beständig wiederholen muss, um Subjekt zu sein. Was dabei unreflektiert bleibt, ist das, was diese Kritik ermöglicht, die Prämisse einer Grenze zwi-schen der Wildnis und der domestizierenden Gesellschaft. Nietzsches Kritik produziert beständig jene Differenz, die sie in Frage stellt: Um den Bruch mit der Wildnis zu problematisieren, muss sie die Vorstellung der Wildnis kontinuierlich hervorbringen. Die Herleitung des schlechten Ge-�—�—�—�—�—�— 436 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 322 437 Ebd., S. 323
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 183
wissens aus der Sehnsucht nach der Wildnis stellt demnach nicht nur die Beschreibung einer zivilisierten Melancholie dar, sondern auch ihr Symptom; sie stellt ein Narrativ dar, welches das Begehren, das sie diagnostiziert, zugleich erzeugt. Dieser Bruch zwischen der Wildnis und der Zivilisation aber, und diese Grenze, die das Subjekt aufsucht, um die Moderne zu überwinden, werden denkbar durch Figuren der Alterität.
Der Mensch und die konstitutive Differenz zum Tier
Die Differenz zwischen Natur und Kultur wird nicht nur am wilden und zivilisierten Menschen, sondern auch am Unterschied zwischen Mensch und Tier festgemacht. Schon in einer früheren Schrift Nietzsches zeichnet sich die Funktion der anthropologischen Differenz für die Selbstformation des Menschen ab: Die Zweite Unzeitgemässe Betrachtung eröffnet die Fragen nach der Geschichte mit dieser Differenz. Sie beginnt mit der Aufforde-rung, eine weidende Herde zu betrachten:
»Betrachte die Heerde, die an dir vorüberweidet: sie weiss nicht was Gestern, was Heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblicks.«438
In der Differenz zwischen Mensch und Tier, die diese Schrift eröffnet, tritt die Geschichtlichkeit des Menschen in einen Gegensatz zum Ungeschicht-lichen des Tieres. Das Tier, das sich dem menschlichen Blick darbietet, ist ahistorisch. Es ist ganz in seine Betätigungen versunken, die es repetitiv vollzieht, ohne einen Begriff der vergehenden Zeit zu besitzen. Während der Beobachter die Stunden und Tage zählt und derart die Herde an sich �›vorbeiweiden�‹ sieht, vollzieht das Tier die ständige Wiederholung dersel-ben Tätigkeiten. Es verfolgt den Wechsel der Momente nicht, die der Mensch beharrlich aneinanderreiht, und damit auch nicht die größeren Bewegungen seiner Lust und Unlust. Es scheint sich auch nicht als Indivi-duum zu formieren, denn es ist nicht vom einzelnen Tier, sondern von der Herde die Rede, die �›vorüberweidet, frisst, ruht und verdaut�‹. Mit der Ver-gangenheit und Zukunft fällt die Individualität weg; die Herde und das individuelle Tier fallen in eins.
�—�—�—�—�—�— 438 Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen II, S. 248
184 G R E N Z F I G U R E N
Der Leser, der zu Beginn aufgefordert wird, die Herde zu betrachten, findet sich selbst in einem Gegensatz zu ihr. Er wird auf einen Platz ver-wiesen, an dem die Herde vorüberweidet, während sich die Herde immer in demselben Augenblick befindet. Er erkennt sich im Unterschied zur Herde als historisches Wesen.
»Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschenthums sich vor dem Thiere brüstet und doch nach seinem Glück eifersüchtig hinblickt �– denn das will er allein, gleich dem Thiere weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Thier. Der Mensch fragt wohl einmal das Thier: warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Thier will auch antworten und sagen, das kommt daher dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte �– da vergass es aber auch schon diese Antwort und schwieg: so dass der Mensch sich darob verwunderte«.439
Der menschliche Beobachter, der die Herde betrachtet, bleibt nicht unbe-teiligt; vielmehr erweist sich dieses Betrachten als aktives Moment, in dem der Mensch immer schon von seiner Betrachtung affiziert ist und eine Haltung zum Betrachteten einnimmt. Diese ist in Bezug auf das Tier eine doppelte: Er �›brüstet sich�‹ vor ihm und �›blickt eifersüchtig zu ihm�‹ hin. Der Mensch setzt sich als historisches Wesen in Pose; in dieser aber zeigt sich das Dilemma seiner historischen Existenz. Der Unterscheid zwischen seiner Körperhaltung und seinem Blick bringt die Ambivalenz zum Vor-schein, die seiner Beziehung zum Tier und zum Ahistorischen eingeschrie-ben ist: Er fühlt sich dem Tier überlegen und beneidet es. Er erstellt eine Hierarchie zwischen sich und dem Tier und empfindet den Vorrang, den er sich selbst zuweist, mit Stolz und Überheblichkeit, er �›brüstet sich vor ihm�‹. Diese Haltung wird aber von seinem Blick durchbrochen, der �›eifer-süchtig nach dem Glück des Tieres blickt�‹. Das Tier, das ohne Schwermut, Überdruss und Schmerz lebt, weckt die Sehnsucht des Menschen nach dem Glück der Geschichtslosigkeit. Die Hierarchie kehrt sich um und das Tier erscheint als vom Glück privilegiertes Wesen. Das bedeutet aber auch, dass sich der Mensch erst im Angesicht des Tieres als historisch erfährt. Seine Geschichtlichkeit ist der Effekt einer performativen Handlung ge-genüber dem ungeschichtlichen Tier. Seine eigene Historizität entsteht durch die Erfahrung des Unhistorischen, die sich ihm am Tier zeigt, die er aber auch aktiv am Tier erblickt.
�—�—�—�—�—�— 439 Ebd.
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 185
»Dann sagt der Mensch �›ich erinnere mich�‹ und beneidet das Thier, welches sofort vergisst und jeden Augenblick wirklich sterben, in Nebel und Nacht zurücksinken und auf immer erlöschen sieht. So lebt das Thier unhistorisch«.440
Indem der Mensch beobachtet, wie das Tier vergisst, erinnert er sich daran, dass er nicht vergessen kann. Der Mensch vollzieht damit den Unterschied zum Tier. Er erkennt dessen Fähigkeit zu vergessen und ist dadurch ge-zwungen zu erinnern, dass er nicht vergessen kann. Die Trennung zwi-schen Tier und Mensch geht nicht auf das Tier zurück; das vergisst zu schnell, um die Erinnerung an eine Differenz halten zu können. Sie wird durch den Menschen erstellt; als ein performativer Akt, der nicht nur die Differenz zwischen Mensch und Tier, sondern auch die zwei Grundverfas-sungen des historischen Menschen hervorbringt: den Vorrang des Ge-schichtlichen und die Sehnsucht nach dem Geschichtslosen.
»Deshalb ergreift es ihn, als ob er eines verlorenen Paradieses gedächte, die wei-dende Heerde oder, in vertrauterer Nähe, das Kind zu sehen, das noch nichts Vergangenes zu verläugnen hat und zwischen den Zäunen der Vergangenheit und der Zukunft in überseliger Blindheit spielt«.441
Der Blick auf die Herde erzeugt beim Menschen die Erfahrung der Diffe-renz zum Ungeschichtlichen. Seine Schwermut angesichts des Glücks des Tieres, seine Erinnerungen, die im Kontrast zum vergesslichen Tier stehen, sein Überdruss am Menschsein und sein Schmerz darüber, nicht Tier zu sein, unterscheiden ihn von dem, was er gleichzeitig verachtet und zu sein wünscht. Indem der Mensch sich als historisch vom Tier absetzt, erzeugt er das Begehren nach dem �›verlorenen Paradies�‹, das sich am unhistori-schen Tier zeigt. Wie bei Hegel markiert das Tier damit eine Zäsur, die sich für die Definition des Menschlichen als grundlegend erweist.442 Das Unhis-torische wird aber an dieser Stelle in eine andere Figur übersetzt, diejenige des Kindes, das sich in �›vertrauterer Nähe�‹ zum Menschen befindet. Zwei Figuren des Anfangs, zwei Grenzfiguren der Geschichte markieren damit den geschichtlichen Menschen: das ahistorische Tier, das der Geschichte immer äußerlich bleibt, und das vor-historische Kind, das bald Eingang in
�—�—�—�—�—�— 440 Ebd., S. 249 441 Ebd. 442 Giorgio Agamben bezeichnet die Erzeugung der Differenz zwischen Mensch und Tier
als �›anthropologische Maschine�‹, welche die westliche Philosophie antreibt und ihren Begriff des Menschlichen erst möglich macht: »Die Anthropogenese resultiert aus der Zäsur und der Gliederung zwischen Humanem und Animalischem. Diese Zäsur verläuft allererst im Inneren des Menschen.« (Agamben, Das Offene, S. 87)
186 G R E N Z F I G U R E N
die Geschichte finden und ebenfalls zum Menschen werden wird, der stolz und eifersüchtig auf Tier und Kind blickt.
Mit dem Tier und dem Kind als Figuren vor der Geschichte kommen zwei unterschiedliche Differenzen ins Spiel, die in der Konstitution des Menschen als historisches Wesen am Werk sind. Das Tier markiert das Außen der Geschichte, das Kind hingegen die Nähe zum Übergang in die Geschichtlichkeit. Mit dem Kind verbindet sich nicht nur die Wehmut über das �›verlorene Paradies�‹, sondern auch die Ambivalenz der Passage, durch welche die Geschichtlichkeit gewonnen und die Selbstvergessenheit verloren wird: »Und doch muss ihm [dem Kind] sein Spiel gestört werden: nur zu zeitig wird es aus der Vergessenheit herausgerufen.«443 Anhand des Kindes erinnert sich der Erwachsene daran, wie er sich zu erinnern be-gann. Das Kind ist im Gegensatz zum Tier nicht nur das Wesen, das sich nicht, sondern dasjenige, das sich noch nicht erinnert und bald erinnern muss. Das Kind ist jene Figur des Anfangs, welche die Passage zwischen Unhistorischem und Historischem denkbar macht. Es ermöglicht es, das Ende der Vergessenheit und den Anfang der Erinnerung zu erinnern.
Während das Tier das Außen der Geschichte markiert, ist das Kind die Figur ihres Anfangs. In einer Vorstufe zur Zweiten Unzeitgemässen Betrachtung aus dem Herbst/Winter 1873/74 erscheint an dieser Stelle allerdings eine dritte Figur, welche aus der Druckfassung gestrichen wird. Die Differenz zwischen historischem und unhistorischem Leben wird in diesem Frag-ment nicht nur an Mensch und Tier, Erwachsenem und Kind, sondern auch am Unterschied zwischen dem Europäer und dem Inder festgemacht.
»Solche Betrachtungsart ist bei uns selten und anstössig, denn wir fordern gerade Unersättlichkeit in der Betrachtung des Geschehenden und nennen die Völker, die mit diesem unersättlichen Drange weiter leben und, wie man sagt, immer �›fort-schreiten�‹, im ehrenden Sinne die �›geschichtlichen�‹ Völker; ja wir verachten die andersgesinnten, z. B. die Inder, und pflegen uns ihre Art aus heissem Clima und allgemeiner Trägheit, vor allem aus der sogenannten �›Schwäche der Persönlichkeit�‹ abzuleiten: als ob unhistorisch leben und denken immer das Zeichen der Entartung und Stagnation sein müsse.«444
Nietzsche schlägt an dieser Stelle vor, die Bedeutung der Historizität aus der Perspektive eines ungeschichtlichen Volkes zu betrachten. Die An-nahme, alle Geschehnisse müssten notwendigerweise gesammelt, zusam-mengetragen und geordnet werden, verliert ihren Anspruch auf Unbe-�—�—�—�—�—�— 443 Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen II, S. 249 444 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1869�–1874, Fragment 30[2], S. 728f.
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 187
dingtheit, wenn das Primat der Historizität in Frage gestellt wird. Die he-gelianische Vorstellung, Geschichtsbewusstsein und Entwicklung ließen sich nicht voneinander trennen, wird aus einer solchen Außensicht pro-blematisch. Die Figur aber, welche diese Perspektive ermöglicht, ist der angeblich unhistorische Inder. Dieser ermöglicht, wie Stephan Günzel ausführt, einen anderen Blick auf die Bedeutung des Geschichtlichen: »Hier [�…] führt Nietzsche ein Argument ein, das eine externe Position benötigt: Nietzsche fordert zu einem Gedankenexperiment auf, aus der Position einer existierenden Kultur zu denken, welche aus europäischer Sicht �– und besonders aus der Sicht Hegelianischer Geschichtsphilosophen �– als �›ungeschichtlich�‹ betrachtet werde.«445 Nietzsches Feststellung, es quäle »unsere Gelehrten, mit der Herstellung einer indischen Geschichte so gar nicht fertig werden zu können«,446 liest sich wie eine Anspielung auf Hegel, der in seinen Geschichtsvorlesungen festhält: »Was man also von der indischen Geschichte weiß, ist meist durch Fremde bekannt geworden, und die einheimische Literatur gibt nur unbestimmte Data an. Die Europäer versichern die Unmöglichkeit, den Morast indischer Nachrichten zu durchwaten.«447
Nietzsche zieht an dieser Stelle auch die bei Hegel artikulierten Zu-sammenhänge zwischen Klima und Entwicklungsstand eines Volkes in Frage. Diese Kritik allerdings ist, wie Günzel bemerkt, in Nietzsches Schriften keineswegs durchgängig: »Es finden sich zahlreiche Hinweise und Aussagen, in denen Nietzsche die Idee eines kausalen Determinationsver-hältnisses zwischen Klima und geistiger oder körperlicher Entwicklung unterschreibt.«448 Ob Nietzsche vor allem ein kausales Verhältnis zwischen Klima und Kultur annimmt, kann bezweifelt werden; er geht aber an vielen Stellen von Zusammenhängen zwischen Klima und Kultur aus.449 Auch im zitierten Fragment verwirft Nietzsche die Möglichkeit einer solchen Ver-bindung nicht, sondern er schreibt sie der Perspektive des Europäers zu
�—�—�—�—�—�— 445 Günzel, »Nietzsches Schreiben als kritische Geographie«, S. 239f. 446 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1869�–1874, Fragment 30[2], S. 729 447 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 205 448 Günzel, »Nietzsches Schreiben als kritische Geographie«, S. 241 449 So endet die erste Abhandlung der Genealogie mit dem Vorschlag, ein Preisausschreiben
zu veranstalten, in dem es unter anderem darum gehen soll, die Zusammenhänge zwi-schen Physiologie und Moral zu untersuchen. Dabei ist auch die Rede vom Wert der Moral »in Hinsicht auf möglichste Dauerfähigkeit einer Rasse (oder auf Steigerung ihrer Anpassungskraft an ein bestimmtes Klima oder auf Erhaltung der grössten Zahl)« (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 289).
188 G R E N Z F I G U R E N
und relativiert dadurch ihre Aussagekraft. Die Vorstellung, dass ein unge-schichtliches Leben nur unter dem Blickwinkel des Historizismus als min-derwertig und stagnierend wahrgenommen wird, ermöglicht eine ironische Rückbesinnung auf das europäische Primat der Geschichtlichkeit, das nun lediglich als anderer Modus des Lebens erscheint:
»Die historischen Menschen merken nicht, wie unhistorisch sie sind und wie auch ihre Beschäftigung mit der Geschichte nicht im Dienste der Erkenntniss, sondern des Lebens steht. Vielleicht betrachten hinwiederum die Inder unsere Gier nach dem Geschichtlichen und unsre Schätzung der �›geschichtlichen�‹ Völker und Men-schen als ein occidentalisches Vorurtheil oder sogar als eine Krankheit der Köpfe: �›haben nicht so unhistorisch wie wir �– werden sie sagen, auch alle jene Männer gelebt, die selbst ihr die Weisen nennt? Oder war Plato kein unhistorischer Mensch? [�…]�‹«450
Der Blick des Inders auf Europa ermöglicht es, den Anspruch des histori-schen Menschen zu dämpfen. Auch an dieser Stelle liest sich Nietzsches Text wie eine Kritik an Hegel: Die Geschichtlichkeit Europas belegt nicht seinen Vorrang und auch nicht, dass die europäische Existenz im Dienste der Erkenntnis steht. Vielmehr stellt der europäische Umgang mit Ge-schichte nichts anderes als eine spezifische Form des Lebens dar, die ne-ben anderen Lebensweisen existiert und aus der Sicht des Inders ebenso sehr als Vorurteil wahrgenommen werden kann wie das angebliche ge-schichtliche Desinteresse des Inders aus der Sicht Europas.
Indem also die Perspektive des Inders auf Europa angewendet wird, relativiert sich der historische Status Europas. Aus der Sicht des Inders sind die Europäer nicht das bedeutungsvolle Zentrum der Geschichte, sondern sie sind die �›Occidentalen�‹ mit ihrer Besessenheit für die Historie. Die fiktive Position des kulturell Anderen ermöglicht damit Nietzsches Kritik an der eigenen Kultur. Die Inder treten auf, um den Anspruch des historischen Menschen in Frage zu stellen und ihn daran zu erinnern, dass die Prämisse der Geschichtlichkeit selbst historisch ist. Auf diese Ein-wände der Inder gibt es aber keine Antwort der Occidentalen; vielmehr werden die Inder im Anschluss daran zu zankenden Weisen, von denen sich der Europäer getrost wieder abwendet:
»Doch lassen wir die Inder zanken: mögen sie weiser sein als wir, wir wollen aber heute einmal unserer Unweisheit recht froh werden und uns als den �›Thätigen und Fortschreitenden�‹ einen guten Tag machen. Denn es soll über den Nutzen der
�—�—�—�—�—�— 450 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1869�–1874, Fragment 30[2], S. 729
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 189
Historie nachgedacht werden und zwar darüber, ob wir bereits den grösstmöglichen Nutzen, der von ihr zu gewinnen ist, gewonnen haben. Es lebe das occidentalische Vorurtheil für das Historische: sehen wir nur zu, dass wir, bei dem Glauben an den Fortschritt, auch innerhalb jenes �›Vorurtheils�‹ fortschreiten, nämlich jedenfalls irgendwohin, wo wir noch nicht standen.«451
Der Inder dient also einem Perspektivenwechsel, der den Blick auf Europa und damit die Kritik an einem Geschichtsverständnis ermöglicht, das in Europa bereits den Status des Selbstverständlichen erlangt hat. Mit Hilfe des unhistorischen Blicks des Inders, der an der Grenze der Geschichte erscheint, kann Hegels These von der Untrennbarkeit von Geschichte und Entwicklung angefochten werden. Durch die indische Perspektive wird die Geschichte als Randphänomen denkbar und deren zentrale Bedeutung für die europäische Moderne sowohl aufgezeigt als auch aufgebrochen. Ironi-scher Effekt dieser Erzählung ist allerdings die Konstruktion eines Inders, der in seiner Kritik am historischen Selbstverständnis Europas selbst ein großes Geschichtsverständnis aufweist.
Wie Hegel geht auch Nietzsche an dieser Stelle von der Differenz zwi-schen einem historischen Europa und einem ahistorischen Orient aus, und wiederholt damit den Unterschied zwischen Mensch und Tier, Erwachse-nem und Kind auf der Ebene der Kultur. Das Tier macht dem europäi-schen Menschen deutlich, dass er seiner Geschichtlichkeit nicht entfliehen kann, das Kind zeigt ihm, dass der Verlust des Ungeschichtlichen irreversi-bel ist, und der Inder ermöglicht ihm die Einsicht, dass auch die geschicht-liche Existenz nur eine spezifische Form des Lebens darstellt. Während das ahistorische Tier und das vorhistorische Kind den Verlust des Paradieses und damit jene melancholische Grundstimmung ins Spiel bringen, welche in der Genealogie als Sehnsucht nach der Wildnis beschrieben wird, wird mit dem Inder eine selbstironische Relativierung der eigenen Geschichtlichkeit erzeugt. Effekt dieses Vergleichs ist aber nicht nur die Produktion eines historischen Europas, das einem unhistorischen Indien gegenübergestellt wird. Dadurch, dass der Mensch am Anfang des Textes dem Tier als �›histo-risches�‹ Wesen gegenübertritt, wird der unhistorische Inder �– zumindest aus der Perspektive des Occidentalen, die der Text nach dem Exkurs zu den Indern wieder einnimmt �– aus dem Bereich des Menschlichen verwiesen.
Der Unterschied zwischen Mensch und Tier wird in der Genealogie an-ders bestimmt als in der Zweiten Unzeitgemässen Betrachtung; er wird nicht an �—�—�—�—�—�— 451 Ebd., S. 730
190 G R E N Z F I G U R E N
der Geschichtlichkeit, sondern an der Produktion von Werten festgemacht. Dieser Aspekt jedoch kommt in der Zweiten Unzeitgemässen Betrachtung be-reits performativ ins Spiel, indem der Mensch als ein Wesen erscheint, das sich kontinuierlich am Anderen �– dem Tier, dem Kind, dem Inder �– misst. In der Genealogie nun wird dieses Vermögen des Maßnehmens zum Zeichen des Menschlichen selbst. Der Mensch wird zum �›abschätzenden Tier�‹:
»Man hat noch keinen noch so niedren Grad von Civilisation aufgefunden, in dem nicht schon Etwas von diesem Verhältnisse bemerkbar würde. Preise machen, Werthe abmessen, Äquivalente ausdenken, tauschen �– das hat in einem solchen Maasse das allererste Denken des Menschen präoccupiert, dass es in einem gewis-sen Sinne das Denken ist: hier ist die älteste Art Scharfsinn herangezüchtet worden, hier möchte ebenfalls der erste Ansatz des menschlichen Stolzes, seines Vorrang-Gefühls in Hinsicht auf anderes Gethier zu vermuthen sein. Vielleicht drückt noch unser Wort �›Mensch�‹ (manas) gerade etwas von diesem Selbstgefühl aus: der Mensch bezeichnet sich als das Wesen, welches Werthe misst, werthet und misst, als das �›abschätzende Thier an sich�‹.«452
Die Grenze zwischen Mensch und Tier wird an dieser Stelle anders be-stimmt als zu Beginn der Zweiten Unzeitgemässen Betrachtung. Der Mensch er-kennt sich nicht nur in der Differenz zum Tier als Mensch. Er ist das Tier, das sich durch die Fähigkeit, diese Differenz zu setzen, von anderen Tieren unterscheidet. Was die Menschen �›noch so niedren Grads von Zivilisation�‹ zu teilen scheinen und was sie von anderen Tieren absetzt, ist, dass sie ab-schätzen, messen und abwägen. Die große Zäsur verläuft damit nicht zwischen Tier und Mensch, sondern zwischen zwei Arten von �›Getier�‹: zwischen dem Tier und dem abschätzenden Tier. Mit der Logik der Äqui-valenz, jener frühen Form des Scharfsinns, entwickelt sich aber nicht nur eine solche ökonomische Auffassung des Denkens, sondern auch ein An-satz des Vorranggefühls gegenüber �›anderem Getier�‹. Abschätzen heißt immer auch wertschätzen, hochschätzen, tiefschätzen, unterschätzen, überschätzen. Mit dem Vorgang des Schätzens geht die Hierarchisierung von Schätzendem und Geschätztem einher. Indem der Mensch zwischen sich und anderen Tieren einen Unterschied setzt, leitet er gleichzeitig sei-nen Vorrang daraus ab.
Damit ergibt sich auch eine neue Erzählung des Anfangs. Wenn das Tier, das abzuschätzen beginnt, zum Menschen wird, dann kann alles Menschliche auf diese Fähigkeit des Abschätzens, Messens und Verglei-chens zurückgeführt werden. So heißt es auch, dass man »keinen noch so �—�—�—�—�—�— 452 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 306
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 191
niedren Grad von Civilisation aufgefunden [hat], in dem nicht schon Etwas von diesem Verhältnisse bemerkbar würde«.453 Was für Differenzen ope-rieren aber in diesem Verständnis des Menschlichen? Wie ist, mit anderen Worten, das abschätzende Tier in diesem Satz selbst am Werk? Wer ist das �›man�‹, das Zivilisationen niederen Grades �›auffindet�‹ und darin Verhältnisse �›bemerkt�‹, die darauf verweisen, dass auch diese Menschen abschätzende Tiere sind, oder vielmehr, dass auch diese Tiere abschätzen und darum Menschen sind? Was für eine Differenz operiert zwischen den Menschen einer Zivilisation �›niederen Grades�‹ und denjenigen, die den Grad der Zivi-lisationen bestimmen? Und welche Bedeutung kommt der Differenz zwi-schen dem ökonomischen Denken der �›frühen�‹ Menschen und dem mora-lischen Denken der �›späten�‹ Menschen zu?
Die Grenze des Menschlichen bleibt aber beweglich und verschiebbar. So heißt es an anderer Stelle, dass der Mensch erst durch die Moral »über-haupt ein interessantes Thier geworden ist« und »erst hier die menschliche Seele in einem höheren Sinne Tiefe bekommen hat und böse geworden ist �– und das sind ja die beiden Grundformen der bisherigen Überlegenheit des Menschen über sonstiges Gethier!«454 Die Grenze des Menschlichen, die an dieser Stelle gezogen wird, trennt nicht den Menschen als abschätzendes Tier von anderen Tieren, sondern den Menschen als Tier mit einer tiefen und bösen Seele vom �›anderen Getier�‹. Auf dem Hintergrund der Genealogie lassen sich Tiefe und Bosheit aber nicht ohne die Moral denken. Was be-deutet diese Definition des Menschlichen nun für die �›frühen Menschen�‹ und diejenigen einer �›niederen Zivilisation�‹, die in einem vormoralischen Zu-stand leben? Wenn das Menschliche einerseits mit der Fähigkeit, zu messen und abzuschätzen, gleichgesetzt wird, an anderer Stelle aber mit der Tiefe und Bosheit der Seele, dann scheint die Grenze zwischen dem vormorali-schen und dem moralischen Menschen instabil zu sein. Jene Figuren, die als Menschen vor der Verinnerlichung des Willens auftreten, befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Menschlichen. Sie stehen einer-seits am Übergang vom Tier zum abschätzenden Tier, der einen Anfang des Menschen markiert. Sie repräsentieren andererseits auch die Grenze zwischen dem vormoralischen und dem moralischen Menschen. Mit dem Ressentiment, der Verinnerlichung und dem schlechten Gewissen beginnt erst jener Mensch, der zugleich böse und interessant ist, schwächlich und klug, krank und im Übergang zu einer neuen Gesundheit. Der Mensch vor �—�—�—�—�—�— 453 Ebd. 454 Ebd., S. 266
192 G R E N Z F I G U R E N
der Moral hingegen erscheint nur im Kontrast zu diesem �›interessanten Tier�‹, dem moralischen Menschen. Welche Funktion aber nimmt der vor-moralische Mensch ein im Versuch, die Diagnose des modernen Menschen zu erstellen?
Das Leiden der Moderne
Das schlechte Gewissen bringt nicht nur neue Möglichkeiten des Denkens und der Imagination hervor, die sich vom ökonomischen Denken der frühen Menschen unterscheiden. Die Moral initiiert auch neue Formen des Leidens, durch die sich der moderne Mensch vom Menschen vor der Moral unterscheidet, denn das schlechte Gewissen ist die »rückwärts gewendete[ ] Grausamkeit«.455 Indem der transitive Wille reflexiv wird, richtet sich seine Gewalt nicht mehr nur gegen Andere, sondern vor allem gegen sich selbst. Die Subjektformation wird zum gewaltsamen Verhältnis des Willens zu sich selbst; ein Verhältnis, durch das sich der Wille nun selbst Leiden zu-fügt. »Mit ihm [dem schlechten Gewissen] aber war die grösste und un-heimlichste Erkrankung eingeleitet, von welcher die Menschheit bis heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am Menschen, an sich.«456 Die Grausamkeit, die der Wille im schlechten Gewissen entwickelt, entsteht aber nicht erst im Zuge seiner Rückwendung. Sie ist seiner �›formbildenden und vergewaltigenden Natur�‹ vielmehr bereits eingeschrieben.457 Das Pa-thologische besteht, mit anderen Worten, nicht in der Existenz des Lei-dens, sondern darin, dass der moderne Mensch sich selbst leiden macht.
�—�—�—�—�—�— 455 Ebd., S. 389. Giorgio Colli erachtet das �›Leiden�‹ als einen Schlüssel zu Nietzsches Werk:
»Das Thema des Leidens zieht sich also wie ein roter Faden durch das Werk; es fällt vielleicht nicht sofort auf, in Wirklichkeit verbindet es jedoch die unterschiedlichen von Nietzsche hier behandelten Themen miteinander und erhellt den neuen Kurs seiner Ge-danken.« (Colli, »Nachwort«, S. 419)
456 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 323 457 Vgl. dazu folgende Stelle: »An sich von Recht und Unrecht reden entbehrt alles Sinns, an
sich kann natürlich ein Verletzen, Vergewaltigen, Ausbeuten, Vernichten nichts �›Un-rechtes�‹ sein, insofern das Leben essentiell, nämlich in seinen Grundfunktionen verlet-zend, vergewaltigend, ausbeutend, vernichtend fungiert und gar nicht gedacht werden kann ohne diesen Charakter.« (Ebd., S. 312)
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 193
Die Verschiebung dessen, wie Leben und Leiden verbunden sind, ver-sucht Nietzsche an einem Vergleich mit der vormoralischen Zeit aufzuzei-gen. Mit dem transitiven, nach außen gerichteten Willen war auch die Grausamkeit transitiv: Sie war die Grausamkeit, die Anderen angetan wurde, und darum nicht mit dem eigenen Leiden verknüpft, sondern mit der Lust, den Anderen Leid zuzufügen.
»Jetzt, wo das Leiden immer als erstes unter den Argumenten gegen das Dasein aufmarschieren muss [�…], thut man gut, sich der Zeiten zu erinnern, wo man umgekehrt urtheilte, weil man das Leiden-machen nicht entbehren mochte und in ihm einen Zauber ersten Rangs, einen eigentlichen Verführungs-Köder zum Leben sah.«458
Erst indem sich der Wille auf sich selbst zurückwendet, ruft er das Leiden, das er Anderen zugefügt hat, nun an sich selbst hervor. Dem nihilistischen Wunsch, diesem Zirkel von Gewalt zu entkommen, indem die Grausam-keit und das Leiden überwunden werden, liegt darum ein falsches Ver-ständnis des Willens zugrunde. Das Problem der Moderne besteht nicht darin, dass der Wille grausam ist oder dass er Leid zufügt, sondern viel-mehr darin, dass er seine Grausamkeit auf sich selbst richtet und sich selbst Leid zufügt. Mit der »Verzärtlichung und Vermoralisierung«459 des Men-schen verliert das Leiden aber nicht nur seine Bedeutung als �›Verführungs-köder zum Leben�‹, es wird gleichsam zum Anzeichen einer modernen Lebensmüdigkeit. Mit dem wachsenden Leiden des Menschen an sich selbst wird das Leiden, das sich vom Leben nicht trennen lässt, zum �›Ar-gument gegen das Dasein�‹. Nietzsche hält dieser spezifisch modernen Be-deutung des Leidens nun den Schmerz des vorgeschichtlichen Menschen entge-gen, den er in den �›Negern�‹ repräsentiert sieht:
»Vielleicht that damals �– den Zärtlingen zum Trost gesagt �– der Schmerz noch nicht so weh wie heute; wenigstens wird ein Arzt so schliessen dürfen, der Neger (diese als Repräsentanten des vorgeschichtlichen Menschen genommen �–) bei schweren inneren Entzündungsfällen behandelt hat, welche auch den bestorgani-sirten Europäer fast zur Verzweiflung bringen; �– bei Negern thun sie dies nicht. (Die Curve der menschlichen Schmerzfähigkeit scheint in der That ausserordent-lich und fast plötzlich zu sinken, sobald man erst die oberen Zehn-Tausend oder Zehn-Millionen der Übercultur hinter sich hat; und ich für meine Person zweifle nicht, dass gegen Eine schmerzhafte Nacht eines einzigen hysterischen Bildungs-Weibchens gehalten, die Leiden aller Thiere insgesammt, welche bis jetzt zum
�—�—�—�—�—�— 458 Ebd., S. 303 459 Ebd., S. 302
194 G R E N Z F I G U R E N
Zweck wissenschaftlicher Antworten mit dem Messer befragt worden sind, einfach nicht in Betracht kommen.)«460
Die �›Neger�‹ erscheinen in einer doppelten Differenz zum Europäer, als Andere nämlich, welche wiederum Andere repräsentieren. Sie sind kulturell Andere, die die historisch Anderen darstellen. Wie funktioniert diese Er-setzung? Die �›Neger�‹ werden, so Nietzsche, als �›Repräsentanten des vorge-schichtlichen Menschen genommen�‹. Wer �›nimmt�‹ an dieser Stelle, und was für eine Bewegung zeigt dieses �›Nehmen�‹ an? Warum repräsentieren die �›Neger�‹ den �›vorgeschichtlichen Menschen�‹? Wie kommt das Repräsentati-onsverhältnis zwischen dem vorgeschichtlichen Menschen im Singular und den �›Negern�‹ im Plural zustande? Kehrt damit die Differenz zwischen dem historischen Menschen und der unhistorischen Herde wieder? Bedeutet es, dass die �›Neger�‹ auf der Stufe des vorhistorischen Menschen verblieben und deshalb mit ihm vergleichbar sind? Oder können sie aufgrund von Ähnlichkeiten an die Stelle des vorgeschichtlichen Menschen treten? Wer legt diese Ähnlichkeiten fest? Von der Perspektive des Europäers aus, welche diese Passage zu organisieren scheint, ermöglichen die �›Neger�‹ eine Verbindung zur Vergangenheit. Obwohl sie Zeitgenossen sind, repräsen-tieren sie die Vorgeschichte �– jedenfalls wenn man sich die Mühe macht, sie dafür zu �›nehmen�‹. Eine komplizierte raum-zeitliche Verschränkung ist an dieser Stelle am Werk: Die geographisch-kulturelle Differenz zwischen den �›Negern�‹ und dem Europäer wird in eine historische Differenz über-setzt. Ein Art Zeitmaschine setzt sich in Betrieb: Mit Hilfe der �›Neger�‹ werden die europäischen Vorfahren �– oder zumal ihre Repräsentation �– in den Kontext der Moderne geholt. So können sie zum Arzt geschickt, un-tersucht und diagnostiziert werden. Neue Versuchsanordnungen werden möglich: Der vorgeschichtliche Europäer, dargestellt durch die �›Neger�‹, kommt mit demselben �›inneren Entzündungsanfall�‹ neben dem modernen Europäer auf ein Krankenbett zu liegen und kann mit ihm verglichen werden.
Der medizinische Schauplatz dieser Passage bringt die Metaphorik der Krankheit, welche sich durch die Genealogie zieht, erneut ins Spiel, allerdings mit einer entscheidenden Veränderung. Die kranken �›Neger�‹ rücken zwar in die Nähe zum modernen, �›kranken�‹ Subjekt. Während dieses aber auch an seiner Verinnerlichung durch das schlechte Gewissen leidet, werden den �›Negern�‹ lediglich �›schwere innere Entzündungsanfälle�‹ diagnostiziert. Ihre
�—�—�—�—�—�— 460 Ebd., S. 303
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 195
innere Erkrankung ist �– im Gegensatz zu derjenigen des Europäers �– eine rein körperliche. Dass die kranken �›Neger�‹ �– und mit ihnen der vorge-schichtliche Mensch �– an einem physischen Leiden nicht verzweifelt(e)(n) �– die Schwierigkeit der zeitlich-räumlichen Adäquation von �›Negern�‹, die gleichzeitig der vorgeschichtliche Europäer sind, schlägt sich grammatikalisch nieder �–, macht es möglich, den spezifischen Leidenszustand des europäi-schen modernen Menschen herauszustellen.
Folgen wir dieser Inszenierung: Wir befinden uns beim Arzt. Auf sei-nem Behandlungstisch liegen �›Neger�‹ und ein Europäer. Beide leiden an schweren inneren Entzündungen. Der Europäer, vielleicht sogar ein �›best-organisierter Europäer�‹, bringt dies zur Verzweiflung. Die Effekte kultu-reller Zucht und Disziplin schützen ihn nicht davor, am körperlichen Schmerz zu verzweifeln. Die �›Neger�‹ hingegen weisen gegenüber dem Schmerz eine Indifferenz auf, die nicht weiter beschrieben wird. Es wird nicht gesagt, was sie empfinden. Verzweiflung aber, das wird durch die typographische Sperrung des Wortes physisch sichtbar, empfinden sie �›n icht �‹ . Verzweiflung aber ist kein körperlicher Schmerz. Verzweiflung ist ein Effekt der Seele. Die �›Neger�‹ werden von der Bedeutung des Menschli-chen, die der Begriff der �›Verzweiflung�‹ an dieser Stelle einführt, ausge-klammert. Sie repräsentieren den leidenden vorgeschichtlichen Menschen als Körper im Schmerz. Genauer noch, die �›Neger�‹ im Plural repräsentieren eine ungewisse Anzahl von Körpern im Schmerz. Als solche stehen sie im scharfen Kontrast zum individuierten Europäer, dessen Schmerz in ein emotionales und intellektuelles Register übersetzt wird, das den �›Negern�‹ verschlossen bleibt.
Der historisierende und abschätzende Blick, den der Mensch auf das Tier richtet, wird in dieser Passage zum Blick des Arztes auf die vorge-schichtlichen �›Neger�‹. Allerdings wird die Autorschaft dieser Zeilen da-durch erschüttert, dass die Position des Arztes eigenartig unstabil ist: »we-nigstens wird ein Arzt so schliessen dürfen, der Neger [�…] behandelt hat«.461 An dieser Stelle wird nicht die Aussage eines Arztes präsentiert, sondern dem Arzt eine Aussage nahegelegt. Es ist von einem möglichen Arzt die Rede, der wahrscheinlich/vermutlich/ziemlich sicher auf jenes Ergebnis kommen könnte. Die Stimme des Autors und diejenige des Arz-tes überkreuzen sich an dieser Stelle auf eine Weise, die sowohl die Auto-rität des Arztes wie auch diejenige des Autors stört, indem der Autor dem
�—�—�—�—�—�— 461 Ebd.
196 G R E N Z F I G U R E N
Arzt suggeriert, was dieser diagnostizieren soll, damit sich der Autor auf die Autorität des Arztes berufen kann. Dass beide in eine verwirrende Nähe geraten, ist vielleicht nicht erstaunlich in einem Projekt, welches die Moral als Krankheit der Moderne ausweisen will und damit selbst ein dia-gnostisches Unterfangen darstellt. Nicht erstaunlich ist auch, dass die Ver-wirrung an der Stelle in den Text einbricht, wo der Arzt gleichzeitig als einer ausgewiesen wird, �›der Neger behandelt hat�‹, ein Moment, das den fiktiven Arzt, der Entzündungsanfälle behandelt, vom Philosophen unter-scheidet, der eine Diagnose der Moderne erstellt. Diese Destabilisierung wird aber buchstäblich gesperrt, wenn es danach apodiktisch heißt, dass die Schmerzen der Entzündungsanfälle den Europäer fast zur Verzweiflung bringen, »�– bei Negern thun sie dies nicht .«462 Der Blick des Arztes und des Genealogen fallen wieder zusammen: Die Übersetzungsarbeit zwischen den �›Negern�‹, dem vorgeschichtlichen Menschen und dem Europäer wird erneut gewährleistet.
Die �›Neger�‹ spezifizieren derart den modernen Europäer in dreifacher Weise: erstens als Gruppe, welche die Individualität des Europäers her-vortreten lässt. Zweitens lassen die �›Neger�‹ als Wesen, die gegenüber dem Schmerz indifferent sind, den Europäer in seiner Sensibilität erscheinen. Sie verweisen auf eine Leidensfähigkeit, die dem Europäer �– den �›Zärtlin-gen�‹, an die sich der Text wendet �– zusammen mit seiner Männlichkeit abhanden gekommen ist. Drittens ermöglichen sie es, dass sich die euro-päische Moderne von ihrer Vergangenheit gleichzeitig abhebt und sich mit ihr verbindet. Die �›Neger�‹ erscheinen als Grenzfiguren, welche die Dia-gnose des Europäers zu erstellen helfen, indem sie sowohl auf seine verlo-rene als auch auf seine wiederzugewinnende Gesundheit verweisen.463 Erst
�—�—�—�—�—�— 462 Ebd. 463 Sander L. Gilman geht in seiner Interpretation dieser Stelle davon aus, dass sich die
Repräsentation des vorgeschichtlichen Menschen durch die �›Neger�‹ und die Hysterikerin ironisch auf Hegels Vorstellungen von Afrika beziehen: »This spectrum, from the stoic Black to the tormented female, reverses Hegel�’s concept of history.« (Gilman, »The Fig-ure of the Black«, S. 154) Für diese Vorstellung einer �›guten�‹ nietzscheanischen Darstel-lung afrikanischer Menschen, die sich von einer �›schlechten�‹ hegelianischen absetzt, scheint allerdings wenig zu sprechen. Zwar erscheinen die �›Neger�‹ als positive Figuren, weil sie (noch) nicht durch die Zivilisation verweichlicht sind. Gleichzeitig bleiben sie aus dem Bereich der Moral ausgeschlossen, in dem der Mensch �›interessant�‹ und über-haupt erst Mensch wird. Wenn Gilman schreibt: »Unlike contemporary man, the Black bears suffering as suffering, without resorting to intellectual subterfuge such as trans-fering suffering to the realm of the aesthetic (�›tragisches Mitleid�‹) or the religious« (ebd., S. 155), dann übersieht er, dass Nietzsche sich genau, und im Grund genommen nur für
N I E T Z S C H E : G R E N Z F I G U R E N D E R S U B J E K T K R I T I K 197
in der Differenz zu ihnen kann sich die Sensibilität des Europäers als Ver-lust und als Verlust einer ihm ursprünglichen Stärke manifestieren. »Den Menschen nämlich zurückübersetzen in die Natur«464: Diese Übersetzungs-bewegung, so zeigt sich erneut, wird erst möglich durch eine andere Über-setzung, welche vorausgesetzt, aber nicht ausgewiesen wird. Denn Nietz-sches Diagnostik liegt die Annahme zugrunde, dass die �›Neger�‹ als Reprä-sentanten des vorgeschichtlichen Menschen und somit als Vorlage für die �›Rückübersetzung�‹ des schmerzempfindlichen Europäers verwendet wer-den können.
Wie Hegels Ausführungen zur Subjektkonstitution beruht Nietzsches Subjektkritik auf einem Spiel kultureller Differenzen, das die Fiktion des tropischen Anderen kontinuierlich in den Versuch einschreibt, das eigene Selbst zu bestimmen �– und es implizit als europäisches Selbst zu bestim-men. Während das afrikanische Bewusstsein für Hegel einen Abstoßungs-punkt darstellt, zu dem es keine Rückkehr gibt und von dem sich das eu-ropäische Subjekt immer nur entfernen muss, stellen die �›Neger�‹ bei Nietz-sche Grenzfiguren dar, die aufgesucht werden müssen. Sie ermöglichen die Perspektive auf eine andere Leiblichkeit, die der zivilisierte Mensch be-gehrt, die ihm aber abhanden gekommen ist und die er über die Nähe zu den Wilden wiederzugewinnen sucht. Anders als die Hysterikerin, die eine Grenze der Moderne darstellt, von der sich das Subjekt nur abwenden kann, stehen die �›Neger�‹ für eine verlorene Körperlichkeit, der dieses an der Moderne leidende und das Leiden der Moderne diagnostizierende Subjekt bedarf. Die Durchquerung der Alterität, welche die �›Neger�‹ reprä-sentieren, ermöglicht es dem modernen Subjekt, ein prä- und post-morali-sches Selbstverhältnis andenken zu können. Es sind die kulturell Anderen, welche diese Imagination eines anderen Selbst, das gleichzeitig ein neues und ein wiedergewonnenes Selbst ist, ermöglichen. Er will nicht �›Neger�‹ sein, dieser Kritiker der Moderne, sondern durch sie, die seine verlorene Vergangenheit denkbar machen, zu einem anderen Europäer werden.
�—�—�—�—�—�— diese intellektuellen und ästhetischen Aspekte des Menschen interessiert, diese aber mit einer selbstbejahenden Haltung zu vereinbaren sucht.
464 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, S. 169
Nachwort
Figuren der Alterität, dies war ein Ausgangspunkt meiner Arbeit, kursieren in den philosophischen Werken der Moderne �– und sie tun das auf eine für die Interpretation dieser Texte nicht vernachlässigbare Weise. Sie bestim-men und verorten die Grenzen desjenigen, was als Subjekt auftaucht, und ermöglichen auf diese Weise seine Stabilisierung, Geschlossenheit, Kon-gruenz, Selbsterkenntnis und Selbstkritik. Was in philosophischen Texten als vorgegeben und gewiss erscheint, wird demnach erst über die Differenz zu Anderen performativ hergestellt �– in einem Prozess, über den die Texte nicht oder nur am Rande Rechenschaft ablegen. Diese Annahmen, die meiner Lektüre zugrunde lagen, wurden im Verlaufe meiner Arbeit sowohl bestätigt als auch in Frage gestellt. Der Einsatz unterschiedlicher Grenz-figuren, das zeigen die dekonstruktiven Lektüren, ist konstitutiv für die Subjektformation. Zugleich aber erweist sich das Spiel von Identität und Differenz als prekär, unsicher und brüchig. Der Prozess der Subjektfor-mation erschöpft sich nicht im Gestus eines Subjekts, das sich selbst als Zentrum der Welt entwirft; es muss vielmehr als Prozess kontinuierlicher Stabilisierung und Destabilisierung gedeutet werden. Der scheinbar syste-matische Einsatz der �›Anderen�‹ birgt eine Unberechenbarkeit und Mehr-deutigkeit, die sich nicht stillstellen und niemals ganz kontrollieren lässt.
Die schwierige Justierung und Austarierung projektiver Bewegungen und differentieller Momente, welche die Texte dokumentieren, zeigen darum, dass moderne Konzeptionen des Subjekts nicht bloß als Ausdruck einer unproblematischen Selbstgewissheit entziffert werden können. Auch werden die Anderen dabei nicht nur in einem technischen Sinne zu Mitteln und Instrumenten der Selbstkonstitution. Ihre Verfügbarkeit kommt viel-mehr beständig an Grenzen, weniger darum, weil es die Grenzen der An-deren sind, sondern weil das Subjekt durch die Anderen kontinuierlich an seine eigenen imaginären Grenzen, an die Grenzen der Imagination stößt. An diesen Stellen zeigt sich der hohe Einsatz dieses Spiels: Die Figuren der
200 G R E N Z F I G U R E N
Alterität sind, wenn sie zur Herausbildung der eigenen Identität unabding-bar sind, auch als Verworfene und als Grenzfiguren Teil der Subjektfor-mation. Es gibt, mit anderen Worten, affektive Bezüge zwischen dem Subjekt und diesen Spiegel- und Gegenbildern. Denn wenn die Anderen die ausgelagerten, die verdrängten, die nur partiell erlaubten und negierten, aber auch die begehrten und ersehnten Aspekte des Subjekts darstellen, benötigt das Subjekt diese Anderen in einem grundlegenden und existenti-ellen Sinne. Wenn es dadurch entsteht, dass es seine Grenzen mit Hilfe dieser Anderen markiert, dann ist es auf eine Weise mit diesen Anderen verbunden, die seine Macht über sie begründet, aber nicht allein in Begrif-fen der Verfügbarkeit zu verstehen ist. Das kontinuierliche Zurechtrücken der Distanzen zwischen dem Selbst und den Anderen, das diese Texte dokumentieren, lässt sich nicht nur als Ausdruck von Herrschaft und Macht lesen, sondern auch als Zeichen der kontinuierlichen Anstrengung, diese herzustellen und aufrechtzuerhalten �– und der beständigen Gefahr, sie zu verlieren.
Für eine solche Reflexion über moderne Subjekttheorien stellen Hegel und Nietzsche bedeutsame Ausgangspunkte dar, weil sie auf der Oberflä-che eine Gegensätzlichkeit aufweisen, die einem zweiten Blick nicht stand-hält. Was in Hegels systematischer Beschreibung als das Außen, die Ränder und die Grenzen des Menschlichen erscheint, wird bei Nietzsche zu den Grenzen, die den Menschen in seinem Inneren durchziehen. Geht es bei Hegel darum, den Bereich des Menschlichen in seiner Differenz zu wech-selnden Figuren des Nicht-Menschlichen oder Vor-Menschlichen zu kon-stituieren, erweist sich gerade die Auflösung der Grenze zwischen Mensch und Tier, zwischen Wildem und Zivilisiertem als Strategie von Nietzsches Analyse. Als radikaler Gesellschaftskritiker zieht Nietzsche die Geschlech-ter- und Kulturgrenzen nicht nur entlang der Linien, die gesellschaftlich vorgegeben sind. Vielmehr ermöglicht ihm der partiell gegenläufige Einsatz dieser Figuren der Alterität, ein Subjekt zu denken, das sowohl die Selbst-affirmation der Wildheit als auch die durch die Kultur hervorgebrachte ästhetische Lebensform in sich vereint.
Entscheidend ist indessen, dass sich sowohl Nietzsche als auch Hegel auf ein Imaginäres beziehen, welches das Außen, die Grenze, die Krise, den Einbruch und das Andere der Kultur durch Figuren der Alterität dar-stellt. In Nietzsches affirmativer Bezugnahme auf Andere, welche implizite Abgrenzungen von ihnen beinhaltet, werden diese ebenso funktionalisiert wie in den Denkbewegungen Hegels, die sich von den Anderen abstoßen
N A C H W O R T 201
und gerade dadurch mit ihnen verbunden bleiben. Grenzfiguren formieren demnach ein bewegliches Bedeutungsnetz, in dem sich Subjektvorstellun-gen sowohl herausbilden und etablieren als auch wieder auflösen und transformieren. Sie markieren dabei nicht nur die Ränder des Subjekts, sie stecken auch das Feld desjenigen ab, was denkbar ist. Und sie werden eingesetzt, um dieses Feld zu erweitern, zu verschieben, aufzubrechen und umzuformen. In ihrer Positionierung am Rande des Denkbaren sind sie bereits Bestandteil der Wissensordnung, als deren Grenze und Außen sie erscheinen.
Moderne Subjektkonzepte sind deshalb auf entscheidende Weise mit problematischen Vorstellungen von Anderen verwickelt und von ihnen nicht abzulösen. Die postkoloniale Frage nach Europa zu holen, die femi-nistische Perspektive auf die Männlichkeit zu richten, die queere Theorie auf die Frage der Heteronormativität anzuwenden, heißt verstehen zu wollen, auf welche Weise die Herstellung hegemonialer Identitäten mit sol-chen hierarchisierten Differenzen verbunden ist. Wenn wir von der Bedeu-tung des Anderen für das Subjekt ausgehen und zu verstehen versuchen, inwiefern dieses erst durch problematische Figuren der Alterität möglich �– und das heißt unter anderem: denkbar �– wird, verschiebt sich auch die Per-spektive auf das Subjekt. Es zeichnet sich eine neue, eine andere Erzählung desjenigen Subjekts ab, das manchmal vorschnell als Meistersubjekt, als au-tonomes, herrschaftliches Subjekt beschrieben worden ist.
Die Vorstellung der Autonomie, der Selbstgenese, der Handlungsfähig-keit gehört mit zur modernen Konzeption des Subjekts, aber feministische, queere, postkoloniale KritikerInnen laufen Gefahr, dieser Fiktion aufzusit-zen, wenn sie nicht untersuchen, durch welche Abhängigkeiten das Kon-zept der Unabhängigkeit und durch welche Ungewissheiten die Idee der Selbstgewissheit möglich gemacht werden. Philosophische �›Meistertexte�‹ haben, so ein Fazit meiner Lektüre, über diese Aspekte mehr zu sagen, als es den Anschein machen könnte. Sie eröffnen bei genauerem Hinsehen, wie brüchig und fragmentiert das Selbstverständnis dieser Subjekte ist, auch wenn, und gerade dort, wo es sich als Herrschaftssubjekt konstituiert. Dies festzustellen bedeutet nicht, dass die Analyse von Macht und Herr-schaft einem Verständnis von Alterität weichen muss, das für alle Subjekte gleichermaßen und ohne Unterschiede gilt. Es geht im Gegenteil darum, Macht und Herrschaft auf eine Weise zu denken, in der das hegemoniale Subjekt nicht eine Leerstelle bleibt, sondern ein kontinuierlich produzier-tes, anfälliges Selbstbild darstellt, das von der Herrschaftslogik, die es ent-
202 G R E N Z F I G U R E N
wickelt und repräsentiert, nicht nur affiziert ist, sondern durch sie zugleich �– und auf eine Weise, die erst noch zu verstehen ist �– hervorgebracht wird.
Literatur
Agamben, Giorgio, Das Offene. Der Mensch und das Tier, Frankfurt a. M. 2002. Arendt, Hannah, Vita Activa oder Vom tätigen Leben, München 1992. �— Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 1995. Aristoteles, »Über die Zeugung der Geschöpfe«, in: ders., Die Lehrschriften, hrsg.
von Paul Gohlke, Paderborn 1952. Behler, Ernst, Derrida�–Nietzsche. Nietzsche�–Derrida, München 1988. Benhabib, Seyla, »On Hegel, Woman and Irony«, in: Jagentowicz Mills, Patricia
(Hg.), Feminist Interpretations of G. W. F. Hegel, University Park 1996, S. 25�–43. Bhabha, Homi, Die Verortung der Kultur, Tübingen 2000. Bronfen, Elisabeth, The Knotted Subject. Hysteria and its Discontents, Princeton 1998. Brusotti, Marco, »Wille zum Nichts, Ressentiment, Hypnose. �›Aktiv�‹ und �›reaktiv�‹
in Nietzsches Genealogie der Moral«, in: Nietzsche-Studien 30/2001, S. 107�–132. Buck-Morss, Susan, »Hegel and Haiti«, in: Critiqual Inquiry 26/2000, S. 821�–865. Butler, Judith, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M. 1991. �— »Kontingente Grundlagen: Der Feminismus und die Frage der �›Postmoderne�‹«,
in: Benhabib, Seyla u. a., Der Streit um Differenz. Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart, Frankfurt a. M. 1994, S. 31�–58.
�— Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Berlin 1995. �— Subjects of Desire: Hegelian Reflections in the Twentieth-Century France, New York
1999. �— Antigones Verlangen: Verwandtschaft zwischen Leben und Tod, Frankfurt a. M. 2001. �— Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt a. M. 2001. �— »Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend«, in: Deutsche Zeitschrift für
Philosophie 2/2002, S. 249�–265. �— »Imitation und die Aufsässigkeit der Geschlechtsidentität«, in: Kraß, Andreas
(Hg.), Queer Denken, Frankfurt a. M. 2003, S. 144�–168. Castro Varela, María do Mar/Dhawan, Nikita, »Postkolonialer Feminismus und die
Kunst der Selbstkritik«, in: Steyerl, Hito/Gutiérrez Rodríguez, Encarnación, Spricht die Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Theorie, Münster 2003, S. 270�–290.
Colli, Giorgio, »Nachwort« [zu Jenseits von Gut und Böse und Zur Genealogie der Moral ], in: Nietzsche, Friedrich, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. von
204 G R E N Z F I G U R E N
Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 5, München/Berlin/New York 1999, S. 413�–421.
Conrad, Sebastian/Randeria, Shalini, »Einleitung. Geteilte Geschichten �– Europa in einer postkolonialen Welt«, in: dies., Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften, Frankfurt a. M./New York 2002, S. 9�–49.
Deleuze, Gilles, Nietzsche und die Philosophie, Hamburg 2002. Derrida, Jacques, Glas, Paris 1974. �— »Signatur, Ereignis, Kontext«, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien 1988,
S. 325�–351. �— »Sporen. Die Stile Nietzsches«, in: Hamacher, Werner (Hg.), Nietzsche aus
Frankreich, Frankfurt a. M./Berlin 1986, S. 129�–168. Diethe, Carol, Nietzsche�’s Women: Beyond the Whip, Berlin/New York 1996. Du Bois, W. E. B., The Souls of Black Folks, New York 2003. Elman, Benjamin A., »Nietzsche and Buddhism«, in: Journal of the History of Ideas
44/1983, S. 671�–686. Engel, Antke, Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlecht im Fokus queerer Politik
der Repräsentation, Frankfurt a. M./New York 2002. Fink-Eitel, Hinrich, Die Philosophie und die Wilden. Über die Bedeutung des Fremden für
die deutsche Geistesgeschichte, Hamburg 1994. Foucault, Michel, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1979. �— »Nietzsche, die Genealogie, die Historie«, in: ders., Von der Subversion des Wis-
sens, Frankfurt a. M. 1987, S. 69�–90. Freud, Sigmund, »Das Unheimliche«, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. XII, Frank-
furt a. M. 1999, S. 227�–268. Freud, Sigmund, »Trauer und Melancholie«, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. X,
Frankfurt a. M. 1999, S. 427�–446. Gilman, Sander L., »The Figure of the Black in the Thought of Hegel and
Nietzsche«, in: The German Quarterly 2/1980, S. 141�–158. �— »Heine, Nietzsche and the Idea of the Jew«, in: Colomb, Jacob (Hg.), Nietzsche
and Jewish Culture, New York 1997, S. 76�–100. Groddeck, Wolfram, Friedrich Nietzsche �›Dionysos-Dithyramben�‹. Bedeutung und Ent-
stehung von Nietzsches letztem Werk, 2 Bde., Berlin/New York 1991. Guha, Ranajit, History and the Limit of World-History, New York 2002. Günzel, Stephan, »Nietzsches Schreiben als kritische Geographie«, in: Nietzsche-
forschung Bd. 5/6/2000, S. 227�–244. Gutiérrez Rodríguez, Encarnación, »Fallstricke des Feminismus. Das Denken �›kri-
tischer Differenzen�‹ ohne geopolitische Kontextualisierung«, in: polylog. Zeit-schrift für interkulturelles Philosophieren 4/1999, S. 13�–24.
Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M. 1985. Han, Byung-Chul, »Hegel und die Fremden«, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie
29.3/2004, S. 215�–223. �— Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung, Berlin 2005.
L I T E R A T U R 205
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dritter Teil: Die Philosophie des Geistes, in: ders., Werke, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 10, Frankfurt a. M. 1970.
�— Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: ders., Werke, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Bd. 12, Frankfurt a. M. 1970.
�— Phänomenologie des Geistes, in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 9, hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede, Hamburg 1980.
�— Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), in: ders., Gesammelte Werke, Bd. 20, hrsg. von Wolfgang Bonsiepen und Hans-Christian Lucas, Hamburg 1992.
�— Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. von Johannes Hoffmeister, Hamburg 1995.
Heller, Edmund, »Diesseits und Jenseits von Gut und Böse. Zu Nietzsches Moral-kritik«, in: Nietzsche-Studien 21/1992, S. 10�–27.
Honegger, Claudia, Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Menschen und das Weib, Frankfurt a. M./New York 1991.
Honneth, Axel, Leiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechts-philosophie, Stuttgart 2001.
Hsia, Adrian/Cheung, Chieu-yee, »Nietzsche�’s Reception of Chinese Culture«, in: Nietzsche-Studien 32/2003, S. 296�–312.
Irigaray, Luce, Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts, Frankfurt a. M. 1980. �— »Das Geschlecht, das nicht eins ist«, in: dies., Das Geschlecht, das nicht eins ist,
Berlin 1979, S. 22�–32. �— »Macht des Diskurses. Unterordnung des Weiblichen. Ein Gespräch«, in: dies.,
Das Geschlecht, das nicht eins ist, Berlin 1979, S. 70�–88. �— »Fragen«, in: dies., Das Geschlecht, das nicht eins ist, Berlin 1979, S. 125�–176. �— »L�’universel comme médiation«, in: dies., Sexes et Parentés, Paris 1987, S. 139�–
164. Kimmerle, Gerd, Die Aporie der Wahrheit. Anmerkungen zu Nietzsches �›Genealogie der
Moral�‹, Tübingen 1983. Kimmerle, Heinz, Die Dimension des Interkulturellen. Philosophie in Afrika �– Afrikanische
Philosophie. Zweiter Teil: Supplemente und Verallgemeinerungsschritte, Amsterdam 1994.
Klinger, Cornelia, »Zwei Schritte vorwärts, einer zurück �– und ein vierter darüber hinaus. Die Etappen feministischer Auseinandersetzung in der Philosophie«, in: Die Philosophin 12/1995, S. 81�–97.
Knodt, Eva M., »The Janus Face of Decadence: Nietzsche�’s Genealogy and the Rhetoric of Anti-Semitism«, in: The German Quarterly 22/1993, S. 160�–175.
Koebner, Thomas, »Geheimnisse der Wildnis. Zivilisationskritik und Naturexotik im Abenteuerroman«, in: ders./Pickerodt, Gerhart (Hg.), Die andere Welt. Stu-dien zum Exotismus, Frankfurt a. M. 1987, S. 240�–266.
Kofman, Sarah, Nietzsche et la scène philosophique, Paris 1986.
206 G R E N Z F I G U R E N
Kuydendall, Ronald, »Hegel and Africa: An Evaluation of the Treatment of Africa in The Philosophy of History«, in: Journal of Black Studies, 23/1993, S. 571�–581.
Laqueur, Thomas, Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis zu Freud, Frankfurt a. M. 1992.
Long, Thomas A., »Nietzsche�’s Philosophy of Medicine«, in: Nietzsche-Studien 19/ 1990, S. 112�–128.
Lonzi, Carla, »Let�’s Spit on Hegel«, in: Jagentowicz Mills, Patricia (Hg.), Feminist Interpretations of G. W. F. Hegel, University Park 1996, S. 275�–297.
Löwith, Karl, Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts, Zürich/Wien 1941.
Maihofer, Andrea, Geschlecht als Existenzweise, Frankfurt 1995. �— »Dialektik der Aufklärung �– Die Entstehung der modernen Gleichheitsidee,
des Diskurses der qualitativen Geschlechterdifferenz und der Rassentheorien im 18. Jahrhundert«, in: Hobuß, Steffi u. a. (Hg.), Die andere Hälfte der Globa-lisierung. Menschenrechte, Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt a. M./New York 2001, S. 113�–132.
Man, Paul de, Allegories of Reading, New Haven/London 1979. Mbembe, Achille, On the Postcolony, Berkeley 2001. McClintock, Anne, Impertial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest,
New York/London 1995. Meyer, Katrin, Ästhetik der Historie. Friedrich Nietzsches �›Vom Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben�‹, Würzburg 1998. Moore, Gregory, »Hysteria and Histronics: Nietzsche, Wagner and the Pathology
of Genius«, in: Nietzsche-Studien 30/2001, S. 246�–266. Mudimbe, Valentin Y., The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of Knowl-
edge, Bloomington Indianapolis/London 1988. Müller-Lauter, Wolfgang, Über Werden und Wille zur Macht. Nietzsche-Interpretationen I,
Berlin/New York 1999. Nagl-Docekal, Herta, Feministische Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven, Frank-
furt a. M. 1999. Nancy, Jean-Luc, Hegel: L�’inquiétude du Négatif, Paris 1997. Nietzsche, Friedrich, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und
Nachtheil der Historie für das Leben, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studien-ausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 1, München/ Berlin/New York 1999.
�— Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 1, München/Berlin/New York 1999.
�— Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister. Erster Band, in: ders., Sämt-liche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Monti-nari, Bd. 2, München/Berlin/New York 1999.
L I T E R A T U R 207
�— Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 3, München/Berlin/New York 1999.
�— Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 5, München/Berlin/New York 1999.
�— Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studi-enausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 5, München/ Berlin/New York 1999.
�— Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studi-enausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 6, München/ Berlin/New York 1999.
�— Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studi-enausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 6, München/ Berlin/New York 1999.
�— Ecce homo. Wie man wird, was man ist, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studien-ausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 6, München/ Berlin/New York 1999.
�— Nachgelassene Fragmente 1869�–1874, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studien-ausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 7, München/ Berlin/New York 1999.
�— Nachgelassene Fragmente 1885�–1887, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studien-ausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 12, München/ Berlin/New York 1999.
�— Nachgelassene Fragmente 1887�–1889, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studien-ausgabe, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 13, München/ Berlin/New York 1999.
Oliver, Kelly, »Nietzsche�’s Abjection«, in: Burgard, Peter J. (Hg.), Nietzsche and the Feminine, Charlottesville 1994, S. 53�–67.
�— »Woman as Truth in Nietzsche�’s Writing«, in: dies./Pearsall, Marilyn (Hg.), Feminist Interpretations of Friedrich Nietzsche, University Park 1998, S. 66�–80.
Picart, Caroline Joan S., Resentment and the �›Feminine�‹ in Nietzsche�’s Politico-Aesthetics, University Park 1999.
Pieper, Annemarie, »Ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch«. Philosophische Er-läuterungen zu Nietzsches erstem �›Zarathustra�‹, Stuttgart 1990.
�— Aufstand des stillgelegten Geschlechts. Einführung in die feministische Ethik, Freiburg i.Br. 1993.
�— »Vorrede«, in: Höffe, Otfried (Hg.), Klassiker Auslegen. Zur Genealogie der Moral, Berlin 2004, S. 15�–29.
Pietz, William, »The Problem of the Fetish I«, in: Res 9/1985, S. 5�–17. �— »The Problem of the Fetish II. The Origin of the Fetish«, in: Res 13/1987,
S. 23�–45.
208 G R E N Z F I G U R E N
�— »The Problem of the Fetish IIIa. Bosman�’s Guinea and the Enlightenment Theory of Fetishism«, in: Res 16/1988, S. 105�–123.
�— »Fetishism and Materialism: The Limits of Theory in Marx«, in: Apter, Emily/ Pietz, William (Hg.), Fetishism as Cultural Discourse, Ithaca/London 1993, S. 119�–151.
Pöggeler, Otto, »Die Komposition der Phänomenologie des Geistes«, in: Fulda, Hans Friedrich/Henrich, Dieter (Hg.), Materialien zu Hegels »Phänomenologie des Geistes«, Frankfurt a. M. 1998, S. 329�–390.
Poliakov, Léon/Delacampagne, Christian/Girard, Patrick, Rassismus. Über Fremden-feindlichkeit und Rassenwahn, Hamburg/Zürich 1992.
Sarasin, Philipp, »Zweierlei Rassismus? Die Selektion des Fremden als Problem in Michel Foucaults Verbindung von Biopolitik und Rassismus«, in: Stingelin, Martin (Hg.), Biopolitik und Rassismus, Frankfurt a. M. 2003, S. 55�–79.
Sedgwick, Eve Kosofsky, Epistemology of the Closet, Berkeley/Los Angeles 1990. Siep, Ludwig, Der Weg der �›Phänomenologie des Geistes�‹. Ein einführender Kommentar zu
Hegels �›Differenzschrift�‹ und zur �›Phänomenologie des Geistes�‹, Frankfurt a. M. 2000. Simonis, Linda, »Der Stil als Verführer. Nietzsche und die Sprache des Performa-
tiven«, in: Nietzsche-Studien 31/2002, S. 57�–74. Smitmans-Vajda, Barbara, Melancholie, Eros, Muße. Das Frauenbild in Nietzsches Philo-
sophie, Würzburg 1999. Spivak, Gayatri Chakravorty, »Displacement and the Discourse of Woman«, in:
Krupnick, Mark (Hg.), Displacement. Derrida and After, Bloomington 1983, S. 169�–195.
�— »Achtung: Postkolonialismus!«, in: Weibel, Peter/Zizek, Slavoj (Hg.), Probleme des Postkolonialismus und der globalen Migration, Wien 1997, S. 117�–130.
�— A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present, Cam-bridge MA/London 1999.
Stegmaier, Werner, »Hegel, Nietzsche und Heraklit. Zur Methodenreflexion des Hegel-Nietzsche-Problems«, in: Djuric, Mihailo/Simon, Josef (Hg.), Nietzsche und Hegel, Würzburg 1992, S. 110�–129.
�— Nietzsches �›Genealogie der Moral�‹, Darmstadt 1994. Stevens, Jacqueline, »On the Genealogy of Morals«, in: Political Theory 31/2003,
S. 558�–588. Thüring, Hubert, »Form und Unform, Wert und Unwert des Lebens bei Nietz-
sche«, in: Stingelin, Martin (Hg.), Biopolitik und Rassismus, Frankfurt a. M. 2003, S. 27�–54.
Ward, Janet, »Nietzsche�’s Transvaluation of Jewish Parasitism«, in: The Journal of Nietzsche Studies 24/2004, S. 54�–82.
Weigel, Sigrid, »Die nahe Fremde �– das Territorium des �›Weiblichen�‹. Zum Ver-hältnis von �›Wilden�‹ und �›Frauen�‹ im Diskurs der Aufklärung«, in: Koebner, Thomas/Pickerodt, Gerhart (Hg.), Die andere Welt. Studien zum Exotismus, Frankfurt a. M. 1987, S. 171�–200.
L I T E R A T U R 209
Young, Iris Marion, »Anerkennung von Liebesmühe. Zu Axel Honneths Feminis-mus«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 3/2005, S. 415�–435.
Yovel, Yirmiyahu, »Nietzsche and the Jews«, in: Colomb, Jacob (Hg.), Nietzsche and Jewish Culture, New York 1997, S. 117�–134.
Zamir, Shamoon, Dark Voices. W. E. B. Du Bois and American Thought, Chicago 1995.




















































































































































































































![Hegel y la identidad como proceso [Hegel and identity as a process]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d52c8d5372c006e04dff1/hegel-y-la-identidad-como-proceso-hegel-and-identity-as-a-process.jpg)