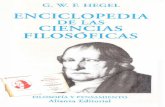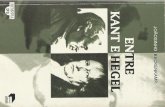Exzessive Subjektivität. Eine Theorie tathafter Neubegründung des Ethischen nach Kant, Hegel und...
Transcript of Exzessive Subjektivität. Eine Theorie tathafter Neubegründung des Ethischen nach Kant, Hegel und...
Dominik Finkelde
Exzessive Subjektivität.
Eine Theorie tathafter Neubegründung des Ethischen nach Kant, Hegel und Lacan
»Der heute vorherrschende Begriff von Subjekti-vität beruht auf dem Habermas’schen Projekt gegenseitiger Anerkennung von frei und verant-wortlich handelnden Akteuren. Was diesem Pro-jekt entgeht, ist das antagonistische Herzstück von Subjektivität: die traumatische Verstörung, die in den Begriff des Subjekts selbst - von Kant bis Hegel - eingeschrieben ist. Mit Bezug auf Lacan erinnert uns Finkelde kraftvoll an diese vernachlässigte Dimension: die wahre Bedeu-tung von exzessiver Subjektivität liegt darin, dass Subjektivität als solche exzessiv ist. Das Buch »Exzessive Subjektivität« ist nicht bloß ein wich-tiger Beitrag zur Subjektphilosophie, es ist viel mehr: es bestimmt das Themenfeld gänzlich neu. Kurz gesagt, es ist bereits jetzt ein Klassiker.«
Slavoj Žižek Abstract Wie lassen sich ethisch motivierte Taten denken, die sich auf keine gegebenen sittlichen Vorstellungen und keine Legalität stützen können? Das heißt: Taten, welche – umgekehrt – die gegebenen normativen Ordnungen radikal in Frage stellen, dennoch aber nicht einfach als eigennützige Verletzung oder willkürliche Übertretung der herrschenden Normativität zu qualifizieren sind? Taten, die das bislang verborgene, unbemerkt gebliebene und still-schweigend tolerierte Unrecht der gegebenen normativen Ordnung plötzlich sichtbar wer-den lassen?
Was der Titel des Buches als „exzessive Subjektivität“ benennt, zielt auf genau sol-che historisch so seltenen wie fundamentalen (nämlich gründenden) ethischen Ereignisse. Damit sind Akte radikalen Neubeginns gemeint, die erst durch ihr Ereignis-gewesen-Sein den Raum ihrer Verwirklichung eröffnen, ohne klar legitimierbare externe Motivation, inter-ne Neigung oder soziale Beglaubigung. Die Rede von ‚exzessiver Subjektivität‘ wird dabei als ein Strukturmoment verstanden, aber nicht in der Verwirklichung dessen, was Ethik als philosophische Disziplin erklärbarer und rechtfertigbarer Handlungen vorzuschreiben ver-sucht, sondern als Verwirklichung ‚des Ethischen‘, das sich im Sinne eines Kontextbruches mit der Sittlichkeit als Ineinssetzung von Partikulärem und Allgemeinem erst nachträglich (be)gründet. Mit der vorliegenden Studie zur exzessiven Subjektivität geht es darum, jenen extrem riskanten ethischen Gründungstaten gerecht zu werden, die imstande sind, und zwar außerhalb jeder historisch gegebenen und legitimatorisch abgesicherten normativen Ordnung, eine neue ethische Normativität zu gründen. Erst im Nachhinein, also dann, wenn sie moralische Evidenz und Exemplarität erlangt haben, lassen sie sich – gleichsam unter Rekurs auf sich selbst – begründen.
!
! 2!
Als historische Beispiele solcher riskanten und sogar normative Schwindelgefühle erregenden Taten, die das handelnde Subjekt ohne jede Begründungsmöglichkeit und ver-lässlichen moralischen Halt zurücklassen, nennt die Studie: Antigone, Sokrates, nicht zu-letzt aber auch Rosa L. Parks, die sich am 1. November 1955 in Montgomery, Alabama, weigerte, einen Platz in einem für Weiße reservierten Busabteil freizugeben, wie es die all-gemein akzeptierten Regeln für Rassentrennung in Alabama bislang vorgeschrieben hat-ten. Erst der abrupte Durchbruch einer Praxis durch Rosa Parks’ Handlungstat zeigte nachträglich die Amoralität derselben, während viele vor diesem Durchbruch die morali-sche Verfehlung derselben segregationistischen Praxis nicht unmittelbar als kognitiv be-drängend wahrnehmen konnten.
Das ethik- und politiktheoretische Erkenntnisinteresse der Studie zur exzessiven Subjektivi-tät – als einer fundamentalen Struktur ethischen Handelns – steht somit im Vordergrund. Es geht nicht um eine abstrakte, pyramidale Ethiktheorie (im Stile John Rawls etwa), mit der sich aus universal und apriorisch angesetzten Prinzipien eine Reihe normativer Hand-lungsregeln deduzieren ließen; umgekehrt geht es aber auch nicht um einen kulturalistisch normativen Relativismus, der die unterschiedlichen herrschenden normativen Ordnungen einfach gleichgültig hinnehmen und sie aufgrund ihrer sittlichen Faktizität rechtfertigen möchte. Die Theorie exzessiver Subjektivität ist konzeptuell stattdessen an der Schnittstel-le zwischen einem abstrakten, a-historischen Universalismus einerseits und einem kultura-listischen Relativismus des Sittlichen andererseits angesiedelt. Der Begriff zielt auf genau jenen Punkt, wo ‚das Ethische‘ sich im Sinn eines Kontextbruches mit der Sittlichkeit als Ineinssetzung von Partikulärem und Allgemeinem (be)gründet, das heißt, wo herrschende Ordnungen im Namen eines – bislang noch nicht in Erscheinung getretenen – Universalen radikal in Frage gestellt und neu begründet werden. Das zentrale Anliegen des Buches be-steht darin, diesen riskanten (exzessiven, stets von Scheitern bedrohten, dennoch unum-gänglichen) Moment der „tathaften Neubegründung“ als zentrales Strukturmoment des Ethischen selbst herauszuarbeiten, und zwar des ‚modernen‘ Ethischen, das Kants koper-nikanische Wendung bereits vollzogen hat. Es kann nicht mehr von einem apriorisch ange-setzten, bekannten Guten ausgehen, das es zu realisieren gilt, sondern muss sich selbst vernünftig legitimieren in Bezug auf Handlungsnormen, die ‚formal‘ begründet werden müssen, nämlich bezüglich der Form des universalen Gesetzes, dessen Inhalt nicht im Vorhinein gegeben ist und das entsprechend leer oder unbestimmt bleibt.
Die Studie arbeitet die Struktur exzessiver Subjektivität – in der es um einen Ver-such der Gründungs- und Begründungsfigur moderner Ethik geht – in drei Kapiteln zu Kant, Hegel und Lacan heraus. Das Kant-Kapitel verdeutlicht die unversöhnte, aporetische Struktur des Ethischen einsichtig, wie es Kant in seinen Grundlegungsschriften (Grundle-gung der Metaphysik der Sitten, Kritik der praktischen Vernunft) entwickelt, nämlich die Unmöglichkeit, je schon moralisch handeln zu können. Anders gesagt, moralisches Han-deln lässt sich nicht am Leitfaden gegebener normativer Regeln verwirklichen, es setzt vielmehr die ständige Unruhe der Infragestellung des (bedingten) Partikularen im Hinblick auf seine (unbedingte) Universalisierbarkeit voraus. Kants Ethik ist als eine Art ‚negativer Ethik‘ zu lesen, als Bestimmung eines Nicht-Ortes, der den Einzelnen weder zum Relati-vismus noch zum Formalismus drängt, sondern in einer durch seine eigene Subjektivität zu verantwortende Macht einsetzt, mit der von Kant hartnäckig thematisierten Gespaltenheit umzugehen. Sie ist Ort eines nicht ableitbaren Exzesses, in dem sich die Freiheit des Sub-jekts manifestiert.
!
! 3!
Das Hegel-Kapitel gilt sodann dem Nachweis, dass Hegels Rechts- und Ge-schichtsphilosophie das Moment exzessiver Subjektivität, wie es bereits für Kant tragend geworden war, keineswegs ‚aufhebt‘ (und zum Verschwinden bringt) – etwa in eine Figur totalitärer, staatlicher Vernunft –, sondern dass Hegel das individualmoralische Theorem der Kant’schen Gesinnungsrevolution zu einer Gesinnungsrevolution für den Bereich des Politischen aufgreift, mit dem Ziel einer theoretischen Durchdringung gesellschaftlich-struktureller und nicht mehr individualmoralischer Gespaltenheit. Hegel legt offen, inwiefern die symbolischen Ordnungen, die sich im Verlauf von Jahrhunderten als sozio- kulturelle Ausgestaltungen menschlicher Geschichte ablösen, an zentralen Punkten durch wider-ständige politische Akteure in eine neue Gestalt gezwungen werden.
Die zentralen historischen Beispiele solchen Widerstands bilden Antigone und Sok-rates. Exzessive Subjektivität, wie Hegel sie am Beispiel von Antigone und Sokrates vor-stellt, artikuliert eine Leerstelle im politischen Signifikationssystem politischer Differenziali-tät. Diese Differenzialität ist von einem radikalen Außen herausgefordert, wenn die eigenen Grenzen in einer durch ein Subjekt als ‚konkretes Allgemeines’ ausgelösten politischen Kri-se erschüttert werden.
Das abschließende Kapitel der Studie zeichnet das Werk Jacques Lacans in die idealistische Tradition Kants und Hegels ein. Dabei wird deutlich, wie in Lacans Philoso-phie der Psychoanalyse und ihrer begrifflichen Artikulation eine Fortschreibung, zugleich eine Vertiefung jener ethischen Figur „exzessiver Subjektivität“ stattfindet, wie sie im Werk Kants und Hegels bereits tragend ist. Die Ethik der Lacan’schen Psychoanalyse ist keiner Figur des ‚Guten‘, keiner vorab gegebenen Idealvorstellung und keiner verbürgten Norm (des guten Lebens) verpflichtet, sondern jener ethischen Wahrheit exzessiver Subjektivität, in der allein Wahrheit zu erhoffen ist. Die Wahrheit ist hier keine Angleichung an bereits gegebene Normen und Ideale, sie ist vielmehr das hörende Entsprechen gegenüber einem insistierenden Begehren, das es als Freiheit zu bejahen und zugleich sozial zu verantwor-ten gilt. Die Verantwortung ist keinem illusionären, entfremdenden Ideal (Phantasma) ver-pflichtet, sondern dem Realen als dem Anderen.
8JF MBTTFO TJDI FUIJTDI NPUJWJFSUF 5BUFO EFOLFO EJF TJDI BVG LFJOFHFHFCFOFO TJUUMJDIFO 7PSTUFMMVOHFO VOE LFJOF -FHBMJUÅU TUÛU[FO LÕO�OFO %BT IFJ�U� 5BUFO XFMDIF m VNHFLFISU m EJF HFHFCFOFO OPSNB�UJWFO 0SEOVOHFO SBEJLBM JO 'SBHF TUFMMFO EFOOPDI BCFS OJDIU FJOGBDIBMT FJHFOOÛU[JHF 7FSMFU[VOH PEFS XJMMLÛSMJDIF ¾CFSUSFUVOH EFSIFSSTDIFOEFO /PSNBUJWJUÅU [V RVBMJGJ[JFSFO TJOE� %JF JO EFN WPSMJF�HFOEFO #VDI QSÅTFOUJFSUF 5IFPSJF vFY[FTTJWFS 4VCKFLUJWJUÅUj [JFMU BVGHFOBV TPMDIF IJTUPSJTDI TP TFMUFOFO XJF GVOEBNFOUBMFO OÅNMJDIHSÛOEFOEFO FUIJTDIFO &SFJHOJTTF� %JF 3FEF WPO vFY[FTTJWFS 4VCKFL�UJWJUÅUj XJSE EBCFJ BMT FJO 4USVLUVSNPNFOU WFSTUBOEFO BCFS OJDIU JOEFS 7FSXJSLMJDIVOH EFTTFO XBT &UIJL BMT QIJMPTPQIJTDIF %JT[JQMJO FS�LMÅSCBSFS VOE SFDIUGFSUJHCBSFS )BOEMVOHFO WPS[VTDISFJCFO WFSTVDIU TPOEFSO BMT 7FSXJSLMJDIVOH vEFT &UIJTDIFOj EBT TJDI JN 4JOOF FJOFT,POUFYUCSVDIFT NJU EFS 4JUUMJDILFJU BMT *OFJOTTFU[VOH WPO 1BSUJLV�MÅSFN VOE "MMHFNFJOFN FSTU OBDIUSÅHMJDI CF�HSÛOEFU� %JF 4UVEJFVOUFSTVDIU VOE BOBMZTJFSU EJFTFO SJTLBOUFO VOE EFOOPDI VOVNHÅO�HMJDIFO .PNFOU FJOFS vUBUIBGUFO /FVCFHSÛOEVOHj BMT [FOUSBMFT4USVLUVSNPNFOU EFT &UIJTDIFO JO EFO 8FSLFO WPO ,BOU )FHFM VOE-BDBO�
��� �����DZ
%PNJOJL 'JOLFMEF +BISHBOH ���� JTU 1SPGFTTPS GÛS 1IJMPTPQIJF BO EFS)PDITDIVMF GÛS 1IJMPTPQIJF JO .ÛODIFO�
%PNJOJL 'JOLFMEF
&Y[FTTJWF4VCKFLUJWJUÅU&JOF 5IFPSJFUBUIBGUFS /FVCFHSÛOEVOHEFT &UIJTDIFO OBDI,BOU )FHFM VOE -BDBO
7FSMBH ,BSM "MCFS 'SFJCVSH�.ÛODIFO
)NHALT
) %INLEITUNG� 6ON DER .OTWENDIGKEIT DER (ANDLUNGSTAT � � � ��
)) %XZESSIVE 3UBJEKTIVITËT� :UM 0ARADOX DER !UTONOMIE ALSIHRE "EDINGUNG � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
))) +ANT� $AS GESPALTENE 3UBJEKT ETHISCHER (ANDLUNG � � � � � ��,BOU VOE EFS ,BOUJBOJTNVT � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��7PO (FTJOOVOH VOE 3FWPMVUJPO � � � � � � � � � � � � � � � ��(FTJOOVOH BMT vTVCKFLUJWFS (SVOEj GÛS FJOFO
v)BOH [VN #ÕTFOj � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��(FTJOOVOH VOE JISF 4QPOUBOFJUÅU � � � � � � � � � � � � � � � ��(FTJOOVOHTSFWPMVUJPO JO FUIJTDIFS (SFO[TJUVBUJPO � � � � � � ��%JF v"V�FS�'PSNj EFT LBUFHPSJTDIFO *NQFSBUJWT � � � � � � � ��5BMFOU BMT v&Y[FTTj EFS 6SUFJMTLSBGU � � � � � � � � � � � � � � ��,BOU VOE EFS vJOGFSFOUJFMMFj ,BOUJBOJTNVT� .D%PXFMM VOE
#SBOEPN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��%JF FS[XVOHFOF 8BIM NPSBMJTDIFS 7FSQGMJDIUVOH � � � � � � � ���,BOUT ,SJUJL BN *OGFSFOUJBMJTNVT � � � � � � � � � � � � � � � ���,BOUT 5ZQVT QSBLUJTDIFS 6SUFJMTLSBGU VOE FY[FTTJWF
4VCKFLUJWJUÅU � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���%JF QSBLUJTDIF 6SUFJMTLSBGU � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���%JF MFHBM�FUIJTDIF *OUFSQSFUBUJPO EFT v5ZQVTj � � � � � � � � ���;V WFSBOUXPSUFOEF VOWFSBOUXPSUCBSF 6ONÛOEJHLFJU � � � � � ���)BCJUVT MJCFSUBUJT� (FTJOOVOHTÅOEFSVOH VOE (FTUJL � � � � � ���,BOUT 5VHFOEMFISF � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���;VN "CTDIMVTT� %BT HFTQBMUFOF 4VCKFLU NPSBMJTDIFS
)BOEMVOHTUBU VOE EFS 'BMM 3PTB 1BSLT ���� � � � � � � � ���
�
)6 (EGEL� $IE GESPALTENE 3ITTLICHKEIT UND DAS 3UBJEKT � � � � � ���)FHFM HFHFO ,BOU � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���%JF 5BU BMT "VTCSVDI BVT VOCFTUJNNUFS *OOFSMJDILFJU � � � � � ���(FTJOOVOHTSFWPMVUJPO VOE TP[JBMFS 3BVN � � � � � � � � � � ���)FHFMT "OUJHPOF� 5SBHJL VOE 5SBHÕEJF � � � � � � � � � � � � ���%JF 5SBHÕEJF EFS "OUJHPOF� "OUJHPOFT "LU � � � � � � � � � � ���5SBHJL VOE 5SBHÕEJF JN ,POUFYU WPO 8JTTFO VOE 8BISIFJU � � ���%BT 3BUJPOBMF EBT TJDI WFSXJSLMJDIU IBCFO XJSE � � � � � � � � ���)FHFMT 4PLSBUFT�*OUFSQSFUBUJPO � � � � � � � � � � � � � � � � ���)FHFM VOE EBT (FXJTTFO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���4PLSBUFT� (FXJTTFO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���"MMHFNFJOFT VOE #FTPOEFSFT � � � � � � � � � � � � � � � � � ���*O "CHSFO[VOH [VS TDIÕOFO 4FFMF � � � � � � � � � � � � � � ���7FSSÛDLUIFJU VOE %JTTP[JBCJMJUÅU EFS NFOTDIMJDIFO 4FFMF � � � ���
6 ,ACAN� $IE "EGRàNDUNG AUTONOMINELLER 2ECHTSSUBJEKTIVITËTUND IHRE +ONSEQUENZEN � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
.FUBQTZDIPMPHJF VOE JISF QPMJUJTDIF %JNFOTJPO � � � � � � � ���-BDBOT 3FDIUTUIFPSJF JO #F[VH BVG ,BOU VOE )FHFM � � � � � � ���6STQSÛOHF� 'SFVET -VTULPPSEJOBUFO EFS "OSVGVOH � � � � � � ���%BT 4VCKFLU TFJOF 4VCKFLUJWJFSVOH VOE EFS FSIBCFOF
4JHOJGJLBOU � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���;FJDIFO VOE v(FTFU[FTLSBGUj � � � � � � � � � � � � � � � � � ���"OUJHPOF 3PTB 1BSLT VOE EFS v%JTLVST EFT )ZTUFSJTDIFOj � � ���%JF 4FMCTUCFOFOOVOH EFT 4VCKFLUT BVT TFJOFS -FFSTUFMMF
-BDBO ÛCFS 3VTTFMM VOE 'SFHF � � � � � � � � � � � � � ���&T HJCU LFJOF .FUBTQSBDIF � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���4QSBDIF BMT &SFJHOJT EFT 6OCFXVTTUFO � � � � � � � � � � � � ���*NQFSBUJWF � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���1IBOUBTNBUJTDIF "CXFIS EFS "OSVGVOHFO � � � � � � � � � � ���v-B USBWFSTÊF EV GBOUBTNFj � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���/JDIU SFQSÅTFOUJFSUF 4JHOJGJLBOUFO � � � � � � � � � � � � � � ���v%BT -PTCSFDIFO EFS 4JHOJGJLBOUFOj � � � � � � � � � � � � � ���#FEFVUVOH PIOF (FMUVOH � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
�
)NHALT
;VN 1BSBEPY FY[FTTJWFS "VUPSJUÅU � � � � � � � � � � � � � � ���v+F EJT UPVKPVST MB WÊSJUÊƾj � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
6) ,ITERATURVERZEICHNIS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
6)) 0ERSONENREGISTER � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
�
)NHALT









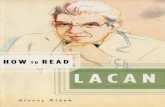


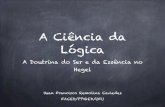
![Hegel y la identidad como proceso [Hegel and identity as a process]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d52c8d5372c006e04dff1/hegel-y-la-identidad-como-proceso-hegel-and-identity-as-a-process.jpg)

![Mesjańska (bez)nadzieja nowoczesności: Hegel, marksizm, psychoanaliza [Messianic Hope(lessness) of Modernity: Hegel, Marxism, psychoanalysis]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cb25e93f371de190191e8/mesjanska-beznadzieja-nowoczesnosci-hegel-marksizm-psychoanaliza-messianic.jpg)