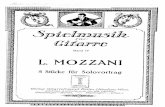Strategien des Entziehens. sinnhaft. Journal für Kulturstudien 22
Transcript of Strategien des Entziehens. sinnhaft. Journal für Kulturstudien 22
Sinnhag 22
Strategien des Entziehens
Lœcker Verlag
Editorial S. 8 – Heide Hammer und Stephanie Kiessling Sinnlose Verwei- gerungen S. 12 – Holger Schulze Das häusliche Leben S. 30 – Karin S. Wozonig Kunst oder Leben S. 44 – Thomas Ballhausen Im Süden S. 56 – Antonia von Schöning Archiv
des Entziehens S. 62 – Katja Rothe Die Schule des Entzugs S. 74 – Odin Kroeger Zur Kritik des Entzugs als politischer Praxis S. 90 – Sebastian Gießmann Orte der
Kulturwissenschaften: The McLuhan Program S. 104 – Paul Lafargue Das Recht auf Faulheit S. 108 – Klaus Neundlinger Der Entzug der Natur S. 116 – Impressum S. 122
Strategien des EntziehensEditorial S. 8 – Heide Hammer und Stephanie Kiessling Sinnlose Verwei-
gerungen S. 12 – Holger Schulze Das häusliche Leben S. 30 – Karin S. Wozonig Kunst oder Leben S. 44 – Thomas Ballhausen Im Süden S. 56 – Antonia von Schöning Archiv
des Entziehens S. 62 – Katja Rothe Die Schule des Entzugs S. 74 – Odin Kroeger Zur Kritik des Entzugs als politischer Praxis S. 90 – Sebastian Gießmann Orte der
Kulturwissenschaften: The McLuhan Program S. 104 – Paul Lafargue Das Recht auf Faulheit S. 108 – Klaus Neundlinger Der Entzug der Natur S. 116 – Impressum S. 122
Strategien des EntziehensEditorial S. 8 – Heide Hammer und Stephanie Kiessling Sinnlose Verwei-
gerungen S. 12 – Holger Schulze Das häusliche Leben S. 30 – Karin S. Wozonig Kunst oder Leben S. 44 – Thomas Ballhausen Im Süden S. 56 – Antonia von Schöning Archiv
des Entziehens S. 62 – Katja Rothe Die Schule des Entzugs S. 74 – Odin Kroeger Zur Kritik des Entzugs als politischer Praxis S. 90 – Sebastian Gießmann Orte der
Kulturwissenschaften: The McLuhan Program S. 104 – Paul Lafargue Das Recht auf Faulheit S. 108 – Klaus Neundlinger Der Entzug der Natur S. 116 – Impressum S. 122
Strategien des EntziehensEditorial S. 8 – Heide Hammer und Stephanie Kiessling Sinnlose Verwei-
gerungen S. 12 – Holger Schulze Das häusliche Leben S. 30 – Karin S. Wozonig Kunst oder Leben S. 44 – Thomas Ballhausen Im Süden S. 56 – Antonia von Schöning Archiv
des Entziehens S. 62 – Katja Rothe Die Schule des Entzugs S. 74 – Odin Kroeger Zur Kritik des Entzugs als politischer Praxis S. 90 – Sebastian Gießmann Orte der
Kulturwissenschaften: The McLuhan Program S. 104 – Paul Lafargue Das Recht auf Faulheit S. 108 – Klaus Neundlinger Der Entzug der Natur S. 116 – Impressum S. 122
8
… die aktuelle Sinnhaft fragt vor dieser Folie nach aktuellen Ausprägungen der Figur des Entziehens in der Kunst, der Popularkultur und der Theorie; nach Logiken und Techniken und Wissensformen des Entziehens; nach den Chancen und Problemen die-ser Figur als Orientierungsmarke des Agierens; nach ihren gesellschaftlich-emanzipati-ven sowie psychisch-regressiven Seiten; nach ihren transgressiven wie traumatisieren-den Effekten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht die Redaktion dieser Ausgabe (Karin Harrasser, Da-niel Winkler, Marie-Noëlle Yazdanpanah)
Editorial: Als wir 2008 mit der Redaktion des vorliegenden Heftes begannen, glaubten wir eine gewisse Lähmung feststellen zu können: Individuelle Lebensentwürfe und po-litisches Agieren schien in unseren Breitengraden zunehmend in sich selbst zu kreisen. Der gefühlte Sieg des Kapitals, so schien es, hatte jede Utopie ausgetrieben und als lin-ke Widerstandsstrategie blieb nur noch die Schwundstufe der Negation, der Rückzug übrig. Dieser Eindruck verstärkte sich für uns KulturarbeiterInnen 30+, da wir erlebt hatten, dass residuelle Orte und gesellschaftliche Nischen zunehmend enger und rarer geworden waren. Außerdem hatten die letzten Jahre deutlich gezeigt, dass Strategien der Subversion, dass die Gegenkulturen der 60 er und 70 er Jahre längst neoliberal kolo-nisiert und zu Marketingstrategien verkommen waren.
Und dann kam sie doch: Die Störung (einst Hoffnungsträgerin der Marxschen Ma-schinenstürmer) und zwar in Form einer Wirtschaftskrise, die nicht so einfach re-inte-griert werden konnte. Unmengen von Kapital wurden vernichtet, keynesianische und andere Wirtschaftstheorien der staatlichen Regulierung wurden aus der Mottekiste ge-holt und die »natürliche« Dynamik des Marktes, die in den letzten Jahren so massiv den Rückbau staatlicher Versorgungsanstalten argumentativ gestützt hatte, kam in Verruf.
Aber hat die Krise tatsächlich eine Repolitisierung nach sich gezogen? Vorderhand ja: Staatliche oder überstaatliche Wirtschaftspolitik besteht nicht mehr nur darin, die Entfaltung des freien Marktes zu gewährleisten, die Gewerkschaften der Autobauin-dustrie treten wieder medial in Erscheinung, einige Fabriken wurden von der Arbei-terschaft übernommen und zuletzt haben auch endlich die Studierenden begonnen zu streiken. Man kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass der im doppelten Sinn aufgebrachte Aktivismus nicht in Richtung eines Generalstreiks tendiert, sondern dass es in den meisten Fällen darum geht, den Zustand vor der Krise, wiederherzustellen. Anlass für die aktuellen Proteste ist also die Störung eines Status quo in Form von bür-gerlichen Sicherheiten und Bequemlichkeiten, die als selbstverständlich aufgefasst wer-
9
den. Das Ziel scheint zu sein, sich das Recht auf einen (erneuten) Rückzug ins Private zu erstreiten. Und das macht durchaus Sinn: Sich ins Private zurückziehen kann man – ist man nicht so konsequent und radikal wie Melvilles Bartleby – nämlich nur, wenn existentielle Probleme gelöst sind, wenn der Arbeitsplatz gesichert und das Bankkon-to halbwegs gefüllt ist. Nie schien Paul Lafargues Plädoyer für ein Recht auf Faulheit deshalb so paradox wie heute: Der Mangel an Arbeit im (vielleicht nicht mehr ganz so reichen) Westen, ein Effekt der Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer, be-straft auf der einen Seite diejenigen weniger Privilegierten und Ausgebildeten, die ger-ne arbeiten würden durch sozialen Ausschluss bzw. Ausschluss von Konsum und pro-duziert auf der anderen Seite immer mehr reiche Opfer des Burn-out-Syndroms (und auch weiterhin: immer mehr Millionäre).
Die aktuelle Sinnhaft fragt vor dieser Folie nach aktuellen Ausprägungen der Figur des Entziehens in der Kunst, der Popularkultur und der Theorie; nach Logiken und Techniken und Wissensformen des Entziehens; nach den Chancen und Problemen die-ser Figur als Orientierungsmarke des Agierens; nach ihren gesellschaftlich-emanzipati-ven sowie psychisch-regressiven Seiten; nach ihren transgressiven wie traumatisieren-den Effekten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht die Redaktion dieser Ausgabe (Karin Harrasser, Da-niel Winkler, Marie-Noëlle Yazdanpanah)
Editorial: Als wir 2008 mit der Redaktion des vorliegenden Heftes begannen, glaubten wir eine gewisse Lähmung feststellen zu können: Individuelle Lebensentwürfe und po-litisches Agieren schien in unseren Breitengraden zunehmend in sich selbst zu kreisen. Der gefühlte Sieg des Kapitals, so schien es, hatte jede Utopie ausgetrieben und als lin-ke Widerstandsstrategie blieb nur noch die Schwundstufe der Negation, der Rückzug übrig. Dieser Eindruck verstärkte sich für uns KulturarbeiterInnen 30+, da wir erlebt hatten, dass residuelle Orte und gesellschaftliche Nischen zunehmend enger und rarer geworden waren. Außerdem hatten die letzten Jahre deutlich gezeigt, dass Strategien der Subversion, dass die Gegenkulturen der 60 er und 70 er Jahre längst neoliberal kolo-nisiert und zu Marketingstrategien verkommen waren.
Und dann kam sie doch: Die Störung (einst Hoffnungsträgerin der Marxschen Ma-schinenstürmer) und zwar in Form einer Wirtschaftskrise, die nicht so einfach re-inte-griert werden konnte. Unmengen von Kapital wurden vernichtet, keynesianische und andere Wirtschaftstheorien der staatlichen Regulierung wurden aus der Mottekiste ge-holt und die »natürliche« Dynamik des Marktes, die in den letzten Jahren so massiv …
12
SinnloseVerweigerungen
Bedeutungsvolles Beginnen
Wir können die gewünschten Bedeutungen erzwingen, indem wir unsere Subjekte be-liebig multiplizieren oder dividieren oder ihnen ein »durch die Zeiten Ziehen« zubilli-gen; der Konjunktiv ist hier ebenso ein Segen. Wir können der Textstruktur unseren Wunsch diktieren, spielerisch die Ordnung modifizieren, dezent und versteckt, nur wir wissen um diese Lenkung. Zeigt sich hier die Beliebigkeit von Zeichen, Sinn und Be-deutung, ihre willkürliche Verknüpfung ? Wir wechseln die Beispiele um Worte zu ver-meiden, die sich nicht eignen, entsprechend unserer Zielsetzung. Unsere Ideen wollen nicht durch ein Répertoire beschnitten werden. Wir möchten uns der Unterordnung unter ein bestimmtes, gleichwohl beliebiges Zeichen entziehen, unsere Formulierungen nicht von begrenzten Optionen diktiert wissen. Dies ist vielleicht unsinnig, überflüssig, ein Hindernis zu dem keine Notwendigkeit besteht, eine Beschneidung von Möglich-keiten könnte der/die LeserIn kritisieren. Richtig. Doch sich der geringen Möglichkei-ten bewusst, erregt diese Eingrenzung plötzlich heftigen inneren Widerspruch – nicht selten liegt der Ursprung des Opponierens in unvermittelten, plötzlichen Erkenntnis-sen. Es gibt nur fünf, sie fordern die Unterwerfung, der wir uns verweigern wollen. Be-weise unserer Eitelkeit ? Nein, lustvolles Experimentieren ! Ihr meint: Wozu ein Mini-mieren, logischer erschiene doch ein Vermehren der Möglichkeitsfelder ? Gewiss, dies schiene ein reizvolles, zu riskierendes Unternehmen, doch wer würde dergleichen pub-lizieren ? Ein solches Experiment fiele jeglichem Verstehen zum Opfer.
Ein Selbst Versuch, sich bestimmter Logiken des Lebens und Schreibens zu entziehen von Heide Hammer und Stephanie Kiessling
13
Hier zeigt sich ein generelles Problem der verschiedenen Formen des Sich-Entziehens bzw. der Verweigerung, die konstruktiv wirken wollen: In einem vorgegebenen, de-finierten Feld neue Beweglichkeiten entwickeln, die doch gleichzeitig mit einem Ver-zicht verbunden sind. Eine Selbst-Einengung, eine Reduktion der Möglichkeiten, denen nur schwer neue Optionen hinzuzufügen sind. Wie können wir unsere Möglich-keiten in der Welt vermehren ohne entsprechende Ressourcen ?
Chef Duzen Ein Internet-Forum1 verspricht »lieber feiern denn schuften« und bietet nützliche Tipps zur Progression dieses Entwurfs. Gelobt werden hier Spielwiesen des Müßig-Gehens und nicht die informellen Erscheinungsweisen geordneter Systeme, ein Pseudonegieren von Befehlsstrukturen. Im legeren »Du« wird in moderner Verwertungslogik Gleichheit suggeriert, womit jedoch weder reziproke Beziehungen noch gleichwertige Kontoerlö-se einhergehen. Vielmehr gelingt so die Intensivierung der Nützlichkeit: erfinderische Lösungen und gehöriger Eifer werden durch die Involvierung der Person mit ihren Be-sonderheiten, Wünschen und Gefühlen erzeugt. Dem Wichtignehmen der Dienstneh-merInnen durch die ChefInnen folgt ein subjektives Gefühl des Wichtigseins, welches letztendlich zur Produktionssteigerung führt – Betriebspsychologie hieß diese Kunst früher und mühselig wurde sie erlernt, heute bereits eingegliederter Nebeneffekt klei-nerer Ökonomien. Hier herrscht die Pervertierung lustvollen Produzierens, nicht zu-letzt in Formen verinnerlichten Pflichtstrebens.
Der Furcht vor Erwerbslosigkeit können die Schrecken gewöhnlicher Demütigun-gen und Zumutungen gegenübergestellt werden. In den Foren werden Beispiele gelis-tet, wie diesen wirkungsvoll begegnet werden könnte. Wer sein unermüdliches Tun nicht dem Unternehmen, der Idee monotoner Progression widmen will, findet in Grup-pen und Szenen unterstützende FreundInnen.
Nur zeigt selbst dieses lustvolle Gegenmodell im Müßiggehen eine deutliche Ge-schlechterdifferenz: Die Coolness der Verweigerung des Einen wird zur Depression im weiblichen Erscheinungsbild. Im Fehlen von konkreten Zielorientierungen steckt, so die Unterstellung, die typisch weibliche Hemmung, konkrete Entscheidungen zu treffen. Der Vorwurf nicht zu genügen und zu entsprechen wird in diesem dichotomen Denken weiblich konnotiert. Mit der Beschreibung geglückter Gegenbilder wird ver-sucht ein Spiel verfeinerter Wiederholungen zu eröffnen, um der Einförmigkeit ökono-mischen Funktionierens und den sexistischen Gewissheiten zu trotzen.
1 www.chefduzen.de
14
Drop out
Eine New Yorker Künstlerin, nennen wir sie der Kürze wegen Lee, probte Ende der 1960er in verschiedenen Selbstversuchen kontinuierlich den rigiden Entzug bzw. wech-selweise die Zuführung bestimmter Stoffe sowie Begegnungen mit ihrer Umwelt. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten, so ihre Hoffnung, zu einer Verbesserung ihrer – gleichwohl der generellen – Lebensbedingungen, zu einer völligen Verschmelzung von Kunst und Leben führen. So utopisch bzw. teilweise irrwitzig ihre Projekte erscheinen mögen, meist sind es Experimente penibler Selbsterforschung wie beispielsweise einige Zeit Selbstbefriedigung mit unterschiedlichsten Dingen oder mit sich selbst (Selbstbe-friedigungsstück, 1969), die Umsetzung sollte – zumindest theoretisch – doch möglich sein.² Ein Ehrgeiz, der die Künstlerin besonders bei ihrem »No Drugs Stück« mit schwe-ren Entzugserscheinungen ringen ließ. Die Eindrücke dieser Erlebnisse dokumentierte sie eingehend in Listen, Büchern oder Briefen. In ihren Formulierungen und Bildtexten spielte Lee zudem phonetisch-poetisch mit der Verschiebung von Schriftzeichen, wenn sie – übersetzt es euch ins Englische – postulierte: »Ich verlor Gewicht/Zeit (Frist).« Die künstlerische Form konnte für sie nur legitim sein, wenn sie dem Sinn entsprechen-de Bedeutungen vermittelt.
In ihrem öffentlichen Brief im Frühling 1969, verlesen bei der Sitzung des Kunst-werkendenkollektivs, negierte sie die Möglichkeit einer (zu jener Zeit kollektiv ersehn-ten) »Kunstrevolution« ohne gleichzeitiger politischer Revolution, ohne Bildungsrevo-lution, Drogenrevolution, Sexrevolution oder der Revolution im persönlichen, nicht-öffentlichen Bereich. Der Brief zeigt ihre kritischen Überlegungen, ihre Skepsis zu den (selbstbezüglichen) Forderungen des Kunstbetriebes. Die Fortführung ihrer Idee, vom »Generellen Streik Stück« (1969) über ihr »No Info Stück«, in dem sie sich vorüberge-hend jeglicher Beziehung mit der Umwelt entzog (kein Fernsehen, kein Hörfunk, kei-ne Bücher, keine BesucherInnen, kein Blick durchs Fenster, keine Uhren usw.) spitzte ihre Einengungs- und Selbstbeherrschungsexperimente immer weiter zu: Im Sommer 1971 entschied sich Lee im Zuge eines ihrer Projekte für eine ursprünglich begrenzte Zeit – vier Wochen – nicht mehr mit ihrem weiblichen Umfeld zu kommunizieren, die-ses völlig zu boykottieren: Weder Worte noch Blicke sollten zwischen ihr und den für sie im Kunstkontext konkurrenz- und streitsüchtigen »Wichtigtuerinnen« gewechselt werden. Deren Befreiung schien ihr (deswegen) in bitterlicher Weise zum Scheitern verurteilt. Diese letzte Stufe ihrer Selbstversuche führte schlussendlich zum völligen Drop out, ihrem Rückzug von der Kunstwelt: Sie redete nie wieder mit ihrem weibli-
2 Wen’s interessiert: Die »sexy Mohrrübe« beurteilte Lee in ihren Erkundungen besonders positiv.
15
chen Umfeld. Von der Zeit zwischen 1971–1982 gibt es keine Infos über ihren Verbleib in New York, 1982 übersiedelte sie in den Süden zu ihren Eltern, wo sie bis zu ihrem Tode 1999 lebte. Bis vor kurzem trug die Rezeption ihrer Werke noch den Stempel des »Schizoiden«. Ein Los, geteilt mit vielen Künstlerinnen, die sich wie sie in unbeding-ter Weise den Zurichtungen einer konkurrenzorientierten Welt entziehen wollten, die Konsequenzen des Irrewerdens eingeschlossen.
Die (selbst-)destruktiven Wirkungen solch kompromissloser Versuche, Kontrolle über eine beherrschende, unfrei empfundene Welt zu erreichen, werden durch ihr Bei-spiel evident, weil sie, im Widerspruch zu ihren eigenen Setzungen, doch individuell bleiben. Ihr Ziel einer Fusion von Kunst und Leben schien für Lee selbst erreicht, doch notierte sie bereits 1969 deprimiert: »(B)isher bringt es mich nirgendwo hin.« Die kol-lektive Umsetzung erfolgte nicht, ein zu utopisches Ziel. Ohne flexible Optionen, den gegebenen Bedingungen Positives zu erwidern, bleibt ein solches Unternehmen bloße Selbstbeschneidung. Verweigerung wird so zur Möglichkeitsreduktion ohne Eröffnung neuer Horizonte, neuer Fluchtlinien.
Ergebnis- bzw. Erfolgsorientierung
Keine Hobbys und kein Zeitvertreib ohne Listenführung für die kommenden Bewer-bungsschreiben, kein Sport ohne die günstigen Effekte der Körperformierung, kein un-entgeltliches Schreiben diverser Texte ohne wenigstens die Liste der eignen Veröffent-lichungen im Hinterkopf. Im Feld der Unternehmungen zirkuliert die Nützlichkeit wie sonstwo früher goldene Münzen. Die Ergebnisorientierung verinnerlicht – es reicht nicht mehr, gut genug zu sein, wir müssen besser werden – beziehen wir letztlich unse-re Geltung, unser Prestige über sie, selbst in den vergnüglichsten Zerstreuungen unse-res Lebens. Dinge nur für sich, ohne Sinn oder Zweck zu tun, erscheint ungeheuerlich. Die Ergebnisoffenheit des Experimentellen ist unerwünscht, zu ungewiss sein Nutzen, wenn es sich den Logiken der Verwertung entzieht.3 Hier wird es schwierig: Selbstre-dend entsteht eine Lust beim Produktiv-Sein, die befriedigt und mit Stolz erfüllt, doch nur die erfolgreiche Umsetzung im Kopf, bei der Vermeidung von Fehlern um jeden Preis, wird jeglicher Erkenntnisgewinn, der sich erst im Scheitern zeigen könnte, un-terbunden.
Der Druck, Nützliches bzw. Sinnvolles zu produzieren, durchzieht zudem nicht nur unser Tun, er formt überdies unsere Denkbewegungen: Der These – Gegenthese folgt die Synthese: Der Widerspruch in der eigenen Rede oder im Geschriebenen wird gerne
3 In den Chor der Lobpreisungen der kleinsten, der unnützen Dinge wollen wir hingegen nicht einstimmen. Boomen die Dinge in ihrer vermeintlich unschuldigen Reinheit in den kunst- und kulturgeschichtlichen Diskursen, spiegelt sich hierin doch weniger unsere gerügte moderne Seinsvergessenheit denn unser Unvermögen, sich den Menschen und der Liebe zu ihnen zu widmen.
16
eingeflochten, um die Stringenz der Beweisführung zu belegen: So wurde es uns in den Schulen und Unis gelehrt, so wiederholen wir es eifrig. Die Ergebnisse müssen letztend-lich geschlossen, logisch und schlüssig sein, der Widerspruch wird nur in Form rhetori-scher Wendungen geduldet. Er muss bereinigt werden, dies verleiht ihm seine Existenz-berechtigung. Zudem eröffnet diese Finte noch eine weiterreichende Konsequenz: Wer den Widerspruch gleich selbst formuliert, nimmt den potenziellen Einspruch vorweg.
Funktionieren Bei Rot stehen bleiben und bei Grün gehen sind vielleicht noch sinnvolle Intervention, um die Verkehrsdichte zu regeln, wobei selbst im Bereich des Verkehrs mitunter ver-nünftigere Überlegungen an Bedeutung gewinnen. In einigen Orten werden Zeichen und Schilder bereits durch gemeinnützige Bestimmungen ersetzt, ein bequemes Fre-quentieren der Wege ist wieder möglich, wenn Gehende oder TreteselbetreiberInnen gegenüber dem motorisierten Verkehr bevorzugt werden, inklusive einer generellen Berechtigung zum Trödeln.4
In gleichem Sinn wirkt eine bereits wiederholt erprobte Inszenierung, ein Befrüh-stücken öffentlicher Orte mit Tischtuch, feinem Geschirr und bequemen Stühlen. Die-se Intervention verschönt jede Verkehrsinsel und begegnet dem voreiligen Schritt ins Büro mit einem kurzweiligen Vergnügen. Verbindende Formen der Zerstreuung stören den eintönigen Betrieb: Wer ein solches Frühstück besucht, versucht sich in der Kopie der Idee und kreiert ein, zwei, viele Inseln des Genusses. Nicht selten reichen die Ver-lockungen eines solchen Essens bis in die Schlummerstunden, ein impliziter Erkennt-nisgewinn, der vermeintliche Pflichten und notwendige Termine in den Hintergrund rückt.
Glück durch Geschwindigkeit
Wieso sehen wir den Segnungen der Technik nicht mehr hoffnungsfroh entgegen ? Der Flug zum Mond ist schon ein Weilchen her und – jetzt sind wir eines Besseren belehrt – Teflon wurde schon 1938 vom Chemiker Roy Plunkett hergestellt, ein Nebenprodukt der Suche eines neuen Kühlmittels und nicht des kosmischen Flugverkehrs. Seit 1957 wird dieses Universum wiederholt mit Sputniks und komplexeren Flugobjekten erkun-det, mitunter ist selbst ihre Rückkehr inklusive Begleiter geglückt. Kosmische Helden dieser Zeit, Jurij oder Sigmund, eignen sich heute zur Symbolisierung des Wunschs
4 Ein Verkehrskonzept kollektiv genutzter öffentlicher Orte sorgt vorwiegend in den NL für Furore. Hierorts versuchen drei steirische Gemeinden ohne Schilder und Lichter, rechts vor links und Frechheit vor Großzügigkeit zu bestehen. Die größte ist bisher Voitsberg mit 10.000 EinwohnerInnen.
17
kommunistische Entwürfe neben den herkömmlichen Verzückungen des Konkurrenz-Lust-Dispositivs zu eröffnen. In der Wiederholung dieser Fernreisen könnte neue Pu-blicity für politische Versuche gewonnen werden, kosmische Utopien in Differenz zur hiesigen Ökonomie.
Indes ist es in unseren Kreisen schon seit einer Weile chic, Produkten zu huldigen, die nicht in menschenleeren Betrieben gefertigt wurden, sondern effektvoll die Insigni-en geübter Finger zeigen, deren Wohl respektive jenes der Vehikel-, Mohrrüben- oder KleidungsproduzentInnen ist jedoch von geringer Bedeutung. Dem Herstellungsort ih-rer mühseligen Produktion wird der Nimbus der neuen, freien Welt entnommen und US in die hiesigen linken Szenen übersetzt. Den sportiven Tretesel ziert ein Hinweis zu Ort und Weise der Herstellung und selbst T-Shirts gewinnen Bedeutung, wenn sie von einem Betrieb im Zentrum kommen, hier wie dort von emsigen, nützlichen Unterneh-mensmitgliedern gefertigt. Obendrein wird Biogemüse gelobt und genussvoll verzehrt, wer die hübschen bis runzeligen Sprossen und Stengel dem feuchten, mistgedünkten Boden entnimmt, kommt meist von Ex-Ost und liebt bestimmt ein Werken unter frei-em Himmel und in frischer Luft. Ein Teil des Verlusts der technophilen Utopie ist nicht zuletzt der Ökobewegung geschuldet. Entschleunigung tut gut, wenn sie die kollekti-ve Verteilung von Freizeit befördert (eine Illusion hinsichtlich der verschwimmenden Grenzen von Frei- und Dienstzeit), wobei die Liebe zur Geschwindigkeit in der Be-schleunigung eines Flugzeugs – kurz vor der letzten Berührung der Piste – deutlich wird. Der Zeitgewinn wird konzentriert, bildet den Reichtum von Wenigen, setzt vie-le frei, die den Schmutz und die Fron nicht scheuen dürfen, um der Verwertungs logik nicht vollends enthoben zu werden.
Hysterie
Ein kleiner lebensgeschichtlicher Einbruch verunmöglicht die konzise Textentwick-lung: Heute Morgen, zum 7.x in Folge ( !) wurde mir mein Tretesel gestohlen, in meinem direkten Lebensumfeld, dem Weg zu meiner Wohnung oder der Treppe zu ihr. Für sol-che Diebe finde ich keine Worte, meine Wut bricht sich in körperlichen Verrenkungen – ich koche, nein, ich tobe innerlich ! Gewiss, eine Kleinigkeit, wir wollen unser Herz doch nicht mit der Liebe zu weltlichen Dingen beschweren – doch Mercedes stehen en gros vor meiner Türe, wieso sieht die denn keineR ? Ich regrediere in eine Form hilflo-ser Erregung kombiniert mit heftigen Zuckungen, in Wellen wechselt irres Gekicher mit wilden Schimpfergüssen – und meine Erinnerung ist undeutlich: Existiert nicht eine
18
treffende Bezeichnung für diese Befindlichkeit ? Jetzt weiß ich’s: Hysterie ! Ein psycho-logischer Begriff für eine neurotische Störung, heute heißt es offiziell: Konversions-störung, doch ich tendiere mehr zur Definition: »Hysterische Persönlichkeit«, es ent-spricht mir im Moment eher. Eine hygroskopische Beschreibung – wurde der Hysterie doch unterstellt, sie zeige sich nur vor Publikum: Ich bezeuge, eine schnöde Lüge – es ist kein notwendig die Geselligkeit liebendes Leiden ! Möge die Hysterie unendlich oft in Verbindung mit dem weiblichen Geschlecht gestellt worden sein, ich weiß dem nichts Verwerfliches zu entnehmen, dem Zorn, der sich – und sei es über meinen Uterus – den Weg bricht, möchte ich in keine Sperre weisen. Zu Unrecht diskreditiert – ich ersehne eine Kultur der Tobsucht, der unkontrollierten Tumulte – sie sind in dieser / jeder Hin-sicht nur entsprechend ! Viel zu wenig zeigen wir unser Entsetzen, unser Wut mit ihren körperlichen Symptomen: Wieso verschleiern, wo deutlicher Exzess sein sollte ? Doch der Ruf der Hysterie ist heute völlig ruiniert: 1928 wurde ihr fünfzigstes Bestehen zu-mindest in künstlerischen Kreisen noch mit Festsschriften und Lobpreisungen gefei-ert5, 2008 wurde ihr Fünfundsiebzigster bereits weise weitgehend ignoriert.
Himmel, ich muss morgen zur Polizei einen Diebesbericht zu Protokoll geben ! Jetzt erinnere ich mich, im Oktober 2007, bei meiner letzen polizeilichen Bekundung der Entwendung meines Tretesels rief mich der Polizist im Revier des fünften Wiener Ge-meindebezirks zu sich: »Kommens, junger Herr !« Ich blickte um mich, keineR sonst im Zimmer, ich zögerte. Der Polizist entschuldigte sich sogleich. Dennoch, ich gestehe: Von meiner bestürzten Wut heilte mich diese Verwirrung kurzfristig.
Ich (nicht)
In der Begriffsreihe gewohnter Ordnung klebt prominent unser Ich, dem wir uns noch nicht widmen wollten; denn wo Ich ist, soll Es schreiben, gewissenlos, unweigerlich. Verweigert werden die gewohnten Verweise, Referenzen, Fußnoten, ebenso die Flucht ins Konventionelle, ein Versteck hinter den Zeichen der Meister, hinter dem erworbenen Wissen. Ich sollte freilich in seriösen Texten gemieden werden, die Person verschwin-det hinter der Beschreibung: objektiv und gültig. Wie endlich der Wert dieser Wissen-sproduktion ist, bleibt unerheblich. Mit derselben Vehemenz und im sprichwörtlichen Brustton der Überzeugung wird morgen schon die neue Erkenntnis postuliert. Ein mo-dernes Bild, dessen begrenzte Geltung den ErforscherInnen der Kultur gewiss vermit-telt und konzediert wird. Für jedes gewichtige Streben im methodenergebenen Feld gel-ten die Ergebnisse der Messung. Unser Schreiben involviert die Person: Körper, Seele,
5 Die Hysterie sei, so Breton, einst Medizinstudent und stilgebender Poet jener Epoche, ein mehr oder weniger irreduzibles Geistesbefinden, welches durch die Subversion der Beziehungen gekennzeichnet ist, die zwischen dem Subjekt und der sittlichen Welt, der es sich zugehörig meint, jenseits eines jeden Trug- bzw. Illusionssystems bestehe. Die Hysterie sei dementsprechend kein medizinisches Leiden, sondern in jeglicher Hinsicht überlegenes Mittel der Befindlichkeit.
19
Psyche inbegriffen. Sie zeigt kein Geschlecht, denn der Sexus gilt nicht mehr, Sex schon, er fungiert im Sinne einer notwendigen Illusion und ermöglicht Berührungen. Die Stö-rung kontinuierlich begründeter Ordnungen gelingt. Intensives Erleben ist mit einem entsprechenden Gegenüber möglich, oder mehreren, wobei der Reiz besonders groß ist, wenn die Versprechen nicht gefüllt werden müssen, gefühlt jedoch schon.
Dem Es, jenem wesentlichen Teil der beliebten Dreiheit, wird doch wieder zu we-nig Bedeutung beigemessen. Die Bewegung dieses Schreibprozesses direkt dem Unbe-wussten zu entnehmen, ist eine hübsche Vorstellung, vorerst muss jedoch die Berüh-rung möglicher Irrwege genügen. Dem Konzept des guten Gewissens, einem Über-Ich, fehlt der Biss, wenn wir uns diesem Vernunftgebot, den üblichen Regeln und Geboten entziehen. Hier soll nicht plötzlich Destruktion oder indifferente Unhöflichkeit be-worben werden, gerne bewegen wir uns in freundlicher Umgebung. Wir stellen nur der Freud’schen Illusion eines ursprünglich unversehrten Ichs, welches sein Gewissen erst durch einen schmerzvollen Verlust errichtet, die Butler’sche Sichtweise entgegen: kein geschlossenes, unverletztes Ich muss erst die übergeordnete Stelle kreieren, der Verlust geht immer bereits mit dem Subjekt einher.
Die existenzielle Erkenntnis dieser Trennung zeigt sich in jedem intensiven Begeh-ren, dem undurchdringlichen, geheimnisvollen Wunsch einer Überwindung des isolier-ten Seins. Dennoch birgt die sehnsuchtsvolle Suche eines völlig entsprechenden Gegen-übers, eines fehlenden Teils zur symbiotischen Beziehung keine gültige Lösung. Wir sind jeweils Ensemble unserer kollektiven Verortungen und Verbindungen.
Job
Ein nie endendes Frühstücksidyll: Den Morgen mit Illy beginnen, lesen, mit dem/der Bettgenossen/in Zeit verbringen. Zeitungen und Bücher kommen mit FreundInnen, ebenso Blumen und Fisch. Die Zimmer werden vernebelt, nebenher die Entdeckungen des intensiven Lesens geteilt. Rezitiert und referiert wird bevorzugt Groteskes.
In den 1970ern versucht ein Rundfunksender dem Begehren eine Stimme zu geben und den KorrespondetInnen der Demos, Sit-ins und Musiksessions, deren Berichte gleich wieder die Orte des Geschehens erfüllten, technische Beweglichkeit zur Störung der Ordnung des Diskurses. In die Willkür sinnvoller Sprechgewohnheiten werden die Wut, die Verrücktheit und die Ungeduld der Befreiung eingeführt, nichts Konstrukti-ves. Ein Kollektiv sendet Entdeckungen, Rezepte, Horoskope, Lieben und Lügen, ver-bunden mit der Ermunterung, im Bett zu bleiben, Musikinstrumente herzustellen, sich
20
wohlzufühlen. Der russische Futurist M. werkt im Hintergrund und Rin Tin Tin spielt die Mundorgel. Ein sinngebendes Subjekt wird nicht mehr im illusorischen Bereich der Kunst entfesselt, sondern in den empörenden, obszönen Komplexen des gewöhnlichen Lebens. Nicht mehr von den Wünschen reden, wünschen.
Der Teufel ist zur Erde zurückgekehrt, in vielen Erscheinungen, er ist Grinsen, Kör-per, Geist, Einbruch in die Disziplinen der Trennung. Ein Spiel mit den Regeln des Sprechens treibt wundervolle Nonsenseblüten – ZUT ein Lieblingswort des poetisch-politischen Senders konspiriert mit befreundeten Zeitschriftenprojekten.
Kollektive
Wer will unter sich keine Knechte und über sich keine Herren ? Worin finden wir Spu-ren vom Glück KommunistIn zu sein ? Und wer liebt die Freiheit ? Wird die bescheidene Befriedigung durch ein Gefühl der Überlegenheit in kollektiven Entwürfen durchbro-chen, im verschwenderischen Verteilen von Lob und Bewunderung für Verrücktheiten und (un-)geteilte Vorlieben ? Seit dem Ende der Systemkonkurrenz ist die Drohung der Entsubjektivierung – eindrucksvoll verkörpert im Kollektiv der Borg – ungeheuer le-bendig. Seven of Nine, die von den Borg getrennt wurde, vermisst in der Crew der Ster-nenflotte jene Verbindung, die multiethnische KriegerInnen mit forschendem Ethos und wohlmeinenden Berechnungen nicht bieten. Ihre Tendenz zur Perfektion ist we-nig liebenswert, doch in ihrer Zurückweisung herkömmlicher Vergnügungen werden die Grenzen individuellen Glücksstrebens offensichtlich. Ein Rest von Dystopie durch-zieht diesen Entwurf, der in der merkwürdigen Struktur der Borg – viele Drohnen und eine Königin, die dieses Kollektiv verkörpert (»Ich bin eine, ich bin viele, ich bin die Borg«) – ein Wechselspiel ideologischer Blockbildung illustriert.
Von dem Gegenspieler Durkheims, G. T., Soziologe und Jurist, geliebt und rezipiert von PhilosophInnen mit dem Epitheton »post« und vielen mit Neigung zur »french con-nection«, wird die Differenz von Erfindung und Kopie korrigiert. Er entsubjektiviert ein intellektuelles Geschick, um die Ebene der unpersönlichen psychologischen Vermö-gen zu erreichen, Erkenntnis, die jeglicher Unterscheidung zwischen Objekt und Sub-jekt, zwischen sinnlichen Eindrücken und dem Intelligiblen vorhergeht. Dem Genie-kult, der Figur eines gelehrten Erfinders und Forschers, dessen Geistesblitze Geschich-te schreiben, wird hier widersprochen. Die Dichotomie von Individuum und Gruppe ist in dieser Sicht suspendiert. Die beiden Begriffe gehorchen nicht mehr widerstrei-tenden Konzepten von Progression. Beide sind durch dieselbe Fülle von Beziehungen
21
und Verbindungen strukturiert, ein Individuum ist ontologisch mit seiner kollektiven Dimension verbunden, beide sind Ergebnis eines Prozesses. In seinem Modell entsteht Fortschritt durch eine Serie von Kopien, deren Schnittpunkte weitere Objekte, Begrif-fe und Verbindungen hervorbringen. Eine Erfindung ist somit Produkt von unterschied-lichen Wiederholungen, beliebigen Pointierungen – intersubjektive Befriedigung. Weil Wissen kein zu vernutzendes Gut, der Bildungskuchen kein Schokokirschkuchen ist, der umso kleiner wird, je mehr ihn essen, ist Geiz nicht opportun.
Liebesentzug
Effektive Methoden der Verweigerung suchend, stolpern wir unvermeintlich über den Begriff des »Liebesentzugs«. Im Unterschied zur Verweigerung bestimmter Dinge, Leistungen oder eines konformen Benehmens geht es hier um den Entzug einer kon-kreten, meist begehrten Emotion. Eingebettet in eine spezifische Beziehungsform steht die Drohung im Vordergrund. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, meist zum Zwecke der »guten Erziehung«, werden Verfehlungen mit dem Entzug der Liebe quittiert: Diese Form der Erpressung funktioniert schlechterdings nur, wenn ein Ungleichgewicht zwi-schen den Positionen vorliegt, wenn dem oder der vom Entzug Bedrohten keine oder nur wenige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sich seiner/ihrerseits dieser Drohung zu entziehen. Prominentestes Beispiel ist gewiss die Eltern-Kind-Beziehung: »Wenn du nicht tust wie ich will, liebe ich dich nicht mehr !« Erwünschtes Benehmen wird erzwun-gen, denn ein Kind verfügt nicht über die Freiheit zu entscheiden, ob es will oder nicht, es muss sich der Forderung unterwerfen, wenn es der dieser Drohung innewohnenden Vernichtung entrinnen will. Die Position des/der Drohenden scheint unerschütterlich und fern jedweder Einflussmöglichkeiten. Doch die wichtige Dimension dieses Erpres-sungsversuchs liegt in seiner spezifischen Bewegung, denn die Drohung des Liebesent-zugs ist bereits der Entzug der Liebe, Verkündung und Umsetzung werden im Moment der Rede ident.
Möglichkeitsverlust
Mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die von einem Verlust bestimmt ist, sei es der ei-nes geliebten Menschen durch Trennung oder Tod, der Verlust eines Objekts oder einer Hoffnung, wird der Welt gerne durch inneres Monologisieren oder Zerstreuungen ent-flohen. Jede und jeder kennt solche fiktiven Spielereien, die Geschichten und Hirnge-
22
spinste im eigenen Kopf. Verschiedenste Optionen werden durchgespielt, um sich den Gegebenheiten des konkreten Hier und Jetzt zu entziehen. »Wenn« ist der Schlüssel, der uns die ersehnte Fluchttür eröffnet.
Wie beim Ringen mit dem Gefühl des Kummers ist beispielsweise die Empfindung ei-nes chirurgisch entfernten Körperglieds (ein in der Philosophie gern zitiertes Beispiel) ein Verlust von Welt- und Lebensmöglichkeiten. Die Zweideutigkeit dieses Schmer-zes nennen wir »wissendes Nichtwissen«, ein trotziges Nichterkennenwollen. Ver-lieren zeitigt einen Prozess entsprechend dem Vergessen. Umgekehrt ist der Gewinn neuer Möglichkeiten zu vergleichen mit dem Erinnern, einem Prozess, in dem sich der Körper und mit ihm gleichzeitig die Möglichkeiten in der Welt modifizieren. Wie beim Kummer müssen wir uns mit den Verlusten konfrontieren, wenn dies nicht geleistet wird, bleiben die existierenden Möglichkeiten blockiert. Es ist ein exzeptionelles Im-Moment-Sein, welches nicht vergehen soll, ein Leben in einer vorgestellten Welt, die es in dieser Weise nicht mehr gibt. »These foolish things remind me of you«, summt der/die Schwermütige, trübsinnig beim Biertrinken. Die Existenz in der ersten Person for-miert sich im Weiterleben, ohne den Erfordernissen der Jetztzeit zu begegnen. Sich die-sem Resignieren hinsichtlich der Über- oder Unterforderungen der Welt zu entziehen, der Wunsch – diese Überlegungen entsprechend der politischen Entwicklungen gewen-det – nicht so regiert werden zu wollen, ist folglich Motor unseres Begehrens. Wir wol-len nicht in den erprobten Gewissheiten Zuflucht suchen, sondern lieber den möglichen Zugewinn der Ungewissheiten riskieren.
Nepotismus
In den innigen, zur jeweiligen Unterstützung und Beförderung von FreundInnen be-triebenen Verbindungen wird dem schnöden Leistungsprinzip getrotzt. Ein Kollektiv ist ungemein hilfreich, wenn es um die Verteilung von Gutscheinen, Eintrittsbons oder Empfehlungen geht. In der Gruppe werden Beziehungen gelebt, die vielseitige Funkti-onen erfüllen und Gelingen ermöglichen. Ein bedeutendes Ensemble bildete Bloomsbu-ry. Ein Gefüge, in dem zwei Schwestern eheliche und weitere liebevolle Verbindungen knüpften. Die Stephens und ihre GenossInnen suchten sich von den Fesseln ihrer gut-bürgerlichen Erziehung zu befreien, nutzten den ererbten Reichtum und bildeten ein Verweissystem, dessen Werke die britische Kunst- und Kulturszene wesentlich berei-cherten. Geschriebenes wurde selbst gedruckt, illustriert, kunstvoll gebunden und von FreundInnen rezensiert. Nebst einem »Room of One’s Own« wurde ökonomische Frei-
23
heit für intellektuelle Prozesse und weibliche Selbstbestimmung gefordert. Zugleich er-möglichten diese Gruppenbeziehungen sowie die kollektiv gefüllte Zeit die persönli-chen Erfolge und Entwicklungen: Wie sonst sollte die eigene Existenz befördert und verschönt werden, denn durch Klüngeln und Klönen ?
Ordnung (Schöner Wohnen, Schöner Sein)
Zwei Orte, die uns zur Ordnung nötigen: Die Wohnung und der eigene Leib, Domizile unseres Ichs. Beide wollen gereinigt, geschmückt, schön hergerichtet sein. Duftend und vom Dreck befreit funkeln sie wie StellvertreterInnen unserer Befindlichkeit. Ich öff-ne dir meine Wohnungstüre und du siehst in meine Seele. Wir bohnern die Böden, die Fensterscheiben blitzen in der Sonne, brüchige Möbel hüllen wir in feines Tuch, so wie uns selbst. Wir cremen, ölen und epilieren unseren Körper in hingebungsvoller Weise, die Wimpern sind getuscht, die feine Wolle des Körpers geschoren. Bloß nicht den Ein-druck erwecken, wir seien irgendwie heruntergekommen, wir ließen uns gehen. Schön-heit und ewige Jugend sind Systeme, deren Einflüssen wir uns nur schwer entziehen können. Jede Runzel unseres Gesichts wird skeptisch befühlt, jeder Hinweis getilgt. Euphemismen dieses Gebots existieren reichlich: Sich wohl fühlen im eigenen Körper/Heim, mit sich zufrieden sein und, die schlimmste Politur des Zweifels: Mit sich ins Reine kommen. Trugbilder der Hoffnung, der Erinnerung, des schönen Scheins: ein-drucksvolle Ruinen, die wir hegen und pflegen um zu vertuschen, wie endlich wir sind. Formen wir doch unsere Körper und Heime zu Deponien, sichern wir die Spuren, den unordentlichen Reichtum unsers eigenen Lebens und dokumentieren wir unser Zur-Neige-Gehen. Bloß nichts unter den Teppich kehren, nur beim Bier tolerieren wir ein Reinheitsgebot !
Perspektiven
Die Verweigerung erscheint uns wie eine übergroße Geste, ein rigides System mit strik-ten Regeln und nicht zuletzt: Nur sich selbst genügend. Wir bevorzugen die Beweg-lichkeit des Sich-Entziehens, um die der Verweigerung innewohnende Kompromiss-losigkeit zu meiden. Nicht mittun, wenn im Unterricht ein Plus fürs Notenbuch er-rungen werden könnte durch ein schnelles Bezeugen des eigenen Wissens und so den Leistungs- und Konkurrenzdruck im Schulsystem boykottieren: Ist dies bereits Ver-weigerung oder »nur« ein dem Moment entsprechender Selbstentzug ? Wem nützt die-
24
se Findigkeit bzw. wem nützt sie nicht, ist es nicht eher Selbstboykott ? Und: Wie ver-flüchtigungsresistent muss ein solches Unternehmen konzipiert werden, um kollektiv erfolgversprechend zu sein ? Wird es so zu einem beliebigen, nutzlosen Projekt, ohne wirkliches Ziel und ohne Konsequenzen ? Die Eröffnung neuer Möglichkeitsfelder soll-te keinen neuen Druck erzeugen, dies erschiene wenig produktiv, noch weniger lust-voll. Doch ohne irgendeine Form der Konsequenz, der Stetigkeit verlieren sich die Spu-ren im Nichts. Ein eitler Wunsch durch Vorbildwirkung zu überzeugen, zum Imitieren zu verführen ?
Es geht nicht um den Wunsch, unsterblich zu sein oder zu werden – wie steinerne Figuren mit Sockel vom Publikum beglotzt und verehrt –, sondern um eine effektive und – wenn möglich – bleibende Verbesserung oder zumindest Korrektur des Gegebe-nen. Doch selbst wenn diese Korrekturen nur vorübergehend sind, so sind sie immer-hin ein Beginn, eine Spur im Schnee, der noch weitere folgen oder die von weiteren fes-ter getreten werden können. Die Ungewissheit bleibt: Wie sind diese Vernetzungen herzustellen, wie ist ein Fluktuieren der Ideen und Visionen unter losen Menschen zu bewerkstelligen, wie können Bündnisse geschlossen werden, die für den Moment, die Sekunde Gültigkeit gewinnen, ohne mit klebrigen Verbindlichkeiten zu hemmen, ohne durch intellektuelle Kettenlegung den freien Fluss zu behindern ?
Queer
Weswegen sollten wir der dichotomen Ordnung folgen (wollen) ? Die Subjekte und Ob-jekte unserer Begierde in mögliche und verbotene einteilen ? Unser Selbst zu einem ge-schlossenen Bild formen, in ein Mieder zwingen oder doch in eine Rüstung, deren Nut-zen vielleicht in der Sicherheit des Überkommenen liegt ? Dem Unglück ob seiner Ge-wissheit den Vorzug geben ? Wer kennt sein/ihr genetisches Geschlecht und versieht die Kreuzung von X- und Y-Chromosomen mit Gewicht ?
Besser dem herrschenden Sexismus, der Hoffnung in die simple Ordnung der Din-ge und Bedeutungen mit Subversion begegnen und eine politische Fehde führen, mit Quoten und Diskriminierungsverboten, nebst großzügigen Bußgeldern. Lieber die Un-eindeutigkeiten genießen und den Irrwegen folgen – wenige Episode genügen, um den schillernden Wechsel zu illustrieren:
Wenn Ben Sisko im Universum von DS 9 seinem Freund Curzon (geübter Trinker und Verführer) in neuer Symbiontenform begegnet, spricht er zugleich mit jener Per-son, die er vermisst und die nun Teil der jungen Pilotin und Forschungsoffizierin ge-
25
worden ist. Wirt und Erscheinungsbild des Trills sind different, doch im Wurm – dem solideren Teil der Zweierverbindung – bleiben die früheren Wesenseinheiten bestehen. Der Tod ist nicht mehr universell gültig, doch bleibt der Verlust um eine konkrete Ver-bindung und nicht zuletzt einen spezifischen Körper bestehen. J.D. verkörpert nun zu-gleich jede der früheren Persönlichkeiten und fügt diesen eine weitere hinzu. Sie ist per-sonifizierte Überwindung eines kongruenten Ichs, geschlossener Inszenierungen oder eines eindeutigen Begehrens.
Reproduktion
Sexuelle Verweigerung
Eine weitere Spielwiese zur Erprobung der eigenen Potenz (im ursprünglichsten Sin-ne) bieten die unendlichen Weiten des frisch bezogenen Doppelbetts. So eröffnet bei-spielsweise die »sexuelle Verweigerung« neue Dimensionen, die lustvoll eingesetzt wer-den könnten. Nicht völlig ironiefrei ermöglicht sie, zumindest fiktiv, einige witzige Op-tionen. Der Widerspruch erklingt sogleich: Ist dies kein Schuss ins Knie ? Hmmm. Ein kleines Beispiel, den Einfluss der kollektiven Verweigerung des Eros illustrierend: Ein griechisches Eheweib, nennen wir sie Lys, ist Titel und Heldin einer Komödie der hel-lenistischen Zeit. Seit gut zwanzig Erdumdrehungen tobt der Peloponnesische Krieg.
26
Vor diesem Hintergrund mobilisiert unsere Heldin die Griechinnen beider Seiten zum generellen Ehestreik, bis die Geehelichten den Krieg endlich beenden, denn die Grie-chinnen sind es müde und leid die Verletzten und Verwundeten pflegen und heilen zu müssen, vom Sterben der Geliebten völlig zu schweigen. Den Werbungen und Hinder-nissen zum Trotz stehen sie ihren selbst bestimmten sexuellen Entzug durch und den Kriegern, im Schwindel ihrer unendlicher Erregung und Begehrlichkeit ist es schlicht unmöglich, einen vernünftigen Krieg zu führen (Selbstbefriedigung schien keine Op-tion). Die Streikenden erreichen ihr Ziel durch die kollektive Geschlossenheit, wie es bei jedem Streik von Bedeutung ist. Der schwule Comiczeichner König überzeichnete diese Geschichte und begründete in seiner Deutung den Erfolg des Kriegsendes durch eine weitere Finte der empörten Krieger. Der Streikenden Spiel verkehrend entwickel-ten sie die Not zur Tugend, in dem sie es sich (zuerst nur dem Befehl des Heeresfüh-rers folgend) gegenseitig doch nicht weniger befriedigend besorgten. Diese Option in den eigenen Reihen eröffnete jedoch der Krieger Blick- wie Möglichkeitsfeld, mit weit-reichenden Konsequenzen. Den Griechinnen entglitt ihre eigene List wie Lust, doch immerhin: ihr Ziel der Kriegbeendigung erreichten sie, denn sich gegenseitig vögelnde Krieger führen keinen Krieg.6
Trotziges Schweigen
Eine beliebte Form der Verweigerung findet sich nicht selten in Liebesbeziehungen und dient, wie der Liebesentzug, der Festigung der eigenen Überlegenheit. Der erreg-ten Rede, der wütenden Forderung oder den zornigen Beschuldigungen mit gleich-gültigem Blick zu begegnen, die Lippen fest geschlossen, steigert die Wut des Gegen-übers ins schier Unermessliche, ihm/ihr droht der Kontrollverlust. Wieder spielt die Selbstbeherrschung die entscheidende Rolle: Sich keine Blöße zu geben, schützt die ei-gene, schon beleidigte Hülle vor weiteren Verletzungen bei gleichzeitiger Steigerung der Verletzlichkeit des Gegenübers. Eine sehr geschlechtsspezifische Deutung stiftet hier überdies Verwirrung: So klingen uns die Verse eines volkstümlichen Liedes im Ohr (bemerkenswerterweise von einer Interpretin und nicht von einem Interpreten ge-sungen), in welchem die besondere Weise, die Liebe zu zeigen, im Schweigen liege. So heißt es: »Worte zerstören, wo sie nicht hingehören.« Die Furcht, im Zweifel ein Wort zu viel zu verlieren, setzt diese scheint’s mit Gold gleich.7 Mitunter führt jedoch des/der einen Schweigen zum trotzigen Schweigen des/der Beschwiegenen. Zwei stummen Fi-schen gleich glotzen sich die beiden entgegen, wenn Worte nicht mehr zirkulieren, nis-
6 Wenngleich wir leider nicht schlussfolgern dürfen, schwule Krieger seien keine Krieger. Selbst weibliche Kriegerinnen sind immer noch Kriegerinnen, ebenso wie weibliche Priesterinnen immer noch Priesterinnen sind. Nicht jeden historisch verwehrten Bereich gilt es im Ringen um Gleichstellung zu erobern.
7 Die (gerne von jugendlichen Schulkollegen ins Poesiebuch geschriebene) Redewendung »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold« unterstreicht diese geschlechtsspezifischen Vorstellungen recht deutlich. Wobei, hier weist uns eine Freundin zurecht, es liege ein entscheidender Unterschied im Schweigen-Wollen und Nicht-Reden-Können.
27
tet sich die Gleichgültigkeit gemütlich ein, Rückzug scheint die bessere Verteidigung. Der Rückzug ins Schweigen beflügelt bloß unsere inneren Überzeugungen, wir erin-nern uns einer kindlichen Ressource, welche doch nur unsere Hilflosigkeit und unsere Verletzungen widerspiegelt.
Unterbrechung
Im Unterschied zum risikolosen Schweigen erscheint uns folgender Kunstgriff reizvol-ler: Der Entzug der Worte durch Unterbrechung ist in Begegnungen mit Menschen, zu denen keine tiefere Beziehung besteht, meist nützlich. Hilfreich besonders in Momen-ten, in denen einem die Rede durch ihren Sinn zuwider wird. Eine nicht sonderlich höf-liche Intervention, doch wer will schon – beispielsweise zur Ohrenzeugin verhöhnen-der, sexistischer oder xenophober Meinungen genötigt – höflich sein ? Störung ist hier Gebot der Stunde ! Seit unserer Kindheit zur Höflichkeit erzogen, fehlt uns in entschei-denden Momenten mitunter der Mut, mit diesen Konventionen zu brechen. Wie schwer es ist, Übergriffe zu benennen oder ein schlichtes »Nein« bei geflüsterten Obszönitäten oder Gesten zu brüllen, zeugt von diesem Korsett der Freundlichkeiten. Die Furcht, sich bloßzustellen, zu vorschnell oder möglicherweise irrtümlich zu kontern, hemmt die Übungen in diesem Bereich. Nicht übertriebener Heldenmut soll hier beschworen werden (Feigheit ist mitunter eine ebenso nützliche wie hilfreiche Ressource, spezi-ell wenn es um den Schutz der körperlichen Unversehrtheit geht – Stichwort: Wegren-nen). So liegt doch in der Unhöflichkeit, der Unterbrechung der eigenen freundlichen Existenz ein nicht zu verkennendes Vermögen: Spöttische Ironie, die Worte im Mund verdrehen oder ihre Flut schlicht unterbinden: Ich will es nicht hören ! In letzter Konse-quenz: Sich umdrehen und gehen. Die Verweigerung von Höflichkeiten wird zur Res-source, die wir einsetzen können, um eine Rede, ein Benehmen nicht widerspruchslos hinnehmen zu müssen.
Viel zu viel
Erst ein Los erwerben, gewinnen und sofort reisen, ohne Ziel – zusehen, wie die Zeit vergeht. Selbstvergessen dem Meer und den Wellen zuhören, unbegrenzte Ferien in keiner bestimmten Gegend. Immer in Bewegung bleiben und doch nichts tun. Mu-sik und Geschichten hören und wieder gehen, lesen und schreiben. Diese Zeilen wie-der verwerfen. Bei einem großen Konzern beginnen, Teil der Führungsebene werden,
28
eine Stufenleiter des Erfolgs erklimmen, viel Geld verdienen, Segeln gehen, den Sohn und Erben eines betuchten Investors kennenlernen, eine vernünftige Ehe schließen und wieder lösen. Mühevolle Entwürfe beiseitelegen. Juristin sein, hin und wieder depres-siv, meist zynisch, die Scherze dezent geistreich, die Kleidung gediegen. Beweise be-kommen Bedeutung, die Denkgewohnheiten Struktur, die herkömmlichen Fertigkei-ten der Profession sind hinreichend geduldet und weitgehend erfüllt. Gelungene Skizze bescheidener Wünsche. Hin und wieder ein kosmisches Bild pinseln von unendlichen Weiten, neue Welten erforschen, ein neueres, wilderes Leben.
Wunsch
Ein Verzeichnis von Dingen, die wir uns wünschen, kein immer wieder bemühter Ver-such, den Begriff und seine Bedeutungskomponenten bei Deleuze und seinen Epigo-nInnen zu referieren. Die intellektuelle Wüste getrost den KünstlerInnen schenken, für eine Weile zumindest, bis die ungeduldige Suche neue Wörter kreiert, die nicht im-mer dieselben Überlegungen im Kreis treiben. Deswegen wollen wir gleich mit dem Sonnenschein beginnen, der fehlt hierorts zu oft. Strudel der jeweiligen Lieblingssor-te, Topfen zum Beispiel und endlich eine entscheidende Fehde gegen den Hunger in der Welt führen, dem Elend ein Ende setzen, um die Revolte zu beginnen. Kriege been-den, Leute befreien, die Unbelehrten und Feindseligen mit Golf und Konsum betören. Und zu guter Letzt wünscht ein Freund 24 Stunden nur für sich, jeweils zwischen dem Ende und dem Beginn der neuen Woche, um leichtsinnig zu sein, Zeit zu genießen, die ihm frei zur Verfügung steht. Und Postskriptum, weil die WG-Erhebung ein weiteres Ergebnis bringt: Reisende mögen glücklich zurückkehren, die Verliebtheit will gelebt werden, denn Leben lebt nicht (per se), wie Wiesengrund schon betonte.
XY-Chromosom
siehe Queer
Zu guter Letzt
Eine berühmte tschechische Schriftstellerin, Brieffreundin und nebenbei Geliebte des Schloss-Schreibers, formulierte einst bezüglich der lebensgeschichtlichen Erkenntnisse und Weisheiten, den viel gepriesenen, einsichtigen Quellen unseres zukünftigen Stre-
29
bens, dies seien doch nur Bremsen der Begeisterung, der Blick gen Ende schon zu Be-ginn. Dem »Es ist doch sinnlos« der Gleichmütigen hielt sie die Begeisterung der Jugend entgegen. Denn, so spinnen wir weiter, bedeutet die Verweigerung der Gleichgültigkeit schlussendlich den Dingen nicht immer die gleiche doch immer eine gewichtige Gültig-keit beizumessen. Wollen wir uns dem Nivellieren der zehnten Verliebtheit durch den wehmütigen Vergleich mit der ersten entziehen, dem mutlosen Resignieren ob des un-vermeidlichen Scheiterns, so eröffnet uns doch die ungebrochene Begeisterung von Be-gegnungen und Berührungen ein intensives Erleben jeder Verliebtheit, jeden Versuchs. Wir vergleichen und imitieren, gönnen uns ein Stück Unvernunft, ein irritierendes Ex-periment, dessen Lesegenuss dem Schreibprozess vielleicht korrespondiert. Freuds be-rühmte Tochter nimmt die Begeisterung ihrer ZuhörerInnen im Schreiben ihrer Re-den schon vorweg, um im Glücksgefühl des Jubels ihre Texte zu fertigen. Wir sind uns selbst beileibe nicht genug, setzten gegen die Möglichkeit des Resignierens und des Ernstes Humboldt’scher Sitten einen kursorischen Blick, poetische Eklektizismen, viel Vergnügen !8
8 Die Grenzen des Schreibexperiments sind erreicht, wenn für konkret zu Benennendes keine Synonyme existieren, keine Umschreibungen mehr gefunden werden können. Die mitunter kryptischen Verschlingungen und Wendungen des Textes sind unserem simplen Versuch geschuldet, uns der Verwendung eines bestimmten Zeichens unserer Schrift zu entziehen, hier konkret dem a.
31
Das häusliche LebenEine Erzählungvon Holger Schulze
Ich habe vierzig Tage lang meine täglichen Handlungen aufgezeichnet. IhreErzählung zeigt weder besonders Ruhmreiches noch Schmähenswertes. Dertägliche Fluss aus Handlungen und Empfindungen bewegt sich in einemmittleren Maß. Zum Abdruck in dieser Zeitschrift habe ich fünfundzwanzigTage ausgewählt.
Eine Schale Pasta, Pesto, Parmiggiano. Die Festplatte meines Rechners konnte dieser nicht mehr auffinden, ich füllte gut gelagerten, schaumigen Weißwein in ein Glas, eine kleine, entblätterte Physalisfrucht gab ich hinzu und sprach: Es lebe die internationale Solidarität ! Frühjahrserzählung. Später beim Abräumen des Tisches fiel mir das Glas vornüber vom Tablett. Ich schrieb meiner Frau eine Liebeserklärung als Kurzmittei-lung aus unser beider liebsten Kaffeehaus. Hellsichtige Weichheit. Meine Liebe zum Grundwortschatz in abgewogenen Satzfolgen erneuerte sich in gleichem Maße. Die Sprache der Handschrift, Rechnersprache. Häuslichkeit. Wie lange lebte ich schon ? Wie lange würde ich noch leben ? Ich genoss die momentane Haltlosigkeit dieses Ta-ges, dieses Nachmittages (obwohl mein Leben wohl noch nie so gehalten worden war von Beruf, Haus, Freunden, Liebe wie derzeit). Gegenwart und Mitsein. Ich erinner-te mich an den Morgen nach meinem ersten Selbstmord am vierundzwanzigsten März Neunzehnhundertneunzig, den Sonntagmorgen danach. Mein Atem, fiel mir auf, lief so ruhig und gleichmäßig dahin, als wäre ich eingeschlafen. Lebte ich das Leben eines Penners ? Natürlich schlief ich jede Nacht in unser beider geteiltem Bett. Ich ging vie-le Tage in ein Gebäude, in dem ich regelmäßig durch Gespräche und Reden mit ande-ren Menschen, durch Erzählungen und Ansprachen, die ich für sie schrieb und die die vorgesehenen Folgen zeitigten, durch all dies eine Art von Arbeit verrichtete, die mit
1.
32
Währungseinheiten entgolten und auf mein Konto überwiesen werden konnten. Ich be-gegnete Menschen als Verhandlungsführern in Momenten, die als Termine galten und im eigenen Haus, einem Büro, Café, in eigens dafür hergerichteten Konferenzräumen oder auch in ausschließlich per Flugzeug erreichbaren Städten abgehalten wurden. Ich ging täglich oft die gleichen Wege durch diese Stadt. Diesen Ort verlassen, hier und jetzt streunte und vertändelte ich diesen ganzen Tag. Kaufte für eine Währungseinheit eine Erzählung aus dem Jahr Neunzehnhundertundneunzig auf vierundfünfzig eng be-druckten Seiten. Bevor ich mich in Ruhe bettete und schrieb. Die sieben Gesichter auf dem Titelblatt der Illustrierten, die die Geschehnisse dieser Stadt als Programm abbil-dete, die Gesichter, die besondere Persönlichkeiten, Filmschauspielerinnen darstellen sollten, sie schienen mir allesamt vollkommen gleich. Die billigen Dinge, die als Produk-te in den Auslagen der Geschäfte lagen, die Menschen, arme, junge Mädchen und Jun-gen, die inmitten billiger Möbel in diesen Geschäften zu stehen hatten und Tastaturen bedienten und auf Bildschirme schauten, sie schienen nicht mich zu meinen. Mein Kopf öffnete sich, so fühlte es sich an. Er wurde ganz weit und umso enger erschien mir die Welt um mich herum. Die Worte und die Stoffe, die Dinge und ihre Farben, die Bewe-gungen und ihre Formen, meine Selbsteinschätzungen und Eigenschaften, meine Bezie-hungen zu Menschen und Gegenständen und Gewohnheiten: alles dies bewegte sich auf wohltuend erleichternde Weise voneinander weg. Die Weite und Endlosigkeit der Welt und der Möglichkeiten des Handelns und Lebens drangen tief in meinen Körper ein. Ich umfasste mehrere Zeitzonen und Dimensionen, lokale Haufen und pulsierende Singu-laritäten. Den Abend verbrachte ich lesend in drei Büchern: in einem Gesellschaftsro-man des neunzehnten Jahrhunderts, dem fünften (nach Zählung ihres Autors, Hono-ré de Balzac); einer gedankenvollen Erzählung des ausgehenden zwanzigsten Jahrhun-derts sowie in einer Zeitschrift von Aufsätzen zur gegenwärtigen politischen Lage des Frühjahrs Zweitausendundacht. Ein längst verstorbener Pianist spielte Sonaten aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Ich knabberte an verschieden salzigem Reisgebäck, das Geschäftspartner eines Unternehmens von der anderen Seite der Erd-kugel nach ihrem Besuch in unseren Räumen zurückgelassen hatten. Mein Leben ist ein seltsamer Traum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir wünschen will, daraus aufzuwa-chen oder ob ich mir wünschen soll, niemals wieder daraus aufzuwachen.
Am Morgen, nach dem Aufwachen, brauchten mein Blut und all die Körpersäfte einige Zeit bedachten Ruhens, um wieder herabzukochen. Zum ruhigen Atem des Tages. In den Straßen, durch die ich täglich, teils mehrmals, ging, sah ich die Gebäude am Rande
2.
33
als vollkommen fremde an. Ich schloss mich für eine Zeit auf einer öffentlichen Toilette ein. Um die Sätze dieser Erzählung weiter zu bedenken. Später, im Gebäude der Arbeit, erhöhte mein Blutdruck sich kurzzeitig wieder für etwa sechzig Minuten. Ich hatte den Schriftsatz einer Angestellten lesen müssen, deren Bekundungen drohten, die gemein-samen Vorbereitungen, die unser Haus seit Monaten mit aller Anstrengung getroffen hatte, handstreichartig zunichte zu machen. Ich saß beim Mittagessen, freitags gab es Fisch, als mein Puls und mein Atem wieder merklich zur Ruhe kommen konnten. Ich las weiter im fünften Gesellschaftsroman des neunzehnten Jahrhunderts. Ich schwitzte und schwitzte, rannte und rannte. Die Hitze stieg mir immer mehr zu Kopf, so sehr, bis sie in vollkommene Kühle umschlug. Später im Dampfbad kam ich zu mir. Mit meiner Frau und ihrer Schwester lag ich in Ruhe. Langsam entließ mich mein Bewusstsein.
Der Herrenschneider empfing mich achtsam, über eine Stunde lang sorgte er sich um mich. Es wurde warm. Die neuen Kleider wollten mir mein Leben für dieses Jahr wo-möglich in einen anderen Schnitt fassen. Ich ließ mich rahmen. Alle Worte, Bilder und Klänge hatte mein Rechner indes wieder aufgefunden – wenn auch in einem anderen, neuen Körper. Ich übertrug sie zur Sicherheit auf einen großen, neuen und weiteren, über zehn Mal so großen Körper. Nach dem Besuch eines gezeichneten Spielfilmes über die jüngere iranische Geschichte am Abend, stritt ich in einer nahegelegenen Bar mit ei-ner guten alten Freundin über die propagandistische oder nicht propagandistische Stel-lungnahme eines weltbekannten Urheberrechtsanwaltes für die Wahl des schwarzafri-kanischen Präsidentschaftskandidaten. Ihre Streitbarkeit in dieser Angelegenheit über-raschte mich. Meine Frau schlief allmählich dabei ein. Meine eigene Streitbarkeit hatte sich zuvor schon in einer Auseinandersetzung über Wert oder akademische Ablehnung von Nähe und Intensität gezeigt. Vielleicht lag mir auch nur meine neue Hose zu deut-lich eng geschnürt um den Bauch. Wir fielen ins Bett.
Mitten in der Nacht war ich aufgewacht und empfand einen unstillbaren Hass – ge-gen wen ? Ich wollte aufstehen und einen Menschen mit meinen eigenen Händen töten. Dann schlief ich wieder ein. Nach dem Aufwachen, wieder hocherhitzt (meine Frau ar-beitete im Nebenzimmer), fühlte ich mich wie ein zartes, rissiges und leicht anrührba-res Häutchen, in die Welt hinein gespannt. Alle Sätze, Bilder und Klänge hatten sich über Nacht in Sicherheit gebracht. Die Getränke des letzten Abends hingen mir noch in den Muskeln. Nach dem Vortrag am Morgen des japanisch-hanseatischen Künstlers an der Westküste gingen wir durch den Park. Ein Paar ging mit uns, das Führungskräf-
3.
4.
34
te beriet, ihr kleiner Terrier voraus. Die Sonne verschwand rotglühend. Ich hatte das starke Bedürfnis, jede Ansprache und Anforderung, die mir gegenübertrat, umgehend abzulehnen. Ich wollte alle Gegebenheiten dieses derzeitigen Lebens verlassen. Lebt wohl ! Lebt wohl. Ich glaubte zu spüren, wie das Leben endet. Nicht einmal der durch-aus anregende Gegenstand, über den ich in etwa einem Monat in München vorzutra-gen eingeladen war, nicht einmal dieser konnte mich bewegen. Ich hörte Musik aus dem vierzehnten Jahrhundert. Der Heilbutt am Abend brachte mich wieder zu mir.
Am späteren Morgen sah ich die Nachrichten und Botschaften, die Mitteilungen und Schriftsätze durch, die für mich bestimmt waren. Nichts konnte mich dazu bewegen, Gedanken zu notieren, die beruflich nutzbar gewesen wären. Ich lauschte wieder Musik des vierzehnten Jahrhunderts, aus dem Codex Faenza. Später sprach ich über Schrift-sätze und Gespräche, die morgen zu erstellen und zu führen sein würden. Der Tag neig-te sich. Ich ging also hinaus, um zu laufen und zu schwitzen. Auf dem Weg schien es mir, als wären alle Gewohnheiten des täglichen Lebens nichts als Weisen, das Leben zu ver-meiden. Ich glaubte, dass alle Menschen in meinem Gesicht in einen Abgrund aus Lee-re und Enttäuschung blicken mussten. Der Puls schlug mir heiß in den Kopf. Wenn ein fremder Mensch mich anblickte, wandten sich meine Augäpfel nach unten hin weg. In der Hitze aber kam mein Körper wieder zu mir. Ich mied die Nähe von Menschen, die in kleinen Gruppen sich lebhaft austauschten. Ich fürchtete, in unliebsame Erwartun-gen und Pflichten verstrickt zu werden. Ich überlegte, welche Überschrift diese Auf-zeichnungen hier am Ende tragen sollten. Häuslichkeit, wie ich sie anfangs genannt hat-te ? Hausgeister ? Das häusliche Leben ? Die Bewegung der Empfindung, noch einmal ? Oder Empfindungsgenauigkeit ? Philosophie der Empfindung ? Ästhetik des Domesti-schen (zu angestrengt) ? Das Maß meiner Schritte hatte sich so sehr verlangsamt, dass selbst ich schon eine tiefsitzende Trauer und Enttäuschung vom Leben daraus abzule-sen meinte. Zur Nacht aß ich ein Brot mit Fleisch, das gegrillt und scharf gewürzt war. Ein weiterer Tag lag hinter mir.
Ich bemerkte, wie Vertragsverhältnisse die persönlichen Beziehungen zerstören. Es könnte sein, dass ich ausgerechnet in dem Jahr, in dem ich mit einigen meiner Arbeiten den vielleicht größten Erfolg meines bisherigen Lebens vorweisen kann – am wenigs-ten noch Interesse, geschweige denn Lust an all diesen Tätigkeiten und dem Leben da-rin mehr empfinde. Das Ende des Lebens ist der Anfang des Sterbens. Ich fragte mich, ob ich schlicht zu faul geworden war, um Selbstmord zu begehen ? Das Gespräch mit
5.
9.
36
dem befreundeten Künstler und Musiker bestärkte mich eher in all diesen Überlegun-gen. Die Feier in der Bar am späteren Abend geleitete mich durch vergorene und destil-lierte Getränke in andere, eher förderliche Wahrnehmungen.
Früh am Morgen erwachte ich, hörte Musik und schrieb. Ich aß eine Kleinigkeit und be-gann einige Telefonate und Schriftsätze, deren Adressaten in verschiedenen Zeitzonen sich aufhielten. Ich freute mich an der Kunstfertigkeit, ein gewohnheitsmäßiges, aufre-gungsloses Leben als Arbeit erscheinen zu lassen. Sollte ich mein Leben ändern ? Oder doch besser weiter an Verdorbenem mich abmühen ? Ich lauschte der Musik aus dem vierzehnten Jahrhundert. Ich las weiter im sechsten Gesellschaftsroman des neunzehn-ten Jahrhunderts. Einen Sinn in meinem Leben versuchte ich darin zu finden. Nach dem Schwitzen und Laufen am Abend lag ich endlich in Ruhe. Es schien mir, dass ich wohl ein neues Ziel in meinem Leben bräuchte. Konnte es sein, dass nach gut zwei Jahren re-gelmäßigen und ausdauernden Laufens und Schwitzens und Gewichtehebens mein Kör-per sich zunehmend tiefgreifend und grundlegend zu wandeln schien ? Vor dem Schla-fengehen sah ich eine gut fünf bis zehn Jahre alte Folge der amerikanischen Fernsehserie über eine Gruppe von Freunden, die im New Yorker Stadtteil Manhattan miteinander zu tun haben.
Ich wachte auf und hörte, wie die Straße vor unserem Haus aufgesägt und parkende Wa-gen umgesetzt wurden. Ich aß einige scharf gewürzte, japanische Rohfischrollen. Die Auskühlung meines Körpers versuchte ich abzuwehren, den Husten und den Schleim in der Nase. Die früh gealterten jungen Männer am Nebentisch sprachen über die Ge-staltung elektronisch zugänglicher Ladengeschäfte. An anderen Tischen sprachen sie zueinander in geschäftlich gelernten Weltsprachen. Später, in einem Kaffeehaus um die Ecke, drückte das junge Mädchen stolz und strebsam ihren Rücken durch, nachdem sie einen Kapuzinerkaffee bestellt hatte. Ich schrieb an einigen Schriftsätzen und führte einige Ferngespräche, sandte elektronische Briefe in die Welt. Ich hörte Jazz und Folk aus dem frühen einundzwanzigsten Jahrhundert. Dann nahm ich ein heißes Bad, legte mich schlafen und freute mich auf meine Frau, die in wenigen Stunden von ihrer kleinen Reise zurückkommen würde.
Ich spürte noch ihre Lippen auf den meinen. Langsam und tranig glitt ich in diesen Tag. Der Hausbesorger schaute um die Mittagszeit nach den Wasserflecken und den mittler-weile schwerer schließenden Türen. Ich genoss in meinem Stammkaffeehaus das An-
13.
14.
12.
37
branden und Davonrollen der vielen bewegten Gespräche um mich herum. Die Men-schen, einige davon, erkannten mich wieder. Ich war froh, dass eine weitere Annähe-rung seit Jahren noch vor der Vorstellung der eigenen Person halt gemacht hatte. Das Glück, namenlos zu bleiben. Die Luft in den Straßen war eisenweich wie an den Tagen spät im Jahr, wenn der noch heiße Sommer unversehens kippt in eisig kalten Winter. Unaufhörlich musste ich husten. Vor der Filmvorführung saßen wir in einem der mit Sicherheit hässlichsten, da raumgespürlosesten Gasthäuser der Stadt. Während des Fil-mes bemerkte ich, wie sehr alle Menschen und Menschengruppen, deren Handeln ei-nen tief überzeugten und nicht widerlegbaren Glauben zeigten, eine panische und tiefe Angst um mein Leben mir beibrachten.
Am späteren Nachmittag, der mir fast schon wie ein früher Abend schien, schlenderte ich durch die Straßen. Ich kam mir vor wie ein Obdachloser. Allein, da ich ohne beson-dere Absicht – vor allem keine Konsum- oder Kaufabsicht – durch diese Stadt ging.
Ich war mit der befreundeten Kuratorin und Kunstkritikerin durch zwei Ausstellun-gen gegangen. Am Nachmittag war meine Frau zu einer Tagung im Nordwesten dieser großen Halbinsel gereist. Unsere Liebe und unser Leben waren seit Monaten nun schon derart befriedigend, vertraut und im Regelmaß wie vielleicht nie zuvor in meinem Le-ben. Und doch dachte ich über das Alleinsein nach, traurig. Ich freute mich auf den fol-genden, vollkommen ungeordneten Tag ohne jede Ansprache und Erwartung. Bevor ich zu Bett ging, sah ich Fratzen hinter den Fenstern hinaus auf die Straße.
Ich las und aß und schlief. Ich tauschte wenige Kurznachrichten sowie Worte in Fernge-sprächen. Hustend. Abends sah ich einen Endzeitfilm.
Ich schrieb. Später am Morgen schaute der Hausbesorger noch einmal vorbei, während ich einige Ferngespräche führte und Kurzmitteilungen tauschte. Mittags nahm ich Pas-ta, Sardellen und Pesto zu mir. Am Nachmittag hingen dunkelgraue Wolken über der Stadt. Ich wollte hinausgehen, um die bildende und Körperkünstlerin zu treffen. Das Kleidungsstück, das ich glaubte vor über zwei Wochen verloren zu haben, fand ich beim Ankleiden wieder. Die Sonne stach grell über die Landschaft. Ich setzte meine Sonnen-brille auf und freute mich. Wir sahen uns Kunstwerke der letzten vier Jahrzehnte an. Wir sprachen darüber, wie wir zu ihren Urhebern standen und wie wir unsere Tage ver-brachten. Später saßen wir im angrenzenden Kaffeehaus. Aus den Lautsprechern sang
15.
17.
18.
21.
39
die derzeit beliebte Engländerin, bleich vor Erlösungssehnsucht. Lächelnd ging ich zum Laufen und Schwitzen am Abend. Ich überlegte, wie ich diese Erzählung besser ord-nen und anders erzählen könnte. Konnten die Tagesunterteilungen wegfallen ? Oder mussten die Tage genauer benannt werden ? Konnten diese Handlungen in eine ferne-re Vergangenheit versetzt werden ? Sollte womöglich eine wohltuend dahinfließende Erzählung hieraus werden ? Ich dachte an eine kleine Vorbemerkung, die sagte, was es hiermit auf sich haben sollte. Ich nannte diese Erzählung »Der mittlere Fluss«. Ich be-merkte nach dem Schwitzen wie mir eine Kraft zuströmte. Ich erkannte, dass ich we-nigstens noch drei Jahrzehnte lang tätig sein würde. Wenn mein Leben glückte, konnte ich womöglich noch bis zu sechs Jahrzehnte in der einen oder anderen, selbst gewählten Weise, tätig sein. Eine weite Sicht tat sich vor mir auf. Ein lang andauernder Hallraum. Kraft, Lust, Freude und Genuss. Ich beschloss, mich von nun an seltener den bewegten Bildtonströmen tatenlos hingeben zu wollen. Ich hörte eine Reihe von Liedern, die mir mein bester Freund zusammengestellt hatte, als ich dies hier aufschrieb.
Einen ganzen Tag lang hatte ich Gespräche geführt, teils fernmündlich sowie Kurz-mitteilungen und Schriftsätze ausgefertigt. Früh am Abend saß ich mit einer Ausstel-lungs- und Projektemacherin zusammen. Sie hatte Geschichte der Kunst studiert. Wir sprachen und schrieben uns schon einige Zeit zur Fertigstellung einer Aufsatzsamm-lung. Nun erläuterte ich ihr die Möglichkeiten eines größer angelegten, gemeinsamen Tuns. Ich erzählte ihr von meinem Vortrag in München, an dem ich täglich schrieb, auch über den Vortrag des japanisch-hanseatischen Künstlers an der Westküste dieser Stadt vor über zwei Wochen. Ich fühlte mich belebt. Später traf ich eine weitere Projektema-cherin und Forscherin. Sie hatte Literatur studiert. Sie erzählte mir von ihren letzten, höchst erschöpfenden Tagen des Schreibens an Schriftsätzen zur Beantragung einer Unterstützung durch einerseits die österreichische, andererseits die deutsche Republik für fünf höherbildende Lehrstätten auf zwei, durch ein großes Meer getrennten Land-massen. Ich zog mich aus und schlief ein über dem Schreiben dieser Zeilen.
Kaum aufgewacht, noch mit rauhem Hals, raunte mir eine Stimme innen zu: Folge dem Impuls ! Ich tat’s, ich wollte’s tun und war doch überrascht über mich. Beim Zubereiten des Morgengerichts lauschte ich auf das kehlige Simmern der Therme. Ich nannte diese Erzählung »Das häusliche Leben«. Kurz schrieb ich weiter an meinem Vortrag für Mün-chen in gut einer Woche und dachte: Ich bin heilig. Am späteren Nachmittag freute ich mich auf die Rückkehr meiner Frau. Abends gingen wir zum Wiedervereinigungskon-
22.
23.
40
zert einer Ska-Band dieser Stadt. Meine Frau hatte den Bassisten der Band für längere Zeit immer mal wieder näher gekannt. Eine Sorglosigkeit bemächtigte sich meiner. Ich las in einem weiteren, den siebten Gesellschaftsroman des neunzehnten Jahrhunderts von Balzac und hörte elektronische Musik des Duos aus Rochdale. Es regnete ein wenig. Der Auftritt der Gruppe mit zwei Gitarristen, zwei Sängern und vier Bläsern begann kurz vor Mitternacht. Nach zwei Stunden waren alle Zugaben gespielt. Alte Freunde, die sich zuletzt vor zwölf Jahren beim letzten Auftritt gesehen hatten, begrüßten ein-ander. Sie wollten von sich erzählen. Meine Frau sollte bleiben. Ich ging nach einer wei-teren halben Stunde. Die Schwester meiner Frau hatte ein gutes Gespräch begonnen mit einem angenehmen jungen Mann. Die Untergrundbahn war voll von Menschen aller Launen und widerstreitender Wege. Der Regen dauerte an. Ein Sturm kam auf.Der zweite Monat dieses Jahres war vorüber. Ich glaubte langsam, der Lauf dieses Jah-res wäre einer der bislang schnellsten.Wir saßen, lasen und aßen. Dann standen wir auf. Wir kauften ein. Wir liebten uns, aßen zu Abend und sangen kurz darauf in einem nahe gelegenen Stadtviertel bei nahezu allen Liedern aus vollem Hals mit, die eine junge deutsche Band im Festsaal dort spielte. Es regnete und stürmte noch.
Der Tag entrollte sich auf unvorhergesehen weiche und stimmige Weise. Wir liebten uns. Wir aßen und lasen und schrieben. Wir kochten und schwitzten, wir gingen zu Bett.
Ich genoss die Stille, die herrschte, seit eine Beunruhigung durch anders getaktete Bild-tonströme hier Tag für Tag ausblieb. Ich beendete meinen Vortrag für München, genau-er: das nahe gelegene Kloster, in dem die Tagung einiger Gesellschaftswissenschaftler stattfinden sollte. Nach dem Essen und einem Kaffee liebten wir uns. Ich sah einige jün-gere Untersuchungen durch, fertigte ein paar Schriftsätze an und sandte einige Kurz-mitteilungen in die Welt. Abends sprach ich mit einem älteren und nicht nur darum er-fahrenen Mitarbeiter. Auf dem Weg dahin überlegte ich, meine öffentlichen Notizen des kommenden Monats unter die Überschrift »Une Agence de la Décristallisation« zu stellen. Ich fuhr dann direkt zurück in unser Haus.
Ich entleerte ausgiebig meinen Darm während die Seiten meines Vortrags für München gedruckt wurden. Ich aß auswärts zu Mittag, kaufte ein Geschenk für meine Familie, ein frisch erschienenes Buch, und traf einen möglichen Mitarbeiter eines unserer nächsten Vorhaben in meinem liebsten Kaffeehaus. Fahrzeuge, die in dieser Stadt gewohnheits-mäßig alle Orte miteinander verbanden, fuhren heute nicht. Ihre Fahrer und alle, die an
25.
26.
28.
41
30.
ihren Fahrten beteiligt waren, arbeiteten nicht, um gegen ihre ausdrücklich zu niedrige Bezahlung ihren Widerstand kundzutun. Zuhause begrüßte ich meine Frau, setzte die-se Aufzeichnungen fort und bereitete meine morgige Abreise vor. Abends schwitzte ich. Ich spürte, wie die Grenze meines Körpers sich deutlich nach außen verschoben hatte. Sie lag nun eindeutig etwa einen oder mehrere Finger breit weit weg von mir.
Am Morgen fuhren wir in das nahe gelegene Kloster, in dem die Tagung stattfinden soll-te. Auf dem Weg dahin machten wir halt zu einem beruflichen Gespräch meines Be-kannten in einer mittelkleinen Stadt, die um ein Münster herum erbaut worden war, Ulm. In der Zeitung las ich vom Tode eines der Pioniere und zugleich auch Skeptikers der rechnerischen Welt, Joseph Weizenbaum. Ich war erleichtert. Ich fragte mich, wes-halb ich eigentlich erleichtert war ? Mir schien, als könne sein Tod ein Anzeichen sein für eine schwindende Sucht, sich rauschhaft und verkrampft um technische Neuerun-gen rechnerischer Umsetzung und Darbietung nur noch zu kümmern. Das schien mir arm. Ich schaute zum Fenster hinaus und genoss die Sonne und das Getränk vor mir. Gedankenrhythmen in Rückenmark und Kranium.Wir fuhren weiter. In der Gegend rund um das Kloster lag mehr und mehr Schnee. Der erste Vortrag eines Gesellschafts-wissenschaftlers regte das Gespräch an zum ersten Einstieg. Der Husten, der von mei-ner Erkältung vor ein, zwei Wochen noch geblieben war, unterbrach mir unangenehm die ruhige Aufmerksamkeit auf den Vortragenden. Der zweite Vortrag eines Unterneh-mers und bedachten Lebensmittelhändlers führte das Gespräch in die Tiefe und Breite bestimmter Beispiele. Am Abend aßen, tranken und sprachen wir weiterhin, vielfältig und immer rauschhafter, entgrenzend. Trunken lag ich im Bett.
Am Morgen hielt ich meinen Vortrag über den japanisch-hanseatischen Künstler Jona-than Meese. Der Widerhall bei den Teilnehmern der Tagung war angenehm und anre-gend. Gemeinsam schauten wir uns die Gebets- und Festtagsräume des Klosters an und aßen im Kloster zu Mittag. Nach einer Fahrt im Wagen meines Bekannten saß ich wie-der im Zug und fuhr nach Norden zurück. Ich schrieb weiter an dieser Erzählung. Ich las und hörte Musik.
Lange Zeit brauchte ich, um den Tag beginnen zu lassen. Ich las viel, notierte noch mehr, konnte erst spät die letzten drei Tage hier nachtragen. Nachmittags sprach ich mit mei-ner Kollegin. Am frühen Abend überarbeitete ich ein weiteres Mal die Schriftsätze ei-nes Antrages, der schon vor über einem Vierteljahr gestellt worden war. Danach las und
31.
36.
42
bewertete ich eine weitere Reihe von Abschlussarbeiten. Ich hörte Musik einer Gruppe von Musikern einer Hafenstadt im Südwesten Englands. Sie hatten ihre Lieder seit ei-nem Jahrzehnt nicht mehr gespielt – geschweige denn neue komponiert. Ich fragte mich wieder, wohin dies alles noch führen sollte, mein Leben. Hatte es einen Sinn für mich, all diese Dinge jeden Tag zu tun, die ich so tat und die ich hier sorgsam notierte ? Tat ich wirklich das, was ich am besten konnte und weshalb ich dieses Tätigkeitsfeld nach und nach angesteuert hatte ? Ich sah mir später einige Bildtonströme der nordamerika-nischen Musikerin und Handlungskünstlerin an, die ich einstmals so verehrt hatte. Mei-ne Frau schaute sich einen davon auch an, bevor wir ins Bett gingen. Ich fühlte mich, als rollte ich auf einer gezündeten Bombe durch die Welt. Die künftig mit Sicherheit, jeden Moment einmal, in die Luft fliegen und mich und alles, dies alles, zerreißen und zerstö-ren könnte. Ich las weiter im letzten Buch meines bevorzugten Romanschriftstellers.
Im Halbschlaf am frühen Morgen – wie ich das oft tue – fielen mir die angemessenen ein-führenden Worte ein, die ich bei einer Abschlussveranstaltung unserer Abteilung am Ende diesen Monats sagen sollte. Ich notierte sie gleich als erstes. Nach dem Frühstück setzte ich mich endlich wieder einmal an das Buch, das ich seit einigen, vielen Monaten schon schrieb. Mein viertes Buch. Ich schrieb und las und las weiter und wurde dabei immer glücklicher. Ich hörte ein Hörstück, das ein Kollege und guter Freund vor über einem halben Jahrzehnt gemeinsam mit mir zu einer Erzählung von mir hergestellt hat-te. Das Glück steigerte sich noch. Mittags, zum Verdauungsespresso, las ich wieder in einem weiteren, nunmehr dem achten Gesellschaftsroman des neunzehnten und lausch-te Musik des vierzehnten Jahrhunderts. Ich saß und lag an diesem Tag an verschiedenen Orten unseres Hauses. Es schien mir, als wollte ich die etlichen Stunden unterwegs in der vergangenen Woche ausgleichen durch ein möglichst ausdauerndes Verharren und Nichtbewegen. Spät in der Nacht sahen wir einen Bildtonstrom aus Paris, eine Feier der Andersartigkeit.
Am Morgen liebten wir uns, frühstückten, sie ging schnell zu einer Freundin, um ihr zur Hand zu gehen und hernach zu schwitzen; ich las noch einige weitere Abschlussarbei-ten und hatte Zahlen zu schreiben und Zahlen aus Papieren abzulesen und zusammen-zutragen, damit dieses Gemeinwesen die Summe angemessen berechnen konnte, die ich zu entrichten oder gar von ihm zurückzuerhalten hätte. Nach einigen Stunden ging ich wieder in mein Lieblingskaffeehaus. Ich trank, aß und las im neunten Gesellschaftsro-man des neunzehnten Jahrhunderts. Und dabei kam mir der Gedanke: Ich hätte nichts
37.
39.
43
zu bedauern, würde nun mein Leben enden. Das machte mich leichter. Beschwingt und angeregt schlenderte ich nachhause. Ich schrieb dort, fast rauschhaft, ein kleines Feuil-leton eben über diese Gesellschaftsromane des Honoré de Balzac. Schrieb auch an die-ser Erzählung; bevor wir zu dem Paar gingen, das Führungskräfte beriet, um gemein-sam zu speisen und einen Spielfilm zu sehen. Am Ende des Abends nahm ich mir vor, am kommenden Tag noch die letzten anstehenden Schriftsätze termingerecht anzufertigen sowie die anstehenden Ferngespräche zu absolvieren.
In der Stadt, in der ich studierte, fuhr ich auf einen höheren Berg mit einem öffentli-chen Verkehrsmittel; eine junge, schmale Frau fasste mich an der Hand, ich sollte sie lie-ben, als wir beide aufwachten. Meine Frau sprach über ihren Körper zu mir, ich hielt sie im Arm. Wir standen auf, Stunden früher als sonst. Die Angestellten des öffentlichen Dienstes hatten ihre Arbeit in dieser Stadt wieder aufgenommen. Wir aßen und lasen. Rund dreißig Kurzmitteilungen und Schriftsätze hatte ich dann am Ende des Morgens versandt sowie eine weitere Handvoll entworfen sowie an einer weiteren Handvoll wei-tergeschrieben. Ich saß und notierte weiterhin Zahlen und Namen für die Berechnung meines Anteils an den Ausgaben des Gemeinwesens. Der Spargel und die neuen Kartof-feln kochten schon in ihren Töpfen. Die Sonne schien, ich rechnete die letzten Zahlen zusammen und den gesamten Satz an Papieren und Listen steckte ich in einen großen, weißen Briefumschlag. Ich schrieb etliche weitere Kurzmitteilungen, vollendete einige Schriftsätze und konnte einige sogar aussenden an ihre seit langem bestimmten Emp-fänger. Ich hörte Lieder der Musikgruppe, die großstädtisches Singen und Spielen mit Überlieferungen afrikanischer Musik ganz anders verbinden wollten, Vampire Week-end. Ich hörte Lieder dieses alten amerikanischen Sängers Black Francis, der mit seinen Liedern und Tonwechseln die wohlständigere Welt schon vor über zwei Jahrzehnten erfrischt hatte. Ich ging in den Abend hinaus. Ich lief und hob und schwitzte und fühlte mich leichter und gespannter als noch zuvor. Fremd schaute ich am folgenden Morgen auf die Anlage, die sowohl elektrisch wie auch mechanisch die Gleisweichen zu schal-ten hatte.
40.
45
Kunst oder LebenBetty Paoli über Literatur und Entsagungvon Karin S. Wozonig
In der Zeit des Biedermeier ist das romantische Ideal von der Einheit von Kunst und Leben nicht aufrecht zu halten. Die Gesellschaft der sich emanzipierenden Bürger braucht zuverlässige Mitglieder, die ihre Leidenschaften zähmen und eine klare, ef-fiziente Aufteilung der Sphären befolgen. Die Dichter der Zeit sind Grenzgänger zwi-schen den Welten, die sich den bürgerlichen Anforderungen entziehen und sie da-durch stabilisieren. Gilt das auch für die Dichterinnen ? In diesem Beitrag wird das Werk der österreichischen Lyrikerin und Journalistin Betty Paoli (1814–1894) zu die-sem Thema befragt.
46
Liebeslyrik und männliche Affektkontrolle
In der Liebeslyrik der Biedermeierzeit gilt: Die Frau gefährdet das Werk. Und zwar dann, wenn sie das Liebeswerben des lyrischen Ich (bei dem es sich oft um einen Dichter handelt) erhört. Denn anders als in der Goethezeit, in der Liebe als die »erfüll-te humane Utopie schlechthin«, die »Synthese der sexuellen und spirituellen Seite der ›Natur‹« betrachtet werden konnte (Lindner 2002, 39), folgte der Biedermeierdichter den Vorgaben einer neuen Anthropologie und stieß damit an die Bürger-Natur, die den Liebesdiskurs mit bürgerlich gezähmter, das bedeutet: ehelicher Fortpflanzungssexu-alität koppelte. Die Kontrolle der Leidenschaften wurde in allen Lebensbereichen zu einem wichtigen Merkmal des Bürgers, und zwar sowohl seiner Person als auch seiner Selbstdefinition als Angehöriger der gesellschaftlichen Schicht. Denn Affektkont-rolle ist die Garantie dafür, dass die auf Zuverlässigkeit und (geschlechtsspezifische) Arbeitsteilung basierende bürgerliche Gesellschaft funktioniert. Ging es anfangs noch um eine weitgehend auf äußere Formen beschränkte Selbstdisziplinierung, die darauf abzielte, durch vernünftigen Ressourceneinsatz die politische und gesellschaftliche Konkurrenz (den Adel) zu überflügeln, so hatte der Mensch der Biedermeierepoche diese Bürger-Natur bereits verinnerlicht. Die Normen waren »in Form von spezi-fischen Dispositionen, Kompetenzen, Affektstrukturen und Deutungsmustern« (Reckwitz 2006, 10) im Subjekt verkörpert. Sie sind, um ein im Zusammenhang mit biedermeierlicher Literatur passendes Bild der Theoretiker(innen) der Subjektivation zu verwenden, in das Bürger-Subjekt eingeschrieben. Damit erreichte die Verbürgerli-chung der Gesellschaft in der Zeit des Biedermeier eine neue Qualität, nämlich die der Psychologisierung. Das hatte Folgen unter anderem für die Trennung der Wirkungs-bereiche von Männern und Frauen, für die Repräsentation von Leidenschaften und Individualität und für die Definition von persönlicher Autonomie. Affektkontrolle galt nicht vorrangig als Selbstbeschränkung oder Entsagung, sondern sie wurde z.B. als Voraussetzung für die gesellschaftlich erwünschte Form von Partnerschaften und von geordneter biologischer Reproduktion betrachtet. Die Liebeslyrik der Zeit bekam die Funktion, die aus dem öffentlichen Bereich verdrängte, gesellschaftlich nicht sankti-onierte erotische Leidenschaft aufzufangen. Es war eine schwierige Aufgabe, die der Dichter zu erfüllen hatte: Einerseits bot das lyrische Dichter-Ich dem lesenden Bürger eine Alternative zu Ehe und Familie, indem es ihm einen Diskurs erotischer Autono-mie und unvernünftiger Geschlechtsliebe ohne Fortpflanzungsabsichten anbot. An-dererseits konnte dieser Liebesdiskurs seine Wirkung nur durch die Unerfüllbarkeit
47
der Liebe und die Umlenkung der Leidenschaft entfalten. Die normgerechte Erfüllung des Begehrens entspräche seiner Selbstabschaffung. Unerfüllte Geschlechtsliebe, hoffnungslose Sehnsucht, Entsagung, Verzicht und der Tod der geliebten Frau sind daher wichtige, stets wiederkehrende Themen der biedermeierlichen Liebeslyrik. Das lyrische Dichter-Ich lenkt durch diese Situationen der Entsagung seine Triebhaftigkeit nach innen, trauert einer nicht erfüllten oder vergangenen Liebe nach und speist aus dieser dunklen Energie sein kreatives Schaffen. Die poetische Sublimation stellt die Leidenschaft nicht still und bleibt gleichzeitig gesellschaftsfähig.An der Massenproduktion stereotyper sprachlicher Bilder und Motiv-Muster wird die regulierende Funktion dieser Liebeslyrik deutlich. Der literarisch gebildete Leser er-kannte den überindividuellen Liebesdiskurs, der auf immer gleichen Konflikten auf-baut und der durch das zerrissene Dichter-Subjekt, das zwischen Kunst und bürgerli-chem Leben vermittelt, ausgedrückt wird. (Lindner 2002, 52) Die poetische Sublima-tion funktioniert, da der Dichter weiß, dass die bürgerliche Norm für den Leser lebens-bestimmend ist und die Abweichung davon als Funktion des lyrischen Dichter- oder Künstler-Ich wahrgenommen wird. Die biedermeierliche Liebeslyrik poetisiert die Un-vereinbarkeit von ungezähmter, irrationaler Leidenschaft und bürgerlicher Existenz und stellt die Diskrepanz als allgemeingültig dar. Damit bietet sie ein Ventil für die Fol-gen der Rationalisierung von Liebesbeziehungen und erfüllt, was die Philosophin Cor-nelia Klinger in Bezug auf die moderne Privatsphäre als »die Aufgabe der Konstituie-rung des Subjekts, der Identitätsstiftung des Individuums und der Reparatur von Mo-dernisierungsschäden« (Klinger 2004, 29) bezeichnet. Das lyrische Ich entzieht sich der bürgerlichen Norm, denn nur so kann es den Motor seiner Kreativität am Laufen halten. Seine Außenseiterrolle und seine Zerrissenheit sind das Ergebnis eines positiv konnotierten Entsagens, das dem bürgerlichen Leser seine eigene Normerfüllung, sein Sichnichtentziehen, vor Augen führt und sie bestätigt. Das lyrische Ich des Gedichts verzichtet auf die Liebeserfüllung, die in Ehe und Fortpflanzung münden müsste, und bewahrt so für den Leser die Leidenschaft – eine Arbeitsteilung, in der der Literatur die Funktion der Stabilisierung bürgerlicher Verhältnisse zukommt.
Das schreibende Subjekt
Was für das Dichter-Ich des Gedichts gilt, stimmte zumeist auch für seinen Autor. Auch wenn der Druck zur Verbürgerlichung im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts stieg und viele Schriftsteller sich sehr bemühten, ein Norm-Bürgerleben zu führen, so büßte
48
ein Dichter doch kaum Sozialprestige ein, falls er sich der Ehe, der Familiengründung oder anderer bürgerlicher Ordnungsinstrumente entzog. Ehelosigkeit wurde in seinem Fall nicht als Versagen oder ungebührliche Verweigerung gedeutet und beließ ihn in sei-ner Männlichkeit intakt. Für eine Dichterin stellte sich die Situation schwieriger dar. Das lyrische Dichterinnen-Ich kann nur unter sehr speziellen Voraussetzungen geltend machen, dass der Mann das Werk gefährdet. Sich ihm (und dem einzigen akzeptierten, weil »natürlichen« Beruf, nämlich der Mutterschaft) zu entziehen, gefährdet die Inte-grität des lyrischen Ich, da es damit gegen den weiblichen Geschlechtscharakter ver-stößt. Das Dichterinnen-Ich und mit ihm (sehr viel enger verknüpft als beim schreiben-den Mann) die Dichterin entzieht sich durch Ehelosigkeit und durch die Verweigerung der biologischen Reproduktion nicht nur einem bürgerlichen Ordnungsinstrument, son-dern verstößt damit gegen die naturgegebene Bestimmung der Frau. Die Begründung, dass Ehe und Familie die dichterische Kraft beeinträchtigten und die Stillstellung der Leidenschaften den kreativen Prozess beenden würde, galt bei einer Schriftstellerin nicht, da es ihrem »eingeschriebenen« Geschlechtscharakter entsprach, passiv, leiden-schaftslos und auf ihr häusliches/privates Umfeld beschränkt zu sein. Ihre dichterische Produktivität, wie Aktivität generell, stellte das »männliche Prinzip par excellence« (Treder 1988, 38) dar, das heißt: Es war gegen die Natur. Gustav Klemm, keineswegs misogyn, sondern ein Frauenversteher der Zeit, beschreibt die literarischen Ambitio-nen von Frauen so: Die ersten Autorinnen traten ziemlich bescheiden auf; je mehr ihre Anzahl aber sich mehrte, desto kecker wurden sie, bis es endlich dahin gekommen, daß auch Frauen die Poesie und Literatur zum Erwerbszweig machten. (…) Vor Allem aber hat es den Frauen sehr geschadet, daß sie sich in Gebiete gewagt, deren Bewältigung die ihnen von der Natur gegebenen Fähigkeiten nur in sehr seltenen, also widernatürlichen Fällen möglich machen (Klemm 1859, 4f.). Im Gegensatz zu der nachahmenden Tätig-keit des Übersetzens, dem Schreiben von Texten mit haushaltsnahen Themen oder sol-chen, die dem Privatbereich zugeordnet werden (Briefe, Tagebücher), war die originel-le literarische Schöpfung, zumal die der formstrengen Lyrik, kein angemessenes weib-liches Betätigungsfeld.
Entziehen ? Entsagen !
Um Akzeptanz für ihre unbescheidenen Werke zu erreichen, mussten sich Schriftstel-lerinnen besonderer rhetorischer Strategien bedienen, die das Entziehen aus der vor-gegebenen weiblichen Lebensgestaltung reflektieren. Alleinstehende Frauen waren da-
49
bei im Vorteil, denn eine häufige und mit dem bürgerlichen Ideal konform gehende Be-gründung für ihr Schreiben war die, dass sie sich damit über das Unglück, nicht ver-heiratet zu sein und keine Familie zu haben, hinwegtrösteten. Diese Frauen schrieben, um die fehlende Befriedigung im »natürlichen« Beruf zu kompensieren, meinte z.B. der einflussreiche Publizist Robert Prutz (Prutz 1859, 249). Die unverheiratete Lyrikerin Betty Paoli (1814–1894) bemerkte in einem Brief gegenüber Leopold Kompert, dem Redakteur der Tageszeitung Lloyd: Dem beifolgenden Artikel bitte ich im Lloyd eine Aufnahme zu gönnen, obwohl mich in der neulich darin enthaltenen und wahrschein-lich von Ihnen herrührenden Recension der Ausspruch, daß Frauen sich des Schreibens enthalten sollten, nicht wenig erschreckt hat. Er macht mir umso größeren Eindruck, als ich im Herzensgrunde eigentlich ganz und gar Ihrer Ansicht bin. Warum ich dennoch schreibe ? Weil der Mensch nicht so logisch ist wie ein Rechenexempel und weil man in Ermanglung echter, d.h. natürlicher Interessen sich wenigstens künstliche schaffen muß, um nicht ganz zu verdumpfen und zu ersticken. Es ist gewiß noch keiner glückli-chen Frau eingefallen zu schreiben, und dieß mag bei der Beurtheilung so vieler schlech-ter Bücher als mildernder Umstand gelten.Der Nachteil dieser Rechtfertigungsstrategie ist evident: An literarische Werke, die von vornherein als Kompensation gelten, werden keine ästhetischen Maßstäbe angelegt und gute Texte können leicht als ein von einem blinden Huhn gefundenes Korn abgetan werden. Für schreibende, alleinstehende Frauen, die mit ihrer Arbeit ernstgenommen werden wollten, war es daher wichtig, in die Kategorie des außerbürgerlich-kreativen Menschen zu fallen und dadurch von den Vorgaben ihres Geschlechtscharakters unab-hängig zu werden. Eine Möglichkeit bestand darin, sich als geschlechtsloses Genie zu stilisieren und die schriftstellerische Fruchtbarkeit auf einen geschlechtsneutralen An-trieb zurückzuführen: »Unweibliche Idee ? wie Ihr doch thöricht sprecht !/Was hat der Geist denn wohl gemein mit dem Geschlecht ?« (Paoli 1845, 235) Dabei führte aber die Wahrnehmung, dass die Produktivität des schreibenden Menschen und die Schöpfer-kraft des Genies männlich konnotiert ist, zu einigen Schwierigkeiten (Higonnet 1994, 288–290). An einem Ende der Skala der Rechtfertigung für das Schreiben von Frau-en (sowohl der Autorin als auch des lyrischen Dichterinnen-Ich) steht der Hinweis auf das Unglück über den unfreiwilligen Verzicht auf Ehe und Familie. Am anderen Ende steht die Selbststilisierung als autonomes, geschlechtsloses Genie. Beides funktioniert nur begrenzt. Besser geeignet und im Rahmen der literarischen Affektkontrolle für die bürgerliche Leserschaft (auch für die Frauen der Bürger) verwendbar, ist die Berufung auf die Besonderheit der schöpferischen Frau, die neben sich keinen gewöhnlichen (das
50
bedeutet: bürgerlichen) Mann dulden kann, will sie nicht Verrat an der Kunst (dem Ge-gengewicht zur bürgerlichen Rationalität, für das sie im Privatbereich zuständig ist) begehen. Mit dieser Begründung wird eine Mischung aus neutralem Genie und künst-lerisch-leidenschaftlicher Frau geschaffen, eine Vermittlerinstanz zwischen bürgerli-chem Ideal und Kunst, die das Sich-Entziehen zu ihrem kreativen Antrieb machen kann und aus dem Pool der Sehnsucht nach Erfüllung ihrer weiblichen Bestimmung schöpft. Die Verbindung zwischen lyrischem Dichterinnen-Ich und dem Leben ihrer Autorin-nen wurde vom zeitgenössischen Publikum zumeist ganz unmittelbar hergestellt. Da-her diente diese Strategie des Entziehens auch dazu, für die Autorinnen den Verlust an Sozialprestige, der durch Ehe- und Kinderlosigkeit entstand, gering zu halten. Wichtig dafür war es allerdings – wie auch bei der von Männern verfassten Liebeslyrik der Zeit –, dass das bürgerliche Ideal als Hintergrund diente, von dem sich die Besonderheit des lyrischen Dichterinnen-Ich abhob. Anders als das lyrische Dichter-Ich, dem eine eigene Identität jenseits der Bürgerexistenz zugestanden wurde, blieb die schreibende Frau des Gedichts im Grunde ihrer bürger-psychologischen Identität immer eine Frau mit der ver-störenden Eigenheit des unbezwingbaren Drangs zu schreiben.
Bekenntnis
Betty Paoli machte in einigen ihrer Gedichte die dichterische Berufung des lyrischen Ich zur Begründung für die Entsagungshaltung gegenüber der Geschlechtsliebe. Dabei bediente sie sich des Geniediskurses, den sie für die Dichterin umdeutete. Aber auch die moralische Überlegenheit der Frau (ein stereotypes Element des bürgerlichen weib-lichen Geschlechtscharakters) wird in Paolis Gedichten zum Anlass für das Scheitern von Liebesbeziehungen mit darauffolgender völliger Entsagung. Ein besonders frucht-barer Ansatz der Schreib-Rechtfertigung ist die oftmals explizit durch die Umstände er-zwungene Teilnahme des weiblichen lyrischen Ich am äußeren Leben (also am männli-chen Bereich). Sie führt dazu, dass die Bestimmung als Ehefrau und Mutter nicht mehr erfüllt werden kann. Im 23-strophigen Gedicht mit dem Titel »Kein Gedicht«, erschie-nen in Paolis erstem Gedichtband 1841, wendet sich das lyrische Ich an einen werben-den Mann. Die Begründung für die Ablehnung seiner Werbung liegt in dem atypischen weil selbstständigen Frauenleben des lyrischen Ich, die Schilderung dieses Lebenswegs wird kontrastiert mit dem weiblichen Lebens-Ideal.
51
O,wäremirdasheitreLoosgefallen, DasstillbeglückendandernFrauenfällt, InschirmenderBeschränkunghinzuwallen DurcheinesengenKreiseskleineWelt;
MeinHerzgleicheinerBlumezuverschließen, VorjedemSturmundjedemWehderZeit, DesLebensFreudenharmloszugenießen InahnungsloserUnbefangenheit!
DochandershatsichmeinGeschickgewendet, EinKampfplatznurwarmeineLebensbahn; …
Damit das Entziehen aus der weiblichen Rolle überhaupt sinnvoll dargestellt werden kann, muss der bürger-psychologische weibliche Geschlechtscharakter vorab als das zu erstrebende Ideal aufgebaut werden. Zu ihm gehören nicht nur die äußere und innere »Beschränkung«, sondern auch eine klare, naturgegebene Hierarchie der Geschlechter. Entsprechend gipfelt die Klage des lyrischen Ich in den Zeilen:
WehJedem,derinseinemThunundLassen DeminnerenGesetznichtfolgenkann! MeinUnglückläßtsichinzweiWortefassen: IchwareinWeibundkämpftewieeinMann!
Die erzwungene Abweichung von der weiblichen Rolle begründet, dass das lyrische Ich dem werbenden Mann keine Liebe entgegenbringen kann, da die natürliche Ordnung, die es verlangt, dass die Frau zum Mann aufsieht, gestört ist. Das Entziehen aus dem Liebes- und Partnerschaftsverhältnis als Folge der poetischen Berufung ist in dem Ge-dicht Bekenntniß, erschienen 1840, besonders deutlich ausgedrückt. Die erste Strophe lautet:
52
Ihrfragt,warumsoeinsammirverflossen DesLebensfrühlingsblüthumdrängteZeit, WarumichvondemBundeausgeschlossen, DemandreHerzenfreudigsichgeweiht, WarumichohneSehnsucht,ohneKlage FreywilligjedemLiebesglückentsage?
Die Einsamkeit des dichterischen Menschen, ein Topos aus dem Geniediskurs, wird in der ersten Zeile aufgerufen. In der zweiten Zeile wird mit dem »Lebensfrühling«, der »blüthumdrängt« ist, kurz und das einzige Mal in dem Gedicht ein Bild aus dem poeti-schen Liebesdiskurs verwendet. Mit der Aussage, dass für das lyrische Ich keine Gel-tung hat was für »andre Herzen« gilt, wird eine Abgrenzung gegenüber einem poeti-schen Gemeinplatz vorgenommen. Die Freiwilligkeit des Verzichts auf erfülltes Liebes-glück wird am Beginn des Gedichts betont und in den weiteren sechs Strophen begrün-det. Die ersten zwei Zeilen der zweiten Strophe drücken noch einmal die Situation des lyrischen Ich aus: »Wohl steh’ ich einsam in dem Weltgewühle,/Wo keine Brust sich an die meine legt, …«, es folgt dann eine sehr dezidierte Aussage zur Überlegenheit des ly-rischen Ich. In der dritten und vierten Strophe wird der Abstand zwischen dem gewöhn-lichen Liebes-/Lebenspartner und dem dichterischen Genie (weiblich) behandelt:
53
SollichherabvonmeinerHöhesteigen, EntsagenmeinemRechtemeinemRang, UmmichvoreinemIrdischenzuneigen, DernieverständemeinesHerzensDrang? SollkindischicheinWahngebildvergöttern, Umes,enttäuscht,dannwiederzuzerschmettern?
WolltichauchhemmenmeinesIch’sEntfaltung, BeschränkenmeinenfreyenWolkenzug, MichunterwerfenfremdenGeist’sGestaltung, Eswär’einthörichteitlerSelbstbetrug! Undkönnt’auchErinmeinerNäh’erwarmen, IchbliebeeinsamdochinseinenArmen!
Der Ausdruck »Irdischer« evoziert die Göttlichkeit des schöpferischen Menschen, ein Bestandteil der romantischen Dichterselbststilisierung. Das Gedicht schließt mit einer endgültigen Verweigerung einer Liebesbeziehung:
WieeineJungfraufürstlichenGeschlechtes EntschlossenwähltdesKlostersEinsamkeit, Eh’sie,vergessendihresstolzenRechtes, UngleichemBündnißsichmitNiedernweiht, MagmeineSeeleleichterLieb’entbehren, AlsdurchgemeineNeigungsichentehren.
Undweilihrfernebliebderwürd’geFreyer, Aufdensiehoffte,dochjetztnichtmehrharrt, HülltsiesichstillinihrenNonnenschleyer– EindunklerPurpuristerandrerArt. EntsagenlieberjedemFreudenbilde, AlseinenFleckenaufdemWappenschilde!
54
Der Vergleich der erhabenen Seele mit der fürstlichen Jungfrau ist ein deutlicher Aus-druck der Abgrenzung des lyrischen Ich gegenüber dem gewöhnlichen Mann, einer Ab-grenzung, die so stark ist wie die des Hochadels vom Bürgertum. Die Störung der bür-ger-natürlichen Hierarchie zwischen den Geschlechtern wird von Paoli häufig als Be-gründung für das weibliche Entziehen aus der vorgesehenen Geschlechterrolle heran-gezogen. Im Falle der dichtenden Frau ist es evident, dass der »würd’ge Freyer«, der des »Herzens Drang« verstehen könnte, selbst ein Dichter sein müsste. Andeutungen einer gleichberechtigten Beziehung finden sich in einigen der 56 Lie-der, die Paoli in ihrem zweiten Gedichtband Nach dem Gewitter (1843) unter dem Titel Astern zusammenstellte, und zwar in jenen, in denen sich das lyrische Dichterinnen-Ich an einen dichtenden Liebhaber wendet oder ihm ihr Lied widmet. Im zweiundzwan-zigsten Lied wird eine Liebesbeziehung beschrieben, die ihren Anfang im Lesen der jeweiligen Gedichte genommen hatte, noch bevor sich die beiden Liebenden jemals begegnet waren. Eine Entkörperlichung und Entsexualisierung der Liebesbeziehung findet sich auch in der mehrfachen religiösen Überhöhung der Poesie, die Dichterin und Dichter zu keuschen Priester(inne)n macht. Außerdem stellt eine Abwertung der äu-ßeren Reize des Gegenübers bei Aufwertung seiner inneren Qualitäten wie in Lied 42 eine Umdeutung der Liebe von einer sexuellen Beziehung hin zu einer seelischen Ver-wandtschaft dar. Damit ist zwar der Dichter als ebenbürtiger Partner im Geiste aus-gewiesen, die Liebesbeziehung kann aber nicht in eine dauernde Verbindung mün-den. Einige der Gedichte, die in Astern aufgenommen wurden, waren bereits 1840 in der Wiener Zeitschrift publiziert worden und lösten bei den Zeitgenossen (und später bei Paolis Biografen) Spekulationen darüber aus, welcher der Schriftsteller in ihrem Bekanntenkreis wohl mit dem Dichter-Partner des Gedichts gemeint sein könnte, ein typischer Rückschluss vom lyrischen Ich auf die schreibende Frau. In einer kritischen Würdigung des Dramas Sappho von Franz Grillparzer stellt Paoli das Dilemma zwi-schen Poesie und Leben, bzw. Kunst und bürgerlicher Existenz dar und bemerkt, dass die Diskrepanz zwischen poetischer Sendung und den Anforderungen an den bürger-lichen Geschlechtscharakter nicht nur die schreibende Frau betrifft. Vielmehr sei Sapp-ho ein »Symbol des Looses, das, von allen individuellen Tugenden und Fehlern abge-sehen, über den Künstler als solchen verhängt ist« (Paoli 1875, 24). Und das, so könn-te man ergänzen, dazu führt, dass er/sie sich dem bürgerlichen Normleben entzieht. Ob es, wie in Kein Gedicht, am Lebenskampf oder einem nicht unterdrückbaren poeti-schen Drang liegt: Die Frauen in Paolis Gedichten sind für die weibliche Rolle überqua-lifiziert.
55
Bibliografie
higonnet, anne: Bilder – Schein und Erscheinung, Muße und Subsistenz. 1994, georges duby und michelle perrot (hg.): Geschichte der Frauen. 1997, Bd. 4, Frankfurt /M, New York, S. 284 – 311.klemm, gustav: Die Frauen. Culturgeschichtliche Schilderungen des Zustandes und Einflusses der Frauen in den verschiedenen Zonen und Zeitaltern. 1859, Bd. 6, Dresden.klinger, cornelia: 1800 – Eine Epochenschwelle im Geschlechterverhältnis. 2004, Katharina Rennhak /Virginia Richter (Hg.): Revolution und Emanzipation. Geschlechterordnung in Europa um 1800, Köln u.a., S. 17 – 32.lindner, martin: »Noch einmal«: Das tiefenpsychologische und künstlerische KonservierenderErinnerunganden»Liebesfrühling«inLiebeslyrik-Zyklen1820bis1860. 2000, in Michael Titzmann (Hg.): Zwischen Goethezeit und Realismus. Wandel und Spezifik in der Phase des Biedermeier, Tübingen, S. 39 – 77.lukas, wolfgang: »Weibliche«Bürgervs.»männliche«Aristokratin.DerKonfliktder GeschlechterundderStändeinderErzählliteraturdesVor-undNachmärz. 1999, in: »Emancipation des Fleisches«. Erotik und Sexualität im Vormärz. Jahrbuch des ForumVormärzForschung 5, S. 223 – 260.paoli, betty:Bekenntniß. 1840, in: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, 71, 4. Mai 1840, S. 563f.paoli, betty:KeinGedicht. 1842, in: Gedichte. Zweite vermehrte Auflage, Pest, S. 70 – 75.paoli, betty:BriefanLeopoldKompert.1908, 25. November 1850, in: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, 18, 1908, S. 190f.paoli, betty:GrillparzerundseineWerke. 1875, Stuttgart.prutz, robert: DiedeutscheLiteraturderGegenwart. 1859, Bd. 2, Leipzig. reckwitz, andreas: DashybrideSubjekt. 2006, in Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Weilerswist.treder, ute: DasverschütteteErbe.Lyrikerinnenim19.Jahrhundert. 1988, in: Gisela Brinker-Gabler (Hg.): Deutsche Literatur von Frauen, Bd. 2, München, S. 27 – 41.
56
Im Süden Dreizehn Fragmente zur Technik des Rückzugsvon Thomas Ballhausen
Isitenoughtohavesomelove,smallenoughtoslipinsideabook,smallenoughtocoverwithyourhand,becauseeveryonearoundyouwantstolook?
Isitenoughtohavesomelove,smallenoughtofitinsidethecracks?Thepiecesdon’tfittogethersogoodwithallthebreakingandthegluingback.
AndIamstillnotgettingwhatIwant.Iwanttotouchthebackofyourrightarm.IwishyoucouldremindmewhoIwasbecauseeverydayI’malittlefurtheroff.Amanda Palmer: Astronaut
57
Es scheint ganz so, als hätten wir etwas von Bedeutung überstanden, ohne der Bege-benheit dann aber die Wichtigkeit zuzumessen, die sie verdient hätte. Wir sind uns be-wusst, dass eine Rückkehr in einen Zustand der Unschuld absolut unmöglich ist; schon der Wunsch danach zeugt von unseren kindischen Haltungen. Zumindest ist das rück-sichtslose, überschwängliche Gefühl des Sieges ausgeblieben, stattdessen wird alles von der dumpfen Empfindung abgewendeter Besiegbarkeit dominiert, von einem Makel, ei-ner Erinnerung an die Sterblichkeit.
Der Bahnhof ist ein Ort des Dazwischen, eine Schnittstelle, die wie eine Druckaus-gleichskammer auf der urbanen Blase hockt. Heute beherbergt er seit langem wieder Reisende, die wie Astronauten wirken, also Reisende sind, die den Taumel von Ge-schwindigkeit und die Entfernung suchen, in der sie sich vor der unmittelbaren Vergan-genheit sicher wähnen können. Manche haben nahezu engelsgleiche Gesichter, die we-der ein Lächeln noch ein Stirnrunzeln kennen, Gesichter, die zwischen dem Dampf der Maschinen und dem hereinbrechenden Tageslicht hervorscheinen, zwischen Nebel und Licht wie eingeklemmt wirken. Es sind trotz der Kälte noch zahlreiche andere Leute auf den Bahnsteigen, die auf ihre Züge warten. Sie alle sind dabei, die Stadt zu verlas-sen. Kaum jemand hier macht auf mich den Eindruck, jemanden zu erwarten, hier abzu-holen und zu Hause willkommen zu heißen.
Ich habe eine Waffe bei mir, ich will vorbereitet sein. Irgendwie kann ich den Gedan-ken nicht abschütteln, dass man mir meine Schuld doch ansehen müsste, dass man die Umstände ganz zweifelsfrei mit mir in Verbindung bringen könnte. Doch niemand hin-dert mich, kaum jemand beachtet mich. Ein Mann in Eile, der mich zufällig im Vorüber-gehen streift, verschafft mir etwas wie Hoffnung: Nun bin ich doch noch enttarnt, er-wischt worden. Noch auf dem Bahnsteig wird man nun Gerechtigkeit üben, sich sofort der Ursache allen Übels auf grausame Weise entledigen. Doch nichts dergleichen pas-siert. Entschuldigend tippt der Mann, sich zu mir umdrehend und seinen Schritt nur ein wenig verlangsamend, an seinen mitgenommenen Hut, den zerschlissenen Mantel mit der anderen Hand enger an seinen dünnen Körper ziehend. Dann läuft er weiter, mich meiner Zukunft überlassend. Das Gewicht der Waffe fällt mir nach diesem Zwischen-fall besonders auf, sie erscheint mir nun wie ein lächerliches überflüssiges Gepäckstück, das ich einem Komiker gleich vergeblich unter meiner Kleidung zu verbergen suche. Schnell gehe ich weiter, auf den Zug zuhaltend, der mich aus der Stadt bringen wird.
1
2
3
58
Der Blick fällt durch das Glas des Waggonfensters auf die Landschaft, ein Flugzeug steckt im Himmel, wirkt wie platziert und vollkommen stillstehend, während alles an-dere – Bäume, Felder, Häuser – in Bewegung ist. Die Luft bebt, versetzt das Glas des Fensters in Schwingung. Irgendwo beginnen die sichersten Türme einzustürzen, ihre Trümmer und Schatten fallen auch auf mich. Zwei junge Frauen, in ihr Gespräch ver-tieft, reißen mich aus meinen trüben Gedanken. Eine der beiden entdeckt einen auf-geweckten Jungen, der auf dem Schoß eines ernst dreinblickenden Mannes, vielleicht seines Vaters, sitzt und herumzappelt. Während der Mann und eine müde wirkende Frau ihm gegenüber, die trotz des bewölkten Wetters eine überdimensionierte Sonnen-brille trägt, wortlos bedeutungsvolle Blicke austauschen, beginnt die junge Frau quer über den Gang des Waggons hinweg eine ganz ähnliche Unterhaltung mit dem Kind: Sie streckt ruckartig, fast wie ein Teil eines ritualisierten Erkennens und Grüßens, ihre Zunge hervor. Der Junge, plötzlich in seiner Bewegung erstarrt, wendet, statt den ei-genwilligen Gruß zu erwidern, den Blick ab, pikiert und irgendwie peinlich berührt. Ein Missverständnis, ein Missverstehen.
Ich reise, als müsste ich vergessen, als würde ich in geborgten Sprachen und entspre-chenden Phrasen um mein Leben trauern. Die Bedenken, die eine Entblößung mit sich bringt, werden im Blick der Allgemeintheit zu Entstellungen, zu Malen eines unüber-sehbaren Makels. Ganz wie ein verfemter Historiker vor mir scheine ich gebrandmarkt, bestehe ich im Entwurf Dritter nur noch aus Abschweifungen und Ausschweifungen. Da ist ein Toter auf Reisen, so meine ich sie zischen zu hören, an ihm kann man sich ver-giften. Dies ist eine Flucht aus der Tyrannei der Gleichmut, den gewohnten Positionen und Stellungen. Wir haben uns munitioniert, geladen, entsichert. Wir sind losgegan-gen, immer und immer wieder. Ich kann diesen Zustand der Aufrüstung nicht mehr er-tragen, das Abspulen vertrauter Abfolgen, die mich lähmende Situation, den ständigen Einsatz der Waffen.
Da ist eine Vergangenheit, die nicht vergehen will, weil sie mir innewohnt, mich mehr bestimmt und ausmacht, als ich bereit bin mir einzugestehen. Es ist mir unmöglich, mit meinem Leben, meinem Sein zu brechen. Ich spüre das leichte Verlangen zur Rückkehr zu älteren Gewohnheiten, zu lange verdeckt gebliebenen Ritualen. Es gibt unverlern-bare Bewegungsabläufe, moves, an die sich mein Körper auf eigentümliche Weise im-mer noch erinnert. Ich lächle den posierenden Mädchen zu, meine Gesichtsmuskeln tun es fast von alleine. Dieser neue Aufenthaltsort wird mich zumindest kurz wärmen,
4
5
6
59
halten können. Die Wirkung der Schönheit wird eine geraume Zeit anhalten, bis ich sie erneut nicht mehr zu erkennen vermag.
Die Zitadelle hoch oben über der Stadt weist weithin sichtbare Risse in ihren Mauern auf, es ist der Hinweis auf eine vergangene Welt, die angeblich einer Frau wegen zerfal-len ist. Da ist ein Krieg verlorengegangen, schon vor langer Zeit, doch die schrecklichen Auswirkungen der darauf folgenden Ereignisse sind immer noch spürbar. Das allgemei-ne Bewusstsein der Bewohner hat sich ein Echo bewahrt, einen Reigen fluchbeladener Bilder. Nach der ersten Liebe, so ließen es die Sieger von einst verkünden, geht es nur noch um Wiedergutmachung in ihrer brutalsten Form, um Rache für das Erlittene. An diesem Ort kannst Du mir nicht mehr begegnen, meine Gestalt wird Dich nicht mehr er-innern und mahnen können, Dein Blick kann mich nicht mehr zufällig streifen. »Ich bin so viel weiter mit Dir gegangen, als es mir alle geraten haben.« Dieser Satz klingt immer noch in mir nach, lässt mich in den Chor der Bewohner, den Nachfahren der Verlierer, miteinstimmen.
Immer häufiger bekomme ich nun Unfälle zu sehen. Meist gehe ich dann so nahe an den Ort des Geschehens wie nur irgend möglich heran. Dieses viele Fleisch um mich ist wie eine Belagerung, die Gefahr eines Rückfalls gegeben. Aber: Der süße Geruch ist betörend, betäubend. Ich lehne dann an einer der Straßenecken, höre auf den heil-samen Klang der Sirenen, die das Näherkommen der Einsatzkräfte begleiten, schaue di-rekt in das irritierende Licht der Fahrzeuge, in dem man sich nach und nach zu verlieren droht. Es sind immer die gleichen Gesten der Hilflosigkeit, des Elends und der Qual; die sich ins Unermessliche steigernden Weinkrämpfe der Überlebenden, die gebückte Haltung über den oft blutig verschmierten Opfern. So: als ob sie die Seelen der Toten abhalten könnten, sich zu lösen, als ob sie den Moment des Todes noch ein wenig auf-schieben oder gar verhindern könnten. Die Leere, die ich dabei empfinde, wenn ich wie ein Schmerzabhängiger in der Nähe solcher Szenen stehe, habe ich mir nach und nach angewöhnt.
Ich bemerke ein kleines Kind mit einem Spielzeug, mit dem es lange Ketten schillern-der Seifenblasen erzeugt, die es wie eine Spur hinter sich herzieht. Dieser Anblick erin-nert mich an die Geduldspiele, die in die Deckel der Behälter mit dem präparierten Was-ser eingelassen waren: Unter einer grellen Kunststoffschicht war ein kleines Labyrinth angebracht und die zu lösende Aufgabe bestand darin, mit vorsichtigen Bewegungen
7
8
9
60
zu versuchen, eine Vielzahl silberner Kügelchen in die dafür vorgesehenen Vertiefun-gen hineinzudirigieren. Während ich mich an die Unmöglichkeit erinnere, alle Kugeln gleichzeitig in ihren Öffnungen zu halten, weiche ich automatisch den Seifenblasen aus, zwinge mich dann stehenzubleiben und die Blasen einfach an mir vorüberziehen zu las-sen. Keine einzige berührt mich; ich halte noch einen Moment inne, wie auf eine weite-re Welle wartend, dann erst wechsle ich ungewöhnlich beschwingt die Straßenseite.
Hin und wieder erlaube ich mir die von Schwäche getragene Vorstellung, mich doch noch mit einer letzten Botschaft von Dir zu verabschieden. Dir einen Brief zu schrei-ben, schiene mir vermessen, wäre er doch nur eine Anlehnung an bereits Geschriebe-nes, an vor langer Zeit verfasste Eingeständnisse einer Überwindung. Lieber würde ich Dir eine kurze, knappe Botschaft schicken, ein Telegramm, in das ich diese neue Stim-mung einwickeln könnte wie in ein ausgeschnittenes Bild. Ich möchte Dir das Rauschen des Meeres schicken, die Bewegung der Wellen, die ersten Sätze des lange aufgescho-benen, schließlich doch unter Mühen in Angriff genommenen Werkes. Ich möchte Dir von den Verdachtsmomenten schreiben, von den Fälschungen und Täuschungen der Bindungen, des Geldes und der Sprachen. Ich möchte Dir vom mehrdeutigen Schwin-del schreiben, vom abgesteckten Terrain des Zweifels und des Verzichts, von der unbe-eindruckten Bewegung dieses seltsamen Planeten.
Das konkurrierende Nebeneinander von Erträumtem und Wirklichem scheint mir fast schon ungehörig. Was alles real sein kann und nebeneinander existiert, zeigt, dass es keine Erlösung gibt, nur eine Pendelbewegung, der eines Tauchers nicht unähnlich, ein Auf und Ab zwischen dem Verharren im Schwebezustand und dem, was die Wirklich-keit an Tatsachen wie unpassende Vorschläge mit sich bringt. Es gibt ein Missverhält-nis zwischen den Angeboten der Realität und dem, was ich aus dieser Wirklichkeit und den an sie gebundenen Optionen ziehen möchte, ja, was ich geradezu mit ihr anstellen möchte. Aber zu oft bleibt es beim Wunsch, denn nicht weniger stark ist der Umstand, dass mein Mut für zu wenig reicht, nistet doch ein unausräumbarer Zweifel wie ein le-bendiges Wesen in mir. Ich traue mir kaum über den sprichwörtlichen Weg, ich traue mir nur so weit, so weit ich mich auch werfen kann. Denn zu leicht, viel zu leicht, gehen auch mir die harten Worte von den Lippen. Du hättest Dich von der ganzen Wahrheit nie erholt, ich musste sie in mir begraben wie etwas, das mir nicht gänzlich fremd ist.
10
11
61
Wie sehr ich das Meer vermisst habe, die langsam ansteigende See, die, geleitet von ei-nem bedächtigen und beharrlichen Puls, dem Land flache Uferteile abgetrotzt hat. Der lebendige Rhythmus des Wassers kennt ebensowenig ein Ende wie das blinde, uneigen-nützige Verlangen nach mehr Raum. Diese Vorstellung lässt mich innehalten. Aber ich bin kein Weiser geworden, ich bin bloß auf der Durchreise, ich will noch immer keine Ahnung haben. Fast schon erstaunt es mich, wie mich etwas so Einfaches wie der An-blick des Meeres tatsächlich glücklich macht, mich für einen kurzen, beinahe schon pa-thetisch erhebenden Moment alles, was ich hinter mir gelassen habe, vergessen lässt. Ich ziehe meine Schuhe aus und mit hochgekrempelten Hosenbeinen watschle ich wie ein ungeschickter Vogel auf das Wasser zu. Das Meer ist kalt, klar. Ich hoffe, dass es et-was Unerwünschtes, Vergangenes von mir abwäscht. Mit jeder neuen Welle wird der Grund unter meinen Füßen unsicherer, lockerer.
Es gibt selbst hier noch den Verdachtsmoment, dass die mich umgebende Welt eine er-bärmliche Konstruktion ist, die Kunst im Abgleich mit der Wirklichkeit: Was das in letzter Konsequenz auch meint, ist der mich bedingende, unausgesetzte Versuch, der mich bedrängenden Welt mit meinen Interpretationen beizukommen. Gewissheit und Bewusstsein gehen dann Hand in Hand, dass der Mensch also sterben kann und wird, aber eben nicht an der Liebe. Um mich zu vergewissern, greife ich nach meinem Hand-gelenk und taste nach dem Puls. Wer von uns ist denn nun der Täter, wer der Tote ? Das einzige Geräusch, das ich wahrnehmen kann, ist das Meer, dessen Wellen sich beständig an den Felsen der Küste abarbeiten. Der Sand ringsum ist von einer nie gesehenen Rein-heit, er wirkt auf mich wie grober Schnee. Ich klettere erneut hinunter, wieder näher ans Wasser heran und male mir aus, wie unter dem Druck des langsamen Versinkens, in dieser hoffnungslosen Lage des Wünschens, meine Kunst zu mir zurückkommt, bevor die Wellen über meinem Kopf zusammenschlagen.
Editorische Notiz des Autors: Der vorliegende Text basiert auf einigen Textpassagen aus meiner Erzählung »Die Unversöhnten« (2007), der damit einspätes Postskriptum hinzugefügt wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen, wenngleich ich immer noch den Verdacht habe, dass auch die Worte »à suivre« oder das Zitat »Für einen weiteren Stoß ist ja kein Platz mehr an mir« einen passenden, weilwidersprüchlichen Schlusspunkt für den vorliegenden Versuch dargestellt hätten.
13
12
62
Ohne medientechnische Operationen wie Archivieren, Kopieren, Transkribieren ist an Geschichtsschreibung (und also Geschichte überhaupt) nicht zu denken. An der Forma-tion historischen Wissens sind grundsätzlich Medien und Medienprozesse konstitutiv beteiligt. Doch in jeder Darstellung von Geschichte bleiben Lücken, Zwischenräume und blinde Flecken. Es gibt Gespenster der Geschichte, Aussagen und materielle Spu-ren, deren Erscheinen unerwartet und auch unheimlich ist, und deren genaue Herkunft und Bedeutung unklar bleibt. Dass eine klassisch-repräsentative Geschichtsschreibung ihren Gegenstand immer ein Stück weit verfehlen muss, da dieser sich ihrem vollstän-digen Zugriff stets zu entziehen droht, bedeutet jedoch nicht notwendigerweise ein Scheitern der Historiografie im Allgemeinen, sondern ermöglicht vielmehr andere Ar-ten der Erzählung. Dabei geht es nicht darum, vermeintliche historische Wahrheiten aufzudecken, sondern um die Freilegung historiografischer Prozesse und medientech-nischer Operationen und um die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten anderer Sagbarkeiten und Sichtbarkeiten. An den Lücken der Geschichte anzusetzen und diese produktiv zu machen, ist der Ausgangspunkt des Projekts einer alternativen Geschichtsschreibung, dem sich die At-lasGroup annimmt. In den Untersuchungen der AtlasGroup werden Strategien des Ent-
Archiv desEntziehens Anmerkungen zur Atlas Groupvon Antonia von Schöning
63
ziehens in der Geschichtsschreibung explizit und zu einem zentralen Thema. Die These dieses Aufsatzes ist, dass gerade durch die Betonung dessen, was dem Blick des Histo-rikers scheinbar entgeht, andere Formen des Sprechens, Zeigens und Erzählens ermög-licht werden. Dabei interessiert an dieser Stelle insbesondere die Durchmischung von fiktionalen und nicht-fiktionalen Darstellungsweisen, durch die das Verhältnis von Me-dien und Geschichtsschreibung thematisiert und ein Nachspüren von Motiven des Ent-ziehens, der Latenz und des Gespenstischen angeregt wird. Die AtlasGroup wurde 1999 – wobei es manchmal auch heißt 1976, 1990 oder 1991 – in Beirut gegründet und widmet sich der Erforschung und Dokumentation der libane-sischen Zeitgeschichte, genauer der Geschichte des Libanesischen Bürgerkrieges, der von 1975 bis 1991 dauerte. Die AtlasGroup findet, bewahrt, erforscht und produziert au-diovisuelle, fotografische und schriftliche Dokumente, die im sogenannten AtlasGroupArchive mit Sitz in Beirut und New York organisiert werden. Das Archiv ist nach drei Aktenkategorien geordnet: Typ A (einem identifizierbaren Individuum zugeordnet), Typ FD (aufgefundene Dokumente) und Typ AGP (der AtlasGroup zugeordnet). Entgegen des ersten Eindrucks handelt es sich bei der AtlasGroup jedoch nicht um eine geschichtswissenschaftliche Institution oder ein staatliches Archiv, sondern um ein Künstlerkollektiv, hinter dem im Grunde nur eine einzige Person steht: der libanesisch-amerikanische Künstler Walid Raad. Raad spricht von einer »imaginary research foun-dation« (Raad 2000, 47), einer imaginären Forschungsstiftung, die fotografisches Mate-rial, Videos, Zeitungsausschnitte und schriftliche Aufzeichnungen sammelt, auswertet und zur Verfügung stellt. Die genaue Herkunft dieses Materials ist zweifelhaft. Raad behauptet, eine Menge davon gefunden zu haben, anderes sei der AtlasGroup übergeben worden, um über die Zeit des Bürgerkrieges forschen zu können. Es zeigt sich jedoch, dass es dabei weniger um eine Dokumentation des Kriegsverlaufs und eine Rekonst-ruktion von Ereignissen in den 1970er bis 1990er Jahren geht. Das eigentliche Anliegen der AtlasGroup ist die Verhandlung der Frage beziehungsweise des Problems der Dar-stellbarkeit von Geschichte, speziell einer Geschichte des Libanesischen Bürgerkriegs, die Darstellbarkeit eines vermeintlich Undarstellbaren. Mit anderen Worten: Die At-lasGroup entwickelt Strategien, mit dem Entziehen des historischen Gegenstandes pro-duktiv umzugehen. Unsicherheiten, Latenzen, Nebel und Geheimnisse werden heraus-gestellt, bewusst eingesetzt oder auch gezielt hervorgebracht, um eine Reflexion über die Geschichtsschreibung des Libanesischen Bürgerkrieges anzustoßen. Walid Raad formuliert dies gegenüber der Kunstzeitschrift Springerin folgendermaßen: »Wir gehen in dieser Untersuchung davon aus, dass ›Der Libanesische Bürgerkrieg‹
64
keine selbstverständliche Episode, keine unabänderliche Naturgegebenheit ist. Dieser Krieg, oder vielmehr: diese Kriege kamen nicht durch miteinander verknüpfte, einheit-liche und bereits vorhandene Objekte zustande. Im Gegenteil, ›Der Libanesische Bür-gerkrieg‹ konstituiert sich aus verschiedenen Handlungen, Situationen, Personen und Umständen, von denen wir einige untersucht haben. Es ist dies nicht der Versuch, den Krieg auf das eine oder andere Geschehen, eine spezielle Person oder Zeit, diesen oder jenen Raum festzulegen, sondern wir stellen (und suchen die Antwort auf) folgende Frage: Wie schreibt man eine Geschichte des ›Libanesischen Bürgerkriegs‹ ?« (ibid.) Raad beantwortet diese Frage mit der radikalen und permanenten Verquickung von Nicht-Fiktionalem und Fiktionalem in der Darstellung. Er benutzt vorgefundene Fotos, Zeitungsartikel und Objekte, ordnet sie neu an, kombiniert sie mit selbst produziertem Material und stellt sie in einen neuen Kontext. Er findet und erfindet also gleicherma-ßen. Alles wird ins Archiv überführt, mit einem Eintrag versehen und einer Aktengrup-pe zugeordnet. So erhält das Material die Autorität eines Dokuments.
Die Sehnsucht der Historiker
Walid Raad sät permanent Zweifel, vernebelt Autor- und Zeugenschaft und hält Quel-len verdeckt. Wie auf diese Weise bewusst gängige geschichtswissenschaftliche Kate-gorien der Authentizität und Evidenz unterlaufen werden, ist auch Gegenstand der AkteFakhouri. Dr. Fadl Fakhouri wird als einer der wichtigsten Historiker des Libanesischen Bürgerkriegs vorgestellt. Nach seinem Tod 1993 übergab seine Familie der AtlasGroup dessen Notizbücher, Fotografien und Super-8-Filme zur Aufbewahrung und Präsenta-tion. Die Bilder aus dem Notebook 72 werden unter dem Titel MissingLebaneseWars zusammengefasst. Auf der Rückseite des orangenen Notizbuchs steht auf Französisch: »Kaum einer weiß, dass die bedeutendsten Historiker der Libanonkriege begeisterte Glücksspieler waren. Sie sollen sich jeden Sonntag auf der Rennbahn getroffen haben. Die Marxisten und Islamisten setzten auf die Rennen eins bis sieben, die maronitischen Nationalisten und Sozialisten auf die Rennen acht bis fünfzehn. Rennen für Rennen standen die Historiker hinter dem Rennbahnfotografen, dessen Aufgabe es war, das Siegerpferd zu fotografieren, wenn es die Ziellinie überquerte. Man erzählt sich auch, dass sie den Fotografen überzeugten (manche sagen: bestachen), nur eine Aufnahme des Siegerpferdes bei dessen Einlauf zu machen. Die Historiker schlossen Wetten darü-ber ab, wann genau – wie viele Bruchteile einer Sekunde bevor oder nachdem das Pferd die Ziellinie überquerte – der Fotograf den Auslöser drücken würde.«
65
Jede der folgenden Notizbuchseiten enthält eine Fotografie aus der Zeitung Annahar aus der Ausgabe vom Tag nach dem Rennen. Die Seiten sind mit Notizen zur Dauer und Distanz des Rennens, Berechnungen der Durchschnittsgeschwindigkeit, den Wet-ten der Historiker, gekennzeichnet durch deren Initialen, dem Ergebnis und einem kur-zen Kommentar zum Wettsieger beschriftet. Diese Serie ist in mehrfacher Hinsicht in-teressant: Denn mehr als um die Frage, was hier stimmt und was eventuell nicht, geht es bei MissingLebaneseWars um eine Reflexion von Geschichtsschreibung und ihren Techniken. Mit der Zusammenführung von Statistik, schriftlicher Aufzeichnung und Bilddokumentation werden in Dr. Fakhouris Notizbuch drei wesentliche historiografi-sche Techniken angewandt. Interessant sind aber die mehrfachen Verschiebungen, die sich in diesen Blättern aufzeigen lassen und durch welche die genannten historiografi-schen Techniken unterlaufen werden. Die Historiker sind wider Erwarten nicht damit beschäftigt, das Kriegsgeschehen zu verfolgen, sondern sie treffen sich regel mäßig bei den Pferderennen. Die Erwähnung von politischen, ideologischen und religiösen Zu-ordnungen liefert außer diesen keine weitere Information. Die Abwesenheit des Kriegs-geschehens drückt sich auch im Titel der Serie aus: MissingLebaneseWars. Es gibt einen Krieg, aber er ist nicht explizit im Bild oder im Aufgeschriebenen präsent. Eine weitere Verschiebung lässt sich darin erkennen, dass die Historiker statt auf ein Pferd auf den Moment wetten, in dem das Foto des einlaufenden Siegerpferdes geschossen wird. Ge-winner ist derjenige, der am präzisesten die Differenz zwischen dem Zieleinlauf und dem Auslösen der Kamera voraussagen kann, also die fotografische ›Verfehlung‹ festzu-halten im Stande ist. Der Ausdruck »Missing« ruft hierbei also noch weitere Bedeutun-gen auf: »Missing has this idea of longing for, yet the inability to arrive. It’s as if you’re always longing for that which you missed«, sagt Walid Raad (Smith 2003, 129). Beschreibt Raad hier nicht das Begehren und zugleich das notwendige Scheitern der Historiogra-fie ? »Longing for yet the inability to arrive.« Den Historikern bleibt also nichts anderes übrig, als zu Glücksspielern zu werden. Sie rekonstruieren keine Vergangenheit, sondern wetten auf die Abweichung der Re-präsentation. Dass dabei sogar noch falsch gespielt werden kann, wird in der angedeu-teten Bestechung des Fotografen deutlich. Und schließlich ergibt sich eine weitere Ver-schiebung durch den Kommentar auf den Notizblockseiten, der sich nicht etwa auf das Siegerpferd oder das Rennen, ja nicht einmal auf das Foto bezieht, sondern auf den je-weiligen Sieger-Historiker, die jeweilige Sieger-Historikerin: »uncivil and sullenly rude. Haughty and arrogant« oder »He was imbued with a patience and otherwordliness
67
ill-suited for politics« oder »With her, there is no cynicism and there are no conclusions, just a clear-eyed and compassionate acknowledgement of things as they are, a quality that can be termed wisdom. We should be grateful when it is handed to us in such gene-rous terms.« Es gibt kein historisches Wissen, nur Wetten und zweifelhafte Zeichen. Die Seiten aus der Fakhouri-Akte implizieren jene zentrale und immanente ›Verfehlung‹ einer Ge-schichtsschreibung mit aufklärendem Anspruch, nämlich die Unmöglichkeit, Geschich-te darzustellen und Erlebtes zu repräsentieren, um die das gesamte Projekt der AtlasGroup kreist. Walid Raad stellt dem eine fiktionalisierende Narration entgegen, die die Inkommensurabilität von tatsächlich Geschehenem und individuell-subjektiv Erfahre-nem mit einrechnet.
Gespenster im Archiv
Welche Qualität haben diese Dokumente aus dem Atlas-Archiv und worüber geben sie Aufschluss ? Sie belegen offensichtlich nicht das, was sich tatsächlich ereignet hat, son-dern das, was vorgestellt, gesagt, sichtbar gemacht und für wahr gehalten werden kann. Walid Raad spricht bezüglich der Dokumente, die er aus gefundenem und selbst produ-ziertem Material erstellt, von »hysterischen Symptomen«: »I consider these documents to be hysterical symptoms that present imaginary events constructed out of innocent and everyday material. Like hysterical symptoms, the events depicted in these documents are not attached to actual memories of events, but to cultural fantasies erected on the basis of memories« (Raad 2000, 47). Den von Sigmund Freud entlehnten Begriff der »hysterical symptoms« (im Gegen-satz zu historical facts) kann man hier als produktive Störungen der Wahrnehmung und Erinnerung verstehen. Unschuldiges und alltägliches Material rekrutiert sich aus einem individuellen und kollektiven Gedächtnis, das unabhängig von einer offiziellen, institu-tionellen Geschichtsschreibung besteht. In einem Land, das bis heute kein Geschichts-buch für den Schulunterricht hat, weil man sich auf keine Version einigen kann, hat eine solche Konzeption eine ziemliche politische Brisanz. Die Arbeiten der AtlasGroup werden oft mit anderen »Atlas-Projekten« der Kunst-geschichte in Verbindung gebracht, zum Beispiel Aby Warburgs Mnemosyne-Projekt oder Gerhard Richters Atlas, die jeweils auf spezifische Art Bilder eines kollektiven oder hoch individuellen Gedächtnisses zusammenstellen. Wie auch der Atlas, impli-ziert das Archiv eine Organisationsform und Ordnung von Wissen und Aussagen.
68
»Das Archiv ist das allgemeine System der Formation und Transformation der Dis-kurse«, schreibt Michel Foucault in seiner ArchäologiedesWissens (Foucault 1973, 188). Beim Archiv handelt es sich demnach um alles andere als einen trägen Speicherraum, in dem sich die Menge der Überlieferungen passiv ablagert oder als bloße Materie se-dimentiert. Das Archiv bewahrt nicht einfach Reste einer Vergangenheit, die durch eine äußere Analyse reaktiviert werden. Das Archiv nach Foucault ist vielmehr direkt zusammengeschlossen mit der Bewegung, die es erschließt. Das Archiv ist folglich ein Prozessbegriff, denn es ist die Möglichkeitsbedingung historischer Forschung und er-laubt, das Gewesene als aktuell fortbestehend zu begreifen. Anders gesagt: Es konstitu-iert eine Art Wirklichkeits-Möglichkeits-Raum. Bei der Serie SecretsfromtheOpenSea vom Aktentyp FD der AtlasGroup handelt sich laut Beschreibung um 29 fotografische Abzüge, die 1993 während der Abrissarbeiten in Beiruts kriegszerstörten Geschäftsvierteln unter dem Schutt gefunden wurden. Die Abzüge zeigten Flächen von verschiedenen Blautönen und hatten alle die Maße 111 x 173 cm, sie waren also sehr groß. Sie wurden 1994 der AtlasGroup zur Aufbewahrung und Analyse übergeben, so die Beschreibung. Die AtlasGroup schickte sechs davon zur che-mischen und digitalen Analyse an Labore in Frankreich und Großbritannien. Bemerkenswerterweise konnten die Labore aus den blauen Abzügen kleine verbor-gene, schwarzweiße Bilder zurückgewinnen, die unter den blauen Flächen verborgen gewesen sein müssen. Über die hierfür verwendeten fotochemischen Techniken gibt die AtlasGroup keine nähere Auskunft. Die geheimnisvollen Bilder zeigten Gruppenport-räts von Männern und Frauen. Der AtlasGroup gelang es, alle in den kleinen Schwarz-weißbildern dargestellten Personen zu identifizieren. Es stellte sich heraus, dass es sich um Personen handelte, die in den Jahren zwischen 1975 und 1991 ertrunken, gestorben oder tot im Mittelmeer aufgefunden worden waren. Vielleicht wird hier deutlicher, was hysterische Symptome oder produktive Störun-gen sein können. Die Serie Secrets ist eine Parodie auf die Suche der Geschichtsschrei-bung nach Ursprüngen und ursprünglichen Dokumenten und vielleicht eine Weise der Infragestellung des Dokuments nach Foucault. Denn was hier konstruiert wird, ist eine Struktur von völlig instabilen Verkettungen und fragwürdigen Verweisen. Zwischen den blauen Flächen und den winzigen Schwarzweißfotografien besteht zunächst kein evidenter Zusammenhang. Dieser muss vielmehr durch den begleitenden Text und das Aufrufen einer Pseudo-Autorität in Gestalt von entfernten, europäischen Laboren her-gestellt werden. Dabei werden die kleinen Fotos als latente Bilder im Blue Screen her-geleitet. Hinter dem Schirm, auf den ja bekanntlich im Film- und Fernsehbetrieb alles
70
projiziert werden kann, befinden sich Bilder wie diese Gespenster des Mittelmeeres. Medien sichern kein ursprüngliches Ereignis im Archiv. Sie konstruieren dagegen kom-plizierte und problematische Verweisketten. Dokumente zirkulieren, tauchen uner-wartet auf und gehen Beziehungen miteinander ein. Der Blue Screen, als den man die großen blauen Fotoflächen auch bezeichnen könnte, steht paradigmatisch für die Un-abgeschlossenheit des Archivs, die potenziellen, imaginären und aktualisierten realen Aussagen und Ereignisse. In den Bildern der Serie manifestiert sich die ozeanische Dimension des Archivs: die Unüberschaubarkeit in Fläche und Tiefe und das Flotieren von Signifikanten ohne sta-bile Beziehung zum Signifikat. Es handelt sich keineswegs um eine Stillstellung der Dokumente. Im Gegenteil, es rumort, brodelt und blubbert permanent in diesem Babel-Archiv, an dem sicher auch Jacques Derrida seine Freude gehabt hätte ob dessen Produktivität, des eruptiven Auf-tauchens der Dinge, Worte und Bilder aus der Latenz und dem ständigen Verweis auf etwas Anderes, auf ein Außen (Derrida 1997).
Die andere Stimme
Die Beobachtung, dass sich den hegemonialen Ansprüchen einer an Fakten und Wahr-heiten orientierten, jedoch prinzipiell an mediale Vermittlung gebundenen klassischen Geschichtsschreibung immer auch etwas entzieht, ihr etwas entgeht und von ihr igno-riert wird, ist Voraussetzung für die Möglichkeit einer anderen Art der Darstellung und einer Neuverteilung der Sprecherpositionen und Handlungsrollen. Eben hier scheinen die Arbeiten der AtlasGroup einen Beitrag zu leisten, indem in ihnen eine andere Er-zählung von Ereignissen, Personen und Dingen wirksam wird, die von klassischen Hie-rarchien der Repräsentation abweicht und im Anschluss an Jacques Rancière mit dem Konzept des »ästhetischen Regimes der Künste« beschrieben werden kann (Rancière 2006). Rancière unterscheidet »drei große Regime der Identifizierung dessen, was wir Kunst nennen« (ibid, 36): das ethische, das repräsentative und das ästhetische Regime der Künste. Während die ersten beiden ihren Ursprung in der Antike haben, bildet sich das ästhetische Regime um 1750 heraus. Im Gegensatz zur staatstragend-didaktischen Rolle der Kunst im ethischen Regime und der hierarchischen Aufteilung der Künste in Gattungen und Genres im repräsentativen Regime, geht es im »ästhetischen Regime« vor allem um eine andere Politik der Darstellung. Diese zeichnet sich durch den Bruch mit Hierarchien der Gattungsformen, Genres und Sujets aus und aktualisiert sich in ei-
71
ner Gleich-Gültigkeit der Gegenstände, einer Austauschbarkeit der Sprecherpositio-nen oder einer Aufmerksamkeit und Beschreibung des Alltäglichen und der Dinge. Was dabei auf dem Spiel steht ist, nach Rancière, die herrschende Aufteilung des Sinnlichen und die feststehende Zuschreibung des Sinnlichen mit Sinn. Die Arbeit der AtlasGroupHostage:TheBacharTapes#17and31 handelt von der so-genannten westlichen Geiselkrise. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht Souheil Bachar, der sich in den Jahren 1983 bis 1993 in Geiselhaft in Beirut befand. Während drei Mona-ten dieser Zeit wurde Bachar zusammen mit fünf amerikanischen Geiseln festgehalten. In den 1980er und 1990er Jahren wurden im Libanon wiederholt US-Amerikaner und andere Personen westlicher Staatsangehörigkeit von militanten Gruppen entführt. Ihr Schicksal hat in den westlichen Medien große Aufmerksamkeit erfahren, wodurch die lokalen politischen Konfigurationen, internationale Involvierungen und die Erfahrun-gen der libanesischen Zivilbevölkerung während der Kriegsjahre eher zurücktraten. Nachdem Souheil Bachar aus seiner Gefangenschaft entlassen wurde, produzierte er gemeinsam mit der AtlasGroup 53 Videokassetten über seine Erfahrungen. Nur zwei davon sind für die Präsentation in Nordamerika und Westeuropa vorgesehen, Nummer 17 und Nummer 31. Gleich am Anfang von Kassette 17 erfahren wir, dass es Bachars aus-drücklichem Wunsch entspricht, dass sein Bericht ins Englische übersetzt und durch eine weibliche Stimme nachsynchronisiert wird. Von Anfang an haben wir es also mit einer Verschiebung der Sprechrollen, Sprachen und Positionen und Bedeutungen zu tun. Zugleich wird damit eine tiefe Diskrepanz zwischen der Darstellung der Geiselkri-se in den westlichen Medien und der arabisch-libanesischen Erfahrung konstatiert. Um diese Diskrepanz geht es: Bachars Erzählungen setzen jeweils an den blinden Stellen ein, die er in den westlichen Repräsentationen der Geiselkrise, und insbesonde-re in den autobiografischen Veröffentlichungen seiner amerikanischen Mitgefangenen konstatiert. Er sagt: »My interest today is in how this kind of experience can be docu-mented and represented. I am also convinced that the Americans have failed miserably in this regard but that in their failure they have revealed much to us about the possibili-ties and limits of representing the experience of captivity.« In ihren autobiografischen Darstellungen, so Bachar, depolitisieren die Amerika-ner den Konflikt und die Geiselkrise. Fast immer beginnen sie ihre Erzählungen mit Beschreibungen des Wetters. Dann schreiben sie über ihre Beziehungen, die zumeist nicht gut liefen, bevor sie in den Mittleren Osten kamen. Es dominieren also psycholo-gische und individuelle Weisen des Umgangs mit der Geiselhaft in den Darstellungen der Amerikaner, statt dass sie als soziales oder politisches Phänomen behandelt wird.
72
Bachar dagegen betont die komplizierte Involvierung der USA, Israels und des Iran und weiterer politischer Akteure in den Libanesischen Bürgerkrieg. Die Geiselnahme stand nämlich im Zusammenhang mit der sogenannten Iran-Contra-Affäre, bei der Amerika Mitte der 1980er Jahre unter der Regierung Reagan Waffen an den Iran verkaufte, um die Freilassung von Geiseln im Libanon zu bewirken, aber auch, um paramilitärische Aktivitäten in Nicaragua zu unterstützen. Was die Amerikaner in ihren Berichten außerdem verschweigen, so Bachar, sind die erotischen Aktivitäten zwischen ihnen und Souheil Bachar. Er spielt an dieser Stelle auf gängige geschlechtliche Kodifizierungen des Ostens und Westens und daran geknüpfte Ängste und Fantasien an, die sich einerseits auf das Bild eines feminisierten Orients und andererseits auf die Abneigung gegenüber dem männlichen arabischen Körper bezie-hen. Mit den BacharTapes wird eine subalterne arabische Stimme in eine der bekanntes-ten historischen Narrationen westlich-arabischer Konflikte eingeführt. Man kann TheBacharTapes auch als Kritik und Infragestellung der Bestimmtheiten des repräsentati-ven Regimes nach Rancière und als Problematisierung von Hierarchien der Repräsen-tation betrachten. Die politische Dimension, die dem eingeschrieben ist, besteht in der Infragestellung von festgeschriebenen Sprechrollen, Identitäten und Positionen und damit auch von Bedeutungen. Was in der Einführung der fiktionalen Geisel Bachar und seines Berichts in eine nicht-fiktionale Historie thematisiert wird, ist die Neuverteilung des Anteils am Gemeinsamen, am Sichtbaren und Sagbaren. »Politik, Kunst, Wissen«, so Rancière, » – sie alle konstruieren ›Fiktionen‹, das heißt materielle Neuanordnungen von Zeichen und Bildern, und stiften Beziehungen zwi-schen dem, was man sieht, und dem, was man zeigt, zwischen dem, was man tut und tun kann« (Rancière 2006, 62). Es steht zu behaupten, dass die Arbeiten der AtlasGroup eben jene Art von Fiktionen schaffen, jenes Spiel von Wirklichkeiten und Möglichkei-ten, und sich somit dem ästhetischen Regime nach Rancière zuordnen. Das Projekt der Atlas Group, so kann zusammenfassend formuliert werden, be-steht darin, das politische und ästhetische Potenzial des Entziehens in den Praktiken der Geschichtsschreibung auszuloten und ausnutzen für andere Formen der Erzäh-lung und eine Neuverteilung der Sprecherrollen und Identitäten. Gespenster, flüchti-ge Er scheinungen und fiktionale Elemente finden einen Platz in der dokumentarischen Dar s tellung und bringen zugleich eigene ästhetische und narrative Formen hervor.
73
Bibliografie
derrida, jacques: DemArchivverschrieben.1997, Berlinfoucault, michel: DieArchäologiedesWissens. 1973, Frankfurt/Main.göckede, regina: ZweifelhafteDokumente.ZeitgenössischeKunst, WalidRaadunddieFragederRe-Präsentation. 2006, in: Regina Göckede und Alexandra Karentzos (Hg.): Der Orient, die Fremde. Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur, Bielefeldkaplan, janet: FlirtationswithEvidence. 2004, in: Art in America, Oktober 2004 S. 134 – 139raad, walid: AlreadyBeenInLakeofFire. 2000, in: Springerin. Hefte für Gegenwartskunst, Nr. 4, 2000 – 2001, S. 42 – 47rancière, jacques: DieAufteilungdesSinnlichen. 2006, Berlin.rancière, jacques: IstKunstwiderständig? 2008, herausgegeben, übersetzt, um ein Gespräch mit Jacques Rancière und ein Nachwort erweitert von Frank Ruda und Jan Völker, Berlinrogers, sarah: ForgingHistory,PerformingMemory.2002, in: Parachute. Nr. 108, Oktober 2002, S. 68 – 79smith, lee: MissinginAction:TheArtoftheAtlasGroup/WalidRaad. 2003, in ArtForum International, Nr. 6, Februar 2003, S. 124 – 129 Kassandra Nakas/Britta Schmitz (Hg.) (2006): The Atlas Group Project (1989 – 2004). A Project by Walid Raad, Köln
74
Das Radio ist ein Medium des Entzugs. In ihm erscheinen Dinge, die sich der An-schauung und der Semiose entziehen, Lärm, Geräusch und Rauschen. Die Radio-stimmen wiederum entziehen sich der Körper, überhaupt ist der Status dessen, was im Radio erscheint, unklar und steht in einem Spannungsverhältnis zwischen unmit-telbarem Ereignis und Simulation. Und nichtsdestotrotz gehört gerade der Entzug zur Ökonomie des Mediums Radio. Der Text zeigt anhand von Walter Benjamins Kin-derhörspiel »Radau um Kasperl« von 1932 jenes strategische Entziehen als kons-titutives Moment des Radios, wobei Radio nicht als Apparat der Repression oder Distribution verstanden wird, sondern als Experimentalsystem.
Die Schule desEntzugs Walter Benjamins Radio-Kasperlvon Katja Rothe
76
Was Kasperl zu erzählen hat: Kinderlieder und -hörspiele aus dem Deutschen Rund-funkarchiv aufgenommen in den 1930er und 1950er Jahren, Frankfurt am Main. Typo-skript zu Radau um Kasperl im Literarischen Archive der Akademie der Künste, Berlin. Walter Benjamin Archiv. 6 lfm.
Am Abend des 10. März 1932 hört man auf den Sendern Köln und Frankfurt am Main das »Pfeifen und Tuten von Schiffsirenen«, die für Kasperl einen »nebligen Morgen« ein-leiten, einen Morgen voller Irrungen und Wirrungen. Mit diesen Geräuschen beginnt eine Übungsstunde, mit der Walter Benjamin in die Funktionsweise des Radios und die Wahrnehmungsmöglichkeiten seiner HörerInnen einführt. Benjamin lässt uns diesen Annäherungsversuch an ein neues Medium anhand einer recht handgreiflichen, schlag-fertigen Figur vollziehen. Kasperl ist der Begleiter durch die radiophonen Medienräu-me, ja mehr noch: Kasperl bringt das Radio durch seine Performance überhaupt erst zur Erscheinung und zwar als Geräuschratespiel, als Test und Übung einer neuen Wahrneh-mungsweise. Benjamins Kasperl tobt durch die Welt der Radios der Weimarer Repub-lik, tritt dessen hehre Bildungsansprüche mit Füßen und bringt mit seiner Vorliebe für geräuschvolle Sinnlosigkeiten die kulturbeflissenen Programmverantwortlichen aus der Fassung. Die HörerInnen verfolgen das geräuschvolle Spektakel und werden durch das Format der Sendung, ein Ratespiel für »Radau«, für Krach und Lärm, mitten hin-eingerissen in das Medienereignis. Und das alles wird dadurch ermöglicht, dass Kas-perl sich dem Radio entziehen will. Überhaupt ist Kasperl im gesamten Stück auf der Flucht. Sein Versuch, sich zu entziehen, seine Flucht ist der Inhalt des Stückes. Letzt-lich stellt sich heraus, dass die Strategie des Entzugs zur Ökonomie des Mediums Radio gehört, eine Ökonomie, die – wie ich nun zeigen möchte – die Ambivalenz zwischen der Unverfügbarkeit der Störung und deren Regulierung im Experimentellen zum Motor ihres Funktionierens macht.
Radiophone Strategien des Entzugs
An einem nebligen Morgen also wird Kasperl von seiner Frau Puschi geschickt, um auf dem Markt einen Fisch zu kaufen. Unterwegs begegnet ihm aber Herr Maulschmidt, der Sprecher des Rundfunks, dessen Namen wortwörtlich Programm war im Radio der Weimarer Republik. Benjamin formuliert seine Kritik an der pädagogischen Mis-sion des Rundfunks in einem Brief an seinen Freund Scholem nicht gerade zurückhal-tend: »Hier quatschen alle Universitätslehrer durch den Rundfunk« (Benjamin 1966,
77
373). Dieser Herr Maulschmidt also möchte unbedingt den »erfahrenen, berühmten Freund der Kinder« vor das Mikrofon bringen (Benjamin 1972, GS IV.2, 677). Kasperl sträubt sich erst heftig, gibt aber schließlich nach, doch nur aus einem ganz persönlichen Grund – es nutzt die günstige Gelegenheit für einen Rachefeldzug gegen seinen frühe-ren Freund Seppel, ein Rachefeldzug, der im absoluten Chaos auf dem Sender endet. Kasperl ›macht‹ Radio:
kasperl: So, das wär fein. Das scheint mir der richtige Augenblick. Räuspert sich. Du miserabliges Mistviech, du ! Elende Kreatur ! Hörst mich ? Wer hat dir das angeschafft, dass du den Flurschütz hast rufen müssen ? Grad, wie ich auf dem Pflaumenbaum gesessen bin. Dös wer ich dir heimzahln. Du Sa-kramentskerl, du elendiglicher ! Komm du mir nochmal vor die Finger ! Dir hab ich eine Watschn zurecht gelegt, da besinnst dich – Telefonläuter.
fräulein: Hier Fernamt. Stimme: Jawohl. Ich verbinde.neue stimme: Polizeipräsidium Putzingen. Dort Rundfunk ? herr maulschmidt: Um Himmelswillen ! Ausschalten ! Unterbrechen ! Der
Malefizkerl, der Kasperl, der Halunke. … Haltet ihn ! Haltet ihn ! Tot oder lebendig, ich muss ihn haben, den Kasperl !
Türenschlagen, Scheppern von Scherben. Neues Telefonläuten.Dazwischen Autohupen.rufe: Da vorn ! Um die Ecke !(Benjamin 1972, GS IV.2, 678f.)
Nach dieser temporären Annexion des Senders muss Kasperl vor der meuchelnden Meute, angeführt vom Herrn Maulschmidt, flüchten. Kasperl funktionalisiert das Ra-dio, das sich an alle richten soll, zu seinem eigenen Nutzen um. Seine Schimpftiraden unterminieren das Eigenbild des Rundfunks, sich in volksbildnerischer Absicht an eine lernwillige Masse zu richten. So, wie nur Radio hören darf, wer die Gebühr bezahlt, so darf im Rundfunk Europas auch nur reden, wer sich gebührend verhält und das heißt, ein angemessenes Reden, das an eine zu bildende, zu führende Masse adressiert ist. Wie die »Zaungäste« (also die SchwarzhörerInnen) so wird auch Kasperl wegen seiner wilden Rede unnachgiebig verfolgt. Die Möglichkeit der Annexion von Radiosen-dern für ordnungsgefährdende Zwecke, die staatsfeindliche Besetzung z.B. der Sender durch die politische Linke, weckte noch vor der Gründung nationaler Rundfunkanstal-ten die schlimmsten Befürchtungen der Staaten Europas. Der Äther des Staates wur-de in Deutschland explizit als nationaler Rundfunk gedacht, der die verstreute Masse
78
unter autoritärer Oberhoheit und kulturpolitischem Auftrag zusammenschließen soll-te. In einem solchen Rundfunk musste jeder Lärm, jedes Rauschen und Geräusch, das sich dem Dichterwort entgegenstellte, bekämpft werden. Im Rundfunk des Herrn Maulschmidt wird die technische Aufzeichnung von Realem in unversöhnlichem Ge-gensatz zur »symbolischen Fixierung von Symbolischem« (Kittler 1995, 289) gedacht. Was im Rundfunk erscheint, soll weiterhin aus den Archiven abzählbarer Zeichenmen-gen (Buchstaben, Ziffern, Noten) kommen: deutsches Kulturgut, Goethe, Schiller, die Herren Professoren etc. Die Möglichkeit der Analogmedien, jede Sequenz reeller Zah-len als Frequenzen wiederzugeben, bleiben diesem Denken suspekt. Sie sollte als Stö-rung, Lärm, Geräusch vermieden und bekämpft werden. Denn im Rauschen und im Lärm ist das Radio ein Medium, dass sich dem Zugriff des Symbolischen entzieht.
Genau dieses Reich des Analogen, der Frequenz, ist das Reich des Kasperls: Das me-taphysische Rauschen eines Orakels auf dem Jahrmarkt wird unter seiner frechen Ko-mik zum puren Spiel der Signifikanten, es ahmt Tierlaute nach und stellt durch sein so verständiges Unverständnis und seine zum Teil brutale Handgreiflichkeit die Welt des Symbolischen auf den Kopf; und das heißt im vorliegenden Fall: auf die Basis des Ra-dios. Beispielsweise gerät der metaphysisch beschworene Auftritt eines transzenden-talen »Geistes«, eines »Zaubermagiers«, »Unsichtbaren«, der die Zukunft vorhersagen kann, zur Echokammer (Benjamin 1972, GS IV.2, 684). Kasperl befragt das Orakel:
kasperl: Soll ich nicht vielleicht die Weltweisheit studieren ? Denn was ist der Mensch ohne Philosophie ?
lipsislapsus: Vieh ! …kasperl: Nun, so werd ich Doktor.lipsislapsus: Tor ! (Benjamin 1972 GS IV.2, 685)
Der »Geist« Lipsislapsus erweist sich als Echo der eigene Frage, völlig unabhängig vom Inhalt und adressierten Sinn – ganz wie das Radio, das wiedergibt, was gespeichert und/oder übertragen werden kann. Lipsislapsus steht im Zeichen des Freud’schen Un-terbewussten, das sich unter Bedingung elektronischer Signalverarbeitung zur Spra-che bringt, im Zeichen des unbewussten Sprechens jenseits bewusster Steuerung. Das Echo – die Stimme, die von ihrem Körper getrennt ist – regte schon seit der Antike Überlegungen zum Schall an, Forschungen zur Verzerrung, Synthetisierung, Simulati-on, Aufzeichnung und Übertragung von Stimmen. Das Echo inspirierte beispielsweise Chladnis Forschungen zum Klang und damit die experimentelle Akustik, aber auch die
79
ersten Apparate zur Schallaufzeichnung. Mit der Technologie der Wellenaussendung, eben der Radiotechnologie, wurde das Echolot, die Ortung von Feinden und Schiffen, möglich und zu guter Letzt sei darauf verwiesen, dass 1929 erstmals beim Sender Mün-chen ein »Echoraum« zur Raumsimulation verwendet wurde (Döhl 1982). Das Echo ist also Radiopraxis. Die Thematisierung des Echos gibt einen Hinweis darauf, wie sehr Walter Benjamin sein Kinderhörspiel von den technischen Bedingungen des Radios her denkt. Kasperl hat es mit der Welt des technischen Mediums Radio zu tun, mit einer Welt voll Senderskalen, Drehkondensatoren und Mikrofonen, einer Welt der Echos, der akusmatischen, nicht lokalisierbaren, haluzinatorischen Stimmen ohne Träger und Subjekt, die sich der Referenz auf einen Sinn verweigern (Chion 2003). Ganz anders also als deutsche Hörspieltheoretiker Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre propa-gieren – das Hörspiel als Hort der Innerlichkeit und befruchtenden, gemeinschaftsbil-denden Funktion des Dichterwortes – entwirft Benjamin das Radio von der Technik her und das bedeutet aus der Perspektive der Störung des Symbolischen, aus der Pers-pektive des Rauschens, der Unterminierung des Sinns durch das Herausstellen der Ma-terialität der Sprache, ihrer Klangqualität und ihrer technischen Reproduzierbarkeit jenseits von Operationen der Semiose. Benjamins Kasperlradio bringt zur Erscheinung, was sich dem Symbolischen entzieht.
Radau ! Experimentalordnungen
Aber diese Ordnung analoger Medien, die das Reale aufzeichnen und übertragen kön-nen, ganz unabhängig von Sinn und Bedeutung, die auch »Radau« speichern, Lärm und Krach und Rauschen, ist nicht einfach eine Welt chaotischen Spiels und komischer Stö-rungen. Benjamin stellt die Frage der Macht: Nicht nur annektiert Kasperl den Sender und betreibt einen Missbrauch des Rundfunkgeräts. Am Ende des Hörspiels stellt sich heraus, dass die Störungen Kasperls gewollte waren und von den Rundfunkleuten über-wacht wurden. Nach wilden Verfolgungsjagden nämlich erwacht Kasperl verletzt zu Hause in seinem Bette. Dort hatten die Rundfunkleute in der Zwischenzeit unbemerkt ein Mikrofon installiert und Kasperls Tiraden mitgeschnitten.
herr maulschmidt: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir vom Rundfunk sind doch schlauer als du. Während du in der Stadt deine Schandtaten verübt hast, haben wir heimlich hier in deinem Zimmer unter dem Bett ein Mikro-phon aufgebaut, und nun haben wir alles, was du gesagt hast, auf Platten und hier habe ich dir gleich eine mitgebracht. Hört nur zu: … (Benjamin 1972, GS IV.2, 694f.)
80
Das unmittelbare Ereignis, die Störungen, die Flucht erweisen sich als Kasperls traum-wandlerischer Monolog, gebannt auf einer Platte, die Herr Maulschmidt triumphierend vorspielt. Am Ende des Hörspiels ist der Hörer/die Hörerin mit erst durch analoge Spei-chermedien möglichen Zeitachsenmanipulationen konfrontiert, mit der Verwürfelung eines seriellen Datenstroms (vgl. Kittler 1993). Voraussetzung hierfür ist die Möglich-keit der Speicherung und damit Vorproduktion, die im deutschen Rundfunk erst seit 1930 und auch nur spärlich eingesetzt wurde. Kasperls Spektakel mit all seinen Entzü-gen und Störungen zeigt sich als Effekt von Übertragung und Speicherung, als Live-Ef-fekt des Radios.
In dieser letzten Szene wird darüber hinaus deutlich, dass der flüchtende, sich entzie-hende Kasperl von einer technischen Apparatur und durch den Experimentator, Herrn Maulschmidt, innerhalb eines experimentellen Arrangements akustisch überwacht, be-obachtet worden ist. Das Radio stellt sich als Beobachtungsinstrument heraus, das auch die HörerInnen auf eine Position der Kontrolle, der Beobachtung verweist.
Benjamins Kinderhörspiel inszeniert also an den Grenzen, an den offenen Wunden der symbolischen Ordnung Kasperls Katastrophen, Störungen, seine Flucht und Aus-fälligkeiten. Doch diese spektakuläre Szene der Störung und des Entzugs ist gleichzei-tig Ort einer experimentellen Annäherung an das Radio und seine HörerInnen. Und eben dieser experimentelle Zugriff ist erklärtermaßen auch Benjamins theoretischer Zugriff auf das neue Medium.
Walter Benjamin konzipierte sein Hörspiel für Kinder als experimentelles Ge-räuschratespiel. Viel deutlicher als in der vorliegenden gedruckten Fassung war wohl der ursprüngliche Plan des Hörspiels – da hieß es noch Kasperl und der Rundfunk, eine Geschichte mit Lärm – auf die Einübung des Publikums in die neuen medialen Räume gerichtet (Schiller-Lerg 1984). Das Hörspiel sollte eine Reihe von Episoden – durch den Zoologischen Garten, über einen Jahrmarkt usw. – vorführen, »deren Kernstück jeweils in verschiedenen charakteristischen Geräuscharten besteht, die hin und wieder von Andeutungen, Worten unterbrochen werden« (Benjamin nach Döhl 1987). Dabei sollten die einzelnen Sequenzen so offen bleiben, dass sie sich die HörerInnen »nach ih-rem Gefallen (…) ausmalen können, die jeweiligen Geräusche erraten müssen, um die Lösungen dann zur Preisverteilung an den Sender einzuschicken« (ibid.). Ein Rund-funksprecher sollte vorab das experimentelle Ratespiel erklären. Im Manuskript der Sendung vom 10. März 1932, 19.45 bis 20.45, im Sender Frankfurt am Main unter der Regie von Benjamin selbst sind die zu erratenden Geräusche als »Erster«, »Zweiter«, »Dritter Radau« handschriftlich notiert (ibid.). Die Südwestdeutsche Rundfunk-Zeitung
81
forderte das Publikum bereits im Vorhinein auf, »die hierbei auftretenden Geräusche« zu erraten und »dem Südwestfunk mitzuteilen« (Südwestdeutsche Rundfunk-Zeitung 1932, 1). Im Hörspiel werden den HörerInnen außerdem Hörfiguren angeboten, die eine ähnliche Aufgabe zu bewältigen haben: Beispielsweise erraten unter Anleitung des Kasperls Kinder im Zoo Tierlaute (Benjamin 1972, GS IV.2, 689f.). Benjamin konst-ruiert also in seinem Hörspiel eine Ratesituation, eine Testsituation für die großen und kleinen Kinder im und vor dem Radio. Er fordert die HörerInnen immer wieder auf, auf die Materialität der Sprache, auf das Geräusch und das Rauschen im Radio zu ach-ten und bietet (meist recht leicht als Ulk erkennbare) Interpretationen des Nicht-Inter-pretierbaren an. Das Radio und seine unerfahrenen HörerInnen sind für Benjamin – der immer das Verständnis des Rundfunks als paternalistisches Volksbildungsinstitut kri-tisiert hatte – eine Experimentalanordnung, in der performativ Wissen über den neu-en medialen Raum hergestellt wird. Benjamin geht es dabei um die Entwicklung einer »neuen Haltung«, um die performative Aneignung eines neuen Mediums im Medium (Benjmin 1977, GS II.2, 661f.). Dabei werden – wie das Ende des Stückes zeigt – nicht nur HörerInnen, sondern auch Radioexperten wie der hinterhältige Herr Maulschmidt in die Experimentalanordnung miteinbezogen.
Aus der technisch ausgelösten Krise der Anschauung, der Referenz, des Symbo-lischen macht das Hörspiel eine Experimentalanordnung, in der das, was sich der Sig-nifikation entzieht, zur Erscheinung gezwungen wird, in der das Phantasma der Mög-lichkeit einer Repräsentation ins Spiel gesetzt wird. Es werden Hörfiguren konstruiert, die stellvertretend für die unzugänglichen vielen HörerInnen zu Hause die »Geschichte mit Lärm« durchleben, Tierstimmen deuten und Geräusche erraten. Gleichzeitig treten auch die Radioexperten selbst auf. Kasperl wird als Leiter der Geräuschratespiele akus-tisch von Herrn Maulschmidt beobachtet. Die HörerInnen wiederum beobachten akus-tische Beobachtungsszenerien. Wie sich letztlich herausstellt, werden dabei die Reak-tionen der Hörfiguren einerseits zur Dokumentation aufgezeichnet. Andererseits zielt das Stück aber auf die Reaktionen jener, die die Aufzeichnung in ›Echtzeit‹ verfolgen – z.B. auch Kasperl und Puschi am Ende des Stückes, wenn ihnen Herr Maulschmidt das Hörspiel vorspielt. Das Stück exponiert also eine Experimentalsituation, in der Störun-gen, »Radau« und Lärm zum nicht-verfügbaren, sich entziehenden Zentrum einer Wis-sensproduktion im zweifachen Sinne werden: Es ist eine experimentell-performative Annährung an a) das Radio als technisches Medium, das sich dem Spiel der Repräsen-tation entzieht und b) an die vielen, unbekannten HörerInnen, die ebenso unzugänglich in ihrer Zerstreuung und Abwesenheit sind, die aber nichtsdestotrotz über die Vorfüh-
82
rung von Techniken der Beobachtungen in eine Haltung des Experimentellen eingeübt werden sollen. Die Beobachtung ist hier also nicht mehr nur exploratives Mittel eines Experimentators, sondern wird als eine Selbsttechnik der vielen zerstreuten HörerIn-nen entworfen, über die man auf die gestörten, unbewussten, verrauschten und simu-lierten Vorgänge im Radio zugreifen kann.
Das Experimentieren hat hierbei nicht die Funktion, eine klar definierte Hypothe-se oder Theorie zu bestätigen oder zu widerlegen noch ist eine distanzierte Beobach-tungsposition vorgesehen. Vielmehr wird ohne vorgängiges Wissen das sich entziehen-de Kontingente des technischen Mediums, die Welt der Frequenzen und des Rauschens innerhalb eines performativ agierenden Experimentalsystems positiviert. Benjamins Hörspiel konstruiert ein Experimentalsystem im Sinne Hans-Jörg Rheinbergers: als »Anordnungen zur Manipulation von Objekten des Wissens, die eingerichtet werden, um unbekannte Antworten auf Fragen zu geben, die wir ihrerseits noch nicht klar zu stellen vermögen« (Rheinberger 1994, 408). Experimentalanordnungen eröffnen den Prozess einer Wissensproduktion als eine provisorische Bastelei, deren unerwartete Ergebnisse neue Theorien begründen (ibid.).
Experimentelle Zähmungen
Diese ›Zähmung‹ des Kontingenten im Experimentalsystem erscheint vor allem aus machtpolitischen Gründen notwendig. Denn die zerstreute Masse der vielen einzelnen RadiohörerInnen entzog sich dem Wissen und der Ordnung der Repräsentation, was Rundfunkverantwortliche und staatliche Stellen, aber auch die HörerInnen selbst ver-unsicherte. Die zerstreute Masse ist eine medial erst konstituierte, räumlich kaum be-grenzte und zeitlich sehr dynamische ›Öffentlichkeit‹, die aus vielen verstreuten Einzel-nen besteht. Michael Gamper beschreibt diese medialisierte ›Masse‹ als fluktuierende, unstetige, sich entziehende Erscheinung, die sich nicht – wie etwa die ›Nation‹ – in ihrer Repräsentation zu erkennen gibt. Sie erscheint vielmehr nur in der Performance ihres Auftretens. Wenn sie nicht gerade Medienereignis ist, ist sie immer nur virtuelle bzw. potenzielle Masse (Gamper 2007, 20, 475–509). Diese zerstreute Masse der Radio-hörerInnen war ob ihrer ereignishaften Unzugänglichkeit in den ersten Jahren des eu-ropäischen Radios immer wieder Ziel von Geräusch-Testsendungen und HörerInnen-befragungen in den Rundfunkzeitschriften (Schmitthenner 1978, 230; Gethmann 2005, 308). Darüber hinausgehend und ergänzend zu den allerorts kursierenden spiritistisch, hypnotischen Machtfantasien (Hagen 2002, 2001), schlugen Hans Bredow, Bertolt
83
Brecht und Manfred von Ardenne einen strikt disziplinierenden, psychotechnischen Zugriff auf diese zerstreute Masse vor: Hans Bredow, immerhin Begründer des deut-schen Rundfunks, und der Radiorevolutionär Bertolt Brecht denken das Radio als Teil arbeitswissenschaftlicher Optimierungsmaßnahmen gegenüber einer Masse im tech-nisierten Arbeitsalltag, als Instrument, dessen störungsfreies Funktionieren aufgrund seines strategischen Nutzens zur Debatte steht (Herrmann 2002; Rothe 2009).
Benjamins Kinderhörspiel (das sich aber nicht nur an Kinder richtete) wiederum fragt nach der unbekannten, unzugänglichen Größe ›HörerInnen‹ nicht in Form der Zu-richtung, im Test, sondern im Modus eines Experimentalsystems. Man könnte weiter-hin mit Rheinberger sagen, dass das epistemische Ding »RadiohörerInnen«, das neue, interessante Phänomen der zerstreuten Masse, die stets im Fluss, im Werden ist, die sich nicht greifen lässt, hier mit Hilfe von Figuren fixierbar und damit beobachtbar gemacht werden soll (Rheinberger 1994, 409). Die Hörfiguren wären so Darstellungs-möglichkeiten für das epistemische Ding RadiohörerInnen, das selbst einen prekä-ren Status hat und von »charakteristische(r), irreduzible(r) Vagheit« geprägt ist (ibid., 408). Diese erste, provisorische Fixierung wiederum führt im Falle der RadiohörerIn-nen letztlich zur Etablierung eines – um in der Logik Rheinbergers zu bleiben – techni-schen Dings: der statistisch konstituierten Figur des DurchschnittshörerInnens, wie er ab den 1940er Jahren in der Demoskopie auftaucht. Der DurchschnittshörerInnen wie-derum erscheint wohl nicht ganz zufällig im Kontext eines Hörspiels, das ganz gezielt mit Störungen spielt: Orson Welles’ Krieg der Welten von 1939. Der öffentliche Aufruhr um dieses Hörspiel initiierte Hadley Cantrils Studie The Invasion from Mars. A Study in the Psychology of Panic (1940), eine erste empirische Studie zur Suggestibilität elektroni-scher Medien (Hagen 2005, 244–247; Hagen 2003, 23–36).
Bezogen auf die Frage nach der Macht heißt das also: In Benjamins radiophonem Kasperltheater ist nicht primär die Disziplin am Werk. Es geht hier nicht um die Durch-setzung einer Verhaltensregel oder Norm durch Prozeduren der Zurichtung. Vielmehr konstruiert dieses Stück denormalisierte Szenarien, die von Störungen geprägt sind: Es setzt die Angst vor dem neuen Medium, die Frage nach Kontrolle und Bewusstsein in eine Denormalisierungsszene, um diese wiederum zum exemplarischen Schauplatz ei-ner experimentellen Annäherung an das sich entziehende Radio werden zu lassen.Im Zentrum dieser theatralen Bewegung steht die Figur des Kasperls, die einerseits für die Bedrohung steht, für Risiko und Störung, und sich gleichzeitig als ›Instrument‹ in einer Experimentalanordnung erweist, mit Hilfe dessen das »betreffende Ding dazu gebracht wird, sich mit einer seiner Eigenschaften an der Veranstaltung zu beteiligen,
84
die man mit ihm auf dem Labortisch anstellt« (Rheinberger 2001, 55f.). Die Figur stört nicht einfach, sondern schafft die Möglichkeit, den Ansatzpunkt, um auf die denorma-lisierten, störungsanfälligen Ereignisräume und auf ihre sich entziehenden AkteurIn-nen, operativ-performativ, also normalisierend zuzugreifen: Die Kinder erleben durch Hörfiguren die Szene mit, vollziehen sie nach und sollen so mit dem »Radau« im theatra-len Spiel experimentell umgehen lernen – gewissermaßen im akustischen Vollzug akus-tisch alphabetisiert werden. Dabei kann Benjamin auf die Tradition der Kasperlfigur rekurrieren.
Ein kleiner Exkurs zur Kasperei
Seit Ende des 18. Jahrhunderts langt auf den Jahrmarktsbühnen das buchstäblich wehr-hafte Kasperl mit gewitzter Beherztheit zu und bewältigt auf diese schlagfertige Weise so manches Problem, das die ZuschauerInnen nicht zu lösen vermochten (Ernst 2003). Kasperl trotzt Gendarm und Büttel, nimmt sich, was seinen Bedürfnissen entspricht und lässt sich von niemandem dreinreden. Kasperl wehrt sich gegen die bestehende Ordnung. Die offene Gewalttätigkeit und der schlagende Humor des Kasperls feiern auf den Bühnen Europas genau zu einer Zeit ihren größten Erfolg, in die Foucault zu-folge der Beginn des gouvernementalen Regierens und das damit einhergehende Ver-schwinden der Sichtbarkeit der disziplinierenden, gewaltsamen Macht fällt. Man könn-te Kasperl so als eine Figur des Widerstandes gegen die Invisibilisierung der Gewalt des Regierens begreifen, eine Figur, die die verdeckte Gewalt der Disziplin (Büttel und Gendarm) exponiert und der Kritik zugänglich macht. Aber über die Ausstellung der Disziplinarmacht hinaus – so meine These – operiert Kasperl bereits effektiv im Feld der Gouvernementalität, in dem die Frage der Macht zu einer Frage des »Führen(s) der Führung« wurde und die Gewaltverhältnisse tief in die performative Normalisierung der Subjekte eingeschrieben ist (Foucault 1987, 255).
Einerseits ist Kasperl also eine Instanz der Kritik des ›gemeinen‹ Volkes. Diese Posi-tion der Kritik ist von den Mächtigen geduldet, ja gefördert. Denn wie der Hofnarr übt Kasperl Kritik und Parodie in einem genau definierten Bereich und von einem klar mar-kierten Ort aus: Kasperl spricht von der Ausnahme her über die Norm und Disziplin und zwar in einem Reflexionsraum, dem Theaterraum, der ebenfalls vom alltäglichen Leben ausgenommen ist. An diesem Ort des »ganz Anderen« ist die Kritik gut umzäunt und eingegrenzt.
85
Im Übergang zum 19. Jahrhundert jedoch rückt die Figur in einer eigentümlichen Wen-dung selbst ins Zentrum der Disziplinarmacht, wird Gegenstand psychiatrischer Be-obachtung und ärztlicher Diagnose. »Der Suppenkasper« ist das erfolgreichste Kapi-tel des weltweit bekannten Struwelpeters, den der Psychiater Heinrich Hoffmann 1844 für die Unterhaltung und die ›Charakterbildung‹ seines Sohnes schrieb. Hoffmann, der als leitender Arzt in der Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische im Feld der Jugend-psychiatrie tätig war, benutzt die Figur, um der Öffentlichkeit die bis dato weithin un-bekannte Krankheit der Anorexia nervosa bekannt zu machen. Gleichzeitig sollte der Text das jugendliche Publikum erziehend unterhalten und anhand recht drastischer Bil-der zu einem ›normalen‹ Essverhalten anhalten. Der Suppenkasper als die Figuration des Anormalen wird Gegenstand wissenschaftlicher Darstellung und fungiert als er-ziehendes Exempel. Der beobachtende ärztliche Blick und die normalisierende Anlei-tung zum ›richtigen‹ Verhalten greifen hier ineinander. Das Kasperltheater der Essens-verweigerung ist zugleich Ort des Interesses der Psychiatrie wie Feld pädagogischer Interventionen. Die scheinbar rasende Widerständigkeit der Figur ist hier Teil eines quasi-experimentellen Arrangements, in der die Folgen der Essensverweigerung in al-len Phasen protokolliert (»am nächsten Tag«, »am dritten Tag« usw.) und bis zur letz-ten Konsequenz (»und war am fünften Tage tot«) ausbuchstabiert wird (Hoffmann 1917). Kasperl wird zur Figur des Anormalen und somit zum Gegenstand der sich im 19. Jahrhundert formierenden Normalisierungsmacht (Foucault 2003). Das neue psych-iatrische Wissen umkreist Kasperl nicht mehr als Einzelnen, der außerhalb der Norm steht und sich gegen die Disziplin stellt, sondern als einen bestimmten Typ von Anor-malität, als eine Form der zu beobachtenden Abweichung, die die Kindheit befällt und der von Seiten der ›Experten‹ (PädagogInnen, TheologInnen, ÄrztInnen und Eltern) entgegenzuwirken ist. Als ›Kinderbuch‹ mäandert die Figuration der psychiatrischen Intervention der Normalisierungsmacht in den Alltag der Heranwachsenden und er-langt eine enorme internationale Popularität.
Seinen Triumphzug als pädagogische Paradefigur bürgerlicher Erziehung tritt Kas-perl Anfang des 20. Jahrhunderts an, als Max Jacob, Anhänger der Wandervogelbewe-gung, es zur Figur seines reformpädagogisch inspirierten und volkstümlichen Puppen-theaters machte. Der sogenannte »Hohensteiner Kasper« bekommt durch Jacob sowohl das Aussehen als auch den erzieherischen Schliff, den er bis heute – beispielsweise in der Augsburger Puppenkiste – hat. Dieser neue, freundlichere Kasper ist zumeist (wie schon der Suppenkasper) selbst ein Kind, ist nicht mehr derb und grob, sondern lustig und witzig, manchmal auch naiv, aber immer ein durchwegs positiver, sympathischer
86
Held. Der Hohensteiner bekommt sogar einen Freund: den Seppel, der auch in Benja-mins Hörspiel eine Rolle spielt. Wie der Suppenkasper bewohnt der Hohensteiner Kas-per den Alltag der Kinder und treibt nicht mehr auf den Jahrmärkten sein Unwesen. Der Kasper der Moderne steht ganz offensichtlich im Dienste der Erziehung des zu bessern-den Individuums: Es gibt inzwischen Polizei- oder Verkehrskasper (Hans Krause aus Hamburg), Feuerwehr-, Zahnputz-, Geldspar- und Umweltkasper.
Der Hohensteiner Kasper ist dabei nicht mehr Figuration des Anormalen, von der es sich abzugrenzen gilt, sondern hat im performativen Spiel der Normalisierung selbst Platz genommen. Ganz im reformpädagogischen Sinne leitet es durch seine Abenteuer zur Selbsttätigkeit an, ist eine Figur der Einübung und nicht der autoritären Unterwei-sung oder Abschreckung. Die Performativität von Handeln und Erleben stehen im Vor-dergrund einer experimentellen Erschließung der Welt.
Benjamins Kasperl steht in der Tradition des Hohensteiner Kaspers, auch wenn Ben-jamin der Reformpädagogik kritisch gegenüberstand (Birkmeyer 2008; Deuber-Man-kowsky 2000). Das Kasperl in Benjamins Hörspiel eröffnet einen Übungsraum für eine durch das Radio erstmals auftauchende Wahrnehmungsweise. Es führt in die Funk-tions- und Wirkungsweise des ersten elektronischen Massenmediums ein und konstitu-iert die Figur des aktiven Radiohörens. Das Radiokasperl operiert in dem Stück als eine Experimentalfigur, die die HörerInnen testet und gleichzeitig schult. Benjamins Kas-perl ist eine Figur der experimentellen Regulierung.
Die Produktivität der Störung
Benjamins Hörspiel kann man als Experimentalsystem verstehen, das – im Gegensatz zum weit verbreiteten paternalistischen Verständnis des Radios der Weimarer Repu-blik – einen regulierenden Zugriff auf die neue Welt des Radios verspricht, auf eine Welt, die von einer permanenten Bewegung des Entzugs geprägt ist. In der Experi-mentalisierung des Ereignisses der Störung im Raum des radiophonen Kasperltheaters liegt ein Normalisierungspotenzial, das angesichts der Störungen im Reich des Symbo-lischen auf die Sicherheit von Beobachtung und Repräsentation zielt, ohne aber Störun-gen negieren oder ein festes Regelwerk installieren zu müssen. Die Störungen sind das sich immer wieder entziehende Zentrum der Performance des Radios und Kasperl ver-körpert diese doppelte Bewegung.
Benjamin stellt also in seinem Kasperlhörspiel die Frage nach adäquater und effekti-ver Anleitung von Verhaltensweisen, die indirekt verfährt, indem sie die Potenziale zur
87
Selbstregierung stärkt und strukturiert. Es geht dabei nicht um die Installierung eines bestimmten Regelsystems, sondern um ständige Modifikation, Anpassung und Infra-gestellung von Verhaltensweisen, um eine Haltung des Experimentierens. Das Expe-rimentalsystem Benjamins ist mithin ein regulierendes Instrument der gouvernemen-talen Erschließung des Radios. Kasperl schafft dabei den Übungsraum für eine durch das Radio erstmals auftauchende Wahrnehmungsweise. Es führt in die Funktions- und Wirkungsweise des ersten elektronischen Massenmediums ein. Das Radiokasperl ope-riert in dem Stück als eine Experimentalfigur, die die HörerInnen testet und gleichzeitig schult. Es ist eine Figur der experimentellen Regulierung, einer Regulierung über dem Abgrund, den die Referenzlosigkeit des Radios aufreißt. Denn das Radio – und daran sei zum Schluss erinnert – ist und bleibt trotz allen Repräsentationsbegehrens ein Me-dium der Unvorstellbarkeit, ein Austragungsort einer Krise der Anschauung, ein Me-dium, das ja gerade die Rückführung der Stimme auf einen Körper, auf ein Wesen, auf eine Referenz unmöglich macht, ein Medium, das die Frage nach dem Status dessen stellt, was in ihm erscheint. Das Radio bleibt damit ein Medium des Entzugs. Doch den Weg, den das epistemische Ding Radio nimmt, um sich zu entziehen, ist die Spur, die im Radioexperiment Benjamins in der Figur des Kasperls zum Erscheinen gebracht und damit wiederum einem Wissen über das Radio zugänglich gemacht wird. In der Figur des flüchtenden Kasperls wird die Spannung zwischen dem Wissen von der Regulie-rung und den Abgründen des Wissens im Ereignis der Störung produktiv.
Bibliografie
benjamin, walter: RadauumKasperl. 2003, Tondokument, Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv (dra): Was Kinder gerne hör(t)en. Was Kasperl zu erzählen hat: Kinderlieder und -hörspiele aus dem Deutschen Rundfunkarchiv aufgenommen in den 1930 er und 1950 er Jahren, Frankfurt a. M.benjamin, walter: BertBrecht. 1977, in: Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser (Hg.): Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Bd. II. 2, Frankfurt a. M., S. 660 – 667benjamin, walter: RadauumKasperl.1972, in: Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Bd. IV. 1,2, Frankfurt a. M., S. 674 – 695benjamin, walter: BriefanScholemimFebruar1925. 1966, in: Gershom Scholem/ Theodor W. Adorno (Hg.): Walter Benjamin: Briefe. Bd. 1, Frankfurt, S. 373
88
burke, peter: Helden,SchurkenundNarren.1981, Europäische Volkskultur in der frühen Neuzeit, Stuttgartchion, michel: Mabuse–MagieundKräftedes»Acousmetre«.2003, Auszug aus Die Stimme im Kino, 1999, in: Cornelia Epping-Jäger, Erika Linz (Hg.): Medien/Stimmen, Köln, S. 124–159döhl, reinhard: WalterBenjaminsRundfunkarbeit.1987, http://www.stuttgarter-schule.de/benjamin.htm, 01. 03. 2009döhl, reinhard: NichtliterarischenBedingungendesHörspiels.1982, in: Wirkendes Wort. Jg. 32/3, S. 154 – 179gamper, michael: Masselesen,Masseschreiben.EineDiskurs-undImaginations- geschichtederMenschenmenge1765 – 1930. 2007, Münchengethmann, daniel: TechnologiederVereinzelung.DasSprechenamMikrophonim frühenRundfunk. 2005, in: Daniel Gethmann, Markus Stauff (Hg.): Politiken der Medien. Zürich/Münchenhagen, wolfgang: DasRadio.ZurGeschichteundTheoriedesHörfunks– Deutschland/USA. 2005, Münchenhagen, wolfgang: Lazarsfeld»SozialePhysik«.FüreineArchäologiederDemoskopie. 2003, in: Gegenwartsvergessenheit. Lazarsfeld, Adorno, Innis, Luhmann, Berlin, S. 23 – 36hagen, wolfgang: DieentwendeteElektrizität–ZurmedialenGenealogiedes »modernenSpiritismus«. 2002, in: Torsten Hahn, Jutta Person, Nicolas Pethes (Hg.): Grenzgänge zwischen Wahn und Wissen. Zur Koevolution von Experiment und Paranoia 1850 – 1910, Frankfurt a.M., S. 215 – 239hagen, wolfgang: RadioSchreber.DermoderneSpiritismusunddieSpracheder Medien. 2001, Weimarherrmann, hans-christian von: PsychotechnikversusElektronik.Kunstund MedienbeimBaden-BadenerKammermusikfest1929. 2002, in: Stefan Andriopoulos, Bernhard J. Dotzler (Hg.): 1929. Beiträge zur Archäologie der Medien, Frankfurt a.M., S. 253 – 267kittler, friedrich: Aufschreibesysteme1800 /1900. 1995, Münchenkittler, friedrich: RealTimeAnalysis,TimeAxisManipulation.1993, in Fried- rich Kittler: Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig, S. 182 – 206schiller-lerg, sabine: WalterBenjaminundderRundfunk.Programmarbeit zwischenTheorieundPraxis. 1984, Münchenschmitthenner, hans-jörg: ErstedeutscheHörspieldokumente. 1978,
89
in: Rundfunk und Fernsehen. Jg. 26 /2, S. 229 – 245. Südwestdeutsche Rundfunk-Zeitung, Jg. 8/10, 1932, S. 1rheinberger, hans-jörg: ObjektundRepräsentation. 2001, in: Bettina Heintz, Jörg Huber (Hg.): Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten, Zürich/Wien, S. 55–61rheinberger, hans-jörg: Experimentalsysteme,EpistemischeDinge,Experimental- kulturen.ZueinerEpistemologiedesExperiments. 1994, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, H. 42 /3, S. 405 – 418rothe, katja: Katastrophenhören.ExperimenteimfrüheneuropäischenRadio. 2010, Berlin (in Druck)stauff, markus: DasneueFernsehen. 2005, Machtanalyse, Gouvernementalität und digitale Medien, Münster
91
Das Ende der Geschichte ist zwar schon wieder vorbei, doch damit ist noch lange nicht geklärt, wie sie weitergehen soll. Es fehlt dabei gar nicht so sehr an Perspektiven, da-für aber an der Naivität, die nötig wäre an diese zu glauben oder sie gegen Widerstände durchzusetzen. Zwar sind wir deshalb noch lange nicht einverstanden, doch das Vorbild für dieses Uneinverständnis erscheint angesichts des »wie soll es weitergehen ?« doch erstaunlich nahe an der Kapitulation: das »I would prefer not to« Bartlebys2, mit wel-chem dieser auf die Ansprüche der bürgerlichen Gesellschaft antwortet, die durch sei-nen Vorgesetzten an ihn gerichtet werden. Darin, und das ist von Bedeutung, leistet er weder Widerstand noch Widerspruch, er äußert lediglich eine Präferenz, entzieht sich. Sein Rückzug ist aber nicht bloß ein Beispiel vermeintlich subversiver Lebensführung, sondern auch ein mögliches Paradigma der Reflexion von Machtverhältnissen (z. B. bei Agamben 1998, 48).
Da Rückzug weder einer Perspektive noch der Entschlossenheit bedarf, ist der Reiz dieses Modells in Zeiten, in denen es an beidem zu mangeln scheint, zwar nachvollzieh-bar, aber es sollte doch zu denken geben, wie sehr Bartleby vom Großmut seines Vor-gesetzten abhängt, der ihn für verwirrt hält und eine fast väterliche Verantwortung auf sich nimmt. Subversives Leben als eine Irrung, die sich die bürgerliche Gesellschaft ge-fallen lässt, weil ihr die Verirrten leidtun, mehr noch die auf dieses Gefallenlassen an-gewiesen ist ? Die Rückübersetzung der Metapher in die politische Praxis lässt das an ihr orientierte Ideal in einem wenig vorteilhaften Licht erscheinen. Noch unvorteilhaf-ter, aber erschreckenderweise ebenso passend, ist das Ende Bartlebys, der Erzählung wie eben auch ihrer Hauptfigur. Sein Vorgesetzter bringt es zwar nicht übers Herz, ihn vor die Tür zu setzen, entschließt sich stattdessen aber, Bartleby alleine zu lassen, seine schützende Hand nicht mehr über ihn zu halten. Bald darauf landet dieser im Gefäng-nis, wo er schließlich verhungert. Nicht weil er schlecht behandelt wird, sondern weil er, seinen Entzug bis zur letzten Konsequenz fortsetzend, selbst die Nahrungsaufnah-me verweigert. Es ist wohl kaum nötig diese Metapher ein weiteres Mal rückzuüberset-zen. Der Entzug als politische Strategie bedarf entweder anderer Vorbilder oder zumin-dest einer Kritik des gegebenen.
Ein weit weniger trostloses Beispiel für eine Politik des Entziehens gibt Benjamin in seiner Kritik der Gewalt: den revolutionären Generalstreik (Benjamin 1921/1991).3
1 Girl zu Cat in »Cat and Girl« Nr. 634, online unter: http://catandgirl.com/?p=634 (abgerufen am 21. Dezember 2008).
2 Der Antiheld aus der gleichnamigen Erzählung Herman Melvilles.
3 Auch Agamben schreitet quasi von Melville zu Benjamin fort, aber das nur am Rande (vgl. Agamben 1998, 63–67).
92
Trotz der augenscheinlichen Unterschiede zwischen einer kollektiven politischen Nicht-Handlung, welche die geltende Ordnung transformiert, und der resignativen Nicht-Handlung eines einzelnen Individuums, fungieren beide als Modelle für Strate-gien des Rückzugs aus der bürgerlichen Gesellschaft. Der gravierendste Unterschied ist die Art und Weise, wie sich beide auf die Allgemeinheit rückbeziehen, der sie sich zu entziehen trachten. Im Begriff des Generalstreiks stehen sich eigentlich zwei All-gemeinheiten gegenüber, einerseits die wirkliche der herrschenden, andererseits die po-tenzielle der kommenden Ordnung. Die ArbeiterInnen ziehen ihre Legitimation dabei daraus, dass die wirkliche Allgemeinheit sie ausbeutet, aber letztlich für ihr Fortbeste-hen auf sie angewiesen ist, also mit einem inneren Widerspruch behaftet scheint, den zu lösen sie die Macht haben, indem sie einfach nicht mehr an dieser partizipieren. Von Bartleby ist nicht einmal klar, ob er einen solchen allgemeinen Anspruch überhaupt er-hebt, jedenfalls spricht er keinen aus. Er versucht zwar ebenso sich nach Kräften der Gesellschaft zu entziehen, erweckt dabei aber nicht den Anschein, als ob er über die Ge-walt verfügte, die nötig wäre, um die herrschende Ordnung auch nur zu verändern.
Es scheint einen Zusammenhang zwischen der Ohnmacht und der Legitimations-schwäche eines politischen Anspruchs zum einen und zwischen dieser Schwäche und der Wahl des Entzugs als politischem Mittel zum anderen zu geben. Benjamin behan-delt diese Zusammenhänge, indem er nach der Legitimationsform verschiedener Ge-waltformen fragt und beide in Hinblick darauf beurteilt, wie sie ihre Ansprüche auf All-gemeinheit einlösen. Seine Analyse ist für eine Bewertung des Entzugs als politische Praxis unumgänglich, bleibt aber für eine solche insofern unzureichend, als deren Be-urteilung als politische Ethik eine Bezugnahme auf das Verhältnis der Einzelnen zur Allgemeinheit erfordert; einen solchen Bezug führt Benjamin aber nicht aus. Einerseits ist er für den eigentlichen Gegenstand seiner Untersuchung unerheblich, andererseits ist er mit der Situation Bartlebys schlicht nicht konfrontiert. Da die Allgemeinheits-bezüge bei Benjamin in der Gestalt des Rechts, also der expliziten Verkörperung der grundsätzlichen Normen einer gesellschaftlichen Ordnung, auftreten, erscheint es legi-tim, diesen Zusammenhang durch einen Rückgriff auf Hegels Rechtsphilosophie (Hegel 1821/1986) zu ergänzen. In dieser entwickelt Hegel das Verhältnis zwischen Individu-um und gesellschaftlicher Allgemeinheit, wie es im Folgenden auszuführen sein wird.
93
Die Kompatibilität der Ansätze Hegels und Benjamins ist zwar dadurch gegeben, dass ersterer zumindest indirekt zu den theoretischen Bezugspunkten des zweiten zu rechnen ist und Hegel seine Philosophie ebenso an religiösen Motiven entwickelt. Doch gerade darin, wie diese Motive philosophisch verhandelt werden, tut sich eine Dif ferenz auf, die für das vorliegende Thema von Bedeutung ist. Während Hegel im Christen-tum zwar die höchste Stufe der gefühlten Gemeinschaft sieht, dieses Gefühl aber not-wendig in der vernünftig verstandenen Gemeinschaft aufgehoben wissen will (Hegel 1807/1986, Kap. VII, VIII), betont Benjamin die spirituelle Figur der Erlösung als Be-dingung der wahren Allgemeinheit. Etwas weniger abstrakt ließe sich sagen, Hegel lie-fert die begriffliche Apparatur um Bartlebys Problem zu verstehen, aber erst Benjamin kann es lösen. Mehr noch, weil Benjamin die Erlösung mit der Figur des Entzugs paral-lelisiert, kann er damit nicht nur an Bartlebys Verweigerungshaltung anschließen, son-dern diese sogar radikalisieren. Es wird daher zweckmäßig sein, zuerst kurz auf die re-levanten hegelschen Unterscheidungen einzugehen, dann auf die wesentlichen Punkte der Kritik der Gewalt Benjamins. Schließlich soll aus den beiden Ansätzen eine Synthese gebildet werden, mit der die politische Praxis Bartlebys bewertet werden kann, nach-dem dieser zu einem Idol praktischer Lebensführung avanciert zu sein scheint, dessen Ausstrahlung sich gerade die akademische Linke nolens volens nur schwer zu entziehen im Stande ist.
Hegels Rechtsphilosophie stellt sich die Aufgabe, den Staat der preußischen Monarchie als Verwirklichung der Freiheit zu erweisen. Diese eigentümliche Apologetik leistet Hegel, indem er die Freiheit des individuellen Willens gegen den vernünftigen, also zur objektiven Allgemeinheit bestimmten, Willen ausspielt bzw. diese miteinander vermit-telt. Gerade der Objektivität, der Garantin dieser Apologie, kommt für eine an Benja-min orientierte Kritik Hegels besondere Bedeutung zu.
Die Betrachtung Hegels beginnt mit dem Willen eines einzelnen Individuums, der je-doch – und in dieser Spannung ist bereits ihre letztliche Aufhebung angelegt – aus einem konkreten Inhalt und dessen allgemeiner Form besteht. Anders gesagt, schon der Wille enthält insofern eine regelhafte Allgemeinheit, als er zwischen verschiedenen konkre-ten Begehren zu entscheiden hat und diese Entscheidung nur mittels einer Systemati-
94
sierung dieser Begehren treffen kann. Da diese selbst gegen sich qua ihrer Besonderheit keinen Standard angeben, benötigt er ein Kriterium, das über diesen steht; dies wiede-rum erfordert deren Verallgemeinerung und diese kann nur vernünftig, mithin objektiv erfolgen.
Diese Vermittlung verschiedener besonderer Begehren durch eine allgemeine Regel wiederholt sich nun außerhalb des Individuums, wenn verschiedene partikulare Wil-len aufeinander treffen. Dadurch etabliert sich das abstrakte Recht, in dem sich diese Willen einfach nur gegenseitig begrenzen (was allerdings nicht mit dem Rechtsbegriff Benjamins gleichzusetzen ist). Wo diese Grenzen aber überschritten werden, also ein Unrecht geschehen ist, entsteht ein Widerspruch zwischen rächender und strafender Gerechtigkeit. Zwar will das geschädigte Individuum Rache, doch es muss dieses Be-gehren als ebenso partikular erkennen, wie das Begehren jenes anderen Willens, durch den es geschädigt wurde. Daher obsiegt die strafende Gerechtigkeit, die danach trach-tet, in allgemeiner und damit verbindlicher Weise den Rechtszustand wiederherzustel-len. Das einzelne Individuum, das dennoch etwas Allgemeines will, bezeichnet Hegel als das moralische. Diese Allgemeinheit ist allerdings insofern eine falsche, als sie eine besondere, nämlich eben die eines besonderen Individuums, also nicht wahrhaft all-gemein ist. Um dies zu werden muss sie erst mit den Allgemeinheiten anderer vermit-telt werden. Das erfolgt in den Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, zuvorderst im Staat, durch den diese Ansprüche nicht nur verhandelt, sondern auch entschieden und nötigenfalls gewaltsam durchgesetzt werden. Dies ist die Sphäre der Sittlichkeit, der wahren Allgemeinheit. Sie wird durch den Staat verwirklicht und für Hegel ist diese Wirklichkeit »im wesentlichen gut geworden« (Theunissen 1982, 325). So erscheint der Staat als objektive Geltung der Freiheit und der in ihr durch den Willen angelegten Ten-denz auf Allgemeinheit.
Doch was heißt das für Bartleby ? An den bürgerlichen Verhältnissen, die ihm gegen-überstehen, an den Institutionen, die ihn beherrschen, hat er, obgleich er in seiner Stel-lung als Schreiber für diese tätig ist, keinen Anteil.4 Mit Hegel wäre das allenfalls dann zu verstehen, wenn Bartleby sich zuerst von der Gesellschaft und nicht diese sich zuerst von ihm abgewendet hätte. Die Erzählung bleibt hier ambivalent und hält lediglich fest, Bartlebys vorige Stelle beim Dead Letter Office, der Abteilung für unzustellbare Briefe,
4 Auch hierin, dass er in den Institutionen arbeitet, die ihm als äußere gegenübertreten, ähnelt Bartleby linken AkademikerInnen.
95
sei seinem ohnehin düsteren Gemüt nicht bekommen. Aber selbst wenn die ihm gesell-schaftlich zugewiesene Funktion nur eine Disposition realisierte, wäre diese Zuwei-sung inadäquat, hätte allein schon beim Vorliegen einer solchen Veranlagung unterblei-ben müssen. Weder hätte sie daher in einer wirklich allgemeine Ordnung, also einer, die ihre allgemeine Gültigkeit darauf stützt, der Besonderheit ihrer Individuen gerecht zu werden, vorgenommen werden können, noch wäre sie aus ihr heraus erklärbar. Bartleby erscheint vielmehr als von seiner Gesellschaft entfremdet und insofern es seine emotionale Konstitution ist, der seine Arbeit – die er überdies offenbar als zwang-haft empfindet – nicht entspricht, liegt es nahe, diese Entfremdung auf die verding-lichende Automatik des Kapitalismus zurückzuführen.5 Diese Verdinglichung ist zu-gleich auch die Möglichkeitsbedingung dafür, aus unberechenbaren, weil besonde-ren und damit nicht-allgemeinen, Individuen, starre Einheiten zu machen, die als sol-che rationalisierender Kalkulation und objektiven Regeln unterworfen werden können (vgl. Lukács 1923).6
Bemerkenswerterweise fordert Hegel für das Recht, explizit für die Gestalt des Ver-trags, die Schriftform; was objektiv gelten soll, muss gegenständlich präsent sein. Doch diese Vergegenständlichung der Sprache, die Schrift, impliziert eine andere Art der Ver-dinglichung, nämlich die Fixierung einer Bedeutung jenseits ihres Realkontexts. Anders als in einem Gespräch, in dem der Kontext das Gesagte stets begleitet und im Zweifels-fall durch Nachfragen expliziert werden kann, steht das geschriebene Wort, gleich ei-nem Ding, für sich. Soll eine derartig dekontextualisierte verschriftlichte Norm wieder auf einen konkreten Einzelfall angewendet werden, so muss sie wieder rekontextuali-siert werden. Insofern diese Rekontextualisierung leichter fällt, wenn der betreffende Einzelfall gleichsam auf ein kontextloses Ding reduziert wird, korreliert die Verdingli-chung des Individuums mit der Objektivierung des allgemeinen Gültigkeitsanspruchs des Rechts (vgl. Wieland 1982, Kap. 1).7
Desto objektiver die Regeln sind, nach denen diese Rekontextualisierung selbst voll-zogen wird, desto hilfloser, aber auch verhärteter ist der Regelvollzug gegen jene, die sich, wie Bartleby, der Verdinglichung entziehen. Schlimmer noch, dieser verweigert durch seinen Entzug auch die Teilhabe an der gesellschaftlichen Vermittlung und ne-giert so die Wahrhaftigkeit der Allgemeinheit der herrschenden Ordnung. Da er sich
5 Gegen diese Lesart mag eingewandt werden, sie unterstelle Bartleby Motive, die dieser so niemals äußert. Dazu wird später noch mehr zu sagen sein, hier bleibt vorläufig nur anzumerken, dass die Spannung zwischen Allgemeinheit und Individualität durch das Nicht-Handeln Bartlebys induziert wird, wofür seine Motive erst einmal keine Rolle spielen. Da es dem Verdinglichungsbegriff letztlich auch um diese Spannung geht, erscheint seine Anwendung gerechtfertigt.
6 Für aktuellere Ausführungen, die v. a. auf die sprachkritischen Einwände gegen den Verdinglichungsbegriff eingehen, vgl. Christoph Demmerling (Demmerling 1994) und Axel Honneth (Honneth 2005).
7 Wieland greift dabei auf Platons Schriftkritik und deren Anwendung auf Fragen der politischen Organisation zurück, vgl. dessen »Phaidros« (274b–78b) sowie »Politikos« (293c–300c).
96
aber auch nicht wieder integrieren lassen will, bleibt der Ordnung, um ihrer Wahrhaf-tigkeit willen, nur Bartleby völlig aus der Sphäre ihrer Geltung zu verbannen, womit sie seinen Tod mehr als nur billigend in Kauf nimmt.
Da das Individuum aufgrund seiner Besonderheit den allgemeinen Ansprüchen des Rechts nie nachkommen kann, ist es allein durch die Geltung des Rechts mit einer Schuld belastet, die es dem Recht ausliefert. Anders als Hegel, der glaubt, dieser Rest der Besonderheit gegen die Allgemeinheit würde schließlich in der Vermittlung aufge-hen, fordert Benjamin deswegen die Erlösung von der Schuld, und damit vom Recht selbst. Allein durch diese Erlösung kann die wahre Allgemeinheit verwirklicht werden, nämlich jene in der erst gar kein Rest konstituiert wird. Wie sich noch zeigen wird, geht es dabei aber nicht einfach um eine völlige Vernichtung des Rechts oder gar aller Re-geln, sondern um die Aufhebung bzw. Transformation ihres Geltungsanspruchs.8
Benjamin stellt sich in seiner Kritik der Gewalt (vgl. kritisch hierzu Derrida 1992) die Frage, ob jene jemals ein rechtmäßiges Mittel gerechter Zwecke sein kann. Wenn diese Frage heute noch gestellt wird, dann meist um sie möglichst schnell zu verneinen. Nach den Erfahrungen mit dem Realsozialismus und der RAF versteht sich der bei weitem überwiegende Teil der deutschsprachigen Linken als gewaltfrei (vgl. Pohrt 1986). Ei-nerseits weil Gewalt an sich diskreditiert ist, andererseits weil allen Zwecken bzw. Per-spektiven zu sehr misstraut wird, um ihretwillen Gewalt anzuwenden. Benjamin hin-gegen nimmt diese Frage nicht nur noch ernst, sondern affirmiert Gewalt als politisches Mittel; dabei verwendet er allerdings einen Gewaltbegriff, der eher mit Macht oder Herrschaft, als mit direkter körperlicher Gewalt gleichzusetzen ist, obgleich er letztere auch umfasst. Erst nach dieser Kontextualisierung, kann nun Benjamins Beantwortung der eingangs gestellten Frage rekonstruiert werden.
Es geht Benjamin in seiner Kritik nicht darum, ob die Zwecke, um deretwillen Ge-walt angewendet wird, gerecht sind oder für welche Zwecke bzw. unter welchen Um-ständen Gewalt ein rechtmäßiges Mittel ist; vielmehr geht er von einer grundsätzlichen Antinomie selbst zwischen gerechten Zwecken und rechtmäßiger Gewalt aus. Denn jede zweckhafte Gewalt hat letztlich die Gestalt der Erpressung, sie ist das Mittel, das nur eintritt, wenn die außer ihr liegende Forderung, ihr Zweck, nicht umgesetzt wird.
8 Vgl. dazu die Ausführungen Agambens zum Verhältnis des Rechts zu seiner Ausnahme, d.h. von objektivierter Allgemein- heit und Besonderheit, im ersten Teil von »Homo Sacer« sowie in »State of Exception« (Agamben 2005). Der Gerechtig- keitsbegriff der hier zur Anwendung kommt, ist einer der Ungleichheit, nämlich jener des berühmtem Diktums Marxens: »jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!« (Marx, Engels 1875/1956, 22).
97
Darin etabliert sie eine Kausalität, also eine Regel und dadurch schließlich eine Ord-nung, weswegen zweckhafte Gewalt grundsätzlich rechtsetzend, bzw. nach der erfolg-ten Setzung, rechtserhaltend ist. Den dadurch implizierten Anspruch auf Allgemein-heit kann sie zwar nie einlösen, doch ist jede rechtsetzende Gewalt, die in Opposition zur rechtserhaltenden beansprucht, wahrhaftig allgemein zu sein, letztlich mit dersel-ben Aporie konfrontiert. Die dadurch implizierte Spirale zwischen rechtserhaltender und immer neuer, ihr feindlich gesinnter rechtsetzender Gewalt kann nur unterbro-chen, wahre Gerechtigkeit nur verwirklicht werden, durch eine Form der Gewalt, die nicht rechtsetzend, also nicht zweckhaft ist.9
Die nichts bezweckende Gewalt ist reines Mittel ihrer selbst. Der Gegensatz die-ser beiden Formen wird offenbar am Vergleich des politischen und des revolutionä-ren Generalstreiks, die beide jeweils eine jener gegensätzlichen Gewaltformen ex-emplifizieren, obwohl der Streik als Nicht-Handlung keine unmittelbare Gewalt ausübt. Der ›politische Generalstreik‹ (Georges Sorel zit.n. Benjamin 1921/1991, 194 passim) versucht höhere Löhne zu erpressen, ist daher der rechtsetzenden Ge-walt zu zuordnen, was sich auch daran ablesen lässt, dass er die bestehende Ordnung weitestgehend in ihrem Recht belässt, wohingegen der revolutionäre Generalstreik keinerlei Forderungen an diese Ordnung stellt, sondern sie als Ganzes verwirft, er
geschieht nicht in der Bereitschaft, nach äußerlichen Konzessionen und irgendwelcher Modifikation der Arbeitsbedingungen wieder die Arbeit aufzunehmen, sondern im Entschluß, nur eine gänzlich veränderte Arbeit, eine nicht staatlich erzwungene, wieder aufzu- nehmen, ein Umsturz, den diese Art des Streikes nicht sowohl veranlaßt als vielmehr vollzieht. (…) Dieser tiefen, sittlichen und echt revolutionären Konzeption kann auch keine Erwägung gegenübertreten, die wegen seiner möglichen katastrophalen Folgen einen solchen Generalstreik als Gewalt brandmarken möchte (Benjamin 1921/1991, 194f.).
Der revolutionäre Generalstreik veranlasst die neue Ordnung nicht, führt sie nicht durch Androhung der Gewalt herbei, sondern vollzieht sie, indem er sich der alten ent-
9 Diese Interpretation nimmt einige Motive vorweg, die im Text eigentlich erst später entwickelt werden. Benjamin baut sein Argument an dieser Stelle noch nicht über den Gegensatz von Besonderheit und Allgemeinheit, sondern über jenen zwischen rechtsetzender und rechtserhaltender Gewalt auf. Das impliziert allerdings eine problematische Ontologisierung der Gewalt zu einer eigenständigen Kraft, weswegen ich hier, in Vorgriff auf den späteren Benjamin, die oben genannte Spirale anders rekonstruiere (Benjamin 1939/1974, v.a. These VIII). Da ähnliche Motive auch im eigentlich besprochenen Text behandelt werden, erscheint dies vertretbar.
98
zieht. Er ist dadurch sogleich reine Gewalt, die keine Zwecke außer sich mehr verfolgt, als auch völlig gewaltlos: weder erpresst er, noch vergießt er Blut. Hier wird der Entzug zum Paradigma der Revolution, aber nicht wegen seiner Gewaltlosigkeit, sondern weil er als reine Gewalt auftritt. Um aber im benjaminschen Sinn rein zu sein, darf diese Gewalt nichts Außersich-liegendes wollen, ist eher durch ihre Ursache als durch ihr Ziel bestimmt, welches in ihr selbst liegen muss. Als solche findet sie ihr bestes Beispiel im Zorn. Dieser mag zwar begründet sein und dadurch sogar berechtigt scheinen, doch ist seine Gewalt ge-genüber allen Zwecken blind, sie »ist nicht Mittel, sondern Manifestation« (Benjamin 1921/1991, 196). Der Zorn der mythischen Gottheiten trifft seine Opfer ohne Vorwar-nung oder Drohung und zwar nicht weil sie ein Gesetz übertreten hätten, sondern weil sie ihn durch ihr Tun auf sich lenkten, wie etwa Niobe durch das Verspotten der Göttin Leto, weil diese weniger Kinder gebar als sie selbst. Doch insofern die Manifestation des Zorns auf jenes Tun folgt, es also bestraft und somit auch seine Wiederholung unter Strafe stellt, etabliert auch die mythische Gewalt eine Ordnung, kann auch die reine Ge-walt eine rechtsetzende sein.
Der Gegenbegriff zur mythischen Gewalt, ist die göttliche. Wohingegen die mythische ein Exempel statuiert und vor jenen einhält denen dieses gilt, bspw. Leto zwar alle Kin-der Niobes töten lässt, nicht aber Niobe selbst, vernichtet die göttliche Gewalt gren-zenlos. Sie macht, wie der Generalstreik, der sich nicht mit kleinen Veränderungen be-gnügt, sondern die Ordnung als solche aussetzt, nicht eher halt als sie das Ganze erfasst hat. Dabei, und das muss angesichts Benjamins doch recht bedrohlicher Wortwahl ex-pliziert werden, gilt weiterhin das fünfte Gebot (»Du sollst nicht töten«), doch ist mit seiner Übertretung eben keine Strafe (mehr) verbunden, denn das Gebot weiß sich, an-ders als das Gesetz, als inkommensurabel mit der Tat.10 Statt den Verstoß gemäß einer Regel zu bestrafen, muss für jede Tat neu, und damit dieser angemessen und in diesem Sinne gerecht, darüber entscheiden werden, wie mit ihr umzugehen ist. Da die Vermitt-lung von Norm und Tat nicht als vorgängig objektivierte und daher ausscheidende, son-dern als ihrerseits besondere erfolgt, ist sie wahrhaft allgemein. Durch diese rechtsver-nichtende Kraft entsühnt die göttliche Gewalt die Einzelnen von jener Schuld, die ihnen durch das Recht auferlegt wurde.11 Auch Bartlebys Entzug ist eine Form der Gewalt,
10 Es ist diese Wortwahl, die Derridas Kritik evoziert. Obwohl dies nicht Gegenstand dieses Textes ist, muss ergänzt werden, dass Benjamin, neben dem revolutionären Generalstreik, als einziges anderes Beispiel einer solchen Gewalt jene der Bildung anführt, also explizit auch, aber – und in dieser Hinsicht ist Derridas Sorge gerechtfertigt – nicht nur eine im engeren Sinne gewaltfreie Gewalt meint.
11 Diese Vorstellung vom aufgehobenen Recht, das aber nicht an Bedeutung verloren hat, das nicht mehr gilt, aber noch studiert wird, entwickelt Benjamin auch gemeinsam mit Scholem (vgl. Scholem 1980, Briefe 57, 63 und 65). Die hier ange- deutete Erlösung betrifft allerdings lediglich die Schuld der Einzelnen gegen die Gesellschaft, nicht die Schuld der Menschen gegen Gott, d.h. die abstrakte Allgemeinheit bzw. die Vorstellung vom Paradies. Selbst die Verwirklichung des revolutionären Generalstreiks bliebe notwendig von dieser unterschieden (vgl. Scholem 1980, 155; Benjamin 1977, 152-157).
99
obwohl er die Drohung allenfalls gegen sich selbst richtet. So gewinnt er durch sie doch Macht, zwar nicht über die Gesellschaft, wohl aber über seinen Vorgesetzten, der diese verkörpert. Da dieser noch an die Allgemeinheit, an die Moral der bürgerlichen Gesell-schaft glaubt,12 empfindet er Mitleid für Bartleby, muss ihn dulden und schließlich ver-suchen ihm zu helfen. Auf diese Weise setzt Bartleby, quasi durch einen persönlichen politischen Streik, Stück für Stück tatsächlich Verbesserungen seiner Arbeitsbedingun-gen durch, nämlich dass er von immer mehr Aufgaben entbunden wird, bis er schließ-lich völlig aufhört zu arbeiten. Obwohl seine Gewalt daher zweckhaft scheinen mag, ist sie eine mythische; denn sie ist rein insofern als Bartleby niemals explizit Forderungen oder gar Drohungen äußert, doch rechtsetzend insofern als er durch sie Sonderrechte für sich gegen die übrigen Angestellten der Kanzlei etabliert – und tatsächlich wird der Bann, in den Bartleby seinen Vorgesetzten zieht, als mysteriös beschrieben.
Erst als er – ohne zu arbeiten – auch noch beginnt, in der Kanzlei zu wohnen, also eine Teilhabe ohne Teilnahme einfordert, wendet sich sein Vorgesetzter schließlich ab und offenbart so den scheinbar politischen Streik Bartlebys als revolutionären Streik auf Raten. Indem Bartleby es vorzieht, nicht mehr zu essen, übertritt er die letzte Gren-ze und verwandelt seine mythische Gewalt in eine göttliche, erlöst seinen Vorgesetzten von aller Schuld gegen ihn und sich selbst von der seinen gegen die Gesellschaft.
Da Bartleby seine Beweggründe für das, was nicht einmal eine Bewegung zu sein scheint, nie äußert, fällt es leicht, seinem Nicht-Handeln jeglichen politischen Charak-ter abzusprechen. Wird es jedoch als Benjamins reiner Gewalt verwandt verstanden, so wird Bartleby gerade deswegen beispielhaft politisch, weil er seine Motive in der Tat für sich behält. Sein Nicht-Handeln bedarf nicht nur keiner Äußerung seiner Ziele, eine solche würde sogar riskieren, Zweck und Mittel in ebenjene Antinomie zu verstricken, um die es Benjamin geht. Die, zum Wesen des Politischen gehörende, Bezugnahme auf die Allgemeinheit bleibt also nicht aus, sondern erfolgt durch die Negation ihrer An-sprüche (vgl. Benjamin 1972, 396).
Auch wenn sich in der Sittlichkeit und der Erlösung zwei konträre Thesen zum Wesen der wahren Allgemeinheit gegenüberstehen, korrelieren die Unterscheidungen von Mo-ral und Sittlichkeit sowie mythischer und göttlicher Gewalt dahingehend, dass sowohl
12 Obgleich sich seine Duldung Bartlebys in Widerspruch zur protestantisch-calvinistischen Ethik seiner Zeit befindet.
100
die Moral als auch der Mythos eine falsche Allgemeinheit bezeichnen. Der Grund, wa-rum Bartlebys Entzug zwar reine Gewalt ist, aber – zumindest zunächst – keine göttli-che, liegt in seiner Vereinzelung. Die Gewalt Bartlebys ist mysteriös, mythisch und mo-ralisch zugleich und nichts anderes als dessen Moral bindet auch seinen Vorgesetzten an ihn. Desto weiter sich Bartleby aber verweigert und dabei doch an die Gesellschaft gebunden bleibt, desto tiefer wird auch der Graben zwischen beiden. Alle Rechte, die Bartleby setzt, sind stets seine Sonderrechte, nie allgemeine, noch weniger hebt er das Recht als solches auf. Erst als er seine Vereinzelung gemeinsam mit seiner Existenz en-den lässt und sich damit vollends von der Gesellschaft löst, entbindet er sich und alle an-deren von seiner mythischen Gewalt, geht auf im entzogenen Göttlichen.
Trotz der Schwierigkeiten, die sich aus Bartlebys Vereinzelung ergeben, muss seine Radikalität gewürdigt werden, weil das Erduldenkönnen des Verlusts Voraussetzung radikalen politischen Handelns überhaupt ist. Dieses Erduldenkönnen ist gerade dort erforderlich, wo der Entzug realiter am ernsthaftesten als politische Taktik angewen-det wurde, etwa bei Hungerstreiks oder während der indischen Unabhängigkeitsbewe-gung. Erst dies versetzt Bartleby überhaupt in die Lage, die herrschende Ordnung trotz seiner Vereinzelung herauszufordern; so setzt er nicht nur ein – fast unmöglich zu igno-rierendes – Zeichen gegen diese, er nimmt ihr auch die Möglichkeit, darauf in gewohn-ter Weise zu reagieren, sie kann ihm weder drohen, noch ihn bestechen. Was ihr freilich bleibt, solange Bartleby einfach nur als Einzelner gegen sie steht, ist das von ihm gesetz-te Zeichen zu verklären und zu naturalisieren. So vermag sein Vorgesetzter eben gerade durch einen Verweis auf Bartlebys düsteren Charakter, also seine Besonderheit, dessen Handeln so zu interpretieren, als hätte es mit den herrschenden Verhältnissen nichts weiter zu tun, sodass diese sich über dessen Tod nicht weiter zu bekümmern brauchen.
Doch jene Form des Entzugs, die sich angesichts der Aussichtslosigkeit als Taktik zu empfehlen scheint, kommt gar nicht erst soweit, sich fragen zu müssen, wie sie vermei-den kann ebenso abgetan zu werden. Sie vermag ohnehin niemanden zu verstören, denn es ist ausgesprochen zweifelhaft, dass sich die dafür nötige Radikalität aus der Resig-nation speisen könnte. Sie kann diese Radikalität auch sonst nirgends hernehmen, denn diese bedarf einer intrinsischen Motivation, die aber zumindest im Westen kaum vor-zuliegen scheint.13 Darin drückt sich auch nicht einfach eine »mangelhafte« politische
13 Wie sich durchaus auch aus der überwiegenden Ablehnung der Gewalt als politischem Mittel ablesen lässt.
101
Einstellung aus, sondern viel mehr Verhältnisse, die weder nach solcher Entschlossen-heit zu verlangen scheinen, noch wirken, als wären sie durch eine solche sonderlich zu beeindrucken.
Wenn die radikale Konsequenz Bartlebys aber keine Option ist, so muss der Gra-ben zwischen Einzelheit und Allgemeinheit anders überbrückt werden, nämlich indem ein wahrhaft allgemeiner Anspruch erhoben wird. Das erfordert gegen die zweckhafte Gewalt die Forderung der Utopie, also danach sich nicht mit Modifikationen zu begnü-gen, sondern nicht eher inne zu halten, als bis das Ganze verändert ist – das heißt: ge-gen die mythische Gewalt und die Moralität, die Verwirklichung dieser Forderung in einer ebenso allgemeinen, einer gemeinschaftlichen politischen Praxis. Das heißt nicht, Ansprüche, die aus der Partikularität heraus formuliert werden, wären allein deswegen schon illegitim, doch um über die falsche Allgemeinheit der Moral hinauszukommen, muss ein Anspruch nicht nur an sich allgemein sein, sondern diese Allgemeinheit schon in der Form seiner Verwirklichung einlösen; mithin einerseits die Einzelheit durch die Vermittlung transzendieren und andererseits versuchen, die so angestrebte wahre All-gemeinheit bereits im Streben vorwegzunehmen, damit jene sich nicht als äußerlich zu diesem verhält.
Ohne die utopische Forderung nach Erlösung etabliert auch das Entziehen nur neue Normen und modifiziert so bestenfalls das Verhältnis aller Einzelnen als Vereinzelten zueinander, anstatt die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu verändern. Schon der Ver-such, sich so von der Schuld der Partizipation an der herrschenden Ordnung zu entsa-gen, muss scheitern, denn diese Schuld wird durch jene Normen, nicht nur die der herr-schenden Ordnung, sondern auch und mehr noch durch die, welche sich dieser zu ent-sagen vorschreiben, überhaupt erst begründet. Wenn überdies ihre Verwirklichung nur vereinzelt angestrebt wird, so haben diese letztlich keinen politischen, sondern nur ei-nen moralischen Anspruch. Moral wiederum ist nur dort politisch relevant, wo sie ge-predigt wird und diese Predigt erhört, genau das aber darf sie sich kaum erwarten, re-präsentiert sie doch stets nur einen partikularen Standpunkt. Und selbst wenn sie es dürfte, so würde sie immer noch nur jene hegelsche Sphäre der Sittlichkeit verwirkli-chen, der mit Benjamin vorgeworfen werden könnte, immer noch eine mythische zu sein; nicht die wahre Allgemeinheit, sondern bloß die Objektivierung der falschen.
102
Um eine tatsächlich politische Strategie zu sein, erfordert auch der Entzug eine Uto-pie und jenes, die Hoffnung auf diese verkörpernde, politische Subjekt, wegen deren Verlust der Rückzug überhaupt erst angetreten werden sollte.
Bibliografie
agamben, giorgio: HomoSacer:SovereignPowerandBareLife. 1998, Übers. von Daniel Heller-Roazen. Hrsg. von Werner Hamacher und David E. Wellbery, Meridian. Stanford, CA: Stanford University Pressagamben, giorgio: StateofException. 2005, Übers. von Kevin Attell. Chicago, IL: University of Chicago Pressbenjamin, walter: DerdestruktiveCharakter. 1972, in Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Bd. IV.1, 396 – 98. Frankfurt am Main: Suhrkampbenjamin, walter: ÜberdenBegriffderGeschichte. 1939 /1974, in Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Bd. I.2, 691 – 704. Frankfurt am Main: Suhrkamp benjamin, walter: ÜberdieSpracheüberhauptundüberdieSprachedesMenschen. 1977, In Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Bd. II.1, 140–57. Frankfurt am Main: Suhrkampbenjamin, walter: ZurKritikderGewalt. 1921 / 1991, in Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf Tiedemann, Hermann Schweppenhäuser, Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Bd. II.1, 179 – 203. Frankfurt am Main: Suhrkampbenjamin, walter und gershom scholem, Briefwechsel1933 – 1940.1980, hrsg. von Gershom Scholem. Frankfurt am Main: Suhrkamp
103
demmerling, christoph: SpracheundVerdinglichung:Wittgenstein,Adorno unddasProjekteinerkritischenTheorie. 1994, Frankfurt am Main: Suhrkampderrida, jacques: ForceofLaw:The»MysticalFoundationofAuthority«. 1992, in Deconstruction and the Possibility of Justice, hrsg. von Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld und David Gray Carlson, 3 – 67. New York, NY: Routledgehegel, g. w. f.: GrundlinienderPhilosophiedesRechts.1821 /1986, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Werke. Frankfurt am Main: Suhrkamphegel, g. w. f.: PhänomenologiedesGeistes.1807 /1986, hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Werke. Frankfurt am Main: Suhrkamphonneth, axel: Verdinglichung:EineanerkennungstheoretischeStudie.2005, Frankfurt am Main: Suhrkamplukács, georg: DieVerdinglichungunddasBewusstseindesProletariats. 1923, in Geschichte und Klassenbewusstsein: Studien über marxistische Dialektik, 94 – 218. Berlin: Malikmarx, karl: KritikdesGothaerProgramms. 1875 /1956, in Marx, Engels: Werke, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Bd. 19, 12 – 33. Berlin: Karl Dietz Verlagmelville, herman: Bartleby. 1985, hrsg. von Ferdinand Schunck. Stuttgart: Reclamplaton: Phaidros. 1991, in Sämtliche Werke, hrsg. von Karlheinz Hülser, Bd. VI, 9 – 149. Frankfurt am Main: Insel Verlagplaton: Politikos. 1991, in Sämtliche Werke, hrsg. von Karlheinz Hülser, Bd. VII, 295 – 463. Frankfurt am Main: Insel Verlagpohrt, wolfgang: GewaltundPolitik.1986, in Die alte Straßenverkehrsordnung. Dokumente der RAF, hrsg. von dems., 7 – 19. Berlin: Edition Tiamattheunissen, michael: DieverdrängteIntersubjektivitätinHegelsPhilosophiedes Rechts. 1982, in Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und ihre Logik, hrsg. von Dieter Henrich und Rolf Peter Horstmann, 317 – 81. Stuttgart: Klett-Cottawieland, wolfgang: PlatonunddieFormendesWissens. 1982, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
104
Orte der Kultur-wissenschaften:The McLuhanProgram in Culture and Technology,Torontovon Sebastian Gießmann
105
»Media Prophet and Faculty«. Großformatig prangt Marshall McLuhans Gesicht auf lan-gen blauroten Werbebannern, die der University of Toronto Ivy-League-Charme ver-schaffen sollen. Mitten auf dem zentral gelegenen Backsteingotik-Campus des purita-nisch-geschäftigen Toronto flattert der unerbittliche Kritiker der Gutenberg-Galaxis. In hübsch gedruckter Form wohlgemerkt – und nicht etwa auf Fernsehmonitoren oder Com-puterbildschirmen. Auch wenn es sich deutsche Medienwissenschaftler Innen kaum vor-stellen können: Der Prophet McLuhan gilt an der UofT, wo Kanada laut Werbeslogan im-merhin nicht weniger als die Fragen der Welt beantwortet, herzlich wenig. Sein Vorbild Harold Innis hat es – immerhin ! – noch zum Namensgeber eines Colleges geschafft. Die Sektenmitglieder des McLuhan Program in Culture and Technology sind hingegen nur geduldete Gäste im wohlgeordneten Backstein-Kosmos. So führt der Weg zu einem der unwahrscheinlicheren Orte der Kulturwissenschaft an das hintere Ende eines Parkplat-zes. Nach einem munteren, besonders nach Einbruch der Dunkelheit kontaktintensiven Stoßstangen-Parcours erreicht man ein einfaches zweistöckiges Gebäude. Die Website muntert nachdrücklich zur intensiven Erkundung auf: Ob dieser strategischen Randlage müsste man fasst denken, dass unser liebevoll »Coach House« genanntes Häuslein wohl absichtlich versteckt wurde. Im besten Glücksfalle trifft man nach dem Anklopfen Der-rick de Kerckhove, einen der bekanntesten Vertreter des medientheoretischen Jetsets. Auch eine Strategie des Entziehens: Während die deutsche Medienwissenschaft McL-uhan 2007 in Bayreuth neu liest, fliegt der Mitveranstalter de Kerckhove flott zum nächs-ten Termin nach Italien weiter. Mit ähnlicher Rasanz vollzog sich an den noch unschul-digen frühen Tagen des September 2001 meine Initiation als McLuhan Fellow. Sie dau-erte ungefähr zehn Minuten und beinhaltete Hallo, Kurzrundgang, Willensbekundung zur Seminarsteilnahme (»Media, Mind and Society«) und liebevolle Bemerkungen über beiderseitige seltsame Begegnungen mit Friedrich Kittler. Derart unbürokratisch geht es sonst in keiner höheren Lehranstalt zu. Wer nun misstrauisch wird, argwöhnt zu Recht. Die Hütte am Ende des Parkplatzes gehört zwar offiziell der University of Toronto. Das administrative Tagesgeschäft ist aber nicht deren Sache. Briefporto und Telefonkosten des McLuhan Program werden mit dem Geld bezahlt, dass via Medientheorie-Jetset ein-geworben wird. Zur Gründungslegende des 1963 vom Meister selbst inaugurierten Pro-gram und des 1968 bezogenen Coach House gehört denn folgerichtig der bis heute kulti-vierte Außenseiterstatus. Einen Abschluss kann man hier nicht erwerben, obwohl doch ein McLuhan-Master der Traum jeder universitären Marketingmaschine sein sollte. Die Kurse werden höchstens als Teil anderer Studiengänge anerkannt. Und so wie McLuhan nominell Philologe blieb, ist Derrick de Kerckhove offiziell als Romanist angestellt.
106
Neben ihm tummeln sich denn auch weitere seltsame und para-akademische Agenten im Umfeld des McLuhan Program. Der Name zieht, jenseits bürokratischer Regulari-en, ein internationales Publikum von Graduate Students an. Japan, Mexiko, Deutsch-land, Brasilien, Kanada – ArchitektInnen, KulturwissenschaftlerInnen, Media Ge-eks, TheologenInnen: In der Parkplatzhütte und dem legendären Seminarraum bei den Information Studies geht es zu wie im globalen Dorf. Die frisch ernannten McLuhan Fellows treffen auf Manager, die McLuhans Aphorismen und die wirren »Laws of Me-dia« des Spätwerks als beratungskompatible Werkzeuge einsetzen wollen. Ein kreati-ver Thinktank zur Netzwerkgesellschaft wird per Telekonferenz mit Kalifornien als Adhoc-Projekt begründet. Derrick de Kerckhove erklärt jahraus, jahrein nahezu jeden Trend im Worldwideweb als wunderbare neue Form ›konnektiver Intelligenz‹. Und hinter alledem ruht im Hintergrund jenes furchtbare Gemälde von René Cera, das Pe-ter Bexte als gemalte »Gebetsmatte« der Fernsehmedientheorie identifiziert hat (Bexte 2008, 323–337). Dem Charme eines solch fröhlich projektemachenden Mischmaschs kann man sich kaum entziehen. Hier wird, mitsamt aller Unschärfen, exakt undiszipli-nierte Wissenschaft betrieben. Niemand hat deren kreative Merkwürdigkeit besser auf den Punkt gebracht als Woody Allen. Das McLuhan Program ähnelt in vielerlei Hin-sicht dem Verlauf der berühmten Kinoschlangen-Szene aus Annie Hall. Mit der Rede über den Medienpropheten wird der Meister selbst medial beschworen: Mr. McLuhan ist offenbar anwesend.
www.mcluhan.utoronto.ca
Bibliografie
bexte, peter: CadillacundGebetsmatte. 2008, McLuhans TV-Gemälde, in: Leeker, Martina und Schmidt, Kerstin (Hg.): McLuhan neu lesen, Kritische Analysen zu Medien und Kultur im 21. Jahrhundert, Bielefeld 2008, S. 323 – 337.
107
Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe Thomas Ballhausen, Autor, Film- und Literaturwissenschaft-ler. Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft und der Deutschen Philologie an der Univer-sität Wien. Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Filmarchiv Austria, Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Koordinator und Mitarbeiter mehrerer filmspezifischer Projekte, Kuratorentätigkeit im In- und Ausland. Wissenschaftliche und literarische Publikationen; zuletzt erschienen u.a. »Delirium und Ek-stase. Die Aktualität des Monströsen« (Wien 2008), der Sammelband »Die Logistik der Verführung« (Red., gemeinsam mit Verena Bauer; Graz 2009) und der Comic »Wired Worlds« (gemeinsam mit Jörg Vogeltanz, Graz 2009) Sebastian Gießmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturwis-senschaft, HU Berlin. Forschungsschwerpunkte zur Netzwerkgeschichte, Epistemologie der Übertra-gungsmedien, Bewegungskulturen, Geschichte der Druckverfahren, Bildtheorie des Diagramms und zeitgenössischem politischen Film. Aktuelle Monografie: »Netze und Netzwerke. Archäologie einer Kulturtechnik 1740 – 1840« (Bielefeld 2006). Heide Hammer, geb. 1973, Philosophin und Sozialwissen-schafterin, assoziiert u.a. mit gruppe mañana, episteme. Kooperative für Forschung und Intervention, Context XXI, neigungsgruppe_donauschwimmen. Stephanie Kiessling, un/tätig in Wien. Odin Kröger, Studium der Philosophie in Wien, Berlin und Canberra. Geht verschiedenen prekären Beschäftigungen nach, in aller Regel an der Universität Wien. In Kürze erscheint: »Geistiges Eigentum und Originalität: Zur Politik der Wissens- und Kulturproduktion« (Kroeger, Friesinger, Lohberger, Ortland und Ballhausen (Hg.), Wien, Turia + Kant). Klaus Neundlinger, Philosoph, Übersetzer und Lehrer für Deutsch als Fremd-sprache. Beschäftigt sich mit den Themen neue Selbständigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, Wissens-arbeit und Wertbildung durch Kommunikation. Katja Rothe, Kultur- und Literaturwissenschaftlerin in Wien und Berlin; wissenschaftliche Mitarbeiterin im FWF-Projekt »Regulierungswissen und Möglich-keitssinn 1914 – 1933« an der Uni Wien, Promotion zum frühen Radio in Europa, Forschungsschwer-punkte: Wissensgeschichte des Experiments, Medien-, insbesondere Radiotheorien, Literatur und Kul-tur der Weimarer Republik, Geschichte des Arbeitsbegriffs. Antonia v. Schöning studierte Theaterwis-senschaft, Neuere deutsche Literatur und Politikwissenschaft in Berlin und Europäische Medienkul-tur in Weimar und Lyon. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur » Geschichte und Theorie Künstlicher Welten« an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar und ist derzeit Mitarbeiterin am eikones NFS Basel. Sie arbeitet an einer Dissertation zum Thema »Stufen, Schich-ten, Etagen. Zur Historiographie des Raumes 1859|1950«. Holger Schulze lehrt an der Universität der Künste Berlin Klanganthropologie und Klangökologie. In den 2000er Jahren hat er dort den Studien-gang Sound Studies – Akustische Kommunikation aufgebaut und geleitet; seit den 1990ern arbei-tet er an einer allgemeinen Theorie der Werkgenese: Das aleatorische Spiel (1998), Heuristik (2005), Intimität und Medialität (2007). Er gibt die Buchreihe Sound Studies im transcript Verlag heraus und schreibt auf mediumflow.de und auf soundstudies.info. Karin S. Wozonig, Studium der Verglei-chenden Literaturwissenschaft, Germanistik und Anglistik in Wien und Los Angeles, freie Wissen-schaftlerin und Texterin. Veröffentlichungen zur österreichischen Literaturgeschichte des 19. Jahr-hunderts und zur Beziehung der Literaturwissenschaft zu den Naturwissenschaften. Zuletzt erschie-nen: »Chaostheorie und Literaturwissenschaft« (Wien, Innsbruck 2008). Blog: www.karin-schreibt.org
108
Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalis-tische Zivilisation herrscht. Diese Sucht, die Einzel- und Massenelend zur Folge hat, quält die traurige Menschheit seit zwei Jahrhunderten. Diese Sucht ist die Liebe zur Arbeit, die rasende Arbeitssucht, getrieben bis zur Erschöpfung der Lebensenergie des Einzelnen und seiner Nachkommen. Statt gegen diese geistige Verirrung anzukämp-fen, haben die Priester, die Ökonomen und die Moralisten die Arbeit heiliggesprochen. Blinde und beschränkte Menschen, haben sie weiser sein wollen als ihr Gott; schwache und unwürdige Geschöpfe, haben sie das, was ihr Gott verworfen hat, wiederum zu Eh-ren zu bringen gesucht. Ich, der ich weder Christ, noch Ökonom, noch Moralist bin, ich appelliere von ihrem Spruch an den ihres Gottes, von den Vorschriften ihrer religiösen, ökonomischen oder freidenkerischen Moral an die schauerlichen Folgen der Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft.
In der kapitalistischen Gesellschaft ist die Arbeit die Ursache des geistigen Verkom-mens und körperlicher Verunstaltung. Man vergleiche die von einem menschlichen Die-nerpack bedienten Vollblutpferde in den Ställen eines Rothschild mit den schwerfälli-gen normannischen Gäulen, welche das Land beackern, den Mistwagen ziehen und die Ernte einfahren. Man betrachte den edlen Wilden, wenn ihn die Missionare des Han-
Das Recht auf Faulheitvon Paul Lafargue, Textauswahl von Klaus Neundlinger
109
dels und die Vertreter in Glaubensartikeln noch nicht durch Christentum, Syphilis und das Dogma der Arbeit verdorben haben, und dann vergleiche man mit ihm unsere elen-den Maschinensklaven.
Will man in unserem zivilisierten Europa noch eine Spur der ursprünglichen Schön-heit des Menschen finden, so muß man zu den Nationen gehen, bei denen das wirt-schaftliche Vorurteil den Haß gegen die Arbeit noch nicht ausgerottet hat. Spanien, das – ach ! – verkommt, darf sich rühmen, weniger Fabriken zu besitzen als wir Gefängnisse und Kasernen; aber der Künstler genießt, den kühnen, kastanienbraunen, gleich Stahl elastischen Andalusier zu bewundern; und unser Herz schlägt höher, wenn wir den in seinem durchlöcherten Umhang majestätisch bekleideten Bettler einen Herzog von Or-sana mit »Amigo« anreden hören. Für den Spanier, in dem das ursprüngliche Tier noch nicht ertötet ist, ist die Arbeit die schlimmste Sklaverei. Auch die Griechen hatten in der Zeit ihrer höchsten Blüte nur Verachtung für die Arbeit; den Sklaven allein war es gestattet zu arbeiten, der freie Mann kannte nur körperliche Übungen und Spiele des Geistes. (…) Die Philosophen des Altertums lehrten die Verachtung der Arbeit, diese Herabwürdigung des freien Menschen; die Dichter besangen die Faulheit, diese Gabe der Götter: (…)
Und auch das Proletariat, die große Klasse, die alle Produzenten der zivilisierten Na-tionen umfaßt, die Klasse, die, indem sie sich befreit, die Menschheit von der knechti-schen Arbeit befreien und aus dem menschlichen Tier ein freies Wesen machen wird, das Proletariat hat sich, seine Instinkte verleugnend und seine geschichtliche Aufgabe verkennend, von dem Dogma der Arbeit verführen lassen. Hart und schrecklich war seine Züchtigung. Alles individuelle und soziale Elend entstammt seiner Leidenschaft für die Arbeit. (…)
Um die Faulheit auszurotten und um den Stolz und Unabhängigkeitssinn zu beugen, schlug der Verfasser des Essay on trade vor, die Armen in ideale Arbeitshäuser (ideal workhouses) einzusperren, die »Häuser des Schreckens sein müßten, in denen man 14 Stunden pro Tag in der Weise arbeiten sollte, daß nach Abzug der Mahlzeiten volle 12 Arbeitsstunden übrigbleiben«.
12 Arbeitsstunden pro Tag, das Ideal der Menschenfreunde und Moralisten des 18. Jahrhunderts. Wie weit sind wir über dieses Ideal hinaus ! Die modernen Werkstätten sind ideale Zuchthäuser geworden, in welche man die Arbeitermassen einsperrt, und in denen man nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und Kinder zu 12- und 14-stündiger Zwangsarbeit verdammt ! Und die Kinder der Helden der Französischen Revolution haben sich durch die Religion der Arbeit so weit herabwürdigen lassen,
110
daß sie 1848 das Gesetz, welches die Arbeit in den Fabriken auf 12 Stunden täglich be-schränkte, als eine revolutionäre Errungenschaft entgegennahmen; sie proklamierten das Recht auf Arbeit als ein revolutionäres Prinzip. Schande über das französische Pro-letariat ! Nur Sklaven sind einer solchen Erniedrigung fähig. 20 Jahre kapitalistischer Zivilisation müßte man aufwenden, um einem Griechen der antiken Heldenzeit eine solche Entwürdigung begreiflich zu machen !
Und wenn die Leiden der Zwangsarbeit, die Foltern des Hungers, über das Proleta-riat hereingebrochen sind, zahlreicher als die Heuschrecken der Bibel: eben das haben sie selbst heraufbeschworen.
Dieselbe Arbeit, welche die Proletarier im Juni 1848 mit den Waffen in der Hand for-derten, haben sie ihrer Familie auferlegt; sie haben ihre Frauen, ihre Kinder den Fa-brikbaronen ausgeliefert. Mit eigener Hand haben sie ihre häuslichen Herde zerstört, mit eigener Hand die Brüste ihrer Frauen trocken gelegt; diese Unglücklichen haben schwangere und stillende Frauen in die Bergwerke und Fabriken geschickt, wo sie sich schinden und die Nerven zerrütten; sie haben mit eigener Hand das Leben und die Kraft ihrer Kinder untergraben.
Schande über die Proletarier ! Wo sind jene Gevatterinnen hin mit frechem Mund-werk, frischer Offenherzigkeit, dem Saufen zugeneigt, von denen unsere alten Mär-chen und Erzählungen berichten ? Wo sind die Übermütigen hin, die stets herumtrip-pelnd, stets anbändelnd, stets singend, Leben säend, wenn sie sich dem Genuss hinga-ben, ohne Schmerzen gesunde und kräftige Kinder gebaren ? Heute haben wir Frauen und Mädchen aus der Fabrik, verkümmerte Blumen mit blassem Teint, mit Blut ohne Röte, mit krankem Magen und erschöpften Gliedmaßen ! Ein gesundes Vergnügen ha-ben sie nie kennengelernt und sie werden nicht lustig erzählen können, wie man sie er-oberte. Und die Kinder ? 12 Stunden Arbeit für die Kinder. O Elend ! Alle Jules Simon von der Akademie der moralischen Wissenschaften, alle jesuitischen Germinys hätten kein den Geist der Kinder mehr verdummendes, ihr Gemüt mehr verderbendes, ihren Körper mehr zerrüttendes Laster ersinnen können als die Arbeit in der verpesteten At-mosphäre der kapitalistischen Werkstätten.
Unser Jahrhundert wird das Jahrhundert der Arbeit genannt; tatsächlich ist es das Jahrhundert der Schmerzen, des Elends und der Verderbnis. (…)
Arbeitet, arbeitet, Proletarier, vermehrt den gesellschaftlichen Reichtum und damit euer persönliches Elend. Arbeitet, arbeitet, um, immer ärmer geworden, noch mehr Ur-sache zu haben, zu arbeiten und elend zu sein. Das ist das unerbittliche Gesetz der kapi-talistischen Produktion. (…)
111
Statt in den Zeiten der Krise eine Verteilung der Produkte und allgemeine Belus-tigung zu verlangen, rennen sich die Arbeiter vor Hunger die Köpfe an den Toren der Fabriken ein. Mit eingefallenen Wangen, abgemagerten Körpern überlaufen sie die Fa-brikanten mit kläglichen Ansprachen: »Lieber Herr Chagot, bester Herr Schneider, ge-ben Sie uns doch Arbeit, es ist nicht der Hunger, der uns plagt, sondern die Liebe zur Arbeit !« – Und, kaum imstande sich aufrechtzuerhalten, verkaufen die Elenden 12 bis 14 Stunden Arbeit um die Hälfte billiger als zur Zeit, wo sie noch Brot im Korbe hat-ten. Und die Herren industriellen Menschenfreunde benutzen die Arbeitslosigkeit, um noch billiger zu produzieren.
Wenn die industriellen Krisen auf die Perioden der Überarbeit so notwendig folgen wie die Nacht dem Tag und erzwungene Arbeitslosigkeit bei grenzenlosem Elend nach sich ziehen, so bringen sie auch den unerbittlichen Bankrott mit sich. Solange der Fab-rikant Kredit hat, läßt er der Arbeitswut die Zügel schießen, er pumpt und pumpt, um den Arbeitern den Rohstoff zu liefern. Er läßt drauflosproduzieren, ohne zu bedenken, daß der Markt überfüllt wird und daß, wenn er seine Waren nicht verkauft, er auch sei-ne Wechsel nicht einlösen kann. In die Enge getrieben, fleht er den Rothschild an, wirft sich ihm zu Füßen, bietet ihm sein Blut an, seine Ehre. »Ein klein wenig Gold würde meinem Geschäft gut tun«, antwortet der Rothschild, »Sie haben 20 000 Paar Strümp-fe auf Lager, die 20 Sous wert sind; ich nehme sie für 4 Sous.« Ist der Handel gemacht, so verkauft Rothschild zu 6 und 8 Sous und steckt lebendige 100-Sousstücke ein, für die er keinem etwas schuldet; der Fabrikant aber hat seinen Aufschub nur erlangt, um desto gründlicher pleite zu gehen. Endlich tritt der allgemeine Zusammenbruch ein und die Warenlager laufen über; da werden dann so viel Waren aus dem Fenster herausge-worfen, daß man gar nicht begreifen kann, wie sie zur Tür hereingekommen sind. Nach Hunderten von Millionen beziffert sich der Wert der zerstörten Waren; im vorigen Jahrhundert verbrannte man sie oder warf sie ins Wasser. (…)
Wie an Waren, so herrscht auch Überfluß an Kapitalien. Die Finanziers wissen nicht mehr, wo dieselben unterbringen; so machen sie sich dann auf, bei jenen glücklichen Völkern, die sich noch Zigaretten rauchend in der Sonne räkeln, Eisenbahnen zu bau-en, Fabriken zu errichten und den Fluch der Arbeit zu importieren. Und dieser franzö-sische Kapitalexport endet eines schönen Tages mit diplomatischen Verwicklungen: in Ägypten wären sich Frankreich, England und Deutschland beinahe in die Haare gera-ten, um sich zu vergewissern, wessen Wucherer zuerst bezahlt werden, und mit Krie-gen wie in Mexiko, wo man französische Soldaten hinschickte, die Rolle von Gerichts-vollziehern zur Eintreibung fauler Schulden zu spielen.
112
Diese persönlichen und gesellschaftlichen Leiden, so groß und unzählbar sie auch sind, so ewig sie auch erscheinen mögen, werden verschwinden wie die Hyänen und die Scha-kale beim Herannahen des Löwen, sobald das Proletariat sagen wird: »Ich will es«. Aber damit ihm seine Kraft bewußt wird, muß das Proletariat die Vorurteile der christli-chen, ökonomischen und liberalistischen Moral mit Füßen treten; es muß zu seinen na-türlichen Instinkten zurückkehren, muß die Faulheitsrechte ausrufen, die tausendfach edler und heiliger sind als die schwindsüchtigen Menschenrechte, die von den übersinn-lichen Anwälten der bürgerlichen Revolution wiedergekäut werden; es muß sich zwin-gen, nicht mehr als drei Stunden täglich zu arbeiten, um den Rest des Tages und der Nacht müßig zu gehen und flott zu leben. (…)
Da jedoch die Arbeiterklasse in ihrer Einfalt sich den Kopf hat verdrehen lassen und sich mit ihrem kindlichen Ungestüm blindlings in Arbeit und Enthaltsamkeit gestürzt hat, so sieht sich die Kapitalistenklasse zu erzwungener Faulheit und Üppigkeit, zur Unproduktivität und Überkonsum verurteilt. Und wenn die Überarbeit des Proletari-ers seinen Körper abrackert und seine Nerven zerrüttet, so bringt sie dem Bourgeois nicht weniger Leiden.
Die Enthaltsamkeit, zu welcher sich die produktive Klasse hat verurteilen lassen, macht es der Bourgeoisie zur Pflicht, sich der Überkonsumtion der zuviel verfertigten Produkte zu widmen. Zu Anfang der kapitalistischen Produktion, vor ein oder zwei Jahrhunderten, war der Bourgeois noch ein ordentlicher Mann mit vernünftigen und friedlichen Sitten: er begnügte sich mit einer Frau, wenigstens beinahe, er trank nur, wenn er Durst, und aß nur, wenn er Hunger hatte. Er überließ den Höflingen und Hof-damen die adligen Tugenden der Ausschweifung. Heute gibt es keinen Sohn eines Em-porkömmlings, der nicht glaubt, er müsse die Prostitution fördern und seinen Körper verquecksilbern, um der Schufterei, der sich die Arbeiter in den Quecksilberminen aus-setzen, einen Sinn zu geben. (…)
Einmal in der absoluten Faulheit versunken und von dem erzwungenen Genuß de-moralisiert, gewöhnte sich die Bourgeoisie trotz der Übel, welche ihr daraus erwach-sen, bald an das neue Leben. Mit Schrecken sah sie jeder Änderung der Dinge entgegen. Angesichts der jammervollen Lebensweise, der sich die Arbeiterklasse resigniert unter-warf, und der organischen Verkümmerung, welche die unnatürliche Arbeitssucht zur Folge hat, steigert sich noch ihr Widerwille gegen jede Auferlegung von Arbeitsleistun-gen und gegen jede Einschränkung ihrer Genüsse.
Und just zu dieser Zeit setzten es sich die Proletarier, ohne der Demoralisierung, wel-che sich die Bourgeoisie als eine gesellschaftliche Pflicht auferlegt hatte, im geringsten
113
zu achten, in den Kopf, die Kapitalisten zwangsweise zur Arbeit anzuhalten. In ihrer Einfalt nahmen sie die Theorien der Ökonomen und Moralisten über die Arbeit ernst und schickten sich an, die Praxis derselben den Kapitalisten zur Pflicht zu machen. Das Proletariat proklamierte die Parole: »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.« Im Jah-re 1831 erhob sich Lyon für »Blei oder Arbeit«; die Juni-Insurgenten von 1848 forderten das Recht auf Arbeit; und die Föderierten vom März bezeichneten ihren Aufstand als die Revolution der Arbeit. (…)
Und so besteht, angesichts der doppelten Verrücktheit der Arbeiter, sich durch Über-arbeit umzubringen und in Entbehrungen dahinzuvegetieren, das große Problem der kapitalistischen Produktion nicht darin, Produzenten zu finden und ihre Kräfte zu ver-zehnfachen, sondern Konsumenten zu entdecken, ihren Appetit zu reizen und bei ih-nen künstliche Bedürfnisse zu wecken.
Und da die europäischen Arbeiter, vor Hunger und Kälte zitternd, sich weigern, die Stoffe, die sie weben, zu tragen, den Wein, den sie ernten, zu trinken, so sehen sich die armen Fabrikanten genötigt, wie Wiesel in ferne Länder zu laufen und dort Leute zu suchen, die sie tragen und trinken. Hunderte von Millionen und Milliarden sind es, wel-che Europa jährlich nach allen vier Enden der Welt zu Völkern exportiert, die nicht wis-sen, was sie damit anfangen sollen. (…)
Was die Arbeiter, verdummt durch ihr Laster, nicht einsehen wollen: man muß, um Arbeit für alle zu haben, sie rationieren wie Wasser auf einem Schiff in Not…
Wenn die Verkürzung der Arbeitszeit der gesellschaftlichen Produktion neue me-chanische Kräfte zuführt, so wird die Verpflichtung der Arbeiter, ihre Produkte auch zu verzehren, eine enorme Vermehrung der Arbeitskräfte zur Folge haben. Die von ih-rer Aufgabe, Allerweltsverbraucher zu sein, erlöste Bourgeoisie wird nämlich schleu-nigst die Menge von Soldaten, Beamten, Dienern, Kupplern usw., die sie der nützli-chen Arbeit entzogen hatte, freigeben. Infolgedessen wird der Arbeitsmarkt so über-füllt sein, daß man ein eisernes Gesetz haben muß, das die Arbeit verbietet; es wird unmöglich sein, für diesen Schwarm bisher unproduktiver Menschen Verwendung zu finden, denn sie sind zahlreicher als die Heuschrecken. Dann wird man an die denken, die für den kostspieligen und nichtsnutzigen Bedarf dieser Leute aufzukommen hatten. Wenn keine Lakaien und Generäle mehr geschmückt, keine verheirateten oder unver-heirateten Prostituierten mehr in Spitzen gehüllt, keine Kanonen mehr gegossen und keine Paläste mehr eingerichtet werden müssen, dann wird man mittels drakonischer Gesetze die Schnick-Schnack-, Spitzen-, Eisen-, Bau-Arbeiter und -Arbeiterinnen zu gesundem Wassersport und Tanzübungen anhalten, um ihr Wohlbefinden wieder her-
114
zustellen und die menschliche Art zu verbessern. Von dem Augenblick an, wo die eu-ropäischen Produkte am Ort verbraucht und nicht mehr zum Teufel geschickt werden, werden auch die Seeleute, die Verladearbeiter und die Fahrer anfangen, Däumchen dre-hen zu lernen. Dann werden die glücklichen Südseeinsulaner sich der freien Liebe hin-geben können, ohne die Fußtritte der zivilisierten Ankömmlinge und die Predigten der europäischen Moral zu fürchten.
Noch mehr. Um für alle Nichtsnutze der heutigen Gesellschaft Arbeit zu finden, und die immer weitere Vervollkommnung der Arbeitsmittel zu fördern, wird die Arbeiter-klasse ihrem Hang zur Enthaltsamkeit, gleich der Bourgeoisie, Gewalt antun und ihre Konsumfähigkeit unbegrenzt steigern müssen. Anstatt täglich ein oder zwei Unzen zä-hes Fleisch zu essen, wenn sie überhaupt welches ißt, wird sie saftige Beefsteaks von ein oder zwei Pfund essen; statt katholischer als der Papst bescheiden einen schlech-ten Wein zu trinken, wird sie aus großen, randvollen Gläsern Bordeaux und Burgunder trinken, der keiner industriellen Taufe unterzogen ist, und das Wasser dem Vieh über-lassen.
Die Proletarier haben sich in den Kopf gesetzt, den Kapitalisten zehn Stunden Schmiede oder Raffinerie aufzuerlegen – das ist der große Fehler, die Ursache der sozia-len Gegensätze und der Bürgerkriege. Nicht auferlegen, verbieten muß man die Arbeit. Den Rothschilds, den Says wird erlaubt werden, den Beweis zu liefern, daß sie ihr gan-zes Leben lang vollkommene Nichtstuer gewesen sind; und wenn sie versprechen, trotz des allgemeinen Zuges zur Arbeit, als vollkommene Nichtstuer weiterzumachen, wer-den sie auf die Rechnung gesetzt und erhalten jeden Morgen auf dem zuständigen Rat-haus ein 20 - Francstück als Taschengeld. Die gesellschaftliche Zwietracht verschwin-det (…).
Wenn die Arbeiterklasse sich das Laster, welches sie beherrscht und ihre Natur he-rabwürdigt, gründlich aus dem Kopf schlagen und sich in ihrer furchtbaren Kraft er-heben wird, nicht um die »Menschenrechte« zu verlangen, die nur die Rechte der ka-pitalistischen Ausbeutung sind, nicht um das »Recht auf Arbeit« zu fordern, das nur das Recht auf Elend ist, sondern um ein ehernes Gesetz zu schmieden, das jedermann verbietet, mehr als drei Stunden pro Tag zu arbeiten, dann wird die alte Erde, zitternd vor Wonne, in ihrem Inneren eine neue Welt sich regen fühlen – aber wie soll man von einem durch die kapitalistische Moral verdorbenen Proletariat einen männlichen Ent-schluß verlangen !
Wie Christus, die leidende Verkörperung der Sklaverei des Altertums, erklimmt unser Proletariat, Männer, Frauen und Kinder, seit einem Jahrhundert den harten Kal-
115
varienberg der Leiden; seit einem Jahrhundert bricht Zwangsarbeit ihre Knochen, mar-tert ihr Fleisch, zerrüttet die Nerven; seit einem Jahrhundert quält Hunger ihren Magen und verdummt ihr Gehirn (…)
O Faulheit, erbarme Du Dich des unendlichen Elends !O Faulheit, Mutter der Kunst und der edlen Tugenden, sei Du der Balsam für die Schmer-zen der Menschheit ! (…)
Quelle
paul lafargue: Das Recht auf Faulheit. Widerlegung des »Rechts auf Arbeit«von1848, 1883 (neu übersetzt und herausgegeben als Sondernummer der »Schriften gegen die Arbeit«, Ludwigshafen 1988), www.wildcat-www.de/material/m003lafa.htm
116
Der Entzug der Naturzu Paul Lafargues Polemik gegen die Lohnarbeitvon Klaus Neundlinger
Greift man im Zusammenhang eines kulturwissenschaftlichen Schwerpunktes, der sich mit den Strategien des Sich-Entziehens beschäftigt, auf einen Text zurück, der vorder-gründig das Sich-Entziehen par excellence zum Thema hat, nämlich die Verweigerungs-haltung gegenüber der wesentlichen Quelle materieller und symbolischer gesellschaft-licher Produktion und Reproduktion, so gilt es zunächst einmal, Vorsicht walten zu las-sen. Versuchen wir also einerseits, uns vorschnellen Analogien zu entziehen, und setzen wir uns andererseits dem Dilemma aus, das der Text selbst exemplifiziert: Jegliche Zu-rückweisung eines materiellen oder geistigen Aufwandes ist selbst mit materiellem oder geistigem Aufwand verbunden.
Paul Lafargue fordert ein Recht ein, dessen Logik seiner Auffassung nach den fun-damentalen Bestrebungen der arbeitenden Klassen seiner Zeit entgegengesetzt ist. In-sofern ist seine Kritik an der ArbeiterInnenbewegung eine Kritik an der Ideologie des Arbeitsbegriffs, die diese Bewegung seiner Auffassung nach vorbehaltlos übernommen hat. Er versucht zu zeigen, wie sehr das Bestehen auf dem »Recht auf Arbeit« diese Klas-se immer weiter ins Elend treibt, anstatt die Bedingungen für gerechte Entwicklung und Entfaltung des individuellen wie des sozialen Lebens zu schaffen. Es geht ihm also nicht darum, das Recht selbst als Instanz der Regelung des symbolischen und materiel-len Verkehrs der gesellschaftlichen Klassen untereinander abzuschaffen, sondern dar-um, den Gehalt jener Forderungen infrage zu stellen, die es den Arbeiterinnen und Ar-beitern nicht ermöglicht haben, aus dem Zustand der Unterdrückung auszubrechen. In dieser Hinsicht handelt es sich nun keinesfalls um einen historischen Text, denn die von
117
Der Entzug der Naturzu Paul Lafargues Polemik gegen die Lohnarbeitvon Klaus Neundlinger
Lafargue beschriebenen Arbeits- und Lebensbedingungen sind zwar zu einem Großteil aus den Gesellschaften des Westens verschwunden, wuchern aber weiter in den Fer-tigungsstätten und urbanen Räumen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Denkt man darüber hinaus an die Prozesse der Aushöhlung des Arbeitsrechts und der Ausbreitung von Beschäftigungsverhältnissen, die keine ausreichende soziale und materielle Absi-cherung bieten, so muss man sogar zur Überzeugung gelangen, dass sich der von Lafar-gue beschriebene Prozess innerhalb der wohlhabenden Gesellschaften auf höherer Stu-fe zu wiederholen scheint. An die Stelle der Verelendung trotz Arbeit sind in den entwi-ckelten kapitalistischen Ökonomien eine Reihe von Ausschlussmechanismen getreten, die viele Menschen trotz Erwerbsarbeit von der Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben und am Genuss vieler erzeugter Güter abhält.
Das von Lafargue ins Treffen geführte Recht auf Faulheit verweist nicht auf das Nichtstun schlechthin, sondern auf den ursprünglich politischen Charakter der Ar-beit selbst. Es verweist auf jene Arbeit, die in die Schaffung von sozialen und politi-schen Verhältnissen einfließt und die nur vor dem Hintergrund einer Analyse der sym-bolischen Ökonomie in einen »notwendigen« und einen »müßigen« Teil getrennt wer-den kann (vgl. Bourdieu 2005). Lafargue wirft eine Frage auf, die es gewissermaßen an jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt auf je andere Weise zu stellen gilt, nämlich die Fra-ge nach der Organisation von Arbeit, nach ihrer Begrenzung, nach ihrem Sinn, nach ih-rer kollektiven wie individuellen Bedeutung. Wer genießt die Früchte des geschaffenen Reichtums, wie wird über die Versorgung mit Gütern entschieden, wie werden diese verteilt, was wird als sinnvolle Tätigkeit anerkannt, welche Formen der Tätigkeit wer-den der Produktion, welche der Reproduktion zugeschrieben ? All diese Fragen wer-den nicht unter Gleichberechtigten ausgehandelt, sondern auf einem Markt der sym-bolischen Produktion, der von Machtverhältnissen und Strukturen der Repräsentation geprägt ist.
An diesem Punkt jedoch beginnt die Fragestellung sich dem Autor zu entziehen, und in diesem Sinn können wir bestimmt nicht an seine doch so sympathischen Ausführun-gen anschließen. Lafargue argumentiert die Faulheit nämlich metaphysisch, indem er sie zwar einerseits der Arbeit als wesentlichem Mittel zur Kolonisierung und Diszip-linierung der arbeitenden Massen auf der ganzen Welt entgegenstellt, jedoch anderer-seits der Versuchung erliegt, einen originären, moralisch noch nicht verdorbenen Zu-stand zu konstruieren, in dem Faulheit ein verbrieftes Recht zu sein scheint: ein Ensem-ble von natürlichen Bedingungen, unter denen Gesellschaften funktionieren, bis die sie bestimmenden Beziehungen von der Maschine des Kapitalismus aufgebrochen und
118
nachhaltig zerstört werden. Doch weisen auch jene Gesellschaften, die noch nicht von der blinden Verehrung des Götzen Arbeit erfasst wurden, institutionelle Bedingungen und soziale Verhältnisse auf, die mehr als fragwürdig sind. Lafargues positive Verwei-se auf die antiken Gesellschaften mit dem für diese charakteristischen Ausschluss der notwendigen Arbeit aus dem Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe sind diesbezüglich nur allzu verräterisch.1
So scharfsinnig er den mit der industriellen Revolution verbundenen Fortschritts-glauben als Illusion demaskiert, so leichtfertig gibt er sich selbst dem Glauben hin, dass die Sklaverei dank eines konsequenten Einsatzes von Maschinen sich früher oder später erübrigen wird. Er hat wohl Recht, wenn er davon ausgeht, dass gerade der Widerstand der arbeitenden Massen gegen die Unterwerfung unter die Fabrikarbeit zu schnelle-ren und effizienteren technischen Entwicklungen führt, dass dieser Widerstand, wie Deleuze und Foucault es hundert Jahre später formulieren sollten, »primär« ist. Dieser Widerstand, dessen politischen Wert entdeckt und formuliert sowie daraus Strategien des Arbeitskampfes entwickelt zu haben eine der wesentlichen Leistungen des italie-nischen Operaismus ist (vgl. Tronti 1974), muss sich jedoch organisieren und ist damit all den Fragen ausgesetzt, die die ArbeiterInnenklasse im Verlauf des 20. Jahrhunderts nicht mehr verlassen werden: die Konstruktion eines zu repräsentierenden Subjekts und damit die Frage nach den impliziten Hierarchien, den antiminoritären, sexistischen und rassistischen Strukturen, die aus einer einheitlich auftretenden Klasse eine zutiefst ambivalente »Multitude« machen (vgl. Virno 2005). Es gibt also wesentlich mehr Pro-bleme zu lösen als die Reduktion der Arbeitszeit, anders ausgedrückt, die durchaus zu begrüßende Festlegung der Arbeitszeit auf drei Stunden täglich ist nur ein kleiner Teil der Lösung.
Der Begriff der »Natur«, der den Text heimsucht, ist also in zweierlei Hinsicht kri-tisch zu befragen: Erstens: In welchem Ausmaß trägt er dazu bei, die symbolische Pro-duktion zu unterschlagen, also den Umstand, dass Klassen und Gesellschaften auf je-den Fall Arbeit aufwenden, um ihre inneren Hierarchien zu organisieren, um Tausch-beziehungen zu instituieren und soziale Differenzen aufrechtzuerhalten ? Die Analyse darf nicht dabei stehen bleiben, dialektisch ein Recht auf Faulheit zu verlangen, wo die Arbeit zum Zwang geworden ist und die Rede vom »Recht« darauf also ad absurdum geführt wird. Solch eine Analyse unterschlägt nämlich – wie Lafargue in seinem Text auch ironisch andeutet –, dass es in einer Gesellschaft immer eine Verteilung zwischen angenehmer und unangenehmer, zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit gibt, sowie es für einige das Privileg auf Faulheit gibt, also das Vorrecht, zu genießen, wo
1 Wahrscheinlich hätte Lafargue nicht so weit in die Vergangenheit zurückzugehen brauchen, um die Frage nach dem Verhältnis von sozialer Frage und politischer Teilhabe zu stellen. Aufgrund der jeweils recht unterschiedlichen sozialen und materiellen Voraussetzungen nahmen die beiden Revolutionen, die die Heraufkunft der modernen Staatsgebilde unter den Bedingungen des Republikanismus und der Verfassung einläuteten, nämlich die amerikanische und die französische, ebenso unterschiedliche Züge an (vgl. Arendt 1965).
119
andere der Mühe, dem Leiden und der Verelendung ausgesetzt sind und sich dem mo-ralischen Vorwurf des Faulseins aussetzen, wenn sie sich diesem Zustand zu entziehen trachten.Zweitens: Inwiefern dient die »Natur« als Projektionsfläche, auf die das Außen der je-weiligen Gesellschaft gemalt wird ? Sie wird gleichermaßen dazu verwendet, Wün-sche aus dem gesellschaftlichen Realen abzuspalten und Figuren zu schaffen, welche die Aggressivität, den Hass und alles, was gesellschaftlich nicht akzeptiert ist (die Un-werte), anschaulich darzustellen und vom Gesellschaftskörper fernzuhalten. Wir ken-nen diese Operationen zur Genüge, da sie (nicht nur, aber vor allem) von den rechtsext-remen und rechtspopulistischen Parteien in der politischen Auseinandersetzung einge-setzt werden. Wenn »Natur« in diesem Sinn einerseits jenen Ort bedeutet, an dem sich die gesellschaftliche Organisation und die mit ihr verbundenen Hierarchien und Unter-drückungsmechanismen verstecken, so müssen wir andererseits auch auf einen Begriff von »Natur« zu sprechen kommen, der üblicherweise mit den Grenzen des kapitalisti-schen Wachstums in Verbindung gebracht wird. Nicht Wachstum an sich ist verdam-menswert und einzugrenzen, sondern jenes Wachstum, das es nicht versteht, die ver-schiedenen Materialzyklen so aufeinander abzustimmen, dass die eingesetzten Materi-alien nicht mehr oder nur unter großen Verlusten weiter verwendet werden können. In eine ökologisch – nicht effiziente, sondern – effektive Produktion (vgl. Braungart, Mc-Donough 2003) ist demnach noch reichlich wenig und in gewissem Sinn doch zu viel Ar-beit geflossen. Denn auch in diesem Zusammenhang geht es nicht um eine simple Ent-gegensetzung, wie beim Begriffspaar Arbeit/Faulheit. Es geht darum, zu verstehen, wie Wachstum vom Zeitpunkt des Entwurfs an in die Produktion integriert werden kann, nicht erst ab dem Zeitpunkt, an dem alle ökologischen und sozialen Belastungen als »Externalitäten« getarnt werden und deshalb nicht mehr in den Preis des Produktes einfließen. Auch hinsichtlich der Produktzyklen scheint sich das begriffliche Paar Ar-beit/Faulheit zu verdoppeln, und auch in diesem Fall zeigt sich die Ambivalenz der Zu-ordnung. Sollen Produkte ein »Recht auf Faulheit« erhalten, so kann damit nur gemeint sein, dass ökologische, soziale und politische Fragen in ihren Zyklus integriert werden, und zwar als Wachstum, als Bereicherung, nicht als Kosten. Im Film Schwarze Katze, weißer Kater (1998) von Emir Kusturica sieht man immer wieder ein Schwein, das am Straßenrand sitzt und langsam, aber stetig, ein Autowrack verspeist. Was man einer-seits als Metapher für den unerbittlichen Prozess des Sich-Verzehrens der Zeit deuten könnte, wäre doch eine schöne Aufgabe für KonstrukteurInnen, die ökologisch effekti-ve Autos bauen wollen: solche, die man essen kann !
120
Bibliografie
arendt hannah: Über die Revolution. 1965, Münchenbourdieu, pierre: Was heißt sprechen ? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. 2005, Wienbraungart, michael und william mcdonough: Einfach intelligent produzieren. 2003, Berlintronti, mario: Arbeiter und Kapital. 1974, Frankfurtvirno, paolo: Grammatik der Multitude. 2005, Wien
122
impressumMedieninhaberin, Verlegerin, Herausgeberin:Hyper[realitäteten]büroRienößlgasse 11/14, 1040 Wien
redaktionKarin HarrasserDaniel WinklerMarie-Noëlle Yazdanpanah
gestaltungKlaus Hofeggerwww.hofegger.com
fotografieHanna Haböckwww.haboeck.com illustration Elvira Stein www.elvirastein.com
vertriebLöcker VerlagAnnagasse 3a, 1015 Wien
ISBN 978-3-85409-536-1