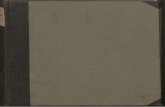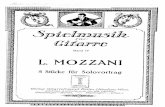mtschrift für Allgemeinmedizin - DEGAM
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of mtschrift für Allgemeinmedizin - DEGAM
mtschrift für Allgemeinmedizin3/96"l. Jahrgang • Heft 3 • 20. Februar 1996
'iH
Forum Qualität:“Was wünschen sich die
Patienten vom Arzt?
Aktuelle Übersicht: Indikationen zur
Schrittmacher-Therapie
Wie werden Bradykardien richtig
behandelt?
Sinnvolle Diagnostik vor Einsatz eines Schrittmachers
Schrittmacher-Patient: Welche Notfälle
können auftreten?3. 9^
Merkblatt für Ihre Schrittmacher-Patienten
HIPPOKRATES VERLAG GMBH • STUTTGART"wcnm
ZFA ISSN 0341-9835
126
Ein Klassiker
ByiiD300Wirkstoff: Roxithromycin 1 x1
umfassend wirksam gegen Atemwegsinfekte
Rulid® 300Zusammensetzung: 1 Filmtablette Rulid 300 enthält 300 mg Roxithromycin. Sonstige Bestandteile: Hydroxypropylcellulose, Poloxamer (79,28, 79), Polyvidon K 30, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Talkum, Maisstärke, Hypromellose, Glucose, Titandioxid (E171), Propylenglykol. Anwendungsgebiete: Infektionen durch roxithromycinempfindliche Erreger. Insbesondere Infektionen im HNO-Bereich - Tonsillitis, Pharyngitis, Sinusitis, Otitis media -, Infektionen der Luftwege - Bronchitis, Pneumonie, auch durch Mykoplasmen und Legionellen, Keuchhusten -, Infektionen des Urogenitaltraktes - Urethritis, Cervicitis, Cervicovaginitis durch Chlamydien und Mykoplasmen (keine Gonokokken) -, Infektionen der Haut - Furunkulose, Pyodermie, Impetigo, Erysipel -. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Makrolide, Schwangerschaft. Bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen Kontrolle der Leberenzyme, ggf. Dosishalbierung. Behandlung mit Mutterkornalkaloiden. Kreuzresistenz mit Erythromycin. Kinder und Jugendliche, Patienten unter 40 kg. Nebenwirkungen: Gastrointestinale Störungen, in Einzelfällen blutige Durchfälle, selten allergische Reaktionen jeglichen Schweregrades bis zum Schock. Vorübergehende Störungen der Leberfunktion. Sehr selten Kopfschmerz, Schwindel, Parästhesien. In Einzelfällen Anzeichen einer Pankreatitis. SuperinfektionenmitCandida. Störungen desGeschmacks-ZGeruchssinnes. Wechselwirkungen: Mutterkornalkaloide, Theophyllin (Drugmonitoring über 15 mg/l). Möglicherweise: Vitamin-K-Antagonisten, Digoxin, Disopyramid, Verstärkung der Midazolamwirkung. Vorsicht bei Terfenadin. Wirkwelse: Hemmung der bakteriellen Proteinsynthese. Dosierung: Erwachsene über 40 kg: täglich 1 x 1 Filmtablette Rulid 300. Handelsformen und Preise: Rulid 300: Packung mit 7 Tabletten (NI) DM 49,65; Packung mit 10 Tabletten (NI) DM 67,40; Krankenhauspackungen. Verschreibungspflichtig (Stand: September 1995).
Albert-Roussel Pharma GmbH, Abraham-Lincoln-Str. 38-42, 65189 Wiesbaden
Grünenthal GmbH, SteinfeldstraBe 2, 52222 Stolberg/Rhld.
GRUNENTHAL
Jahre Erfahrungen mit zschrittmachem
Nach der Erstimplantation am 8.10. 1958 begann Anfang der 60er Jahre der breitere klinische Einsatz der Herzschrittmacher. Die Modelle auf der Titelseite belegen 35 Jahre Herzschrittmacher-Generator-Entwicklung. Das Thema mag eng erscheinen für unseren Praxisalltag, aber jeder von uns hat unter seinen Patienten Herzschrittmacherträger - und sie kommen mit Fragen, selten mit echten Problemen. Denn diese Therapie gehört zu den sichersten und wirkungsvollsten.
Die technische Entwicklung, ihren Standard belegen die Aufsätze dieses Heftes ebenso wie sie uns über mögliche Störungen und Komplikationen informieren auf einem Behandlungsweg, der ein Stück gestörter Natur so für den einzelnen Kranken auszugleichen versucht, daß wieder ein fast folgenloser Zustand eintritt. Mit den immer näher an die Normalfunktion sich herantastenden Systemen haben sich auch die Indikationen zur Implantation erweitert. Andererseits ist manches - wie der Einsatz der antitachykarden Systeme - inzwischen überholt, durch andere Behandlungsmöglichkeiten wirkungsvoller ersetzt. Auch das erfahren wir.
An dieser Stelle mag es erlaubt sein, daß auch ein Schriftleiter dieser Zeitschrift einmal sozusagen aus sich herausgeht. Von Beginn meiner internistischen Tätigkeit an war ich von dieser Behandlungsmethode begeistert, fasziniert. Ich bin es heute noch, umsomehr wenn ich mich an die Anfänge mit den unzähligen, eigentlich banalen technischen und Materialschwierigkeiten erinnere!
Ich sende daher mit diesen Zeilen und diesem ZFA-Heft, das als ein praktisches Herzschrittmacher-Kompendium nun vor dem Leser liegt, dankbare Grüß an den heutigen Senior der deutschen Kardiologie, Prof. Dr. Konrad Spang, und seinen damaligen Oberarzt Dr. Adolf Bruck.
Diese Arbeiten belegen ein Stück miterlebter Medizingeschichte für eine äußerst segensreiche Behandlungsart. Ich empfinde es dabei als Vorteil, daß diese Gesamtübersich aus einem einzelnen führenden Zentrum stammt.
Ihr
Dr. med. W. Mahringer Schelztorstr. 42 73728 Esslingen
gut geschlafen - nun hellwach!
Der Erfolg einerSchlaftherapie zeigt sich danach:• am nächsten Morgen• beim Absetzen• bei den ArzneikostenChloraldurat' 500. Wirkstoff: Chloralhydrat. Verschreibungspflichtig. Zus.: 1 Kapsel enthält 500 mg Chloraldurat. Sonstige Bestandteile: Macrogol 400; Gelatine; Glycerol 85%; Mannitol, Sorbitan und Polyole; Farbstoffe E 171, E 124, E 172. Anw.-Geb. : Schlafstörungen. Zur Beruhigung bei Erregungszuständen organischer bzw. psychischer Genese wie Z.B.: cerebralsklerotisch bedingten Unruhezuständen. Gegenanz.-: schwere Leber- und Nierenschäden, schwere Herz-Kreislaufschwäche, Gravidität, Stillzeit, Antikoagulantientherapie (Cumarin-Typ), Kinder unter 6 Janren. Nebenw.; Selten Benommenheit, Schwindel, Schlafstörung, psychische Beeinträchtigungen z.B. Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Unruhe, Allergie (vor allem an der Haut), Müdigkeit am Morgen, Kopfschmerzen. In Einzelfällen Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (z.B. Blähungen, Druckgefühl, Übelkeit, Durchfall). Toleranz und Abhängigkeit sind nicht völlig auszuschließen. Beeinträchtig, der aktiven Verkehrsteilnahme oder Maschinenbedien. möglich, insbesondere zusammen mit Alkohol. Wechselw.: Wirkverstärkung durch Sedativa und Alkohol. Wirkbeeinflussung von Antikoagulantien (Cumarin-Typ). Dos./Anw.: 1-2 Kapseln 1/2 h vor dem Schlafengehen. Maximale Tagesdosis 4 Kapseln. Handelsf.: 15/30 Kapseln DM 7,39/14,15. Klinikpackung. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., 25551 Hohenlockstedt. Stand 12.95. Inpress 4220.
PohlBoskamp
Chloraldurat® 50015 Kapseln DM 7,39
30 Kapseln DM 14,15
Als erste Instanz bei
ärztlich zu behandelnden
Schlafstörungen
INHALT ***
krates Verlag GmbH Stuttgart 72. Jahrgang, Heft 3
Dl-
H.-
Di'H.
No>Sei;H.-:
kaiioneii zur Schrittmacher-Therapie' Trappe
Gr; entialtherapie bradykarder : üimusstöruiigen.r Irappe und P. Pfitzner
'riuostik vor der Schrittmacher-TherapieTrappe und P. Pfitzner
fälle und Komplikationen nach rittmacher-Implantation. Trappe
Service Box
Merkblatt für Schrittmacher-Patienten
OnlinePraxis-EDVKongreß ExtraKongreßberichteForum QualitätBuchbesprechungenImpressum
135
146
155
163
145
171
131 141 177 172 180 154132
129
PROSTAMEDProstatasyndrom mit Harnverhaltung, Miktionsbeschwerden und Restharn, Reizblase, auch bei Frauen
Zusammensetzung: 1 Tablette Prostamed enthält: Kürbisglobulin 0,1 g, Kürbismehl 0,2 g, Kakao 0,05 g, Extr. fl. Herb. Solidag. 0,04 g, Extr. fl. Fol. Popul. trem. 0,06 g. Sacch. lact. ad^ 0,5 g.Anwendungsgebiete: Prostata-Adenom Stadium I und beginnendes Stadium II mit Miktionsbeschwerden, Reizblase.Dosierung: 3x täglich 2-4 Tabletten einnehmen.Handelsformen und Preise:Prostamed-Tabletten:60 St. (NI) DM 9,38; 120 St. (N2) DM 16,34;200 St. (N3) DM 24,32; 360 St. DM 38,73
Dr. Gustav Klein, Arzneipflanzenforschung, 77732 Zell-Harmersbach/Schwarzwald
130 Inhalt
Bei welchen Patienten ist eine Schrittmachertherapie indiziert? Relativ einfach ist die Entscheidung bei
rezidivierenden Synkopen und nachweisbaren hö- hergradigen sinuatrialen oder atrioventrikulären
Leitungsstörungen. Aber wie ist es bei Patienten mit Schwindelzuständen oder Synkopen ohne nachweis
bare Rhythmusstörung? Indikationen zur Schrittmacher-Therapie
Seite 135
Für die Indikation zur Schrittmacher-Therapie sind vor allem Anamnese und klinische Symptomatik entscheidend. Auf welche Untersuchungen dürfen Sie also getrost verzichten, was ist nötig?Diagnostik vor der Schrittmacher-TherapieSeite 155
Spaß beiseite: Welche Wünsche haben Ihre Patienten denn nun eigentlich? Wollen sie einen Arzt
mit moderner technischer Ausstattung, einen schnellen Helfer für den Notfall oder eher einen verständnisvollen Gesprächspartner? Eine auf
schlußreiche Studie! Forum Qualität: Was wünschen Patienten vom
Hausarzt? Seite 180
Abbildungsnachweise:Titel und S. 130 oben: U. Lärz, Mitte: H.-J. Klemann, unten: R. Löffler.
UND WAS FEHLT IHNEN DENNSCHON WIEDER
EIGENTLICH NUR EINE KLEINE KRANKHEIT, MIT DER ICH 6 WOCHEN ZU HAUSE
BLEIBEN KANN
onli
Benzodiaiepiise bei alten Menschen meist falschdosiert!Die Einnahme von Benzodiazepinen erhöht bekanntermaßen das Risiko älterer Menschen zu stürzen. Welchen Einfluß Dosis und Eigenschaft des Benzodiazepins auf dieses Risiko haben, wurde in einer Eall-Kontroll-Studie untersucht. 493 Patienten im Alter über 55 Jahren, die mit einer Femurfraktur (93% Schenkelhals) nach plötzlichem Sturz hospitalisiert worden waren, wurden je drei Kontrollpatienten zugeordnet. Die Einnahme von Medikamenten irgendwelcher Art war in beiden Gruppen gleich hoch. Zwei Drittel der Patienten waren älter als 74 Jahre, drei Viertel waren Frauen.Mit einem signifikant erhöhten Sturzrisiko mit Femurfraktur als Folge gingen gegenwärtige Benzodiazepineinnahme (rel. Risiko 1,6), die Einnahme von Benzodiazepinen mit kurzer Halbwertzeit (1,5), die gleichzeitige Einnahme kurz- und langwirkender Benzodiazepine (2,5) sowie plötzliche Dosiserhöhungen (3,4) einher. Ferner bestand eine hochsignifikante Dosisabhängigkeit des Risikos. Das erhöhte Sturzrisiko wird in erster Linie durch zu hohe Dosen erklärt.Die Empfehlung, für alte Menschen die Benzodiazepindosierung für Erwachsene zu halbieren, war bei den meisten Patienten mit Fraktur nicht befolgt worden. Bei zwei Dritteln betrug sie mindestens 75% der Standarddosis. Die Halbwertzeit scheint nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. (ChR)Herings R et al: Benzodiazepines and the risk offalling leading to femur fractures. Arch Intern Med 1995; 155: 1801-07.
Was halten die Patienten vom Computer im Sprechzimmer?
Noch benutzen weniger als 1% der US- amerikanischen Ärzte computerisierte Patientenkarteien, doch angesichts sinkender Hard- und Software-Preise wird sich dieser Anteil sicher rasch erhöhen. Bedenken ärztlicherseits, einen Computer ins Untersuchungszimmer zu stellen, gründen sich u.a. auf einer möglicherweise negativen Beeinflussung der Arzt- Patient-Beziehung. Hängt die Zufriedenheit der Patienten von der Art, wie Daten und Befunde festgehalten werden, ab? Zu dieser Frage wurde in einer kalifornischen Gemeinschaftspraxis mit zwei Allgemeinärzten eine randomisierte Crossover-Studie an viermal 15 zufällig
Unter dem Stichwort ’’Elobact im Gespräch^^ hatten wir Sie zu Ihrer Erfahrung mit dem Praxis-Antibiotikum Elobact befragt. Über 2500 Ärzte aller Fachrichtungen haben geantwortet.
Hier einige Stellungnahmen:
im
„Bei alten Patienten gebe ich oft Dosierbriefe, da Schluckprobleme, gleichzeitig Flüssigkeitszufuhr...”(G. M.; Internist aus E.)
„Bei sehr alten Patienten gute;^ Verträglichkeit. Oft reichen ^ 5 Tage Therapie aus. Günstig auch die Trockensaftform für Pflegefälle.”(B.W.; Internist aus D.)
Thema heute: Altere Patienten„Hohe Ansprechrate, sehr gute Verträglichkeit. Gute Anwendung auch beim alten bettlägerigen Patienten. Aufgrund der guten Erfolge konnten sicherlich zahlreiche Krankenhausaufenthalte vermieden werden.”(S. M.; Internist aus N:)
„Gute Verträglichkeit. Prompter Wirkungseintritt. Gute Möglichkeit -der Kombination mit anderen ♦Präparaten. ”(R. L.; HNO-Arzt aus D.)
„Initial besonders bei älteren Patienten mit sehr gutem Erfolg. Schwere Infektionen, konnten damit verhindert werden (Übergang von Bronchitis in Pneumonie)... ”(E. -M. B. und K. D. B.;Allgemeinmediziner > aus L.)
P'
3[KII3ZÄ\(3ü®PRAXIS-ANTIBIOTIKUM
Wirkstoff; Cefuroximaxetil. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 Filmtablette ELOBACT 125 bzw, 250 bzw. 500 enthält: 150,36 mg bzw, 300,72 mg bzw. 601,44 mg Cefuroximaxetil, entsprechend 125 mg bzw. 250 mg bzw, 500 mg Cefuroxim. ELOBACT-Trocken- saft: 5 ml (= 1 Meßlöffel) der zubereiteten Suspension enthalten 150,36 mg Cefuroximaxetil, entsprechend 125 mg Cefuroxim sowie 3,06 g Saccharose (= 0,26 BE), 58,48 g bzw. 116,96 g Granulat ergeben 70 ml bzw. 140 ml gebrauchsfertige Suspension. ELOBACT 125 Dosier-Brief: 1 Dosier-Brief mit4,18 g Granulat enthält 150,36 mg Cefuroximaxetil, entsprechend 125 mg Cefuroxim sowie 3,06 g Saccharose (= 0,26 BE). ELOBACT 250 Dosier-Brief: 1 Dosier-Brief mit 8,35 g Granulat enthält 300,72 mg Cefuroximaxetil, entsprechend 250 mg Cefuroxim sowie 6,12 g Saccharose (= 0,51 BE). Andere Bestandteile: Elobact 125/250/500: Konservierungsmittel: Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat; Cellulose Derivat, hydriertes Pflanzenöl, Natriumdo- decylsulfat, hochdisperses Siliciumdioxid, Titan(IV)-oxid, Propylenglykol, Natriumbenzoat. Elobact-Trockensaft/- 125 Dosierbrief/- 250 Dosierbrief: Saccharose, Stearinsäure, Aromastoff, Polyvidon, Anwendungsgebiete: Infektionen durch Cefuroxim-empfindliche Erreger, wie z.B. Infektionen der Atemwege einschließlich Hals- und Ohrinfektionen, Nieren und/oder der ableitenden Harnwege, Haut und des Weichteilgewebes, akute, unkomplizierte Gonorrhoe. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Cephalosporine. Bei Penicil- linüberempfindlichkeit mögliche Kreuzallergie beachten. Vorsicht bei Patienten, die zuvor eine anaphylaktische Reaktion auf Penicillin entwickelt haben. ELOBACT Filmtabletten sind für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet. Deshalb sollte für diese Altersgruppe ELOBACT-Trockensaft oder ELOBACT Dosier- Briefe verwendet werden. Keine ausreichenden Erfahrungen bei Kindern unter 3
Monaten. Strenge .Indikationsstellung in Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen: Übelkeit, Erbrechen, Bauchbeschwerden und Durchfall (etwas häufiger nach Einnahme höherer Tagesdosen); wie auch bei anderen Antibiotika Berichte über pseudomembranöse Coiit.is. Aliergische Hautreaktionen, Juckreiz, Arzneimittelfieber, Serumkrankheit, Überempfindlichkeitsreaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Anaphylaxie kann lebensbedrohlich sein. Wie auch bei anderen Cephalosporinen, vereinzelt Fälle von Erythema multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch epidermale Nekrolyse, Aufgrund des Gehaltes an Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxy- benzoat (Parabenen) in ELOBACT 125/250/500 Filmtabletten bei entsprechend veranlagten Patienten ebenfalls Überempfindlichkeitsreaktionen möglich. Veränderungen der Leukozytenzahl (z.B. Eosinophilie, Leukopenie, Neutropenie). Kopfschmerzen, Schwindel. In Einzelfällen vor allem bei älteren Patienten oder Patienten mit hohem Fieber oder schweren Infekten ZNS-Störung wie ünruhe, Nervosität, Verwirrtheit oder Halluzinationen. Vorübergehender Anstieg von Transaminasen (SGOT, SGPT) und LDH, in Einzelfällen Ikterus. Entzündung der Mund- und Scheidenschleimhaut (teilweise verursacht durch Candida-Super- infektionen), Darreichungsformen: ELOBACT 125: 12 Filmtabletten (N 1) DM 47,45; 24 Filmtabletten (N 2) DM 79,50; Klinikpackungen. ELOBACT 250: 12 Filmtabletten (N 1) DM 72,-; 24 Filmtabletten (N 2) DM 129,85; Klinikpackungen. ELOBACT 500:12 Filmtabletten (N1) DM 126,51; 24 Filmtabletten (N 2) DM 219,90; Klinikpackungen. ELOBACT-Trockensaft: 70 ml Flasche (NI) DM 58,85; 140 ml Flasche (N 2) DM 97,80; mit Granulat zur Herstellung von Suspension. Klinikpackungen. ELOBACT 125 Dosier-Brief: 12 Dosier-Briefe (N 1) DM 47,45; ELOBACT 250 Dosier-Brief: 12 Dosier-Briefe (N 1) DM 76,85; AVP incl. 15% MWST. (Stand: Juli 1995)
I cascan GmbFI & Co. KG65009 Wiesbaden
Im Mitvertrieb:cascapharm GmbH & Co., 65009 Wiesbaden cascaßiarm
Dragees • Saft
CAPVAL(NOSCAPIN)
Gegen Reizhusten
Z.B.10 Depot-DraseesDM 5,95
Capwa'
DRELUSO PHARMAZEUTIKA 31833 Hess. Oldendorf
Zusammensetzung: 1 Capval-Dragee enthält; 40 mg Noscapln-Resin (Noscapin gebunden an Ionenaustauscher der Polystyrolsultonsäureharzgruppe) entsprechend 25 mg Noscapin. 1 g Capval-Saft enthält: 7,86 mg Noscapin Resin (Noscapin gebunden an Ionenaustauscher der Polystyrolsulfonsäureharzgruppe) entsprechend 5 mg Noscapin. Anwendungsgebiete: Keuchhusten, Reiz- und Krampfhusten; Erkrankungen der Atemwege; zur unterstützenden Begleittherapie bei Erkältungskrankheiten, die eine hustenreizstillende Wirkung erfordern. Gegenanzeigen: Vor Beginn einer Behandlung mit Capval muß das Bestehen einer Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Der Eintritt einer Schwangerschaft unter der Behandlung ist zu vermeiden. Ist eine Behandlung während der Stillzeit erforderlich, sollte während und bis zu 24 Stunden nach Ende der Behandlung auf Flaschennahrung umgestellt werden. Nebenwirkungen: Nicht bekannt. Wechseiwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt. Dosierungsanleitung und Anwendung: Dragees: Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren bis zu 3mal täglich 2 Dragäes, Kinder von 3 bis 12 Jahren bis zu 3mal täglich 1 Dragäe. Saft: Capval-Saft vor Einnahme kräftig schütteln. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 3mal täglich 2 Teelöffel, Kinder von 3 bis12 Jahren 3mal täglichl Teelöffel, Kleinkinder ab 6 Monate 2mal täglich 1/2 Teelöffel ein. Besondere Hinweise: Saft: Vor Einnahme kräftig schütteln. Capval ist für Diabetiker geeignet. Darreichungsformen und Packungsgrößen: Dragöes: Packung mit 10 Dragäes/DM 5,95 N1,20 Dragäes/ DM 8,95 N2, Saft: Flasche mit 100ml NI/11,33 DM.
— Verschreibungspflichtig —
Zeitschrift für Allgemeinmedizin
German Journal of General Practice. Ehemals: Der Landarzt. Zugleich Organ der Vereinigung der Hochschullehrer und Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin e.V. und der DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin).
Schriftleitung: Dr. med. Heinz-Harald Abholz, Ce- ciliengärten 1, 12159 Berlin. Prof. Dr. med. Winfried Hardinghaus, Chefarzt der Med. Abt., Krankenhaus St. Raphael, 49179 Ostercappeln, AG Gesundheitswissenschaften LFniversität, 49069 Osnabrück. Prof. Dr. med. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Abteilung für Allgemeinmedizin der Georg-August-Univ., Robert-Koch-Str. 40, 37075 Göttingen. Dr. med. Wolfgang Mahringer, Schelz- torstr. 42, 73728 Esslingen. Priv.-Doz. Dr. med. Ursula Marsch-Ziegler, St. Gertrauden-Kranken- haus, Paretzer Str. 12,10713 Berlin. Dr. med. Gertrud Volkert, Traubergstr. 16, 70186 Stuttgart.
Verlag: Hippokrates Verlag GmbH, Rüdigerstr. 14, 70469 Stuttgart, Postfach 30 05 04, 70445 Stuttgart, Tel. (0711) 89 31-0, Telefax (0711) 89 31- 453.Geschäftsführung: Dipl.-Kaufmann Andre Caro, Dipl.-Kaufmann Albrecht Hauff.Anzeigen: Günter Fecke, Tel. (07 11) 89 31-448. Redaktion/Produktion: Günther Buck (Chefredakteur), Tel. (07 11) 89 31-446. Ruth Auschra (Stellv. Red.-Ltg.), Tel. (07 11) 89 31-445. DipL- Wirt.-lng. (FH) Ingrid Schaul (Herstellung), Tel. (0711) 89 31-445.Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. Stuttgart. Printed in Germany 1996. © 1996 Hippokrates Verlag GmbH.Die Zeitschrift erscheint zweimal monatlich.
Die Kartei der praktischen Medizin ist jedem 2. Heft der Kombi-Ausgabe zum Heraustrennen beigeheftet. Diese Kartei referiert aus maßgebenden Fachzeitschriften des ln- und Auslandes unter den Aspekten; kritisch, kurz und praxisnah. Alle Preise und Versandspesen enthalten 7% Mehrwertsteuer. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis zum 30. September vorliegt. Das Abonnement wird zum Jahresanfang berechnet und zur Zahlung fällig. Die Beilage »Die Arzthelferin« erscheint unregelmäßig. 15. Jahrgang 1996.Bezug: Durch jede Buchhandlung oder eine vom Verlag beauftragte Buchhandlung. Postscheckkonto: Stuttgart 6025-702. Bankverbindung: Dresdner Bank, Filiale Stuttgart, Nr. 9014731. Baden-Württembergische Bank Stuttgart, Nr. 1004527600. Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile: Stuttgart und Hamburg.
Bezugs- Abonnements-Versandpreise preis kosten
Gesamt
ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin (Ausgabe A) Inland DM 168,00 DM 30,00 DM 198,00Ausland DM 168,00 DM 72,00 DM 240,00
Vorzugspreis für Studenten und Ärzte im Praktikum Inland DM 50,00 DM 30,00 DM 80,00Ausland DM 50,00 DM 72,00 DM 122,00
ZFA -I- Kartei der praktischen Medizin (Ausgabe B) Inland DM 182,00 DM 30,00 DM 212,00Ausland DM 182,00 DM 72,00 DM 254,00
Vorzugspreis für Studenten und Arzte im Praktikum Inland DM 68,00 DM 30,00 DM 98,00Ausland DM 68,00 DM 72,00 DM 140,00
Einzelheft (Ausgabe A) DM 12,50, (Ausgabe B) DM 13,00 zuzüglich Versandkosten ab Verlagsort, Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Preise,
Anzeigenschluß: 6 Wochen vor Erscheinen, UNVERLANGTE ARBEITEN KÖNNEN AN DEN VERLAG GESANDT WERDEN.Die Annahme einer Arbeit durch die Schriftleitung erfolgt unter der Voraussetzung, daß es sich um eine Originalarbeit handelt, die von keiner anderen Redaktion angenommen wurde und keiner anderen Redaktion gleichzeitig angeboten ist. Mit der Annahme der Arbeit durch die Schriftleitung geht das Verlagsrecht an die Hippokrates Verlag GmbH Stuttgart über, einschließlich des Rechts zur Vergabe von Nachdrucklizenzen oder sonstigen Nebenrechten. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind für die Dauer des Urheberrechts geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen dürfen nur einzelne Exemplare für den persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt werden. Jede im Bereich eines gewerblichen Unternehmens zulässig hergestellte oder benutzte Kopie dient gewerblichen Zwecken gern. § 54 (2) UrhG und verpflichtet zur Gebührenzahlung an die VG Wort, Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49, 80336 München 2, von der die einzelnen Zahlungsmodalitäten zu erfragen sind.
Wichtiger Hinweis:Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, daß Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, daß diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in dieser Zeitschrift abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, daß es sich um einen freien Warennamen handele.
Hinweis für unsere Leser:Der Verlag ist um eine zuverlässige Zustellung der abonnierten Zeitschrift äußerst bemüht. Gelegentlich versäumen Abonnenten nach einem Umzug ihre neue Anschrift mitzuteilen. In den betreffenden Fällen hilft die Bundespost, die neue Anschrift dem Verlag mitzuteilen. Abonnenten, die mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind, werden gebeten, dies dem Verlag mitzuteilen.
DEGAMDoiitschn (iosfillschaft für Allgomoinmcdi/in
Mitglied der Arboitsgemoinschaft I.eseranaly.se medizinischer Zeitschriften e.V.
1’his Journal is regularly listed in EMBASE
inline ’online *** online online online 133
a wählten neuen Patienten durch-
Zi....> n.st erhob Arzt A die Befunde sc.!' - - i'ch auf traditionelle Weise, wäh- rer 'l Arzt ß ein Computer-Notebook benutzte N-«f’h je 15 Patienten wechselten bei; A; zte die Arbeitsweise. Per Frage!- 'i zn wurde vor der Untersuchung die Ei,.:,t ! c;ng der Patienten gegenüber Co't.'.' - n-n und danach ihre Meinung spe: '- 11 ■■.ur Interaktion zwischen Arzt un- ' ermittelt.Die . iifra denheit der Patienten hing we(^'on der Art. der Befundnotierung nor.ii oii einem bestimmten Arzt oder vo” 'U-.>an Umgang mit dem Computer ab, davon, wie sehr ein Patient den Umgar ■ i'dt Computern gewohnt war. Aue- äalien die Patienten keine signifi- kaniap nierschiede bezüglich der Ahlen.;ang d.3s Arztes, der Intensität des Zu- hörens oder des Augenkontakts. Mit compi iierisierten Patientenkarteien kann der Coi oputer auch für andere Aufgaben als das Festhalten von Befunden verwandt vverden, etwa um frühere Notizen oder Labordaten nachzusehen. Ob bei intensiverem Gebrauch des Computers die Meinung der Patienten anders ausgefallen wäre, sei dahingestellt. (ChR)Solomon G et al: Are patients pleased with computer use in the examination room? JFam Pract 1995; 41; 241-44.
Israelische Ärzte dürfen jetzt werben!
Israels oberster Gerichtshof hat eine Entscheidung des Bezirksgerichts Tel Aviv aufgehoben, welches drei ärztlichen Zentren verboten hatte, für sich zu werben, da dies ein Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung sei. Diese noch aus der britischen Mandatszeit stammende Ordnung verbiete approbierten Ärzten jede Art der Werbung.Die entsprechende Bestimmung wurde vom obersten Gericht als antiquiert angesehen und auf engst mögliche Weise interpretiert, indem sie nur auf Einzelpersonen, nicht aber auf ärztliche Zusammenschlüsse bezogen wurde. In den Anzeigen der Zentren waren keine Namen von Ärzten genannt worden. Das Gericht bewertete die Rechte auf freie Meinungsäußerung und freie Berufsausübung sowie das Recht der Öffentlichkeit auf uneingeschränkte Informationsmöglichkeiten höher als die Äbsicht der Bestimmung, die Würde des ärztlichen Standes zu schützen. Verbraucher seien an Informationen interessiert, anhand derer sie ihren Arzt wählen könnten. Außerdem fördere die Werbeerlaubnis über den Wettbewerb eine Verbesserung ärzt
licher Leistungen und die Kostendämp- fung.Da jeder Zusammenschluß von zwei Ärzten als Gruppe gelten kann und damit die Bestimmungen der Berufsordnung praktisch hinfällig werden, erarbeitet das Gesundheitsministerium zur Zeit neue Richtlinien zur Werbung für ärztliche Leistungen. (ChR)Fishman R: Israeli doctors allowed to advertise. Lancet 1995; 346:1620.
Hepatitis-G-Virus bei Drogenabhängigen
Seit einigen Monaten ist bekannt, daß es amerikanischen Wissenschaftlern gelungen ist, das Hepatitis-G-Virus nachzuweisen. Inzwischen wurde der Erreger - vor allem bei i.v.Drogenabhängigen - auch am Robert-Koch-Institut identifiziert. Hier wurde eine erste Studie an Drogenabhängigen mit Hepatitis-C-Infektion durchgeführt: Bei 19 von 52 Patienten (36%) wurde auch das Hepatitis-G-Virus nachgewiesen.Erste amerikanische Studien gehen davon aus, daß 1-2% der Blutspender mit HGV infiziert sind. (RKl/au)
Diarrhoe direkt:
Heren
direkt ’’vor Ort”schnelle Wirkung, hochdosiert praktische Handhabung
PerenXerof250nig Pulver \Perenterol* 250 mg Pulver. \A/irkstoff: Trockenhefe aus Saccharomyces boulardii. Zusammensetzung: 1 Beutel mit 765 mg Pulver enthält: 250mg Trockenhefe aus Saccharomyces boulardii (Synonym: Saccharomyces cerevisiae Hansen CBS 5926). Hilfsstoffe: Lactose 1 HjO, Fructose, hochdisperses Siliciumdioxid, Aromastoff. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung akuter Durchfallerkrankungen (Diarrhoen). Zur Vorbeugung und symptomatischen Behandlung von Reisediarrhoen sowie Diarrhoen unter Sondenernährung. Zur begleitenden Behandlung (als Adjuvans) bei chronischen Formen der Akne. Hinweis; Bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen einhergehen, sollte ein Arzt aufgesuoht werden. Gegenanzeigen: Hefeallergie bzw. bekannte allergische Reaktionen auf Perenterol. Hinweise: Säuglinge und Kleinkinder sind in jedem Fall von einer Selbstmedikation auszuschließen. Patienten mit gestörtem Immunstatus (z.B. HlV-lnfektion. Chemotherapie, Bestrahlung) sowie Fructose-Unverträglichkeit (auch an die Möglichkeit einer bisher unerkannten Fructose- Unverträglichkeit bei Säuglingen und Kleinkindern denken) sollten vor Einnahme dieses Arzneimittels den Rat eines Arztes einholen. Schwangerschaft und Stillzeit: Bisher sind keine fruchtschädigenden Wirkungen oder schädliche Wirkungen auf den gestillten Säugling bei vorschriftsmäßiger Anwendung des Arzneimittels bei der (werdenden) Mutter bekannt geworden. Nebenwirkungen; Die Einnahme kann Blähungen verursachen. In Einzelfällen Unverträglichkeitsreaktionen (Juckreiz, Urtikaria, lokales oder generalisiertes Exanthem sowie Quincke-Ödem). Hinweis: Werden während einer Therapie mit Saccharomyces boulardii mikrobiologische Stuhluntersuchungen durchgeführt, so sollte die Einnahme dem Untersuchungslabor mitgeteilt werden, da sonst falsch-positive Befunde erstellt werden könnten. Wechselwirkungen: Die gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln gegen Pilzerkrankungen kann das Behandlungsergebnis mit Perenterol beeinträchtigen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Monoaminooxidase-Hemmstoffen ist eine Blutdruckerhöhung möglich. Warnhinweise: Bei Durchfallerkrankungen muß, besonders bei Kindern, auf Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Durchfälle bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern die Rücksprache mit dem Arzt. Thiemann Arzneimittel GmbH, Postfach 440,45725 Waltrop. Stand: Dezember 1995
1Multikulturell I
\
• Cephalosporin der 3. Generation mit breitem Wirkspektrum
• bewährt bei über100 Mio. Patienten weltweit
• Ix täglich genügt
CEPHORALIhr Allround-Antibiotikum
Cephoral’ Filmtabletten, Suspension, Trockensaft.Wirkstoff: Cefixim. VerschreitDungspflichtig. Zusammensetzung: 1 Filmtablette enthält 223,8 mg Cefixim 3 HjO (entspricht 200 mg Cefixim). Hilfsstoffe; Cellulose, Maisquellstärke, Calcium- Hydrogenphosphat, Magnesiumstearat, Hypromellose, Natriumdodecylsulfat, dünnflüssiges Paraffin, Farbstoff E 171. 5 ml Suspension enthalten 111,9 mg Cefixim 3 HgO (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfsstoffe: Polysorbat 80, Saccharose, Magnesiumstearat, mittelkettige Triglyzeride, Himbeer-Aroma. 5 ml gebrauchsfertige Suspension, hergestellt aus Trockensaft, enthalten 111,9 mg Cefixim 3 H2O (entspricht 100 mg Cefixim). Hilfsstoffe: 2,5 mg Natriumbenzoat als Konservierungsmittel, Xanthan-Gummi, Saccharose, Aromastoff. Anwendungsgebiete: Akute u. chronische Infektionen durch Cefixim-empfindliche Krankheitserreger; Infektionen der unteren u. oberen Atemwege; Infektionen des HNO-Bereiches, wie z.B. Otitis media, Sinusitis, Tonsillitis, Pharyngitis, Laryngitis; Infektionen der Niere u. ableitehden Harnwege; Infektionen der Gallenwege; akute, gonorrhoische Urethritis. Gegenanzeigen: Cephalosporin-Überempfindlichkeit. Mögliche Kreuzallergie mit anderen Betalaktam-Antibiotika beachten. Vorsicht bei schweren Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance <10 ml/min/1,73 m^) u. Allergie- bzw. Asthma-Anamnese. Bis zum Vorliegen weiterer klinischer Erfahrungen sollte Cephoral Frühgeborenen, Neugeborenen u. stillenden Müttern nicht verabreicht werden. Schwere Magen- u. Darmstörungen mit
Erbrechen u. Durchfällen. Schwan- B In Lizenz der Firma gerschaft; in experimentellen
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., Studien keine fruchtschädigende Osaka, Japan Wirkung. Empfehlung: Gründ
liche Nutzen/ Risikoabwägung in ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Nebenwirkungen Gelegentlich Magendrücken, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Blähungen, häufign weiche Stühle od. Durchfall. Bei schweren u. anhaltenden Durchfällen an pseudomeff branöse Kolitis denken! Gelegentlich Hautausschläge (Exantheme, Erytheme u.a., in B zelfällen Erythema exsudativum multiforme, Lyell-Syndrom), Juckreiz, Schleimhautentzüf düngen, Überempfindlichkeitsreaktionen aller Schweregrade bis hin zum anaphylaktische Schock, in Einzelfällen Arzneimittelfieber, serumkrankheitsähnliche Reaktionen, hämc lytische Anämie, interstitielle Nephritis. Gelegentlich Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, se ten vorübergehende Hyperaktivität. In Einzelfällen Blutbildveränderungen (Leukopenif Agranulozytose, Panzytopenie, Thrombozytopenie, Eosinophilie) sowie Blutgerinnungsstc rungen. Selten vorübergehender Anstieg der Kreatinin- u. Harnstoffkonzentration im S« rum. Selten reversibler Anstieg von Leberenzymen (Transaminasen, alkalische Phosphats se), in Einzelfällen Hepatitis, cholestatische Geibsucht. Handelsformen u. Packungsgft ßen: 10 Filmtabletten NI DM 71,50, 20 Filmtabletten N2 DM 127,49; 25 ml Suspension Di 29,90, 50 ml Suspension DM 58,50, 100 ml Suspension DM 98,90; 13,25 g Trockensut stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 25 ml Suspension) DM 29,90, 26,5 g Trockensut stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 50 ml Suspension) DM 58,50, 53 g Trockensut stanz zur Suspensionsbereitung (ergibt 100 ml Suspension) DM 98,90. Klinikpackunge> Nähere Angaben siehe Gebrauchs- bzw. Fachinformation. Stand: 10/95.Merck KGaA, 64271 Darmstadt.
v>^^i ■«jivzi i\iii iirNpciL^rNui
MERCK
Fortbildung
Hans-joachim Trappe und Petra Pfitzner
Indikationen zur Schrittmacher TherapieDie Implantation permanenter Schrittmachersysteme ist einerseits unabdingbar bei charakteristischen pathologischen Störungen von Erregungsbildung oder Erregungsleitung,andererseits sind typische Krankheitsbilder bekannt, bei denen eine Schrittmacherimplantation zu einer Verbesserung von Symptomatik und/oder Prognose führt (27). Von entscheidender Bedeutung für die Indikation zur Schrittmachertherapie sind die Erfassung von Grunderkrankung und zugrundeliegender Rhythmusstörung sowie die klinische Symptomatik eines Patienten.
Bradykarde Rhythmusstörungen
Störungen von Erregungsbildung und Erregungsleitung sind möglich im Bereich des Sinusknotens, der sinuatrialen Überleitung, im AV-Knoten, im His-Bündel und im rechten und/oder linken Tawara-Schenkel(A6ö. 1). Störungen von Erregungsbildung und -leitung kommen vor beim akutem Myokardinfarkt, bei entzündlichen Erkrankungen, bei Elektrolytstörungen, durch Medikamente bedingt, häufig bei Fibrosierungen im Bereich von Sinusknoten, Vorhof und AV-Knoten bei degenerati- ven Erkrankungen, Klappenfehlern oder nach Myokardinfarkt.
Bei der Indikation zur temporären oder permanenten Schrittmachertherapie sind die zu-
grundeliegende Arrhythmie, aber auch die klinische Symptomatik von entscheidender Bedeutung.
Bei Patienten mit rezidivierenden Synkopen und nachweisbaren höhergradigen sinuatrialen oder atrioventrikulären Leitungsstörungen ist die Indikation zur Schrittmacherimplantation relativ leicht zu stellen, bei Patienten mit Schwindelzuständen oder Synkopen ohne nachweisbare Rhythmusstörungen sind umfassende nicht-invasive und invasive Untersuchungstechniken nötig.
Sinusknoten----
LinksposteriorerFaszikelAV-Knoten'
His-Bündel
LinksanteriorerFaszikel
RechterT awara-Schenkel
Abbildung 1: Scbematische Darstellung der Anatomie des Erregungsleitungssystems. Abkürzungen: AV = atrio- ventrikuar, LA = linker Vorbof, LV = linker Ventrikel, RA = rechter Vorhof, RV = rechter Ventrikel
Sinuatriale Blockierungen, Sinusarrest, Sinusknoten-Syndrom
Die Sinusbradykardie ist charakterisiert durch einen regulären Sinusrhythmus mit Frequenzen < 60/min und einer regulären atrioventrikulären Überleitung. Sie wird in der Regel beobachtet bei trainierten Athleten, während des Schlafes oder bei Patienten mit Digitalistherapie, anderen Medikamenten, Hypothyreose oder Hypothermie. Als Mechanismen einer Sinusbradykardie werden bei diesen Patienten ein erhöhter parasympathischer Tonus und ein verminderter Sym- pathikotonus diskutiert (13). Besonders in den ersten Stunden eines frischen inferioren Infarktes wird bei bis zu 40% der Patienten eine Sinusbradykardie beobachtet. Sie ist meistens Ausdruck eines gesteigerten Vagotonus. In den meisten Fällen sind Patienten mit Sinusbradykardie asymptomatisch und eine spezifische Therapie ist nicht notwendig. Bei Patienten mit symptomatischer Sinusbradykardie, besonders beim akuten Infarkt, ist eine Therapie mit Atropin hilfreich. Eine permanente Schrittmachertherapie ist nur selten gerechtfertigt, häufiger ist die temporäre Stimulation bei Patienten nach akutem Myokardinfarkt.
Nach akutem Infarkt Sinusbradykardie bei bis zu 40% der Patienten!
Sinuatriale Leitungsstörungen oder ein Sinusarrest sind entweder Störungen der Erregungsleitung und/oder der Erregungsbildung.
Z. Allg. Med. 1996; 72: 135-145. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
136 Fortbildung; Indikationen zur Schrittmacher-Therapie
1Indikationen zur permanenten Schrittmachertherapie
Schrittmachertherapie bei Sinusknoten-Dysfunktion Indikation:• Dokumentierte permanente symptomatische Bradykardie• Schwindel und/oder Synkopen bei sinuatrialem Block
III. Grades oder SinusarrestMögliche Indikation:• Gelegentliche Kammerfrequenz < 40/min mit klinischer
SymptomatikKeine Indikation:• Asymptomatischer Patient mit Bradykardie durch negativ
chronotrope MedikamenteBradykardie bei herzgesunden Patienten
Schrittmachertherapie bei AV-BlockierungenSichere Indikation:• Kompletter AV-Block bei symptomatischen Patienten• Kompletter Block mit Kammerfrequenzen < 40/min bzw.
einer Asystolie > 3 sek• Intermittierender AV-Block II. Grades mit klinischer
Symptomatik• Symptomatischer erworbener AV-Block bei Vorhofflim
mern oder VorhofflatternMögliche Indikation:• Asymptomatischer (permanenter oder intermittierender)
kompletter AV-Block• Asymptomatischer (permanenter oder intermittierender)
AV-Block II. Grades, Typ Mobitz• Asymptomatischer intra- oder infrahissärer AV-Block
II. Grades, Typ WenckebachKeine Indikation:• AV-Block I. Grades• Asymptomatischer AV-Block II. Grades (intranodale
Lokalisation), Typ Wenckebach
Schrittmachertherapie bei bifaszikulären und trifasziku- lären BlockierungenSichere Indikation:• Intermittierender, symptomatischer AV-Block III. Grades• Intermittierender, asymptomatischer AV-Block 11. Grades,
Typ MobitzMögliche Indikation:
Synkope ohne dokumentierten AV-Block bei nicht nachweisbarer anderer Ursache HV-Intervall >100 msek Induzierter infranodaler AV-Block
Keine Indikation:Asymptomatischer AV-Block I. Grades
Schrittmachertherapie bei hypersensitivem Carotis-SinusSichere Indikation:• Rezidivierende Synkopen bei nachweisbarem Carotis-
Sinus-Syndrom (cardiodepressiver Typ)Mögliche Indikation:• Rezidivierende Synkopen mit hypersensitivem Carotis-
Sinus, bei dem die Carotis-Massage aber nicht zur Synkope führt
• Patienten mit Synkope und induzierter Bradykardie durch Kipptisch-Untersuchung
Keine Indikation:• Hypersensitiver Carotis-Sinus vom vasodepressorischen
Typ.
Elektrokardiographisch ist das Fehlen von P- Wellen bei charakteristischen PP-Intervallen für die Diagnose eines sinusatrialen Blocks (SA- Block) typisch; beim SA-Block II.° vom Typ I findet man Pausen, die kürzer sind als das doppelte RR-Intervall. Beim SA-Block II.° vom Typ II werden Pausen beobachtet, die exakt dem doppelten RR-Intervall entsprechen. Beim SA- Block III.° ist die Überleitung vom Sinusknoten auf das umliegende atriale Gewebe komplett unterbrochen und P-Wellen sind nicht sichtbar. Beim Sinusarrest ist keine Impulsbildung im Sinusknoten vorhanden, charakteristisch sind junktionale Ersatzrhythmen im EKG {Abb. 2). Eine Unterscheidung zwischen komplettem sinuatrialen Block (SA-Block IIP) und Sinusarrest im Oberflächen-EKG ist nicht möglich! Für die Indikation zur Schrittmacherimplantation ist die klinische Symptomatik entscheidend, Patienten mit rezidivierendem
> I ' iiii ji
25 mm /s
Abbildung 2: Oberflächen-Elektrokardiogramm bei einem 63jährigen Patienten mit rezidivierenden Synkopen nach Vorderwandinfarkt. Darstellung der Extre- mitäten-Ableitungen 1,11,111, aVR, aVL und aVF. Vorliegen eines überdrehten Linkstyps mit Zeichen eines linksanterioren Hemiblocks (q in Abi. 1 und aVL), Sinusarrest mit einer Pause von 6 sek und einem junktionalen Rhythmus. P-Wellen sind nicht erkennbar
Schwindel oder Synkopen sind Kandidaten für eine permanante Stimulation. Darüber hinaus sind Häufigkeit und Ausmaß der Leitungsstörungen für die Indikation zur Schrittmacherbehandlung entscheidend.
Das Sick-Sinus-Syndrom oder Sinusknoten- syndrom ist eine der häufigsten Ursachen für eine Schrittmacherimplantation. Dieser Begriff wird verwendet, wenn bei einem Patienten bra- dykarde Rhythmusstörungen vorliegen, die mit klinischen Befunden wie Schwindel, Unsicherheit oder Synkopen einhergehen. Dem Sinusknoten-Syndrom liegen Störungen von sinu- atrialer Überleitung und einer pathologischen Impulsbildung zugrunde. Ursachen sind Störungen des autonomen Nervensystems, des endokrinen Systems und pathologisch-anato-
sHj... ■ ■-■^s-.v!-. ■■■ Vi
DROMOS MACHT DEN KOPF FREI.
FREI FÜR DAS WESENTLICHE
Technik soll dem Menschen dienen. Dieser Grundsatz gilt
besonders für moderne Schrittmacher-Systeme. Denn was helfen Ihnen umfangreiche Funktionen, wenn Sie sich mehr um die Technik als um den Patienten kümmern müssen? Deshalb haben wir von BIOTRONIK ein neues System entwickelt: Die Schrittmacher der DROMOS-Familie. Die halten Ihnen den Kopf frei für die wichtigen Aufgaben.
Hinter dem Namen DROMOS verbirgt sich ein flexibles Kon
zept, das Ihnen alle therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten
moderner Schrittmachertherapie eröffnet und dabei einfach und sicher zu bedienen ist. Ein neues Programmiergerät, fraktal beschichtete Elektroden und drei Schrittmacher für Single-Lead-VDD, DDDR und SSIR- Therapie ergeben ein
umfassendes System, das im unkomplizier
ten Zusammenspiel : seine wahre Stärke zeigt.
Genaue Einzelheiten über alle Bausteine des DROMOS-
Systems schildern wir Ihnen gern persönlich. Rufen Sie uns an. Wir fassen uns kurz.
® BIOTRONIKBIOTRONIK GmbH & Co. • Woermannkehre 1 • D-12359 Berlin -Tel. (030)689 05-0 • Fax (030)684 40 60
BIOTRONIK GmbH & Co. Vertriebs KG ■ Wiesentalstraße 26 • D-79540 Lörrach -Tel. (076 21)40 94-0 • Fax (0 76 21)40 94 89 BIOTRONIK Vertriebs-Ges. mbH • Otto-Probst-Straße 36/11/3 • A-1100 Wien - Tel. (01)615 44 50 • Fax (01)615 4410
138 Zmk Fortbildung: Indikationen zur Schrittmacher-Therapie
Ursachen sinuatrialer Blockierungen oder eines Sinusarrestes• Exzessive vagale Stimulation• Hypersensitiver Carotissinus• Akuter Myokardinfarkt• Hyperkaliämie• Hypokaliämie• Tumoren• Myokarditis• Medikamente
- Betablocker- Calciumantagonisten- Digitalis- Klasse-l-Antiarrhythmika- Klasse-lll-Antiarrhythmika
mische Befunde wie Fibrosierung oder Kolla- genbildung im Bereich von Sinusknoten und atrialem Gewebe. Sinusknoten-Syndrome können außerdem durch medikamentöse Interventionen oder Elektrolytstörungen hervorgerufen werden. Häufig sind Störungen der Sinusknotenfunktion und der sinuatrialen Überleitung mit AV-Knoten-Dysfunktionen vergesellschaftet (20).
Atrioventrikuläre Blockierungen
Blockierungen im Bereich des AV-Knotens werden traditionsgemäß eingeteilt in AV-Blockie- rungen 1°, 11° und 111°. Die Diagnose ist aus dem Oberflächen-EKG einfach zu stellen. Man findet eine Verlängerung der PQ-Zeit > 200 msek mit regulär übergeleiteten P-Wellen beim AV-Block 1°, während bei AV-Block 11° nicht alle P-Wellen auf die Kammern übergeleitet werden. Der AV- Block ir wird in einen Typ Wenckebach (zunehmende Verlängerung der PQ-Zeit bis zum Ausfall eines Kammerkomplexes) und einen Typ Mobitz (konstante PQ-Zeit mit konstantem Ausfall von Kammerkomplexen) unterteilt (Abb. 3). Während die Überleitungsstörung beim Typ Wenckebach in der Regel im AV-Knoten selbst lokalisiert ist, findet man beim Typ Mobitz die Lokalisation der Blockierung subnodal oder im Bereich des His-Bündels. Ein AV-Block IIP ist durch eine komplette Unterbrechung von Vorhof und Kammer charakterisiert.
Störungen der AV-Überleitung können im AV- Knoten, im His-Bündel oder den Tawara- Schenkeln liegen. Die Prognose ist von der Lokalisation der Blockierung abhängig! Durch Atropin, durch einen Belastungstest oder Katecholamine bzw. durch Carotis-Sinus-Massa- ge kann der Ort der Blockierung bestimmt wer
den (32): Interventionen, die zu einer Verlangsamung der AV-Überleitung führen (vagale Manöver) verschlechtern einen intranodalen AV- Block. Sie verbessern aber einen subnodalen Block, da weniger Impulse durch den AV-Knoten geleitet werden, die dann ohne Probleme subnodal weitergeleitet werden. Umgekehrt führen Interventionen wie Atropin oder Katecholamine zu einer Verbesserung der AV-Überleitung und verschlechtern die subnodalen Blok- kierungen, da die Steigerung der übergeleiteten Impulse nicht zu einer adäquaten Weiterleitung der Impulse führt (Tab. 1). AV-Blockie- rungen können besonders beobachtet werden bei akuten Infarkten (meistens inferiore Lokalisation), bei Patienten unter Digitalis-Therapie, nach Herzoperationen oder bei Erkrankungen, die zu einer Fibrosierung im Bereich des AV-Knoten führen. Die klinische Symptomatik ist neben der Art der Blockierung (Grad I-III) von der Frequenz der Kammeraktion und/oder des Ersatzzentrums abhängig. Während beim AV-Block r in der Regel keine Therapie notwendig ist (sieht man einmal vom Absetzen
Vagale Manöver bessern einen subiiodalen und verschlechtern einen intranodalen Block
i ^ ■ 1 ;50 mm/s
Abbildung 3: 12-Kanal-Oberflächen-EIektrokardio- gramm bei einer 47jährigen Frau mit rezivierendem Schwindel und einer Synkope. Man erkennt, daß neben einem kompletten Rechtsschenkelblock (rSR-Konfigu- ration VI bei einer QRS-Breite von 140 msek) ein AV- Block II. Grades, Typ Mobitz, vorliegt (P = P-Wellen)
oder einer Dosisreduktion von verabreichten dromotropen Medikamenten ab), sind Patienten mit höhergradigen AV-Blockierungen Kandidaten für eine temporäre oder permanente Schrittmacherstimulation. Bei der Schrittmacherindikation ist es wichtig, AV-Blockierungen ir in die Typen Wenckebach und Mobitz zu differenzieren: Während beim Typ Wenckebach häufig die engmaschige Beobachtung eines Patienten ausreichend ist, sind Patienten mit AV-Blockierungen IT Typ Mobitz bei klinischer Symptomatik (Schwindel, Synkopen) Kandidaten zur Schrittmacherimplantation. Da
13d
nicht länger den Knorpel zerstören
Hek: Keine Chance nornel'Killer
Rheumo-Hek nimmt den Schmerz und verbessert die Beweglichkeit
Rheumo-Hek hemmt destruktive Zytokine und schützt die Gelenke
Rheuma-Hek ist gut verträglich, schont Magen und Darm
Bei Arthrose hemmt Rheuma-Hek mit dem Urtica-Extrakt IDS 23 selektiv die Zytokine Tumor-Nekrose-Faktor-a und Interleukin-1 ß {TNF-a und IL-Iß).
Der Zytokin-Antagonist
Khcuma^nGkStrathmann AG
Hamburg
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 335 mg Brennesselblätter-Trockenextrakt (Extr. Urticae e fol. sicc.) IDS 23. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Therapie rheumatischer Beschwerden. Nebenwirkungen: Keine bekannt. Dosierung: 2x2 Kapseln täglich. Handelsformen und Preise: OP mit 50 (N2); 100 (N3) Kapseln DM 22,40; DM 39,50. Strathmann AG Hamburg Stand: Januar 1996 86/89
Fortbildung: Indikationen zur Schrittmacher-Therapie
Tabelle 1: Nicht-invasive Verfahren zur Bestimmung des Ortes der Leitungsblockierung beim AV-Block
Intervention AV-Knoten SubnodaleLeitung Leitung
Atropin besser schlechterBelastung besser schlechterKatecholamine besser schlechterCarotis-Sinus-Massage schlechter besser
die AV-Blockierung nach inferiorem Infarkt nur passager ist, sollte die Implantation eines Schrittmachers frühestens nach 10 Tagen (bei permanenter Blockierung und klinischer Symptomatik) erfolgen. Bei Patienten mit komplettem AV-Block ist in der Regel die Implantation eines Schrittmachersystems notwendig.
Schenkelblöcke
Das Vorliegen eines kompletten Links- oder Rechtsschenkelblocks ist keine Indikation zur Schrittmachertherapie. Demgegenüber ist das Risiko einer kompletten AV-Blockierung bei Vorliegen eines kompletten Rechtsschenkelblocks in Verbindung mit einem linksanterioren oder linksposterioren Hemiblock (bifaszikulärer Block) beschrieben. Leitungsstörungen oder Bradykardien sind in der Regel keine Todesursachen, aber viele dieser Patienten erliegen (bei organischer Herzerkrankung mit linksventrikulärer Funktionseinschränkung) einem
plötzlichen Herztod oder einem myokardialen Pumpversagen. Patienten mit kompletten Schenkelblockierungen oder einem bifaszikulärem Block sollten engmaschig kontrolliert werden. Für Patienten mit bifaszikulärem Block ist die Indikation zur Implantation eines
Schrittmachers gegeben, wenn es zu Schwindel oder Synkopen kommt {Abh. 4a und 4h).
Engmaschige Kontrolle bei Patienten mit
bifaszikulärem oder komplett- tem Schenkel
block!
Carotis-Sinus-Syndrom
Der Carotis-Sinus ist im Bereich der Bifurkation der Arteria carotis lokalisiert und seine Stimulation ist ein exzellentes diagnostisches und therapeutisches vagales Verfahren, führt zu einer Leitungsverzögerung oder zum Block im Bereich des AV-Knotens und wird zur Terminierung supraventrikulärer Tachykardien ge-
260 ms
50 mm/s
Abbildung 4a: 12-Kanal-Oberflächen-Elektrokardio- gramm bei einem 51jährigen Patienten nach Aortenklappenersatz bei Endokarditis und Abszeßbildung im Ventrikelseptum. Rezidivierende Schwindelattacken und präsynkopale Zustände. Vorliegen eines überdrehten Linkstyps mit linksanteriorem Hemiblock, eines kompletten Rechtsschenkelblocks und eines AV-Rlocks 1. Grades (PQ-Zeit 260 msek)
Sinusknoten
AV-Knoten LinksposteriorerFaszikel
Abbildung 4b: Schematische Darstellung der Mechanismen des Elektrokardiogramms von Abbildung 4a. Komplette Blockierung des rechten Schenkels und des linksanterioren Tawara-Schenkels. Die Erregungsleitung findet nur noch über den linksposterioren Faszikel statt und auch nur mit einer deutlichen Leitungsverzögerung im AV-Knoten (AV-Block 1. Grad mit einer PQ-Zeit von 260 msek). Abkürzungen: LA = linker Vorhof, LAH = linksanteriorer Hemiblock, LV = linker Ventrikel, RA = rechter Vorhof, RSB = Rechtsschenkelblock, RV = rechter Ventrikel.
nutzt. Das Carotis-Sinus-Syndrom bezeichnet einen Zustand einer zerebralen Mangeldurchblutung mit Schwindel oder Synkopen in der Folge eines hypersensitiven Carotis-Sinus-Re- flexes unter Carotis-Sinus-Massage. Klinische Hinweise sind u. a. synkopale Zustände, diez.B. durch Drehbewegungen des Kopfes oder beim Rasieren beobachtet werden. Unterschieden werden muß ein rein kardioinhibitorischer Typ, für den eine Schrittmacherindikation sinnvoll ist und zu einer Verhinderung von Schwindel und/oder Synkopen führt (5,18). Bei diesen Patienten wird ein pathologischer Carotis-Druck- Versuch beobachtet, d.h. die Massage des rechten oder linken Carotis-Sinus führt zu einer Asy- stolie von >3 Sekunden {Abh. 5). Bei Patienten mit einem Carotis-Sinus-Syndrom vom vasode- pressorischen Typ (RR-Abfall von > 50mmHg bei Carotis-Sinus-Stimulation) ist eine Schrittmacherindikation nicht gegeben (1, 26). Auch bei Patienten mit einem Carotis-Sinus-Syn-
Smschalten vonil^r hm
»Warum iri die IJmschaltung von DOS nach Windows bei mir so umständlich oder feliloT anfällig?« Diese Frage wird häufig gesi eilt, auch auf unseren Fragebögen.Die meisten der bisher existierenden Pra- xisprograiTi-ne stammen aus der DOS- (Stein-)Zeit so daß es zum Konflikt mit Windows kommt, denn DOS-Programme lassen sii h nicht auf Windows »umstellen« geschweige denn»aufrüsten«.Ande- rerseits verlangen viele Anwender nach
VERTRAGE ICH nicht!
den Vorteilen, die Windows bietet. Einige Hersteller bieten nun einen Kompromiß an; DOS-Programme werden »scheibchenweise« modifiziert, indem z.B. Texte an Windows (Word) weiterge- geben werden.
Das Problem »aussitzen«? Genau!Warten Sie mit einem Umstieg ab, bis die Hersteller die windowskompatible Neuprogrammierung vollzogen haben. Bis dahin (Ende ‘96, Anfang ‘97?) sollten Sie die Umschaltfunktion möglichst selten verwenden!Bedenken müssen Sie auch die finanzielle Seite. Windows folgt der Microsoft-Tra- dition, die nach mehr Speicher, modernen Prozessoren, höheren Taktfrequenzen und besseren Bildschirmen verlangt. Sollten in Ihrem Gerätepark noch Rechner vom Typ 386/3 3 MHz vorhanden sein, werden diese unter Windows bald ersetzt werden müssen...
Umfrage Praxis-EDVNatürlich passierte es pünktlich zur Auswertung unserer Fragebogen-Aktion: Mein Computer machte noch ein paar häßliche Geräusche, dann gab er seinen «Geist« endgültig auf.. Aber für Ersatz ist gesorgt, so daß die neue Broschüre voraussichtlich ab März bestellt werden kann!
Ihr Dieter Krieseil
141
Natürlich
bei
<’h
■ . \
,50 Tabletten-SINFRONTAL
BeiEnt^SSen der Nasenneb
^ ^ 'S»\ % \ A w
\
jk
gute Compliance durch einfache Dosierung
^ Sinusitis-Präparat als Sublingual-Tablette
^ preisgünstig (Tagestherapiekosten nur 0,88 DM)
Zusammensetzung; 1 Tablette enthält: arzneilich wirksame Bestandteile; Chininum arsenicosum Trit. D12 (HAB 1, Vorschr. 6) 60 mg, Cinnabaris Trit. D4 20 mg, Ferrum phosphoricumTrit. D3 (HAB 1, Vorschr. 6) 60 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni Trit. D5 260 mg, sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören akute und chronische Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Hinweis; Bei akuter Nasennebenhöhlenentzündung mit eitrigem Schnupfen oder Fieber und bei Beschwerden, die länger als eine Woche bestehen, ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich. Gegenanzeigen: Schwere Nierenerkrankungen mit gestörter Elektrolyt-Ausscheidung (Kumulationsgefahr). Schwangerschaft, Stillzeit, Nicht anzuwenden bei Säuglingen und Kleinkindern. Nebenwirkungen; Tritt zwischen den einzelnen Gaben von Sinfrontal* 400 übermäßiger Speichelfluß auf, ist das Mittel abzusetzen. Hinweis; Wenn jedoch durch den Patienten Nebenwirkungen beobachtet werden sollten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, ist er angehalten, diese dem Arzt oder Apotheker mit- zuteilen. Dosierung; 3mal täglich 2 Tabletten im Mund zergehen lassen. Auch nach dem Abklingen der akuten Beschwerden kann die Einnahme von Sinfrontal* 400 bis zu einer Woche fortgesetzt werden. Darreichungsform und Packungsgrößen: OP mit 150 Tabletten (NI). Stand Juni 1995Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG 73008 Göppingen
Bei Reizmagen und ReizkolonVöllegefühl
r'
Übelkeit / Erbrecfieiii:k:>.
t \
m.T V
Aufstoßen / Sodbrennen
®Druck / Schmerz Iberogast
Pflanzliches Arzneimittelschnelle und umfassende Wirkung
Nebenwirkungen, Wechselwirkungen,
Gegenanzeigen: keine bekannt
kostengünstige Behandlung
Iberogast' TinkturZusamnicnsetzung: 100 ml Tinktur enthalten: Alkohol. Frisehpflanzenauszug (6:10) aus Iberis amara (Bittere Schleifenblume) 15,0 ml. Alkoholische Drogenauszüge (3,5:10) aus: Angclikawurzel 10,0 ml. Kamillenblüten 20,0 ml, Kümmel 10,0 ml, Mariendistelfrüchten 10,0 ml, Melissenblättcm 10,0 ml, Pfcfferminzblättem 5,0 ml, Schöllkraut 10,0 ml, Süßholzwurzel 10,0 ml. Das Arzneimittel enthält 31,0 Vol.-% Alkohol. Anwendungsgebiete: Funktionelle und motilitätsbedingte Magen-Darm-Störungen, Gastritis, Magen- und Darmspasmen, Ulcus ventriculi et duodeni. Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt. Dosierung und Art der Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 3mal täglich 20 Tropfen, Kinder 3mal täglich 10 Tropfen vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit (empfehlenswert ist warmes Wasser) ein. Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: OP mit 20 ml Tinktur zum Einnchmen (NI) DM 9,95; OP mit 50 ml Tinktur zum Einnchmen (N2) DM 17,10; OP mit 100 ml Tinktur zum Einnchmen (N3) DM 30,95. Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, D-64295 Darmstadt. Stand: Januar 1996
Fortbildung: Indikationen zur Schrittmacher-Therapie
1 J M
25 mm/s
Abbildung 5: Carotis-Druck-Versuch bei einer 73jäb- rigen Frau nach mehrfachen Synkopen. Massage des Carotis-sinus links. Unmittelbar nach leichtem Carotisdruck kommt es zu einer Pause von 8,6 sek, verbunden mit Schwindel. Darstellung der Extremitäten-Ableitun- gen 1,11 und 111. Abkürzung: CSD = Carotis-Sinus-Druck.
drom vom gemischten Typ (kardioinhibitorisch und vasodepressorisch) ist die Schrittmachertherapie nur zur Verhinderung einer Asystolie sinnvoll, während die Symptomatik (Schwindel und/oder Synkope) durch reflektorisch bedingte Hypotension nicht verhindert wird.
Tachykarde Rhythmusstörungen
Besonders in den 80er Jahren wurden antita- chykarde Schrittmachersysteme bei Patienten mit supraventrikulären (AV-Knoten-Tachykar- dien, Tachykardien bei Präexzitationssyndromen) und ventrikulären Tachykardien implantiert, die durch spezielle Stimulationsalgorithmen zu einer Terminierung bei selektionierten Patienten führten. Bei Patienten mit ventrikulären Tachykardien kann so jedoch Kammerflimmern provoziert werden {Abb. 6). Die anti- tachykarde Stimulation ist daher völlig verlassen worden. Bei Patienten mit supraventrikulären Tachykardien spielt seit der Entwicklung der Katheterablation die antitachykarde Stimulation ebenfalls keine Rolle mehr.
Koronare Herzkrankheit
Die Indikation zur temporären und/oder permanenten Schrittmachertherapie spielt vor allem beim akuten Myokardinfarkt eine große Rolle. Leitungsstörungen beim akuten Infarkt sind auch prognostisch relevant und sollten daher unverzüglich erkannt und behandelt werden. Der Ort der Leitungsblockierung ergibt sich in der Regel aus Ort und Lokalisation des verschlossenen Koronargefäßes. Bei 90% der Patienten werden das hintere Ventrikelseptum, der AV-Knoten und das proximale His- Bündel von der rechten Koronararterie versorgt, die Vorderwand des Herzens und die vor-
Abbildung 6: Nicht-invasive elektrophysiologische Untersuchung nach Implantation eines Kardioverter-Defi- brillators vom Typ Ventak PRx I (CPI, St. Paul, MN, USA). Induktion einer anhaltenden monomorphen Kammertachykardie (Frequenz 170/min). Regelrechte Detektion und Abgabe von 7 Stimulationsimpulsen. Degeneration der Kammertachykardie in Kammerflimmern und sichere Terminierung durch Abgabe eines DC-Schocks (»Stern«). Abkürzung: ATP = Antitachykardie-Pro- gramm.
deren zwei Drittel des Ventrikelseptums vom Ramus interventricularis anterior. Der erste septale Ast, der vom Ramus interventricularis' anterior abgeht, versorgt meistens das distale His-Bündel und die proximalen Anteile der Ta- wara-Schenkel (12).
Aufgrund der anatomischen Versorgung des AV-Knotens werden vor allem bei inferioren Infarkten höhergradige AV-Blockierungen (zirka 15% der Fälle) beobachtet, die dann auch mit einer erhöhten Mortalität verbunden sind. Die AV-Blockierungen sind häufig nur vorübergehend, sprechen in der Regel gut auf Atropin an (0,1mg iv.), der Kammer-Ersatzrhythmus beträgt etwa 40-60/min. Bei Patienten mit Adams-Stokes-Anfall oder niedriger Herzfrequenz mit klinischen Zeichen einer Herzinsuffizienz ist die Indikation zur temporären Schrittmacherstimulation gegeben. Da bei Patienten mit inferioren Infarkten die AV-Blockierungen oft rückläufig sind und nach >10 Tagen vielfach nicht mehr vorliegen, ist die Indikation zur permanenten Schrittmachertherapie zurückhaltend zu stellen und sollte frühestens 10 Tage nach Infarktbeginn bei persistierender symptomatischer Bradykardie in Erwägung gezogen werden. AV- Blockierungen sind bei Patienten mit Vorderwandinfarkten seltener, müssen aber ernster eingeschätzt werden. Während bei inferioren Infarkten der AV-Block durch eine Unterbrechung der Blutzufuhr der AV-Knotenarterie bedingt ist, sind AV-Blockie- rungen bei Vorderwandinfarkten Ausdruck einer ausgedehnten Infarzierung von Ventrikelseptum und/oder infranodalem Leitungssystem. Bei Patienten mit Vorderwandinfarkten und AV-Blockierungen ist die Gefahr eines kompletten Blocks bekannt, deshalb sind temporäre Schrittmacherimplantationen indiziert.
Indikation zur Schrittinacher- therapie frühestens zehn Tage nach inferiorem Infarkt
144 2SFA Fortbildung; Indikationen zur Schrittmacher-Therapie
Vorsicht bei proximalen Ver
schlüssen des Ramus interven-
trikularis!
Das Auftreten von kompletten Schenkelblök- ken oder Hemiblöcken in der Akutphase eines Infarktes kennzeichnet in der Regel große Infarkte. Solche Leitungsstörungen finden sich vor allem bei proximalen Verschlüssen des Ramus interventricularis anterior. Bei diesen Patienten ist besondere Vorsicht geboten, da relativ rasch ein myokardiales Pumpversagen und/oder maligne Rhythmusstörungen auftre- ten. Bei Patienten mit Vorderwandinfarkt, die einen Rechtsschenkelblock und einen links
anterioren oder linksposterioren Hemiblock entwickeln, ist die Gefahr eines kompletten AV-Blocks groß. Diese Patienten sollten primär mit einem temporären Schrittmacher versorgt werden. Der komplette Block ist in der Regel nur vor
übergehend vorhanden, eine permanente Stimulation ist nur in wenigen Fällen notwendig. Beim Auftreten eines Linksschenkelblocks ist eher mit einem myokardialen Pumpversagen zu rechnen, eine prophylaktische Schrittmacherstimulation ist nicht notwendig.
Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie
Eine sequentielle Stimulation bei Patienten mit hypertroph obstruktiver Kardiomyopathie (HOCM) kann eine sinnvolle Alternative zur operativen Intervention sein (15, 24). Bei den meisten vorgestellten Patienten wurden sequentielle (DDD) Schrittmachersysteme mit einem kurzen AV-Intervall (50-150msek) implantiert. Es wurde eine Reduktion des Ausflußbahngradienten von > 50% beobachtet, wobei der mittlere arterielle Druck nicht signifikant verändert wurde. Hämodynamische Befunde und klinische Parameter (Herzinsuffizienz und/oder Angina pectoris) verbesserten sich, die Belastbarkeit nahm zu.
Dilatative Kardiomyopathie
Die Behandlung von Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie (DCM) und schwerer Herzinsuffizienz ist oft schwierig, eine medikamentöse Behandlung führt nur (noch) zu geringgradigen Verbesserungen der klinischen Symptomatik. Wenn eine konventionelle medikamentöse Therapie unzureichende Erfolge zeigt, kann eine sequentielle Stimulation mit kurzem AV-Intervall (< 100 msek) eine Alternative sein
(4, 17, 21). Neben einer Verbesserung der klinischen Symptomatik durch DDD-Stimulation war eine Steigerung der linksventrikulären Auswurffraktion und eine Verringerung von linksatrialen und linksventrikulären Diametern zu erreichen. Die DDD-Stimulation bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz und DCM aus hämodynamischer Indikation hat sich allerdings bisher nicht durchgesetzt.
Schrittmachertherapie nach Herztranspiantation
Bradykardien werden nach orthotoper Herztransplantation bei zirka 18-50% der Patienten beobachtet. Diese Bradykardien sind oft nur vorübergehend vorhanden, so daß keine Indikation zur permanenten Schrittmachertherapie gegeben ist (16, 25). Sinusknotendysfunktionen oder AV-Blockierungen können früh (bis zu 15 Tagen nach Transplantation) oder spät * •
------------------------------------------- 4 ------------------------------------------------
Differentialdiagnose von Synkopen
Kardiogene Ursachen• Arrhythmien (Bradykardien, Tachykardien)• Aortenstenose• Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie• Lungenembolie• Aortendissektion• Pulmonale Hypertonie• Myokardinfarkt mit Pumpversagen• Fallot-Anomalien• Vorhoftumoren• Carotis-Sinus-Syndrom vom
kardioinhibitorischen Typ
Vaskuläre Ursachen• Vasovagale Synkope• Sympathikotoner orthostatischer Kollaps• Postpressorische Synkope• Organische Gefäßerkrankungen (zerebro-
vaskulär)• Subclavian-steal-Syndrom
Neurologische Ursachen• Epilepsien• Narkolepsie• Hysterie• Eklampsie• Intrazerebrale Blutungen
Metabolische Ursachen• Hypoglykämie• Hyperglykämie• Hepatisches Koma• Urämisches Koma• Hypophysäres Koma• Thyreotoxische Krise• Intoxikationen
Fortbildung: Indikationen zur Schrittmacher-Therapie ÜZÖEQäl 145
(Monate oder Jahre nach Transplantation) auf- treten. Der Mechanismus der Leitungsstörungen nach Transplantation ist unklar. Möglicherweise spielt die Ischämie des Spenderorgans während der Präparation des Organs die größte Rolle in der Pathogenese postoperativer Arrhythmien (22). Bei zirka 50% von Patienten mit implantierten Schrittmachern nach Herztransplantation war nach 12 Monaten keine Bradykardie mehr nachzuweisen (7), so daß eine Reversibilität der Sinusknotenfunktion denkbar erscheint.
Synkopen
Synkopen (zerebrale Minderdurchblutung mit Bewußtseinsverlust) können durch eine primäre kardiale Erkrankung (rhythmogen, Klappenfehler), durch metabolische Entgleisungen oder durch neurologische Erkrankungen bedingt sein. Die genaue Abklärung der Ursache ist wichtig: Die 2-Jahres-Letalität bei kardiovas
kulärbedingten Synkopen beträgt 20-25%, dagegen nur 2-4%, wenn andere Ursachen vorliegen.
Literatur kann beim Verlag oder beim Verfasser angefordert werden!
Autor: Prof. Dr. med. Hans-Joachim Trappe, Abteilung Kardiologie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Konstanty-Gutschow-Str. 8,30625 Hannover.
Beruflicher Werdegang: Facharztausbil- dung Innere Medizin. Seit 1983 an der Medizinischen Hochschule Hannover, 1990 Habilitation, 1994 Ernennung zum apl. Professor.
Zur Person
Co-Autorin:MHH.
Dr. med. Petra Pfitzner,
M ServiceBox
Arbeitsmittel
Gibt es in Ihrer Praxis Probleme damit, ein Langzeit-EKG korrekt anzulegen? Oder wollen Sie eine Informationsvorlage für Ihre Patienten haben? Dann interessiert Sie das kostenlose Poster »Das Anlegen des Langzeit-EKG’s«. Bestellen beim Sotalex® Service Bristol-Myers-Squibb GmbH Postfach 460667/PSM 80914 München.
Ein Merkblatt für Schrittmacher-Patienten finden Sie auf Seite 171 dieser Ausgabe der ZFA. Sie können es heraustrennen, kopieren und zur Information an Ihre Patienten weitergeben!
Patientenratgeber
HerzschrittmacherImpulsgeber für »ein neues Leben im Takt«.H. Funke/A.P. Conrad/R. Köllner/S.D. Ermatinger Ein Patientenbuch der Deutschen Herzstiftung, das Buch für Schrittmacher-Patienten.TRIAS. 104 S.. 24Abb.. 24.80DM.
Anschriften
Deutsche Liga zur Bekämpfmig von Herzrhythmusstörungen e.V.Goethestraße 4 53757 St. Augustin
Aktivitäten sind u.a. Patientenaufklärung, Aus- und Weiterbildung von Ärzten in der Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen, Info-Material, Anregung und Koordination wissenschaftlicher Untersuchungen.
Deutsche Herzstiftung e.V.Wolfsgangstraße 20 60082 Frankfurt/Main Tel: 069/955128-0 Fax: 0 69/95512813
Es wird u.a. die Zeitschrift der Deutschen Herzstiftung herausgegeben, eine sehr informative Patientenzeitschrift.
Patientenbroschüren
»Herzrhythmusstörungen in den Takt gebracht!«Diese kostenlose Patientenbroschüre wurde jetzt neu aufgelegt. Die Information wird verstanden als Kommunikaitonshilfe zwischen Arzt und Patient. Sie soll dem Patienten dabei helfen, Herzrhythmusstörungen zu verstehen und gegebenenfalls deren Behandlung einzusehen und einzuhalten. Anfordern beim Sotalex® Service. Bristol-Myers-Squibb GmbH. Postfach 4606 67
146 23e^A Fortbildung
Hans-Joachim Trappe und Petra Pfitzner
Differentialtherapie bradykarder RhythmusstörungenWie liest man den Schrittmachercode?
Die Codierung gibt in der Position I die Kammer an, in der stimuliert wird (A = Vorhof, V Ventrikel, D = Vorhof und Kammer). Position II beschreibt den Ort der Wahrnehmung (»sensing«) von intrakardialen Signalen mit identischen Abkürzungen. Position III charakterisiert den Modus der Schrittmacherantwort (Inhibierung oder Triggerung), Position IV die programmierbaren Parameter und Position V spezielle antitachykarde Funktionen {Tab. 1). Während die Positionen I-III immer angegeben werden, sind die Positionen IV und V nur fakultativ.
Schrittmachersysteme und Stimulationsformen
Vor einer Schrittmachertherapie sind einige grundsätzliche Überlegungen notwendig, die
Neben der Wl-Stimulation haben in den vergangenen Jahren vor allem die frequenz
adaptive Stimulation und die vorhofgesteuerte Zweikammerstimulation erheblich an Bedeutung
gewonnen. Vorteil der sequentiellen Zweikammerstimulation ist die wesentlich bessere Hämodynamik. Die VDD-Stimulation mit nur einer rechtsventrikulär plazierten Elektrode ist ein geeignetes vorhofsynchrones Stimulationsverfahren, das besonders bei jungen Patienten mit höhergradigen AV-Blockierungen, normaler Sinusknotenfunktion und ohne supraventrikuläre Arrhythmien indiziert ist. Von den frequenzadaptiven Schrittmachersystemen haben sich vor allem muskelaktivitätsgesteuerte Schrittmacher und QT-Zeit- gesteuerte Schrittmacher bewährt, während sich die anderen frequenzadaptiven Schrittmachersysteme im wesentlichen nicht durchgesetzt.
Zum Inhalt
Über Erfolg oder Mißerfolg entscheiden. Dazu gehören die Erfassung und Beurteilung der Rhythmusstörung, die klinische Symptomatik, die Grunderkrankung und das Ausmaß einer linksventrikulären Funktionseinschränkung. Nach einer Charakterisierung dieser Parameter muß unter Berücksichtigung vor allem hä- modynamischer Aspekte entschieden werden, welche Form der Stimulation erfolgen soll.
Einkammersysteme haben lediglich eine Elektrode im rechten Vorhof (AAI-Stimulation) oder im rechten Ventrikel (Wl-Stimulation), während die sequentielle Stimulation entweder mittels Zweikammerstimulation (DVI, DDI, DDD) oder mittels Einkammerstimulation (VDD) möglich ist. Bei der Einkammerstimulation im rechten Ventrikel (Wl-Stimulation) wird die Schrittmacherelektrode im rechten Ventrikel plaziert. Dort werden definitionsgemäß Signalwahrnehmung (V) und Stimulation (V) durchgeführt; die Stimulation wird bei der Erkennung eigener ventrikulärer QRS-Komplexe inhibiert (I).Der Wl-Schrittmacher ist ein Bedarfsschrittmacher, der nach programmiertem Intervall einen Stimulationsimpuls abgibt, dem eine Kammerdepolarisation folgt. Wl-Schritt- macher sind für eine bestimmte Zeitspanne nach stimuliertem Komplex oder erkannter Eigenaktion refraktär, so daß ein ventrikuläres »Ereignis« während dieser Refraktärperiode nicht erkannt und nicht beantwortet wird. Die AAI-Stimulation erfolgt über eine im rechten Vorhof plazierte Elektrode, mit der Signalwahrnehmung (A) und Stimulation (A) im rechten Vorhof möglich sind; die AAI-Stimulation wird durch Erkennung eigener Impulse inhibiert (I). Die AAI-Stimulation setzt eine intakte Überleitung des atrioventrikulären Systems voraus und verbietet sich bei gleichzeitig bestehenden AV-Blockierungen. Vorteile der AAI-Stimulation sind eine erhaltene Vorhof-Kammer-Kon- traktionsfolge mit einer günstigeren Hämodynamik. Die AAI-Stimulation ist ein sinnvolles
Sequentielle Stimulation ist mittels Ein- oder Zweikammerstimulation möglich
Z. Allg. Med. 1996; 72: 146-154. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
Elektrolyt- Therapie
Jgßm %
if-*Ö,Ä»=3.Physiologisch und kausal!
Zentramin Bastian® N Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Magnesiumcitrat wasserarm 75 mg, Calciumcitrat 4 HjO 60 mg, Kaliumcitrat 1 HjO 35 mg; Glycin (Aminoessigsäure), lösl. Polyvidon, Magnesiumstearat. 1 Ampulle zu 5 ml enthält Magnesiumchlorid wasserfrei 40 mg, Calciumchlorid wasserfrei 45 mg, Kalium
chlorid 15 mg; Glycin (Aminoessigsäure), Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Durch Verschiebungen im Elektrolythaushalt bedingte Fehlregulationen des vegetativen Systems, häufig psychosomatischen Ursprungs, wie Herzschmerzen, Herzjagen, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, migräneartige Zustände;
tetanoide Zustände (wie nächtliche Wadenkrämpfe); Ampullen zusätzlich: Allergosen (wie Sonnenallergien, juckende Dermatosen). Gegenanzeigen: Bei Niereninsuffizienz hochdosierte Daueranwendung vermeiden. Ampullen zusätzlich: Myasthenia gravis, AV-Block. Nebenwirkungen: Nur Ampullen: Bradykardie, Überleitungsstörungen, periphere Gefäßerweiterungen. Hinweis: Bei Patienten, die mit Herzglykosiden (Digitalis, Strophanthin) behandelt werden, sind Zentramin Am
pullen kontraindiziert. Dosierung und Anwendung: 1-2 Tabletten 3mal täglich einnehmen, 1-2 Ampullen i.v., bei Bedarf mehrmals täglich. Handelsformen und Preise: 5 Ampullen (N 1) DM 15,04, 10 Ampullen (N 2) DM 28,36; 50 Tabletten (N 2) DM 22,24, 100 Tabletten (N 3) DM 40,71 Bastian-Werk GmbH, 81245 München
Stand 06/1995
NEU!
DAS DUO VITALE IN DER
RHEUMATHERAPIE;
RANTUDIL & RANTUtäElZB
Wirkstoff
Wse»AntlfheumiAntiphlogisiAnalgetikum
m(oatiWW
Erkrankungen des rheumatischen Formen
kreises verlangen Therapiekonzepte, die
zum einen wirksam und verträglich akute
Beschwerden beseitigen und zum anderen
die Lebensqualität des Patienten verbessern.
Rantudil hilft durch seine starke analgeti
sche und antiphlogistische Potenz sympto
morientiert. RantuCARE erweitert diese
Therapie ursachenorientiert durch
das Konzept der Mobilisierung. Ein
umfangreiches Angebot von Trai
nings- und Ratgeberprogrammen zu
Bewegung, Ernährung und Entspan
nung macht es Ihnen leicht, Ihren Patienten
individuell das Richtige zu empfehlen.
Nähere Einzelheiten erfahren Sie demnächst.
Rahtuditforte retardDIE KRAFT UND DIE VERTRÄGLICHKEIT
RANTUDIL KAPSELN • RANTUDIL FORTE KAPSELN • RANTUDIL RETARD KAPSELN WIRKSTOFF: Acemetacin. ZUSAMMENSETZUNG: 1 Rantudil Kapsel enthält 30 mg Acemetacin, 1 Rantudil forte Kapsel enthält 60 mg Acemetacin, 1 Rantudil retard Kapsel enthält 90 mg Acemetacin; weitere Bestandteile: Talkum, Magnesiumstearat, Farbstoffe: E 171, E 172; Rantudil retard zusätzlich: Celluloseacetatphthalat, Triacetin, Polyvidon.ANWENDUNGSGEBIETE: Schmerzen u. Bewe
gungseinschränkung bei: chron. Gelenkrheumatismus (chron. Polyarthritis, rheumatoide Arthritis), akuten Reizzuständen bei degener. Gelenkerkrankungen, insbes. der großen Gelenke und der Wirbelsäule (aktivierte Arthrose/Spondylarthrose) M. Bechterew (Spondylitis ankylosans), Gichtanfall, entzündl. Zuständen d. Gelenke, Muskeln und Sehnen, Sehnenscheiden- oder Schleimbeutelentzündung, Lumbago-Ischialgie, Entzündung oberflächl. Venen (Thrombophlebitis) und anderer Gefäße (Vasculitis). Zusätzliche Anwendungsgebiete bei Rantudil forte und Rantudil retard: Psoriasis-Arthritis, Entzündungen und Schwellungen nach Operationen und stumpfen Verletzungen. GEGENANZEIGEN: Ungeklärte Blutbildungsstörungen, Liberempfindlichkeit gegen Acemetacin oder Indometacin, letztes Drittel der Schwangerschaft. Strenge Nutzen-Risiko-Abwägung im ersten und zweiten Drittel der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwüren (auch in der Vorgeschichte). Anwendung nur unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen (Notfallbereitschaft) bei Patienten, die auf nichtsteroidale entzündungshemmende/analgetische Wirkstoffe z. B. mit Asthmaanfällen, Hautreaktionen o. akuter Rhinitis überempfindlich reagiert haben (bes. gefährdet sind Patienten, die an Asthma, Heuschnupfen, Nasenschleimhautschwellungen 0. chron. Atemwegserkrankungen leiden). Besonders sorgfältige ärztliche Überwachung erforderlich bei Patienten mit Magen-Darm-Beschwerden, bei Hinweisen auf Magen- u. Darmgeschwüre oder Darmentzündungen (z.B. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) in der Vorgeschichte, bei eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion, Bluthochdruck und/oder Herzinsuffizienz sowie bei älteren Patienten. Keine Anwendung bei Kindern unter 14 Jahren, da für diese Altersklasse keine Erfahrungen vorliegen. NEBENWIRKUNGEN: Gelegentlich: Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein/Schmerzen im Magen-Darm-Bereich, Durchfälle, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindelgefühl, Schläfrigkeit/Müdigkeit, Tinnitus, verborgener Blutverlust aus dem Magen-Darm-Trakt, der in Ausnahmefällen eine Blutarmut verursachen kann sowie Magen-Darm-Geschwüre, u.U. mit Blutung und Durchbruch (sollten stärkere Schmerzen, insbesondere im Oberbauch und/oder Schwarzfärbung des Stuhls auftreten, ist dies dem Arzt sofort mitzuteilen). Selten: Angstzustände, Verwirrtheit, Psychosen und Halluzinationen, depressive Verstimmung, Reizbarkeit, Muskelschwäche, periphere Neuropathien, Nierenschäden, Ödeme, Blutdruckanstieg, Hyperkaliämie, Überempfindlichkeit mit Hautrötung, Exanthem, Enanthem, angioneurotisches Ödem, Hyperhidrosis, Urtikaria und Juckreiz, Haarausfall, anaphylaktische Reaktionen, Leukopenie, Anstieg der Leberenzymwerte, Anstieg des Blutharnstoffes, Pigmentdegeneration der Retina und Corneatrübungen (nach Langzeitbehandlung). In Einzelfällen: hämolytische Anämie, Thrombozytopenie, Agranulozytose, Panzytopenie, apiastische Anämie, Gehörstörungen, schwere Hautreaktionen, allergische Reaktionen mit Gesichts- bzw. Lidschwellungen, phototoxische Dermatitis, aktues Nierenversagen, toxische Hepatitis und Leberschäden, Hyperglykämie und Glukosurie, pektanginöse Beschwerden, Vaginalblutungen, Sehstörungen mit Doppelsehen, Flimmern bzw. „Farbflecken-sehen“, Miktionsstörungen, Stomatitis, aphtöse Mundgeschwüre. Besondere Vorsichtshinweise: Verstärkung der Symptome bei Epilepsie, Morbus Parkinson u. psychiatrischen Vorerkrankungen bzw. eine Beeinflussung der Thrombozytenaggregation bei vermehrter Blutungsneigung möglich, ln manchen Fällen wurde eine Erhöhung der Parameter der Leber- und Nierenfunktionstests festgestellt. Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Reaktionsvermögen so weit verändert werden, daß die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN: Rantudil, -forte, -retard/DigoxIn-Präparate: evtl. Erhöhung der Digoxin-Plasmaspiegel; -/Lithium-Präparate: Kontrolle der Lithium-Clearance notwendig; -/Antikoagulantien: Blutungsrisiko evtl, erhöht (wegen Thromboxansynthese-Hemmung); -/Kortikoide o. andere Entzündungshemmer: erhöhtes Risiko von Magen-Darm-Blutungen; -/Acetylsalicylsäure: Erniedrigung d. Acemetacin-Plasmaspiegel; -/Probenecid: evtl. Verlangsamung der Acemetacin-Elimination; -/Penicilline: evtl. Verzögerung der Penicillin-Elimination; -/Furosemid: Beschleunigung der Acemetacin-Ausscheidung; -/Diuretika bzw. Antihypertensiva: evtl. Abschwächung der antihypertensiven Wirkung; -/kaliumsparende Diuretika; besondere Kontrolle der Serum-Kaliumwerte nötig (evtl. Hyperkaliämie); -/zentral wirksame Pharmaka o. Alkohol: besondere Vorsicht geboten. HANDELSFORMEN: 20 Rantudil Kapseln (NI)DM 15,49; 50 Rantudil Kapseln (N2) DM 33,61; Anstaltspackungen. 20 Rantudil forte Kapseln (NI) DM 26,01; 50 Rantudil forte Kapseln (N2) DM 56,44; 100 Rantudil forteKapseln (N3) DM 101,42; Anstaltspackungen. 20 Rantudil retard Kapseln (NI) DM 35,78; 50 Rantudil retard Kapseln (N2) DM 78,49; 100 Rantudil retard Kapseln (N3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DM 144,88; Anstaltspackungen. Verschreibungspflichtig. Bayer AG, Leverkusen Stand: April 1995 Pharma Deutschland
FortbüdjBng; Differentialtherapie
Tabelle 1: Darstellung des Schrittmachercodes
Position I II III IV V
Funktion Stimulation Sensing SM-Antwort Prog.-Parameter AT-FunktionV = Ventrikel V = Ventrikel T = Triggerung P = programmierbar B = BurstA = Vorhof A = Vorhof I = Inhibierung M = multiprogram. N = normal-
stimulationD = A+V
S = single c.
D-A+V0 = keine
S = single c.
D = A+V0 = keine
R = Frequenzadaptiv S = Schock0 = keine E = externe
Steuerung
Abkürzungen: AT = antitachykard, c = chamber (Einkammer), Prog = programmierbar, SM = Schrittmacher, A = Vorhof, V = Ventrikel
AAI“Stim«lation; nicht bei Patien
ten mit Vorhofflimmern oder
-flattern
Konzept bei Patienten mit Bradykardien und ausschließlichen Sinusknotenfunktionsstörun
gen und intakter atrioventrikulärer Überleitung; eine andere Indikation für die AAI-Stimulation wurde bei Patienten mit Torsade de poin- tes-Tachykardien bei QT-Syndrorh gesehen (49). Bei Patienten mit AAI- Schrittmacher sollten permanente
oder intermittierende Phasen von Vorhofflimmern und/oder Vorhofflattern nicht vorliegen.
Frequenzadaptive Stimulation
Das Herz-Kreislauf-System kann das Herz-Zeit- Volumen unter Belastung etwa um das 3-4- fache steigern, bei Patienten mit komplettem AV-Block und implantierten Wl-Schritt- machern ist das nicht möglich (28). Die Entwicklung frequenzadaptiver Schrittmachersysteme führte zu einer Verbesserung von klinischer Symptomatik und Hämodynamik des Schrittmacherpatienten durch Anpassung der Stimulationsfrequenz an physiologische Belastungen (14, 31, 34, 39).
Bewegungs- und muskelaktivitätsgesteuerte SchrittmacherUnter den frequenzadaptiven Schrittmachersystemen werden heute die Bewegungs- oder muskelaktivitäts-gesteuerten Schrittmacher am häufigsten implantiert, die als Sensor die Bewegung oder die Muskelaktivität verwenden {Tab. 2). Als Sensor dient ein piezoelektrischer Kristall, der im Schrittmachergehäuse integriert ist. Er wandelt mechanische Erschütterungen, die auf die Gehäusewand übertragen werden, in elektrische Spannungen um, die
über Mikroprozessoren zu einem Frequenzanstieg unter körperlichen Belastungsbedingungen führen. Nachteile sind eine fehlende Frequenzanpassung auf psychische Streßsituationen, ein unzureichender Frequenzanstieg bei statischen Belastungen sowie eine inadäquate Frequenzsteigerung bei externen Störeinflüssen durch passiv erfahrene Vibrationen (Autofahren über Kopfsteinpflaster, Traktorfahren, Umgang mit Bohrmaschinen usw.). In
Tabelle 2: Gerätetypen und Hersteller von frequenzadaptiven Schrittmachersystemen
Steuerungsursache SM-Name Hersteller
Muskelaktivität Activitrax, Legend Medtronic
Bewegung Sensolog, Solus ErgosDashExcel VRSwing
SiemensBiotronicIntermedicsCPISorin
QT-Intervall TX, Quintech TX Rhythmyx
VitatronVitatron
Atemfrequenz/Atem-minutenvolumen
Biorate RDP 3 Biorate MB 1Meta MV
Biotec Alpha Biotec Alpha Teletronics
02-Sättigung HemologOxytrax
SiemensMedtronic
Temperatur Kelvin 500ThermosNova MR
CookBiotronicIntermedics
Hämodynamik-Steuerung
PreceptDeltatrax
CPIMedtronic
150 :ZWA Fortbildung; Differentialtherapie
einer eigenen Untersuchung konnten wir zeigen, daß die Belastbarkeit bei Patienten mit AV-Block Iir nach His-Ablation nur bei 14% mit Wl-Schrittmachern normal war. Ein Fre- quenz-Zeit-Diagramm aus einer eigenen Untersuchung zeigt unter Belastungsbedingungen einen relativ schnellen Anstieg der Herzfrequenz, der nach Ende der Belastung wieder relativ schnell abfällt (Abb. 1).
Belattung (km/h)
Abbildung 1: Frequenz-Zeit-Diagramm unter Belastungsbedingungen (Laufbandergometrie) bei Patienten mit aktivitätsgesteuerten Schrittmachersystemen bei AV-Block III” nach His-Bündel-Ablation (Schrittmacher VVI,R, Typ Activitrax, Firma Medtronic)
QT-Zeit-gesteuerte SchrittmacherDie QT-Zeit verkürzt sich mit steigender Herzfrequenz, ebenso wie unter Katecholamineinfluß. Dieser Beobachtung liegt das Konzept des QT-Zeit-gesteuerten Schrittmachers zugrunde, bei dem über eine rechtsventrikuläre Elektrode das intrakardiale und gefilterte Signal der Stimulus-T-Zeit erfaßt wird. Die Stimulationsfrequenz wird jeweils durch den Vergleich mit der vorausgehenden stimulierten Stimulus-T- Zeit errechnet. Der Schrittmacher wählt die Frequenz niedriger, wenn das vorausgehende Zeitintervall länger ist und höher, wenn das vorausgehende Zeitintervall kürzer ist (14). Das Ausmaß der Frequenzänderung orientiert sich an der Anstiegssteilheit im Verhältnis zur oberen Grenzfrequenz. Da der QT-Zeit-gesteuerte Schrittmacher über eine Messung der QT-Zeit arbeitet, benötigt er keinen separaten Sensor. Mehrere Autoren haben nachgewiesen, daß mit einem QT-Schrittmacher bei über 90% der Patienten eine zufriedenstellende Anpassung der Herzfrequenz an Belastungsbedingungen möglich war (9, 22). In einer eigenen Untersuchung (48) fanden wir bei Patienten mit komplettem AV-Block nach His-Ablation unter Belastungsbedingungen einen relativ langsamen Fre
quenzanstieg und ein ebenfalls relativ langsames Absinken der Herzfrequenz nach Belastungsende [Abb. 2). Häufig ist das Frequenzverhalten bei länger dauernden, repetitiven oder wechselnd hohen Belastungen nicht adäquat. Negativ können sich auch psychische Streßsituationen mit Katecholamin-induzierter Frequenzsteigerung oder der Einfluß einer medikamentösen Behandlung als mangelnde Frequenzvariabilität auswirken. Beschrieben wurde auch das Phänomen der Frequenzoszillationen: Eine initiale belastungsinduzierte Erhöhung der Stimulationsfrequenz führt zu einer weiteren Verkürzung der QT-Zeit, die der Schrittmacher fälschlicherweise als fortdauernden adrenergen Einfluß deutet und mit einer weiteren Frequenzsteigerung beantwortet. Selbstverständlich sind Patienten mit abnormer Repolarisation (QT-Syndrom) keine Kandidaten einer QT-Zeit-gesteuerten Stimulation. Es muß auf die Bedeutung der medikamentös verlängerten QT-Zeit (Betablocker, Klasse-I- und Klasse- III-Antiarrhythmika) hingewiesen werden. Der klinische Alltag des Patienten mit QT-Zeit-ge- steuerten Schrittmachern zeigt, daß Programmierung und Handhabung aufwendiger sind als z.B. bei muskelaktivitäts-gesteuerten Schrittmachersystemen (48).
Temperatur-gesteuerte SchrittmacherUnter Belastung wird eine Änderung der Temperatur in der Vena cava inferior beobachtet. Dieses Phänomen war Grundlage für die Entwicklung temperaturgesteuerter frequenzadaptiver Schrittmacher (31). Der temperaturgesteuerte Schrittmacher arbeitet über einen
Keine QT-Zeit- gesteuerte Stimulation für Patienten mit QT-Syndrom!
Belattung (50'100-150 Watt) Ruhephate
Abbildung 2: Frequenz-Zeit-Diagramm unter Belastungsbedingungen (Laufbandergometrie) bei Patienten mit aktivitätsgesteuerten Schrittmacbersystemen bei AV-Block III” nach His-Bündel-Ablation (Schrittmacber VVI,R, Typ Quintecb 911, Firma Vitatron)
Fortbildung: Differentialtherapie üüQRSAk. ISl
0,4mm großen Termistor zur Messung der zentralvenösen Bluttemperatur, der in die Schrittmacherelektrode integriert ist. Dieses Therapiekonzept hat sich klinisch nicht durchgesetzt (störanfällige Thermistor-Elektrode, sehr langsame Frequenzanpassung, inadäquate Frequenzsteigerungen bei Fieber oder thermischen Einflüssen).
Atemfrequenz-gesteuerte SchrittmacherEine vielversprechende Form der frequenzadaptiven Stimulation ist die Anpassung der Herzfrequenz durch Atemfrequenz- bzw. Atemminutenvolumen-Steuerung (32). Die Messung der Atemfrequenz ist entweder durch einen Sensor möglich, der intrapleurale atemsynchrone Druckschwankungen registriert, oder aber durch Messung von Atemexkursionen über eine Impedanzänderung zwischen Schrittmacher und der Spitze einer zusätzlich implantierten Hilfselektrode. Die Ausdehnung der Lunge bei Inspiration führt zu einer Steigerung des Widerstandes. Dieser wird durch einen Impedanzsensor registriert, dies führt zü einer Abschätzung des Atemminutenvolumens und einer Frequenzsteigerung. Die Atmung und damit die Frequenzanpassung reagiert schnell
auf Belastungen, dennoch ist die An- Leider reagierte Passung bei Belastungsbeginn nur
der Schritt- langsam. Leider führen auch Armmacher auch auf Bewegungen, Hyperventilation oder Hyperventilation Atemwegserkrankungen zu inad-
oderHusten äquaten Reaktionen des Schrittmachers (35, 36). Detektionsproble
me ergeben sich besonders bei Patienten mit Lungenemphysem und Zwerchfellatmung.
pH-Wert-gesteuerte SchrittmacherDas Konzept des pH-Wert-gesteuerten frequenzadaptiven Schrittmachersystems beruht auf einer Senkung des pH-Wertes unter Belastung, bedingt durch eine Steigerung des zellulären Metabolismus und einer Freisetzung von Kohlendioxyd (CO2) und Laktat (11, 12). Bei Patienten mit chronotroper Inkompetenz und inadäquatem Herz-Zeit-Volumen führt eine Belastung zu einer C02-Erhöhung und einer konsekutiven Senkung des pH-Wertes; der Abfall des pH-Wertes ist dabei wesentlich ausgeprägter als beim Gesunden. Der Sensor des pH-gesteuerten Schrittmachers ist ein aus Iridium/Iridiumoxyd (Ir02) bestehender Ring, der im Bereich des Vorhofs bei einer rechtsventrikulär plazierten Elektrode liegt. Bisher bestehen konstruktive Probleme in der Entwicklung eines langfristig ohne Störanfälligkeiten arbei
tenden Sensors (13). Darüber hinaus ist berichtet worden, daß der Sensor auch auf Schmerz, Kälte und emotionale Situationen reagiert (36).
Sequentielle Stimulation
Die Schrittmachertherapie hat in den vergangenen Jahren durch die Entwicklung frequenzadaptiver Systeme enorme Fortschritte gemacht (46). Trotzdem wurden z.T.Einbußen in der hämodynamischen Enorme Fort- Leistung von Patienten beobachtet, schritte durch die durch den Verlust der atrioven- frequenzadap- trikulären Synchronisation bedingt tive Systeme! waren. Die hämodynamischen Vorteile der vorhofbeteiligten Kammerstimulation wurden bei Patienten mit komplettem AV-Block in vielen Studien belegt (44, 54).
Die sequentielle Stimulation ist bei Zweikammerschrittmachern durch zwei Elektroden (Vorhof- und Ventrikelelektrode) mit direktem Wandkontakt in Vorhof und Ventrikel charakterisiert. Die vorhofsynchrone Stimulation setzte sich zunächst jedoch nicht allgemein durch, da Schwierigkeiten bei der Implantation (besonders der Vorhofelektroden) auftraten, die mit unzuverlässiger Wahrnehmung und Stimulation verbunden waren. Durch Weiterentwicklungen besonders der Elektrodentechnologie kam es zu einer deutlichen Reduktion der Dislokationsrate. Patienten, die prinzipiell für eine sequentielle Stimulation in Frage kommen, haben hier eine echte Alternative zu anderen Stimulationsformen (19, 42). Neben der WI- Stimulation gehören die Zweikammersysteme zu den am häufigsten implantierten Schrittmachersystemen.
DVI-Stimulation
Eine sequentielle Stimulation liegt der DVI-Stimulation zugrunde: Eine Stimulation in Vorhof und Ventrikel (D) ist möglich, die Signale werden aber nur im Ventrikel (V) wahrgenommen. Die Inhibierung (I) erfolgt nur bei ventrikulär registrierten Impulsen. Die Stimulation im DVI- Modus war vor allem zur Prävention Schritt- macher-induzierter Tachykardien und bei Patienten mit Vorhofflimmern sinnvoll. Bei Patienten mit DVI-Schrittmacher konnte durch einen ventrikulären Stimulus über eine retrograde Leitung eine vorzeitige Erregung der Vor-
152 ^JFA Fortbildung: Differentialtherapie
DDD-Stimulation auch bei hyper-
thropher- obstruktiver
Kardiomyopathie
höfe erreicht werden. Dadurch erfolgte eine Stimulation der Kammern mit der Folge einer Schrittmacher-induzierten Tachykardie.
DDI-StimulationDie DDI-Stimulation ist ebenfalls eine AV-se- quentielle Stimulation mit einer Signalwahrnehmung in Vorhof und Kammer. Das Konzept der DDI-Stimulation ist der DVI-Stimulation ähnlich, sieht man einmal davon ab, daß DDl- Schrittmacher mit einer atrialen und ventrikulären Signalwahrnehmung verbunden sind.
DDD-StimulationFür Patienten mit einem symptomatischen AV- Block 11° oder 111° und regelrechter Sinusknotenfunktion ist die vorhofgetriggerte ventrikuläre Stimulation die hämodynamisch günstigste Stimulationsart (19, 46). Die DDD-Schritt- machertherapie ist in diesen Fällen bisher am weitesten verbreitet. Dieser Schrittmacher erlaubt bei chronotroper Kompetenz über eine vorhofgesteuerte Kammerstimulation eine physiologische Stimulation. Eigenaktionen werden sowohl im Vorhof als auch in der Kammer erkannt (D) und führen zur Stimulation (D) oder zur Inhibierung der Impulsabgabe. Die AV-Überleitungszeit ist als fixer oder variabler belastungsabhängiger Parameter programmierbar. Eine neuere Indikation zur DDD- Schrittmachertherapie ist bei Patienten mit hypertroph-obstruktiver Kardiomyopathie gege
ben. Hier konnte eine deutliche Reduktion intraventrikulärer Druckgradienten, eine Verbesserung von Herzinsuffizienz und klinischer Symptomatik erreicht werden (21, 26, 52). Die Indikation zur DDD-Stimulation ist bei Patienten mit hyper
troph-obstruktiver Kardiomyopathie jedoch noch nicht umfassend definiert.
DDDR-StimulationLiegt bei Patienten mit AV-Block 11° oder 111° eine chronotrope Inkompetenz vor, ist die Indikation zum DDDR-Schrittmacher gegeben. Dieses System steigert die Herzfrequenz belastungsabhängig über einen in den Schrittmacher integrierten Sensor. DDDR-Schrittmacher umfassen daher das gesamte Stimulationsspektrum, das von herkömmlichen DDD-Systemen bekannt ist. Durch den integrierten Sensor wird entweder eine Vorhofsteuerung durch P-Wel- len-synchrone Stimulation (bei chronotroper Kompetenz) oder durch Sensor-gesteuerte Stimulation (bei chronotroper Inkompetenz) er
VDD-Schrittmachersysteme
Gerätetypen
Ultra IIPhymosUnitySaphir 600 VDR Thera VDD Dromos
Hersteller
CPIMedicoIntermedicsVitatronMedtronicBiotronic
reicht. Die Möglichkeit einer integrierten frequenzadaptiven Stimulation ist besonders bei Patienten mit intermittierenden Vorhofrhythmusstörungen wichtig: Ein DDDR-Schritt- machersystem, das über die Möglichkeit des »mode switch« verfügt, würde bei Vorliegen z.B. eines Vorhofflimmerns auf eine WIR-Sti- mulation umschalten. Erkennt die Vorhofelektrode des Schrittmachersystems wieder regelrechte P-Wellen, wird der DDD- oder DDDR- Modus reaktiviert.
VDD-StimulationDie Entwicklung einer AV-sequentiellen Stimulation mit nur einer ventrikulär plazierten Elektrode ist nach den bisher vorliegenden Berichten als wichtige Vereinfachung aufzufassen. Verschiedene Entwicklungen und Fortschritte in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Vorhofsignalen durch flottierende Vorhofringelektroden führten zur Entwicklung des VDD-Einzelelektroden-Schrittmachersystems.
Das Prinzip der VDD-Stimulation ist die Wahrnehmung von Vorhofsignalen über eine frei flottierende Vorhofringelektrode (Doppelringe bzw. Halbringe in Höhe des rechten Vorhofs), deren Signale zu einer Ventrikelstimulation führen, die durch den Vorhof getriggert werden [Ahb. 3a, b). Hohe Eingangsempfindlichkeiten der Verstärker ermöglichen mit modernen VDD-Schrittmachersystemen auch die Wahrnehmung von niedrigen Vorhofpotentialen. Für den Erfolg der VDD-Stimulation ist eine genaue Berücksichtigung verschiedener Kriterien notwendig:
1. genaue Auswahl der Patienten,2. Zuverlässigkeit der Wahrnehmung atrialer
endokavitärer Signale,3. Ausrichtung einer Elektronik auf die Wahr
nehmung von Signalen durch eine flottierende Sonde,
4. optimale Implantationstechnik und5. sorgfältige Programmierung.
Fortbildung: Differentialtherapie Z£A. 153
VDD-Stimulation - wer ist nicht geeignet?
• Patienten mit Sinusknotenfunktionsstörung in Ruhe und/oder bei Belastungen,
• Kammerfrequenzen < 70/min oder ein unzureichender Frequenzanstieg unter Atropin sind als bedenklich anzusehen,
• Patienten mit supraventrikulären Arrhythmien, intermittierenden Episoden von Vorhofflimmern und/oder Vorhofflattern.
Abbildung 3a: Röntgen-Thorax-Aufnahme (antero-po- steriorer Strahlengang) nach Implantation eines VDD- Schrittmachersystems. Man erkennt eine regelrecht plazierte VDD-Elektrode mit einer Ringelektrode zur Signalwahrnehmung im rechten Vorhof und einer Stimulationselektrode im rechten Ventrikel
Abbildung 3b: Röntgen-Thorax-Aufnahme (seitlicher Strahlengang) nach Implantation eines VDD-Schritt- machersystems. Man erkennt eine regelrecht plazierte VDD-Elektrode mit einer Ringelektrode zur Signalwahrnehmung im rechten Vorhof und einer Stimulationselektrode im rechten Ventrikel
Patienten mit einem hochgradigen AV-Block und einer normalen Sinusfunktion sind ideale Kandidaten für diese Stimulationsform (2). Bereits 1992 konnten wir bei 19 Patienten zeigen, daß in 88% der Fälle eine 100%ige AV- Synchronisation auch unter Belastung erreicht werden konnte (27). Analysiert man die bisher publizierten Ergebnisse der VDD-Stimulation,
muß sie als effektive Schrittmachertherapie mit physiologischer Stimulation angesehen werden, die für Patienten mit hochgradigem AV- Block die WIR-Stimulation ersetzt (53). Insbesondere hier ist eine gute Patientenauswahl von großer Bedeutung.
Differentialtherapie
Die Frage, welche Schrittmachertherapie für welchen Patienten in Frage kommt, richtet sich in erster Linie nach der vorliegenden Rhythmusstörung (17). Darüber hinaus sind natürlich Fragen der Grunderkrankung, der klinischen und hämodynamischen Situation und Begleitumstände in differentialtherapeutische Überlegungen miteinzubeziehen (29).
SinusknotendysfunktionIn einer Analyse über die Befunde der Schrittmachertherapie bei Patienten mit Sinusknotendysfunktion wurde gezeigt, daß unter ventrikulärer WI-/WIR-Stimulation das Auftreten von Vorhofflimmern und thromboembolischen Komplikationen wesentlich seltener auftrat als unter atrialer Stimulation. Unter AAI-Stimula- tion ließen sich deutlich günstigere Befunde hinsichtlich des Schweregrades der Herzinsuffizienz und von Vorhofflimmern nachweisen als bei Wl-Stimulation. Bei Sinusknotendysfunktion waren die Befunde hinsichtlich Herzinsuffizienz und Klinik unter sequentieller Stimulation deutlich günstiger als unter Wl-Stimulation. Alle bisher vorgestellten Untersuchungen zeigen, daß die Stimulationsarten mit Beibehaltung der AV- Synchronisation einer Wl-Stimulation eindeutig überlegen sind. Neben einer verminderten Inzidenz von Vorhofflimmern führt die sequentielle Stimulation vor allem zu günstigeren hämodynamischen Befunden und geht mit einer
Sinusknotendysfunktion: Anzustreben ist derErhalt der AV-Synchronisation
154 Fortbildung: Differentialtherapie
niedrigen kardialen Letalität einher. Auch das thromboembolische Risiko scheint durch sequentielle Stimulation günstig beeinflußt zu werden.
AV-BlockierungenBei Patienten mit AV-Blockierungen haben DDD- und WIR-Stimulationen deutliche hämo- dynamische Vorteile im Vergleich zur Wl-Sti- mulation (20, 33). Verschiedene Studien zeigen, daß die Beibehaltung der AV-Synchroni- zität die Lebensqualität im Vergleich zu Stimulationsarten, die nur die Frequenzadaptation berücksichtigen, verbessert. Langfristig scheint die Zweikammerstimulation mit ähnlich günstigen Ergebnissen einherzugehen wie bei Patienten mit Sinusknotendysfunktion.
Frequenzadaptive SchrittmacherTrotz günstiger Befunde der sequentiellen Stimulation sind WI- und WIR-Schrittmacher die weltweit am häufigsten implantierten Systeme (18). Vor allem der aktivitätsgesteuerte und QT- Zeit-gesteuerte WIR-Schrittmacher hat sich durchgesetzt. Als klassische Indikation für eine
frequenzadaptive Stimulation gelten die chro- notrope Inkompetenz, z.B. bei Patienten mit Sinusknotensyndrom und erhaltener AV-Über- leitung oder Patienten mit Brady arrhythmia absoluta.
Literatur kann beim Verlag oder beim Verfasser angefordert werden!
Autor; Prof. Dr. med. Hans-Joachim Trappe, Abteilung Kardiologie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Konstanty-Gutschow'-Str. 8,30625 Hannover.
Beruflicher Werdegang: Facharztausbildung Innere Medizin. Seit 1983 an der Medizinischen Hochschule Hannover, 1990 Habilitation, 1994 Ernennung zum apl. Professor.
Co-Autorin: MHH.
Dr. med. Petra Pfitzner,
Buchbesprechung
H.-W. Baenkler
MedizinischeImmunologie
Grundlagen • Diagnostik • Klinik • Therapie • Pro
phylaxe • Sonderbereicheecomed Verlagsgesellschaft
AG & Co. KG, Landsberg/ Lech 1995, 809 Seiten,
187 Abb., davon 74 farbig, 152 Tabellen, 248,- DM.
Inhalt -Gesamtverzeichnis• Grundlagen der Immuno
logie• Immunkrankheiten• HIV/AIDS• Rheumatischer Formen
kreis• Immunopathien des Her
zens• der Atmungsorgane• der Leber• des Magen-Darm-Traktes• der Nieren• des HNO-Bereiches• des ZNS• Sonderbereiche, z.B. In
fektionsimmunologie
KommentarDer erste Beitrag (Grundlagen der Immunologie) besticht durch Diktion und didaktisch hervorragende farbige Abbildungen und weckt dadurch hohe Erwartungen an die Folgekapitel, die nicht immer trotz einer vorgegebenen Systematik (Definition, Vorkommen, Ätiologie, Pathogenese, Krankheitsbild, Verlauf und Prophylaxe) erfüllt werden.Vor allem ist die Herausarbeitung gerade der Immunologie und Immunpathologie nicht immer stringent und nur in den Kapiteln über organlokalisierte Immunopathien mit dem Grundlagenkapitel gut vernetzt. Dringend erforderlich ist ein Beitrag über immunologische und immunopathologische Labordiagnostik.Alle Kapitel müssen gestrafft werden: Therapieempfehlungen finden sich in Tabellen und/oder im Text, die Jones-Kriterien sind zweimal abgedruckt, die propädeutische Einführung in die Lungenfunktionsanalyse ist überflüssig, das mehrfach
erwähnte Caplan-Syndrom kann gestrichen werden, die Literatur über die Epidemiologie der Bronchitis aktualisiert werden, und es könnte herausgearbeitet werden, daß das panlobuläre Emphysem mit einem alpha^-An- titrypsinmangel assoziiert ist. Die Röntgenbilder könnten kleiner sein und z. T. auch fehlen. Statt dessen: Wie erfolgt die Interaktion der Immunkomplexe in gelenkbildenden Strukturen, welche Rolle spielen Antihistonanti- körper bei Procain- und Hy- dralazin-induzierten ANÄ? Weiß man nicht schon mehr über das Fibromyalgiesyn- drom? Sollte die Polymyositis granulomatosa bei Sarkoidose eingefügt werden?Das vorliegende Buch wird nach Straffung, Beseitigung von Druckfehlern, Verwenden der PNA ein Standardwerk für Ärzte, Gebietsärzte, Immunologen und Immunpathologen werden und sollte in keiner Klinik-Bibliothek fehlen. Die Ausstattung des Buches ist sehr gut, der Preis angemessen.
Dr. med. K.-H. Bründel, Arzt für Allgemeinmedizin
Fortbildung 155
Hans-Joachim Trappe und Petra Pfitzner
Diagnostik vor der Schrittmacher-TherapieWeichen Stellenwert haben nicht-invasive und invasive Verfahren im Rahmen der Indikationsstellung zur Schrittmacher-Therapie?
Für den Erfolg einer Schrittmacher-Therapie sind eine klare Indikationsstellung und die Auswahl des für den Patienten geeignetsten Schrittmachersystems notwendig (24, 25). Vor der Schrittmacherimplantation sind deshalb umfassende Untersuchungen erforderlich. Nur die Gesamtheit aller Befunde von Anamnese, klinischer Untersuchung bzw. nicht-invasiver und invasiver Verfahren führt zu einer erfolgreichen Behandlung. Wichtige nicht-invasive diagnostische Verfahren sind 12-Kanal-Oberflächen- EKG, Belastungs-EKG, Langzeit-EKG und Kipptisch-Untersuchung, während die elektrophy- siologische Untersuchung das wichtigste invasive Verfahren ist. Heute ist allerdings nur bei relativ wenigen Patienten vor einer geplanten Schrittmacherimplantation eine elektrophysio- logische Untersuchung notwendig.
Zum Inhalt
Für die Indikation zur Schrittmacherimplantation sind vor allem Anamnese und klinische
Symptomatik entscheidend. Eine Reihe von nicht-invasiven und invasiven Verfahren sind zur Ent
scheidung einer Schrittmacherimplantation sicher hilfreich, können aber nur im Zusammenhang mit klinischen Befunden interpretiertwerden. Nicht-invasive Verfahren haben für die Indikation zur Schrittmachertherapie sicher einen höheren Stellenwert als die invasiven elektrophysiologischen Techniken, die, abgesehen von wissenschaftlichen Fragestellungen, nur bei relativ wenigen Patienten vor Schrittmacherimplantation durchgeführt werden sollten. Bei diesen Patienten liegen in der Regel unklare Befunde zu Anamnese, Klinik und nicht-invasiven Untersuchungsergebnissen vor, so daß die elektro- physiologische Untersuchung zur Diagnosesicherung und zur Therapieentscheidung beitragen kann.
Nicht-invasive Untersuchungen
Oberflächen-ElektrokardiogrammVon entscheidender Bedeutung für die Beurteilung intrakardialer Leitungsstörungen ist das 12-Kanal-Oberflächen-Elektrokardiogramm (33, 34). Es konnte in mehreren Arbeiten gezeigt werden, daß bereits aus dem EKG wichtige Informationen über normale und pathologische Befunde abzuleiten sind, und daß das EKG darüber hinaus zur Risikoidentifikation von Patienten, die für einen plötzlichen Herztod gefährdet sind, herangezogen werden kann (27, 35). In vielen Fällen sind aus dem EKG auch Informationen über Mechanismen von brady- karden und/oder tachykarden Arrhythmien zu erhalten [Abb. 1] (26). Es sollten daher bei auffälligen Befunden (Palpitationen, Schwindel, Präsynkopen, Synkopen) mehrfache Elektrokardiogramme aufgezeichnet und genau analysiert werden. 1-, 2- oder 3-Kanal-Registrie- rungen sind in der Regel nicht ausreichend.
mmAbbildung 1: Brustwand-EKG-Ableitungen V1-V6 bei einem 23jäh- rigen Patienten mit rezidivierendem Schwindel und einer Synkope. Nachweis maligner ventrikulärer Rhythmusstörungen mit nicht anhaltenden schnellen Kammertachykardien.
Z. Allg. Med. 1996; 72: 155-162. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
156 Zm. Fortbildung; Diagnostik vor Schrittmacher-Therapie
Langzeit-ElektrokardiogrammDas Langzeit-EKG hat einen festen Stellenwert in der Abklärung tachykarder und/oder brady- karder Rhythmusstörungen (12). Es wurde auch zur Beurteilung des Frequenzverhaltens und von ST-Strecken-Veränderungen (»stumme Ischämie«) eingesetzt, Seit vielen Jahren wird es zur Risikoidentifikation von Patienten hinsichtlich eines plötzlichen Todes herangezogen (27) {Ahb. 2)
Belastungs-EKGNeben der Beurteilung von ST-Strecken und der Leistungsfähigkeit eines Patienten wird das Belastungs-EKG vor allem zur Analyse des Herzfrequenzverhaltens und belastungsinduzierter Arrhythmien herangezogen {Ahb. 3). Hier ist der Begriff der chronotropen Inkompetenz einzuführen; eine Situation, in der eine nach Alter, Größe und Gechlecht vorbestimmte Herzfrequenz unter Belastüngsbedingungen nicht erreicht wird. Die Erfassung der chronotropen
Indikationen zum Langzeit-EKG
Abklärung von Rhythmusstörungen• supraventrikuläre Arrhythmien• ventrikuläre Arrhythmien• Leitungsstörungen
Risikoidentifikation (komplexe ventrikuläre Arrhythmien)
nach Myokardinfarkt bei Kardiomyopathie bei Klappenfehlern bei entzündlichen Erkrankungen ohne nachweisbare Herzkrankheit
Unklare Synkopen bradykarde Arrhythmien tachykarde Arrhythmien Leitungsstörungen
"herapiekontrolleantiarrhythmisch-medikamentöse Therapie Betablocker-Behandlung nach interventioneilen Eingriffen Katheterablation Rhythmuschirurgie ICD-Implantation
Nach SchrittmacherimplantationVerdacht auf Fehlfunktion Sensingverlust Exit BlockSchrittmacherinduzierte Tachykardien
Nachweis stummer Ischämien
HerzfrequenzvariabilitätAbkürzung;ICD = implantierbarer automatischer Defibrillator
Inkompetenz durch Belastungs-EKG und pharmakologische Intervention (Atropintest) ist vor allem zum Ausschluß einer Sinusknotendysfunktion wichtig. Das Belastungs-EKG hat auch im Rahmen der Therapiekontrolle einen festen Stellenwert (Kontrolle einer antiarrhythmischen Therapie bei belastungsinduzierten Rhythmusstörungen!)(19).
KipptischuntersuchungPatienten mit Synkopen sind in der inneren Medizin relativ häufig, die Abklärung der Ursache ist oft schwierig: Bei mehr als 40% dieser Patienten findet sich keine definitive Diagnose und die Mehrheit der Patienten erleidet weiterhin synkopale Episoden (11). Rezidivierende unklare Synkopen sind in den Vereinigten Staaten für 6% aller Klinikaufenthalte verantwortlich und für 3% aller Notfallbehandlungen in Ambulanzen (9). Die vasovagale Synkope wird hervorgerufen durch einen plötzlichen Abfall des venösen Blutrückstroms als Folge eines venösen Poolings. Eine Schrittmacher-Therapie würde bei diesen Patienten keine Besserung bewir-
Bei chronotro- per Inkompetenz schließt das Belastungs-EKG eine Sinusknotendysfunktion aus
nsr
" V ,S 3 S S 3 il fV, f. .''"3 3,3' * ,1 /(A 3 3 3 * 3 3 A« a a 3«3 * .13 A A' A»,1A ,3 A A 3 a 3,1A , vv V 'v V V V W V V Vv V s, ’VV VV Vw vV Sf V w V V V vj y V ’v V V w V V V w V Vv V V v 'v V V w JIV
•' ‘ .1; * >}. '1 *1“ /I ■■ * * .* .* 'I .1 (1 D ,il 1’ II H ' /I r A A A A * \ A A ft ft M V« ft A V" 1 A ft *'*'«V w V V V V V vV V v sp V X - « V V V w V V V w f'. ':||| •/ y •'. )l 1 ■■■'
■ ' ■ ■ ■■ 'fi. Reanimation
Abbildung 2: Langzeit-EKG-Registrierung eines 47jäb- rigen Patienten mit rezidivierenden Synkopen. Man erkennt zunächst eine nicht anhaltende monomorphe Kammertachykardie, die in eine anhaltende (Pfeil) Kammertachykardie , schließlich in Kammerflattern und in Kammerflimmern übergeht. Schließlich Reanimation.
Diuretikum Verla’Triamteren + Hydrochiorothiazid
Tabletten
Diu-Ätenolol Verla’Atenolol + Chlortatidon
TablettenZ-mite
Captopril VerlaTabletten 12,6 mg, 25 mg, 50 mg
Mifedipin VerlaKapseln 5 mg/10 mg
Tablettsin 10 mg/20 mg retard
Metoprolol VerlaTabletten 50 mg/100 mg
200 mg retard
VerladynDihydroergotaminmesilat
Lösung
Verla-Lipon’Tabletten, Ampullen, Infusionsset
Piroxicam Verla®Tabletten 10 mg/20 mg
’iracetam 800 Verla®Tabletten
LactuverlanGranulat, Sirup
SIE KENNEN UNSERE MAGNESIUM SEITE
...KENNEN SIE AUCH DIESE ANDERE SEITE?
Es gibt ein Thema, das Frau S.auch mit ihrer besten Freundin nicht bespricht...
%
befreiWirkstoff: Atropinsulfat
Dysurie belastet -... die kostengünstige spasmolytische Therapie bei Dysurie, Reizblase, Inkontinenz
Dysurgal NWirkstoff: Atropinsulfat. Zusammensetzung: Tropfen: In 1 g: Atropinsulfat 1 H2O0,5 mg. Enthält 18Vol.-% Alkohol. Dragees: 1 Dragee enthält: Atropinsulfat 1 H2O 0,25 mg. Verschreibungspflichtig. Anwendungsgebiete: Dysurie mit und ohne krankhaftem Harnbefund, funktionelle Miktionsstörungen, Reizblase, Tenesmen, Harnträufeln, Pollakisurie, Nykturie, dyskinetische Beschwerden bei organischen Erkrankungen der ableitenden Harnwege und Adnexe, sowie nach Eingriffen im Bauchraum. Zur unterstützenden Behandlung bei der Chemotherapie von Infektionen der Harnorgane. Dosierung: Erwachsene 3 mal täglich 10-15 Tropfen bzw. 3 mal täglich 1 Dragee, Kinder 3 mal täglich 5-10 Tropfen mit Flüssigkeit. Die Verabreichung an Kinder soll durch Erwachsene erfolgen. Handelsformen: Packungen N 1 mit 30 ml DM 17,91, N 2 mit 50 ml DM 27,26, N 3 mit 100 ml DM 43,40; N 1 mit 25 Dragees DM 10,88, N 2 mit 50 Dragees DM 17,77, N 3 mit 100 Dragees DM 30,20. Gegenanzeigen: Engwinkelglaukom, Blasenentleerungsstörungen mit Restharnbildung, mechanische Stenosen im Bereich des Magen-Darm-Kanals, Tachyarrhythmie, Megacolon, akutes Lungenödem, Stillzeit. Strenge Indikationsstellung im 3. Trimenon und unter der Geburt. Nebenwirkungen: In Abhängigkeit von der Dosierung und der individuellen Empfindlichkeit können Abnahme der Schweißdrüsensekretion (Wärmestau), Hautrötung, vorwiegend bei Überdosierung zentralnervöse Störungen (z.B. Unruhe, Halluzinationen), Akkommodationsstörungen, Glaukomauslösung (Engwinkelglaukom), Mundtrok- kenheit, Tachykardie und Miktionsbeschwerden auftreten. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Amantadin, Chinidin, tri- und tetrazyklischen Antidepressiva, Neuroleptika: anticholinerge Wirkung verstärkt. Dopaminantagonisten (z.B. Metoclopramid): Gegenseitige Abschwächung der Wirkung auf die Motilität des Magen-Darm-Traktes.GALENIKA DR. HETTERICH GMBH, FÜRTH/BAYERN
Dysurgal® IMWirksto'f: Atropinsulfat
Bei Reizblase Inkontinenz
Dysurie
50 ml N2
?ysurgi>'ot(:A|,opin
^'Rebbl nicht and. ^5-10Tro
's: Atropin '^ßtschreibi
Dysurgar NWirkstoff: Atropinsuffal
50 Dragees N2
Reizblase, Inkontinenz, Dysurie
».HETTERICH
QalenikaGalenika Dr. Hetterich GmbH -90762 Furth/Bay
Fortbildung: Diagnostik vor Schrittmacher-Therapie 159
VT b«i Ergomatrie
wJT
H.S. m. 49 J. RV und LV-OY8PLASIE
Abbildung 3: Belastungsinduzierte monomorphe Kammertachykardie (Zykluslänge 410msek) während einer Ergometrie bei einem 49jährigen Patienten mit arrhythmogener rechts- (RV) und linksventrikulärer (LV) Dysplasie
ken! Die Identifikation vasovagaler Synkopen ist deshalb extrem wichtig. Viele Beobachtungen unterstützen das Konzept, daß ein positiver Kipptischtest mehr oder weniger äquivalent zu spontan auftretenden vasovagalen Synkopen ist(l, 3, 15, 22). Therapeutische Ansätze müssen bei Patienten mit vasovagalen Syn- open und positiver Kipptisch-Untersuchung individuell erarbeitet werden (20). Bei Patienten mit vasovagalen Synkopen ist vor allem die medikamentöse Therapie sinnvoll, eine Schrittmacherimplantation ist ungeeignet. Zahlreiche Substanzen sind zur Prävention vasovagaler Synkopen eingesetzt worden (8), heute scheinen vor allem Betablocker und Disopyramid die Medikamente der Wahl zu sein. Weitere Untersuchungen an größeren Patientenzahlen sind jedoch notwendig.
Carotis-Sinus-Druck-VersuchFür die Abklärung von Patienten mit rezidivierendem Schwindel oder Synkopen ist der Ca- rotis-Sinus-Druck-Versuch fester Betandteil nicht-invasiver Diagnostik. Hierbei soll durch Änderung des nervalen Tonus überprüft werden, ob bei einem Patienten sinuatriale oder atrioventrikuläre Leitungsstörungen provoziert werden können (33). Die Durchführung des Ca- rotis-Sinus-Druckversuches wird durch vorsichtige Massage im Bereich der Bifurkation von Arteria carotis interna und externa für zirka 5 Sekunden durchgeführt. Der Druckversuch sollte zunächst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite erfolgen.
Pathologische Reflexantwort ohne klinische Symptomatik: nur beobachten!
Eine Abnahme der Sinusfrequenz um > 20/min oder eine Pause von > 2 sek sind als pathologisch anzusehen. Es ist wichtig, zwischen Patienten mit klinischer Symptomatik und pathologischem Carotis-Druck-Versuch (Carotis-Sinus-Syndrom) und Patienten mit asymptomatischem Ca- rotis-Sinus-Reflex zu unterscheiden. Während das Carotis-Sinus- Syndrom behandlungsbedürftig ist und eine klare Indikation zur Schrittmacher-Therapie besteht (24), ist eine pathologische Reflexantwort ohne klinische Symptomatik lediglich beobachtungswürdig.
Atropin-TestDer Atropin-Test (0,1mg i.v.) dient vor allem zur Überprüfung der Sinusknotenfunktion. Unter Atropin-Stimulation sollte eine Herzfrequenz >90/min erreicht werden. Ein Erequenz- anstieg von <25% bzw. eine Maximalfrequenz <90/min gelten als Zeichen einer gestörten Sinusknotenfunktion und als Hinweis für ein Sinusknotensyndrom. Die Anpassung der Herzfrequenz an metabolische Bedürfnisse, besonders unter Belastung, ist bei diesem Patienten schlecht, und man spricht auch von chronotro- per Inkompetenz.
Invasive Untersuchungsverfahren
Die Methoden der intrakardialen Elektrokardiographie haben unsere Kenntnisse über Art und Mechanismen von Rhythmusstörungen in großem Maße erweitert. Invasive Techniken haben heute in der klinischen Kardiologie auch therapeutisch einen großen Stellenwert (Katheterablation supraventrikulärer und ventrikulärer Arrhythmien). * •
Carotis-Druck-Versuch: Vor und während der Durchführung sind folgende Maßnahmen unbedingt erforderlich:
• Palpation und Auskultation müssen eine Carotis-Stenose ausschließen, um zu vermeiden, daß ein Druckversuch zur transitorisch ischämischen Attacke oder gar zum apoplekti- schen Insult führt.
• Während des Druckversuches muß unbedingt ein kontinuierliches Monitoring mit permanenter EKG-Aufzeichnung erfolgen.
• Die Möglichkeiten zur notfallmäßigen anti- bradykarden Stimulation müssen verfügbar sein, ebenso wie die intravenöse Gabe von Medikamenten (i.v.-Zugang!).
Fortbildung: Diagnostik vor Schrittmacher-Therapie
Elektrophysiologische UntersuchungJe nach Fragestellung werden bei der elektro- physiologischen Untersuchung mehrere 2-10- polige 6-7-French-Elektrodenkatheter in Lokalanästhesie von der Vena femoralis, brachia- lis oder jugularis im rechten Herzen plaziert. Sie werden im oberen rechten Vorhof, im His- Bündel, Coronarsinus (als Referenz für den linken Vorhof) und rechten Ventrikel lokalisiert {Abb. 4). Zusätzlich können Elektrodenkatheter in den linken Vorhof (über ein offenes Foramen ovale oder nach transseptaler Punktion des Vorhofseptums) und/oder den linken Ventrikel eingebracht werden. Erregungsleitungsstörungen können die sinuatrialen, intraatrialen, atrioventrikulären und intraventrikulären
Abbildung 4: Positionierung von Elektrodenkathetern bei einer elektrophysiologischen Untersuchung (Aufnahme in RAO 30”). Man erkennt 2polige Elektrodenkatheter im oberen rechten Vorhof und im rechten Ventrikel, einen 3-poligen Elektrodenkatheter am His-Bündel und einen lOpoligen Elektrodenkatheter im Sinus coronari- us. Abkürzungen: CS = Sinus coronarius, HIS = His-Bündel, RA = rechter Vorhof, RV = rechter Ventrikel.
Verzögerungen betreffen. Für die Indikation zur Schrittmacher-Therapie sind vor allem Sinusknoten-Funktionsprüfungen und Studien zur atrioventrikulären Überleitung bedeutsam. Besonders in der Abklärung von Patienten mit Synkopen ist aber auch die programmierte rechtsventrikuläre Stimulation (Differentialdiagnose bradykarder oder tachykarder Arrhythmien) bedeutsam.
Prüfung der SinusknotenfunktionSinuatriale Leitungsstörungen oder ein Sinusarrest sind entweder Störungen der Erregungsleitung und/oder der Erregungsbildung. Eine Unterscheidung zwischen komplettem sinuatrialen Block (SA-Block 111”) und Sinusarrest ist nur durch invasive elektrophysiologische Techniken möglich. Die Prüfung der Sinusknotenfunktion durch Bestimmung von Sinusknoten
Totaler Sinu- atrialer Block und Sinusarrest sind im EKG nicht miter- scheidbar
erholungszeit, sinuatrialer Leitungszeiten, Registrierung atrialer Elektrogramme und sinuatrialer Refraktärzeiten sind hilfreich zur Entscheidung einer notwendigen Schrittmacherimplantation [Kasten 3). Häufig werden diese Befunde ergänzt durch medikamentöse Interventionen mit dem Ziel einer autonomen Blockade. Bei der Sinusknotenerholungszeit (SKEZ) wird eine Stimulation des rechten Vorhofs mit Frequenzen durchgeführt, die oberhalb der spontanen Sinusfrequenz liegen. Ein typisches Protokoll wird mit Stimulationsfrequenzen von 80, 100, 120, 140 und 160/min über 60sek durchgeführt. Anschließend wird die Zeit vom letzten stimulierten Vorhofkomplex bis zur nächsten Sinusknotenaktion bestimmt.Als Beurteilung der Sinusknotenfunktion wird die korrigierte Sinusknotenerholungszeit herangezogen (SKEZ minus Zykluslänge bei Sinusrhythmus). Als normal gilt eine korrigierte SKEZ<550msek (23).
Prüfung der AV-KnotenfunktionDer AV-Knoten ist für die zeitlich geordnete Kontraktion von Vorhöfen und Kammern verantwortlich. Er verzögert die anterograde Erregung und hat darüber hinaus die Eunktion eines Eilters, der die Kammern vor hochfrequenten Erregungen der Vorhöfe schützt. Die elektrische Erregung läuft vom Sinusknoten •
Formen der elektrophysiologischen Untersuchung
Stimulation des rechten Vorhofs• Schnelle Vorhofstimulation• Sinusknotenerholungszeit• Atriale Einzelstimulation• Bestimmung atrialer Refraktärzeiten• Atriales Kathetermapping mit Bestimmung
sinuatrialer Leitungszeiten• Beurteilung der Einflüsse einer autonomen
Blockade
His-Bündel-Elektrokardiogramm• Bestimmung der AH-Zeit• Bestimmung der HV-Zeit• Diagnostik atrioventrikulärer Leitungs
störungen• Diagnostik intranodaler Leitungsstörungen• Diagnostik infrahissärer Leitungsstörungen
Stimulation des rechten Ventrikels• Ventrikuläre Einzelstimulation• Burststimulation• Bestimmung ventrikulärer Refraktärzeiten• Ventrikuläres Kathetermapping.
Fortbildimg: Diagnostik vor Schrittmacher-Therapie ZEA. 161
Über den AV-Knoten und das His-Bündel zur Kammer. Die charakteristischen elektrophysio- logischen Befunde sind intrakardiale Elektro- gramme vom Vorhof (»A«), His-Bündel (»H«) und Ventrikel (»V«). Die normalen Zeit-Intervalle betragen für die AH-Zeit 50-120 msek und für die HV-Zeit 35-45 msek {Abb. 5). Die Dauer des Erregungsablaufs im His-Bündel liegt bei 15-20msek. Die invasive elektrophysiologische
lIllllllllllimllllllllllllllll.Miliiiilniiliiiiliniliiiiliiiiliiiili
Abbildung 5: Registrierung von Oberfläcben-EIektrokardiogrammen I, II, aVR, VI, V2 und V6 und 3 intrakardialen Elektrogrammen vom oberen rechten Vorhof (HRA), His-Bündel (HBE) und rechtsventrikulärem Apex (RVA), 25jährige Frau mit rezidivierenden Synkopen. Man erkennt Potentiale aus Vorhof (»A«), His-Bündel (»H«) und rechtem Ventrikel (»V«). Die gemessenen Intervalle (AH-Intervall und HV-Intervall) sind völlig unaulTällig.
Untersuchung (EPU) kann bei symptomatischen Patienten zur Beurteilung der AV-Über- leitung herangezogen werden (31) [Kasten 4). Eine EPU ist nicht indiziert bei symptomatischen Patienten mit höhergradigen AV-Blockie- rungen, die durch Oberflächen-EKG und/oder Langzeit-EKG dokumentiert sind, da bei diesen Patienten die Indikation zur Schrittmacherimplantation durch die nachgewiesenen eindeutigen Befunde bereits gegeben ist.
Prüfung von His-Bündel und intraventrikulärem LeitungssystemDie His-Bündel-Elektrokardiographie ist ohne Zweifel ein geeignetes Verfahren, um bei Patienten mit Leitungsstörungen den Ort der Blok- kierung exakt festzulegen (34, 35). Besonders bei Patienten mit atrioventrikulären Blockierungen ist eine genaue Lokalisation des Blocks möglich und es kann unterschieden werden, ob intranodale oder z.B. intrahissäre Blockierungen vorliegen. Auffällige intrakardiale Befunde sind bei intrahissären Leitungsblockierungen die Splittung des His-Bündel-Signals {Abb. 6), während bei intrahissären Blockierun-
Indikationen zur elektrophysiologischen Untersuchung
Verdacht auf Sinusknotenfunktionsstörungen• Symptomatische Patienten (Präsynkope,
Synkope, Schwindel) mit pathologischem EKG• Symptomatische Patienten mit normalem EKG• Klinischer Verdacht einer Sinusknoten
erkrankung
Verdacht auf AV-Leitungsstörungen• Symptomatische Patienten mit unklarer
Indikation zur SM-Implantation
Beurteilung intrakardialer Elektrophysiologie vor SM-Implantation• Analyse der atrio-ventrikulären Leitung• Analyse der ventrikulo-atrialen Leitung
Patienten mit zusätzlichen Tachykardien• Analyse der Art der Tachykardie• Beurteilung der Mechanismen• Abklärung der Indikation zur Ablation
Verdacht auf AV-Knoten-Leitungsstörungen• Symptomatische Patienten (Präsynkope,
Synkope, Schwindel) mit pathologischem EKG• Analyse des Ortes der Leitungsstörung
Intraventrikuläre Leitungsstörung• Ausschluß alternierender Schenkelblockbilder• Symptomatische Patienten (Präsynkope,
Synkope, Schwindel) mit komplettem Schenkelblockbild
• Differentialdiagnose bradykarder Arrhythmie• Differentialdiagnose tachykarder Arrhythmie.
Abkürzung: SM = Schrittmacher
gen eine regelrechte Überleitung vom Vorhof über den AV-Knoten bis zum His-Bündel verläuft (AH-Intervall), und daß dann eine Leitungsblockierung erfolgt (fehlender Ventrikel- Spike nach dem His-Potential) {Abb. 7). Darüber hinaus läßt sich exakt festlegen, ob eine regelrechte Überleitung von atrialen Impulsen auf AV-Knoten und Kammer vorliegt oder bereits die Leitung vom Vorhof auf den AV-Kno- ten blockiert ist und die klinische Symptomatik wie Schwindel und/oder Synkopen auf eine unzureichende atrioventrikuläre Leitung zurückzuführen ist. Die Entwicklung von intraventrikulären Leitungsstörungen ist besonders bei Patienten nach Myokardinfarkt nicht ungewöhnlich (35). In der akuten Infarktphase ist die Entwicklung eines Schenkelblockbildes Anzeichen eines ausgedehnten Infarktes und charakterisiert Patienten mit erhöhtem Risiko eines kardialen Pumpversagens oder plötzlichen Herztodes (27, 28). Die Problematik dieser Patienten besteht zudem in der Entwicklung eines kompletten AV-Blocks (16). Während
Fortbildung: Diagnostik vor Schrittmacher-Therapie
Hi..,8,12.10.61
/ *'*» '■ A
Abbildung 6: Oberfläehen-EKG-Ableitungen I, II, III, aVR und aVL und intrakardiale Abi. vom oberen rechten Vorhof (RA) und vom His- Ründel (HRE), 34jährige Erau mit rezidivierendem Schwindel. Man erkennt bereits während Sinusrhythmus (»links«), daß die AH-Zeit (90msek) normal ist, aber verlängerte HV-Zeit (80 msek) vorliegt. Bei Stimulus (S) aus dem rechten Vorhof (»rechts«) Nachweis einer intrahissären Leitungsblockierung (»Splittung« des His-Slgnals)
kein Zweifel an der Indikation zur Schrittmacherimplantation bei Patienten mit alternierenden Schenkelblockbildern besteht (34), ist die Situation bei Patienten mit komplettem Schenkelblock und klinischen Zeichen wie Schwindel, Präsynkopen oder Synkopen nicht so klar, so daß für diese Patienten eine elektro- physiologische Untersuchung notwendig ist. Dabei muß geklärt werden, ob die klinische Symptomatik durch eine Störung von Sinusknotenfunktion, sinuatrialer Leitung und/oder atrioventrikulärer Überleitung hervorgerufen wird, oder aber (bei ausgedehnter Schädigung des linken Ventrikels) Ausdruck einer tachykar- den Rhythmusstörung ist. Diese Abgrenzung ist von entscheidender Bedeutung für die Therapie; Während bei symptomatischen Patienten mit nachgewiesenen Leitungsstörungen die Indikation zur Schrittmacher-Therapie gegeben ist, sollte bei Patienten mit Synkopen, schlechter linksventrikulärer Funktion und auslösbaren tachykarden ventrikulären Arrhythmien die Indikation zur Defibrillatortherapie oder alternativen Verfahren diskutiert werden (29,30).
Programmierte VentrikelstimulationDie programmierte Ventrikelstimulation wird vor allem zur Abklärung ventrikulärer Rhythmusstörungen eingesetzt (32). Sie erfolgt üblicherweise über einen 2poligen Elektrodenkatheter, der meistens zunächst in der Spitze des rechten Ventrikels und später im rechtsventrikulären Ausflußtrakt plaziert wird. Die Stimulation erfolgt in der Regel mit verschiedenen Zykluslängen (330-600msek) und 1-3 Extrastimuli unterschiedlicher Kopplungsintervalle. Mit dieser Methode kann abgeklärt werden, ob Synkopen durch bradykarde oder tachykarde Rhythmusstörungen hervorgerufen sind. Besonders bei Patienten mit einge-
Hi..,?, 12.10.61
A H V
A H
Abbildung 7: OberIlächen-EKG-Ableitungen und intrakardiale Ableitungen bei der Pat. aus Abb. 3. Ein atrialer Stimulus (S) zeigt eine deutliche Verlängerung der HV-Zeit (140 msek) (»oben«), eine Verkürzung des Stimulus führt zur infrahissären Blockierung (»unten«)
schränkter linksventrikulärer Punktion (nach Infarkt, Kardiomyopathie oder Klappenfehlern) und Synkopen in der Anamnese ist zu klären, ob die Bewußtseinsverluste durch Bradykardien erklärt werden können (und der Patient damit Kandidat für eine Schrittmacherimplantation ist) oder aber ob tachykarde Rhythmusstörungen vorliegen (Kammertachykardien und/oder Kammerflimmern) und der Patient damit eher einer nichtmedikamentösen Therapie zugeführt werden sollte (27, 30).
Literatur kann beim Verlag oder beim Verfasser angefordert werden!
Autor: Prof. Dr. med. Hans-Joachim Trappe, Abteilung Kardiologie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Konstanty-Gutschow-Str. 8,30625 Hannover.
Beruflicher Werdegang: Facharztausbil- dung Innere Medizin. Seit 1983 an der Medizinischen Hochschule Hannover. 1990 Habilitation, 1994 Ernennung zum apl. Professor.
Zur Person
Co-Autorin:MHH.
Dr. med. Petra Pfitzner,
Fortbildung 'ZIFA 163
Hans-Joachim Trappe, Petra Pfitzner und Klaus Gille
Notfälle und Komplikationen nach Schrittmacher-ImplantationHinweise auf Fehlfunktionen
Der Verdacht einer Fehlfunktion eines implantierten Schrittmachersystems erfordert eine umgehende Klärung, da bei einer fehlerhaften Impulserkennung und/oder fehlenden bzw. fehlerhaften Stimulation das Leben des Patienten bedroht sein kann. Neben der klinischen Untersuchung sind die exakte Erhebung der Anamnese und die Erfassung von Indikation, Implantation und bisheriger Nachsorge des Schrittmacherpatienten wesentlich. Eine Beurteilung ist selbstverständlich nur möglich, wenn Art und Eunktionsweise des implantierten Elektrodensystems und des Generators bekannt sind (Schrittmacherausweis des Patien,- ten!). Auch müssen entsprechende Abfrage- und Programmiergeräte zur Prüfung der einzelnen Parameter vorhanden sein.
Klinische Hinweise für Eehlfunktionen eines Schrittmachersystems sind Synkopen, Schwindel, Palpitationen, Bradykardie, Tachykardie, Schmerzen im Bereich des Generators und auffällige Lokalbefunde wie Schwellung, Rötung, Abszeßbildung, Eluktuation oder Überwärmung des Gewebes im Bereich von Generator
Die Schrittmacher-Therapie führt bei richtiger Indikation und Auswahl des richtigen Sy-
stems zweifellos zu einer Verbes- serung von klinischer Symptomatik, Lebensqualität und Progno
se. Komplikationen sind zwar relativ selten, können aber im Einzelfall zu einer erheblichen Bedrohung oder sogar zum Tod eines Patienten führen. Fehlfunktionen sind im Bereich des Schrittmachergenerators und/oder des Elektrodensystems möglich. Patienten bedürfen daher nach Implantation regelmäßiger Kontrollen. Neben einer genauen Erhebung von Anamnese und klinischem Befund ist besondere Sorgfalt bei der Überprüfung von Generator und/oder Elektrodensystem notwendig.
und/oder Elektrodensystem. Pathologische Stimulationen mit Zwerchfellzuckungen oder abnormen Muskelzuckungen werden in der Regel spontan berichtet und sind klinisch leicht zu diagnostizieren. Bei der körperlichen Untersuchung sollte besonders nach Zeichen pathologischer Stimulationen, Halsvenenstauung, »Kanonen-A-Wellen« im Bereich der Halsvenen sowie auf pathologische Auskultationsbefunde geachtet werden. Häufig erlauben Lagewechsel oder Armbewegungen bereits die Diagnose einer Sondendislokation oder eines Isolationsdefektes, wenn durch diese Bewegungen Stimulationsartefakte oder die Inhibierung des Schrittmachersystems provoziert und beobachtet werden können.
Der Verdacht einer Eehlfunktion eines Schrittmachersystems muß zur 12-Kanal-EKG-Regi- strierung und zur Röntgen-Thorax-Aufnah- me führen (eventuell mit Zielaufnahme der verdächtigen Region), bei manchen Patienten sind auch Belastungsuntersuchungen, Langzeit- EKG oder transthorakale bzw. transösophageale echokardiographische Studien sinnvoll. Besonders das EKG gibt wichtige Hinweise auf Schrittmacherdysfunktionen. In vielen Fällen sind Änderungen z.B. der Morphologie des QRS-Komplexes oder Änderungen der elektrischen Achse erste Anzeichen einer fehlerhafter Schrittmacherfunktion. Zu den technischen Untersuchungen gehört selbstverständlich die Abfrage des Schrittmacher-Systems mit einem speziellen Programmiergerät. Auf andere Untersuchungstechniken, die im Rahmen von speziellen Komplikationen (z.B. Infektionen) Anwendung finden, soll in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen werden.
Intraoperative und/oder perioperative Komplikationen
Komplikationen nach Schrittmacherimplantation können intraoperativ, früh postoperativ (»frühe« Komplikationen) oder erst im Verlauf (»späte« Komplikationen) auftreten {Tab. l).ln-
Z. Allg. Med. 1996; 72: 163-171. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
Fortbildung: Notfälle und Komplikationen
traoperative Komplikationen ergeben sich meistens durch Probleme bei der Elektrodenplazierung und können folgenschwer sein, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Die sicher schwerwiegendste Komplikation ist die Perforation des Ventrikels (Häufigkeit zirka 1%) mit Herzbeuteltamponade, meistens bedingt durch robustes Vorschieben der durch einen Mandrin verstärkten Schrittmacherelektrode. Bei manchen Patienten sind trotz Perforation des Myokards intraoperativer und postoperativer Verlauf völlig unauffällig und erst ein Zwerchfellzucken oder ein Anstieg der Schrittmacherschwelle und/oder auffällige
fäße selbst sind somit möglich, ebenso Verletzungen der begleitenden Arterien. Komplikationen wie Pneumothorax (Häufigkeit 0,4%) oder Hämatothorax werden in der Regel früh (< 48 Stunden nach Implantation) erkannt.
Dislokationen von Elektroden gehören nach Schrittmacherimplantation zu den häufigsten Komplikationen, sie werden besonders bei Patienten mit rarefiziertem rechtsventrikulären Trabekelwerk oder bei diktierten Herzhöhlen beobachtet (17, 18). Die Häufigkeit beträgt bis zu 20% (21). Besonders bei Patienten mit implantierten DDD-Schrittmachersystemen ist
Tabelle 1: »Frühe« und »späte« Schrittmacher-Komplikationen
Früh Spät Früh oder spät
Pneumothorax Thromboembolie Dislokation der ElektrodeHämatothorax Elektrodendefekt SM-ArrhythmienSubkutanes Emphysem Anstieg der Reizschwelle SM-SyndromPerforation Batterieerschöpfung BatterieerschöpfungVerletzung der Arterie Twiddler-Syndrom KonnektorproblemeVerletzung des Plexus brachialis Drucknekrosen InfektionAllergie InfektionInfektionWundheilungsstörungenLungenemboliePath. Stimulation Path. Stimulation Path. Stimulation
Abkürzung; path. = pathologisch, SM = Schrittmacher
elektrokardiographische bzw. röntgenologische Befunde lenken den Verdacht auf eine mögliche Perforation (27). Auch tödliche Verläufe durch Perikardtamponade mit Blutdruckabfall, venöser Einflußstauung und Pumpversagen nach Perforation sind beschrieben (19).
Klinische Zeichen einer Perforation sind neben auffälligen Befunden wie Hypotension, Halsvenenstauung und Pulsus paradoxus (bei Perikardtamponade) Perikarditis, Perikarderguß und Zwerchfellzuckungen. Im Fall einer Perikardtamponade soll
te rasch eine Perikardpunktion zur hämodyna- mischen Entlastung durchgeführt werden, gefolgt von einer umgehenden Revision der Elektrode.
Die häufigsten Zugangswege zur Schrittmacherimplantation sind die Vena cephalica, Vena subclavia, Vena jugularis externa und Vena jugularis interna. Diese Gefäße werden in der Regel punktiert; Fehlpunktionen der Ge-
Trotz Perforation kann der postoperative
Verlauf anfangs unauffällig sein!
eine Dislokation der Vorhofelektrode bekannt {Ahh. la. b). Klinische Zeichen sind Fehlfunktionen des Schrittmachersystems mit inadäquater Erkennuiigs- und Stimulationsfunktion bzw. einem Anstieg der Stimulationsreizschwelle. Besonders postoperativ auftretende Elektrodendislokationen sind röntgenologisch leicht zu diagnostizieren, während spät aufgetretene Dislokationen (besonders Mikrodislokationen) oft nur schwer zu beweisen sind. Die Therapie besteht in einer chirurgischen Revision mit erneuter Plazierung der Schrittmacherelektrode.
Eine gefürchtete frühe Komplikation ist die Infektion von Schrittmachertasche und/oder Elektrodensystem, sie geht mit einer erhöhten Morbidität und Letalität einher (3, 12). Die Inzidenz solcher Infektionen wird mit 1-12% angegeben (28). Klinische Zeichen einer Frühinfektion (1-6 Monate postoperativ) sind manifeste Entzündungszeichen mit Rötung, Schwellung und/oder Abszeßbildung im Be-
Fortbildung: Notfälle und Komplikationen
Abbildung 1 a: Röntgen-Tborax-Bild (seitUcber Strablen- gang) eines 40jäbrigen Patienten nach Implantation eines DDD-Scbrittmachersystems bei rezidivierenden Synkopen und AV-Block III. Grades. Man erkennt regelrechte Positionen der atrialen und ventrikulären Elektroden
Abbildung Ib: Röntgen-Thorax des gleichen Patienten wie in Abb. la. Dislokation der atrialen Elektrode früh postoperativ (36 Stunden nach Schrittmacherimplantation). Verlagerung auch der ventrikulären Schrittmacherelektrode
reich der Schrittmachertasche verbunden mit Fieber, Leukozytose und einem erhöhten C-re- aktiven Protein. Der typische Keim einer Frühinfektion, meistens bedingt durch unexakte operative Asepsis mit Wundkontamination, ist Staphylococcus aureus, z.T. werden aber auch Pseudomonas aeruginosa oder gramnegative Bakterien beobachtet. Über das geeignete Vorgehen bei Schrittmacherinfektion sind die Meinungen kontrovers: Während einige Autoren bereits beim Verdacht einer Schrittmacherinfektion unverzüglich die Entfernung von Schrittmacheraggregat und Elektrodensystem
Bei gesicherter Infektion muß das Schrittmachersystem sofort entfernt werden!
durchführen, sehen andere zunächst die Notwendigkeit einer antibiotischen Therapie mit Keimnachweis. Es scheint klar, daß bei Zeichen einer gesicherten flori- den Infektion unverzüglich eine operative Entfernung von Generator und Elektrodensystem erfolgen muß, um ein Eortschreiten der Infektion zu vermeiden. Da sich eine Infektion vom Bereich der Schrittmachertasche entlang der Elektrode ausbreiten kann, muß das gesamte Schrittmachersystem entfernt werden.
Spätkomplikationen
Zu den Spätkomplikationen des Schrittmacher- * * Patienten gehören vor allem Fehlfunktionen von Generator und Elektrodensystem. Kennzeichen solcher Fehlfunktionen liegen in einer fehlenden Stimulation (kein Stimulusartefakt), in einer fehlenden Stimulation bei vorhandenem Stimulusartefakt und/oder in fehlerhafter Impulserkennung.
Infektionen entstehen oft bei Wundheilungsstörungen oder im Gefolge von Drucknekrosen. Komplikationen wie das Schrittmacher- Syndrom und Schrittmacher-induzierte Tachykardien sind eher seltene Probleme, die durch Interaktionen von Schrittmacher und Erregungsleitungssystem bedingt sind (20). Beim Pacemaker-Twiddler-Syndrom kommt es zu einer ineffektiven Stimulation, da sich durch Bewegungen des Schrittmachers in seiner Tasche die endokardiale Elektrode um das Aggregat wickelt. Elektrodenbrüche infolge von Materialermüdung, durch Druck-, Zug- oder
1Ursachen fehlender Schrittmacherstimulation (kein Stimulusartefakt)
• Batterieerschöpfung• Batteriedefekt• Kabelbruch• Oversensing
a) Elektromagnetische Interferenzenb) Muskelpotentialec) Pathologische Potentiale bei Isolationsdefektd) Pathologische Potentiale bei Elektrodenbruch
• Fehlerhafte Konnektion von Elektrode und Generatora) Unipolare Elektrode im bipolaren Generatorb) Bipolare Elektrode mit unipolarer Programmierung.
166 Fortbildung: Notfälle und Komplikationen
Ursachen fehlender Schrittmacherstimulation (Stimulusartefakt vorhanden, aber kein folgender QRS-Komplex)
• Elektrodendislokationa) Mikrodislokationb) Makrodislokation
• Elektrodenbruch• Reizschwellenanstieg
a) akut postoperativb) früh postoperativc) spät postoperativ
• Myokardinfarkt• Metabolische Ursachen (Azidose, Alkalose,
Hypoxie)• Elektrolytentgleisungen (Hyperkaliämie)• Medikamente (Encainid, Flecainid,
Propafenon, Sotalol)• Myokardperforation• Fehlerhafte Elektrodenlage
a) Sinus coronariusb) Vena gastrica
• Fehlerhafte Konnektion• Batterieerschöpfung.
Abscherspannungen sind in der Regel im Röntgenbild (Übersichts- und/oder Zielaufnahmen) zu erkennen. Die Häufigkeit schwankt zwischen 0,9%und 7,8% (14, 25). Isolationsdefekte der Elektrode und Diskonnektionen zwischen Elektrodensystem und Generator können zu Eehlfunktionen führen, sie sind klinisch oft nur schwer erkennbar. Hinweise können Stimulationsausfälle bei anderweitig nicht erkennbaren Ursachen sein. Die Diagnosen werden häufig erst intraoperativ gesichert. Alle Störungen bzw. Eehlfunktionen des Elektrodensystems erfordern eine rasche chirurgische Intervention. Defekte des Schrittmachergenerators werden heute nur noch sehr selten beobachtet. Ihre Lebensdauer beträgt etwa 6-10 •
------------------------------- 3 -----------------------------------Ursachen fehlerhafter Impulswahrnehmung
• Änderungen des QRS-Komplexesa) Schenkelblockbildb) Kammertachykardiec) Kammerflimmernd) Vorhofflimmern/flattern
• Myokardinfarkt• Schlechte Elektrodenposition• Elektrodendislokation
a) Makrodislokationb) Mikrodislokation
• Elektromagnetische Interferenzen
Jahre, Eehlprogrammierungen können sie allerdings verkürzen. Hinweise sind neben der Erequenzabnahme bei einigen Schrittmachertypen der Verlust der QRS-Steuerung. Ein Abfall der Stimulationsfrequenz oder eine akut aufgetretene Erequenzabnahme muß zur umgehenden Klinikeinweisung führen. Isolationsdefekte und Elektrodenbrüche kommen auch im Langzeit-Verlauf vor. Sie führen zu Reizschwellenanstiegen, einer ineffektiven Stimulation, Reizungen des Zwerchfells oder der Pek- toralismuskulatur (17). Elektrodenbrüche oder Isolationsdefekte finden sich meistens im Bereich des Generators oder an der Einmündung der Elektrode in die verwendete Vene (9). Reizschwellenanstiege sind in den ersten Wochen nach Schrittmacherimplantation nicht ungewöhnlich, sie erreichen nach etwa 2-6 Wochen ihre Maximalwerte. Kommt es nach diesem Zeitraum zu weiteren Reizschwellenanstiegen, ist eine Schrittmacherstimulation nicht mehr möglich. Es liegt ein »Exit Block« {Ahh. 2) vor, der die Revision und/oder Neuplazierung des Elektrodensystems nötig macht (10, 22). Neuere Elektroden mit Steriodköpfen haben zur deutlichen Reduktion von Reizschwellenanstiegen geführt (13, 24, 26).
Spätinfektionen treten mehr als 6 Monate nach Schrittmacherimplantation auf, im Vergleich zur Erühinfektion ist der Infektionsverlauf eher protrahiert. Die klinischen Befunde sind oft diskret, typische Abszeßzeichen fehlen in aller Regel. Meistens ist die Aggregattasche betroffen. Eür die Diagnose ist der Lokalbefund
Abbildung 2: 6-Kanal-EKG-Registrierung (Standard-Extremitäten- Ableitiingen I, II, III, aVR, aVL, aVF) bei einem Patienten mit rezidivierendem Schwindel, 8 Monate nach Implantation eines W1,R- Schrittmachers. Man erkennt, daß durch überschießenden Reizschwellenanstieg eine reguläre Schrittmacherlünktion durch Ausbildung eines »Exit blocks« nicht mehr möglich ist. Man erkennt auf der einen Seite Schrittmacher-Spikes, die nicht zur Depolarisation und zur konsekutiven Kammeraktion führen (links), auf der anderen Seite findet man aber auch einen regulär stimulierten QRS-Komplex (rechts)
Sandoz A6 .■■;‘<327 NürnbergBriserin®'0 Zusamni. -tzung: 1 Dragee Briserin N enthält: Ar, •:: ''ch wirksame Bestandteile: 5,0 mg Clor ^ iicr 0,1 mg Reserpin. Andere Bestandteil . Arabisches Gummi, Cetylal- kohol, Lactos;., Macrogoi 6000, Polyvinyi- pyrrolidon, -'-".innsäure, Talkum, Farbstoffe El 20 un-,Ä Anwer -./^gebiete; Alle Formen der Flypertoni-B Gegen ■ ' Überempfindiichkeit gegen Suli . •■mide oder andere Inhaltsstoffe, sei: Niereninsuffizienz, Glome-rulonephri", Coma hepaticum, frischer Herzinfar:-,' '.'zpression in der Vorgeschichte, i i -i ■'':tfesistente Hypokaliämie, Flyponatf'.' iv, :-;vperkalzämie, akutes Magenges' :;,- Colitis ulcerosa, Elek- troschockti ■ ;• ip Bei schwerer Koro- narinsuffizi '' ^ id schwerer Zerebralsklerose nur löbliche Senkung des Blutdrucks i.r sorgfältiger Überwachung, deshalb seh" i-ingsamer Dosierungsaufbau, Schwanger: ■ ■:.Stillzeit.R Nebenv,: sagen: Vereinzelt Störungen des ii-Oarm-Trakts (Übelkeit, Erbrechen, •'.■.'mpfartige Beschwerden, Verstopfu'M- ; ;j.chfall). Aufgrund des geringen Rc- 'pingehaltes sind Nebenerscheinungen V i;. depressive Verstimmung oder "verst Nase" sehr selten. Bei höheren Dos,2,i kann es zu Kreislaufstörungen mir Slutdruckabfall, Schwindel und Müdig'r.-'i- (orthostatische Beschwerden) komm-:-' Sei langfristiger kontinuierlicher Einnahme sind Elektrolytverluste (Kalium, Natrium, Magnesium, Chlorid) mit Muskelverspannungen und Wadenkrämpfen möglich. Mm insbesondere einer Verminderung des Biut-Kalium-Gehalts vorzubeugen, ist eine kaliumreiche Ernährung empfehlenswert. Hyperkalzämien (äußerst selten). Extrem selten (nur unter hoher Dosierung von Ciopamid): Mundtrockenheit, Kopfsohmer ten, Herzklopfen, Thromboseneigung (insbesondere bei Venenerkrankungen), Sehstörungen, Erhöhung der Blutfettwerte, Harnstoff- und Kreatininanstieg, Gelbsucht, akute Cholecystitis bei bestehender Cholelithiasis und Pankreatitis. Clopamid kann, wie andere Diuretika auch, eine diabetische Stoffwechsellage beeinflussen. Bei Diabetikern sollte daher der Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrolliert werden. Bei Gichtpatienten kann der Harnsäurespiegel weiter ansteigen. Überempfindlichkeitsreaktionen oder Blutbildveränderungen sind äußerst selten.
D Besonderer Hinweis: Bei Niereninsuffizienz kann die blutdrucksenkende Wirkung von Briserin N weniger ausgeprägt sein. Die Nierenfunktion ist sorgfältig zu überwachen, da sie durch die Behandlung mit blutdrucksenkenden Arzneimitteln weiter herabgesetzt werden kann. Bei der Hochdruckbehandlung mit diesem Arzneimittel regelmäßige ärztliche Kontrolle. Fähigkeit zur aktiven Straßenverkehrsteilnahme oder Maschinenbedienung kann beeinträchtigt sein - insbesondere bei Behandlungsbeginn, Präparatewechsel, sowie im Zusammenwirken mit Alkohol.81 Dosierung: Grundsätzlich wird die Therapie mit 1 Dragee täglich begonnen und nur erforderlichenfalls auf 2 oder maximal 3 Dragees erhöht. Zumeist genügt 1 Dragee täglich.* Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Wechselwirkungen sind möglich mit: Alkohol, Mitteln, die ebenfalls den Blutdruck senken oder zentral dämpfend wirken, Glucocorticoiden, Abführmitteln, nichtsteroidalen Antirheumatika, Lithiumsalzen, blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln, Levodopa und MAO-Hemmern. Weitergehende Angaben entnehmen Sie ^tte der Fachinformation.
Handelsformen: Originalpackungen zu 30 (Ni), 60 (N2) und 100 (N3) Dragees DM 26,35; 47,33 und 65,42. Verschreibungspflichtig. Alle Angaben nach dem Stand bei Drucklegung, November 1995.
SANDOZ
Auf Erfahrung vertrauen...
BriserinlM^In vielen Bereichen des menschlichen Lebens ist
langjährige Erfahrung durch nichts zu ersetzen.
Dies gilt besonders, wenn es um die Gesundheit
ihrer Patienten geht. Fast 100 Millionen Verordnun
gen stehen hinter den bewährten Inhaltsstoffen von
Briserin®N. Sie sind zuverlässig wirksam und gut
verträglich. Briserm®N ist zudem außerordentlich
preisgünstig und eines der meistverordneten Anti
hypertonika Deutschlands.
Der sichere Weg in der Hochdrucktherapie
Muskelrelaxans
Ortotonbeweglich, schmerzfrei und hellwach
Ortoton® tV/rtefo/f.-Methocarbamol. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Methocarbamol 750 mg; Natriumdodecylsulfat, Polyvidon, Carmellose-Natrium, Stearinsäure, Magnesium- stearat. Ortoton® K.I.S. Wirkstoff: Methocarbamol. Zusammensetzung: 1 Ampulle enthält Methocarbamol 1.000 mg; Macrogol 300, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Schmerzhafte Verspannungen und Krämpfe der Skelettmuskulatur bei degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule und der Gelenke. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, Schwangerschaft, Kinder unter 12 Jahre. Nur Ampulle: Nierenerkrankungen, Vorsicht bei Epilepsie. Nebenwirkungen: Gelegentlich Benommenheit, Schwindelanfälle, Mattigkeit und leichte Übelkeit. Selten allergische Erscheinungen. Nur Ampulle: Brennen an der Injektionsstelle, in Einzelfällen Synkopen. Verschreibungspflichtig. Dosierung und Anwendung: 3mal 2 Tabletten täglich, anfangs 4mal 2 Tabletten täglich, max. 10 Tabletten pro Tag einnehmen. Ampulle intravenös oder intramuskulär injizieren oder als intravenöse Kurzinfusion verabreichen. 10-30 ml pro Tag, maximal 90 ml in 3 Tagen. Handelsformen und Preise: 50 Tabletten (N 2) DM 35,35, 100 Tabletten (N3) DM 65,34, 200 Tabletten DM 121,04; 3 Ampullen mit je 10 ml (N 1) DM 27,68, 9 Ampullen mit je 10 ml (N 2) DM 73,38 Ortoton* Plus Zusammensetzung: 1 Tablette enthält Methocarbamol 400 mg, Acetylsalicylsäure 325 mg; Cellulose, Maisstär
ke, Natriumcarboxymethylstärke, Talkum, Stearinsäure, Magnesiumstearat, Polyvidon, Natriumdodecylsulfat. Anwendungsgebiete: Schmerzhafte Verspannungen der Skelettmuskulatur bei degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule und der Gelenke; Weichteilrheumatismus. Gegenanzeigen: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, krankhaft erhöhte Blutungsneigung. Vorsicht bei gerinnungshemmenden Arzneimitteln, bei Glucose- 6-Phosphatdehydrogenasemangel, bei Asthma, bei Überempfindlichkeit gegen Salicylate und Methocarbamol, bei Magen- oder Zwölffingerdarmbeschwerden, bei vorgeschädigten Nieren, Kindern unter 12 Jahren und in der Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Magenbeschwerden, Magen-Darm-Blutverluste, selten Überempfindlichkeitsreaktionen, Benommenheit und leichte Übelkeit, reversibler Anstieg der Transaminasen bei hochdosierter Dauertherapie, sehr selten Thrombozytopenie. Hinweis: Einige Magenmittel (Antacida) können die für bestimmte Indikationen erforderlichen hohen, kontinuierlichen Salicylat-Blutspiegel beeinträchtigen. Verschreibungspflichtig. Dosierung und Anwendung: Anfangsdosis 4mal 2 Tabletten täglich, in sehr schweren Fällen 4mal 3 Tabletten täglich einnehmen. Weiterbehandlung 3mal 1-2 Tabletten täglich. Handelsformen und Preise: 50 Tabletten (N 2) DM 38,38, 100 Tabletten (N 3) DM 70,13, 200 Tabletten DM 133,07 Bastian-Werk GmbH,81245 München Stand 06/1995
A
^3
Ortoton® K.I.S.Kurzzeit-Infusions-System
Muskelrelaxans
Ortoton®Muskelrelaxans
Ortoton® PlusanalgetischesMuskelrelaxans
Fortbildung: Motfälle und Komplikationen
Reizschwellenanstiege durch Medikamente!
Bretylium, Encainid, Flecainid, Morizicin, Propafenon und Sotalol führen sicher zu Reizschwellenanstiegen.
Mögliche Reizschwellenanstiege wurden bei Betablocker-Behandlung, Lidocain, Procainamid und Chinidin-Präparaten beobachtet.
wegweisend (Rötung, Schwellung, Dekubitus). Bei Frühinfektionen wird vor allem Staphylococcus aureus nachgewiesen, bei Spätinfektionen Staphylococcus epidermidis. Pathogenetisch ist an fehlende intraoperative Asepsis zu denken, an Drucknekrosen bei zu großen Schrittmachern und an verminderte Infektabwehr bei Patienten mit Erkrankungen des Immunsystems, Diabetes mellitus oder Neoplasien (5, 16). Auch bei Spätinfektionen von Schrittmachersystemen ist die operative Entfernung von Generator und Elektrodensystem anzustreben (15).
Schrittmachersyndrom
Das Schrittmachersyndrom wird bei zirka 5-10% der Patienten bei ventrikulärer Stimulation beobachtet. Es ist charakterisiert durch Palpitationen, Wahrnehmung von Pulsschlägen im Hals, Schwindel, Präsynkopen, Beklem- mungs- oder Angstgefühle. Es kann auch negative hämodynamische Auswirkungen haben, die sich in Dyspnoe oder mangelnder Leistungskapazität äußern. Die Symptomatologie ist im wesentlichen die Folge eines vorübergehenden oder dauernden Verlustes der normalen AV- Synchronizität, deren ausgeprägteste Form die retrograde 1:1-ventrikuloatriale Überleitung ist. Durch den Verlust der AV-Synchronizität, die beim Wechsel von ventrikulärer Stimulation zum Sinusrhythmus auftritt, kommt es unter Umständen zu einer ausgeprägten Senkung des systolischen arteriellen Druckes und zu einer Reduktion des Herzzeitvolumens. Die Gegenregulation durch periphere Vasokonstriktion tritt meistens mit zeitlicher Verzögerung auf und ist oft unzureichend wirksam; dieses pa- thophysiologische Phänomen ist als das Korrelat für die gesamte Symptomatik des Schrittmachersyndroms aufzufassen. Therapeutisch kommt vor allem die Implantation oder Umprogrammierung eines sequentiellen Schrittmachers in Frage. Es ist besonders darauf zu achten, welche Kriterien für die Indikation aus
schlaggebend waren. Die Kammerstimulation kann bei Patienten mit hypersensitivem Carotissinus oder vasovagalen Synkopen die vaso- depressorische Komponente verschlechtern, so daß die entsprechende Symptomatik der Dysfunktion des vegetativen Nervensystems verstärkt werden kann.
Notfälle nach Schrittmacherimplantation
Nach Schrittmacherimplantation kommt es nur selten zu Notfällen, die dann jedoch umgehend diagnostiziert und behandelt werden müssen. Die häufigste Ursache liegt in fehlerhafter Stimulation und/oder fehlerhafter Signalerkennung, meistens bedingt durch Dislokation von Elektroden. Bei einigen Patienten sind diese Elektrodenfehlfunktionen dauerhaft vorhanden, bei anderen nur intermittierend. Fehlerhafte Erkennung von T-Wellen-Signalen oder Missensing nach Entwicklung eines Rechtsschenkelblocks kann zum Versagen einer effektiven Stimulation führen. Bei Störungen der Sensingfunktion ist zunächst einmal die Sensi- tivität des Schrittmachers zu erhöhen, bei Ineffektivität ist das Elektrodensystem neu zu positionieren. Bei inadäquater Impulsübertragung auf das Gewebe sind zunächst Reizschwelle und Impulsbreite zu erhöhen, bei Ineffektivität ist die Revision des Elektrodensystems notwendig. Ein plötzlicher Ausfall der Schrittmacherstimulation kann zur bedrohlichen Bradykardie, Asystolie und zum Tode füh- * •
Perforation des Myokards - ernster Notfall!
Hinweise auf eine Perforation durch:• röntgenologische und/oder echokardiographi-
sche Zeichen,• Analyse unipolarer abgeleiteter Elektrogram-
me von der Schrittmacherelektrode,• Ableitung von Elektrogrammen von der dista
len Elektrode bei bipolaren Schrittmachersystemen. Ein Elektrogramm mit einer positiven R-Welle bzw. positivem QRS-Komplex und positiver T-Welle spricht für eine Perforation, während normalerweise bei regelrechter Lage der Schrittmacherelektrode im rechten Ventrikel QRS-Komplex und T-Welle negativ sind.
• Sofortige Diagnosesicherung durch Echokardiographie!
• Therapie: Perikardpunktion und/oder operative Revision.
• Eine bestehende Antikoagulation muß sofort unterbrochen werden!
170 ZüA. Fortbildung: Notfälle und Komplikationen
ippi^^g'5?«Pl|ppWiWf!WWWW»||j
50 mm/s
Zirt: 22:96:31 12.5 nn/Sck 5 mm
Abbildung 3: 3-Kanal-EKG-Registrierung (Brustwand-Ableitungen V1-V3) bei einem Patienten mit rezidivierendem Schwindel, 7 Monate nach Implantation eines Wl-Schrittmachers. Man erkennt typische Muskelpotentiale, die vom Schrittmachersystem falsch wahrgenommen werden und die zu einer Inhibierung des Schrittmachers führen
ren. Ursächlich sind ein Versagen der Schrittmacherbatterie, eine plötzliche Erhöhung der Stimulationsreizschwelle und/oder Überleitungsstörungen im Elektrodensystem. Von Bedeutung sind Nachweis oder Fehlen von Schrittmacher-Spikes. Sind keine Spikes im Elektrokardiogramm zu sehen, ist ein Ausfall der Batterie oder ein Ausfall des Elektrodensystems vorhanden, während das teilweise Auftreten von Schrittmacher-Spikes auf einen Elektrodenbruch hinweist. Eine exakte Überprüfung aller beteiligten Systeme des gesamten Schrittmachers (Generator, Elektrode, Adapter) ist notwendig. Die Behandlung besteht in der Regel im Ersatz des defekten Systems.
»Milde« venöse Thrombosen werden hei bis zu 30% der Patienten mit implantierten Schrittmachern beobachtet, schwere Thrombosen der Vena subclavia oder der Vena axillaris sind mit bis zu 2% selten (27). Neben klinischen Zeichen für eine Lungenembolie finden sich typische elektrokardiographische Befunde wie P- pulmonale (P-Wellen-Amplitude >2,5mm in den Ableitungen II, III und aVF), einer Drehung der elektrischen Achse nach rechts (> +90°) und der Entwicklung eines inkompletten oder kompletten Rechtsschenkelblockbildes. Häufig finden sich entweder Sinustachykardien oder supraventrikuläre Arrhythmien wie Vorhofflimmern oder Vorhofflattern. Therapeutisch ist je nach Klinik und Schweregrad von Thrombose oder Embolie eine Heparinisierung oder Lysebehandlung notwendig.
Zill: S:S6:« Im/^
VYYYYYYYYYWYYYYYYYYYvYOAv^
12.5 ai/Sek 5 m/ät
A'AAyVYYYYYVYHf-V'+AAi
Abbildung 4a: Auszug aus dem 24-Stunden-Langzeit-EKG eines Patienten nach Implantation eines DDD-Schrittmachersystems. Man erkennt auf der einen Seite regulär stimulierte Komplexe mit adäquaten atrialen und ventrikulären Stimuli. Ein retrograd geleiteter stimulierter ventrikulärer QRS-Komplex (»geschlossener Pfeil«, oben) oder eine ventrikuläre Extrasystole (»offener Pfeil«, unten) führen zu einer retrograden Vorhofleitung und führen zur Auslösung einer Tachykardie
Die Inhibierung eines Schrittmachersystems durch Muskelpotentiale kann zum plötzlichen Versagen des Schrittmacheraggregates führen (2). Die Diagnose ist anhand des Oberflächen- EKGs relativ einfach. Man erkennt als Artefakte Muskelpotentiale, die vom Schrittmacher registriert werden und zur Inhibierung seiner Funktion führen [Abb. 3). Eine Lösung ist die Verminderung der Schrittmacher-Sensitivität, evtl, kann eine Neuanlage des Schrittmachersystems notwendig werden. Bei Patienten mit intakter ventrikulo-atrialer Leitung können sehr belastende Schrittmacher-induzierte Reentry-Tachykardien entstehen (6). Hier kommt es bei spontaner oder stimulierter ventrikulärer Erregung zu einer retrograden Vorhoferregung, die von der atrialen Schrittmacherelektrode wahrgenommen wird und nach einem programmierten AV-Intervall zu einer Stimulation des Ventrikels führt. Diese Erregung führt wiederum zur retrograden Vorhoferregung und zum Persistieren einer durch den Schrittmacher bedingten Tachykardie [Abb. 4a). Der Mechanismus dieser »Schritt- macher-induzierten Reentry-Tachykardien« ist vergleichbar mit den Befunden, die bei Präexzi-
Fortbildung: Notfälle und Kompiikatioiien
RA-EIektrode
AV-Überleitung
RV-Elektrode
zeit führt zur Terminierung solcher Tachykardien, da retrograd geleitete Impulse nicht mehr von der atrialen Elektrode wahrgenommen werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein kurzes AV-lntervall zu programmieren oder den Schrittmachermodus (DVl) zu ändern.
#Literatur kann beim Verlag oder beim Verfasser angefordert werden!
Abbildung 4b: Schematische Darstellung der Mechanismen einer »Schrittmacher-induzierten Tachykardie«. Durch eine retrograd geleitete ventrikuläre Extrasystole oder einen stimulierten Kammerkomplex kommt es zur Wahrnehmung der retrograden P-Welle durch die atriale Sensingelektrode. Dieser Impuls führt nach einem programmierten AV-Intervall zu einer Stimulation des Ventrikels. Jeder stimulierte ventrikuläre QRS-Komplex wird von einer retrograden Leitung in den Vorhof gefolgt und führt zur »Unterhaltung« der Tachykardie. Abkürzungen; DDD = sequentieller Schrittmacher, LA = linker Vorhof, LV = linker Ventrikel, RA = rechter Vorhof, RV = rechter Ventrikel
tationssyndromen mit orthodromen Tachykardien bekannt sind {Ahh. 4b). Die Diagnose ist aus dem (Langzeit-) EKG relativ einfach zu stellen. Eine Verlängerung der atrialen Refraktär-'
Autor: Prof. Dr. med. Hans-Joachim Trappe, Abteilung Kardiologie, Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Konstanty-Gutschow-Str. 8,30625 Hannover.
Beruflicher Werdegang: Facharztausbil- dung Innere Medizin. Seit 1983 an der Medizinischen Hochschule Hannover, 1990 Habilitation, 1994 Ernennung zum apl. Professor.
Zur Person
Co-Autorin:MHH.
Dr. med. Petra Pfitzner,
Merkblatt für Schrittmacher-Patientenln der Regel arbeitet ein Herzschrittmacher zuverlässig und ermöglicht den Patienten ein normales Leben. Nur selten kommt es zu Komplikationen. Trotzdem sollte der Patient über mögliche Probleme informiert sein.
Allgemeine Hinweise für Schrittmacher- Patienten
>■ Tragen Sie Ihren Schrittmacher-Ausweis immer bei sich, bei jedem Arzt- und jedem Zahnarzt-Besuch!
>- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen Ihren Puls und vergleichen Sie die festgestellte Herzfrequenz mit der programmierten Frequenz des Schrittmachers (siehe Eintragung im Schrittmacher-Ausweis)!
>► Beobachten Sie Ihre Schrittmacher-Tasche regelmäßig und achten Sie auf Hautveränderungen oder Änderungen in der Lage des Schrittmacher-Aggregates!
Besondere Vorsichtsmaßnahmen
In jüngster Zeit wurden verschiedene Berichte vorgelegt, daß Mobil-Telefone im C- und D-Netz Störungen des Schrittmachers hervorrufen können und im Einzelfall zu einer Gefährdung eines Patienten führen. Daher sollten folgende Empfehlungen beachtet werden:
Schrittmacher-Patienten sollten keine Mobil-Telefone im C- und D-Netz betriebsbereit bei sich führen.Das Mobil-Telefon sollte in größmöglicher Entfernung vom Schrittmacher getragen und benutzt werden!Vor Gebrauch eines Mobil-Telefons sollte vorsichtshalber im Rahmen einer Sprechstunden-Vorstellung ein Test mit einem entsprechenden Gerät erfolgen.
Warnsymptome
Ein Herzschrittmacher arbeitet in der Regel viele Jahre problemlos; dennoch sind regelmäßige Kontrollen (halbjährlich bis jährlich) notwendig, um eine sichere Funktionsweise des Schrittmachersystems zu gewährleisten.Bei folgenden Symptomen sollten Sie unbedingt Ihren Hausarzt aufsuchen:>►>►>►>>>
>>
SchwindelBewußtseinsverlustHerzrasenAbfall der HerzfrequenzSchmerzen im Bereich der Schrittmacher-Tasche Auffällige Befunde im Bereich der Schrittmacher- Tasche (Rötung, Schwellung, Überwärmung) Luftnot»Zuckungen« im Bereich des Halses und/oder der Schrittmachertasche.
172 Kongreßberichte
Wie Alkohol das Nervensystem schädigt
Aufgrund der Daten von 1991 ist eindeutig belegt, daß die Deutschen Weltmeister im Verbrauch von Alkohol sind, erklärt Frau Prof. Dr. Christiane Bode vom Institut für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaften der Universität Hohenheim in Stuttgart. Die Daten sind aber auch eindrucksvoll:11.448.000. 000 Liter Bier,1.680.000. 000 Liter Wein und496.000. 000 Liter Spirituosen oder960.000. 000 Liter reiner Alkohol, das sind pro erwachsenem Bundesbürger 12,0 Liter, wurden in diesem Jahr verbraucht. In den letzten 35 Jahren hat der Alkoholkonsum bei uns um nicht weniger als 400 Prozent zugenommen - und daran sind nicht nur die Männer beteiligt. Betrug beim Alkoholmißbrauch das Verhältnis von Männern zu Frauen 1968 noch 10:1, so lag es 1975 bereits bei 3:1, erklärt Prof. Dr. Helmut Woelk aus dem Psychiatrischen Krankenhaus in Gießen. Noch deutlicher wird das Problem, wenn man bedenkt, daß der überwiegende Teil des Alkohols von weniger als 10 Prozent der Bevölkerung konsumiert wird. Wie Prof. Dr. J. Christian Bode vom Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart betont, bilden rund 2,5 Millionen Alkoholabhängige den harten Kern der Verbraucher.
Es gibt aber, so Bode, so gut wie kein Organ- oder Zellsystem, das durch chronischen Alkoholmißbrauch nicht geschädigt oder in seiner Funktion gestört wird: Neben dem Nervensystem, der Leber und der Bauchspeicheldrüse sind auch Herz, Muskulatur, Knochen und das blutbildende System betroffen. Auch das Krebsrisiko - vor allem im Magen- Darm-Bereich und wahrscheinlich auch beim Mammakarzinom - ist bei Alkoholabhängigen erhöht. Insgesamt verkürzt der Alkoholmißbrauch die durchschnittliche Le
benserwartungum 10 Jahre, erklärt Bode.
Problematisch sind vor allem auch die polyneuropathischen Krankheitsbilder, erklärt Prof. Dr. Wilfred Nix aus der Neurologischen Klinik in Mainz. Ein Drittel der Polyneuropathien, so die Faustregel, gehen auf einen Alkoholmißbrauch zurück. Warnzeichen sind hierbei Schmerzen im Bereich der Wadenmuskulatur und Beschwerden und Mißempfindungen im Bereich der Fußsohle. Bei fortschreitender Erkrankung ist dann die Schmerzwahrnehmung eher reduziert. Im ZNS-Bereich sind vor allem die Wernicke-Krankheit und das Korsakow-Syndrom zu fürchten.
»Chronischer Alkoholmißbrauch verringert die Lebenserwartung um 10 Jahre« (Prof. Dr.J. Christian Bode, Stuttgart)
Bei alkoholisch bedingten Nerven- schäden muß stets auch eine Vitaminmangel-Neuropathie bedacht werden. Fast immer geht nämlich der Alkoholmißbrauch mit einer Mangelernährung einher. 20 bis 50 Prozent der Kalorienaufnahme geschieht dort über den Alkohol! Die Schleimhaut des Magen-Darm-Trak- tes atrophiert, die Resorption wird dadurch vermindert. Besonders ein Vitamin-B-Defizit ist häufig festzustellen, aber auch auf die Zink- und Selenaufnahme ist zu achten, denn Zinkmangel schädigt das Immunsystem und Selenmangel reduziert die antioxidative Kapazität des Alkoholikers und läßt vermehrt die Bildung schädlicher freier Radikale zu. Eine Substitution ist deshalb bei diesem Personenkreis angezeigt (z.B. in Form von Benfogamma® - das lipidlösliche Benfotiamin -, Zinkit® 10 und Oxytex® - eine Kombination aus Selen und den auch anti
oxidativen Vitaminen C, E, und Betakarotin).
Daß die Gabe des fettlöslichen Benfotiamin Sinn macht, belegte Prof. Dr. Roland Bitsch vom Institut für Ernährung und Umwelt der Universität Jena. Er zeigte, daß die Konzentration im Blut unter Benfotiamin um das 34fache höher ist als unter Gabe des wasserlöslichen Thiamin. Damit kommt es auch in weit höheren Konzentrationen an die geschädigten oder von Läsionen bedrohten Nerven und - vor allem - es entfaltet seine positive Wirkung auch im Gehirn und verhütet dort den Abbau bzw. die Degeneration von Nervenzellen.(Günther Buck)
5. Hohenheimer Symposium »Polyneuropathien und ZNS-Schäden durch Alkoholmißbrauch« der Fa. Wörwag GmbH am 6. Dezember 1995.
Z. Allg. Med. 1996; 72; 172. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
Artischocken-Exlrakt i-ördert die Feitverdauuna
Cynara scolymus L. ‘
"Artischocken-Extrakt steigert die Gallenfunktion signifikant” Kirchhoff et. al., Phytomedicine 1 (1994), 107
■ normalisiert die gestörte Fettverdauung
■ beseitigt funktionelle Beschwerden der Gallenwege
bessert die Symptome bei Völlegefühl, Blähungen und Reizmagen
■ senkt Gesamt- und LDL-Cholesterin
■ wirkt zusätzlich hepatoprotektiv
PackuuS
Hepar-SL"^ forteGesicherte Wirkung - gute Verträglichkeit -fehlende Nebenwirkungen
für eine kostengünstige Langzeittherapie
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält 320 mg standardisierten Artischockenextrakt 3,8-5,5:l. Anwendungsgebiete: Dyspeptische Beschwerden, Störungen der Fettverdauung, Fettstoffwechselstörungen, Leberfunktionsstörungen. Gegenanzeigen: Allergie gegen Artischocken, Verschluß der Gallenwege. Nebenwirkungen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht bekannt. Dosierungsanleitung: 3 mal täglich 1-2 Kapseln zu den Mahlzeiten unzerkaut einnehmen. Handelsform und Preise: O.P.50 Kapseln (N2) DM 32,20,0.P. 100 Kapseln (N3) DM 59,90,0.P.200 Kapseln DM 99,-. Sertürner Arzneimittel, 33279 Gütersloh. Stand 01.01.1995 2/42 P&P
Drei bewährte Substancemindestens 66% unter Festbetrag!
M Teiiba'eTabletieaDtoo Tabletten (N5) " ||P
u lU D I L* 5 0“ A/*c.w<»mrT»6rJöotoon.' Aa-Hen.^r
preiswerteste40 mg Nifedipin- ^Einmalgabe
20 (Nt)
Cordicant®UnoVVirKSK^:
2um
/h
- \i
f •' j j , proto^^j .
I 30 ^ÜU 60*^0
deutlich unter Restbetrag!
t^undil* 12,5 / 25 / 50, Tabletten Wirkstoff: Captopril Verschreibungspflichtig Zusammensetzung: 1 Tablette Mundil 12,5 enthält 12,5 mg Captopril; 1 Tablette Mundil 25 enthält 25 mg Captopril, 1 Tablette Mundil 50 enthält 50 mg Captopril. Hilfsstoffe: Lactose, Crospovidon, Mikrokristalline Cellulose, ■. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . ' -. . . . . . . . . . . ' ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reibenden"lochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Magnesiumstearat, Maisstärke. Anwendungsgebiete: Bluthochdruck (Hypertonie), Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz) - zusätzlich zu harntreibenden Medikamenten (Diuretika) und insbesondere bei schwerer Herzinsuffizienz auch zu Digitalis Gegenanzeigen'
^icht anwenden bei: Überempfindlichkeit gegen Captopril; Neigung zu angioneurotischem Ödem auch infolge einer früheren ACE-Hemmer-Therapie; Nierenarterienverengung (beidseitig bzw. einseitig bei Einzelniere); Zustand nach Nierentransplantation; Aorten- oder Mitralklappenverengung bzw. andere" ttusflußbehinderungen der linken Herzkammer (z. B. hypertropher Kardiomyopathie), primär erhöhter Aldosteronkonzentration im Blut; Schwangerschaft (vorheriger Ausschluß sowie Verhütung des Eintritts einet Schwangerschaft!); Stillzeit (Abstillen!). Diafyse, LDL-Apherese, Hyposensibilisierung: Mundil nicht tusammen mit High-flux-Membranen insbesondere aus Polyacrylnitrilmethallylsulfonat für die Dialyse (z.B, "AN 69"), während einer LDL-Apherese insbesondere mit Dextransulfat oder während einer Hjipo- bzw. Desensibilisierun
[Olden Reaktionen). Besonders vorskbtig anwenden bei: schweren Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min); Dialyse; Proteinurie (mehr als 1 gffag);schweren Elekl Sklerodermie] ... . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(z.B. Lupus erythematodes, Sklerodermie); gleichzeitiger Therapie
jbofwerten bei: Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel, Niereninsuffizienz, schwmit Immunsupressiva (z.B. Kortikoide, Zytostatika, Antimetabolite), Allopurinol, Procainamid oder Lithium. Hinweise: Vor Thera;
schwerer oder renaler Hypertonie, schwerer Herzinsuffizienz, Patienten über 65 Jahre. Nebenwirkungen: Her. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nl-Dosierui
ana-gestörter Immunreaktion odd
apiebegini ..._ _ _ _ ^ .. _ _ _ _ _ _ _n: Herz-Kreis/auf-System.Gelegentlich, insbesondere zu Beginn der Captopril-Therapie sowie bei Patienten mit Salz- und/odd
Übenivachung von Blutdruck undlodd
Tüssigkeitsmangel z.B. bei Vorbehandlung mit Oluretika, Herzleistungsschwäche, schwerer oder renaler Hypertonie, aber auch bei Erhöhung der Diuretika- und/oder CaptopnI-Dosierung möglich: Hypotonie und Orthostase mit Symptorrien wie Schwindel, Schwächegefühl, Sehstörungen, selten auch m® Synkope. Einzelfallberichte für ACE-Hernmer bei Blutdruckabfall über Tachykardie, Palpjtationen, Herzrhjrthmusstörungen, Angina p^ons, Myocardinfarkt TIA, cerebraler Insult. Niere: Gelegentlich Nierenfunktionsstörungen, in Einzelfällen bis zum akuten Nierenversagen. Selten Proteinurie, teilweise mit gleich-’eitiger Verschlechterung der Nierenfunktion. Atemwege: Gelegentlich trockener Reizhusten und Bronchitis, selten Atemnot, Sinusitis, Rhinitis; vereinzelt Bronchospasmus, Glossitis und Mundtrockenheit. In Einzelfällen Lachen und/oder Zunge (Notfallmaßnähmen!), Magen-Darm-Trakt; Gelegentlich Übelkeit, Oberbauchbeschwerden und Verdauungsstörungen,; jnd Ileus unter ACE-Hemmem. Haut, Gefäße: Gelegentlich allergische Hautreaktionen wie Exanthem, selten Urtikaria, Pruritus sowie
.„..‘ällen bis zum akuten Nierenversagen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___eosinophile Pneumonie, angioneurotische Ödeme mit Beteiligung von Kehlkopf, ......---------------------------- p3„^rejtits
shigoide Hautreaktionen, in Emzelfällen mit Fieber, Myalgien, Arthralgien/Arthritis, Vaskulitiden und bestimmten Laborwertveränderungen (Eosinophilie, Leuko^ose und/oder erhöhten ANA-Tite jefäßkrämpie bei Raynaud-Krankheit unter ACE-Hemmer-Therapie. Nervensystem: Gelegentlich Kopfschmerzen, Müdigkeit, selten Benommenheit, Depressionen, Schlafstörungen, Impotenz, jeschmackweränderungen oder vorübergehender Geschmacksverlust. Laborwerte: Gelegentlich Abfall der Hämogiobintonzentration, Hämatokrit, Leuko- oder Thrombozyten. Selten insbeson
Öncholyse und eine Zunahme de»_ _ _ _ _ _ _ , .. . . . . . . . . . . . . .. - ____ 1, verschwommenes Sehen sow*•änkter Nierenfunktion, Kollagenkrankheiten oder gleichzeitiger Therapie mit
. Kribbeln, Parästhesien, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit, Ohrensausen, insbesondere bei Patienten mit eingeschränktrjeschmacksveränderungen oder vorübergehender Geschmacksverlust. Laborwerte: Gelegentlich ^ . . ... ^
Allopurinol. Procainamid oder bestimmten Medikamenten, die die Abwehrreaktion unterdrücken, krankhafte Verringerung oder Veränderung der Blutzellenzahl (Anämie, Thrombocytopenie, Neutropenie, Eosinophilie), in Einzelfällen Agranulocytose, Panzytopenle. In Einzelfällen wurden Hämolyse/hämolyfr iche Anämie, auch im Zusammenhang mit G-6-PDH-Mangel, berichtet, ohne daß ein ursächlicher Zusammenhang mit dem ACE-Hemmer gesichert werden konnte. Selten, insbesondere bei Nierenfunktionsstörungen, Anstieg der Serumkonzentrationen von Harnstoff, Kreatinin und Kalium sowie /'' " "" Natrium. Bei manifestem Diabetes mellitus wurde ein Anstieg des Serumkaliums beobachtet. Proteinurie möglich. In Einzelfällen kann es zu einer Erhöhung der Bilirubin- und Leberenzymkonzentrationen kommen. Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt werden. Stand der Information: März 1995
i/Virkungsweise: ACE-Hemmer, Mittel gegen Biuthochdnjck und HerzschwächeDosierungs- und Anwendungshinweise: Individuelle Dosierungen in Abhängigkeit von Patient und Krankheitsbild bitte der Packungsbeilage oder Fachinformation entnehmen. Darreichungsform, Packungsgrößen und Preise: 12,5 mg: 20 (NI) Tabletten: 7,81 DM incl. MwSt.; 50 (N2) Tabletten: 16,53 DM incl. MwSt.; 100 (N3) Tabletten: 29,75 DM incl. MwSt.; 25 mg: 20 (N1) Tabletten: 9,83 DM incl, MwSt.; 50 (N2) Tabletten; 21,09 DM incl. MwSt,; 100 (N3) Tabletten: 38,96 DM incl. MwSt.; 50 mg: 20 (NI) Tabletten: 12,11 DM incl. MwSt.; 50 (N2) Tabletten: 26,92 DM incl, MwSt.; 100 {N3) Tabletten: 49,25 DM incl. MwSt.; Mundipharma GmbH, 65549 Limburg (Lahn),
Cordicant*, Kapseln Cordicant* mite, Kapseln Cordicant* retard, Retardtabletten Corjlicant* Lösung Cordicant* Uno, Retardtabletten Wirkstoff: Nifedipin Verschreibungspflichtig Zusammensetzung: 1 Kapsel Cordicant* enthält 10 mg Nifedipin; Hilfsstoffe: Saccharin-Natrium, Macrogol-Glycerolhydroxystearat, Pfefferminzöl, Macrogol 400, Farbstoffe E 171, E 172, Glycerol. 1 Kapsel Cordicant* mite enthält 5 mg Nifedipin; HilfsstofkSaccharin-Natrium, Macrogol-Glycerolhydroxystearat, Pfefferminzöl, Macrogol 400, Farbstoffe E 171, E 172, Glycerol. 1 Retardtablette Cordicant* retard enthält 20 mg Nif^ipin, Hilfsstoffe: Magnesiumstearat, PolyMrbat, Macrogol 400, 6000, Lactose, Talkum E 171, E 17i 1 ml (20 Tropfen) Cordicarf Lösung enthält 20 mg Nifedipin, Hi/fetoffe: Macrogol 200, Pfefferminzöl, Saccharin-Natrium 2 H20.1 Retardtablette Cordicant* Uno enthält 40 mg Nifedipin, Hr/fssloffc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Methylhydroxypropylcellulose, Mannitol, hydriertes Rizinusöl, Polyvidon, Magnesiumstearat, Croscarmellose-Natrium, Lactose, Macrogol
CcL ptop ril.MUNDIL12,5 mg, 25 mg, 50 mg Captopril
Nifedipin......... CordicanfJPUno40 mg Nifedipin
D.iitiazew......... CORAZET
Blickpunkt, drei bewährte Namen ^
0)
Wo, 6000, Farbstoffe E171, E172. Anwendungsgebiete; Zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit (Zustände mit unzureichender Sauerstoffversorgung des Herzmuskels): chronisch stabile Angina pectoris (Belastungsangina); Angina pectoris nach Herzinfarkt (auBer in ersten 8 Tagen nach dem akuten Myokardinfarkt); vasospastische Angina (Prinzmetal-Angina, Variant-Angina); instabile Angina pectoris (Crescendoangina, Ruheangina) insofern eine adäquate Begleittherapie (z. B. mit Beta-Rezeptorenblockern) besteht. Zur Behandlung der
"Vpertonie (gilt nicht für Cordicant mite). Cordicant Lösung zusätzlich: Zur Behandlung der hypertonen Krise; zur Behandlung des Raynaud-Syndroms. Cordicant Uno sollte nur dann eingesetzt werden, wenn mit niedrigen Nifedipin-Dosen kein ausreichender Behandlungserfolg stielt wurde. Gegenanzeigen.' Herz-Kreislauf-Schock, Angina pectoris bei akutem Herzinfarkt, höhergradige Aortenstenose, bekannte Überempfindlichkeit gegen Nifedipin, schwere Hypotension mit weniger als 90 mm Hg systolisch, dekompensierte Herzinsuffizienz, gleich- *tige Einnahme von Rifampicin, während der gesamten Schwangerschaft. Nifedipin geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Zur Anwendung in der Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Nebenwirkungen: Insbesondere zu Beginn der Behandlung wnn es häufig meist vorüb&gehend zu Kopfschmerzen und Gesichts- bzw. Hautrötung mit Wärmegefühl (Erythem, Erythromelalgie) kommen. Gelegentlich können auftreten: Tachykardie, Palpitationen, Unterschenkelödeme, Schwindel und Müdigkeit, Parästhesien und eine ^tone Kreislaufreaktion, hierdurch in Einzelfällen Synkope bei Behandlungsbeginn. Selten Magen-Darmstörungen wie Übelkeit, Völlegefühl und Diarrhoe. Hautüberempfindlichkeitsreaktionen wie Pruritus, Urtikaria, Exantheme. In Einzelfällen exfoliative Dermatitis, kleinfleckige ünblutungen in Haut- und Schleimhaut (Purpura), sensitive Photodermatose sowie anaphylaktische Reaktionen (nach Absetzen reversibel). Blutbildveränderungen (Anämie, Leukopenie, Thrombopenie, thrombozytopenische Purpura, Agranulozytose) sind beschrieben worden. ^Ifeßt selten unter längerer Behandlung Gingiva-Hyperplasie, die sich nach Absetzen völlig zurückbilden. In Einzelfällen Leberfunktionsstörungen (intrahepatische Cholestase, Transaminasenanstiege), die nach Absetzen reversibel sincL In Einzelfällen Hyperglykämie (Diabetes ,®ellitus!)./n seltenen Fällen vor allem bei älteren Patienten unter einer Langzeittherapie Gynäkomastie, die sich bisher in allen Fällen nach Absetzen des Meciikamentes zurückgebildet hat. In Einzelfällen namentlich bei hoher Dosierung Myalgie, Tremor sowie eine geringfügige, Jorübergehende Änderung der optischen Wahrnehmung. Gelegentlich in den ersten Stunden nach der Einnahme Angina-pectoris-ähnliche Beschwerden. Bei einer Niereninsuffizienz vorübergehende Verschlechterung der Niereniunktion. Bei Dialysepatienten mit starkem “uthochdruck (maligne Hypertonie) und Hypovolämie ist Vorsicht geboten (Blutdruckabfall durch Vasodilatation). In den ersten Behandlungswochen Mehrausscheidung der täglichen Urinmenge möglich. Reaktionsvermögen kann beeinträchtigt werden.
Wrkungweise: Calcium Antagonist. Dosierungs- und Anwendungshinweise: Die Dosierung richtet sich nach der Art der Erkrankung und dem Schweregrad. Ausführliche Dosierungsanleitungen sind den Fach- und Gebrauchsinformationen zu entnehmen, “ärreichungsform, PackungsgröBen und Preise (inkl. MwSt.): Cordicant* Kapseln: 30 (NI) 17,35 DM; 50 (N2) 26,58 DM; 100 (N3) 47,43 DM. Cordicant* mite, Kapseln 20 (N1) 7,12 DM; 50 (N2) 15,26 DM; 100 (N3) 27,22 DM. Cordicant* retard, Retardtabletten: 30 INI) 22,10 DM; 50 (N2) 34,03 DM; 100 (N3) 61,11 DM. Cordicant* Lösung: 30 ml (NI) 21,38 DM. Cordicant* Uno, Retardtabletten: 20 (NI) 18,75 DM; 50 (N2) 39,85 DM; 100 (N3) 71,50 DM. Stand Januar 1996
Corazet“ Diltiazem 60, Filmtabletten Corazet* Diltiazem 120 retard, Filmtabletten Wirkstoff: Diltiazemhydrochlorid Veryhreibungspflichtig Zusammensetzung: Corazet Diltiazem 60: Eine FilmtabJette enthält 60 mg Diltiazemhydrochlorid . Hilfsstoffe: Aluminiumhydroxid,^tina HR, Eudragit NE, Glycerol, Lactose, Magnesiumstearat, Mel ' ' . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . ...... .Wcrylate Dispension 30 %, Glycerol, Lactose, Magnesiumstearat,wusknotensyndrom, höhergradigen SA-Blockierungen, Schock, aku.. .... . . . . . . . . . . ... . .«Risiko, eine Kammertachykardie auszulösen), Überempfindlichkeit gegenüber Diltiazem. Besondere ärztliche Überwachung ist erforderlich bei: AV-Block 1. Grades und Links- oder Rechtsschenkelblock, niedrigem Blutdruck (unter 90 mmHg systolisch), älteren Patienten ™riängerung der Eliminationshalbwertszeit), Brar^kardie (Ruhepuls unter 50 Schläge pro Minute), Leber- und/oder Nierenfunktionsstörungen. Nebenwirkungen: Es kann zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel und Schwächegefühl kommen. Gelegentlich Knöchel- bzw. winödeme; allergische Hautreaktionen wie Hautrötungen, Juckreiz und Exantheme, ln einzelnen fällen allerg. Reakt. wie Erythema multiforme, Lymphadenopafnie und Eosinophilie. Selten Magen-Darmbeschwerden (Erbrechen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung). In seltenen ^llen Anstieg der Leberenzyme SGOT, SGPT, gammaGT, LDH und alkal. Phosphatase sowie andere Symptome einer akuten Leberschädigung (Überwachung der Leberparameter!). In Einzelfällen, bes. im höheren Dosisbereich u./o.™ entspr. Vorschädigung des Herzens Bradykardie, AV-Blockierung, stärkerer Blutdruckabfall, Herzklopfen, Synkopen und Herzmuskelscnwäche. Verstärkung der Beschwerden bei Pat. mit peripheren Durchblutungsstörungen mög- Wi. Selten Schlaflosigkeit, Halluzinationen und depressive Verstimmungen. In Einzelfällen Potenzstörungen. Äußerst selten unter längerer Behandlung reversible Gingivahyperplasie. In seltenen Fällen Erhöhung des Blutzuckers "iäbetes mellitus!). Dosierungs- und Anwendungshinweise: siehe Packungsbeilage oder Fachinformation. Corazet Diltiazem 60: 30 (NI) Filmtabletten 16,32 DM incl. MwSt.; 50 (N2) Filmtabletten 23,16 DM incl. MwSt.; 100 ”3) Filmtabletten 43,40 DM incl. MwSt, Corazet Diltiazem 120 retard: 30 (NI) Filmtabletten 35,73 DM incl. MwSt.; 50 (N2) Filmtabletten 51,98 DM incl. MwSt.; 100 (N3) Filmtabletten 97,05 DM incl. MwSt.. Stand: April 1995
Leistung für Arzt und Patient
Esbericum® fortepflanzliches Antidepressivum
Damit aus der depressiven Stimmung keine Depression wird!
Esbericum" fortePflanzliches Antidepressivum
Wirkstoff: Trockenextrakt aus Johanniskraut
bei Niedergeschlagenheit bei Angstgefühlen bei nervöser Unruhe
hilft mit Wirkstoffen aus der |||{QQaitiuir
Esbericum* forte Dragees • Zusammensetzung: 1 Dragee enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Trockenextrakt (Auszugsmittel Ethanol 50 % G/G) aus dem oberirdischen Teil des Johanniskraut (Hyperici herb. extr. sicc.) 250 mg standard, auf 0,50 mg Gesamthypericin. Sonstige Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Lactose, Macrogole (400, 6000, 20 000), Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Hydroxypropylmethylccllulose, Titandioxid E 171, Eisenoxid E 172. Esbericum® Kapseln • Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Hyperici herb. extr. sicc. (Johanniskrauttrockenextrakt) entsprechend Gesamthypericin (standard.) 0,25 mg. Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid, Eisenoxidgelb E 172, Gelatine, Indigotin E 132, Titan(lV)-oxid E 171. Anwendungsgebiete: Psychovegetative Störungen, depressive Verstimmungszustände, Angst und/oder nervöse Unruhe. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen ist eine Photosensibilisierung möglich, insbesondere bei hcllhäutgcn Personen. Darreichungsformen, Packungsgrößen und Preise: Dragees: 30 St. (NI) 15,80 DM, 60 St. (N2) 28,80 DM, 100 St. (N3) 41,50 DM. Kasein: 60 St. (N2) 21,60 DM, 100 St. (N3) 29.80 DM. Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, 38259 Salzgitter (Stand: April 1995).
Q Schaper & BrümmerNaturstoff-Forschung für die Therapie
ZeitschriftfürAllgemeinmedizin
Kona'S?«Ittuell
Lorzaar® (Losartan) - ein neues Wirkprinzip in der HochdrucktherapieSehr gute Wirksamkeit und exzellente Verträglichkeit durch Angiotensin II- Rezeptorblockade
Wozu brauchen wir überhaupt neue Antihypertensiva ?
Wenn man bedenkt, was nach den Empfehlungen der deutschen wie der internationalen Fachgesellschaften zur Therapie eines erhöhten Blutdrucks erlaubt ist, drängt sich schon die Frage auf, was eine weitere Substanzgruppe hier eigentlich noch bringen soll (und kann). Für Deutschlands rund 20 Millionen Hypertoniker stehen Diuretika, Betablocker, Calciumantagonisten, ACE-Hemmer und Alpha-l-Blocker allein oder in verschiedenen Kombinationen zur Verfügung. Eigentlich müßte damit doch schon eine effektive und individualisierte Therapie möglich sein.
Die Sache hat allerdings nicht nur einen, sie hat gleich mehrere Haken: •
• Große Studien zeigen, daß lediglich 37 Prozent aller Patienten wenigstens den Zielblutdruck von 140/90 mm Hg durch die Therapie erreichen, und dies hat sich seit den achtziger Jahren kaum geändert, auch nicht durch die »neueren« Mittel.
• 50 bis 60 Prozent aller Patienten über 40 Jahre brechen innerhalb von 6 Monaten nach Therapiebeginn die Therapie wieder ab.
• Dazu kommt, daß nur für Betablok- ker und Diuretika bislang bei einer Senkung des diastolischen Blutdrucks von 5 bis 6mmHg ein Rückgang der zerebrovaskulären Ereig
nisse und Todesfälle um 42% gezeigt und eine mäßige Abnahme der koronaren Mortalität um 10 bis 14 Prozent zweifelsfrei belegt sind.
Für diese enttäuschende Lage gibt es eine Reihe von Gründen: Da ist einmal die schlechte Compliance der Patienten - der »klassische« Patient mit essentieller Hypertonie fühlt sich ja anfangs unter der Therapie nicht so richtig wohl. Der zweite Grund liegt bei den Ärzten, die das Problem Hochdruck nicht ernst genug nehmen und häufig auch nicht das für den jeweiligen Patienten am besten geeignete Wirkprinzip einsetzen. Kritisch zu hinterfragen ist neben dem Wirkungspotential der eingesetzten Substanzen vor allem deren Nebenwirkungsprofil, das die Ausschöpfung des Wirkungspotentials mitunter verhindert. Ein wichtiger Punkt ist auch die Frage nach der Organprotektion - eine »Blutdruckkosmetik« allein ist nicht ausreichend, erklärt Prof Dr. med. Jürgen Scholze von der Charite in Berlin bei einer Pressekonferenz der Fa. MSD Sharp & Dohme GmhH im Oktober 1995 zur Einführung eines neuen Wirkprinzips in die deutsche Hochdrucktherapie.
ln den letzten Jahrzehnten wurden immer spezifischer wirkende Medikamente mit einer immer selektiveren Beeinflussung relevanter Rezeptoren im Bereich des sympathischen Nervensystems entwickelt. Auch beim Organschutz und der Regression von
Folgekomplikationen des Hochdrucks, wie linksventrikuläre Hypertrophie und Gefäßwandhypertrophie, wurden - zum Beispiel mit ACE-Hem- mern - deutliche Fortschritte erzielt.
Jetzt scheint nach den Erfahrungen aus den bereits vorliegenden Studien an 3000 Patienten ein weiterer »Quantensprung« in der Hochdrucktherapie gelungen: Der Angiotensin- II-Antagonist Losartan zeigte - bei gleicher Wirksamkeit wie andere moderne Antihypertensiva - durchgängig ein Nebenwirkungsprofil, das im Bereich der Plazebogruppen lag, die Abbruchquote lag mit 2,3 Prozent sogar unter derjenigen der Behandlung mit Plazebo! Schon damit scheint die Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit eines neuen, hochspezifischen Wirkprinzips positiv beantwortet.
Die »Entdeckung« des Losartan
Auf der Suche nach immer spezifischeren Methoden, das Renin-An- giotensin-System (RAS) zu beeinflussen, dessen gestörte Kontrolle eine Ursache für die Entwicklung der Hypertonie und der chronischen Herzinsuffizienz ist, stieß man auf das Angiotensin II (A II), berichtet der »Vater« des Losartan, Pieter Timmermans.
Da das RAS in so vielfältiger und potenter Weise an der Entstehung des
Z. Allg. Med. 1995; 71: 177-178. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1995
178
Hochdrucks und seiner Folgekrankheiten beteiligt ist, versuchte man schon seit längerem, dieses System positiv zu beeinflussen - z.B. mit den ACE-Hemmern. Diese erzielen ihre Wirkungen (und ihre Nebenwirkungen wie z.B. den trockenen Husten) jedoch nicht nur durch Hemmung der Bildung von AII, sondern auch durch Hemmung des Abbaus endogener Ki- nine. Vor allem aber weiß man heute, daß A II auch von anderen Enzymen als dem ACE produziert werden kann, stellt der Pharmakologe Prof. Dr. med. Thomas Unger aus Kiel fest. So wäre auch bei vollständiger ACE-Blockade immer noch eine Produktion und damit natürlich eine Wirkung von A- II möglich.
Der bedeutendste Mediator des RAS ist das Angiotensin II. Seine wichtige Rolle bei der Pathogenese kardiovaskulärer Erkrankungen ist an verschiedenen Modellen gut belegt. Die Blok- kade der Bindung von Angiotensin II an seine spezifischen Rezeptoren ist der direkteste und vollständigste Weg, das RAS zu hemmen. Zwei verschiedene Rezeptortypen, ATj und ATg, hat man bislang beim Menschen gefunden. Nach weiteren wird gesucht. Los- artan ist der Prototyp der Angioten- sin-II-Typ AT^-Antagonisten und hat keine Affinität zum AT2-Rezeptor (über dessen Funktion man heute erst wenig weiß). Alle bekannten kardiovaskulären Wirkungen von Angiotensin II werden über den AT^-Rezeptor vermittelt, den Losartan blockiert.
Losartan hemmt offenbar die neointi- male Proliferation und bewirkt so eine Regression oder Verhinderung der kardiovaskulären Hypertrophie, des Remodeling und der durch die RAS- Aktivierung fortschreitenden Herzinsuffizienz. Im Tierversuch wird signifikant die Proteinurie bei nierenkranken Tieren gesenkt, der AT^-Rezeptor-Antagonist schützt vor diabetischer Glomerulopathie und steigert die Überlebensrate bei für Schlaganfälle anfälligen spontan hypertensiven Ratten.
Kongreß
AktuellLorzaar® - ein kurzes Profil
Lorzaar® (Losartan) ist der erste Vertreter einer neuen Generation von Medikamenten für die Therapie desHochdrucks.
• Es blockiert spezielle Angiotensin- II-(AII) -Rezeptoren.
• Es verhindert alle bekannten kardiovaskulären Wirkungen des A II, wie Vasokonstriktion, Sympathikus-Aktivierung und Volumenreten- tion, unabhängig vom Syntheseweg direkt am Rezeptor.
• Nebenwirkungen, wie Flush, Knöchelödeme, kalte Gliedmaßen oder Reizhusten wurden unter Therapie mit Losartan nicht häufiger beobachtet als unter Plazebo.
• Die Abbruchquote wegen unerwünschter Ereignisse lag in klinischen Studien unter Losartan bei 2,3%, unter Plazebo bei 3,7%.
• Losartan wirkt in der Dosis 50mg effizient über 24 Stunden bei einmal täglicher Einnahme.
• Die Blutdrucksenkung erfolgt initial schonend.
• Eine Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz ist nicht erforderlich
Die selektive Blockade des AII direkt an seinen Rezeptoren hat also die erhofften Effekte gezeigt; Ausgeprägte antihypertensive und organprotektive Eigenschaften bei exzellenter Verträglichkeit. Losartan gestattet die gleichmäßige Kontrolle des erhöhten Blutdrucks über 24 Stunden und erweist sich als echte Bereicherung der antihypertensiven Therapie.
Losartan, erklärt Timmermans, ist der erste Vertreter einer neuen Klasse von Wirkstoffen, von deren selektiver und vollständiger Hemmung pathologischer Wirkungen des Angiotensin II man sich in der Therapie viel verspricht.
Wie sieht es denn mit klinischen Daten aus?
Die »Muttersubstanz« Losartan wird rasch resorbiert und flutet schnell an. Entscheidend für die Wirksamkeit ist aber der hochpotente und lang wirk
same Carboxyl-Metabolit, der mit Verzögerung anflutet. Deshalb setzt der antihypertensive Effekt langsam und schonend ein und hält zuverlässig bei einmaliger Gabe von 50mg über 24 Stunden an, stellt Prof Dr. med. Rainer Düsing aus Bonn fest. Die renale Ausscheidung spielt eine relativ geringe Rolle, weshalb auch bei Nierenkranken - bis hin zum Dialysepatienten - keine Dosisanpassung erforderlich ist, eine Akkumulation erfolgt nicht.
Mit 50mg Losartan erzielt man im Durchschnitt bei rund 45 bis 50 Prozent der Patienten eine ausreichende Blutdrucksenkung - dies entspricht ungefähr dem, was unter Monotherapie auch mit anderen Therapieprinzipien zu erreichen ist. Eine Dosissteigerung erzielt keinen wesentlich besseren Effekt.
Eine Beeinflussung des Lipidprofils oder des Glukosespiegels erfolgt nicht. Das Seriumkalium steigt ganz leicht an (ca. 0,1 mmol) - ähnlich wie unter ACE-Hemmung. Serumharnsäurewerte werden dosisabhängig geringfügig gesenkt.
Geeignete Kombinationspartner für Losartan - auch dies weiß man aus Studien - sind Diuretika. Kombiniert man Losartan mit 12,5mg Hydrochlo- rothiazid, erhöht sich die Ansprechrate auf 80 Prozent.
Es bleibt also das Fazit, daß mit dem Angiotensin-II-Antagonisten Losartan ein neues Wirkprinzip in die Hochdrucktherapie Einzug gehalten hat. Es wird ein sehr günstiges Nebenwirkungsprofil erzielt, das die Wahrscheinlichkeit für eine deutlich verbesserte Compliance der Patienten erhöht. Die geringe Nebenwirkungsrate ist wiederum ein wesentliches Resultat der hoch-selektiven Angio- tensin-II-Rezeptorblockade.
(Günther Buck)
Ktngr^Aktuell I
Schlafstörangen:mit Baldrian effektiv zu therapierenSchlafstörungen stellen ein sehr weit verbreitetes Problem dar, an dem bis zu 50 Prozent der Menschen zumindest zeitweise leiden. Das aber heißt nicht, daß sie alle auf die Einnahme klassischer Hypnotika wie Benzodiazepine angewiesen sind. Hilfreicher sind oft pflanzliche Arzneimittel wie Baldrian. Sie harmonisieren das Schlafverhalten, haben deutlich weniger Nebenwirkungen, führen nicht zur Gewöhnung und können - wenn rechtzeitig mit der Therapie begonnen wird - wahrscheinlich dem Übergang in ein chronisches Geschehen Vorbeugen. Darauf hat Dr. E. U. Vorbach, Darmstadt, beim 6. Phytotherapie-Kongreß in Berlin hingewiesen.
Die Wirkung von Baldrian ist gut belegtDaß Baldrian (Valeriana officinalis) tatsächlich eine gute schlafregulierende Wirksamkeit entfaltet, haben nach Vorbach kontrollierte Studien gezeigt. Die volle Wirksamkeit kommt jedoch erst innerhalb einer mehrtägigen Behandlung zum Tragen, so daß mit der Einnahme rechtzeitig begonnen werden sollte. Das hat noch einen anderen Grund: Schlafstörungen neigen zur Chronifizierung, und zwar induziert über eine Fehlkonditionierung. Nicht wenige Betroffene haben vor der nächsten durchwachten Nacht regelrecht Angst, was den Schlaf nachhaltig stört und sich oft wie in einem Teufelskreis zur chronischen Insomnie auswächst.
Dem gilt es vorzubeugen, was nach Vorbach oft durch eine rechtzeitige Behandlung mit Baldrianwurzel-Extrakt möglich ist. Daß sich das Schlafverhalten durch Baldrian bessern läßt, belegte der Mediziner anhand einer multizentrischen, randomisierten Doppelblindstudie bei 121 Patienten mit behandlungsbedürftiger nicht-organischer Insomnie (ICD-10, F51.0). Eine Gruppe von 61 Patienten erhielt 600 mg Baldrian-Trockenextrakt (LI 156, Sedonium®, Lichtwer Pharma), die anderen 60 Patienten erhielten Placebo.
Nach zweimal vier Wochen wurde die Wirksamkeit der Therapie überprüft, und zwar anhand von Schlafratings durch den Arzt, mit Hilfe des klinischen Gesamteindrucks (Clinical Global Impressions, CGI), über die Befindlichkeitsskala nach von Zerssen und den Schlaffragebogen nach Görtelmeyer.
Das Ergebnis: Bei allen Parametern ergab sich für die Verumgruppe ein statistisch signifikant besseres Resultat als unter Plazebo. Die Besserung war bereits nach 14 Tagen deutlich erkennbar und erreichte innerhalb von vier Wochen ausnahmslos Signifikanzniveau. »Es zeigte sich ein deutlicher Symptomabfall unter Verum und beim klinischen Gesamteindruck sogar eine hochsignifikante Verbesserung gegenüber Plazebo«, sagte Vorbach. Die Patienten erklärten nicht nur, besser zu schlafen, sondern sich nach dem Schlaf auch deutlich erholter zu fühlen.
Großes Plus: gute Verträglichkeit, kein AbhängigkeitspotentialAnders als bei herkömmlichen Hypnotika wird die Verbesserung der Nachtruhe beim Baldrian aber nicht mit einer erhöhten Rate an Nebenwirkungen oder gar einer Gewöhnung erkauft. So traten unerwünschte Begleiterscheinungen unter Verum und Plazebo mit je zwei Fällen gleichermaßen häufig auf, eine Abhängigkeitsproblematik gibt es unter dem Phytotherapeutikum nicht.
Privatdozent Dr. H. Schulz, Erfurt, präsentierte in Berlin zwei Untersuchungen, bei denen die sedierenden Wirkungen verschiedener Phytopharmaka (Baldrian, Melisse, Lavendel, Passiflora, Kava-Kava, Escholzia californi- ca und Johanniskraut) mit Hilfe des quantifizierten EEGs untersucht wurden. Bei den Teilnehmern handelte es sich um Frauen im Alter zwischen 44 und 60 Jahren mit leichter nicht-organischer Insomnie. Die Studien waren plazebokontrolliert, als Referenzsubstanz wurde Diazepam (10mg) ver
abreicht, um die Sensibilität des Prüfmodells zu steigern, wurde zudem die Interaktion mit 100mg Coffein untersucht.
Wie unter Diazepam kam es nach Schulz auch unter Baldrian (und geringer ausgeprägt auch unter Lavendel und Kava-Kava) innerhalb von zwei Stunden nach der Medikamenteneinnahme zu einer Zunahm« der subjektiv empfundenen Müdigkeit. Unterschiede zeigten sich jedoch im EEG: Während unter Diazepam eine vermehrte Aktivität im Beta-Frequenzband und eine Zunahme der Delta-Aktivität registriert wurde, zeigte sich unter den Phytopharmaka, insbesondere unter Baldrianextrakt, eine Zunahme der langsamwelligen Aktivität im Delta-, Theta- und Alpha-Frequenzbereich. Diese sedativen Effekte konnten durch die Gabe von Coffein ant- agonisiert werden. Der schlafregulierende Effekt des Baldrians läßt sich nach Schulz somit auch auf neuro- physiologischer Ebene belegen.
Daß es zu signifikanten Veränderungen im EEG unter dem pflanzlichen Arzneimittel kommt, demonstrieren ferner Untersuchungen, die Dr. F. Donath von der Berliner Charite präsentierte: In einer plazebokontrollierten doppelblinden Studie bei 16 gesunden männlichen Probanden stellte er ebenfalls fest, daß die einmalige Gabe von 1200mg Baldrian-Trockenextrakt (Sedonium®) zu einer signifikanten Leistungsverstärkung in den Frequenzbändern Delta, Theta führt. Nach wiederholter Gabe von täglich 600mg Baldrianwurzel-Extrakt über einen Zeitraum von 14 Tagen manifestiert sich im quantifizierten EEG ein Anstieg in den Theta-, Alphal- und Betal-Fe- quenzbereichen. Diese EEG-Verände- rungen sind typisch für die beruhigende und angstlösende Wirkung und objektivieren damit den psychosedati- ven Effekt des Baldrians
(Christine Vetter)
Z. Allg. Med. 1996; 72: 179. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
• •
180 FORUA4 QUALITÄT
Was wünschen Patienten vom Hausarzt?Erste Ergebnisse aus einer europäischen Gemeinschaftsstudie
Einleitung
Die Einbeziehung der Perspektive der Patienten im Rahmen der Qualitätssicherung kann wichtige Hinweise auf Probleme bzw. Versorgungslücken geben, die von seiten der Ärzte nicht unmittelbar erkennbar sind oder in ihrer Bedeutung anders eingeschätzt werden (1). Die Erwartungen und die Zufriedenheit von Patienten sind dabei kein objektives Maß für ihre Bedürfnisse oder für die Qualität ärztlicher Versorgung. Sie können von verschiedenen Faktoren abhängen, zum Beispiel von der Lebensgeschichte des Patienten, seinem aktuellen emotionalen Befinden, bisherigen Erfahrungen mit Ärzten sowie seinen Möglichkeiten, Erwartungen und Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit wahrzunehmen und auszudrücken (2-7). Dennoch sollten positive und negative Rückmeldungen von Patienten wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung sein. Es ist daher wichtig, Patienten zu befragen und die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Bedeutung und Umsetzbarkeit kritisch zu diskutieren.
Zur Zeit werden in Deutschland zwei größere Studien durchgeführt, die sich mit der Bewertung der haus- ärztlichen Versorgung durch Patienten befassen, ln beiden Projekten geht es zunächst darum zu ermitteln, welche Aspekte der hausärztlichen Versorgung aus Sicht der Patienten besonders wichtig sind. Dierks et al. berichteten vor einiger Zeit im Forum Qualität von den Ergebnissen einer Erhebung von Patientenerwartungen im Rahmen von Gruppendiskussionen (8). Hier sollen erste Ergebnisse aus dem deutschen Teil einer europäischen Gemeinschaftsstudie vorgestellt werden, in
der Erwartungen und Wünsche an den Hausarzt mit Hilfe eines Fragebogens erhoben werden.
Die europäische Gemeinschaftsstudie
Im Dezember 1993 gründete sich in Nijmegen eine Arbeitsgruppe mit Wissenschaftlern aus sieben europäischen Ländern (Dänemark, Deutschland, England, Holland, Norwegen, Portugal und Schweden) mit dem Ziel, ein geeignetes Erhebungsinstrument (Fragebogen) zu entwickeln, um die Erfahrungen von Patienten mit der hausärztlichen Versorgung und die Bewertung dieser Erfahrungen zu erfassen und international miteinander zu vergleichen. Indem Patienten aus unterschiedlichen Gesundheitssystemen parallel befragt werden, kann die Bedeutung der Rahmenbedingungen (z.B. freie Arztwahl oder Liste, Zugang zum Facharzt nur über den Hausarzt oder auch direkt, Hausarzt selbständig oder angestellt) für die medizinische Behandlung und für die Beziehung zwischen Hausarzt und Patient mit untersucht werden. Von besonderem Interesse für die deutsche Arbeitsgruppe sind außerdem Unterschiede in den Erwartungen und Erfahrungen von Patienten aus den alten und neuen Bundesländern.
Das Projekt umfaßt drei Teilstudien: In der »Priorities Study« sollen die wichtigsten Aspekte der hausärztlichen Versorgung aus Patientensichtermitteltwerden. Aufgrund der Ergebnisse dieser ersten Teilstudie wird ein Fragebogen zur Bewertung der Versorgung entwickelt und eine internationalen Vorstudie, die »Validation Study«, durchgeführt. An
hand der in dieser Studie gesammelten Erfahrungen wird der Fragebogen überprüft und weiterentwickelt und in seiner endgültigen Fassung in der »International Comparison Study« eingesetzt.
Im Frühjahr 1995 wurde im Rahmen der Priorities Study die erste Befragung durchgeführt. Im Rahmen des Gesamtprojekts dient dieser Studienteil vor allem der Auswahl der wichtigsten Items (Fragen, Aussagen) für die weiteren Erhebungen. Darüber hinaus ergaben sich interessante Einblicke auch in bezug auf die unterschiedliche Gewichtung der Items durch Patienten z.B. in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter, Wohnort (alte und neue Bundesländer) u.a..
Methoden
Um eine möglichst große Zahl von Patienten zu erreichen und einen internationalen Vergleich zu ermöglichen, wurde ein Fragebogen mit vorformulierten Aussagen zur hausärztlichen Versorgung als Erhebungsinstrument gewählt. Die Auswahl der Items erfolgte auf der Grundlage von Literaturanalysen und eigenen Erfahrungen der beteiligten Wissenschaftler mit Patientenbefragungen (9-13). Der internationale Teil enthält 40 Aussagen, der deutsche Fragebogen wurde um zusätzliche 16 Items erweitert. Jede Aussage sollte zunächst von den Patienten auf einer 5teiligen Skala bezüglich ihrer Wichtigkeit bewertet werden (gar nicht wichtig/nicht sehr wichtig/wichtig/ sehr wichtig/besonders wichtig). Sie umfassen die Bereiche:
• Medizinisch-technische Versorgung,
• Arzt-Patient-Beziehung,• Persönliche Eigenschaften des
Arztes,• Information, Aufklärung und
Unterstützung,• Verfügbarkeit und Erreichbarkeit,• Organisation der Praxis,• Verschiedenes.
Z. Allg. Med. 1996; 72: 180-186. © Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1996
SalhuminRheuma-Bad
Natürlich die Heilkraft des Moorestransdermal die Wirkung der Salicylsäure
Die chronischen Formen des Rheumas erfordern eine chronische Therapie. Nutzen und Risiko bestimmen die Wahl der Arzneimittel im Therapie-Plan.
Salhumin Rheuma-Bad wirkt systemisch und transdermal. Deshalb sind auch die Risiken minimiert.
Die natürliche Fleilkraft des Moores und die antirheumatische Potenz der Salicylsäure: Salhumin Rheuma-Bad ist natürlich transdermal wirksam.
Salhumin® Rheuma-Bad Zusammensetzung: 100 g enthalten Salicylsäure 67 g, Huminsäuren, Natriumsalze (45%) 5,55 g, entsprechend Huminsäuren 2,5 g; Natriumsulfat, Farben E 110, E 124, E 151.1 Beutel mit 37 g = 1 Vollbad. Anwendungsgebiete: Rheumatismus, Ischias, Arthrosen. Gegenanzeigen: Größere Hautverletzungen, akute Hautkrankheiten, fieberhafte und infektiöse Erkrankungen, Herzinsuffizienz, Hypertonie, vorgeschädigte Niere, Schwangerschaft. Nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern. Dosierung und Anwendung: AWe 2 Tage ein Vollbad. Handelsformen und Pre/se; 6 Vollbäder (N 1) DM 32,73, 12 Vollbäder (N 2) DM 61,65, 24 Vollbäder (N 3) DM 112,09 Bastian-Werk GmbH, 81245 München
Stand 06/1995
ZALAINLokales Breitbandantimykotikum
IHRE SCHNELLE P1 LZ - EX-CREME.ZaIaYn® Wirkstoff: Sertaconazolnitrat. Lokales Breitbandantimykotikum. Zusammensetzung: 1 g ZalaVn® Creme enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 20 mg Sertaconazolnitrat. Sonstiger wirksamer Bestandteil: 1 mg Methyl-4-hydroxybenzoat. Weitere Bestandteile: Sorbinsäure, Gemisch aus Glycerolmonoisostearat/Glyceroldiisostearat und Polyethylenglycolestern, Polyethylenglycol-1500-(mono, di)stearat, Poly(oxyethylen)-6-glycerol(mono, di) alkanoat (C12-C18), dickflüssiges Paraffin, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Pilzinfektionen der Haut, verursacht durch Hefen oder Dermatophyten. Gegenanzeigen: Zalai'n® Creme darf nicht angewendet werden bei: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem anderen Bestandteil der Creme; bei Patienten mit Überempfindlichkeit gegenüber Methyl-4-hydroxybenzoat (Parabenen). Klinische Erfahrungen zur Anwendung während der
Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Um einen Kontakt mit Säuglingen zu vermeiden, darf ZaIaTn® Creme in der Stillzeit nicht im Brustbereich angewendet werden. Nebenwirkungen: In sehr seltenen Fällen Hautreizungen wie Rötung, Brennen und Juckreiz. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bisher keine bekannt. Darreichungsform,Packungsgrößen und Preise: OP mit 1 Tube ä 20 g Creme N 1 DM 15,01; OP mit 1 Tube ä 50 g Trommsdorff GmbH & Co,Creme N 2 DM 32,84. Anstaltspackung. Verschreibungspflichtig. Stand der Information; April 1995. Arzneimittel • 52475 Alsdorf
••
FORUM QUALITÄT 183
In einem zweiten Schritt sollten von den jeweils acht Aussagen eines Themenbereichs die vier wichtigsten ausgewählt und in eine Rangfolge gebracht werden. Zusätzlich wurden einige Fragen zur Person (Alter, Geschlecht, Familienstand, Bildungsstand, Häufigkeit der Arztbesuche, chronische Krankheit etc.) und zum allgemeinen Gesundheitszustand (Schmerzen, Schlaf etc.) gestellt. Um den Patienten die Gelegenheit zu geben, ergänzend eigene Aussagen zu machen, wurden der deutschen Version offene Fragen hinzugefügt.
In einer kleinen Pilotstudie (1 Praxis, 20 Fragebögen) wurde das Instrument auf Akzeptanz und Verständlichkeit überprüft. Die Auswahl der Arztpraxen erfolgte auch im Hinblick auf die Verteilung in der Grundgesamtheit: Beteiligt waren je vier Praxen aus ländlicher Gegend, Kleinstadt und Großstadt, davon acht Einzel- und vier Gemeinschaftspraxen. Acht Praxen waren aus den alten und vier aus den neuen Bundesländern. In den 12 Praxen wurden, je nach Rücklaufquote, 60 oder mehr Fragebögen ausgeteilt, bis jeweils ein Rücklauf von mindestens 35 auswertbaren Bögen pro Praxis erreicht war. Die Ärzte waren gebeten worden, die Patienten nicht auszuwählen und nur diejenigen auszuschließen, die unter 16 Jahre alt waren oder denen es - z.B. wegen sprachlicher Schwierigkeiten - nach Einschätzung des Arztes nicht möglich wäre, die Fragen zu verstehen bzw. zu beantworten. Die Fragebögen wurden, jeweils zusammen mit einem adressierten und freigestempelten Rückumschlag (»Porto zahlt Empfänger«) versehen, vom Arzt oder von der Arzthelferin an die Patienten ausgegeben mit der Bitte, sie zu Hause auszufüllen und (anonym) an uns zurückzusenden.
Signifikante Unterschiede der Bewertungen der Aussagen durch verschiedene Patientengruppen wurden mit dem Mann-Whitney-Rang-
summen-Test auf einem Signifikanz niveau von p < 0,05 ermittelt (14).
Ergebnisse
429 der 435 an uns zurückgesandten Fragebögen waren auswertbar, die Rücklaufquote betrug insgesamt 39,5%. Das Alter der befragten Patienten reichte von 16 bis 88 Jahre mit einem Durchschnitt von 49,2 Jahren. Es beteiligten sich 162 Männer und 255 Frauen (12 Patienten ohne Angabe des Geschlechts). 297 Patienten wohnten in den alten, 150 Patienten in den neuen Bundesländern. 73,9% gaben an, daß ihnen das Ausfüllen des Fragebogens »(auch) Spaß gemacht« habe, 91,8% hielten eine Patientenbefragung für »wichtig« oder »sehr wichtig«. Die mit 3 zur Wahl stehenden Antwortmöglichkeiten gestellte Frage »Wie scheint Ihnen eine Patientenbefragung am sinnvollsten?« wurde
von 69,9% mit »Fragebogen«, von 20,5% mit »Einzelbefragung mündlich« und von 5,8% mit »Gruppendiskussion« beantwortet (8,2% ohne Angaben; vereinzelt wurden zwei Möglichkeiten angekreuzt). Aufgrund der Wertungen aller 429 Patienten (%-Wertungen »sehr wichtig« und »besonders wichtig«) wurde zunächst eine allgemeine Rangfolge der Wichtigkeit der Aussagen aufgestellt.
Die 20 am höchsten bewerteten Aussagen (Tab. 1) machen vor allem den Wunsch der Patienten nach Erreichbarkeit und Verfügbarkeit des Hausarztes, VerläßlichkeitWertrauen, Information und Kommunikation, Offenheit/Ehrlichkeit, Eachkom- petenz, emotionaler Unterstützung und Beratung deutlich. Für Tabelle 2 wurden Aussagen ausgewählt, die sich auf die besondere Funktion des Hausarztes beziehen. (Dabei erga-
Tabelle 1: Was macht einen guten Hausarzt oder eine gute Hausarztpraxis aus?
Die 20 ranghöchsten Aussagen von 56
Ein Hausarzt sollte...
% Angaben sehr wichtig oder
besonders wichtig
Rang
1 im Notfall schnell zur Hilfe sein 88,72 sorgfältig sein 88,13 genügend Zeit haben zum Zuhören/Reden/Erklären 87,54 mir alles sagen, was ich über meine Krankheit wissen will 84,25 es mir ermöglichen, offen über meine Probleme zu reden 82,46 offen und ehrlich sein 81,97 alle Informationen über seine Patienten vertraulich behandeln 81,78 Nützlichkeit von MedikamentenWerordnungen kritisch abwägen 79,19 über neueste Entwicklungen in der Medizin informiert sein 77,4
10 zuhören können 76,111 vorbeugende Maßnahmen anbieten 75,712 schneller Termin sollte möglich sein 74,213 Untersuchung und Behandlung genau erklären 73,014 ermutigen 69,515 Hausbesuche machen 69,416 Es sollte möglich sein, jedesmal beim selben Arzt behandelt zu werden 68,817 verstehen, was ich von ihm will 66,918 über Fachärzte beraten 66,919 meine Meinung ernst nehmen 66,920 mir vertrauen 66,8
Schriftliche Befragung von 429 Patienten beim Hausarzt.
••
184 FORUM QUAUTATTabelle 2: Was macht einen guten Hausarzt oder eine gute Hausarztpraxis aus?
Ausgewählte Aussagen zur besonderen Funktion des Hausarztes% Angaben
sehr wichtig oderEin Hausarzt sollte... besonders wichtig
Rang
I im Notfall schnell zur Hilfe seinII vorbeugende Maßnahmen anbieten15 Hausbesuche machen16 Es sollte möglich sein, jedesmal beim selben Arzt behandelt zu werden 18 über Fachärzte beraten27 informiert sein, wie sein PraxispartnerA^ertreter mich behandelt hat 32 Interesse zeigen an mir als Person und an meiner Lebenssituation34 die verschiedenen medizinischen Leistungen und Behandlungen,
die ich bekomme, koordinieren35 bereit sein, regelmäßige Gesundheitskontrollen durchzuführen36 nur an einen Facharzt überweisen, wenn es schwerwiegende Gründe gibt 41 mich oft besuchen, wenn ich ernsthaft erkrankt bin49 Es sollte möglich sein, daß der selbe Arzt die ganze Familie behandelt50 sollte meinen Angehörigen Hilfestellung geben, mich zu unterstützen 52 über Organisationen oder Gruppen informieren, die praktische und
persönliche Unterstützung bieten können
Schriftliche Befragung von 429 Patienten beim Hausarzt.
88.775.769.468.8 66,9 59,357.5
56.154.654.249.136.233.2
25.2
ben sich Überschneidungen mit den Aussagen in Tabelle 1.)
In den Antworten auf die offenen Fragen wurde im Hinblick auf das Überweisungsverhalten im Gegensatz zu der Aussage auf Rang 36 [Tab. 2) mehrfach betont, der Hausarzt möge »rechtzeitig überweisen«, »mit Fachärzten Zusammenarbeiten«, »nicht lange herumexperimentieren«.
Aussagen, die den Wunsch nach Respektierung von Autonomie aus- drücken - »soll meine Meinung ernst nehmen« (66,9%), »meine Wünsche mit mir besprechen« (62,4%), »meine Entscheidungen akzeptieren« (58,5), »akzeptieren, wenn ich alternative Behandlung wünsche« (39,9%) - stehen in der allgemeinen Rangfolge auf den Plätzen 19, 24, 31 und 47.
Die Aussage: »Wenn ich einen Termin habe, sollte ich im Wartezimmer nicht lange warten müssen« wurde von 43,6% der Patienten für »sehr wichtig« oder »besonders
wichtig« gehalten und steht damit auf Platz 43 in der Rangfolge.
Bei einer Gruppierung der Patienten z.B. nach Geschlecht, Alter und Wohnort (alte/neue Bundesländer) zeigen sich wesentliche Unterschiede hinsichtlich der jeweils geäußerten Erwartungen. Um einen Überblick über die relativ hohe Zahl von signifikant unterschiedlich bewerteten Aussagen geben zu können, wurden im folgenden bei der Darstellung der Ergebnisse die wesentlichen Inhalte der Aussagen zusammengefaßt.
Geschlecht: Frauen bewerteten 9 der 56 Aussagen signifikant höher als Männer. Der Schwerpunkt dieser Aussagen liegt auf dem Bedürfnis nach Gespräch und persönlicher Zuwendung, nach Ernst-genommen- Werden und Respektierung der Wünsche und Entscheidungen des Patienten sowie nach Informationen und nach örthcher Erreichbarkeit der Praxis. Männer bewerteten keine Aussage signifikant höher als Frauen.
Alter: Die meisten Unterschiede ergaben sich im Zusammenhang mit dem Alter: Bei einer Einteilung der Patienten in zwei Altersgruppen wurden von der Gruppe der Unter- 50-Jährigen 23 der 56 Aussagen für signifikant wichtiger befunden als von Patienten ab 50 Jahre und älter, die Gruppe der älteren Patienten dagegen bewertete nur 5 Aussagen wichtiger als die jüngeren Patienten. Jüngere Patienten haben demnach höhere Erwartungen hinsichtlich schneller Erreichbarkeit (kurzfristiger Termin, kurze Wartezeit), Gespräch und persönlicher Zuwendung, Information und Aufklärung; der Arzt soll Fachkompetenz besitzen und sorgfältig sein, aber auch seine eigenen Grenzen eingestehen und die Eigenständigkeit des Patienten respektieren. Stärker als jüngere Patienten äußern Patienten ab 50 Jahre dagegen das Bedürfnis nach Betreuung und Entlastung.
Alte und neue Bundesländer: Eine ähnliches Bild ergibt sich beim Vergleich von Patienten aus den alten und den neuen Bundesländern: Er- stere betonen mehr den Wunsch nach Eigenständigkeit und schätzen es, wenn der Arzt zugeben kann, wenn er etwas nicht weiß, sie äußern höhere Erwartungen in bezug auf Gespräche mit dem Arzt, persönliche Zuwendung und Verständnis für die eigenen Wünsche, aber auch im Hinblick auf medizinisches Fachwissen. Patienten aus den neuen Bundesländern heben demgegenüber mehr den Wunsch nach Entlastung bei der Bewältigung des Alltags und nach Betreuung (Hausbesuche) im Falle einer schweren Erkrankung hervor. Sowohl ältere Patienten als auch Patienten aus den neuen Bundesländern scheinen demnach eine mehr paternalistische Versorgung durch den Arzt zu suchen, die Wünsche von jüngeren Patienten bzw. von Patienten aus den alten Bundesländern gehen eher in Richtung einer partnerschaftlichen Beziehung.
••
FORUM QUAUTAT 185
Diskussion
Verschiedene Methoden zur Erfassung der Erwartungen und der Zufriedenheit von Patienten sind mit jeweils unterschiedlichen Vor- und Nachteilen z.B. im Hinblick auf die Auswahl der Patienten, die Variationsbreite der erfaßten Aspekte oder die Durchführbarkeit verbunden. Die im Rahmen unserer Erhebung festgestellte deutliche Bevorzugung einer Befragung mit Hilfe eines Fragebogens durch die Patienten hängt sicher auch damit zusammen, daß hier schon eine Auswahl von Patienten vorliegt, die an einer schriftlichen Befragung teilnehmen, und daß bei den Teilnehmern Erfahrungen mit mündlicher Einzelbefragung und Gruppendiskussionen vermutlich kaum vorliegen.
Einzelinterviews können individuelle und tiefere Einblicke in die Sichtweise und die Erfahrungen von Patienten geben als andere Methoden, sie sind aber aus finanziellen und zeitlichen Gründen nicht in größerem Umfang möglich und hinsichtlich der Repräsentativität begrenzt.
Dierks berichtet von guter Durchführbarkeit und hoher Akzeptanz von Focus-group-discussions durch Ärzte und Patienten. Sie nimmt darüber hinaus an, daß mit dieser Form der Befragung ältere Menschen und Menschen mit niedrigem Schulabschluß besser erreicht werden als mit anderen Erhebungsmethoden (8). Gleichzeitig ist aber anzunehmen, daß Patienten, die Schwierigkeiten haben, in eine Gruppe zu gehen oder dort ihre Meinung zu vertreten, sowie diejenigen, die zeitlich bzw. räumlich wenig flexibel sind, in Befragungen dieser Art unterrepräsentiert sind.
Vorteil von Gruppendiskussionen und von offenen Fragen im Rahmen schriftlicher Befragungen ist, daß die Patienten sich in ihren eigenen Worten äußern können. Eine Schwäche des von uns verwendeten Fragebo
gens mit vorformulierten Aussagen liegt darin, daß die Sprache der Patienten vermutlich nicht immer getroffen werden konnte und einzelne Fragen möglicherweise nicht richtig verstanden wurden. Es kann daher angenommen werden, daß vor allem Patienten mit niedrigem Bildungsstand oder hohem Alter unterrepräsentiert sind.
Bei beiden Formen der Befragung (geschlossene bzw. offene Fragen) besteht die Gefahr, daß bestimmte Aspekte der ärztlichen bzw. hausärztlichen Versorgung nicht erfaßt werden; Sei es, weil sie bei der Auswahl der Items von seiten der Wissenschaftler nicht berücksichtig wurden, sei es, weil bestimmte Erwartungen von seiten der Patienten nicht spontan formuliert werden, z.B. weil sie nicht bewußt sind, für selbstverständlich oder auch für zu anspruchsvoll bzw. nicht erfüllbar gehalten werden. Wir haben versucht, durch eine Kombination von offenen und geschlossenen Fragen einen möglichst großes Spektrum an Erwartungen zu erfassen. Es ist anzunehmen, daß die Länge und die Kompliziertheit des eingesetzten Instruments eine Ursache für die geringe Rücklaufquote ist und tendenziell zu einer Auswahl von Patienten mit höherem Bildungsstand geführt hat. Für die folgenden Studienteile ist die Entwicklung eines kürzeren und einfacheren Fragebogens geplant.
Bei Betrachtung der am höchsten bewerteten Aussagen (Tab. 1) fällt auf, daß der Wunsch, der Hausarzt möge »im Notfall schnell zur Hilfe sein« an erster Stelle steht. Diese Aussage ist vermutlich nicht nur unter dem Aspekt der medizinischen Notfall- Versorgung zu verstehen, sondern auch im Hinblick auf die menschliche Beziehung zum Hausarzt: Er/sie sollte jemand sein, an den man sich in der Not wenden kann und auf den Verlaß ist. Die folgenden Aussagen in Tabelle 1 drücken überwiegend Erwartungen aus, die
an Ärzte unabhängig vom Fachgebiet gerichtet sein könnten und sich vor allem auf die allgemeinen menschhchen und fachlichen Qualitäten des Arztes beziehen. Tabelle 2 zeigt, daß die typisch hausärztlichen Funktionen (Notfallversorgung, Vorsorge, Hausbesuche, persönliche Beziehung, Beratung und Vermittlung zu anderen Ärzten bzw. anderen Formen der Hilfe, Berücksichtigung der Lebenssituation des Patienten, regelmäßige Betreuung, Familienbetreuung) zwar in unterschiedlichem Ausmaß, aber jeweils von einem beträchtlichen Teil der Patienten (rund 89% bis 25%) für »sehr wichtig» oder »besonders wichtig» gehalten werden.
Die hier gezeigten Unterschiede zwischen den Erwartungen jüngerer und älterer Patienten sowie von Patienten aus den alten und aus den neuen Bundesländern erscheinen auf dem Hintergrund unterschiedlicher Erziehung bzw. Sozialisierung nachvollziehbar. Es ist anzunehmen, daß jüngere Patienten und Patienten aus den alten Bundesländern eher als die jeweilige Vergleichsgruppe gelernt haben, individuelle Wünsche zu äußern und im Laufe ihres Lebens größere Chancen hatten, daß diese auch erfüllt wurden. Dabei ist hervorzuheben, daß Bedürfnisse nach Betreuung und Versorgung bzw. nach Respektierung von Autonomie zwar unterschiedlich hoch bewertet, aber grundsätzlich von jeder Gruppe geäußert werden.
Möglicherweise äußern bei Patientenbefragungen diejenigen Patienten ihre Bedürfnisse weniger deutlich, die auch sonst weniger Chancen haben, Forderungen zu stellen und sie durchzusetzen (s.o.). Bei der Interpretation von Befragungsergebnissen ist daher zu berücksichtigen, daß die »fordernden« Patienten für andere mit sprechen können, aber vielleicht auch tendenziell andere Bedürfnisse haben als die »zurückhaltenden« oder »schweigenden« Patienten.
••
186 FORUM QUALITÄTNicht zuletzt sollte berücksichtigt werden, daß auch die Arbeitssituation der Ärzte hinterfragt werden muß, wenn es um die an sie gerichteten Erwartungen geht. Daß dafür auch die Patienten Verständnis haben können, zeigen (schriftliche) Äußerungen wie; »Man kann vom Arzt nicht Perfektionismus verlangen, er ist auch nur ein Mensch«, oder: »Der Arzt sollte nicht wie Knetmasse behandelt werden und auch menschlich bleiben dürfen.«
Ausblick
Danksagung
Für die Mitarbeit im ersten Teil der Studie danken wir Frau Dr. Vittoria Braun, Herrn Dr. Matthias Ertel, Frau Dr. Helge Gerke, Herrn Dr. Justus Graubner, Herrn Dr. Antal Kendoff, Frau Dr. Christa Kirchner, Herrn Dr. Joachim Klingebiel, Herrn Dr. Thomas Lichte, Herrn Dr. Matthias Lindstedt, Frau Dr. Karin Müller-Scheffsky, Herrn Dr. Ernst Scholl und Herrn Dr. Wolfgang Stehle sowie den beteiligten Patienten.
ren europäischen Ländern ist aufgrund der Ergebnisse der Validation
Study und der International Comparison Study zu erörtern, wie Unzufriedenheit von Patienten zu interpretieren ist, wo Ursachen dafür liegen können und wie Verbesserungen möglich sind.
Literatur beim Verfasser
Autoren:A. Klingenberg, 0. Bahrs, J. Szecsenyi AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im GesundheitswesenHospitalstr. 27 37073 Göttingen Tel.: 05 51/5415 26 Fax.: 05 51/5415 09
Um Möglichkeiten zu finden, Kritik und Anregungen von Patienten in die Qualitätssicherung einzubinden, sollten weitere Erfahrungen mit Patientenbefragungen gesammelt werden. Auch wenn hinsichtlich der Aussagekraft von Befragungsergebnissen noch erheblicher Forschungsbedarfbesteht (2, 3, 7), sollte die Perspektive der Patienten im Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsförderung ihren festen Platz haben. Die Erhebungen im Rahmen der folgenden beiden Teile der europäischen Vergleichsstudie sollen Einblicke geben, inwieweit Patienten das Gefühl haben, daß ihre Erwartungen in bezug auf den eigenen Hausarzt erfüllt werden bzw. womit sie besonders unzufrieden sind. Im Dialog mit Ärzten und im Vergleich mit den Ergebnissen aus den ande-
Forum Qualität
Dr. med. Ferdinand M. Gerlach, MSP (federführend)Medizinische Hochschule Hannover Abt. Allgemeinmedizin Konstanty-Gutschow-Straße 8 30625 Hannover
Dr. med. Dipl.-Soz. Joachim Szecsenyi (federführend)AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen Hospitalstraße 27 37073 GöttingenTel. 05 51/5415-26/-27, Fax 05 51/5415-09
Dr. med. H.-H. Abholz, Berlin
Prof. Dr. med. M. M. Kochen, MPH, FRCGP, Göttingen
Schreiben - (k)eine Kunst?Workshop für Autorinnen (und vor ollem solche, die es werden wollen)
• Daß Ärzte und Ärztinnen in der hausärztlichen Praxis nicht schreiben können (oder wollen), ist ein oft gehörtes Vorurteil.
• Daß in den Archiven dieser Praxen Daten-Schätze vergraben sind, die unbedingt gehoben werden sollten, ist eine unbestrittene Tatsache.
• Daß die Hebung der Schätze oft nur am Zeitmangel und am technischen »Rüstzeug« scheitert, davon sind wir überzeugt: Schreiben kann man lernen !
Ihre ZFA - Zeitschrift für Allgemeinmedizin und die Redaktion des Forum Qualität wollen mehr Hausärzte und -ärztinnen zur aktiven Mitarbeit gewinnen, denn auch wir haben uns gefragt, weshalb so wenige der Berichte, die uns erreichen, aus der Praxis oder aus den Qualitätszirkeln kommen.
Wir vermitteln Ihnen die notwendigen »Künste«
Unter fachkundiger Leitung wollen wir Ihnen zeigen, wie man Texte zeitsparend und auf den Punkt hin schreiben kann. Unser Autorinnen-Workshop dauert von Freitag, 14. Juni (20 Uhr) bis Samstag, 15. Juni 1996 (ca. 17 Uhr) und findet in den Räumen des »Arbeitskreises Qualitätssicherung in der Allgemeinmedizin« (AQUA) in Göttingen statt. Die Teilnahme ist auf zehn Personen begrenzt. Bei mehr als 10 Anmeldungen entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Bei ausreichendem Interesse wird das Seminar wiederholt.
Teilnahme, Unterkunft und Verpflegung sind kostenlos, Ihre Reisekosten müssen Sie allerdings selbst tragen.
Was müssen Sie bringen?Zwei kleine Hürden haben wir vor der Teilnahme aufgebaut:
l.Sie schicken uns vorab einen von Ihnen selbst verfaßten Beitrag (Umfang maximal 6 Schreibmaschinenseiten) zu den Themenbereichen Qualitätszirkel oder Qualitätsmanagement in der hausärztlichen Praxis.
2. Sie versichern uns, daß Sie selbst niedergelassener Arzt bzw. niedergelassene Ärztin sind.
Den Beitrag senden Sie mit Angabe Ihrer Praxisanschrift bis zum 30. April 1996 an
AQUA - Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen Herrn Dr. Joachim Szecsenyi Hospitalstraße 27 37073 Göttingen Telefon (05 51) 54 15 27 Fax (05 51) 54 15 09.
Die von Ihnen eingesandten Beiträge wollen wir im Seminar gemeinsam diskutieren und bearbeiten. Die so erarbeiteten Texte sollen dann in der ZFA (Forum Qualität) veröffentlicht werden.
Günther Buck,(Redaktion ZFA)Ferdinand M. Gerlach, Joachim Szecsenyi (Redaktion Forum Qualität)
Schwedische Roggenpollen: Naturstoff für eines unserer erfolgreichsten Urologika in
I J«.SS
Das prostatotrope Antikongestivum■ abschwellend, antiphlogistisch, schmerzlindernd
■ hochwirksam bei Nykturie und Restharn
■ signifikante Ergebnisse in der Langzeittherapie
CerniltonDie Prostata-Kapsel
Strathmann AGhHamburg
Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Extract. Pollinis (2,5:1) 23 mg, standardisiert auf 4 mg Aminosäuren, berechnet als L-Glutaminsäure und 0,23 mg Phytosterole, berechnet als Stigmasterol. Anwendungsgebiete: Akute und chronische Reizzustände und Infektionen im urogenitalen Grenzbereich mit Beschwerden beim Wasserlassen: Prostatitis, Prostatovesikulitis, Urethritis. Chronische Entzündungen der Prostata, z. B. Stauungsprostatitis und Kongestion bei Prostatahyperplasie. Dosierung: 3x täglich 1-2 Kapseln. Darreichungsformen: OP mit 60 (NI); 120 (N2); 200 (N3) Kapseln zu DM 27,70; DM 47,61; DM 68,80. Strathmann AG Hamburg. Stand Januar1996 64/22
188
Cerebrale und periphere Durchblutungsstörungen:
Ginkobilratiopharm
Bei Hirnleistungsstörungenz.B.
KopfschmerzenSchwindelDurchblutungsstörungenKonzentrationsschwäche
S
ratiophami
I
O«fcH4Ca690r0lJ*"
GinkobilWirkstoff; Trockenextrakt aus Ginkgo-bibba-Blättem
ratiopharm
20 Filmtabletten
1 GinkobiP ratiopharm TüfiiptfsiiD
□ OP 100 ml Lösung N1 A DM 49,80OP 200 ml Lösung N2 (U DM93,70
Ginkobil®-N ratiopharm
!□
GinkobiP-N ratiopharm Fllmtabletten/GinkobiP ratiopharm Tropfen Zusammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ginkobil”-N ratiopharm: 1 Filmtabl. enth. Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67:1) 40 mg, eingestellt auf 9,6 mg Ginkgoflavonglykoside und 2,4 mg Terpenlactone (Ginkgolide, Bilobalid). Auszugsmittel: Aceton-Wasser. Ginkobil'^’ ratiopharm Tropfen: 1 ml Lösung (entspr, 20 Tropfen) enth. Trockenextrakt aus Ginkgo-biloba-Blättern (35-67 ;1) 40 mg, eingestellt auf 9,6 mg Ginkgoflavonglykoside und 2,4 mg Terpenlactone (Ginkgolide, Bilobalid). Auszugsmittel: Aceton-Wasser. Sonstige Bestandteile: Ginkobil'^-N ratiopharm: Lactose, Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, Siliciumdioxid, Carnauba- wachs, Methylhydroxypropylcellulose, Magnesiumstearat, Talcum, Farbstoffe E171, E172, Macrogole. Ginkobil* ratiopharm Tropfen: Saccharin-Natrium, Glycerol, Propylenglykol, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen
OP 30 Filmtabletten N1 OP 50 Filmtabletten N2 OP 100 Filmtabletten N3
QDM 18,98 DM 28,20 DM 49,50
Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsstörungen im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei dementieilen Syndromen mit der Leitsymptomatik: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmungen, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Verbesserung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlußkrankheit bei Stadium II nach Fontaine (Claudicatio intermittens) im Rahmen physikalisch-therapeutischer Maßnahmen, insbesondere Gehtraining. Schwindel, Tinnitus (Ohrgeräusche), vaskulärer und involutiver Genesa. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Extrakte. Nebenwirkungen: Sehr selten: Leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Bisher nicht bekannt, ratiopharm GmbH & Co, 89070 Lllm/04129 Leipzig 1/96