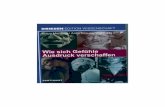„Der mechanische Materialismus und die Sinnlosigkeit der Welt in Büchners ‘Leonce und Lena’."...
Transcript of „Der mechanische Materialismus und die Sinnlosigkeit der Welt in Büchners ‘Leonce und Lena’."...
DER MECHANISTISCHE MATERIALISMUS UND DIE SINNLOSIGKEIT DER WELT IN BÜCHNERS LEONCE UND LENA
Peter Horn (Universität Kapstadt) Im Sommer 1836 verfaßt Büchner für einen von Cottaausgeschriebenen Lustspielpreis das Drama Leonce undLena. Schon im März desselben Jahres hatte BüchnerGutzkow mitgeteilt, daß er vorhabe, in ZürichVorlesungen über Philosophie zu halten. In denExzerpten zu seinem Vorlesungsplan - „Die Entwicklungder deutschen Philosophie seit Cartesius" - findetsich folgende Stelle, die darauf hindeutet, daßBüchner mit dem Begriff des l'homme machine, zumindestin der Cartesianischen Ausprägung durchaus vertrautwar. Mit offensichtlicher Ironie zitiert Büchner denganzen hydraulischen Apparat des descartschenMaschinemenschen: das „Centralfeuer im Herzen", die„Zum Hirn aufsteigenden spiritus animales", die imNervengeist schwebende Zirbeldrüse, „als Residenz derSeele", die Nerven als hydraulische Druckleitungen mitVentilen, kurz, der homme machine „wird vollständigvor unseren Augen „zusammengeschraubt".1 Während Descartes der Auffassung ist, Tiere seiennichts als seelenlose Maschinen, Automaten, undzugibt, auch der Körper des Menschen könne als einesolche Maschine betrachtet werden, versuchte erdennoch den Begriff der Seele als nichtmaterielleSubstanz des eigentlich Menschlichen zu retten. Inseinen Exzerpten macht nun Büchner auf die Problematik1 GEORG BÜCHNER, Sämtliche Werke und Briefe, Historisch-Kritische Ausgabe mitKommentar, hg. von WERNER R. LEHMANN, Bd. 2 (Hamburg 1971), S.179.
2
eines solchen Dualismus von Körper und Seeleaufmerksam: Wie kann, fragt sich der junge Arzt undPhilosoph, Körperliches auf Seelisches, und umgekehrtSeelisches auf Körperliches einwirken; an Descartesbemängelt er, er habe nicht erklärt, „worin dieReaction zwischen Zirbeldrüse und Seele bestehe", undweist ihm so eine grundsätzliche Widersprüchlichkeitin seinem System nach; Descartes habe ja in den erstenGrundsätzen seines Systems einen scharfen Unterschiedzwischen Denken und Ausdehnung gemacht.2 Auf ArnaudsEinwände gegen Descartes zurückgreifend, plädiertBüchner für die Materialität der Seele - mit demArgument, sie sei an körperliche Organe geknüpft, inKindern scheine sie zu schlafen, in Wahnsinnigenvernichtet zu sein.3 Die Ironie Büchners richtet sichalso nicht gegen den Materialismus Descartes', sonderngegen die phantastische Detailstruktur seinermenschlichen Maschine, die durch die fortschreitendenErkenntnisse der Naturwissenschaften unhaltbargeworden war,4 und vor allem gegen Descartes'Dualismus von Geist und Materie. Immer noch aberinteressierte sich Büchner für das Modell des hommemachine und für die praktischen Folgen eines solchenModells für die Ethik und die Justiz. Die Notizen zurGeschichte der Philosophie führen leider über Spinozanicht hinaus; es ist daher mit Sicherheit nichtfestzustellen, ob Büchner JULIEN OFFRAY DE LAMETTRIE's L'Homme Machine kannte, oder ob er sich überden weiteren Verlauf der von Descartes initiiertenDiskussion nur indirekt informiert hat. Ohne Zweifelist immerhin die direkte und indirekte Fortwirkung
2 Ebd., S. 1853 Ebd., S. 1994 Vgl. GERHARD JANCKE, Georg Büchner: Genese und Aktualität seines Werkes.Einführung in das Gesamtwerk, Scriptor Taschenbücher, S. 56(Kronberg/Ts. 1975), S. 267
3
dieses berühmt-berüchtigten Buches und seiner für das18. und 19. Jahrhundert weithin unannehmbarenSchlußfolgerung, der Mensch sei eine Maschine und dasganze Universum bestehe aus einer einzigen Substanz(der Materie).5 Diese Idee verbreitet sich durch dieVermittlung Diderots, D'Holbachs und Jean Paul Maratsund wurde zum heftig umkämpften, selten wirklichverstandenen wissenschaftlichen Skandalon des späten18. und frühen 19. Jahrhunderts. Noch Schillersabgelehnte Magisterschrift Versuch über den Zusammenhang der tierischenNatur des Menschen mit seiner geistigen gehört in diesem Zusammenhang.6
Theologen, Philosophen und Ärzte verwenden viel Zeit und Mühedarauf, die religiös, politisch und moralisch unerträglicheLehre zurückzuweisen.7 Und wie zu erwarten, haben diese"Widerlegungen" nur den skandalösen Erfolg dieses Werkesgesichert. In Deutschland nahmen Feuerbach, Vogt,Moleschott, Czolbe das Gedankengut La Mettries auf,und Georg Büchners Bruder Ludwig wird derPopularisator des Gedankens werden, im Universum gebees nichts außer Materie und Bewegung.8 In seinemaufsehenerregenden Buch Kraft und Stoff (1855) vertritt er dieAuffassung, daß die "gleichmäßig weiche Masse" des Gehirns„alleiniger Grund und Ursache einer so unendlich feinen undkomplizierten Maschinerie sei, wie sie uns die thierische undmenschliche Seele darstellt".9
Auch war es bei der theoretisch-philosophischen Diskussionnicht geblieben. Der Erfinder Vaucanson hatte bereits einen
5 JULIEN OFFRAY DE LA MATTRIE. L'Homme Machine suivi de L'art de Jouir,Introduction et notes de MAURICE SOLOVINE, Editions Bossard(Paris 1921), S. 1426 FRIEDRICH SCHILLER, Theoretische Schriften, Erster Teil, dtv-Gesamtausgabe. Bd. 17 (München 1966), S. 657 Vgl. ARAM VARTANIAN, La Mettrie's L'Homme Machine: A study in the origineof an idea (Princeton, New Jersey 1960), S. 95-113.8 Zit. nach PIERRE NAVILLE, D'Holbach et la philosophie scientifique auXVIIIe siêcle, Editions Gallimard (Paris 1967), S. 2309 LOUIS BÜCHNER, Kraft und Stoff. Empirisch-naturphiosophische Studien inallgemeinverständlicher Darstellung (Leipzig 1864).
4
mechanischen Flötenspieler erfunden, es gab verschiedeneVersuche einen mechanischen Schachspieler zu erfinden, und manmeinte, es sei grundsätzlich möglich, einen sprechendenMaschinenmenschen zu konstruieren)10 Die Faszination, diederlei Ideen für das 18. und 19. Jahrhundert hatten,ist bekannt. In den Wirkungsbereich dieser Ideengehört der Homunculus in Goethes Faust ebenso wie dieAutomaten bei E. T. A. Hoffmann. Die Vorstellung desMenschen als Maschine verdrängt den Menschen nicht nuraus seiner ausgezeichneten Stellung in der Natur alseinziges geistbegabtes Seelenwesen mit einem freienWillen, sondern liefert ihn auch dem „gräßlichenFatalismus" der physikalischen Abläufe aus, die keinenfreien Willen und kein Ziel kennen. Ethik ist damiteine Illusion geworden in der unerbittlichen Kette vonUrsache und Wirkung in ihrer völligen Gleichgültigkeitgegenüber humanen Werten. Eine solche streng gesetzmäßige Sinnlosigkeit desWeltlaufs scheint das Maschinengleichnis Valeriosgegen Ende von Leonce und Lena vorauszusetzen:
Aber eigentlich wollte ich einer hohen undgeehrten Gesellschaft verkündigen, daß hiermitzwei weltberühmte Automaten angekommen sind,und daß ich vielleicht der dritte und
10 Vgl. MICHAEL MACNAMARA/PETER HORN, „Can Machines produceArt?", De Arte 1 (1967) Nr. 2, S. 29f. Jacque de Vaucanson(1709-82) präsentierte im Jahre 1738 der Académie des sciencesseinen berühmten joueur de flûte, den er in seinem Buch Mécanismedun flûteur automate beschrieb. Weitere komplexere Automatenfolgten - z.B. ein joueur de tambourin et de galoubet und ein aspicsifflant eti s'élancant sur le sein de Cléopatre - und im Jahre 1748 wurde erin die Acadêmie des sciences aufgenommen. La Mettrie kannteihn: „s'il a fallu plus d'art à Vaucanson pour faire sonFluteur, que pour son Canard, il eût dû en emploier encoredavantage pour faire un Parleur; Machine qui ne peut plus êtreregardée comme impossible, surtout entre ]es mains d'un nouveauProméthée." Vgl. VARTANIAN [ Anm. 7], S. 246f. und S. 190.
5
merkwürdigste von beiden bin, wenn ich eigentlichselbst recht wüßte, wer ich wäre, worüber man übrigenssich nicht wundern dürfte, da ich selbst gar nichts vondem weiß, was ich rede, ja auch nicht einmal weiß, daßich es nicht weiß, so daß es höchst wahrscheinlich ist,daß man mich nur so reden läßt, und es eigentlichnichts als Walzen und Windschläuche sind, die das Allessagen. Mit schnarrendem Ton. Sehen Sie hier meine Damenund Herren, zwei Personen beiderlei Geschlechts, einMännchen und ein Weibchen, einen Herrn und eine Dame.Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts alsPappendeckel und Uhrfedern. Jede hat eine feine,feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zeheam rechten Fuß, man drückt sie ein klein wenig und dieMechanik läuft volle fünfzig Jahre. Diese Personensind so vollkommen gearbeitet, daß man sie vonanderen Menschen gar nicht unterscheidenkönnte, wenn man nicht wüßte, daß sie bloßePappendeckel sind; man könnte sie eigentlich zuMitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen.11
Büchner greift in seiner Probevorlesung „ÜberSchädelnerven"12 nur scheinbar die l'homme machineAuffassung an; in Wirklichkeit richtet sich seinAngriff nicht gegen einen konsequenten Materialismusund die Auffassung an sich, der Mensch sei eineMaschine, sondern gegen die der teleologischen Schulezugrundeliegende metaphysische Überzeugung, daß in derNatur alles einem großen Zweck untergeordnet sei. Diereligiösen Implikationen eines solchen teleologischverstandenen mechanischen Materialismus hat auch Heineklar gesehen: „Diese Materialisten waren meistens auchAnhänger des Deismus, denn eine Maschine setzt einenMechanikus voraus".13 Indem die Materialisten den
11 BÜCHNER [Anm. 1], Bd. 1, S. 131.12 Ebd., Bd. 2, S. 29113 HEINRICH HEINE, Sämtliche Schriften, hg. von KLAUS BRIEGLEB(München 1971), Bd. 3. S. 557.
6
Menschen als l'homme machine sehen, haben sie ihm dieSelbsttätigkeit und die Mündigkeit genommen und habensich so der Möglichkeit beraubt, die Entwicklung derWelt anders als durch eine nicht selbst verursachteUrsache, einen Gott, der diese Mechanik in Bewegunggebracht hat, zu erklären. Wir aber, sagt Heine, „sinddem Deismus entwachsen. Wir sind frei und wollen keinedonnernden Tyrannen. Wir sind mündig und bedürfenkeiner väterlichen Fürsorge. Auch sind wir keineMachwerke eines großen Mechanikus. Der Deismus isteine Religion für Knechte für Kinder, für Genfer, fürUhrmacher".14 Heines Ansatzpunkt ist in erster Liniedie Kritik an den ideologischen Implikation desmechanischen Materialismus; Büchners Angriff richtetsich gegen die philosophische Unhaltbarkeit derTeleologie und der Physiko-Theologie. Gegen dieBehauptung, in der Natur diene alles einemallumfassenden Zweck, setzt er den Satz: „Alles, wasda ist, ist um seiner selbst willen da".15 Die Gesetzeder Natur sind ihm kausale, nicht teleologische: „DieThränendrüse ist nicht da, damit das Auge feuchtwerde, sondern das Auge wird feucht, weil dieThränendrüse da ist."16 Büchner bezieht sich hier auf Kant, der in seiner Kritikder teleologischen Urteilskraft gezeigt hat, „daß es bloß eineFolge aus der besonderen Beschaffenheit unseresVerstandes sei, wenn wir die Produkte der Natur nacheiner anderen Art der Kausalität, als der Naturgesetzeder Materie, nämlich nur nach der der Zwecke undEndursachen uns als möglich vorstellen"17 und daß14 Ebd., S. 571.15 BÜCHNER [Anm. I], Bd. 2, S. 29216 Ebd., S. 291.17 IMMANUEL KANT, Kritik der Urteilskraft, hg. von WILHELM WEISCHEDEL,Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 57 (Frankfurt/M 1974), S. 362(A346).
7
unsere Erkenntnis der Natur durch eine solcheErklärungsart nicht im mindesten gefördert werde; wennwir uns „auf eine nach Zwecken wirkende Ursacheberufen: so würden wir ganz tautologisch erklären, unddie Vernunft mit Worten täuschen."18 Es läßt sich zwar so zeigen, daß Büchnerswohldurchdachte, wenn auch von ihm selber immer wiederproblematisierte Philosophie atheistisch undmaterialistisch ist und auf dem Begriff der kausalen,nicht der teleologischen Determination aufbaut.Dennoch wäre es verkehrt, in Valerios unzweifelhaftironischer Rede über den Menschen als Automaten eineArt materialistische Glaubensbekenntnis des Autors zuerblicken, wie nahe auch immer rein inhaltlichValerios Auffassung dem Naturwissenschaftler Büchnergelegen haben mag. Zu leicht erläge der Germanist danndem Bierernst seiner eigenen Profession, auch dorttiefsinnige Ernsthaftigkeiten zu suchen, wo derDichter die Narrenkappe trägt. Der Interpret muß inErwägung ziehen, daß er auf einen Studentenscherzhereingefallen ist. Anzeichen dafür gibt es im Stückmehr als genug; darüber hinaus läßt sich dieEntstehungsgeschichte des Dramas aus den BriefenBüchners ziemlich zuverlässig ablesen. In dem schonerwähnten Brief an Gutzkow spricht Büchner zumBeispiel von der „Langeweile" des Studiums der Medizinund der Philosophie.19 An seinen Freund Eugen Böckelschreibt er am 1. Juni 1836, seine Doktorarbeit seieine „ekelhafte Arznei" gewesen; außerdem habe er keinGeld mehr, und müsse sehen, „wie ich mir in dennächsten 6-8 Wochen Rock und Hose aus meinem großenweißen Papierbogen, die ich vollschmieren soll,schneiden werde".20 An seinen Bruder Wilhelm Büchnerschreibt er schließlich mit stark ironischem Unterton18 Ebd., S. 365 (A350f.).19 BÜCHNER [ Anm. l], Bd. 2, S. 454.
8
über seine Pläne, „in meiner Eigenschaft alsüberflüssiges Mitglied der Gesellschaft meinenMitmenschen Vorlesungen über etwas ebenfalls höchstÜberflüssiges, nämlich die philosophischen Systeme derDeutschen seit Cartesius und Spinoza, zu halten".21 Ausden Briefen geht hervor, daß Büchner in dieser Zeitfast pausenlos arbeitet, sich kaum die Zeit nahm, ausdem Haus zu gehen, und daß er bei steigenderErschöpfung und unter dem Druck unbezahlter SchuldenLeonce und Lena sowohl als Mittel sah, zu Geld zukommen, als auch sich aus der ernsthaften undangestrengten Arbeit an der Geschichte der Philosophiewenigstens zeitweilig in die tolle Laune einer totalenParodie alles ernsthaften Tuns zu flüchten, speziellaber in eine Parodie der rationalistischen undidealistischen Philosophie. Das ist fast immerübersehen worden, denn mit wenigen Ausnahmen habenGermanisten eine Vorliebe für ernste Komödien undwenig Sinn für das Burleske.
IIHauptangriffspunkt der Satire Büchners ist dierationalistische und idealistische Seite derPhilosophie (Kant, Fichte und Hegel) .22 Indem er die
20 Ebd., S. 457; vgl. auch ebd., Bd. 1, S. 112: „Mein Lebengähnt mich an, wie ein großer Weißer Bogen Papier, den ichvollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus."(Leonce).21 Ebd., Bd. 2, S. 46022 VIËTORs Auffassung, daß die dargestellte Philosophieeindeutig als die Hegels zu identifizieren sei, ist aus demText selbst nicht zu belegen. Während Büchners Beschäftigungmit Spinoza einwandfrei nachweisbar ist, gibt es nur eineeinzige verhältnismäßig späte Reminiszenz seines FreundesLudwig Wilhelm Lucks (11. Sept. 1978), die daraufhin weist, daßBüchner Hegel überhaupt gekannt hat. Vgl. GEORG BÜCHNER, Werkeund Briefe, hg. von FRITZ BERGEMANN, dtv-Gesamtausgabe (München1965), S. 303E, und KARL VIËTOR, Georg Büchner. Politik,
9
Terminologie dieser Philosophie der „feierlichenNull"23 - dem König Peter - in den Mund legt,verwandelt er sie in leeres Geplapper, mechanischbewegte, warme Luft. Daß diese monarchische Puppe sichauch noch als Inkarnation des Menschen sieht und dieVerpflichtung des Menschen zu denken an sich reißt, jafür seine Untertanen denken will, „denn sie denkennicht, sie denken nicht",24 treibt die Satire auf dieSpitze und gibt ihr eine eindeutig politischeRichtung: daß der Fürst als Spitze des Staates dasRecht usurpiert zu denken und damit gleichzeitig dasRecht, im eigentlichen Sinne des Wortes Mensch zusein, ist eine groteske Verkehrung, aber gleichzeitigeine inhärente Konsequenz des Idealismus, wie sie sichin dem von Büchner so heftig angegriffenen HegelschenSatz formuliert: „Alles, was wirklich, ist auchvernünftig, und was vernünftig, auch wirklich", derHegel die Apotheose des preußischen Staates als Zielder Bewegung des Weltgeists erlaubte. Schon am Anfangseines Philosophiestudiums hatte Büchner den Verdacht,es gäbe in der Philosophie „im Grunde genommen dochnichts als taube Nüsse zu knacken".25 So kehrt dieTerminologie der Definitiones der Ethik von Spinoza, wiesie Büchner in seinen Exzerptheften getreulichherausschreibt, als leeres Wortgeklingel in KönigPeters Rede wieder:
Die Substanz ist das 'an sich', das bin ich. Erläuft fast nackt im Zimmer herum. Begriffen? An sichist an sich, versteht ihr? Jetzt kommen meine
Dichtung, Wissenschaft (Bern 1949), S. 181.23 VIËTOR [ Anm. 22], S. 181.24 BÜCHNER [ Anm. 1], Bd. l, S. 108.25 Ebd., Bd. 2, S. 421.
10
Attribute, Modificationen, Affectionen undAccidenzien, wo ist mein Hemd, meine Hose?26
Wenn man das Wort „Substanz" im Sinne Spinozas nimmt -und die Terminologie „Attribute", „Modificationen",„Affectionen" und „Accidenzien" legt das nahe -, dannbehauptet König Peter praktisch seine Identität mitGott: In der XIV. der Propositiones heißt es nämlich:
Außer Gott kann es keine Substanz geben oderbegriffen werden. Beweis. Gott ist das absolutunendliche Seyn, dem kein Attribut welches dasWesen der Substanz ausdrückt, abgesprochenwerden kann (Prop. VI), und existiertnotwendigerweise (Prop. XI). Wenn es eineSubstanz außer Gott gäbe, so müßte durchirgendein Attribut Gottes ausgedrückt werden,daß es zwei Substanzen von gleichen Attributengeben würde, was nach Prop. V absurd ist;folglich kann es außer Gott keine Substanzgeben oder gedacht werden. Denn wenn siegedacht werden könnte, so müßte sie nothwendigals seyend gedacht werden, was nach dem erstenTheil dieser Demonstration absurd ist. Es kannalso außer Gott keine Substanz geben nochgedacht werden .27
Die Gottgleichheit des Königs, eine Übersteigerungnoch des Gottesgnadentums, entlarvt sich angesichtsdes marionettenhaften Königs Peter allerdings alsleere Aufgeblasenheit; und umgekehrt zeigt dieMöglichkeit der Anwendung des Wortes „Substanz" auf
26 Ebd.. Bd. 1. S. 108.27 Ebd., Bd. 2, S. 242. In seinen kritischen Notizen zu Spinozagreift Büchner vor allem die Proposition V. an, die behauptet:„Es kann nicht mehrere Substanzen von gleicher Natur odergleichen Attributen geben", und kritisiert daher dann auch dieProposition XIV., die wesentlich auf Proposition V. beruht.
11
diesen König durch ihre groteske Unangemessenheit dieideologische Funktion einer solchen idealistischenPhilosophie. Gleichzeitig gestaltet Büchner in dieserSzene, wie Jancke richtig gezeigt hat, die Verwandlungdes Menschen „an sich" in den König durch das Anlegenseiner "Attribute", "Modificationen", "Affectionen"und "Accidenzien" - seiner Kleider und der Insigniender gesellschaftlichen Macht.28 Ähnlich verfährt Büchner mit dem DescartschenHauptsatz "Cogito, ergo sum": die Descartsche Prämisse- "ich denke" - wird verwandelt in eineSollensforderung, die zudem an die Menschheit imallgemeinen gerichtet ist: "Der Mensch muß denken".Die ganze zweite Szene des ersten Akts zeigt nun KönigPeter als einen, der nicht denkt, als einen, der derForderung, die an den Menschen gestellt wird, nichtnachkommt. Statt der immerhin rationalistischenKlarheit des Descartschen Satzes kommt es so zunächstzur Desorientiertheit des königlichen Ichs: "Wenn ichso laut rede, so weiß ich nicht, wer es eigentlichist, ich oder ein Anderer, das ängstigt mich."Schließlich wird aber die Descartsche Conclusioeinfach dekretiert: "Ich bin ich". Doch statt derzumindest behaupteten intellektuellen Sicherheit desDescartschen Satzes, der den Prozeß des Zweifelsstillegt, kommt es sofort wieder zum Zweifel an demeben Behaupteten: „Was halten Sie davon, Präsident?"und der Zweifel ritualisiert sich in der feierlichenAntwort des Präsidenten und der chorhaftenWiederholung des Staatsrats:
PRÄSIDENT gravitätisch langsam. Ja, vielleicht istes so, vielleicht ist es aber auch nicht so. DER GANZE STAATSRATH IM CHOR. Ja, vielleicht
28 JANCKE [ Anm. 4], S. 256
12
ist es so, vielleicht ist es aber auch nichtso.29
Während seines Studiums des Descartes hatte Büchnerbereits seine Bedenken gegen die philosophischeZulässigkeit des Satzes selbst geäußert:
In welcher Eigenschaft denkt sich nun Cartesiusseinen ersten Grundsatz der gewissenErkenntniß? Er erklärt sich nirgends deutlichdarüber, sondern scheint sich selbst in derBeziehung nicht klar gewesen zu seyn. Nacheiner Stelle in dem 10.§ des I. Buches principiorumscheint er ihn als den Schlußsatz einesVernunftschlusses angesehen zu haben ... Dochstreitet wieder sein ganzer Weg vom Zweifel zurGewißheit dagegen, er sagt selbst er wolle mitdem Ersten, Einfachsten anfangen, ist alsocogito der Untersatz und ergo sum der Schlußsatzeines Vernunftschlusses, so ist der fehlendeObersatz das Erste: fieri non potest, ut quid cogitet nonexistat. Dießer Obersatz selbst aber kann erstdurch den Schlußsatz bewiesen werden, es wärealso ein Cirkelschluß.30
Mit einer radikalen Wendung gegen die abstrakterationalistische Spekulation behauptet Büchner danndie empirische Natur alles positiven Wissens: „DieExistenz seiner und der Dinge außer uns wird auf reinpositive, unmittelbare, von der Function des Denkensunabhängige Weise erkannt".31 In Leonce und Lena wird Descartes Vernunftschluß nun voneiner anderen, ebenfalls empirischen, aber diesmaleminent praktischen Seite her angegriffen: wenn man
29 BÜCHNER [Anm. 1], Bd. l, S. 109.30 Ebd., Bd. 2, S. 13931 Ebd., Bd. 2, S. 140
13
die Existenz des Menschen vom Denken her beweisenwill, dann müßten die Menschen eben auch denkenkönnen. Wie beweist derjenige seine Existenz, dernicht denken kann? Umgekehrt: Beweist die Unfähigkeitdes Königs Peter seine Nichtexistenz? Daseulenspiegelhafte Wörtlichnehmen der „Kunstsprache"der Philosophie führt zu Absurditäten; gleichzeitigaber entlarvt es das rationalistische Denken alsAusdruck der herrschenden Klasse: indem es vomwirklich konkret Gegebenen (z.B. der Denkunfähigkeitdes Königs Peter) absieht, verleugnet es im Denken dieempirische Realität und gibt sich den irrealenKonstruktionen eines wirklichkeitsfernen Denkens hin.Wenn der König sich in dieser Sprache an sein Volkerinnern will, so bleibt der Begriff „Volk" ebensoabstrakt wie der Begriff Substanz: die soziale Not desVolkes, wie sie sich in der zweiten Szene des drittenAktes konkret darstellt, kommt nicht in den Blick.Solch ein abstraktes „Volk" kann dann per Befehlaufgefordert werden, sich „von freien Stücken,reinlich gekleidet, wohlgenährt, und mit zufriedenenGesichtern" längs der Landstraße aufzustellen,32 so alsseien diese Attribute einfach durch ein königlichesFiat herstellbar oder als sei die materielle Not desVolkes auf seinen bösen Willen zurückzuführen.Ebenso wie die Abstraktheit der Ich-Vorstellung greiftBüchner die Abstraktheit der Konzeption des „freienWillens" an. In seinen Notizen zu Cartesius hatte erdessen Lehre vom freien Willen kurz so zusammengefaßt:
Die Seele kann zwar die Leidenschaften selbstnicht zerstören, denn dieselben beruhen inkörperlichen Ursachen, aber sie kann durch
32 Ebd., Bd. 1, S. 127.
14
ihren Willen die Wirkungen derselben verhindernund so absolut Herr über sie werden.33
Die Reduktion des freien Willens auf die (Kontrolleüber die?) Sexualorgane in König Peters Ausruf -„Halt, pfui! der freie Wille steht davorn ganz offen.Wo ist die Moral, wo sind die Manschetten?" -ironisiert Descartes Vorstellung, der freie Willekönne absolut Herr über die Triebe werden. Daß der„Wille" allein unzureichend ist, zeigt die Szene mitdem Knoten im Schnupftuch: „an was wollte ich micherinnern?" (meine Hervorhebung). Ebensowenig hilft derBeschluß, „daß meine königliche Majestät sich an diesemTag freuen und daß an ihm die Hochzeit gefeiert werdensollte", auch wenn es so „protokolliert undaufgezeichnet" war.34 Die Absurdität der idealistischenLehre von der menschlichen Willensfreiheit zeigt sichdann in folgendem Dialog:
PETER. Habe ich nicht mein königliches Wortgegeben? Ja, ich werde meinen Beschluß sogleichins Werk setzen, ich werde mich freuen. Er reibtsich die Hände. O ich bin außerordentlich froh! PRÄSIDENT. Wir theilen sämmtlich die GefühleEurer Majestät, so weit es für Unterthanenmöglich und schicklich ist. PETER. O ich weiß mir vor Freude nicht zuhelfen [... ] aber, aber, die Hochzeit? Lautetdie andere Hälfte des Beschlusses nicht, daßdie Hochzeit gefeiert werden sollte? PRÄSIDENT. Ja, Eure Majestät. PETER. Ja, wenn aber der Prinz nicht kommt unddie Prinzessin auch nicht? PRÄSIDENT. Ja, wenn der Prinz nicht kommt unddie Prinzessin auch nicht, - dann - dann -
33 Ebd., Bd. 2, S. 19034 Ebd., Bd. 1, S. 129
15
PETER. Dann, dann? PRÄSIDENT. Dann können sie sich allerdingsnicht heirathen.35
Der Dialog endet mit dem „Trost": „Ein königlichesWort ist ein Ding, - ein Ding, - ein Ding, - dasnichts ist." Der Versuch das Gefühl, das eigentlichSpontane im Menschen, dem rationalen Willen zuunterwerfen, führt zum entleerten und mechanischenZeremoniell des Hofes, das Gefühle auch dann nochspielt, wenn die realen Voraussetzungen dafür nichtgegeben sind: ebendadurch wird der Höfling mit seiner„Höflichkeit" zum Automaten, dessen Gefühlsregungenund Bewegungen dem Räderwerk des höfischen Ritusfolgen müssen. Die leichtfertige Satire auf die rationalistische undidealistische Philosophie leitet sich so zwareinerseits aus dem Überdruß des Studenten her, dererfährt, wie er „ganz dumm in dem Studium derPhilosophie" wird, und der dabei „die Armseligkeit desmenschlichen Geistes wieder von einer neuen Seitekennenlernt",36 andererseits aber enthält diese Satireimmer einen Zug ins Gesellschaftskritische, indem sieneben der Lächerlichkeit des Idealismus auch dessenideologische Funktion aufdeckt. Dem Angriff gegen dieLehre von der Willensfreiheit komplementär nun ist derAngriff gegen einen mechanistischen Determinismus, wieer in Valerios Rede vom Menschen als Maschineenthalten ist; denn ebenso wie die Lehre vom freienWillen des Menschen in ihrer idealistischen Form istauch die Lehre von der völligen Determiniertheit desMenschen der Herrschaftsideologie dienstbar zu machen,wenn man sie dazu benutzt, die Vorstellung einer vomMenschen gewollten Veränderung der, Verhältnisse zu
35 Ebd., Bd. l, S. 129f.36 Ebd., Bd. 2, S. 450.
16
diskreditieren. Auch aus diesem Grunde ist ValeriosRede nicht als Glaubensbekenntnis des Schriftstellerszu lesen. Was Valerios Diatribe von jeder ernsthaftenund sich wissenschaftlich selbst ernstnehmenden Redeunterscheidet, ist das Element der Hyperbolik mitdeutlicher Verfremdungsabsicht über das Glaubwürdigehinaus, damit aber, wie Herbert Anton gezeigt hat, dieMöglichkeit der Sprache - und somit des menschlichenGeistes - sich von der pragmatischen Funktion desRedens zu emanzipieren. Das Stilmittel der Ironie istweit mehr nur als ein Stilmittel unter anderen: dieIronie ist die Freiheit des Geistes (nicht desWillens!) gegenüber dem Fatalismus der Natur und derGeschichte, die eben dadurch, daß der Geist sich sovon der Notwendigkeit emanzipiert, die stupideKausalität selbst in Frage stellt, wenn auch nichtaufhebt.37 Indem Valerio sich selbst als Automaten37 37. HERBERT ANTON, „Die mimische Manier' in Büchners Leonceund Lena", in Das deutsche Lustspiel, hg. von HANS STEFFEN(Göttingen 1968), S. 229. NOAM CHOMSKY weist daraufhin, daßDescartes zu der Überzeugung gelangte, „daß alle Aspektetierischen Verhaltens sich auf Grund der Annahme erklärenlassen, daß das Tier ein Automat sei ... Doch kam er zu demSchluß, daß der Mensch einzigartige Fähigkeiten besitzt, diesich nicht auf rein mechanistischer Grundlage fassen lassen,wenngleich eine solche mechanistische Erklärung sich in sehrgroßem Maß für die Funktion des menschlichen Körpers und seinVerhalten anbietet. Der wesentlichste Unterschied zwischenMensch und Tier zeigt sich am klarsten in der menschlichenSprache, insbesondere in der Fähigkeit des Menschen neueAussagen zu formulieren, die neue Gedanken zum Ausdruck bringenund neuen Situationen angepaßt sind". Obwohl Büchneroffensichtlich Descartes' idealistische Beschreibung der Seelezurückweist, scheint er doch die menschliche Praxis derkreativen Sprache als Anzeichen einer über den Mechanismus undden Determinismus hinausgehenden Struktur des Menschenbegriffen zu haben, und daher, von einem materialistisch-empiristischen Ausgangspunkt aus, eine Auffassung derspezifisch menschlichen Eigenart entwickelt zu haben, die sich
17
bezeichnet und sich selbst jede Einsicht in dasabspricht, was er doch als Rede formuliert, „da ichselbst gar nichts von dem weiß, was ich rede, ja auchnicht einmal weiß, daß ich es nicht weiß", schlägt diebis aufs äußerste getriebene Lehre vom l'homme machinedurch eben diese Übertreibung ins Absurde undWidersprüchliche schließlich doch in eine ArtBestätigung der in der Rede geleugneten Freiheit desmenschlichen Geistes um, da eben nur dieser inFreiheit spielende menschliche Geist dieBewußtlosigkeit des eigenen Handelns einesteilspostulieren und im selben Atemzug verneinen kann. Dierhetorische Dialektik, die dem Menschenleben den Sinnabspricht und im selben Atemzug in der Freiheit deskünstlerischen Spidls den Sinn als eben diese Freiheitvoraussetzt, relativiert den tödlichen Ernst einerWissenschaftlichkeit, die eine doch nie faßbareabsolute Wahrheit bis zur Selbstzerstörung desMenschen mit scheinbar unschlagbarer logischerSchlüssigkeit zu verfolgen vorgibt, die aber, in einemmechanistischen Kausaldenken befangen, dieBesonderheiten der menschlichen Maschine, die aufeigenartige Weise dialektisch gleichzeitig in derKausalität befangen und ihr doch in anderer Weiseenthoben ist, verständnislos übersieht. Die Ironie ist also weit mehr als Spielerei. Sie istdie Antwort des Menschen auf die nihilistischeVerzweiflung, in die ihn eine illusionszerstörenderationalistische Philosophie auf mechanisch-deterministischer Grundlage gestürzt hat. Gegenüberder Descartes, wenn auch unter Vorbehalten, wieder nähert. Vgl.NOAM CHOMSKY, Cartesianische Linguistik: Ein Kapitel in derGeschichte des Rationalismus, übersetzt von RICHARD KRUSE(Tübingen 1971), S. 5f.; vgl. auch L . C. ROSENFIEI,D, FromBeast-Machine to Man-Machine (Fair Lawn, N.J. 1941); K.GUNDERSON, „Descartes, La Mettrie, Language and Machines",Philosophy 39 (1964), S. 193- 222>
18
der völligen Determiniertheit des Kosmos, der er nichtentfliehen kann, weil er selbst Materie ist, macht derMensch seine Freiheit geltend, die sich darin äußert,daß er eben diese so vorgefundene Welt durch seineArbeit verändert, die ihrerseits die Fähigkeit desMenschen, sich selbst Ziele zu setzen, voraussetzt.Nirgendwo bezeichnet Büchner in seinem Werk diesenkonkreten Punkt, in dem sich Determiniertheit undFreiheit zu einer dialektischen Synthese vereinigen(seine Abneigung gegen Hegels abstrakte Dialektik hatihm da den Zugang zu einer Lösung seiner Problematikversperrt), dennoch wehrt er sich intuitiv gegen einemechanistische Determiniertheit des Menschen. Dasbedeutet nun keineswegs, daß Büchner in der Manier deridealistischen Philosophie die menschliche Freiheitabsolut setzt und das Nicht-Ich zum Artefakt des Icherklärt: er bleibt sich der Begrenztheit dieserFreiheit und ihrer Gebundenheit an die tierischdeterminierte Natur des Menschen durchaus bewußt. Aberwie die Komödie sich seit jeher über Wanst undPhallus, den Menschen als Triebwesen, lustig macht,und im Gelächter noch die eigene Triebnatur bestätigtund sie gleichzeitig durch das Gelächter „aufhebt", sofindet sich Büchner in seinem Lustspiel mit dermechanistischen Determiniertheit des Menschen alsTriebwesen gleichzeitig ab und hebt sie doch in derFreiheit des ironischen Spiels auf.
IIIFür den höheren Schwindel des Idealismus, allerdings,der „in fataler Weise mit dem Sonnenschein im Herzenüber reale Not hinwegzutäuschen sucht, mithausbackener Sprichwortgemeinplätzigkeit alles als gutpreist, was besteht",38 hat Büchner nichts übrig. Undvon Schwindel kann man wohl dort zurecht sprechen, wo38 HANS MAYER, Georg Büchner und seine Zeit, Suhrkamp Taschenbuch, 58(Frankfurt/N4 1972), S. 314
19
die Triebnatur des Menschen sorgfältig ausgespart, woHunger, Sexualität und Aggressivität des Menschenverschwiegen werden, um auf dem Nichts bloßerrationalistischer Gedankenkonstruktionen ein höchst zuUnrecht so genanntes Humanitätsideal aufzubauen, dasnämlich am Menschen gerade das nicht sehen will, wasunzweifelhaft tierischer Herkunft, aber ebensounzweifelhaft Teil des Menschseins ist. Mit bitteremSarkasmus verspottet Büchner in einem Brief an seineFamilie die Dichtung des deutschen Idealismus, vorallem die Schillers:
Was noch die sogenannten Idealdichteranbetrifft, so finde ich, daß sie fast nichtsals Marionetten mit himmelblauen Nasen undaffectirtem Pathos, aber nicht Menschen vonFleisch und Blut gegeben haben, deren Leid undFreude mich mitempfinden macht, und deren Thunund Handeln mit Abscheu oder Bewunderungeinflößt. Mit einem Wort, ich halte viel aufGoethe oder Shakespeare, aber sehr wenig aufSchiller.39
Einen solchen Idealismus, der die Freiheit desMenschen nur als Repression seiner Triebe postulierenkonnte, betrachtet er als Anmaßung und „schmählichsteVerachtung der menschlichen Natur", und ließ in seinemWerk keine Gelegenheit aus, ihn zu düpieren. Soverkündet er in fast Brechtschen Worten im Woyzeck dieAbhängigkeit des Menschen von seiner „Natur" undverspottet den hausbackenen Idealismus des Doktors,der den freien Willen des Menschen an seiner Fähigkeitden Urin zu halten bewiesen sieht:
DOCTOR. Was erleb' ich Woyzeck? Ein Mann vonWort.
39 BüCHNER [Anm. 1], Bd. 2, S. 444
20
WOYZECK. Was denn Herr Doctor? DOCTOR. Ich hab's gesehn Woyzeck; Er hat aufdie Straß gepißt, an die Wand gepißt wie einHund. Und doch 2 Groschen täglich. Woyzeck dasist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehrschlecht. WOYZECK. Aber Herr Doctor, wenn einem die Naturkommt. DOCTOR. Die Natur kommt, die Natur kommt! DieNatur! Hab' ich nicht nachgewiesen, daß dermusculus constrictor vesicae dem Willenunterworfen ist? Die Natur! Woyzeck, der Menschist frei, in dem Menschen verklärt sich dieIndividualität zur Freiheit. Den Harn nichthalten können!40
Aber Büchner geht noch weiter, er entlarvt denIdealismus mit seinen hohen Ansprüchen an den Menschenals den Luxus derer, die das Geld haben, ihre Triebeohne Umstände zu befriedigen:
WOYZECK. Ja Herr Hauptmann, die Tugend! ichhab's noch nicht so aus. Sehn Sie, wir gemeineLeut, das hat keine Tugend, es kommt einem nurso die Natur, aber wenn ich ein Herr wär undhätt ein Hut und eine Uhr und eine anglaise undkönnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaftseyn. Es muß was Schöns seyn um die Tugend,Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl.41
Die Büchnersche Ironie ist also keine Verleugnung dermaterialistischen Auffassung, daß der Mensch seinenTrieben unterworfen sei; Büchners Ironie setzt dieseErkenntnis im Gegenteil voraus. Zwei Dinge trennenBüchner von dem optimistischen Materialismus, der sichaus der Erkenntnis der menschlichen Maschine die40 Ebd., Bd. l, S. 17441 Ebd.. Bd. 1, S. 172
21
fortschreitende, unendliche Perfektibilität desMenschen erhoffte, und für den daher die Vorstellung,daß vielleicht die ganze Erde eine solche planvollorganisierte Maschine sei, nichts Erschreckendeshatte: 1. der Verdacht, daß dieser Mechanismus nichtvernünftig ist; 2. eine erste Einsicht in dieKlassenkampfnatur der menschlichen Gesellschaft, dieeine Verbesserung des „Menschen" ausschließt, und diesich bei Büchner in der noch unzureichenden Praxis des„Mit-Leidens" ausdrückt. Jancke hat gezeigt, daß Pessimismus keineswegsnotwendigerweise aus Fatalismus oder Determinismushervorgehen müsse. Gerade bei den Calvinisten z.B. hatder Prädestinationsglaube keine Verzweiflung , sonderneinen Ansporn zu gottgewolltem Handeln hervorgebracht,und Cromwell sah alle seine Taten als von Gottgewollte Notwendigkeit, was ihn keineswegs gehinderthat, von Sieg zu Sieg zu streben, sondern seinemStreben unbeugsame Kraft verliehen hat. „Mit anderenWorten: wenn ich sehe, daß die objektiven, meinemWillen entzogenen Kräfte mich meinem Ziel näherbringen, verleiht mir der Glaube an diese KräfteHoffnung, wenn nicht Gewißheit des Erfolges; derGlaube an diese Gesetze müßte dann die Ursache eineroptimistischen Siegesgewißheit sein. Nur imumgekehrten Falle müßte eine pessimistischeVerzweiflung die Folge sein."42 Büchners„pessimistischere" Auffassung von der Geschichteergibt sich aus der Erkenntnis, daß allein das Volkrevolutionär sein könne, und der Erfahrung, daß imAugenblick im Volk nicht genügend revolutionäre Kräftevorhanden waren; nach dem „Experiment" mit dem
42 JANCKE [Anm. 4], S. 134f.; vgl. auch MAX WEBER, Dieprotestantische Ethik. Bd. I (München/Hamburg 1969), S. 322 und S.204, und GEORGI P. PLECHANOW. Über die Rolle der Persönlichkeit in derGeschichte (Berlin 1945), S. 7.
22
Hessischen Landboten sah Büchner dies ein, undverzichtete vorläufig auf jede weitere Aktion. DieEinsicht, „daß nur das nothwendige Bêdürfniß dergroßen Masse Umänderungen herbeiführen kann, daß allesBewegen und Schreien der Einzelnen vergeblichesThorenwerk ist",43 das ist die Einsicht in den„gräßlichen Fatalismus der Geschichte",44 die Büchneraber keineswegs davon abhält, „immer meinenGrundsätzen gemäß"45 zu handeln. Daß eine solcheEinsicht in die Nichtigkeit des Individuums vor denGesetzmäßigkeiten der Geschichte, vor allem dann, wenndas Individuum zu spüren vermeint, daß die Entwicklungder Zeit sich gegen ihn wendet - eine Erfahrung, mitder alle fortschrittlich gesinnten Schriftsteller derRestaurationsepoche zurechtkommen mußten - vor allemin Augenblicken körperlicher und geistiger Erschöpfungsich in einen fast nihilistischen Pessimismus, selbstZynismus hineinsteigern kann, erstaunt nicht, eher daßBüchner sich immer wieder mit Witz und schneidenderSatire, aber auch im echten Mit-Leiden mit den Opfernüber diese Zustände tiefster Mutlosigkeit erhob, undimmer erneut, wenn auch ohne Illusionen, zum Kampfgegen das verhaßte System antrat. Verständlich auch,daß der empfindliche Dichter die ihn umgebende Weltals eine abgestorbene, puppenhafte, sinnlosautomatische sah:
Das Gefühl des Gestorbenseins war immer übermir. Alle Menschen machten mir dashippokratische Gesicht, die Augen verglast, dieWangen wie von Wachs, und wenn dann die ganzeMaschinerie zu leiern anfing, die Gelenkezuckten, die Stimme herausknarrte und ich das
43 BÜCHNER [Anm. l l, Bd. 2, S. 41844 Ebd., Bd. 2, S. 42545 Ebd., Bd. 2, S. 418
23
ewige Orgellied herumtrillern hörte und dieWälzchen und Stiftchen im Orgelkasten hüpfenund drehen sah, - ich verfluchte das Concert,den Kasten, die Melodie und - ach, wir armenschreienden Musikanten.46
Büchner steht mit seiner Verzweiflung über denunerbittlichen Gang der Geschichte, der in seiner Zeitden Sieg des Inhumanen zu unterstützen schien, undseiner Auffassung von der Abgestorbenheit undMaschinenhaftigkeit der modernen Gesellschaftkeineswegs allein. Frivoler, eher der Tonart Valeriosals der Büchners in seinem sogenannten Fatalismus-Brief entsprechend, läßt Heine in seiner Harzreiseeinen betrunkenen Studenten auf dem Brocken wie folgt„philosophieren":
Meine Herren! Die Erde ist eine runde Walze,die Menschen sind einzelne Stiftchen darauf,scheinbar arglos zerstreut; aber die Walzedreht sich, die Stiftchen stoßen hier und da anund tönen, die einen oft, die andern selten,das gibt eine wunderbare, komplizierte Musik,und diese heißt Weltgeschichte .47
Wenn die Weltgeschichte wie in der Restaurationsepoche„rückläufig" geworden ist und die Hoffnung auf ein„Fortschreiten in eine menschlichere Zukunft sichnicht mehr direkt aus den Geschehnissen der Zeitablesen läßt, wenn die Geschichte gewissermaßen„stillgelegt" wurde und sich nach außen hin alsmonotoner Leerlauf und ewige Wiederkehr des immerGleichen zu erkennen gibt, dann stellt sich leicht dasBild vom Menschen als Puppe, Marionette oder Automatein. Auch in Aus den Memoiren des Herren von Schnabelewopski
46 Ebd., Bd. 2, S. 42447 HEINE [Anm. 13], Bd. 2, S. 150
24
zeichnet Heine das Bild einer solchen „gestorbenen"Gesellschaft: Die Linden des Jungfernstegs waren nur tote Bäume mitdürren Ästen, die sich gespenstisch im kalten Windbewegten. Der Himmel war schneidend blau und dunkeltehastig. Es war Sonntag, fünf Uhr, die allgemeineFütterungsstunde, und die Wagen rollten, Herren undDamen stiegen aus, mit einem gefrorenen Lächeln aufden hungrigen Lippen - Entsetzlich! in diesemAugenblick durchschauerte mich die schrecklicheBemerkung, daß ein unergründlicher Blödsinn auf allendiesen Gesichtern lag, und daß alle Menschen die ebenvorbeigingen in einem wunderbaren Wahnwitz befangenschienen. Ich hatte sie schon vor zwölf Jahren, umdieselbe Stunde, mit denselben Mienen, wie die Puppeneiner Rathausuhr, in derselben Bewegung gesehen, undsie hatten seitdem ununterbrochen in derselben Weisegerechnet, die Börse besucht, sich einandereingeladen, die Kinnbacken bewegt, ihre Trinkgelderbezahlt und wieder gerechnet: zweimal zwei ist vier -Entsetzlich! rief ich, wenn einem von diesen Leuten,während er auf dem Contoirbock säße, plötzlicheinfiele, daß zweimal zwei eigentlich fünf sei.48 Angesichts dieses sinnlosen mechanischen Reigenspostulieren sowohl Heine als auch Büchner, daß die"gebildete und wohlhabende Minorität" zum Aussterbenverurteilt ist:
Ich glaube, man muß in sozialen Dingen voneinem absoluten Rechtsgrundsatz ausgehen, dieBildung eines neuen geistigen Lebens im Volksuchen und die abgelebte moderne Gesellschaftzum Teufel gehen lassen. Zu was soll ein Ding,wie diese, zwischen Himmel und Erde
48 Ebd., Bd. 1, S. 515f.
25
herumlaufen? Das ganze Leben derselben bestehtnur in dem Versuch, sich die entsetzlichsteLangeweile zu vertreiben. Sie mag aussterben,das ist das einzig Neue, was sie noch erlebenkann.49
Langeweile ist der Lebensstil einer Epoche, die„zeitlos" ist, weil sie versucht, den historischenFortgang zu sistieren, und sich daher aus Furcht vordem Unvorhergesehenen, dem eigentlich„Revolutionären", im Gefängnis eines rituellenZeremoniells gefangen hält; Langeweile ist „diegesellschaftliche Empfindung jener Hemmung der Beförderung desNeuen"50 und des Verlustes jeder Zukunft, die anders ist alsdie Gegenwart. Während nun Langeweile, hervorgerufendurch den maschinengleichen Ablauf des Zeremoniells,Lebensstil des höfischen Adels ist, der von jedersinnvollen Tätigkeit entlastet ist, ist das Zeigen vonLangeweile potentiell Kritik an eben dieserGesellschaft und ihrem Lebensstil und daher verpönt.Leonce, als Prinz, kann sich innerhalb gewisserGrenzen erlauben, durch Zurschaustellung derLangeweile den Leerlauf sichtbar zu machen, der sichinzwischen von der höfisch-feudalen auf diebürgerliche Welt ausgebreitet hat, seit auch diese dieUmwälzung der Zustände eher verhindert als befördert.Die Kritik allerdings, wie immer wo Langeweile in derRestaurationszeit zum Thema wird, ist ehersymptomatisch als radikal, die Wurzeln des Übelsangreifend; nur in den wenigsten Fällen - wie hier beiBüchner und bei Heine - wird ansatzweise derZusammenhang zwischen der politisch-sozialen Situationund der geistigen Misere begriffen, und selbst da49 BÜCHNER [ Anm. 1], Bd. 2, S. 45550 PETER MOSLER, Georg Büchners „Leonce und Lena". Langeweileals gesellschaftliche Bewußtseinsform, Abhandlungen zur Kunst-,Musik- und Literaturwissenschaft, 145 (Bonn 1974), S. 66
26
fehlt meist die Einsicht in die ökonomisch-politischenBedingungen, die die Bourgeoisie in ihrem Abwehrkampfgegen das eben erst entstehende Proletariat auf dieSeite des reaktionären Adels drängen. In diesemstillstehendem Wirbel der Geschichte, der einVorwärtsschreiten der Menschheit solange verhindert,als das Volk, die große Masse, noch nicht begriffenhat, daß eine Revolution möglich ist und daß das Volkallein diese Revolution durchdühren kann und muß, inder Zeit, in der das ungeduldige Handeln des Einzelnensinnlose Torheit ist, herrscht notwendigerweise einealle umfassende Langeweile, höchstens die Illusioneiner sinnvollen Tätigkeit:
Was die Leute nicht Alles aus Langeweiletreiben! Sie studiren aus Langeweile, sie betenaus Langeweile, sie verlieben, verheirathen undvermehren sich aus Langeweile und sterbenendlich an der Langeweile und - und das ist derHumor davon - Alles mit den wichtigstenGesichtern, ohne zu merken warum, und meinenGott weiß was dabei. Alle diese Helden, dieseGenies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, dieseSünder, diese Familienväter sind im Grundenichts als raffinirte Müßiggänger.51
IV Gewiß ist Leonce "Vertreter einer privilegiertenLangeweile", gewiß ist vor allem seine Erkenntnis derLangeweile eine „elitäre, privilegierte Erkenntnis" -„Warum muß ich es gerade wissen?" - und gewiß verhöhnter in dieser Erkenntnis all diejenigen, die diegesellschaftlich notwendige Arbeit verrichten müssen,und die sich nach nichts mehr sehnen als nach ebendiesem Müßiggang,52 aber gerade der zitierte Text zeigt51 BÜCHNER [ Anm. 1], Bd. l, S. 10652 JANCKE [ Anm. 1], S. 262
27
doch, daß Leonce diese Langeweile längst nicht mehrals spezifisch höfische sieht: sie hat, angesichts derverschlossenen Zukunft alle Mitglieder derGesellschaft angesteckt, wenn auch in durchausdifferenzierter Weise: der Adelige leidet an dem ausseiner parasitären Stellung hergeleiteten Müßiggang,der Bürger an der sinnlosen immergleichenBeschäftigung, der Arbeiter des heraufziehendenFabrikzeitalters an der Monotonie der stumpfsinnigenArbeit. Gerade Valerio, der aus der niedersten Klassestammt, sieht den Müßiggang als Flucht aus derentfremdeten Arbeit, angelehnt an die populäreVorstellung vom Schlaraffenland, weil das Volk sicheine nicht entfremdete Arbeit noch nicht vorstellenkann, wird aber dadurch Parasit am gesellschaftlichErarbeiteten - genau wie der Adel selbst. Damit wirddie Utopie am Ende des Stücks, die die Entfremdungnicht aufhebt, weder die der Herrschenden noch die derBeherrschten, von vornherein entwertet: nur imLustspiel, „in dem es keinen Winter mehr gibt und wiruns im Sommer bis Ischia und Capri hinausdestillieren,und wir das ganze Jahr zwischen Rosen und Veilchen,zwischen Orangen und Lorbeern stecken", kann Büchnerdas Problem der gesellschaftlichen Arbeit übersehend,das Schlaraffenland dekretieren:
VALERIO. Und ich werde Staatsminister und eswird ein Decret erlassen, daß wer sichSchwielen in die Hände schafft unter Kuratelgestellt wird, daß wer sich krank arbeitetkriminalistisch strafbar ist, daß Jeder dersich rühmt sein Brod im Schweiße seinesAngesichts zu essen, für verrückt und dermenschlichen Gesellschaft gefährlich erklärtwird und dann legen wir uns in den Schatten undbitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen,
28
um musikalische Kehlen, klassische Leiber undeine kommode Religion!53
Diese Lösung ist eine Scheinlösung, ein musikalischer„Trugschluß", notwendig, weil die wirkliche Lösung imAugenblick gesellschaftlich nicht durchsetzbar ist,denn die Klasse, die allein ihn zustande bringenkönnte, ist dazu nicht imstande. In der zweiten Szenedes dritten Akts schildert Büchner nicht nur satirischdie Unterdrückung der Armen, sondern ihren durch dieUnterdrückung hervorgerufenen depravierten Zustand:zerlumpt, willenlos und betrunken, lassen sie allesmit sich geschehen, was die Obrigkeit (der Lehrer undder Landrat) mit ihnen anstellt. Fast verzweifeltschreibt Büchner 1836 (nach seinem mißglückten Versuchmit dem Hessischen Landboten) über den Zustand der„großen Klasse":
Für die gibt es nur zwei Hebel, materiellesElend und religiöser Fanatismus. Jede Parthei,welche diese Hebel anzusetzen versteht, wirdsiegen. Unsere Zeit braucht Eisen und Brod -und dann ein Kreuz oder sonst so was.54
Daß Büchner neben dem materiellen Elend auch eine ArtFanatismus als notwendige Bedingung einer populärenRevolution postuliert, zeigt, daß er zumindest ahnt,wie die Ideologisierung durch Erziehung, Kirche undStaat auch dort noch eine Revolution verhindern kann,wo die materiellen Vorbedingungen gegeben sind; nureine extreme, wirksame Gegenideologie, wie es etwa diePredigten Thomas Münzers während des Bauernkriegeswaren, könnten die Masse gegen die Gewehre derMächtigen in Bewegung setzen. Büchner begreiftdurchaus, daß der Mensch von Faktoren bestimmt wird,über die er keine oder doch kaum eine Kontrolle53 BÜCHNER [Anm. 1], Bd. 1, S. 13454 Ebd., Bd. 2, S. 455.
29
ausübt: seine eigenen Triebe einerseits und diegesellschaftlichen Umstände andererseits. Jene sinddirekt überhaupt nicht zu ändern, höchstens teilweisemodifizierbar, diese können, weil sie in derGesellschaft liegen, auch nur durch die Gesellschaftgeändert werden. Was Büchner nicht predigt, ist einbiologischer, genetischer oder existentiellerDeterminismus; im Gegenteil, in einem Brief im Februar1834 an seine Familie macht er fast ausschließlich diegesellschaftlichen Umstände für die charakterlichenEigenschaften eines Menschen verantwortlich:
Ich verachte Niemanden, am wenigsten wegen seinesVerstandes oder seiner Bildung, weil es inNiemands Gewalt liegt, kein Dummkopf oder keinVerbrecher zu werden - weil wir durch gleicheUmstände wohl alle gleich würden, und weil dieUmstände außer uns liegen.55
Das Kind ist dem Einfluß der Gesellschaft willenlosausgesetzt und der Erwachsene kann nicht nachträglichund rückwirkend die Faktoren, die ihn prägten,ungeschehen machen. Wie aber kann dann jeneDetermination des Menschen aufgehoben, seineVerkümmerung zur Puppe, Marionette, Maschinerückgängig gemacht werden? Augenscheinlich nicht durchErziehung, Bildung und Reform, solange die Mittel zudieser Veränderung ausschließlich in den Händen derherrschenden Klasse sind, sondern allein durch diesoziale Revolution, die eben jene Determinanten ändernkönnte. Büchners Anti-Idealismus, Büchners materialistischerDeterminismus, ist schließlich humaner als alleHumanitätsideale, die die Erlösung des Menschen ausder Qual seiner Existenz von einer Verbesserung des
55 Ebd., Bd. 2, S. 422
30
Individuums abhängig machen will, von einerästhetischen Erziehung des Menschen zum Beispiel, wieSchiller, die die Befreiung des Menschen insUnendliche hinauszögert; denn Büchner lädt uns ein,den Menschen zunächst so zu nehmen, wie er ist, inseiner gegenwärtigen, durch die gesellschaftlicheDetermination hervorgebrachten Gestalt, ihn sichselber aus seiner Unterdrückung und Ausbeutungbefreien zu lassen und seine materiellen Bedürfnissezu befriedigen, und ihm so ein menschenwürdiges Lebenzu erlauben. Es ist in diesem humanen Interesse, wennsich Büchner über jene qualvollen Anstrengungen lustigmacht, mit denen der Mensch sich immer wiedervormachen will, er könnte sich mit einfacherWillenskraft über seine tierische Natur und seinegesellschaftliche Determinierung überheben. Erst dieEinsicht in die Ursachen der Gebundenheit des Menschenermöglicht seine Befreiung. Wenn in Dantons Tod CamilleDesmoulins Herault verspottet, dann ist dieser Spottnicht gegen den Einzelnen, auch nicht gegen denMenschen an sich, sondern allein gegen die Posegerichtet, gegen die „heroische Fratze", die vorgibtmehr zu sein, als sie sein kann:
Wir sollten einmal die Masken abnehmen, wirsähen dann wie in einem Zimmer mit Spiegelnüberall nur den einen uralten, zahllosen,unverwüstlichen Schaafskopf, nichts mehr,nichts weniger. Die Unterschiede sind so großnicht, wir Alle sind Schurken und Engel,Dummköpfe und Genies und zwar Alles in Einem,die vier Dinge finden Platz genug in demnemlichen Körper, sie sind nicht so breit alsman sich einbildet. Schlafen, Verdaun, Kindermachen das treiben Alle, die übrigen Dinge sindnur Variationen aus verschiedenen Tonarten überdas nemliche Thema. Da braucht man sich auf die
31
Zehen zu stellen und Gesichter zu schneiden, dabraucht man sich voreinander zu geniren. Wirhaben uns Alle am nemlichen Tisch krankgegessen und haben Leibgrimmen, was haltet ihreuch die Servietten vor das Gesicht, schreitnur und greint wie es euch ankommt. Schneidetnur keine so tugendhafte und so witzige und soheroische und so geniale Grimassen, wir kennenuns ja einander, spart euch die Mühe.56
Wenn MICHAEL HAMBURGER daher Leonce und Lena einengrausamen Kommentar „zur Illusion der Freiheit und denPrätentionen des homo sapiens"57 nennt, so hat er nurteilweise recht, denn er übersieht, daß der bittereSpott nur grausam in dem Sinne ist, daß er schädlicheÜberheblichkeit auf ihr menschliches Maß reduziert. Indiesem Sinne verteidigt sich Büchner in einem Brief anseine Familie vom Februar 1834 gegen den Vorwurf, erverachte Menschen:
Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr, ichlache oft, aber ich lache nicht darüber, wieJemand ein Mensch, sondern nur darüber, daß erein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann,und lache dabei über mich selbst, der ich seinSchicksal theile. Die Leute nennen das Spott,sie vertragen es nicht, wenn man sich als Narrproducirt und sie duzt; sie sind Verächter,Spötter und Hochmüthige, weil sie die Narrheitnur außer sich suchen.58
Das allein scheint ihm wahrer Hochmuth und wahreVerachtung: das Allzumenschliche in sich selbst nichtsehen und sich bei anderen darüber mokieren. Gegen die
56 Ebd., Bd. 1, S. 70f.57 MICHAEL HAMBURGER, Vernunft und Rebellion (München 1 969), S. 68.58 BÜCHNER [Anm. 1], Bd. 2,,S. 423
32
kehrt er - wieder um des Menschlichen willen - seinenHaß:
Der Haß ist so gut erlaubt als die Liebe, undich hege ihn im vollsten Maße gegen die, welcheverachten. Es ist deren eine große Zahl, die imBesitze einer lächerlichen Äußerlichkeit, dieman Bildung, oder eines todten Krams, den manGelehrsamkeit heißt, die große Masse ihrerBrüder ihrem verachtenden Egoismus opfern. DerAristocratismus ist die schändlichsteVerachtung des heiligen Geistes im Menschen;gegen ihn kehre ich seine eigenen Waffen;Hochmuth gegen Hochmuth, Spott gegen Spott.59
Die Gefahr eines solchen durchdringenden Blicks in diemaschinenhaften und triebhaften Grundlagen und diegesellschaftliche Determination alles MenschlichenHandelns ist eine völlige Demoralisation desErkennenden, die nicht so sehr aus der Erfahrung des„Abgrunds" (wie HAMBURGER meint), sondern aus derErfahrung der Sinnlosigkeit aller menschlichenTätigkeit unter den gegebenen gesellschaftlichenUmständen entspringt.
V Das Zurückführen alles menschlichen Handelns auf immerdie gleichen Triebkomponenten (Hunger, Sexualität,Aggression) und auf die scheinbar unerschütterlichgegebene gesellschaftliche Konstitution führtschließlich zur Verzweiflung über den Zwang, dem wirnirgends entfliehen können. Indem all es individuelleStreben sich als selbst determiniert oder als eitlePose enthüllt, verfällt der Mensch dem Ekel und derLangeweile. Das menschliche Treiben erscheint einemnur solange selbstverständlich und normal, als man
59 Ebd., Bd. 2, S. 423
33
diese Motivationen des Handelns nicht durchschaut.Der, der weiß, wird gelähmt, unfähig weiter zuhandeln, dem Grauen vor dem überall aufgähnendenNichts schutzlos preisgegeben, das unsere Handlungen,solange wir sie ernst nehmen können, uns verdecken.Der nihilistische Skeptizismus Leonces, der sich alsauch ein Aspekt der widersprüchlichen Natur Büchnersin seinen Briefen nachweisen läßt, ist als Kehrseiteder leichtfertigen Philosophiesatire ein weitererGrundton der Komödie Leonce und Lena. Aber wie schon inden Briefen Büchners der Verdacht nicht ganzabzuwehren ist, daß Büchner die Rolle des Nihilistenteilweise spielt, so bleibt auch im Stück ungewiß, wasMaske ist und was nicht. Wie Valerio auf die FragePeters, wer er sei, antwortet: „Weiß ich's?" undlangsam hintereinander mehrere Masken abnimmt, sobleibt auch bei Büchner ungewiß, ob er das oder dasoder das ist. Weil das Gelächter der Erkenntnis sichgegen den Erkennenden selbst richtet, ist dasGelächter heilsam, denn im Gelächter selbst schon wirdder Automatismus der Walzen und Windschläucheüberholt: der Weltschmerz Leonces entlarvt sich in derKonfrontation mit Valerio, der die Rolle derniedersten Instinkte, Fressen und Saufen mit Gustospielt, selbst als Pose, die sich angesichts des Seinsund seiner Notwendigkeiten sinnloserweise mit derErkenntnis der Sinnlosigkeit der Welt wichtig tut. DerNihilismus widerlegt sich selbst: denn wenn angesichtsder Sinnlosigkeit der Welt alle geistige und ethischeAnstrengung nur Pose ist, dann ist die Reflexiondieser Sinnlosigkeit als geistige Anstrengung jaselbst sinnlos und nur Pose. Ohne Valerio allerdings würde aus der Komödie leichteine Tragikomödie, ja eine Tragödie; dann wiederholtesie nämlich als Setzung den absoluten Nihilismus, derDanton schließlich zum Tode reif macht. Valerio setzt
34
dem Unsinn des Skeptizismus - einer konsequentenAusgeburt übrigens des Descartschen Rationalismus, dervom Denken her die Welt konstruieren will - dengesunden Menschenverstand entgegen, dessenphilosophische Entsprechung der Empirismus undSensualismus der englischen Philosophie ist, dencommon sense, der auch noch die Entlarvung aller Poseals Hochmut entlarvt, als gefährliche undselbstzerstörerische Verirrung des menschlichenGeistes, der mehr zu wissen vermeint als andere unddaher mit einer Mischung aus Verachtung wegen ihrerDummheit und Neid wegen ihres ungetrübten Glücks aufden Rest der Menschheit herabschaut. Gerade indemValerio bis in die Übertreibung hinein den Wanstspielt und jedes Ideal denunziert, untergräbt erlachend den etwas ästhetisierenden Nihilismus Leoncesund macht jenseits jeder Wichtigtuerei ein Lebenmöglich, das bei aller scheinbaren Wurstigkeit und beiallem zur Schau getragenen Zynismus doch realer undernsthafter ist als Leonces parasitäre Langeweile. ImGegensatz zu Leonce durchschaut er nicht nur dieAbhängigkeit des Menschen von den tierischenBegierden, sondern sieht gleichzeitig noch tiefer: daßdie Entlarvung, wo sie nicht des Rechts aller Menschenauf ein menschenwürdiges Leben willen gegen diefalsche Überheblichkeit jeder Form des Aristokratismusgerichtet ist, wo sie also den Zweck hat, einemenschenfeindliche Ideologie zu untergraben, selbstlebensfeindlich und tödlich wird, und daß sie, dievorgibt, das Denken in Bildern und Metaphern zuzerstören, selbst in Bildern und Metaphernsteckenbleibt. So wie Brecht mit der zynischen undmenschenfreundlichen Rede, daß erst das Fressen kommeund dann die Moral, das höhere Streben des Menschenangesichts des Hungers und des materiellen Elends der
35
großen Masse als scheinheilige oder gar willentlichbösartige Pose entlarvt, so konfrontiert Valerio immerwieder die triebhafte Notwendigkeit des Essens mit derWichtigtuerei und Verlogenheit idealistischer undnihilistischer Gedankenspielerei. So verspottet er dasNaturgefühl der Romantik:
Es ist eine schöne Sache um die Natur, sie istaber doch nicht so schön, als wenn es keineSchnaken gäbe, die Wirtsbetten etwas reinlicherwären und die Todtenuhren nicht so in denWänden pickten. Drin schnarchen die Menschenund draußen quaken die Frösche, drin pfeifendie Hausgrillen und draußen die Feldgrillen.60
An anderer Stelle reduziertet die Natur, die in derSchwärmerei Leonces zu einer „Schale von dunkelmGold"61 wird, auf ihren Gebrauchswert als Viehweide:
Ach Herr, was ich für ein Gefühl für die Naturhabe! Das Gras steht so schön, daß man ein Ochssein möchte, um es fressen zu können, und dannwieder ein Mensch, um den Ochsen zu fressen,der solches Gras gefressen.62
Leonces große Rede von der vanitas, „Mein Leben gähntmich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den ichvollschreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstabenheraus", beantwortet Valerio mit folgender Rede: Warten Sie, wir wollen uns darüber gleichausführlicher unterhalten. Ich habe nur noch ein StückBraten zu verzehren, das ich aus der Küche, und etwas
60 Ebd., Bd. l, S. 124.61 Ebd., Bd. 1, S. 12562 Ebd., Bd. 1, S. 106f.
36
Wein, den ich von ihrem Tische gestohlen. Ich bingleich fertig.63 Leonces halb ernsthaft-verzweifelte und halbaffektierte Klage, er wisse nicht, was er treibensolle, beantwortet er mit der unlogischen aberkonsequenten Aufforderung:
Ergo bibamus. Diese Flasche ist keine Geliebte,keine Idee, sie macht keine Geburtsschmerzen,sie wird nicht langweilig, wird nicht treulos,sie bleibt eins vom ersten Tropfen bis zumletzten. Du brichst das Siegel und alle Träume,die in ihr schlummern, sprühen dir entgegen.
Aber, wie HERBERT ANTON richtig sieht, „in Leonce denIdealisten und in Valerio den Materialisten zu sehen, hießeder überlegen gespielten Rolle Valerios zu erliegen.Valerio ißt und trinkt - schon deshalb, weil erfortwährend naive Gefräßigkeit vorgeben muß - nichtweniger spirituell als Leonce, und daß er diesem alsspekulativer Geist überlegen ist, sieht Leoncespätestens in dem Moment ein, als Valerio ihn ausGründen spekulativer Überlegenheit,um den schönstenSelbstmord bringt".64
VALERIO. springt auf und umfaßt ihn. HaltSerenissime! LEONCE. Laß mich! VALERIO. Ich werde Sie lassen, sobald Siegelassen sind und das Wasser zu lassenversprechen. LEONCE. Dummkopf! VALERIO. Ist denn Eure Hoheit noch nicht überdie Leutnantsromantik hinaus, das Glas zumFenster hinauszuwerfen, womit man die
63 Ebd., Bd. l, S. 113.64 ANTON [Anm. 37], S. 231
37
Gesundheit seiner Geliebten getrunken? LEONCE. Ich glaube halbwegs du hast Recht. VALERIO. Trösten Sie sich. Wenn Sie auch nichtheut Nacht unter dem Rasen schlafen, soschlafen Sie wenigstens darauf. Es wäre einebenso selbstmörderischer Versuch in eins vonden Betten zu gehn. Man liegt auf dem Stroh wieein Todter und wird von den Flöhen gestochenwie ein Lebendiger.65
Die Weltschmerzgebärde, die sich selbst so ungeheuerwichtig nimmt, daß sie um der Ehrlichkeit willen aufden Selbstmord drängt, entlarvt sich als billigeLeutnantsromantik, gegenüber der Valerio zu recht aufder Gelassenheit besteht, jener Gelassenheit(prudentia), die die Sinnlosigkeit nicht durch denUnsinn zu überwinden versucht, sondern dieSinnlosigkeit als Gegebenheit hinnimmt, mit derzusammen man weiterleben muß. Valerios Hinweis auf dieLeutnantsromantik entwertet Leonces Versuch,wenigstens in der Verzweiflung konsequent zu sein, alsKlischee. Leonce selbst sieht schließlich seinenSelbstmord als Plagiat an Werther: „Der Kerl hat mirmit seiner gelben Weste und seinen himmelblauen HosenAlles verdorben." Werther, der Urtypus derZerrissenheit und Widersinnigkeit, ist inzwischen inLiteratur und Leben tausendfach plagiiert, wiederholtund variiert worden: seine Geste, die vor derfranzösischen Revolution vielleicht noch ehrlicheGeste eines auswegslosen Weltschmerzes war, wird inder Restaurationszeit zur spielerischen Pose einesblasierten und gelangweilten Prinzen. Valerio kann siemit Gelächter verscheuchen. Das Ende des Dramas zeigt, was HELMUT KRAPP bereits amersten Dialog zwischen den Prinzen und Valerio
65 BÜCHNER [Anm. l], Bd. 1, S. 125
38
aufweist, daß zumindest für das Verhältnis der beiden„der Dialog zur eigentlichen Spielweise geworden ist"66
und daher das Sprechen der beiden „ein zielloses Hinund Zurück" ist.67 Wie ihre Auseinandersetzung miteinem absurden Dialog beginnt, der genausogut auch ineinem Drama von Becket stehen könnte, so endet dasDrama, trotz der romantischen Liebe zu Lena,wesentlich am selben Punkt:
VALERIO stellt sich dich vor den Prinzen, legt den Finger andie Nase und sieht ihn starr an. Ja! LEONCE eben so. Richtig! VALERIO. Haben Sie mich begriffen? LEONCE. Vollkommen. VALERIO. Nun, so wollen wir von etwas Anderemreden.68
In einer mechanistischen Welt gibt es wederAusgangspunkt noch Ziel sondern nur sich immerwiederholende vorprogrammierte Vorgänge. In seinerSchlußrede verkündet Leonce im wesentlichen die gleichüberhebliche Langeweile, die nach einer Beschäftigungsucht, wie am Anfang - wo eine sinnvolle Beschäftigungdoch so nahe läge:
Nun Lena, siehst du jetzt wie wir die Taschenvoll haben, voll Puppen und Spielzeug? Waswollen wir damit anfangen? Wollen wir ihnenSchnurrbärte machen und ihnen Säbel anhängen?Oder wollen wir ihnen Fräcke anziehen, und sieinfusorische Politik und Diplomatie treibenlassen und uns mit dem Mikroskop danebensetzen? Oder hast du Verlangen nach einerDrehorgel auf der milchweiße aesthetische
66 HELMUT KRAPP, Der Dialog bei Büchner (München 1958), S. 16667 Ebd., S. 169.68 BÜCHNER [Anm. 1], Bd. l, S. 106.
39
Spitzmäuse herumhuschen? Wollen wir ein Theaterbauen?
Er beantwortet sich die Frage selbst mit dem Traum voneinem vollkommen konfliktfreien „angenehmen" Leben:
Aber ich weiß besser was du willst, wir lassenalle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbietenund zählen Stunden und Monden nur nach derBlumenuhr, nur nach Blüthe und Frucht. Und dannumstellen wir das Ländchen mit Brennspiegeln,daß es keinen Winter mehr gibt.69
Dieser eskapistischen Utopie stellt Valerio seineeigene, irdischere und schließlich ebenso durchsichtiglangweilige des Schlaraffenlandes gegenüber, diegleichzeitig Leonces zarten Traum verlacht undüberbietet und beide als Traum und Spielereibloßstellt. Auf diese Weise ist das Lustspielendegerettet, allerdings um den Preis, daß die
69 Ebd., S. 133f.; auch in der Person Leonces selbst gibt eskeine Entwicklung: „Von Geburt an ein Gefangener, ist derumschmeichelte launische Leonce ebenso unfähig wie zu dessenBeginn die Frage zu beantworten: E la fame? Der Hunger seinerUntertanen bleibt für ihn die geringste seiner Sorgen ...Leonce war ein trauriger Dummkopf; nun wird er durch die Liebeund die Listen Valerios zu einem 'glücklichen' Dummkopf: darinliegt das Geheimnis seiner Heilung ... Diese Satire hat mehrereGebiete als Zielscheibe: sie trifft den Müßiggänger, der daglaubt, essen zu dürfen ohne zu arbeiten (anders ausgedrückt:für welchen die anderen arbeiten, ohne daß er sie überhauptbeachtet); sie gilt dem wohlversorgten, reichgewordenenBettler, - der wie Hérault de Séchelles alsogleich dasschwelgerische Genießen zum Hauptpunkt seines Programms macht;und sie ist natürlich auch auf die frommen Seelen gerichtet,die ihre täglichen Makkaroni nicht von ihrer Arbeit, sondernvon der göttlichen Gnade erwarten" (HENRI PLARD, „Gedanken zuLeonce und Lena: Musset und Büchner", in Georg Büchner, hg. vonWOLFGANG MARTENS, Wege der Forschung, 53 (Darmstadt 1973), S.301f.).
40
eigentlichen Probleme, die noch einmal in ValeriosAutomatenrede aufgeworfen wurden, nicht wirklich,sondern nur im Leichtsinn des Gelächters gelöstwerden, daß Leonces Schwermut mit einem traumleichtenSchleier aus Romantik verhangen wurde. Darum auch kanndas Spiel immer wieder von neuem anfangen:
Gehen Sie jetzt nach Hause, aber vergessen SieIhre Reden, Predigten und Verse nicht, dennmorgen fangen wir in aller Ruhe undGemüthlichkeit den Spaß noch einmal von vornan.70
70 BÜCHNER [Anm. 1], Bd. l, S. 133; GONTHIER-LOUIS FINK sprichtvon einem „furchtbaren Wort": „So hätte das Leben in seinenAugen nicht aufgehört, eine Farce zu sein? ... Auch die Liebescheint seinem Dasein keinen Sinn gegeben zu haben. SeineVerbindung mit Lena hat er mit einer Flucht ins Paradiesverglichen und es erweckt entschieden den Anschein, daß sie nurdas Individuum und keineswegs den Prinzen beeinflußt habe. Nunaber ist er König. Allerdings kann es sich für ihn nicht darumhandeln, geruhsam das Werk seines Vaters fortzuführen und mitden Höflingen oder den lächerlichen Soldaten zu spielen. Aberer könnte versuchen, ein neues Regime einzuführen, seinpolitisches Ideal zu verwirklichen, soweit er überhaupt eineshat. Statt dessen fährt er fort, darin nichts als eine großeKomödie zu sehen; die Metaphern, die der politischen Bühnegegolten hatten, haben jetzt Bezug auf den Jahrmarkt und dasWelttheater. Das Leben in seiner Gesamtheit hat also keinenSinn gefunden. So wird Leonce - wie zu Rosettas Zeiten -Zuschauer bleiben und sich daran vergnügen, mit dem 'Mikroskop'die geringste Bewegung jener Figuren zu beobachten, die sichselbst unbewußt ein Schauspiel spielen. Nur mühsam vermagdieser Redeschwall voller Ironie seine Enttäuschungverbergen ... Dennoch hat Lena (?) ihr nichts anderesanzubieten als ein schönes Märchen, das der Zeit entrücktbleibt, ein Leben in einem immerwährenden Paradies, wenn ihmauch dieses Märchenreich nicht idealer erscheint als dieKomödie des Lebens. Er ironisiert also diese Märchenwelt, indemer gleichzeitig dessen (!) Unwirklichkeit unterstreicht"(GONTHIER LOUIS FINK, „Leonce und Lena: Komödie und Realismus
41
Zwar ist Leonce und Lena kein „Vexierspiel derVerzweiflung", wie GERHART BAUMANN71 meint, wohl aberein selbstbewußtes Spiel aus dem Abstand der Ironie,in der das Ernste relativ und das Relative ernstgenommen wird, in der die Gestalten sich in allemspiegeln, um stets betrogen zu werden, in der auch dieUtopie noch Gegenstand des ironischen Spiels ist,nicht Rausch, der in Ernüchterung umschlagen muß, istselbst bereits ironische Nüchternheit, die dieWunschwelt gar nicht so aufbaut, daß sie von derRealität zerstört werden kann, da sie im Augenblickdes Aussprechens bereits durch die Ironie selbstaufgehoben wird.
bei Georg Büchner", in ¦‚Georg Büchner, hg. von WOLFGANG MARTENS[ Anm. 69], S. 504f.).71 S GERHARD BAUMANN, Georg Büchner: Die dramatische Ausdruckswelt(Göttingen 1961), S.115