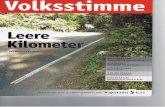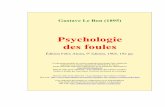Gustave Guillaume: Zeit und Verb. Theorie der Aspekte, der Modi und der Tempora (ed. together with...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Gustave Guillaume: Zeit und Verb. Theorie der Aspekte, der Modi und der Tempora (ed. together with...
1
Vorwort
Gustave Guillaume (1883–1960) ist auf den ersten Blick schwer einzuordnen. Die von ihm
vertretene Linguistik hatte immer ihre Anhänger und Bewunderer. Der erste von ihnen war
sein Förderer Antoine Meillet, der heute als der Begründer der Grammatikalisierungs-
forschung gilt. Sie untersucht die Genese von grammatischen Elementen aus lexikalischen
Elementen heraus. Grammatikalisierungsforschung zeichnet darüber hinaus die
übereinzelsprachlich zu beobachtenden und unumkehrbaren Stadien ihrer Genese von weniger
komplexen zu komplexen grammatischen Kategorien nach.1
Guillaume stellt in „Temps et verbe / Zeit und Verb“ ebenfalls die Genese von
grammatischen Kategorien in den Mittelpunkt seines Arbeitens, hier vor allem von Aspekt,
Tempus und Modus. Während in der Grammatikalisierungsforschung die sprachhistorischen
und sprachtypologischen Gesichtspunkte im Vordergrund stehen, will Guillaume die
„Psychomechanik“ der Genese von grammatischen Kategorien untersuchen. Im Zentrum von
„Zeit und Verb“ steht die Versprachlichung von Zeit in Form von unterschiedlichen
Tempussystemen. Es geht darum aufzudecken, wie sich Zeit / Tempus (le temps) in unserem
Denken (pensée) konstituiert, und welche Phasen (états) durchlaufen werden, bis die
Kategorie Tempus entsteht. Es geht also um die Rekonstruktion der mentalen Genese von
Zeitvorstellungen. Dafür entwickelt Guillaume einen eigenen Begriff, den der Chronogenese
von Tempus. Zu Guillaumes Prämissen gehört vor allem die Annahme der psychologischen
Realität von Chronogenese und der empirischen Überprüfbarkeit seiner Thesen zu den
Stadien der Chronogenese. Ziel ist eine Universalgrammatik der Tempuskategorie sowie, im
1 Als erste und umfassende Einführung in die Grammatikalisierungsforschung ist Hopper/Traugott (1993) zu
empfehlen. In deutscher Sprache gibt Diewald (1997) einen guten Einstieg. Die seither erschienene Literatur
2
Prinzip, aller weiteren grammatischen Kategorien (vgl. zum Beispiel die
universalgrammatische Grundlage von Artikelsystemem in Guillaume 1919/1975). Bei
seinem universalgrammatischen Ansatz will Guillaume Mechanismen bzw. Prozesse
aufzeigen, welche die Genese von Tempussystemen in den verschiedenen Einzelsprachen
steuern. Guillaume nimmt, mit anderen Worten, die universalen Prozesse in den Blick, die
hinter der Erzeugung von einzelsprachlicher Varianz stehen. Varianz und Universalien bilden
somit für Guillaume keinen Gegensatz. Er verfällt nicht dem Inventargedanken, wonach man
sprachliche Universalien aufzählen könnte, um ihnen anschließend die Liste der Varianten
gegenüberzustellen.
Zur Explizierung seines Forschungsprojekts entwickelt Guillaume eine Terminologie,
die sich nicht in bekannte Forschungstraditionen einschreibt; dasselbe gilt für die von ihm
vorgeschlagenen Tempussystematiken des Französischen, Lateinischen, Griechischen,
Russischen und Deutschen. Sie sind auch aus der Sicht eines mit der gegenwärtigen
Forschung zu Aspekt, Tempus und Modus vertrauten Linguisten nur mit viel Geduld
nachzuvollziehen. Dennoch hatte und hat Guillaume viele Anhänger, die in der Regel seine
Terminologie übernehmen und es nicht selten ablehnen, sie in aktuelle Terminologie zu
übersetzen. Das hat ihnen den Vorwurf des linguistischen Sektierertums eingebracht und die
Rezeption von Guillaume über lange Zeit behindert.
Gustave Guillaume war und ist vor allem ein Ideengeber. Er entwickelte Gedanken, die
zu keiner der zu seiner Zeit herrschenden Axiomatiken passten. Ein solcher Gedanke war,
dass alle grammatischen Kategorien im Grunde nur EINE sind. Das heißt, Guillaume zählt
grammatische Kategorien nicht als grammatische Entitäten auf, sondern sieht sie als
unterschiedliche Stadien ihrer selbst (vgl. Leiss 1985). Unerwartete Gedanken lösen entweder
zur Grammatikalisierungsforschung bzw. zur Genese von Grammatik ist immens und kann hier nicht genannt
werden.
3
Abstoßungsreaktionen oder einen vertieften Reflexionsprozess aus. Nehmen wir an, die
These, dass alle Kategorien nur eine sind, hat einigen Plausibilitätsgrad, dann müsste man die
gesamte Forschung zu grammatischen Kategorien überdenken. Es wäre dann nicht mehr
möglich, grammatische Kategorien als isolierte Entitäten, gleichsam als zählbare Gegenstände
aufzufassen. Vielmehr müsste man von Inklusionsbeziehungen, also Teil-Ganzes-Relationen
zwischen den verschiedenen Kategorien ausgehen, wodurch eine völlig neue Modellierung
von Grammatik entstehen würde. Kennzeichnend für Inklusionsbeziehungen ist nämlich, dass
sie unumkehrbar sind. Wenn beispielsweise Tempus die Kategorie Aspekt inkludiert, bedeutet
das, dass Tempus diese als Baustein voraussetzt, während das Umgekehrte nicht zutrifft:
Aspekt setzt die Kategorie Tempus nicht voraus. Eine solche Relation ist nicht möglich. Das
wird wiederum durch die Unumkehrbarkeit der Richtung der Grammatikalisierung von
grammatischen Kategorien bestätigt, wie sie von Meillet und fast der gesamten heutigen
Grammatikalisierungsforschung angenommen wird. Es gibt zwar Stimmen, die eine
Umkehrung der Richtung (sogenannte Degrammatikalisierung) für möglich halten; die
Beispiele dazu sind allerdings spärlich und betreffen meist Wortartkonversionen (wie in das
Für und Wider), die mit Grammatikalisierung nichts zu tun haben.
Wie ist Guillaumes Beitrag zur Linguistik axiomatisch einzuordnen? Seine Berück-
sichtigung der Mereologie, das heißt der Logik der Teil-Ganzes-Relationen, ist aristotelisch
und charakteristisch für die Spekulative Philosophie einschließlich der Spekulativen
Universalgrammatik der Modisten im späten Mittelalter (1275–1330). Trotzdem lässt sich
Guillaume dieser Tradition nicht eindeutig zuordnen. Seine Sprachtheorie ist in Bezug auf
ihre Axiomatik als durchaus hybrid zu klassifizieren. Guillaume steht nämlich auch in der
Tradition der cartesianisch inspirierten Grammaire générale de Port-Royal (1660) von
Antoine Arnauld und Claude Lancelot, die, wie die scholastische Universalgrammatik,
ebenfalls in Paris entwickelt wurde und von dort aus Europas Universitäten eroberte.
4
Cartesianisch ist Guillaumes Sprachtheorie vor allem deshalb, weil er zeit seines Lebens
davon ausgeht, dass Gedanken vor dem Erwerb von Sprache bereits zur Grundausstattung des
Menschen gehören. Das zeigt deutlich folgender Hinweis im Vorwort zur deutschen
Übersetzung von Guillaume (1973):
Schon in seinen frühesten Aufzeichnungen (1911) befaßte er sich mit dem „den Sprechakt leitenden Geist“, und in seiner Vorlesung vom 28. Januar 1960, kaum eine Woche vor seinem Tod, beschreibt er den Sprechakt als „eine Umwandlung des im denkenden Menschen vorhandenen, momentanen Gedankens in Sprache“, und die Sprache selbst als „einen Mechanismus, der Gedachtes in Gesagtes umwandelt“. (Vorwort von Hunger-Tessier / Mader / Pattee zu Guillaume 1973/2000: XIII).
Die Auffassung, dass Sprache Gedanken zum Ausdruck bringe, entspricht dem Rationalismus
der Aufklärung. Sie ist im 17. Jahrhundert die am weitesten verbreitete Vorstellung in Bezug
auf die Konstellation zwischen Sprache und Geist. Diese Auffassung hat sich heute
durchgesetzt und dominiert die meisten linguistischen Ansätze, selbst solche, die sich als
vollständig gegensätzlich definieren.
Guillaumes Ansatz entspricht offensichtlich in einem wesentlichen Punkt nicht dem
Rationalismus der Universalgrammatik der Modisten. Ihnen zufolge drückt Sprache nämlich
Gedanken nicht aus. Sprache ist vielmehr als ein Instrument konzipiert, das humanspezifische
Kognition und damit Denken erst möglich macht. Das lässt sich zugespitzt so formulieren,
dass Sprache Gedanken nicht ausdrückt, sondern in das menschliche Gehirn eindrückt,
wodurch das, was wir „Geist“ nennen, erst möglich wird. Der cartesianische Rationalismus
geht hingegen davon aus, dass die Kategorien keine sprachlichen Kategorien sind, sondern
nichtsprachliche angeborene („eingeborene“) Kategorien, die durch Sprache lediglich
externalisiert werden. Diese werden in Kategorientafeln aufgezählt, beispielsweise bei Kant,
der sie von Aristoteles übernimmt und einfach voraussetzt. Mit diesem cartesianischen
Rationalismus kollidiert jedoch massiv Guillaumes zentraler Theoriebaustein, wonach alle
Kategorien nur EINE Kategorie darstellen. Damit ist, wie gesagt, gemeint, dass zwischen den
grammatischen Kategorien Inklusionsrelationen bestehen. Grammatische Kategorien wie
5
Aspekt, Tempus und Modus werden somit nicht als ein Inventar von voneinander isolierten
grammatischen Entitäten, sondern als unterschiedliche Stadien ein- und desselben
Kategorisierungsprozesses verstanden.
Eben diese Idee verbirgt sich hinter dem Begriff der Genese, der bei Gustave Guillaume
zentral ist. Die Reihenfolge der Genese von Kategorien ist bei Gustave Guillaume: Aspekt >
Modus > Tempus. Heute spricht man jedoch vom ATM-Komplex (Aspekt-Tempus-Modus-
Komplex)2 und geht davon aus, dass die Kategorie des Aspekts sich zuerst herausbildet, dann
die Kategorie Tempus und schließlich Modus und Modalität – die empirischen Evidenzen aus
verschiedenen Bereichen der Sprachwissenschaft konvergieren und lassen gegenwärtig nur
auf diese unumkehrbare Richtung der Genese bzw. Grammatikalisierung von ATM schließen.
Gemeint ist damit keine evolutionäre Vorstellung der Genese der Kategorien des ATM-
Komplexes. Was wir wissen, ist, dass grammatische Kategorien „altern“ können. Die
Kategorie Aspekt entwickelt sich sprachhistorisch in die Kategorie Tempus, diese wieder in
Modus. So wird aus dem imperfektiven Aspekt das Tempus Imperfekt oder Präteritum, wobei
sich das Präteritum dann wiederum in einen Irrealis entwickelt (Modus wie Konjunktiv im
Deutschen). In Bezug auf perfektive Aspektformen lässt sich immer wieder die Entwicklung
früher und später Stadien des Perfekts beobachten, wobei die frühen Phasen aspektuell
dominiert sind und gegenwärtigen Zeitbezug aufweisen (Resultativa), die sich dann ihrerseits
langfristig zu Präterita entwickeln können, sobald imperfektive Verben in die Konstruktion
eintreten, mit denen sich keine resultative Bedeutung konstruieren lässt (vgl. Leiss 1992).
So vielfältig und variant solche Entwicklungsprozesse im Einzelnen sein mögen, sie
folgen dennoch einer unumkehrbaren Entwicklungslogik, die rekurrent bei der Herausbildung
von grammatischen Kategorien den Gesamtprozess steuert. Gleichzeitig lässt sich beobachten,
2 Noch verbreiteter ist die Abkürzung TMA, die allerdings nicht die Komplexität der beteiligten Kategorien
abbildet.
6
dass die Kategorie, die „altert“, nicht verlorengeht, sondern sich erneut
herausgrammatikalisiert. Wir beobachten somit eine zyklische Entwicklung des ATM-
Komplexes: Die grammatischen Kategorien werden zunehmend erneuert. Von Evolution kann
beim gegenwärtigen Stand der Erkenntnis dabei nicht gesprochen werden, da in den etwa
5000 Jahren dokumentierter Sprachüberlieferung keine Erweiterung der grammatischen
Kategorien stattgefunden hat. Die Tatsache, dass der Bestand sprachlicher Funktionen
unverändert geblieben ist, stellt somit ein robustes Argument dafür dar, dass die sprachlichen
Funktionen, die in den grammatischen Kategorien zum Ausdruck kommen, angeboren sind.
Um die Konstanz der grammatischen Kategorien und der von ihnen transportierten
Funktionen zu verstehen, bedarf es vertiefter vergleichender und sprachtypologisch basierter
grammatiktheoretischer Kompetenzen. Sonst werden auf den ersten Blick zwar einleuchtende,
tatsächlich aber in die Irre führende Einwände vorgebracht, wie derjenige, dass bestimmte
grammatische Kategorien in manchen Sprachen vorhanden sind, in anderen aber fehlen. Ein
scheinbar offensichtlicher Fall ist das Vorhandensein oder Fehlen des Artikels in den
Sprachen der Welt. Guillaume hat sich mit diesem Thema in seinem Buch „Le problème de
l’article et sa solution dans la langue française“ (1919/1975) auseinandergesetzt. Eine Lösung
lässt sich finden, wenn man einen kategorienübergreifenden Ansatz wählt. Interessanterweise
entsteht beim Verlust von Aspekt nicht immer wieder Aspekt, sondern stattdessen die
nominale Kategorie des Artikels (vgl. Leiss 2000). Dieses Phänomen hat Guillaume in „Zeit
und Verb“ zwar nicht prognostiziert, aber denkbar gemacht, denn Aspekt ist für ihn als
Grundbaustein nicht nur in verbalen, sondern auch in nominalen sprachlichen Einheiten
vorhanden. Aspekt stellt eine frühe Phase von Chronogenese dar. Wird der Prozess der
Chronogenese in der Anfangsphase abgebrochen, so entstehen nicht finite Verben, sondern
Partizipien oder auch quasinominale Formen wie der Infinitiv. Bei der Erneuerung der
7
Funktionen von Aspekt entsteht somit nicht immer die verbale Kategorie des Aspekts. Es
kann auch ein nominales Korrelat dazu sein (und hier vor allem der Artikel).
Aspekt ist bei Guillaume, wie gesagt, mit einer frühen Phase der Herstellung von
Zeitbildern verknüpft, Tempus mit einer späteren Phase. Die verschiedenen sprachlichen
Formen wie Partizipien, die zwar aspektuelle Qualität haben (das Partizip I im Deutschen ist
imperfektiv, während das Partizip II perfektiv ist), aber kein Tempus zum Ausdruck bringen,
zeugen für Guillaume von einem abgebrochenen Prozess der Chronogenese. Aus diesem
Grund hält er die Bezeichnungen „Partizip Präsens“ oder „Partizip Perfekt / Präteritum“ für
verfehlt, da Temporalität im strengen Sinn noch nicht involviert ist, sondern lediglich
Aspektualität. Das Forschungsprogramm zur Untersuchung von grammatischen Kategorien
umfasst daher bei Guillaume auch die Untersuchung von koverten Kodierungen einer
Kategorie. Meist handelt es sich dabei um noch nicht erkannte Kodierungen einer Kategorie.
Es gibt aber auch Kodierungen von Kategorien ohne materiale Realisierung. So verfügen
einige Sprachen nur über die Kategorie des Aspekts (vgl. die umfassende sprachtypologische
Untersuchung von Bybee 1985); in solchen Fällen übernimmt Aspekt zusätzlich die
Funktionen von Tempus und Modus. Wie ist das möglich? Die verschiedenen Funktionen
werden durch den jeweiligen Skopus („Reichweite“) von Aspekt im Satz kodiert. Aspekt tritt
als solcher in Erscheinung, wenn er nur den Verbalkomplex umfasst. Wird auch das Subjekt
der Proposition umfasst, entsteht eine temporale Lesart der aspektuellen Form. Steht die
gesamte Proposition im Skopus, dann entsteht eine modale Lesart. Meines Wissens wurde
dieser Zusammenhang bislang kaum zur Kenntnis genommen, aber er ist ein schönes Beispiel
für die Kovertheit scheinbar nicht vorhandener Funktionen. Es gibt „unsichtbare“,
nichtmorphologische Mittel der Kodierung wie Skopus und Wortstellung und vermutlich
weitere, noch nicht erkannte Mittel, die auf ökonomische Weise grammatische Kategorien
aufbauen können. Dass dies so konsequent möglich ist, zeigt wiederum die nahe
8
Verwandtschaft von Aspekt, Tempus und Modus. Es reicht die Kodierung eines einzigen
zusätzlichen Merkmals durch eine andere Kodierungstechnik, um eine „neue“ Kategorie
innerhalb eines kategorialen Komplexes wie ATM herzustellen.
Die Realisierung von Aspekt – sowohl im nominalen als auch im verbalen Bereich –
war in der modistischen Universalgrammatik sehr gut beschrieben und erklärt. Sie stellt sogar
einen zentralen Punkt bei der Wortartendiskussion dar und fehlt in keiner modistischen
Universalgrammatik. Dabei steht das Phänomen des Wortartwechsels im Fokus der
Argumentation. Wortartwechsel bedingt vielfach Aspektwechsel bzw. Umkodierungen von
nominaler und verbaler Quantifikation – ein Phänomen, das von Verfechtern der
Degrammatikalisierungsthese bis heute nicht begriffen wird. Guillaume dagegen nähert sich
hier dem Diskussionsstand bei den Modisten.
Der Terminus ‚Modismus‘ bezieht sich auf die These, dass die Grammatik sogenannte
modi significandi bereitstellt. Damit sind alternative Arten und Weisen der Darstellung eines
Sachverhalts gemeint. Man kann ein Verbalereignis entweder als perfektiv oder imperfektiv
darstellen. Und man kann etwas, auf das referiert wird, entweder als unteilbaren und
zählbaren Gegenstand (Massennomen wie das Kristall) oder als zählbaren Gegenstand
modellieren (der Kristall). Es handelt sich jeweils um unterschiedliche Perspektivierungen,
die nichts mit der Realität selbst zu tun haben, sondern mit dem Standort des Sprechers.
Perspektivierungen sind somit nach Auffassung der modistischen Grammatiktheorie nicht in
der Welt vorfindbar, sondern Teil der Betrachtung. Beschreibbar und formalisierbar sind diese
Perspektivierungstechniken mit Hilfe der Merkmale der Teilbarkeit / Nichtteilbarkeit und der
Merkmale der Additivität / Nonadditivität, wie sie von den Modisten aus dem fünften Buch
der Metaphysik von Aristoteles übernommen und für die von ihnen entwickelte Grammatik-
theorie genutzt wurden. Dadurch konnten sowohl nominaler wie verbaler Aspekt als nominale
und verbale Quantifikation formalisiert werden. An der Universität Paris wurde dies im 13.
9
und 14. Jahrhundert auf hohem Reflexionsniveau gelehrt; bei Guillaume finden sich
Bruchstücke dieser verlorenen Tradition. Es handelt sich um die intellektuell anregendsten
Teile seiner Sprachtheorie.
Die Modisten werden axiomatisch dem Realismus zugeordnet. Ihre Modellierung von
Grammatik als einer Technik der Perspektivierung, die gerade nicht Realität abbildet, sondern
die Perspektive, von der aus die Realität betrachtet wird, macht deutlich, dass wir es hier nicht
mit einer naiven Abbildtheorie zu tun haben, sondern mit einem Realismus auf höchstem
Reflexionsniveau. Ausprägungen des Realismus in der späteren cartesianischen Denkumwelt
können damit nicht verglichen werden. Es handelt sich um eine Art Gewächs, dem die
Denkgrundlagen entzogen sind und das auf anderem axiomatischen, nämlich cartesianischem
Nährboden, wo Sprache nur Ausdrucksfunktion hat und nicht eine komplexe Technik der
Perspektivierung und Bewältigung der Wahrnehmung von Welt ist, nicht wurzeln, sondern
nur verkümmern oder absterben kann. Das erklärt auch die umstrittene Einordnung von
Guillaume. Es dürften die nichtcartesianischen Anteile seiner Sprachtheorie sein, die den
Vorwurf des Sektierertums provoziert haben, zugleich jedoch sind dies die
richtungsweisenden Komponenten.
Im Wesentlichen modistisch ist bei Guillaume der Gedanke, dass die grammatischen
Kategorien unterschiedlich komplex sind. Das heißt konkret, dass sie sich quantitativ durch
die Anzahl von differenzierenden Merkmalen unterscheiden. Durch die Subtraktion eines
Merkmals von der Kategorie Tempus entsteht beispielsweise die Kategorie Aspekt. Durch die
Addition eines Merkmals zur Kategorie Tempus entsteht die Kategorie Modus. Das
Basismerkmal, das alle diese Merkmale vereint, ist das der Distanz, also ein räumliches
Merkmal (vgl. Andersson 1989, der diesen gemeinsamen Nenner als erster explizit
hervorgehoben hat).
10
Dass Tempus auf konkreten räumlichen Vorstellungen basiert, ist ein Grundthema von
Guillaume. Diese Annahme ist durch die Grammatikalisierungsforschung umfassend bestätigt
worden, zum Beispiel durch die Untersuchung von räumlichen, temporalen und modalen
Präpositionen: vor dem Haus (räumlich), vor der Vorlesung (temporal), vor Angst (modal),
die im übereinzelsprachlichen Maßstab immer zunächst die räumliche und erst dann die
temporale und modale Bedeutung entwickeln. Das Merkmal der räumlichen Distanz wird
sozusagen in mehreren Stufen re-interpretiert und dabei mit einem je zusätzlichen Merkmal
versehen. Bei Aspekt (Innen- vs. Außenperspektive, wodurch das Merkmal der Begrenztheit /
Nichtbegrenztheit einer Handlung impliziert wird) besteht eine Distanz zwischen dem
Sprecher und dem Gegenstand. Durch die Wahl zwischen zwei verschiedenen Aspekten
(perfektiv / imperfektiv) kommt es dazu, dass der Sprecher sich aufspaltet in Sprecher und
Betrachter. Mit anderen Worten, die grammatische Kategorie ermöglicht es dem Sprecher,
zwei unterschiedliche Perspektiven auf den Gegenstand zu wählen, unabhängig von seinem
realen Standort. Diese Aufspaltung des Sprechers in zwei Personen (Sprecher und Betrachter)
wird auch als double displacement bzw. doppelte Versetzung bezeichnet. Sie ist
charakteristisch für menschliche Kognition und wird durch die Kategorien des ATM-
Komplexes, also durch sprachliche Techniken geleistet.
Doppelte Versetzung liegt auch bei Tempus vor. Hier wird der Sprecher ebenfalls in
Sprecher und Betrachter aufgespalten. Während sich der Sprecher durch die Kategorie Aspekt
vom HIER des Verbalereignisses distanzieren kann, indem er als Betrachter in der Lage ist,
eine Außenperspektive einzunehmen, distanziert er sich mit Hilfe der Kategorie Tempus vom
JETZT der Verbalereignisse und verlegt den Betrachterstandpunkt außerhalb der Gegenwart, in
die Vergangenheit oder Zukunft. Bei Modus (zum Beispiel dem Irrealis in seinen
verschiedenen einzelsprachlichen Ausprägungen als Konjunktiv oder Subjonctif etc.) wird
wieder eine spezifische Form von Distanz modelliert. Diesmal distanziert sich der Sprecher
11
nicht vom HIER und JETZT des Verbalereignisses, sondern von sich selbst, dass heißt vom ICH,
da es sich für den Realitätsgehalt der in der Proposition kodierten Inhalte nicht verbürgt und
damit von ihnen distanziert. Was durch die humanspezifischen grammatischen Kategorien
wie Aspekt, Tempus und Modus somit geleistet wird, ist die Auflösung von natürlichen
Präsuppositionen über die Lokalisation des Sprechers (seine „Origo“ im Sinne von Karl
Bühler, vgl. auch Abraham 2012). Fehlen grammatische Markierungen (liegen also
sogenannte Nullmarkierungen vor), nimmt der Hörer an, dass der Sprecher über ein Ereignis
oder einen Gegenstand spricht, der sich gegenwärtig am Ort befindet und real ist (genauer in
Leiss 1994). Diese Präsuppositionen teilen die Menschen, was das Zeigen auf einen
Gegenstand betrifft, mit den höheren Säugetieren. Wenn ein Hund mit einer Leine im Maul
vor uns erscheint, dann lenkt er die Aufmerksamkeit darauf, dass er HIER und JETZT und zwar
wirklich (REAL) ausgeführt werden will. Die grammatischen Kategorien wie Aspekt, Tempus
und Modus steuern ebenfalls die Aufmerksamkeit des Kommunikationspartners, aber eben
auch auf abwesende, nichtgegenwärtige und nichtreale Kontexte. Die natürliche Origo wird
dabei interessanterweise nicht markiert, das heißt nicht durch formale Mittel versprachlicht.
So weisen das Präsens und der Indikativ im übereinzelsprachlichen Maßstab keine Endungen
auf. Sie sind damit unmarkiert. Dem Menschen gelingt mit grammatischen Markierungen,
was Tieren mit ihrem Kommunikationsapparat nicht möglich ist, selbst Bienen nicht (vgl.
Brandt 2009): der Ausbruch aus der natürlichen Origo. Neben Aspekt, Tempus und Modus
leisten das im Deutschen die noch weit komplexer gebauten epistemischen Modalverben und
die Modalpartikeln, die beide nicht zum Bereich Modus, sondern zum Bereich der Modalität
gehören. Mit dem Erwerb dieser komplexesten Kategorien des ATM-Komplexes (eigentlich
ATMM-Komplexes, wenn man Modalität hinzunimmt, vgl. Leiss 2012), die erst im 9.
Lebensjahr erworben wird, ist das Zeitfenster für den Erwerb von Sprache geschlossen. Was
bis dahin an Grammatik nicht erworben wurde, kann nicht mehr erworben werden. Interessant
12
wäre die Beantwortung der Frage, welche grammatische Kategorie wir dazugewinnen
könnten, würde sich das Zeitfenster für Spracherwerb nicht schließen. Bezeichnenderweise
haben wir keine Vorstellung davon, welche Kategorie das sein könnte.
Die grammatischen ATMM-Kategorien befreien uns von der Beschränkung auf die
natürliche Origo. Sie befreien uns aus dem Gefängnis der Gegenwart und der unmittelbaren
Realität. Guillaume beschreibt und erklärt in „Zeit und Verb“ die Systeme, die in den
verschiedenen Einzelsprachen entwickelt werden, um diesen Ausbruch aus der unmittelbaren
Gegenwart zu ermöglichen. Vertieft man sich in die verschiedenen Tempussysteme, die
Guillaume skizziert, fällt auf, wie viel Raum die Erklärung des Tempus Präsens einnimmt.
Warum ist das Präsens so interessant, wenn die sprachliche Technik der Erzeugung von
Zeitbildern doch die Überwindung der Beschränkung auf die Gegenwart zum Ziel hat? Bei
der Lektüre von „Zeit und Verb“ wird bald deutlich, dass die Gegenwart von Lebewesen ohne
Sprache nicht mit der Gegenwart in einem sprachlich konstituierten Tempussystem
vergleichbar ist. Das Präsens ist in systematischer Opposition zu den weiteren Tempora
modelliert. Mit anderen Worten, mit der Entwicklung und dem Erwerb der grammatischen
Kategorie Tempus ist die Gegenwart nicht mehr das, was sie vorher war. Sie ist, wenngleich
immer noch merkmallos kodiert, das, was die anderen merkmalhaft kodierten Tempora nicht
sind. Das zeigt sich auch sehr deutlich im kindlichen Spracherwerb, zu dessen wesentlichen
Meilensteinen der Erwerb finiter Verben zählt. Finitheit wird sehr häufig mit dem Erwerb von
Temporalität gleichgesetzt. Das ist im Großen und Ganzen richtig und trifft auf die von
Guillaume in „Zeit und Verb“ beschriebenen Sprachen zu. Bezieht man aber auch Sprachen
mit tempuslosen Verben wie das Japanische mit ein, so lässt sich Finitheit besser als
Kodierung eines raumzeitlichen Koordinatensystems definieren, das ausdrucksseitig auch mit
anderen grammatischen Mitteln kodiert werden kann.
13
Mit dem Erwerb von Finitheit, der etwa Ende des 4. Lebensjahres abgeschlossen ist,
können sich Kinder beispielsweise zum ersten Mal an Erlebtes erinnern. Sie bauen eine
spezifische Form des Langzeitgedächtnisses auf, das sogenannte episodische Gedächtnis (vgl.
Tulvings Überblicksdarstellung von 2005). Beim Abbau des episodischen Gedächtnisses, wie
es für die Alzheimersche Krankheit charakteristisch ist (zusammenfassend dazu Leiss 2011),
fallen die Betroffenen in die unmittelbare Gegenwart (und nicht in ein Präsens) zurück. Nichts
kann vielleicht unser Angewiesensein auf den sprachlichen Kategorienapparat im
Allgemeinen und auf die Kategorie Tempus bzw. Finitheit im Besonderen so drastisch
verdeutlichen wie diese Krankheit.
In diesem Zusammenhang stellt sich aktuell folgende Frage: Wenn es die sprachliche
Generierung von Zeitvorstellungen ist, die uns den Ausbruch aus der unmittelbaren
Gegenwart ermöglicht, warum nimmt das Präsens in den Romanen aktuell immer mehr zu?
Es handelt sich um ein Phänomen, das vor einigen Jahrzehnten vereinzelt aufgetreten ist, das
sich aber jetzt zu einem charakteristischen Kennzeichnen aktueller Romanschreibung
entwickelt hat. Handelt es sich um eine grammatische und kognitive Regression? Und
wodurch wäre diese bedingt? Durch eine Mediendynamik der Sprache zwischen Oralität und
Literalität? Zunächst können wir nach dem bisher Gesagten festhalten, dass die These einer
Regression zu weit führt, da ja unmittelbare Gegenwart und das grammatische Präsens nicht
gleichgesetzt werden können. Dennoch ist die Frage, warum für die Herstellung von in der
Vergangenheit, zum Teil auch von in der Zukunft lokalisierten Fiktionen immer mehr das
Präsens und immer weniger das Präteritum als Erzähltempus verwendet wird, eine der
drängendsten. Einen Versuch zur Beantwortung dieser Frage haben von
literaturwissenschaftlicher Seite soeben Armen Avanessian und Anke Hennig mit ihrem Buch
„Präsens – Poetik eines Tempus“ vorgelegt, das, ebenfalls ausgehend von Guillaumes
Tempustheorie, eines der spannendsten Themen der aktuellen Narrativitätsforschung in
14
Angriff nimmt.3 Doch handelt es sich überhaupt um ein narratives Präsens? Oder wird
langfristig mit dem Medienwechsel Narrativität als Technik vollständig umformatiert, um
zunehmend episodische Charakteristika anzunehmen? Was macht der Medienwechsel mit
unserer Sprache? Ich denke, dass wir erst am Anfang stehen, was die Beantwortung solcher
Fragen betrifft.
Suzanne Fleischman (1982) war die erste Sprachwissenschaftlerin, die Präsens-
vorkommen in Erzähltexten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einem
Medienwechsel in Verbindung brachte. Ihr Ausgangspunkt waren die Präsensvorkommen in
altfranzösischen Texten. Man findet sie in vielen älteren Texten, zum Beispiel im
Altisländischen und Altlateinischen. Das Wiederauftreten eines narrativen Präsens in
modernen Erzähltexten brachte Fleischman mit dem Phänomen einer Reoralisierung der
Gesellschaft durch die modernen Medien in Verbindung. Dieser Vorschlag war der erste
ernstzunehmende Versuch, das Zunehmen des narrativen Präsens zu erklären, weist allerdings
viele Probleme auf. Zunächst gibt es die älteren Präsensvorkommen zwar in dominant
mündlichen Kulturen, aber eben nicht in allen, beispielsweise nicht im Alt- und
Mittelhochdeutschen.
Vieles spricht dagegen, dass die Präsensvorkommen in Sprachen wie dem
Altfranzösischen oder dem Altisländischen mit einem Dominieren von Oralität erklärt werden
können. Dagegen spricht, dass das Präsens in ein und demselben Satz mit anderen Tempora
wechselt (ähnlich wie das passé simple und das imparfait in französischen Erzähltexten) und
dass diese Präsensvorkommen eine Art aspektuellen passé simple-Effekt aufweisen, also
Vordergrundierung von Verbalereignissen bewirken. Diesen Effekt können sie haben, weil sie
3 Aus sprachwissenschaftlicher Sicht wurde die Thematik von Benjamin Meisnitzer in seiner Dissertation „Das
Präsens als Erzähltempus in fiktionalen narrativen Texten im Spannungsfeld von Aspektualität und
Temporalität“ (2012) bearbeitet. Die Publikation ist in Vorbereitung.
15
nur mit perfektiven Verben konstruiert werden (vgl. Leiss 2000). Nun weiß man inzwischen,
dass perfektive Verben in vielen Sprachen genutzt werden, um einen nichtpräsentischen
Zeitbezug herzustellen. So gibt es aus sprachtypologischer Sicht (Ultan 1978) sogenannte
prospektive Sprachen wie das Russische, das perfektive Präsensformen zur Herstellung
zukünftigen Zeitbezugs nutzt, und es gibt retrospektive Sprachen wie das Altisländische oder
die meisten indigenen Sprachen Nordamerikas, die perfektive Präsensformen zur Herstellung
von vergangenem Zeitbezug nutzen. In Guillaumes Terminologie könnte man von zwei
unterschiedlichen Architektoniken zum Aufbau von Tempussystemen sprechen, wobei der
Systemstelle Aspekt eine zentrale Bedeutung zukommt. Sie entspricht einem Parameter, der
unterschiedlich gesetzt werden kann.
Zur Erklärung des narrativen Präsens spielt im Zusammenhang mit Medienwechsel
wohl mehr die Unterscheidung zwischen Tempusverwendung im dialogischen Diskursmodus
einerseits und im narrativem Diskursmodus andererseits eine Rolle. Zeman (2010)4 hat
gezeigt, dass sich die Tempussystematik in dialogischen Textpassagen grundlegend von
solchen in narrativen Passagen unterscheidet. Mit der Zunahme der Literalisierung durch den
Buchdruck hat man interessanterweise wiederholt vom Verfall der Kunst des Dialogs
gesprochen. Durch die technischen Medien des 20. Jahrhunderts gewinnen nun aber gerade
dialogische Elemente einen neuen Einfluss und werden zunehmend kultiviert. Man kann
durchaus soweit gehen und sagen, dass sogar im Film Narrativität zunehmend durch
Dialogizität ersetzt wird.
Der durchschnittliche Film, wie er in Massen rezipiert wird, enthält im Grunde keine
narrativen Komponenten mehr. Da in dialogischen Texten (damit sind sowohl geschriebene
4 Ich möchte mich an dieser Stelle bei Sonja Zeman für die Durchsicht dieses Vorworts bedanken sowie für ihre
wertvollen Hinweise zu präziseren Formulierungen zum Bereich Narrativität und Dialogizität in Filmen. Ich
16
als auch gesprochene Dialoge gemeint) das Präsens dominiert, liegt es nahe, folgende These
zu formulieren: Da der der Dialog zu einer neuen Dominante avanciert ist und da
Nichtleitmedien dominante Elemente imitieren, lässt sich die Zunahme des Präsens in
Romanen bzw. aktuellen Erzähltexten als Übernahme von Dialogizitätsmerkmalen erklären.
Einen vergleichbaren Prozess der Übernahme von Merkmalen des Leitmediums gab es bereits
einmal, nämlich bei der Entstehung von Schriftlichkeit als Leitmedium, das seinen Höhepunkt
vom 17. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte: „Er spricht wie gedruckt“ war bis vor
ca. 30 Jahren anerkennend gemeint.
Die mündliche Sprache imitierte lange den Satzbau und andere Merkmale von
geschriebener Sprache, was mittlerweile aber als stilistisch antiquiert eingeordnet wird. Gut
bringt das eine Bemerkung in der Süddeutschen Zeitung über die Sprache des
Sportschaureporters Delling vom 31. Dezember 2012 zum Ausdruck: „Delling häkelt
Schachtelsätze, als wäre Thomas Mann nie von uns gegangen.“ Inzwischen nehmen in
aktueller Erzählliteratur nicht nur Dialogizitätsmerkmale zu, diese Texte enthalten auch mehr
Dialoge als je zuvor und damit die tempusspezifischen Merkmale von Dialogizität. Ein gutes
Beispiel für die zunehmende Leitfunktion von Dialogizität ist der 2012 erschienene Roman
„Heimlich, heimlich mich vergiss“ von Angelika Maier.
Veränderte mediale Konstellationen konnten in der Universalgrammatik der Modisten
und auch bei Guillaume noch nicht wahrgenommen und verdiskontiert werden. Mittlerweile
hat man aber zu verrechnen, dass Medienwandel zu anderen Tempussystematiken führen
kann, ohne dass die universale und humanspezifische Technik, solche Systematiken zu
entwerfen, davon tangiert sein muss. Ob das elektronische Zeitalter zu Reoralisierung geführt
hat, lässt sich noch nicht abschließend beantworten. Sicher ist, dass diese erneute
konnte sie hier nicht vollständig berücksichtigen, da meine Darstellung hier weit grobkörniger ist als der
Auflösungsgrad von Zemans Differenzierungen.
17
Dominantsetzung oraler Medien (sekundäre Oralität) anders ausfällt, da sich das gesamte
mediale System seither geändert und diversifiziert hat. Mit anderen Worten, sekundäre
Oralität ist strukturell anders aufgebaut als primäre Oralität.
Auffallend ist aber auch, dass sich gegenwärtig im Bereich der Philosophie der jüngsten
Generation neue Tendenzen eines Spekulativen Realismus entwickeln, die zumindest auf
Grund der gewählten Terminologie Parallelen zur Spekulativen Philosophie des späten
Mittelalters vermuten lassen. Es scheint also eine Schnittmenge zwischen primärer Oralität
und sekundärer Oralisierung durch die elektronischen Medien zu geben, die zu einer neuen
Modellierung unseres Verhältnisses zur Welt sowie der Relationen zwischen Sprache, Denken
und Wirklichkeit führt. In diesem Zusammenhang fällt der sogenannte speculative turn in der
Philosophie auf. Es stellt sich die Frage, ob hier eine ähnliche Annäherung an die Philosophie
und Grammatiktheorie der Spekulativen Philosophie der Modisten stattfindet, wie wir sie
bereits bei Guillaume vorweggenommen finden, wenn auch mit einer Art Mischaxiomatik.
Der speculative turn wird von einer Gruppe von jungen Philosophen reklamiert, die sich
dem Spekulativen Realismus zuordnen. Bevor man sie mit der Spekulativen Philosophie der
Scholastik vergleicht, muss man wissen, wie der Terminus ‚spekulativ‘ in beiden
philosophischen Richtungen jeweils gebraucht wird. Ursprünglich leitet sich das Adjektiv
speculativus vom Substantiv speculum (‚Spiegel‘) ab. Der Spekulative Realismus der
Modisten meint eine Widerspiegelungstheorie, allerdings keine naive
Widerspiegelungstheorie, sondern eine Theorie, die sehr genau zwischen gespiegelten und
nichtgespiegelten Merkmalen unterscheidet. Sprache wird dabei als ein Filter definiert, der
Merkmale der Realität durchlässt und zwar in variabler Weise, wodurch sich eine komplexe
Architektonik des Lexikons mit hyperonymischen und hyponymischen Relationen ergibt.
Diese werden wieder über eine Logik der Teil-Ganzes-Relationen formal erfasst.
18
Auch der spekulative Realismus der aktuellen „spekulativen Wende“ distanziert sich
vom naiven Realismus (Bryant / Srnicek / Harman 2011a:7), wobei die verschiedenen
Beiträge zum spekulativen Realismus sehr heterogen sind. Es bleibt unklar, was mit
„spekulativ“ eigentlich gemeint ist; auch der Status von Sprache wird nicht klar definiert, da
er weitgehend ausgeblendet bleibt. Und die wiederholte gleichzeitige Nennung von Realismus
und Materialismus macht den Vergleich mit dem Realismus der Modisten auch nicht leichter.
Man kann das Ganze als eine Art von Aufbruchsbewegung wilder Denker charakterisieren,
die in alle Richtungen spekulieren wollen (im umgangssprachlichen Sinn von ‚spekulativ‘),
um sich freizudenken von idealistischer Philosophie.5 Man will eine objektorientierte
Ontologie entwerfen und „zurück zu den Dingen“, von denen behauptet wird, dass sie auch
ohne den Menschen existieren, wie schon der Titel Democracy of objects des Buchs von Levi
R. Bryant nahelegt. Man will nicht mehr Textkritik betreiben, sondern weg von den Texten
hin zur Ontologie, was eigentlich keinen Gegensatz darstellen muss, aber immerhin andeutet,
dass die Kommentierung schriftlicher Texte sowie Schriftlichkeit allgemein abgewertet wird
oder zumindest in den Hintergrund rückt. Dabei bleibt opak, wie dieser nichtnaive Realismus
modelliert werden soll. Anders als beim Realismus der Spekulativen Philosophie der
Modisten wird die Funktion von Sprache in Bezug auf die Abbildung von Welt kaum
beachtet.
Der Grund dürfte darin liegen, dass sich der Spekulative Realismus der Gegenwart vor
allem von der cartesianischen Aufklärungsphilosophie und von Kants Idealismus und
Konstruktivismus distanzieren will. Dort spielt Sprache eine untergeordnete Rolle und kann
5 Deutlich ausgedrückt von Alain Badiou: „The rupture with the idealistic tradition in the field of philosophical
study is of great necessitiy today“ (Interview in Bryant / Srnicek / Harman 2011:19). Diese „Rupturen“ fallen
sehr unterschiedlich aus und umfassen auch nihilistische Ansätze, wie den von Ray Brassier (2007). Einzige
Gemeinsamkeit all der Autoren, die sich dem sogenannten Spekulativen Realismus zuordnen, ist die
Opposition zum Rationalismus der Aufklärung.
19
daher bei ersten Distanzierungsentwürfen nicht sofort als relevanter Punkt erfasst werden.
Angriffsgegenstand ist naheliegenderweise die absolut gesetzte Vernunft des Individuums
(„the self-inclosed Cartesian subject“, so Bryant / Srnicek / Harman 2011a:3). Der speculative
turn ersetze den linguistic turn, so die These. Nun war die linguistische Wende, die von
Richard Rorty ausgerufen worden war, ja keine Zuwendung zur Sprache, sondern vielmehr
mit einer radikalen Abwertung von Sprache verbunden, bis ihr schließlich abgesprochen
wurde, irgendetwas zu repräsentieren, schon gar nicht Welt, und unsere Gedanken in radikaler
Zuspitzung letztendlich auch nicht (vgl. Leiss 2009/2012). Die Spekulative Wende grenzt sich
vor allem vom anti-repräsentationalistischen Programm Richard Rortys ab, das in letzter
Konsequenz nicht nur dazu geführt hat, dass Rorty von der Philosophie in die
Literaturwissenschaft gewechselt ist, sondern auch dazu, dass die Philosophie mittlerweile in
den USA zunehmend den literaturwissenschaftlichen Departments zugeordnet wird. In dieser
Hinsicht ist der Spekulative Realismus ein wichtiger Aufbruch, wobei gegenwärtig klarer ist,
wovon er wegführen soll, als dass sich bereits angeben ließe, wohin er führt.
Gibt es eine Verbindung zum Spekulativen Realismus des Mittelalters? Mit Sicherheit
kann man sagen, dass deren Arbeiten vom aktuellen „Spekulativen Realismus“ nicht rezipiert
werden und praktisch unbekannt sind.6 Auch die Axiomatik des Spekulativen Realismus der
6 Bryant / Srnicek / Harman (2011b:1) schreiben enthusiastisch: „In our profession, there has never been a better
time to be young“, was allerdings auch den Umfang der rezipierten Texte, die für diesen vielversprechenden
neuen philosophischen Aufbruch relevant sein dürften, noch deutlich begrenzt. Die Begeisterung der Autoren
für die Demokratisierung der Diskussionsmöglichkeiten in der „Blogosphäre“ des Internets, wo auch
Studierende und Doktoranden gleichberechtigt mitdiskutieren können, ist verständlich. Denn letztendlich
zählt das beste Argument und nicht der Status des Argumentierenden. Doch wer wird künftig das beste
Argument evaluieren können? Dem Spekulativen Realismus der Modisten am nächsten dürfte noch Levi R.
Bryant kommen, der seinem Buch von 2011 ein Zitat von Samuel Alexander voranstellt, ein Philosoph des
Realismus in Manchester, der die Philosophie von Peirce rezipiert hat, der wiederum die Modisten
ausgewertet hat. Wittgenstein hat die Vorlesungen von Samuel Alexander in Manchester gehört und war von
ihm nach meiner Einschätzung zum Realismus des Tractatus logico-philosophicus inspiriert worden.
20
Modisten ist so gut wie unbekannt, trotz der terminologischen Nähe in den Selbst-
etikettierungen. Und doch gibt es ein Bindeglied. Dieses ist ganz unerwartet der Außenseiter
Gustave Guillaume. Dessen Sprachtheorie mit Teilkomponenten der Mereologie der
spekulativen Universalgrammatik der Modisten wurde von Gilles Deleuze rezipiert. Deleuze
ist nun aber der Philosoph, auf den sich viele, die sich aktuell als Spekulative Realisten
bezeichnen, mehr oder weniger explizit beziehen. Guillaume ist in diesem Zusammenhang
auch relevant, da der Relation zwischen versprachlichtem Tempus und Zeit ein zentraler
Stellenwert für den Ausbau der Theorie zugewiesen wird: „Temporality is another important
issue for the new materialism and realism, as yet not fully developed“ (Bryant / Srnicek /
Harman 2011b:17).
Zeit ist innerhalb einer realistisch konzipierten Theorie ein wichtiger Gegenstand, da
Physiker ihr keinen ontologischen Status zuweisen, wir sie aber dennoch als real erleben. In
dieser Hinsicht war Guillaume richtungsweisend, der die Abgeleitetheit zeitlicher Konzepte
von räumlichen Konzepten und damit die Abgeleitetheit der Tempuskategorien von
aspektuellen Kategorien untersucht hat. Es handelt sich bei Zeit / Tempus um eine
konzeptuelle Metapher (vgl. Evans 2004, der diesen Bereich aus linguistischer Sicht
umfangreich behandelt). Zeit ist nicht in der Realität enthalten; sie ist standortabhängig und
bildet die Perspektive des Betrachters auf die Welt und nicht die Welt selbst ab. Ein
nichtnaiver Realismus muss diese zwei sprachlichen Techniken – Abbildung von Teilen der
Welt versus Perspektive, die nicht Teil der Realität ist – konsequent trennen. Dass Zeit keinen
Realitätsstatus haben soll, ist auf jeden Fall kontraintuitiv, aber in der Physik wenig
kontrovers. Wenn Tempora „überhaupt erst ein Verständnis von Zeit [schaffen]“ (Avanessian
/ Hennig 2012:262), dann muss bei jeder realistisch orientierten Philosophie der Stellenwert
von Sprache bei der Modellierung des Verhältnisses von Kognition und Sprache ins Zentrum
der Diskussion rücken. Im Spekulativen Realismus der Modisten war das der Fall: Sprache
21
wurde als Instrument definiert, das die infinite Realität in finite mentale Repräsentation
überführt. Bei Guillaume finden sich Ansätze für eine solche Modellierung.
Es gibt also viele gute Gründe, Gustave Guillaumes „Zeit und Verb“ zu rezipieren.
Auffallend ist, dass alle wichtigen Denkanstöße zu einem Spekulativen Realismus, auch die
aktuellen, von Frankreich, genauer von Paris ausgegangen sind. Dort wurden die Grundlagen
für einen nichtnaiven Realismus im 13. Jahrhundert gelegt. Untersucht man die Wurzeln
genauer, dann sind es die griechische und arabisch-islamische Philosophie und Wissenschaft,
die an der Universität Paris im 13. und 14. Jahrhundert rezipiert und kommentiert wurden,
nachdem die Texte lange nicht zugänglich, da nicht ins Lateinische übersetzt waren.
Übersetzungen waren und sind für die Tradierung von Wissen unersetzlich. So ist der
überwiegende Teil der hochkomplexen Sprachtheorie der Modisten seit dem Wechsel vom
Lateinischen als Wissenschaftssprache zu den „Volkssprachen“ als Wissenschaftssprachen
der Rezeption entzogen. Der lateinische Wissensbestand, der nicht in moderne
Nationalsprachen übersetzt wurde, kann heute als weitgehend verloren gelten. Das betrifft
beispielsweise die Mehrzahl der Texte der Spekulativen Philosophie des Mittelalters, die als
Manuskripte in Bibliotheken lagern und damit weder die „Gutenberg-Galaxis“ des
Buchdrucks durchquert haben noch übersetzt wurden. Editionen bleiben in der Regel
einsprachig und Spezialisten vorbehalten.
Vergleichbare Entwicklungen beobachten wir heute im Zuge der Globalisierung und der
Ausbreitung des Englischen als Wissenschaftssprache. Mittlerweile werden selbst
französische Texte nur noch dann rezipiert, wenn sie übersetzt sind. Aus diesem Grund ist die
Übersetzung von Gustave Guillaumes Werk „Temps et verbe“, das nicht nur in der Linguistik,
sondern auch in der Philosophie der französischsprachigen Welt einflussreiche Spuren
hinterlassen hat, ein wichtiger Schritt zur Rettung von Texten, die sonst im Zuge einer
22
erneuten medialen Revolution für immer verloren gehen könnten, die wir aber zum
Verständnis der medialen Umbrüche brauchen.
Zitierte Literatur:
Abraham, Werner (2012): Traces of Bühler’s semiotic legacy in modern linguistics. In: Abraham, Werner / Leiss Elisabeth (eds.): Modality and Theory of Mind elements across languages. Berlin, Boston: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 243), 211-250.
Andersson, Sven-Gunnar (1989): Zur Interaktion von Temporalität und Aktionsart bei den nichtfuturischen Tempora im Deutschen, Englischen und Schwedischen. In: Abraham, Werner / Janssen, Theo (eds): Tempus – Aspekt – Modus. Die lexikalischen und grammatischen Formen in den germanischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 237), 27-49.
Arnauld, Antoine / Lancelot, Claude (1660/1676/1966): Grammaire generale et raisonnée ou La Grammaire de Port-Royal. Édition critique présentée par Herbert E. Brekle. Nouvelle impression en facsimilé de la troisième édition de 1676. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1966 (Grammatica universalis 1).
Avanessian, Armen / Hennig, Anke (2012): Präsens. Poetik eines Tempus. Zürich: diaphanes.
Brandt, Reinhard (2009): Können Tiere denken? Ein Beitrag zur Tierphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp (edition suhrkamp 17).
Brassier, Ray (2007): Nihil unbound. Enlightenment and extinction. New York: Palgrave Macmillan.
Bybee, Joan (1985): Morphology. A study of the relation between meaning and form. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins (Typological Studies in Language 9).
Bryant, Levi / Srnicek, Nick / Harman, Graham (2011a): The speculative turn. Continental materialism and realism. Melbourne: re.press.
Bryant, Levi / Srnicek, Nick / Harman, Graham (2011b): Towards a Speculative Philosophy. In: Bryant/Srnicek/Harman 2011a: 1-18.
Bryant, Levi R. (2011): The democracy of objects. Ann Arbor: Open Humanities Press.
Bühler, Karl (1934/1982): Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion von Sprache. Mit einem Geleitwort von Friedrich Kainz. Ungekürzter Nachdruck der Ausgabe von 1934. Stuttgart, New York: Fischer (UTB-Taschenbuch 1159).
Bühler , Karl (1934/1990/2011): Theory of language. The representational function of language, Transl. D.F.Goodwin. 2nd revised edition with a preface by Werner Abraham. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.
Diewald, Gabriele M. (1997): Grammatikalisierung. Eine Einführung in das Sein und Werden grammatischer Formen. Tübingen: Niemeyer (Germanistische Arbeitshefte 36).
Evans, Vyvyan (2004): The structure of time. Language, meaning and temporal cognition. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins (Human Cognitive Processing 12).
23
Fleischman, Suzanne (1982): The Future in Thought and Language. Diachronic Evidence from Romance. Cambridge, London, New York: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Linguistics 36).
Guillaume, Gustave (1919/1975) : Le problème de l’article et sa solution dans la langue française. Réédition avec préface de Roch Valin. Paris: Librairie Nizet / Québec: Les presses de l’université Laval.
Guillaume, Gustave (1929) : Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps. Paris : Champion (La Société de Linguistique de Paris. Collection Linguistique 27).
Guillaume, Gustave (1929/1984): Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps; suivi de L’architectonique du temps dans les langues classique. Avant-propos de Roch Valin. Paris: Champion.
Guillaume, Gustave (1973/2000): Grundzüge einer theoretischen Linguistik. Aus dem Französischen übersetzt von Christine Hunger-Tessier, Berthold Mader und Joseph Pattee. Tübingen: Niemeyer [Franz. Zuerst 1973: Principes de linguistique théorique].
Hopper, Paul J. / Traugott, Elizabeth (1993): Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
Leiss, Elisabeth (1984): Gustav Guillaumes Sprachtheorie – Am Beispiel der grammatischen Kategorien des Verbs. Sprachwissenschaft 9 (1984), 456-472.
Leiss, Elisabeth (1994): Markiertheitszunahme als natürliches Prinzip grammatischer Organisation. In: Köpcke, Klaus-Michael (ed.): Funktionale Untersuchungen zur deutschen Nominal- und Verbalmorphologie. Tübingen: Niemeyer (Linguistische Arbeiten 319), 149-160.
Leiss, Elisabeth (2009/2012): Sprachphilosophie. 2. Auflage. Berlin, Boston: de Gruyter.
Leiss, Elisabeth (2011): Semantisches und episodisches Gedächtnis bei Alzheimer-Demenz und Primär Progredienter Aphasie. In: Geist, Barbara / Hielscher-Fastabend, Martina / Maihack, Volker (eds.): Sprachtherapeutisches Handeln im Arbeitsfeld Geriatrie. Störungsbilder, Diagnostik, Therapie. Köln: Prolog, 141-168.
Leiss, Elisabeth (2012): Epistemicity, evidentiality, and Theory of Mind. In: Abraham. Werner / Leiss, Elisabeth (eds.): Modality and Theory of Mind elements across languages. Berlin, Boston: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 243), 37-65.
Meier, Angelika (2012): Heimlich, heimlich mich vergiss. Roman. 3. Auflage. Zürich: diaphanes.
Meillet, Antoine (1912/1926): L’évolution des formes grammaticales. In : Linguistique historique et linguistique générale. 2. Auflage. Paris: Société de Linguistique Paris VIII, 130-148 [Zuerst in Rivista di scienzia 12 (1912)].
Meisnitzer, Benjamin (2012): Das Präsens als Erzähltempus in fiktionalen narrativen Texten im Spannungsfeld von Aspektualität und Temporalität. Auf den Spuren des narrativen Präsens als Leittempus in Romanen. Diss.: LMU München.
Stephany, Ursula (1985): Aspekt, Tempus und Modalität. Zur Entwicklung der Verbalgrammatik in der griechischen Kindersprache. Tübingen: Narr (Language Universal Series 10).
24
Tulving, Endel (2005): Episodic memory and autonoesis. Uniquely human? In: Terrace, Herbert / Metcalfe, Janet (eds.): The missing link in cognition. Origins of self-reflexive consciousness. Oxford: Oxford University Press, 3-56.
Ultan, Russel (1978): The Nature of Future Tense. In: Greenberg, Joseph (ed.): Universals of Human Language. Vol. 3: Word Structure. Stanford: Stanford University Press, 83-123.
Zeman, Sonja (2010): Tempus und „Mündlichkeit“ im Mittelhochdeutschen. Zur Interdependenz grammatischer Perspektivsetzung und „historischer Mündlichkeit“ im mittelhochdeutschen Tempussystem. Berlin, New York: de Gruyter (Studia Linguistica Germanica 102).
Elisabeth Leiss (LMU München)