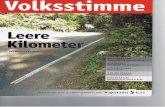Albrecht Altdorfers "Lot und seine Töchter" und die Ambivalenz von Erotik und Moral in der...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Albrecht Altdorfers "Lot und seine Töchter" und die Ambivalenz von Erotik und Moral in der...
Albrecht Altdorfers ,Lot und seine Töchter und die Ambivalenz von Erotik und Moral in der Aktmalerei der
nordischen Renaissance
V O N H A N N S - P A U L T I E S
Albrecht Altdorfers 1537 datierte, im Wie-ner Kunsthistorischen Museum befindli-
che Tafel mit Lot und seinen Töchtern (Abb. 1) zählt zu den am wenigsten beachteten Haupt-werken der deutschen Renaissancemalerei1. Bis heute liegt keine Studie vor, die sich - in um-fassender Weise - mit Fragen der Interpretation und Funktion des Gemäldes beschäftigt2. Die Altdorfer-Forschung hat Otto Beneschs Zu-
schreibung3 zwar weitgehend übernommen4, sie hat sich jedoch schwer getan, das Gemälde, „das durch die Darstellung, Malweise und sein großes Format zunächst gleich befremdlich wirkt", als (Spät-)Werk Altdorfers zu akzeptie-ren5. Eberhard Ruhmer und Franz Winzinger, die sich etwas genauer mit dem Bild beschäftig-ten, haben weitere stilistische Analogien nachgewiesen und die Vielfalt der Malweise
Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Referats, das ich im Sommer-
semester 2002 im Rahmen des Seminars von Prof. Artur Rosenauer zum Thema ,Altdorfer-Fragen' am Wiener
Institut für Kunstgeschichte gehalten habe. Das Manuskript wurde im April 2003 abgeschlossen und im August
2004 geringfügig aktualisiert. Für Rat und Hil fe danke ich Prof. Rosenauer sowie Martina Hauschka, Christian
Nikolaus Opitz, Barbara Six, Georg Vasold, Andreas Michael Winkel und Michaela Zöschg.
ι Lindenholz, 1 0 7 , 5 χ 189 c m · - Z u Erhaltungszustand und Provenienz (das Bild ist um 1600 in Nürnberger Besitz,
spätestens seit der Zeit Karls VI . , 1 7 1 1 - 1 7 4 0 , in den kaiserlich-habsburgischen Sammlungen nachweisbar) vgl. F.
WINZINGER, Albrecht Altdorfer. Die Gemälde, München 1 9 7 5 , S. i o j f .
2 Erst nach weitgehendem Abschluß des Manuskripts hatte ich Zugang zu der Diplomarbeit, die Ilona Neuffer
dem Gemälde gewidmet hat : Die Arbeit, die weniger stringent an der Frage der künstlerischen Herleitung bzw.
Funktion ausgerichtet ist, kommt zu teils verwandten, teils ergänzenden (vgl. die Assoziationen mit den Sujets
von .Garten der Lüste' und ,Satyr und Nymphe ' — S. 75—77, 83F.), teils problematischen (vgl. die These, das Bild
könnte der Propaganda für oder aber gegen die Wiedertäufer, deren Nudismus bzw. Polygamie, gedient haben
— S. 77—79) Ergebnissen. Interessant sind die Hinweise, daß die Zinnflasche mit Bildnismedaillon, welche im rech-
ten unteren Bildeck erscheint, an Pulverflaschen erinnert, die im frühen 16 . Jahrhundert in Nürnberg hergestellt
wurden, und daß ein Prager Inventar von 1 7 3 7 ein Bild mit ,Loth mit seinen zweien Töchtern' als Werk des .Lucas
Kranach' anführt, das in den Maßen mit der Wiener Tafel übereinstimmt (S. 97ff.). Aufgrund dieser Hinweise auf
einen Nürnberger Auftraggeber bzw. eine Entstehung des Bildes im Cranach-Umkreis schließen zu wollen (Neuffer
schließt sich, mir völlig unverständlich, Schindlers Ablehnung der Zuschreibung an Altdorfer an — siehe unten,
Anm. 4), halte ich für überzogen. (Falls sich der Inventarvermerk auf das Wiener Bild bezieht, dürfte es sich, was
die Zuschreibung betrifft, um eine — für das 18 . Jahrhundert plausible — Verwechslung handeln.) — Vgl. I. NEUF-
FER, Altdorfers Lot und seine Töchter von 1 5 3 7 . Ikonographisch-ikonologische Studien, Dipl. Arb. Wien 2002.
3 Vgl. O . BENESCH, Altdorfers Badestubenfresken und das Wiener Lothbild, in : Jb . der Preußischen Kunstsamm-
lungen, 5 1 , 1 9 3 0 , S. 1 7 9 - 1 8 8 . Zuvor war das Gemälde Hans Baidung Grien sowie Matthias Gerung zugeschrie-
ben worden. Vgl. WINZINGER, Gemälde (zit. A n m . 1 ) , S. 106 .
4 Der Vorschlag Herbert Schindlers, das Bild, ebenso wie die Regensburger Badehausfresken, Altdorfer ab- und
dem ,Schüler', der den Regensburger Altar von 1 5 1 7 gemalt haben soll, zuzuschreiben, überzeugt in keinem seiner
Argumente. - Vgl. H. SCHINDLER, Albrecht Altdorfer und die Anfänge des Donaustils, in : Ostbairische Grenzmar-
ken, Passauer Jb . für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 23 , 1 9 8 1 , S. 6 6 - 7 3 , hier S. 7 i f .
5 WINZINGER, Gemälde (zit. A n m . 1 ) , S. 106 . - Z u r Heterogenität von Altdorfers Spätstil vgl. C . S. WOOD, Albrecht
Altdorfer, The invention of Landscape, London 1 9 9 3 , S. 266Í
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 7 8 H A N N S - P A U L T I E S
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R ' 1 7 9
hervorgehoben6. Da man annahm, der Maler
habe die Bibelszene zum bloßen Vorwand einer
„ausgesprochen pervers-erotischen Darstellung"
benutzt7, schien es unnötig, den Diskrepanzen
zwischen biblischer Textvorlage und Darstel-
lung sowie den Konsequenzen, die sich aus der
- immer wieder festgestellten - Adaption italie-
nischer Vorbilder ergeben, weitere Aufmerksam-
keit zu schenken8. Auch jene Arbeiten, welche
Fragen der Lot-Ikonographie gelten (der Uber-
blick von Joshua B. Kind9 sowie Studien zu an-
deren Darstellungen des Themas, die Altdorfers
Gemälde als forciert erotische Interpretation
zum Vergleich heranziehen10), liefern höchstens
Hinweise, die fur eine weitergehende Deutung
nutzbar gemacht werden können. Kind benennt
die Eigenheiten des Wiener Bildes, suggeriert
Bezüge zu den Topoi von ,Weiberlisten' und
,Ungleichem Paar', begnügt sich sonst jedoch
mit der Feststellung: „This extraordinary picture
still remains an enigma. The subject is represen-
ted in a most unique way, not only among con-
temporary versions, but really within the enti-
rety of the corpus of images of the The Drunken
Lot and his Daughters" 1 1 .
Im Folgenden wird versucht, das Desiderat
einer .historischen Erklärung' von Inhalt und
Funktion des Gemäldes einzulösen. Ein kurzer
Uberblick über die Schrift- und Bildtradition
der Lot-Geschichte erscheint notwendig, um
die Eigenheiten von Altdorfers Lösung klarer
hervortreten zu lassen. Im Rahmen der aus-
führlichen Besprechung des Gemäldes (bei der
die für das Bild konstitutive Dualität von Flä-
chenzusammenhang und Raum-Gegenstands-
Zusammenhang 1 2 und deren inhaltliche Impli-
6 E . RUHMER, Albrecht Altdorfer, M ü n c h e n 1 9 6 5 , S. 1 8 , 2 0 - 2 2 , 2 9 - 3 0 , 7 3 . - WINZINGER, ebenda, S. 4 6 - 4 8 , 62 ,
1 0 5 - 1 0 6 . - Für die Autorschaft Altdorfers, daran sei hier erinnert, sprechen nicht zuletzt die - speziell am Ober-
körper des liegenden Frauenaktes sichtbaren - Schwierigkeiten in der anatomisch korrekten Darstellung.
7 Winzinger verglich das Lot-Bi ld mit „manchen ähnlich lasziv wirkenden, oft lebensgroßen Akten sächsischer
H o f d a m e n , die Lukas Cranach in dem puritanisch-protestantischen Wittenberg ebenfalls notdürft ig als Lukretia,
Venus oder Judi th tarnen mußte . " E r war bemüht, jene „Perversität" einem festgelegten Auf t rag und nicht einer
„unerfreulichen Alterserotik" des Künstlers zuzuschreiben. Vgl . WINZINGER, G e m ä l d e (zit. A n m . 1 ) , S. 47 . - N a c h
Friderike Klauner läßt sich das Bild „nur mehr als [durch den Bibeltext gerechtfertigtes] Animierbi ld" auffassen.
Vgl . F. KLAUNER/G. HEINZ, V o m H i m m e l durch die Welt zur Hölle , Inhalt und Sinn von Gemälden , Wien/Salz-
burg 1 9 8 7 , S. i 8 i f .
8 Nach Abschluß des Manuskripts stieß ich auf Manfred Riesels v o m Lot-Bild angeregtes, jedoch vorrangig an der
Persönlichkeit des Künstlers und an dessen vermeintlicher moralischer Skrupellosigkeit interessiertes Essay über „Die
Zeit , in der Albrecht Altdorfer lebte". Der Autor konstatiert die Diskrepanzen zwischen dem Bibeltext und Altdor-
fers „unfaßbarer und unerträglicher" (S. 24), geradezu „bordellhafter" (S. 2 1 ) Darstellung: Unterschiede, die er - in
Unkenntnis der Text- und Bildtradition der Lot-Geschichte - als „bewußte Verfälschung" (S. 24) des Genesis-Textes
von Seiten des Künstlers deutet. Die Gründe dieser „Verfälschung", denen er zwei ausfuhrliche Exkurse widmet,
sieht Riesel in der von Altdorfer als einem „gewissenlosen Opportunisten" (S. 7 1 ) mitgetragenen frühneuzeitlichen
Juden- und Frauenfeindlichkeit. (Riesels Prämisse, „jedes Kunstwerk" sei „zugleich Selbstdarstellung des Künstlers"
[S. 1 7 - der Autor zitiert aus einem Vortrag Winzingers!] ist für das 1 6 . Jahrhundert freilich höchst problematisch.)
Vgl . M . RIESEL, Müssen wir alles glauben, was man uns erzählt?, Kritische Betrachtungen zu Darstellungen in der
Kunst - Sein und Schein, 5 Essays, Mi t einem Vorwort von Elfriede Jelinek, Frankfurt am Main 1998 , S. 1 7 - 9 3 .
9 J . B. KIND, The Drunken Lot and his Daughters : an iconographical study of the uses o f this theme in the visual
arts f r o m 1 5 0 0 - 1 6 5 0 , and its bases in exegetical and literal history, Phil. Diss. N e w York 1 9 6 7 .
1 0 O . BÄTSCHMANN, ,Lot und seine Töchter ' im Louvre. Metaphorik , Antithetik und Ambiguität in einem nieder-
ländischen G e m ä l d e des frühen 1 6 . Jahrhunderts , in: Städel-Jb., N.F. , 8, 1 9 8 1 , S. 1 5 9 - 1 8 5 . - R . MELLINKOFF,
Tit ians Pastoral Scene: A Unique Rendit ion o f Lot and His Daughters, in : Renaissance Quarterly, L I , 3, 1 9 9 8 ,
S. 8 2 9 - 8 6 3 .
h KIND, D r u n k e n Lot (zit. A n m . 9), S. 1 5 4 - 1 5 6 , 3 3 4 - 3 3 6 (Zitat S. 334f . ) .
1 2 Vgl . O. PACHT, Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des 1 5 . Jahrhunderts , in : DERS., Methodisches zur
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
180 H A N N S - P A U L T I E S
kationen berücksichtigt werden sollen) ist die
Frage zu stellen, welche zumal themenfremden
Vorbilder der Maler rezipiert und mit welchen
Folgen er sie umgesetzt hat. Ebenso sollen die
erwähnten Topoi (,Weiberlisten', ,Ungleiches
Paar') für das Verständnis des Bildes nutzbar
gemacht werden. Ein dritter und wesentlicher
Teil meiner Ausführungen gilt der Bestimmung
des Betrachterbezugs sowie dem Versuch, durch
die Heranziehung vergleichbar .ambivalenter'
Darstellungen (und der entsprechenden For-
schungsmeinungen) eine Vorstellung von Auf-
traggeber und Bestimmungsort, von der ,hi-
storischen Wahrnehmung' und Funktion des
Gemäldes zu erhalten 13.
1. ,Lot und seine Töchter': Textvorlage, Schrift- und Bildtradition
Vom Schicksal Lots, eines Neffen Abrahams, be-
richtet das 19. Kapitel der Genesis: Bevor Gott
die am Toten Meer gelegenen Städte Sodom
und Gomorra wegen der sexuellen Exzesse ih-
rer Einwohner durch Schwefel- und Feuerregen
zerstörte, sandte er zwei Engel nach Sodom, die
Lot, den einzigen Gerechten, und seine Fami-
lie rechtzeitig und sicher aus der Stadt geleiten
sollten. Während der Flucht, welche die Familie
ins Gebirge führte, übertrat Lots Frau das Gebot
der Engel, nicht zurückzublicken, und erstarrte
zur Salzsäule. Lot und seine beiden Töchter lie-
ßen sich in einer Höhle nieder. „Da sprach die
ältere zu der jüngeren: Unser Vater ist alt, und
ist kein Mann mehr auf Erden der zu uns ein-
gehen möge nach aller Welt Weise; so komm,
laß uns unserm Vater Wein zu trinken geben
und bei ihm schlafen, daß wir Samen von un-
serm Vater erhalten. Also gaben sie ihrem Vater
Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die
erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater;
und der ward's nicht gewahr, da sie sich legte
noch da sie aufstand" (Genesis 19, 3 1 - 3 3 ) . Am
nächsten Abend wiederholte die jüngere Toch-
ter den Betrug. Die Söhne, die den inzestuösen
Verbindungen entwuchsen, Moab und Ammon,
wurden die Stammväter zweier gleichnamiger
Völker - der Moabiter und Ammoniter. Lots
weiteres Schicksal wird in der Bibel nicht über-
liefert 14.
Seit Lukas 17 , 28-30 wurde der Untergang
von Sodom und Gomorra als Präfiguration des
Weltgerichts verstanden. Lots Errettung galt als
Gleichnis für die Errettung der Seele vor der
ewigen Verdammnis 15. Während der Bibel text
— abgesehen davon, daß sich die Moabiter und
Ammoniter im weiteren Verlauf des AT als blei-
bende Feinde Israels herausstellen - auf eine
kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften, Wien 1977 , S. 1 7 - 5 9 (der genannte Aufsatz erstmals erschienen
1933)· 13 Was die Methode betrifft, fühle ich mich Oskar Bätschmanns .Anleitung zur Interpretation' sowie Michael Vik-
tor Schwarz' Fragen nach der .Funktion' eines Kunstwerks verpflichtet. - Vgl. BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10).
- DERS., Anleitung zur Interpretation: Kunstgeschichtliche Hermeneutik, in: H. BELTING u.a. (Hg.), Kunstge-
schichte, Eine Einführung, Berlin 1996 5 , S. 1 9 2 - 2 2 2 . - M . V. SCHWARZ, Visuelle Medien im christlichen Kult.
Fallstudien aus dem 13 . bis 16. Jahrhundert, Wien u. a. 2002, vor allem S. 9 -24 , 2 5 1 - 2 7 0 . - Die Betrachtung des
Bildes als „Medium", die Beantwortung der Frage, wie „dieser Gegenstand beim Gebrauch durch das Publikum,
für den er hergestellt worden war, funktionierte und wie der Hersteller sein Produkt auf diese Funktion hin abge-
stimmt hatte" (vgl. SCHWARZ, S. 252), scheint mir am besten geeignet, um die Sonderstellung, welche das Lot-Bild
im (Spät-)Werk Altdorfers einnimmt, und die der Forschung Schwierigkeiten bereitet hat, zu erklären.
14 H. M. VON ERFFA, Ikonologie der Genesis. Die christlichen Bildthemen aus dem Alten Testament und ihre Quel-
len, 2, München 1995, S. 1 0 4 - 1 1 9 .
1 5 Ebenda, S. 1 0 8 - 1 1 5 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R 1 181
Bewertung von Lots Trunkenheit und Inzest
verzichtet, bemühten sich die mittelalterlichen
Exegeten um einen Kompromiß aus Rechtfer-
tigung und Verurteilung der Episode : Das Ver-
halten der Töchter wird insofern entschuldigt',
als sie geglaubt hätten, Gottes Strafgericht sei
einer Weltkatastrophe gleichgekommen und es
sei ihre Aufgabe, heroisch Schuld auf sich zu
nehmen, um den Fortbestand des Menschenge-
schlechts zu sichern 16. Lots Anteil an dem Sexu-
aldelikt erscheint insofern relativiert, da er ohne
Zustimmung, und daher frei von Wollust, sowie
unbewußt bzw. unter der bewußtseinslähmen-
den Wirkung von Wein gehandelt habe. Seine
Schuld liegt vielmehr darin, daß er es an zwei
getrennten Abenden zuließ, von der Hand sei-
ner Töchter betrunken zu werden 17 .
Im 14. und 15 . Jahrhundert hielt die Lot-Ge-
schichte Einzug in die weltliche Literatur, spe-
ziell des didaktischen, moralisierenden Genres.
Sie wurde aus dem biblischen Zusammenhang
gerissen und diente - infolge der bewußten Ver-
drehung der biblischen Überlieferung sowie der
exegetischen Auffassung - als negatives Exem-
pel 18 . Die Figur des Lot wurde dazu verwendet,
den Niedergang einer großen Persönlichkeit
durch Trunkenheit sowie das Nahverhältnis von
Trunkenheit - als Ausdruck von Völlerei - sowie
Unkeuschheit zu veranschaulichen: Das 16. Ka-
pitel von Sebastian Brants ,NarrenschifF (1494),
das „Von Völlerei und Prassen" handelt, nennt
- wenige Zeilen nach der Erwähnung eben jenes
Zusammenhangs („Unkeuschheit kommt von
Trunkenheit") - Lot an erster Stelle einer Auf-
zählung prominenter Trunkenbolde („Lot ward
durch Wein zweimal zum Tor") 1 9 . Lots Töch-
ter wurden zu Inkarnationen von Wollust und
.Falschheit': In dem als Sittenlehre für Frauen
verfaßten, 1493 auf Deutsch publizierten Buch
,Der Ritter vom Turn' bleibt die schon in der
Bibel angelegte Entschuldigung unerwähnt. Das
Tun der Töchter erscheint als Folge vom Teufel
eingegebener fleischlicher Begierde20. In Hans
Vintlers ,Die Pluemen der Tugent' ( i486 ge-
druckt) fungieren Lots Töchter als Inbegriff von
,valschhait'21.
Mittelalterliche Darstellungen von Lots Trun-
kenheit und Inzest sind selten und beinahe aus-
schließlich auf das Medium der Bibelillustration
beschränkt: Während die Bibel des Jean de Sy
( 1 355 , Abb. 2) eine sachliche Illustration' des
Texts liefert22, präsentieren die Pariser Bibles
Moralisées ( ι . Hälfte des 13 . Jahrhunderts) eine
moraldidaktische Aufarbeitung23. Im frühen 16.
Jahrhundert entstanden die ersten autonomen
Darstellungen : Mit dem Kupferstich des Kölner
1 6 Die Schuld der Töchter - so die Exegeten - könne, da sie sonst abermals im väterlichen Lager erschienen wären,
auch nicht in Wollust bestehen.
17 KIND, Drunken Lot (zit. Anm. 9), S. 34-8 5b. - VON ERFFA, Ikonologie (zit. Anm. 14), S. 1 1 5-1 1 9 .
18 KIND, ebenda, S. 8 6 - 1 0 1 .
19 S. BRANT, Das Narrenschiff, hrsg. von H.-J. MÄHL, Stuttgart 1998 (zuerst Basel 1494), S. 62-66, hier S. 63. - KIND,
Drunken Lot (zit. Anm. 9), S. 9 8 - 1 0 1 , nennt weitere Texte, die Lot als Exempel der Trunkenheit anführen.
20 „Sie sahen ihren Vater nackt daliegen, ohne Hosen", heißt es in Anlehnung an die Episode von Noahs Trunkenheit,
„und beide wurden versucht, mit ihm fleischlich zu verkehren." - Vgl. KIND, ebenda, S. 87-89.
21 Es heißt dort: [ . . .] nu gedachten sein tochter an der stet, wie si dem vatter machten ain geteusch, damit das er sein
uncheusch mit in trib gar unerkannt [...].— Vgl. H. VINTLER, Die Pluemen der Tugent, hrsg. von I. von ZINGERLE,
Innsbruck 1874 (zuerst Augsburg i486), S. 132.
22 Paris, Bibliothèque Nationale. Vgl. M . H . CAVINESS, Visualizing Women in the Middle Ages. Sight, Spectacle and
Scopic Economy, Philadelphia 2001, S. 76f. (mit Abb. 33a-b).
23 Wien, Osterreichische Nationalbibliothek bzw. The Bodleian Library, University of Oxford. — Der Darstellung
Lots, der die bei ihm sitzenden Töchter umarmt bzw. mit ihnen unter einer Decke liegt, ist das Bild eines von
Welt und Teufel versuchten Eremiten beigeordnet : In seiner Täuschung kehrt der Betrug Lots durch seine Töchter
wieder. Vgl. BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10), S. i66f. (Abb. 7) bzw. CAVINESS, ebenda, S. 76 (mit Abb. 32).
- Für weitere Beispiele vgl. KIND, Drunken Lot (zit. Anm. 9), S. I2 j f . - Von den genannten weltlichen Schriften
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 8 2 H A N N S - P A U L T I E S
2 Bibel des Jean de Sy, 1355. Paris, Bibliothèque Nationale, MS. F. 15397, f. 30 r: Lot und seine Töchter
Meisters P W (um 1500) 2 4 , der das Hauptaugen-
merk auf die prominent im Vordergrund darge-
stellte Verleitung zum Inzest legt, und, gleichsam
als Erkennungshilfe, die brennende Stadt und
die Salzsäule hinzufügt, ist ein Schema geschaf-
fen, das in zahlreichen späteren Darstellungen -
speziell in denjenigen deutscher Graphiker, die
teils als Bibelillustrationen verwendet wurden
- wiederkehrt25. Im Gemälde eines Antwerpe-
ner oder Leydener Malers im Louvre (1.Viertel
des 16. Jahrhunderts) ist den Szenen von Zer-
störung und Flucht bzw. Inzest etwa gleich viel
Raum zugewiesen26. Die Darstellung der Flucht
und des Fluchtweges, welche Brand und Verfüh-
rungsszene im Sinne eines narrativen und räum-
lichen Kontinuums verbinden, sowie die Diffe-
renzierung der beiden Töchter, von denen eine
den Vater verfuhrt, während die andere, etwas
isoliert, Wein einschenkt, kehren in den zahl-
reichen, um 1 5 3 0 entstandenen Lot-Tafeln der
Lucas-Cranach-Werkstatt (Abb. 3) wieder2 7 . Ein
kleines Täfelchen Joachim Patiniers (vor 1 5 1 4 )
gibt dem Brand der Städte breiten Raum, wäh-
rend Lots Flucht und Trunkenheit zu bloßen
Staffageszenen reduziert sind2 8 : Altdorfers und
Patiniers Darstellungen des Stadtbrandes sind
- in malerischer wie ikonographischer Hinsicht
- eng verwandt, was auf eine Patinier-Rezeption
von Seiten Altdorfers verweisen könnte2 9 .
enthält einzig die Druckausgabe der ,Pluemen der Tugent' (1468) eine Illustration der Lotgeschichte. Vgl. KIND, S. 126-128.
2 4 BÄTSCHMANN, e b e n d a , S . ι6γ{. ( A b b . 8).
25 Hans Sebald Beham, Holzschnitt, 1533. - Vgl. R. A. KOCH (Hg.), The Illustrated Bartsch, 15, Early German Masters (Barthel Beham, Hans Sebald Beham), New York 1978, S. 137 (mit Abb.). - Hans Baidung Grien, Holz-schnitt, um 1530. Vgl. H. MÖHLE, Zwei bisher unbekannte Holzschnitt-Illustrationen von Hans Baidung, in: Berliner Museen, NF, XI, Heft 1, September 1961, S. 1 5 - 1 7 (Abb. 2). - Georg Pencz, Kupferstich. Vgl. R. A. KOCH (Hg.), The Illustrated Bartsch, 16, Early German Masters (Jacob Bink, Georg Pencz, Heinrich Aldegrever), New York 1980, S. 93 (mit Abb.). - Hans Schäufelein, Holzschnitt, um 1535. Vgl. BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10), S. 174Í (Abb. 15).
2 6 BÄTSCHMANN, e b e n d a ( A b b . 1 ) .
27 D. KOEPPLIN/T. FALK, Lukas Cranach, Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik, 2. Bde., Ausst.-Kat., Basel/Stutt-gart 1974 (Bd. 1V1976 (Bd. 2); hier Bd. 2, S. 566f. (mit Abb.). - M. J. FRIEDLANDER/J. ROSENBERG, Die Gemälde von Lucas Cranach, Basel u. a. 1979, Nr. 204-207 (mit Abb.).
28 Rotterdam, Museum Boymans - van Beuningen. Vgl. BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10), S. 164 (Abb. 3). 29 Wie bereits Benesch und Ludwig Baldass bemerkten, weist Altdorfers breite, malerische Wiedergabe des Stadtbran-
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R '
3 Lucas Cranach, Lot und seine Töchter, 1529. Aschaffenburg, Staatsgalerie
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
184 H A N N S - P A U L T I E S
2. Altdorfers Lot-Bild: Strukturelle und inhaltliche Besonderheiten
Spätestens jetzt ist es notwendig, ein paar Worte
zu der eigentümlichen formalen Struktur des Ge-
mäldes zu sagen: Betrachtet man das Bild, spe-
ziell das rechte obere Bildeck (mit der sitzenden
Tochter sowie dem Brand der Städte, Abb. 7),
welche inhaltlich zweifellos als eine Art Fernblick
aufzufassen ist, so hat man es weniger mit einem
- durch eine einheitliche Raum- und Farbper-
spektive suggerierten - Kontinuum zu tun als
mit einer ,dis-kontinuierlichen', durch forcierte
Zäsuren und nur schwer nachvollziehbare Maß-
stabsprünge gekennzeichneten Abfolge dreier
Einheiten. Das Bild erscheint - auf seltsam offene
Weise - als Kombination von Einzelbildern, die
hinsichtlich Räumlichkeit, Maßstab und Blick-
winkel je eigenen Gesetzlichkeiten folgen (und
deren Zueinander, ob der komplementären Farb-
bezüge, weniger als Hintereinander im Raum,
denn als Neben- bzw. Übereinander in der Fläche
erlebt wird). Der Arbeitsprozeß des Malers, der,
wie es scheint, mehrere ,Vor-Bilder' teils maß-
stabgetreu rezipiert und im Lot-Bild gleichsam
additiv neben- und übereinander gestellt hat,
wird auf eigenartig plakative Weise sichtbar.
Ebenso wie das räumliche fehlt das narrative
Kontinuum : Altdorfer hat nicht nur die Fliehen-
den, sondern auch - zumindest auf den ersten
Blick - die Salzsäule sowie jede Andeutung eines
Fluchtweges weggelassen. Damit fehlt jedes nar-
rative Bindeglied zwischen Hinter-, Mittel- und
Vordergrund, aber auch jeder bildimmanente
Verweis auf die Komplexität von Lots Persön-
lichkeit, auf seine Eigenschaft als .Gerechter und
Gastfreier (bzw. als Typus des Gerechten, der
vor dem Weltuntergang gerettet wird) sowie auf
das Paradoxon von Rettung und neuerlichem
Sündenfall30. Innerhalb dessen, was dargestellt
ist, fällt auf, daß sich das Interesse des Künstlers
von der Verleitung zum Inzest als einer gemein-
schaftlichen Handlung der beiden Töchter in
Richtung des eigentlichen Beischlafs verlagert
hat: Während sich eine der Töchter bereits am
Lager des Vaters niedergelassen hat, scheint die
andere, allein und in einer schwer bestimmba-
ren Entfernung, auf den für sie vorgesehenen
Moment zu warten. Eine solche inhaltliche
Verschiebung sowie räumliche und inhaltliche
Isolierung der Töchter hat meines Wissens im
Bereich der autonomen Lot-Darstellungen nur
einen Vorläufer. Auf dem Bild von 1536, das
dem Schwaben Matthias Gerung zugeschrieben
wurde (Abb. 4) und welches die Lot-Geschichte
des sowie das Fehlen der „lineare(n) Stilisierung, die alle frühen Wolkenhimmel bis hin zur Alexanderschlacht" aufweisen, auf eine Kenntnis niederländischer Branddarstellungen. Vgl. L. BALDASS, Albrecht Altdorfer, Wien 1941 , S. 196. Benesch hat an Höilenbilder des Hieronymus Bosch gedacht. Vgl. BENESCH, Badestubenfresken (zit. Anm. 3), S. 186. Mir erscheint der Vergleich mit Patinier besonders sinnvoll: Eng verwandt ist neben der Malweise die spezifische Ikonographie des Brandes. Wahrend der niederländische Anonymus (und nach ihm Cranach) den Wortlaut von Gottes Strafgericht (den Regen von Feuer und Schwefel) wiedergeben, konzentrieren sich Patinier und Altdorfer auf eine gleichsam .naturalistische' Schilderung des Brandes, der Glutlichter und Rauchwolken. Es ist anzunehmen, daß Altdorfer ein vergleichbares Werk aus dem Umkreis Patiniers gekannt und nahezu maß-stabgleich (sein ,Bild im Bild' und Patiniers Tafel, die 23 χ 29,5 cm mißt, liegen in derselben Größenordnung!) in sein Bild übersetzt hat. Dokumentarische Nachweise belegen, daß Werke Patiniers schon in den 1510er und -20er Jahren nach Süddeutschland gelangten. - Vgl. WOOD, Altdorfer (zit. Anm. 5), S. 267. Dürer erhielt 1 5 2 1 ein „klein gemalt Täfelein, das Meister Joachim gemacht hat, ist S. Loth mit den Töchtern"(!), zum Geschenk. - Vgl. A. DÜRER, Tagebuch der Reise in die Niederlande, in: E. ULLMANN (Hg.), Albrecht Dürer, Schriften und Briefe, Leipzig 1993 s , S. 2 1 -67 , hier S. 50.
30 VON ERFFA, Ikonologie (zit. Anm. 14), S. 105. Das Zusammenfallen von Rettung und schwerster Sünde veranlaßte Luther und, nach Bätschmann, den Maler des Pariser Lot-Bildes, die „Frage nach der Rechtfertigung Gottes aus dieser Geschichte" zu stellen. - Vgl. BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10), S. 1 7 8 - 1 8 0 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R ' 185
4 Matthias Gerung (?), Die Geschichte Lots, 1536. Stuttgart, Staatsgalerie
in den weiteren Kontext des biblischen Gesche-
hens stellt, ist die Episode des Inzests auf zwei
Szenen verteilt31: auf die traditionelle Szene der
Verleitung und auf die Wiedergabe des Nacht-
lagers, wo eine der Töchter sich anschickt, den
schlafenden Lot zu entkleiden, während die
31 Stuttgart, Staatsgalerie. - Vgl. A.-F. E i c h l e r , Mathis Gerung (um 1500-1570) . Die Gemälde, Frankfurt am Main
u.a. 1993, S. 138-143, 181 (mit Zurückweisung der auf Max J . Friedländer beruhenden Zuschreibung).
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 8 6 H A N N S - P A U L T I E S
andere, etwas entfernt davon, schläft32. Wäh-
rend ,Gerung' - im Sinn der narrativen Abfolge
- zwischen Trunkenheit und eigentlichem In-
zest unterscheidet, überlagern sich bei Altdorfer
diese beiden Aspekte : Die Tochter, die bei Lot
liegt, hält ein halbvolles Weinglas in ihrer ausge-
streckten Linken. Die Plazierung des Glases, das,
im Sinn des Flächenzusammenhangs, gleichsam
zwischen den beiden Töchtern erscheint, mag
ebenso wie der Zeigegestus, der durch das Glas
hindurch sichtbar ist und der zweiten Tochter
gilt, als Verweis auf das Gemeinschaftliche des
Betruges verstanden werden.
Was vor dem Hintergrund der Bildtradition
am wenigsten naheliegt, ist Altdorfers Entschei-
dung, die Akteure der Lot-Geschichte als Aktfi-
guren wiederzugeben. Die Akte des Vordergrun-
des haben ihre Vorläufer in zwei von Altdorfers
Kupferstichen der 1520er Jahre:,Neptun auf der
Seeschlange' (mit aufgestütztem Ellbogen und
gegrätschten Beinen) bzw. ,Liegende Venus mit
Putten' (in unstatisch schwebender Lage und mit
angezogenem linken Bein, Abb. 5). Diese gehen
ihrerseits auf ein italienisches Niello bzw. einen
Stich (in der Art der ,Otto-Prints') zurück3 3 .
Für die Idee, das Motiv des liegenden Aktes in
das monumentale, nicht ganz lebensgroße For-
mat zu übertragen, mag die direkte (oder durch
,Hörensagen' vermittelte) Kenntnis der entspre-
chenden, auf Giorgiones ,Venus' beruhenden
venezianischen Bildtradition maßgeblich ge-
wesen sein34. Die ,Nymphe in der Landschaft'
von Jacopo Palma il Vecchio (ca. 1 5 1 8 - 1 5 2 0 ,
Abb. 6)35 beispielsweise zeigt - gleich wie das
Lot-Bild - das Motiv des auf Tüchern liegenden,
in die Fläche ,geklappten' Frauenakts. Ebenso
vergleichbar ist die Gesamtanlage der Bilder: In
beiden Fällen wird die seichte Raumschicht, die
von den Figuren dominiert wird, teils von einer
Baumgruppe, teils von einem Landschaftsaus-
blick hinterfangen36. Auch der sitzende A k t (mit
überkreuzten Beinen, zurückgeworfenen Armen
und schräger Kopfhaltung) sowie die ,geordnete'
Wiedergabe der Waldlandschaft gemahnen, wie
Berenson erstmals erkannte, an ein italienisches
Vorbild (Abb. 8)37.
3 2 Die ungewohnt ausführliche Schilderung sowie einzelne motivische Lösungen in Gerungs Tafel dürften auf eine
zuerst 1526 publizierte, 169 winzige Holzschnitte umfassende Genesis-Illustration von Hans Sebald Beham zu-
rückgehen. Vgl. KIND, Drunken Lot (zit. Anm. 9), S. 349Í. - Beham zeigt u. a. das Nachtlager, auf dem sich die
jüngere Tochter, die nur mit einem Lendentuch bekleidet ist, Lot nähert. Vgl. f. W. H. HOLLSTEIN, German En-
gravings and Woodcuts, Ca. 1400-1700, 3 (Hans Sebald Beham), Amsterdam 1956, S. 167 (mit Abb.).
33 F. WINZINGER, Albrecht Altdorfer, Graphik, München 1963, S. 1 1 1 , Nr. i 6 i , 162 (mit Abb.). - Zur „Liegenden
Venus" vgl. auch E. MAI (Hg.), Faszination Venus. Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel, Ausst.-Kat., Köln
2000, S. 448. — Z u den Florentiner ,Otto-Prints', einer Gruppe kleinformatiger Kupferstiche, die vornehmlich
Liebesallegorien zeigen, dem Umkreis Baccio Baldinis zugeschrieben und um 1470 datiert werden, vgl. Mark J.
ZUCKER (Hg.), The Illustrated Bartsch, 24 Commentary, Part 1 (Early Italian Masters), 1993, S. 127fr. (hier Nr.
18, 22, 28, 29 ; mit Abb.) sowie B. GAMS, Die Liebesallegorien in der italienischen Druckgraphik um 1500, Dipl.
Arb. Wien 2002, S. 13ÍE
34 Vgl. RUHMER, Altdorfer (zit. Anm. 6), S. 73. - N . RASMO, Donaustil und italienische Kunst der Renaissance, in:
K. HOLTER/O. WUTZEL (Hg.), Werden und Wandlung. Studien zur Kunst der Donauschule, Linz 1967, S. 1 1 5 -
136, hier S. 125.
3 5 Dresden, Gemäldegalerie, Alte Meister. - Vgl. B.AIKEMA/B. L. BROWN (Hg.), Il Rinascimento a Venezia e la pittura
del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, Ausst.-Kat., Venezia 1999, S. 492f.
36 Was Altdorfers ,Lot', anders als die vorangehenden nordalpinen Varianten (vgl. Cranachs Quellnymphen-Bil-
der, die wesentlich kleiner sind), mit den venezianischen Beispielen des Bildschemas verbindet, ist zudem das
monumentale, durch die (annähernde) Lebensgröße der Figuren bedingte Format (ca. 110 χ 190 cm). Z u den
,Quellnymphen' siehe unten, S. 204f., Abb. 15. — Z u Werken Giorgiones und Tizians vgl. F. PEDROCCO, Tizian,
München 2000, S. 81, i66f., 192, 218-220, 222Í, 234^, 259, 304 (mit Abb.).
37 Berenson hat das Täfelchen, das mit 27 χ 37 cm in derselben Größenordnung wie Altdorfers ,Bild im Bild' liegt
(und dessen Verbleib unbekannt ist), als,Venus in Landschaft' bezeichnet, als Decktafel für ein Bildnis angesehen,
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R ' 187
5 Albrecht Altdorfer, Liegende Venus mit Putten, 1520er Jahre, Kupferstich
Interessanter noch als die Tatsache, daß sich
Altdorfer einer Reihe von ,Italianismen' bedient,
ist die Art und Weise, wie er sie für seine spe-
zifische Auslegung der Lot-Geschichte nutzbar
macht: „Indeed", schreibt Kind, „the work is a
catalog of ,Italianisms' [. . .] , yet it easily converts
these separate elements into a whole which is
unmistakably Northern"38.
Betrachtet man die Figuren des Vordergrun-
des, so fállt - etwa im Vergleich mit dem l a -
denden Paar' aus Altdorfers Wandgemälden des
Regensburger Kaiserbades (um 1532) 3 9 - ein
hohes, über die nötige Unterscheidung von Ge-
schlecht und Alter weit hinausgehendes Maß an
Differenzierung auf: Der Körper der Frau zeigt
runde, schwellende, jener des Mannes härtere,
eckigere Formen. Der Körper der Frau, der
- besonders dort, wo er von Lots Händen .be-
griffen' wird - als „einheitliche farbige Masse"
erscheint, verrät keine Knochenstruktur40, jener
des Mannes ist stärker artikuliert. Das Inkar-
nat der Frau ist hell, glatt und rein, jenes des
Mannes dunkel, faltig, durch Behaarung und
Verunreinigungen gekennzeichnet. Das Ant-
litz der Frau ist als ,jung' und ,schön', jenes des
Mannes - durch das vorstehende Kinn, die ge-
wölbte Nase, die rot unterlaufenen Augen und
schütteren Haare - als ,alt' und ,häßlich' cha-
rakterisiert. Die Proportionierung des Körpers
(insbesondere die kräftigen Hüften und der
rundliche Bauch, welche die Frau als „véritab-
les ,Weib"'41 kennzeichnen), die differenzierte
Lorenzo Lotto zugeschrieben und um 1 5 0 0 datiert. Vgl . B . BERENSON, Lorenzo Lotto, Köln 1 9 5 7 , S. 4f. — W o o d
spricht von einem „oberitalienischen Maler" und datiert zwischen 1 5 0 0 - 1 5 1 0 . - Vgl . WOOD, Altdorfer (zit. A n m .
5), S. 267 . - Was die Frage betrifft , wo Altdorfer solche Vorbilder gesehen haben könnte, glaube ich weniger an
eine Italienreise des Künstlers (vgl. — mit Bezug auf das Lot-Bi ld - K . OETTINGER, Altdorfer-Studien, Nürnberg
1 9 5 9 , S. 32 ; RASMO, Donausti l [zit. A n m . 34] , S. 1 2 5 ) als an eine ,Reise' der Vorbilder. Vgl . — mit Bezug auf
Cranach - A . - M . BONNET, Der A k t im Werk Lucas Cranachs, in : C . GRIMM (Hg.) , Lucas Cranach, Ein Maler-
Unternehmer aus Franken, Ausst.-Kat. , Regensburg 1 9 9 4 , S. 1 3 9 - 1 4 9 , hier S. 1 4 1 .
38 KIND, D r u n k e n Lot (zit. A n m . 9), S. 1 5 5 .
39 Regensburg, Stadtmuseum. Vgl . WINZINGER, Gemälde (zit. A n m . 1 ) , S. 55F., i 2 o f . (Abb. 80).
40 BENESCH, Badestubenfresken (zit. A n m . 3), S. 1 8 5 .
4 1 B . HINZ, Venus im Norden, in: MAI, Faszination Venus (zit. A n m . 33) , S. 8 1 - 9 1 , hier S. 89 (bezogen auf Baidungs
.Venus' ; siehe unten, S. 1 9 3 , A n m . 59). Es stellt sich die Frage, ob die - Proportionierung, aber auch Physiognomie
und Ausdruck der Frauen betreffende — Verwandtschaft von Altdorfers und Baidungs Akten (siehe unten, Abb. 9b,
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 8 8 H A N N S - P A U L T I E S
Wiedergabe von Scham und Brüsten sowie der
Schmuck (ein Korallen-Ast und ein graviertes
Kreuz, die von Perlen flankiert sind)42 weisen
die Frau als sinnlich anziehend aus. Lange, wal-
lende, zumeist blonde Haare, deren Bewegtheit
nicht unbedingt szenisch motiviert sein muß,
galten in der nordischen Renaissancekunst als
Inbegriff weiblicher Schönheit und Sinnlich-
keit bzw. - falls diese negativ konnotiert waren
- „ungezügelter Leidenschaften"43. Auch der
gesenkte, „seitwärtsgewandte Blick unter den
Lidern hervor" mag, wie Christian Schoen im
Fall von Hans Baidungs Adam-und-Eva-Tafeln
(um 1524/25, Abb. 9a-b) schreibt, als „erotisch
ausgerichtete Aufforderung" gewertet werden.
Der Blick, der dem Vater gilt und gleichzeitig an
ihm vorbeiführt, erscheint zudem als Ausdruck
von Selbstbewußtsein, Verschlagenheit, als „Zei-
chen von selbstsicherer Dominanz"44. Auch die
im Wortsinn ,dominierende' Position des Frau-
16) als Hinweis auf eine Baidung-Rezeption von Seiten Altdorfers zu werten ist. - Vgl. RUHMER, Altdorfer (zit.
Anm. 6), S. 73 .
42 Vergleichbaren Schmuck zeigen Altdorfers Regensburger Wandgemälde sowie die reich ausgestatteten Frauen, wel-
che die Porträts und die in der Mode der Zeit gekleideten religiösen sowie mythologischen Bilder Lucas Cranachs
- wie etwa die Innenflügel des 1 5 0 6 entstandenen Katharinaaltars der Wittenberger Schloßkirche — bevölkern. Vgl.
FRIEDLÄNDER/ROSENBERG, Cranach (zit. Anm. 27), Nr. I2 f . (mit Abb.).
43 A. MENSGER, Jan Gossaert, Die niederländische Kunst zu Beginn der Neuzeit, Berlin 2002, S. 1 7 6 . — Vgl. Laster-
personifikationen, wie Hans Burgkmairs Holzschnitt der Unkeuschheit (um 1 5 1 0 ) . Vgl. A. G . STEWART, Unequal
Lovers: A study of unequal couples in Northern art, New York 1 9 7 7 , S. 94—97 (Abb. 67). - Vgl. Sündenfall- und
Hexendarstellungen, etwa im Werk Hans Baidungs (siehe unten, S. 204—206, Abb. 96). Vgl. J . L. KOERNER, The
Moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art, Chicago/London 1993 , S. 33F. (zur Inkriminierung von
Frauenhaar im Kontext der Hexenverfolgung).
44 C . SCHOEN, Albrecht Dürer: Adam und Eva. Die Gemälde, ihre Geschichte und Rezeption bei Lucas Cranach d.
Ä. und Hans Baidung Grien, Berlin 2 0 0 1 , S. 1 8 7 . - Baidungs Gemälde befinden sich im Budapester Museum der
schönen Künste.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 1 8 9
8 Oberitalienischer Maler, Akt in Landschaft, ca. 1500-1510. Verbleib unbekannt
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 9 0 H A N N S - P A U L T I E S
enkörpers sowie eine mögliche szenische Lesart
- man könnte sagen, die Frau habe sich aufge-
setzt, um aus der rechts im Vordergrund stehen-
den Feldflasche45 Wein nachzufüllen, habe sich
wieder hingelegt und mache sich ein Vergnügen
daraus, Lot, der sie begehrlich an sich zieht,
den Wein noch ein Weilchen vorzuenthalten46
- vermitteln den Eindruck einer Beziehung, in
welcher der Frau eine dominierende Rolle zu-
kommt. Durch das verkrampfte Grinsen, das
die weit auseinanderstehenden Zähne sichtbar
macht, sowie den starren Blick, der dem Gesicht
oder dem Schoß der Frau, vielleicht auch dem
Weinglas gilt, ist Lot als sinnlich abstoßend und
als Inbegriff von Lüsternheit ausgewiesen47.
Altdorfer, so läßt sich folgern, hat Lots Toch-
ter - in deutlich satirischer Absicht48 - als Ver-
führerin charakterisiert, die ihre Macht, welche
auf der sinnlichen Anziehungskraft ihres Kör-
pers beruht und durch den Wein höchstens
unterstützt wird, selbstbewußt und durchaus
nicht unwillig ausspielt, Lot hingegen als Opfer
seiner durch ,Wein', primär aber durch ,Weib'
entfachten Begierden. Seine Deutung der Lot-
Geschichte gemahnt weniger an Bibeltext und
Exegese als an die literarische Uberlieferung
und an die im frühen 16. Jahrhundert in der
Literatur und bildenden Kunst des nördlichen
Mitteleuropa äußerst beliebten Topoi von ,Wei-
berlisten' und,Ungleichem Paar'.
Der Topos der,Weiberlisten' meint vornehm-
lich der Bibel sowie der antiken Geschichte
entnommene Episoden, in denen Frauen be-
deutende, oft als besonders weise bzw. tapfer
charakterisierte Männer unterwerfen, demüti-
gen oder gar ins Verderben stürzen49. Im frü-
hen 16. Jahrhundert, als die .Weiberlisten' im
Medium der Druckgraphik (so auch im Werk
Altdorfers50) eine große Beliebtheit und Ver-
breitung erfuhren, wurden - zumal im Bereich
der bildenden Kunst - zusätzliche Themen adap-
tiert, deren Deutung in vielen Fällen radikal
verändert, ja umgedreht wurde5 1 : Dazu gehören
der Sündenfall, die Figur der Judith, aber auch
4 5 Verwandte Feldflaschen erscheinen in Cranachs Lot-Bildern : Teils ist gezeigt, wie eine der Töchter aus der Flasche Wein
ausschenkt (vgl. Abb. 3), teils ist die Flasche - wie auf Altdorfers Gemälde - im rechten unteren Bildeck .abgestellt'.
46 Das Offerieren von Wein galt — auch abseits des Lot-Themas — als Metapher sexueller Einladung. — Vgl. Κ. P.
MOXEY, Master E.S. and the folly of love, in: Simiolus, 1 1 , 3/4, 1980, S. 1 2 5 - 1 4 8 , hier S. 1 3 8 - 1 4 1 .
47 In Altdorfers Gemälde wird Lot — stärker als in jeder anderen Darstellung — „der Aura des ehrbaren, weißhaari-
gen, langbärtigen Patriarchen entledigt". Lots Bartlosigkeit ist - laut Neuffer - im Kontext der Lot-Ikonographie
einzigartig. Vgl. NEUFFER, Altdorfers Lot (zit. Anm. 2), S. 58f. - Physische Häßlichkeit (speziell das breite, die
Zähne zeigende Grinsen) galt in der Kunst des 15 . und 16. Jahrhunderts als äußeres Merkmal .niederer', grober
und lasterhafter Charaktere. Vgl. etwa H.-J . RAUPP, Bauernsatiren. Entstehung und Entwicklung des bäuerlichen
Genres in der deutschen und niederländischen Kunst ca. 1 4 7 0 - 1 5 7 0 , Niederzier 1986, S. 5off., 1 0 1 .
48 Die Art, in der Altdorfer (und Ahnliches gilt für Cranach und andere Zeitgenossen) die Protagonisten der Lot-
Geschichte - in denunzierender, spottender Absicht - als wollüstige Verführerin bzw. lüsternen Trunkenbold cha-
rakterisiert hat, entspricht der (gängigen) Definition satirischer Kunstwerke als „intentionally hyperbolic represen-
tations in art that are [unter Verwendung von „humour, parody and irony"] designed to denounce and ridicule the
voluminous vices, follies, stupidities and evils of the human species". In Mittelalter und früher Neuzeit gehörten
hierzu vor allem Sünden wie „lust" und „drunkeness". - Vgl. P. VON BLUM, Artikel „Satire", in: J . TURNER (Hg.),
The Dictionary of Art, 27, London 1996, S. 868-872, hier S. 868f.
49 S. L. SMITH, The Power o f W o m e n : ATopos in Medieval Art and Literature, Philadelphia: University of Pennsyl-
vania Press 199 5. - J . HELD, Die ,Weibermacht' in Bildern der Kunst von der frühen Neuzeit bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts, in: Tendenzen, Zeitschr. für engagierte Kunst, 1 52 , Oktober/Dezember 1985, S. 45 -56 .
50 Unter anderem: Jael und Sisera', Holzschnitt, um 1 5 1 3 ; ,Samson und Deliah', Kupferstich, um 1 5 2 0 - 2 5 . - Vgl.
WINZINGER, Graphik (zit. Anm. 33), S. 64, Nr. 23 ; S. 106, Nr. 145 (mit Abb.).
51 D . HAMMER-TUGENDHAT, Judith und ihre Schwestern, Konstanz und Veränderung von Weiblichkeitsbildern, in :
A. KUHN/B. LUNDT (Hg.), Lustgarten und Dämonenpein, Konzepte von Weiblichkeit in Mittelalter und früher
Neuzeit, Dortmund 1997, S. 3 4 3 - 3 8 5 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R *
9a und b. Hans Baidung Grien, Adam und Eva, um 1524/25. Budapest, Museum der schönen Künste
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 9 2 H A N N S - P A U L T I E S
die Lot-Geschichte. Für den Sündenfall wurde
gegen die Neuzeit hin mehr oder weniger aus-
schließlich Eva verantwortlich gemacht; sein
Wesen wurde weniger in der „Herausforderung
des Schöpfergottes" als in der „unbeherrschten
Sinnlichkeit" gesehen52. Die Figur der Judith
wurde - durch die Herauslösung aus dem nar-
rativen Zusammenhang und die Analogisierung
mit den bösen Frauen - von der keuschen Hel-
din, die in einer spezifischen, für das Volk Is-
rael bedrohlichen Situation und als Werkzeug
Gottes gehandelt hatte, zur bösen, gefährlichen
Verführerin und Männermörderin53. Die Lot-
Geschichte begegnet — als Exempel der ,Weiber-
listen' - in mittelalterlichen Gedichten, die an
die Keuschheit der Kleriker appellieren54, aber
auch in spätmittelalterlichen Schriften wie in
Thomas Murners 1 5 1 9 publiziertem satirischem
Versepos ,Die Geuchmat' (Die Narrenwiese), das
den ,gouch', den von weiblicher Verführungs-
kunst überwältigten Mann und seine unbelehr-
bare Liebestorheit aufs Korn nimmt55 . Bildliche
Darstellungen, welche die Lot-Geschichte mit
anderen Episoden des Topos in direkte Ver-
bindung bringen, sind selten: Ein Becher aus
dem Halleschen Heiltum (1526/27) zeigt - un-
ter dem Zeichen des .keuschen' Einhorns (!)
- Lot und seine Töchter sowie Aristoteles und
Phyllis, ein Kernthema des Topos56. Ein Kup-
ferstich des Philips Galle (um 1569) zeigt die
Lot-Geschichte als zweites von sechs Beispielen
der ,Weiberlisten'57. Häufiger sind autonome
Darstellungen, die — wie jene Altdorfers - die
Lot-Geschichte durch immanente Merkmale als
Exempel der .Weiberlisten' ausweisen: Da die
Macht der Frauen innerhalb des Topos stets und
ausschließlich in ihrem Körper, in ihrer Sexua-
lität gründet, hat Altdorfer folgerichtig gehan-
delt, als er die Akteure entkleidet und den (die)
Frauenkörper auf ungeheuer plakative Weise vor
Augen geführt hat. In diesem Vorgehen steht
Altdorfer nicht allein da. Baidung etwa ließ in
seinem Holzschnitt Aristoteles und Phyllis'
( 1 5 1 3 ) den großen Weisen, der seinen Zögling
Alexander vor den ,Weiberlisten' gewarnt hatte,
sowie die Frau, die ihn (Aristoteles) selbst un-
terwarf und zum Reittier erniedrigte, erstmals
nackt auftreten58. Baidungs monumentale Akts-
52 HELD, Weibermacht (zit. Anm. 49), S. 46-48. Die fleischliche Lust wurde nun nicht mehr, wie seit Augustinus,
als Folge, sondern — maßgeblich in der Schrift ,De originali peccato' ( 1 5 1 8 ) des Humanisten und Arztes Heinrich
Cornelius Agrippa von Nettesheim - als Ursache des Sündenfalls betrachtet. - Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm.
43), S. 146E
53 HELD, ebenda, S. 4 8 - 5 1 . - HAMMER-TUGENDHAT, Judith (zit. Anm. 51), S. 3 4 3 - 3 6 7 .
54 SMITH, Power o f W o m e n (zit. Anm. 49), S. 2 9 - 3 1 .
55 In Murners Aufzählung der von Frauen Betrogenen heißt es : Billich hat Lot [hinter Adam und Ninus] den dritten
standJDarumb, das in syn dochter handt/ouch har hat bracht off disse matt./Ir jede vonjm empfangen hatt./Das war
ein rechte geuchische dadtJDas von eyns vatters geuchischen berden/Beyd döchter sollten schwanger werden. — Vgl. T.
MURNER, Die Geuchmat, hrsg. von E. FUCHS, Berlin 1 9 3 1 (zuerst Basel 1 5 1 9 ) , S. I24F. - Die .Tragedia Johannis
des Täufers' (Johannes Aal, 16. Jahrhundert) nennt Lot und seine Töchter, Adam und Eva, Judah und Tamar als
Exempel der ,Weiberlisten'. - Vgl. KIND, Drunken Lot (zit. Anm. 9), S. 98.
56 P. M. HALM/R. BERLINER, Das Hallesche Heiltum, Berlin 1 9 3 1 , S. 52, Taf. 162 (mit Datierung um 1500). - D .
KoEPPLiN, Ein Cranach-Prinzip, in: W. SCHADE (Hg.), Lucas Cranach, Glaube, Mythologie und Moderne, Ausst.
Kat., Hamburg 2003, S. 1 4 4 - 1 6 5 , hier S. 1 5 5 , Abb. 67 (mit Datierung 1526/27). - Von dem Cranach-Schiiler
Wolfgang Krodel hat sich ein 1528 datiertes Bildpaar erhalten, das Lot und seine Töchter sowie David und Bathseba
zeigt . V g l . KOEPPLIN/FALK, C r a n a c h (zit. A n m . 2 7 ) , 2 , S . 5 7 7 Í - S . FERINO-PAGDEN/W. PROHASKA/K. SCHÜTZ, D i e
Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums in Wien, Verzeichnis der Gemälde, Wien 1 9 9 1 , S. 74 (mit Abb.).
57 M . SELLINK (Hg.), The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1 4 5 0 - 1 7 0 0 (Philips
Galle, Part 1) , Rotterdam 2001 , S. i8off . (mit Abb.).
58 S. DURIAN-RESS (Hg.), Hans Baidung Grien in Freiburg, Ausst.-Kat., Freibug 2001 , S. I96F (mit Abb.). - Vgl.
auch die Zeichnung von 1 5 3 3 mit Herkules und Omphale. — Vgl. C . W. TALBOT, Baidung and the Female Nude,
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 1 9 3
10 Lucas van Leyden, Lot und seine Töchter, 1530, Kupferstich
erie (um 1524/25) zeigt Venus, Adam und Eva
(Abb. 9a-b) sowie - im Sinne der erwähnten
Umkehrung der Interpretation - Judith mit
dem Haupt des Holofernes59. Lucas van Leyden
schließlich war der erste, der in dem Kupferstich
von 1 530 (Abb. 10) Lot und seine Töchter als
monumentale Akte gezeigt und die erotischen
Qualitäten der Szene auf bislang unbekannte
Weise herausgearbeitet hat60.
An dieser Stelle ist es sinnvoll, auf die Kon-
in : J . H . MARROW/A. SHESTACK, Hans Baidung Grien, Prints & Drawings , Ausst .-Kat. , Washington/New Haven
1 9 8 1 , S. 1 9 - 3 7 , hier S. 20, 30 (Abb. 14) .
59 Otterlo, Museum-Kröl ler-Mül ler (.Venus'); Nürnberg , Germanisches Nat ionalmuseum ( Jud i th ' ) . Vgl . G . VON
DER OSTEN, Hans Baidung Grien. Gemälde und Dokumente , Berlin 1 9 8 3 , Kat. Nr. 55, 56 (mit Abb.) . - Vgl . auch
J a n Gossaerts Darstellungen von Herkules und Deianira sowie Salamacis und Hermaphroditus (um 1 5 2 0 ) . Vgl .
MENSGER, Gossaert (zit. A n m . 43) , S. 1 1 0 - 1 2 1 (mit Abb.) .
60 L. SILVER/S. SMITH, Carnal knowledge: The late engravings o f Lucas van Leyden, in : Nederlands Kunsthistorisch
Jaarboek, 29, 1 9 7 8 (Lucas van Leyden Studies), S. 2 3 9 - 2 9 8 , hier S. 25 5. - Das zweifach erhaltene Fragment eines
ca. 90 χ 1 3 0 cm großen Lot-Gemäldes Baidungs (um 1 5 3 0 — 1 5 3 3 , u.a. Berlin, Gemäldegalerie) läßt ob des grünen
Vorhangs, der den im Trinken begriffenen Lot hinterfängt, sowie der Reste der anscheinend als liegende, wenn
auch mit einem Lendentuch bekleidete Akt f igur konzipierten Tochter an eine derjenigen Altdorfers verwandte,
möglicherweise für jene vorbildliche Lösung denken. - Vg l . W. HUGELSHOFER, Wiederholungen bei Baidung, in :
Zeitschr. für Kunstgeschichte, 3 2 , 1969 , S. 2 9 - 4 3 , hier S. 37 (mit Abb.) . - Für einen niederländischen Inventar-
vermerk ( 1 5 2 8 ) , der sich auf ein Lot-Bi ld mit Aktf iguren beziehen könnte, vgl. MENSGER, ebenda, S. 1 2 9 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 9 4 H A N N S - P A U L T I E S
Sequenzen z u verweisen, die sich ergeben, wenn Altdorfer mit der liegenden bzw. sitzenden Akt-figur Bildmuster, welche die italienische Renais-ance an Themen der antiken Mythologie erprobt hat, auf ein Sujet überträgt, das dem typisch nor-dischen Topos der ,Weiberlisten' angehört. Das gemeinsame Thema - die weibliche, erotisch in-szenierte Nacktheit - erfährt eine grundlegende Umwertung: Ihre im Kontext von Hochzeit und reproduktiver Sexualität61 bzw. epikureisch und aristotelisch geprägter Naturmythologie62
erfolgte Aufwertung wird gleichsam rückgängig gemacht. Weibliche Nacktheit erscheint, ganz im Sinne des christlichen Leibethos, als negativ, als nuditas criminalis63. Der nackte Körper der
Frau, der durch die christliche Ideologie als Ort der Sünde und als Ursache des Sündenfalls inkri-miniert ist, wird als erotisch gefährlich inszeniert. Vor diesem Hintergrund ist es besonders inter-essant, daß Altdorfer mit dem liegenden Frau-enakt ein sehr spezifisches Bildmuster rezipiert, das vornehmlich (wie auch von Altdorfer selbst, vgl. Abb. 5) zur Darstellung der antiken Liebes-göttin Venus verwendet wurde64: Altdorfer hat Lots Tochter in der Pose der Venus dargestellt, dabei aber, bewußt oder aber zwangsläufig65, das Venus-Bild der italienischen Renaissance gegen sein nordisches Gegenstück ausgetauscht : Wäh-rend Venus in Italien, in Florenz wie Venedig, als Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin (bezogen auf
61 Zum Bedeutungswandel, der sich etwa zwischen Pisanellos noch pejorativ besetzter ,Luxuria'-Zeichnung und den
positiv besetzten liegenden Nackten der Florentiner ,Otto-Prints' vollzog, vgl. B. HINZ, .Amorosa Visione', Inku-
nabeln der profanen Malerei in Florenz, in: Städel-Jb., NF, 1 1 , 1987, S. 1 2 7 - 1 4 6 , hier S. 135fr .
62 Zur ,Sakralisierung' weiblicher Nacktheit und Sexualität in Francesco Colonnas ,Hypnerotomachia Poliphili' bzw.
in der Arkadienliteratur und -ikonographie der italienischen Renaissance vgl. H. BREDEKAMP, Der ,Traum vom
Liebeskampf als Tor zur Antike, sowie D. BLUME, Beseelte Natur und ländliche Idylle, in: H. BECK/P. C . BOL
(Hg.), Natur und Antike in der Renaissance, Ausst.-Kat., Frankfurt am Main 1985 , S. 1 3 9 - 1 5 3 sowie S. 1 7 3 - 1 9 2 .
— Ein Ausnahmebeispiel stellt Palma Vecchios ,Nymphe in der Landschaft' (Abb. 6) dar, für die eine moralisierende
Deutung (im Sinne einer Voluptas-Virtus-Opposition) vorgeschlagen wurde. Vgl. AIKEMA/BROWN, Rinascimento
(zit. Anm. 35), S. 492Í.
63 Die Präferenz, Nacktheit als nuditas criminalis zu schildern, ist ein Charakteristikum der nordischen - im Unter-
schied zur italienischen - Renaissancekunst. Vgl. SILVER/SMITH, Carnal Knowledge (zit. Anm. 60), S. 243ff .
64 Von den liegenden Nackten, welche die ,Otto-Prints' zieren, ist eine (ZUCKER, Bartsch [zit. Anm. 33], Nr. 28)
durch die Begleitung Amors eindeutig als Venus ausgewiesen. Vgl. HINZ, Amorosa Visione (zit. Anm. 61 ) , S. 1 3 7
(Abb. 1 1 ) . Eine weitere Nackte (ZUCKER, Nr. 29, mit Abb.), die in Begleitung zweier Eroten auf einer Wiese liegt,
während Amor im Begriff ist, seinen Pfeil auf einen Jüngling abzuschießen, den seine Gefährtin mittels eines
Spruchbandes zur Treue (,Fede() ermahnt, läßt sich — wie ich glaube - als Venus identifizieren, wenn man die Dar-
stellung mit der Schilderung römisch-antiker Hochzeitsgedichte (Epithalamia), welche im 15 . Jahrhundert auch in
Florenz bildlich umgesetzt wurden, assoziiert. - Vgl. J . ANDERSON, Giorgione, Titian and the sleeping Venus, in:
TIZIANO E VENEZIA, C o n v e g n o i n t e r n a z i o n a l e d i S t u d i , V i c e n z a 1 9 8 0 , S . 3 3 7 - 3 4 2 . - K . CHRISTIANSEN, L o r e n z o
Lotto and the Tradition of Epithalamic Paintings, in: Apollo, September 1986, S. 1 6 6 - 1 7 3 (mit dem Verweis
auf zwei wenig beachtete Tafeln der Botticelli-Nachfolge - S. 1 7 0 Í ) . - In den Aktbildern, die in der Nachfolge
der Giorgione-Venus (bzw. der Venus-Nymphe der ,Hypnerotomachia Poliphili') stehen, dürfte, auch dort, wo
eindeutige Venus-Attribute fehlen (bzw. andere Primär-Bedeutungen, wie jene der ,Nymphe', dominieren), die
Liebesgöttin zumindest ,mit-gemeint' gewesen sein. Vgl. D. ROSAND, ,So-And-So Reclining on Her Couch', in:
R. GOFFEN, Titians ,Venus of Urbino', Cambridge 1997, S. 37 -62 , hier S. 46ff. - AIKEMA/BROWN, Rinascimento
(zit. Anm. 34), S. 496f.
65 Anne-Marie Bonnet nimmt einen bewußten Vorgang an, wenn sie in Bezug auf Dürers Kupferstich ,Der Traum
des Doktors' von 1497/98 von der „Verbindung der ,modernen' (i.e. italienischen) Venus-Form mit der überliefer-
ten nordalpinen Venus-Ikonographie" (hier als Gleichsetzung von Venus- als Götzenbild) spricht und meint, diese
Verbindung sei „ein reizvolles Spiel für den Connaisseur Celtis" (den Adressaten des Stiches) gewesen. Vgl. A . -M.
BONNET, , A k t ' bei D ü r e r , K ö l n 2 0 0 1 , S . 1 0 4 - 1 0 6 (mi t A b b . ) .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 195
die N a t u r 6 6 bzw. d ie ehe l i che F o r t p f l a n z u n g 6 7 )
ge fe ie r t w u r d e , repräsent ier te ,F rau V e n u s ' i m
N o r d e n „ v i e l f a c h negat iv d i e G e f a h r e n d e r , F r a u
W e l t ' " 6 8 . I m d r e i z e h n t e n K a p i t e l v o n B r a n t s
, N a r r e n s c h i f f e t w a , das „ V o n B u h l s c h a f t " h a n -
de l t u n d dessen e i n l e i t e n d e Verse ( „ A n m e i n e m
Se i le ich n a c h m i r z ieh / V i e l A f f e n , E s e l u n d
N a r r e n v i e h : / I c h täusche , t rüge , v e r f ü h r e s ie . " )
e in A l b r e c h t D ü r e r z u g e s c h r i e b e n e r H o l z s c h n i t t
( A b b . I i ) v e r a n s c h a u l i c h t , beschre ib t V e n u s ihre
M a c h t , L i e b e n d e in N a r r e n z u v e r w a n d e l n ; m i t
D a v i d , S a m s o n u n d Ar i s tote les zähl t sie dre i d e r
b e k a n n t e s t e n O p f e r v o n ,Weiber l i s ten ' z u ihren
, K u n d e n ' 6 9 . Z a h l r e i c h e D a r s t e l l u n g e n v o n Z e i t -
g e n o s s e n A l t d o r f e r s assozi ieren das ( i ta l ienische)
B i l d s c h e m a der s t e h e n d e n V e n u s m i t K o n n o -
t a t i o n e n v o n s ü n d h a f t e r , V e r d e r b e n b r i n g e n d e r
W o l l u s t 7 0 . W e n n n u n A l t d o r f e r ( u n d Ä h n l i c h e s
gi l t f ü r B a i d u n g s , E v a ' u n d J u d i t h ' der S t r a ß -
b u r g e r A k t s e r i e , vg l . A b b . 9 b ) L o t s T o c h t e r
g l e i c h s a m als V e n u s darstel l t , so e r sche int sie in 11 Albrecht Dürer (zugeschrieben), Holzschnittillustration zu
Sebastian Brant, Das Narrenschiff, 1494: Frau Venus
66 Zum Kult der ,Venus Genetrix' und seinen bildlichen Zeugnissen vgl. BREDEKAMP, Traum vom Liebeskampf, (zit.
Anm. 62). — DERS., Sandro Botticelli, La Primavera, Florenz als Garten der Venus, Frankfurt am Main 1988.
67 Die ,Otto-Prints', welche als Dekoration von Geschenkschachteln dienten, die während einer Hochzeitsfeier an
die Gäste verteilt wurden, sowie die .gemalten Epithalamia' in der Nachfolge der Giorgione-Venus gehören in den
Kontext von Hochzeit und reproduktiver Sexualität. Der Anblick der nackten Schönheit sollte „die Erfüllung der
Liebe bewirken und eine reiche Nachkommenschaft gewährleisten". — Vgl. ROSAND, So-and-So (zit. Anm. 64),
S. 46fF. - GAMS, Liebesallegorien (zit. Anm. 33), S. 13 ff., hier S. 28. - Nach Daniela Bohde, die, bezogen auf die
venezianischen Venus-Akte, die Hochzeitbildthese anzweifelt, sind die Bilder - bei gleichbleibend positiver Be-
deutung (vgl. Venus als Schutzgöttin der Kurtisanen) — „im Umfeld der [ . . . ] Kurtisanenkuktur zu situieren". Vgl.
D. BOHDE, Haut, Fleisch und Farbe, Körperlichkeit und Materialität in den Gemälden Tizians, Emsdetten/Berlin
2002, S. I27FF. (Zitat S. 1 3 5 ) sowie, zum ,Venus-Kult' der venezianischen Kurtisanen, C. SANTORE, The Fruits of
Venus: Carpaccio's ,Two Courtesans', in: Arte Veneta, 42, 1988, S. 34-39 .
68 BONNET, Akt bei Dürer (zit. Anm. 65), S. 50.
69 BRANT, NarrenschifF(zit. Anm. 19), S. 50-5 5. Vgl. STEWART, Unequal Lovers (zit. Anm. 43), S. 4 7 - 5 0 . - Murners
,Geuchmat', in der Lot als Opfer der ,Weiberlisten' geführt wird, enthält eine ähnliche Illustration. Vgl. HINZ,
Venus im Norden (zit. Anm. 4 1 ) , S. 84 (Abb. 5).
70 Für Graphiken von Nikolaus Manuel Deutsch, Daniel Hopfer und Hans Brosamer vgl. HINZ, ebenda, S. 87,
90 (Abb. 12 , 18). - MAI, Faszination Venus (zit. Anm. 33), S. 445 (mit Abb.). - Für Jan Gossaerts Gemälde der
.Venus vana' vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 1 8 5 - 1 9 0 (Abb. 107). - Auch Altdorfer selbst schuf Dar-
stellungen der negativ konnotierten Venus: Für den Kupferstich der ,Fortuna-Venus' ( 1 5 1 1 ) vgl. SILVER/SMITH,
Carnal Knowledge (zit. Anm. 60), S. 265 (Abb. 3 1) . - Für die Zeichnung .Venus straft Amor' (1508), welche die
Liebesgöttin - gänzlich unantikisch - im Gewand einer ,Soldatendirne' zeigt, vgl. MAI, S. 404 (mit Abb.). - Zur
Deutung von Venus als Urbild der Meretrix (Dirne) und als Inbegriff der Voluptas (und Vanitas) vgl. HINZ, S. 84ÍF.
- Zur Identifikation von Venus und Voluptas im Kontext mittelalterlicher Lasterpersonifikationen vgl. D. HAM-
MER-TUGENDHAT, Venus und Luxuria. Zum Verhältnis von Kunst und Ideologie im Hochmittelalter, in: I. BARTA
u.a. (Hg.), Frauen - Bilder, Männer - Mythen, Kunsthistorische Beiträge, Berlin 1987, S. 1 3 - 3 4 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
1 9 6 H A N N S - P A U L T I E S
1 2 Lucas Cranach, Ungleiches Paar, um 1530. Düsseldorf,
Kunstmuseum
der Pose jener Instanz, der sie ihre Macht, den
Vater zu verführen und zum Liebestollen zu de-
gradieren, letztlich verdankt71.
Der zweite Topos, den ich zur Interpreta-
tion von Altdorfers ,Lot' heranziehen möchte,
ist jener des .Ungleichen Paares': Erneut geht
es um die Verführungsmacht der Frauen, vor
allem aber um ihre Kehrseite, die Narrheit der
Männer, die es zulassen, daß Leidenschaften
und Begierden die Vorherrschaft des Verstandes
kontaminieren72. Es geht um alte, meist wohl-
habende Männer, die sich in junge Frauen ver-
lieben, diese heiraten und glauben, sie würden
wirklich geliebt. Die Frauen hingegen, welche
nur das Geld der Männer interessiert, sind be-
müht, diese, nicht zuletzt wegen deren Unfähig-
keit, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen,
so schnell wie möglich zu betrügen. Dahinter
steht die spätestens seit dem 14. Jahrhundert
gebräuchliche Analogisierung von Lüsternheit
und Narrheit, die Vorstellung, sinnliche Liebe
raube den Männern - und speziell den Alten,
von denen man eine besondere Weisheit erwar-
ten würde - Verstand und Weitblick, mache sie
blind für die Wirklichkeit. Die Texte und Bilder,
die den Topos thematisieren (wie die unzähli-
gen Tafeln der Cranach-Werkstatt, vgl. Abb.
12) 7 3 , wandten der Beschreibung des in schar-
fem Gegensatz zu ihren Ambitionen stehenden
äußeren Erscheinungsbildes sowie der sexuel-
len Unfähigkeit der alten Liebhaber besondere
Aufmerksamkeit zu. Erasmus von Rotterdam
legt der Torheit in seinem 1509 erschienenen
,Lob der Torheit' folgende Sätze in den Mund:
„Mir allein ist es zuzuschreiben, daß ihr immer
wieder Männer im Alter eines Nestor seht, die
kaum noch Ähnlichkeit mit einem Menschen
haben, lallend, blöde, zahnlos, weiß, kahl oder
[. . .] ungepflegt, krumm, trübselig, runzlig,
glatzköpfig, ohne Gebiß und Geschlechtstrieb,
die aber doch so am Leben hängen und sich so
71 Für die Übertragung des Bildschemas der nackten Liegenden auf Frauengestalten, welche als Verführerinnen be-
kannt und negativ konnotiert waren, weshalb die Venus-Assoziation intendiert gewesen sein dürfte, lassen sich
weitere Beispiele anführen. Für Jan van Scorels (?) Gemälde (ca. 1524) und Augustin Hirschvogels Radierung
( 1 5 4 7 ) d e r , ¡C leopatra ' v g l . AIKEMA/BROWN, R i n a s c i m e n t o (zit. A n m . 3 5) , S . 4 9 4 Í , m i t A b b . , bzw. T . FALK ( H g . ) ,
Hollstein's German Engravings, Etchings and Woodcuts, 1 4 0 0 - 1 7 0 0 , XIII A (Jacob van der Heyden to Nikolaus
Hogenberg), Blaricum 1984, S. 188, Nr. 63 (mit Abb.). - Für Jean Cousins .Pandora als Eva-Venus' (um 1560)
vgl. V. von FLEMMING, Die böse Schöne, Eine Weiblichkeitskonstruktion in Literatur und bildender Kunst der
Frühneuzeit Italiens, in: Zeitsprünge, Forschungen zur frühen Neuzeit, 1 , 2, 1997, S. 279—341, hier S. 319—321,
Abb. 6.
7 2 STEWART, U n e q u a l L o v e r s (zit. A n m . 4 3 ) , b e s o n d e r s S . 5 0 — 8 1 .
7 3 KOEPPLIN/FALK, C r a n a c h (zit. A n m . 2 7 ) , 2 , S . 5 6 7 ^ ( M i t A b b . ) . - STEWART, e b e n d a , S . 1 4 6 - 1 6 1 ( A b b . 1 7 - 5 4 ) .
— FRIEDLÄNDER/ROSENBERG, C r a n a c h (zit. A n m . 2 7 ) , N r . 1 5 5 , 2 8 2 — 2 8 9 ( m i t A b b . ) .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R ' 197
jugendlich gebärden, daß [. . .] wieder ein an-
derer sich in ein Mädchen verliebt, wobei er
es mit verliebtem Unfug jedem jungen Mann
zuvortut".74 Vor diesem Hintergrund hat man
den Eindruck, Altdorfer habe - auf ungeheuer
plakative Weise - die im Topos des ,Ungleichen
Paares' ausgeprägte Vorstellung von der Narr-
heit des Alten, der den Schmeicheleien einer
jungen Frau erliegt, auf seine Interpretation
der Lot-Geschichte übertragen. Das Gegenüber
der beiden Gesichter, die Kennzeichnung Lots
als ,alt', ,häßlich' und ,abstoßend', erscheint
geradezu als Reflex von Cranachs Tafeln75 . Es
scheint verlockend, den diagonal abstehenden
Ast, welcher Blattwerk durchstößt, und sich
genau oberhalb der Stelle befindet, wo das Ge-
schlecht des Mannes vorzustellen ist, als visuelle
Metapher der sexuellen Vereinigung zu deuten,
sein brüchiges, zerborstenes Erscheinungsbild
als ,Satire' auf die zweifelhafte Potenz des Al-
ten.
Auch die zweite Tochter, welche im rechten
oberen Bildeck erscheint (Abb. 7), ist durch
die gekreuzten Beine76 und den aus dem Bild
gewandten Blick77 eindeutig als verführerisch'
charakterisiert78. Das Motiv der Haarpflege, das
hier in besonders aufreizender Pose vorgeführt
wird, tritt in Zusammenhängen auf, wo weib-
liche Sinnlichkeit negativ konnotiert ist, wo
vor Stolz, Vergänglichkeit und vor der Gefahr
weiblicher Verführungskunst gewarnt wird : Im
,Ritter vom Turn' heißt es, eine Frau solle nie-
mals ihr Haar vor einem Mann kämmen79. Eine
Zeichnung Dürers (ca. 1 5 1 4 - 1 5 1 8 ) zeigt eine
nackte Frau, die sich im Spiegel betrachtet und
sich mit einer - jener von Altdorfers Aktfigur
ähnlichen - Bürste die Haare streicht, als ihr der
Tod das Stundenglas vorhält80. Die unmittelbare
74 ERASMUS VON ROTTERDAM, Das Lob derTorheit (Encomium Moriae), hrsg. von A. J . GAIL, Stuttgart 1999 (zuerst
1509), S. 38. - Vgl. STEWART, Unequal Lovers (zit. Anm. 43), S. 6 1 - 6 5 . - E ¡ n Fastnachtsspiel des 15 . Jahrhunderts
(,Vom Heiraten Spil') enthält die Verse : Nu ist sie junk, so ist er alt,/Und ist auch schwach und ungestaltJUnd ist
ain abgerittner gaulJUnd ist des nachts im pett faul. Vgl. STEWART, S. 23f. — Für weitere Textquellen vgl. Ebenda,
S. 1 3 - 3 4 .
75 Ein Blick auf Cranachs Lot-Bilder (Abb. 3) zeigt, daß auch dieser sich der Analogien zwischen der Lot-Geschichte
und den Topoi .Ungleiches Paar' bzw. .Weibermacht' (vgl. das verschlagene, zum Teil aus dem Bild gewandte
Lächeln der Töchter) durchaus bewußt war: Jene extreme Entstellung des biblischen Patriarchen, die Altdorfers
Gemälde kennzeichnet, hat Cranach jedoch nie erreicht.
76 Zum Motiv der gekreuzten Beine und dessen erotischen Implikationen vgl. MARROW/SHESTACK, Baidung Grien
(zit. Anm. 58), Kat. Nr. 76 (mit Verweis auf Werke Baidungs und Cranachs - siehe unten, Abb. 15) .
77 Zur Verführungskraft des weiblichen Blickes vgl. SCHOEN, Adam und Eva (zit. Anm. 44), S. 186f. - MARROW/SHE-
STACK, ebenda, Kat. Nr. 76. - R. W. SCRIBNER, Vom Sakralbild zur sinnlichen Schau, Sinnliche Wahrnehmung und
das Visuelle bei der Objektivierung des Frauenkörpers in Deutschland im 16. Jahrhundert, in: K. SCHREINER/N.
SCHNITZLER (Hg.), Gepeinigt, begehrt, vergessen. Symbolik und Sozialbezug des Körpers im späten Mittelalter
und in der frühen Neuzeit, München 1992, S. 3 3 7 - 3 6 4 , hier S. 3 i / f .
78 Ulrich Söding hat - was m. E. weniger überzeugt - vorgeschlagen, in der kleinen Tochter, deren Gestik er nicht
als verführerisch, sondern - mit Hinweis auf antike bzw. mittelalterliche Vorbilder - als Ausdruck von Schmerz
bzw. Reue liest, einen kritischen Kommentar zur Szene des Vordergrunds zu sehen. — Vgl. U. SÖDING, Kunst der
Donauschule, Cranach, Altdorfer und Leinberger, Vorlesung am Münchner Institut für Kunstgeschichte, 18. 6.
2003 (Mitteilung Barbara Six).
79 Die Baseler Ausgabe von 1493 enthält einen Holzschnitt, der eine junge Frau (als Personifikation der Vanitas) zeigt,
die ihr Haar kämmt, als sie im Spiegel das Gesäß des Teufels erblickt. — Vgl. C . GRÖSSINGER, Picturing Women in
late Medieval and Renaissance Art, Manchester 1997, S. 1 3 - 1 4 (Abb. 6).
80 London, British Museum. - Vgl. BONNET, Akt bei Dürer (zit. Anm. 65), S. 237 (Abb. 1 3 7 ) . - Die Frau mit Kamm
(und Spiegel) ist - als „Inbegriff weiblicher Erotik" - ein zentrales Motiv der mittelalterlichen Venus-Voluptas-
Ikonographie. Vgl. HAMMER-TUGENDHAT, Venus und Luxuria (zit. Anm. 70), S. i6f . (Abb. 2,3). - HINZ, Venus
im Norden (zit. Anm. 4 1 ) , S. 85 (Abb. 8,9).
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
198 H A N N S - P A U L T I E S
Gegenübersetzung von idyllischer Lichtung und
Brandkatastrophe, die Altdorfers ,Bild im Bild'
kennzeichnet (eine Nähe, die sich primär in der
Bildfläche, in dem grellen Komplementärkon-
trast von Grün und Rot ereignet), macht die
Idylle des Mittelgrundes zu einer fraglichen, sie
verleiht der Darstellung der sitzenden Tochter,
wenn nicht dem ganzen Bild, etwas Unangeneh-
mes, Makabres. Winzinger sprach von einem
„schreienden Gegensatz"81. Ruhmer meinte, der
Brand von Sodom sei oft gemalt worden, nie je-
doch „so penetrant, so teuflisch real"82. Wenn
man genau hinsieht, fallen die Baumkronen so-
wie ganz links ein abgestorbener Baum auf, die
den scheinbar so abrupten Ubergang der bei-
den Bildeinheiten - im Sinne einer räumlichen
Nähe - überspielen. Man möchte meinen, die
Idylle der Tochter sei tatsächlich gefährdet, der
Brand, der etwas mehr als die Hälfte der Fläche
des ,Bildes im Bild' einnimmt, würde sich den
Wiesenhang herauf,fressen'. Wie dem auch sei:
Der Brand ist nicht bloß Erkennungszeichen'
des Sujets, sondern integraler Bestandteil der
Bildaussage. Jenseits des Bibeltexts, der die Zer-
störung auf Sodom und Gomorra begrenzt (und
als zeitlich ,vorher' sowie örtlich ,entfernt' defi-
niert), den Inzest jedoch ungestraft läßt, entwik-
kelt das Bild eine Aussage, die von der Nähe von
„Leben" bzw. „Tod und Vernichtung"83, von
Sinnlichkeit und Zerstörung, von schuldhaf-
ter Sexualität und deren unausweichlicher Be-
strafung handelt84. Auch im Fall der sitzenden
Tochter hat Altdorfer, daran sei hier erinnert,
ein italienisches Vorbild (Abb. 8) rezipiert und
radikal umgedeutet: Aus dem Arkadien-Idyll85
ist eine Vanitas-Voluptas-Allegorie geworden
- in der Art des Holzschnitts mit Herkules
am Scheidewege (Abb. 13) , der die lateinische
Ausgabe von Brants ,NarrenschifF (1497) illu-
strierte, sowie der ,Tod-und-Mädchen'-Darstel-
lungen Baidungs86.
Das Moment von Satire, das die Charakteri-
sierung Lots als alten Liebestoren - im Einklang
mit der satirischen Literatur (Brant, Murner)
- impliziert, läßt sich auf drei weitere Motive
übertragen: Auf die Feldflasche und das StofF-
81 WINZINGER, Gemälde (zit. A n m . 1 ) , S. 47 .
82 Die , wie er sagt, „pervers-erotische Szene" werde „durch den Hintergrund des blutigroten Stadtbrands zu einer
makabren Nichtswürdigkeit ohnegleichen", der Brand seinerseits erscheine „hinter diesem lüsternen Vordergrund
doppelt grauenhaft" . Vg l . RUHMER, Altdorfer (zit. A n m . 6), S. zo.
83 H . H . HOFSTÄTTER, Geschichten um Abraham, S o d o m und die Folgen (3), in : Das Münster, 45 , 2, 1 9 9 2 , S. 1 4 7 -
1 5 2 , hier S. 1 5 2 .
84 Auch in dieser Art von Aussage, die sich den Möglichkeiten des Bildes als einer eigenen Sprachform verdankt,
bleibt Altdorfer nicht isoliert : Von den bildlichen Interpreten der Lot-Geschichte hat sich etwa Heinrich Aldegre-
ver (in dem Kupferstich von 1 5 3 0 ) der forcierten Entgegensetzung von laszivem Treiben und hochaufragendem
Flammeninferno bedient. Vgl . H . BEVERS/C. WIEBEL (Hg.), The N e w Hollstein G e r m a n Engravings, Etchings and
Woodcuts 1 4 0 0 - 1 7 0 0 (Heinrich Aldegrever), Rotterdam 1 9 9 8 , S. 35 (Abb. 1 3 ) .
85 D ie Aktf igur des italienischen Gemäldes wurde als Venus bezeichnet (BERENSON, Lotto [zit. A n m . 37] , S. 4f.),
dürfte jedoch eher als N y m p h e oder als ,nackte Frau in Landschaft ' (WOOD, Altdorfer [zit. A n m . 5], S. 267) anzu-
sprechen sein. D ie hügelige Wald- und Wiesenlandschaft und die auf dem Schwarzweißfoto nur schwer lesbaren
Details des Hintergrundes (Hirten mit Schafherden?) weisen in Richtung Arkadienikonographie. Vgl . BLUME,
Beseelte Natur (zit. A n m . 62) , S. 185ÍF. - D ie Kombinat ion von N y m p h e und steilem (Tugend-?)Pfad, die an
Palma Vecchios Gemälde (Abb. 6) erinnert, könnte, das soll nicht verschwiegen werden, auf eine — im Vergleich zu
Altdorfer freilich weit weniger drastische - moralisierende Aussage hindeuten.
86 Der Holzschnitt konfrontiert Herkules mit zwei Frauengestalten, die Voluptas (Unkeuschheit) bzw. Tugend ver-
körpern : Erstere erscheint als nackte, verführerisch blickende Frau, hinter welcher der Tod hervorlugt und über
der - in einer an S o d o m und G o m o r r a gemahnenden Weise - Gottes Straffeuer niedergeht. Ba idung hat die
Voluptas-Darstellung isoliert und — wohl nicht unbeeinflußt von der Kenntnis italienischer Akt-Vorbi lder — ins
Gemälde format übertragen. - Vgl . KOERNER, Self-Portraiture (zit. A n m . 43) , S. 318FF. Z u Baidungs ,Tod-und-
Mädchen'-Darste l lungen siehe unten S. 206.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R 1 199
13 Holzschnittillustration zu Sebastian Brant, Das Narrenschiff, 1497 (Lateinische Ausgabe): Herkules am Scheidewege
stück87, die das ,Stilleben' im rechten unteren
Bildeck konstituieren, sowie auf den Schmuck
der liegenden Tochter.
Die Feldflasche, die im gegenständlichen
Sinn als Weinflasche dient, erscheint als ironi-
sche Metapher der zur Salzsäule erstarrten Mut-
ter. Dafür spricht - abgesehen von der formal-
farblichen Ähnlichkeit zwischen (Zinn-) Flasche
und Salzsäule - das Medaillon, welches die Fla-
sche ziert : Es zeigt das nach links gerichtete Pro-
filbildnis einer Frau mit aufgesteckten Haaren,
flachem Hut (einem Verweis auf den Ehestand?)
87 Bereits die Tatsache, daß sonst keinerlei Gewänder dargestellt sind (die Figuren sind nackt, nicht etwa .entklei-
det' !) , legt nahe, dem StofFstück eine besondere, attributive Bedeutung zuzuschreiben.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
200 H A N N S - P A U L T I E S
u n d p e l z i g e m K r a g e n 8 8 . D a s w e i ß e , v o n b l a u e n t r ia rchen . E s l iegt n a h e , d i e K e n n z e i c h n u n g v o n
S c h m u c k b ä n d e r n geg l ieder te u n d m i t F r a n s e n L o t s J u d e n t u m w e n i g e r d e m B e m ü h e n u m ,hi-
v e r s e h e n e S t o f f s t ü c k , das h i n t e r der F l a s c h e er- s tor i sche ' G e n a u i g k e i t , d e n n d e r f r ü h n e u z e i t l i -
s che int , läßt s i ch als j ü d i s c h e r G e b e t s s c h a l o d e r c h e n , v o n A l t d o r f e r als R e g e n s b u r g e r R a t s h e r r e n
- m a n t e l (Tal l i i ) u n d f o l g l i c h als A t t r i b u t L o t s m i t g e t r a g e n e n J u d e n f e i n d l i c h k e i t zuzuschre i -
ident i f i z i e ren : D e r G e b e t s s c h a l soll g e m ä ß d e m b e n 9 0 : D u r c h d i e - i m K o n t e x t ze i tgenöss i scher
B u c h N u m e r i 1 5 , 3 9 d e n ( m ä n n l i c h e n ) J u d e n , L o t - D a r s t e l l u n g e n e i n m a l i g e 9 1 - B e t o n u n g d e r
d e r ihn b e i m M o r g e n g e b e t t rägt , a n „a l le G e b o t e T a t s a c h e , d a ß der t ö r i c h t e A l t e d e m V o l k des
des H e r r n e r i n n e r n " u n d v o r s ü n d i g e m V e r h a l - A l t e n B u n d e s a n g e h ö r t e , h a t A l t d o r f e r , b e z o g e n
ten b e w a h r e n 8 9 . D i e A s s o z i a t i o n v o n G e b e t s - a u f e ine c h r i s t l i c h - j u d e n f e i n d l i c h e S i c h t w e i s e ,
scha l u n d Inzest v e r d e u t l i c h t - i m S i n n e e iner d i e F i g u r zusätz l ich negat iv k o n n o t i e r t 9 2 . D e m
i r o n i s c h e n Sp i tze — das A u s m a ß v o n L o t s Fall S c h m u c k der l i e g e n d e n T o c h t e r k o m m t , n e b e n
u n d ste igert d i e L ä c h e r l i c h k e i t des b i b l i s c h e n Pa- se iner e ro t i schen F u n k t i o n u n d w o h l e b e n f a l l s
88 Neuffer, welche die Deutung der Flasche als „Anspielung auf die Frau Lots" ebenso erwägt, hat daraufhingewiesen,
daß die Salzsäule auf keiner anderen (zumal vor jener Altdorfers entstandenen) Darstellung von ,Lot und seinen
Töchtern' fehlt. - Vgl. NEUFFER, Altdorfers Lot (zit. Anm. 2), S. 49-52 .
89 T./M. METZGER, Jüdisches Leben im Mittelalter, nach illuminierten hebräischen Handschriften vom 13 . bis 16.
Jahrhundert, Fribourg/Würzburg 1983 , S. 15f . - M. E. SABITZER, Die Kleidung der Juden, Dipl. Arb., Salzburg
2002, S. ioof. - Für weitere, demjenigen Lots verwandte Tallit-Darstellungen, die - unabhängig von der spezi-
fischen Funktion des Gebetsschals — dazu dienen, das Mileu der Tallit-Träger (in allen Fällen Dienerfiguren) als
.jüdisch' zu kennzeichnen, vgl. Altdorfers Tafel der .Handwaschung des Pilatus' vom St. Florian-Altar, Altdorfers
Gemälde der .Susanna im Bade' sowie zwei spätmittelalterliche Beschneidungs-Darstellungen. - Vgl. WINZINGER,
G e m ä l d e (zit. A n m . 1 ) , S . I5FF., 78FF. ( A b b . 1 4 ) bzw. S . 37FR., 1 0 0 (Abb. 49) s o w i e B . BLUMENKRANZ, J u d e n u n d
Judentum in der mittelalterlichen Kunst, Stuttgart 1963, S. 7of. (Abb. 88) bzw. H. SCHRECKENBERG, Die Juden in
der Kunst Europas, Ein historischer Bildatlas, Göttingen 1996. S. 1 5 4 (mit Abb.). - Die Identifikation von Lots
Tallii findet sich auch bei RIESEL, Müssen wir alles glauben? (zit. Anm. 8), S. 23.
90 Altdorfer war als Mitglied des Äußeren Rates an der im Februar 1 5 1 9 erfolgten Vertreibung der Regensburger Juden-
gemeinde beteiligt. Eine von zwei Radierungen, auf denen er - unmittelbar vor ihrer Zerstörung - die Regensburger
Synagoge festhielt, trägt die Bemerkung, der Abriß sei „nach Gottes gerechtem Ratschluß" erfolgt. Als der Judenfriedhof
geschändet wurde, ließ Altdorfer eine Reihe von Grabsteinen in seinem Wohnhaus als Pflastersteine einbauen. - Vgl.
WINZINGER, Gemälde (zit. Anm. i ) , S . 1 0 , 1 4 7 (Urkunde 17).-WINZINGER, Graphik (zit. Anm. 33), S. i i4 f . ,Nr . I73Í.
(mit Abb.). - Zur Geschichte der Regensburger Juden, der Rolle des Künstlers sowie zu weiteren Werken Altdorfers, die
möglicherweise antijüdisch intendiert waren, vgl. W. W. WOLF, The Art of Albrecht Altdorfer: A Mirror of Society, Phil.
Diss., University of Missouri, Ann Arbor 1974, S. 31-50, sowie RIESEL, ebenda.
91 Für Darstellungen des 14 . bis 16 . Jahrhunderts, in denen andere problematische Figuren des Alten Testaments
(Kain, Samson sowie - auf einem Holzschnitt Hans Schäufeleins - einer der Alten, die Susanna bedrängen) in
polemischer, „tadelnder" (Schreckenberg) Absicht (und zwar durch die diffamierenden Erkennungszeichen J u -
denhut' bzw. Judenring') als (zeitgenössische) Juden gekennzeichnet sind, vgl. W. P. ECKERT, „Von Niedrigkeit
umglänzt ihr reines Bildnis", Antijudaismus in der christlichen Kunst, Zur Darstellung von Juden und Judentum
in christlichen Kunstwerken des Mittelalters und des Barock, in: G. B. GINZEL (Hg.), Antisemitismus, Erschei-
nungsformen der Judenfeindschaft gestern und heute, Bielefeld 1 9 9 1 , S. 3 58-388, hier S. 368, sowie SCHRECKEN-
BERG, Juden (zit. Anm. 89), S. 1 2 2 (mit Abb.).
92 Die Übereinstimmung der entsprechenden visuellen Stereotype legt die Annahme nahe, daß auch Lots Häßlichkeit
(vgl. die Krummnase, das abstoßende Grinsen) nicht nur (wenn auch primär) den Liebestoren, sondern auch - in
diffamierender Absicht - den ,bösen' Juden kennzeichnen sollte. Vgl. zur .jüdischen Physiognomie' BLUMENKRANZ,
Juden (zit. Anm. 89), S. 2 3 - 2 7 , 48, 61 (mit Bildbeispielen). - Lots von der Physiognomie her engste ,Verwandte'
im Œuvre Altdorfers finden sich — bezeichnenderweise — unter den Schergen des St. Florian-Altars, speziell in der
Tafel der Dornenkrönung. - Vgl. WINZINGER, Gemälde (zit. Anm. 1), S. I5ÍF., 78ff. (Abb. 9ff.). (Pseudo-)Hebrä-
ische Inschriften sowie jüdische Gewandteile (Kopfbedeckungen, die an den mittelalterlichen Judenhut ' erinnern;
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 201
in satirischer Absicht, apotropäische bzw. talis-
manische Bedeutung zu93. Besonders brisant
erscheint, daß sich Lots Tochter - als wollüstige
Verführerin und als Angehörige jenes Volkes,
das nach zeitgenössischer Auffassung für Christi
Kreuzestod verantwortlich war94 - des Kreuzes
als des zentralen christlichen Schutzsymbols be-
dient95.
3. Altdorfers Lot-Bild: Betrachterbezug, historische Wahrnehmung', Funktion
Spätestens jetzt ist es notwendig, eine Instanz ins
Spiel zu bringen, die bislang stets mitgedacht,
aber nicht explizit genannt wurde: Ich meine
den - unzweifelhaft männlich gedachten - Be-
trachter (im Sinne eines ,impliziten Betrach-
ters', der „Betrachterfunktion im Werk"96), des-
sen sehr bewußte Miteinbeziehung zahlreiche
strukturelle wie inhaltliche Besonderheiten des
Bildes verständlich macht. Die Art und Weise,
wie die Akte des Vordergrundes, besonders der
Frauenkörper, in die Fläche ,geklappt' sind, un-
terstreicht den schon durch die Anordnung her-
vorgerufenen Eindruck, der weibliche Körper
und seine ,arma seductionis' seien - unter Öff-
nung des szenischen Zusammenhangs - weniger
Lot (dessen ,Blickpunkt' weit weniger günstig
erscheint), als dem Betrachter dargeboten. Der-
jenige, den die zweite Tochter verführt, ist nicht
Lot, weder im Sinn einer innerbildlichen, noch
einer narrativen Logik, sondern einzig und allein
der Betrachter. In den Augen des Betrachters
schließlich erhält die ob der ,Dis-Kontinuität'
der Raumübergänge und des aufgeklappten'
Vordergrunds fehlende .innere Einheit' des Bil-
des ihr Äquivalent: Indem sich der Betrachter
auf das Angebot zum Dialog, das die Körper
bzw. der Blick der Frau(en) implizieren, einläßt,
indem er - mit Hilfe seiner Kenntnis des Sujets
und seiner zeitgenössischen Konnotationen - die
strukturell wie narrativ disparaten Bildeinheiten
zusammensieht und die Flächenbezüge deutet,
konstituiert er, um Alois Riegls Begriffspaar zu
der Tallit des Pilatus-Dieners) verdeutlichen, daß Altdorfer die Akteure der Passion — abweichend vom Bibeltext
und entsprechend der Inkriminierung der biblischen wie zeitgenössischen Juden als .Gottesmörder' - (vorrangig)
als Juden kennzeichnen wollte. - Vgl. S. ROHRBACHER, Kreuzestod und Gottesmord, in: DERS./M. SCHMIDT,
Judenbilder, Kulturgeschichte der antijüdischen Mythen und antisemitischen Vorurteile, Reinbek bei Hamburg,
1 9 9 1 , S. 2 1 8 - 2 6 8 , vor allem S. 240.
93 Es wirkt, so Eva Gesine Baut, als sollte der Korallen-Ast Lots Tochter „bewahren vor Gottes Strafe für das unmo-
ralische Vorhaben". Vgl. E. G. BAUR, Meisterwerke der erotischen Kunst, Köln 1995, S. 162 . Zur Funktion der
Koralle (u.a. zum Schutz vor Hagel und Ungewitter - vgl. den .drohenden' Stadtbrand innerhalb von Altdorfers
.Bild im Bild'! - und, nach Berthold von Regensburg, 1 2 2 0 - 1 2 7 2 , ab ira dei) vgl. E. GRABNER, Die Koralle in
Volksmedizin und Volksglaube, in: Zeitschr. für Volkskunde, 65/II, 1969, S. 1 8 3 - 1 9 5 (Zitat S. 185). - Zur Funk-
tion der Perle im Kontext von „Liebes-, Glücks- und Fruchtbarkeitsbeschwörung" vgl. L. HANSMANN/L. KRISS-
RETTENBECK, Amulett und Talisman, München 1966, S. i n .
94 Vgl. ROHRBACHER, Kreuzestod (zit. Anm. 92).
95 Zum Kreuz als Schutzsymbol vgl. D. MORRIS, Glücksbringer und ihre geheimnisvollen Kräfte, München 2000,
S. 1 22 , 13of . — Ein 1506 datierter Kupferstich Altdorfers zeigt zwei ,Einsiedler', die je ein Kreuz „abwehrend-be-
schwörend" gegen ihre Verführerin, eine nackte, aufrecht stehende Frau halten. - Vgl. WINZINGER, Graphik (zit.
Anm. 33), S. 88, Nr. 96 (mit Abb.). - RIESEL, Müssen wir alles glauben ? (zit. Anm. 8) ,S. 81 ( Z i t a t ) . - I m Vergleich
damit, so könnte man folgern, kommt das Kreuz im Lot-Bild .zweckentfremdet' zum Einsatz und wird dadurch
geradezu lächerlich gemacht.
96 Zum .impliziten Betrachter' vgl. W. KEMP, Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz, in: BEL-
TING, Kunstgeschichte (zit. Anm. 13) , S. 2 4 1 - 2 5 8 , hier S. 244ÍF. sowie, bezogen auf Werke Baidungs, KOERNER,
Self-Portraiture (zit. Anm. 43), S. 32IFF.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
202 H A N N S - P A U L T I E S
gebrauchen, die ,äußere Einheit' des Bildes97. Der Anblick aber, welcher sich dem .wissenden' Betrachter bietet, ist ein zutiefst widersprüchli-cher: Das Gemälde inszeniert weibliche Nackt-heit, weist diese jedoch zugleich als nuditas criminalis aus. Die Sinnlichkeit der Frauen(-Kör-per) evoziert begehrliches Blicken, wenn nicht, überspitzt gesagt, den Wunsch, die Grenze zwi-schen Bild und Wirklichkeit zu durchbrechen. Mehrere Bildelemente aber, die der Betrachter gleichsam im zweiten Moment wahrnimmt, enthüllen die Fragwürdigkeit und Gefahr einer derartigen Reaktion : Lot, der den auf den Frau-enkörper gerichteten Blick des Betrachters ver-doppelt', die Erfüllung seines Wunsches, die Be-gehrlichkeiten umsetzen zu können, gleichsam vorexerziert, erscheint - in der Bestimmung als Opfer von ,Wein und Weib', als törichter Alter und als Jude - als zweifelhafte Identifikations-figur. Die unmittelbare Gegenübersetzung von sinnlicher Idylle und Stadtbrand, welche das »Bild im Bild' kennzeichnet, sowie die Tatsache,
daß der Betrachter, der sich von der sitzenden Tochter verführen läßt, gleichsam die , Rolle' Lots übernimmt, verstärken die moralisierende Komponente98.
Bei dieser Ambivalenz von Erotik und Moral, von sinnlicher Inszenierung und moralisieren-der Botschaft, die sich in einer offenen, den Be-trachter aktiv miteinbeziehenden Bildstruktur niederschlägt", scheint es sich - wie ich durch Heranziehung verwandter Werke zeigen möchte - um ein Spezifikum der Renaissancemalerei (und -graphik) in Deutschland und in den Nie-derlanden100 gehandelt zu haben101.
Von Lucas Cranach etwa stammen mehrere Bildtypen, welche im Bereich mythologischer Aktbilder die Präsentation weiblicher Nackt-heit, die vom Thema her nicht zwangsläufig negativ besetzt ist, mit der Wiedergabe von la-teinischen Inschriften bzw. Motiven koppeln, die vor den Affekten warnen, welche die Male-rei evoziert102: Auf der lebensgroßen Tafel mit Venus und Amor von 1509 (Abb. 14) verführt
97 A. R i e g l , Das holländische Gruppenporträt, Wien 1997 (zuerst 1902).
98 Zudem wird der Betrachter — dadurch, daß ihn die kleine Tochter anblickt, während ihn Lot und die große
Tochter nicht bemerken (bzw. vorgeben, ihn nicht wahrzunehmen - vgl. Koerners Ausführungen zu Baidungs
,Eva' von ca. 1524/25, Abb. 9b) — als Voyeur der intimen Szene des Vordergrundes entlarvt. Vgl. K o e r n e r , Self-
Portraiture (zit. Anm. 43), S. 302.
99 Nach Koerner stellt die strukturelle wie inhaltliche Einbeziehung des Betrachters, die Baidungs ambivalente Dar-
stellungen kennzeichnet, eine Pionierleistung dar : „By locating meaning in the painting's effect, by structuring the
image in such a way that it is completed only within the viewer's response, Baldung" — „himself a paradigmatic
viewer of Dürers art" — „gives the viewer a centrality virtually unprecedented in the history of Christian art."
Vgl. K o e r n e r , ebenda, S. 321, 323. Koerner hat versucht, Baidungs ,impliziten Betrachter' mit Phänomenen der
zeitgenössischen Frömmigkeitspraxis und Literatur zu assoziieren. Vgl. S. 344fr.
100 Vor die Aufgabe gestellt, spezifische Merkmale der niederländischen Renaissancekunst im Gegensatz zur italie-
nischen zu benennen, hat Ilja M. Veldman eben jene Ambivalenz von Erotik und Moral bzw. (allgemeiner) die
Koppelung mythologischer Darstellungen mit didaktisch-moralischen Aussageabsichten behandelt. - Vgl. I. M.
V e l d m a n , Die moralische Funktion von Renaissance-Themen in der Bildenden Kunst der Niederlande, in: G.
K a u f f m a n n (Hg.), Die Renaissance im Blick der Nationen Europas, Wiesbaden 1991 , S. 3 8 1 - 4 0 1 . Zur Frage,
wie jene Spezifika (die genauso für die deutschsprachigen Gebiete gelten) zu erklären sind, vgl. S. 390—394.
10 1 Eine Gesamtdarstellung des Phänomens steht, wie schon S i l v e r / S m i t h , Carnal Knowledge (zit. Anm. 60), S. 265
(hinsichtlich der nordischen Präferenz für die nuditas criminalis) bemerkt haben, noch aus. Die folgende Zu-
sammenstellung und die anschließenden Überlegungen mögen als erster Schritt in diese Richtung verstanden
werden.
102 Jörg Robert hat - anläßlich der Hamburger Cranach-Ausstellung vom Frühjahr 2003 - gezeigt, daß die Ambiva-
lenz, welche die Bilder kennzeichnet, ihre Parallele in der „jokoseriösen", Scherz mit Ernst verbindenden Literatur
des deutschen vorreformatorischen Humanismus hat: In Jakob Lochers Schulspiel Judicium paridis de pomo
aureo' bzw. in Konrad Celtis' .Amores' (beide 1502) kontrastieren die moralisch-didaktische Grundhaltung (In-
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 203
1 4 Lucas Cranach, Venus und Amor, 1509. St. Petersburg, Eremitage
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
2 0 4 H A N N S - P A U L T I E S
V e n u s d e n B e t r a c h t e r d u r c h i h r e n B l i c k u n d
d i e R e i z e ihres K ö r p e r s , w ä h r e n d d i e I n s c h r i f t
( „ V e r t r e i b e m i t a l l e n K r ä f t e n d i e F l e i s c h e s l ü s t e ,
d a m i t n i c h t V e n u s d i c h b e h e r r s c h e u n d b l i n d
m a c h e " ) s o w i e d i e g e s e n k t e r e c h t e H a n d d e r
G ö t t i n , d i e d e n b e r e i t s t a t e n d u r s t i g a u f d e n
B e t r a c h t e r b l i c k e n d e n L i e b e s g o t t d a v o n a b h ä l t ,
e i n e n s e i n e r L i e b e s p f e i l e a u f i h n a b z u s c h i e ß e n ,
i n d i e e n t g e g e n g e s e t z t e R i c h t u n g w e i s e n 1 0 3 . I n
C r a n a c h s . Q u e l l n y m p h e n ' (seit 1 5 1 8 ) k o n t r a -
s t i e r e n d i e l e b e n d i g e , s i n n l i c h e I n s z e n i e r u n g
- d i e N y m p h e , w e l c h e m i t d e m B e t r a c h t e r k o -
k e t t i e r t , a n s t a t t z u s c h l a f e n — u n d d i e p s e u d o a n -
t i k e I n s c h r i f t : „ I c h b i n d i e N y m p h e d e r h e i l i g e n
Q u e l l e , s t ö r e n i c h t m e i n e n S c h l a f , i c h r u h e " 1 0 4 .
M e h r n o c h : D e m b e g e h r l i c h e n B e t r a c h t e r , w e l -
c h e r d i e t r a d i t i o n e l l e K o p p e l u n g v o n N y m p h e
u n d S a t y r 1 0 5 s o w i e d i e - i n e i n i g e n V e r s i o n e n
d u r c h M o t i v e w i e d i e n a t ü r l i c h e Q u e l l e (s tat t
d e s B r u n n e n s ) , e i n e n o d e r m e h r e r e H i r s c h e s o -
w i e P f e i l e u n d B o g e n s u g g e r i e r t e - S e k u n d ä r -
b e d e u t u n g d e r N y m p h e als D i a n a ( A b b . i 5 ) 1 0 < s
( e r - ) k e n n t , w i r d e i n e p r ä z i s e , z w e i f e l h a f t e b i s
g e f a h r l i c h e R o l l e z u g e w i e s e n . E r w i r d z u m S a t y r
b z w . z u A k t ä o n , d e r D i a n a b e i m B a d e n z u s a h
u n d m i t d e m T o d b e s t r a f t w u r d e 1 0 7 . E i n e S t e l l e
i n J o h a n n S t i n g e l s N a c h r u f ( 1 5 3 7 ) a u f C r a n a c h s
S o h n H a n s , d e r e b e n f a l l s m a l t e , l e g t n a h e , d a ß
kriminierung der „vita voluptuosa") bzw. der moralische Appell der Vorrede (Lob der „himmlischen Liebe" bzw.
Philosophie, Ablehnung der „törichten", ja „halluzinierenden" Sinnenverfallenheit) mit der literarischen Form
(Liebeselegie, Bukolik) und dem erotischen Inhalt des „Selbstlobs der Venus" (und des „Chores der Landfrauen")
bzw. des - als literarisch-erotische Biographie des Dichters angelegten - Gedichtzyklus. - Vgl. J. ROBERT, Die
Wahrheit hinter dem Schleier, Lucas Cranachs heidnische Götter und die humanistische Mythenallegorese, in :
SCHADE, Cranach (zit. A n m . 56), S. 1 0 2 - 1 1 5 .
103 St. Petersburg, Eremitage. - Vgl . F. MATSCHE, Humanistische Ethik am Beispiel der mythologischen Darstellun-
gen von Lucas Cranach, in: W. EBERHARD/A. A. STRNAD (Hg.), Humanismus und Renaissance in Ostmittel-
europa vor der Reformation, Köln 1996, S. 29-69, hier S. 5 4 - 5 7 . - Für eine andere Übersetzung der Inschrift
(„Vertreibe mit aller Anstrengung die Ausschweifung Cupidos, damit nicht die blinde Venus von deinem Herzen
Besitz ergreift.") vgl. ROBERT, ebenda, S. 109. - A u f mehreren Bildern von .Venus und A m o r als Honigdieb' hat
Cranach die sinnliche Darstellung, „die Theokrits Versen entspricht, die keinerlei moralisierende, lustfeindliche
Tendenz enthalten", mit einer Inschrift gekoppelt, welche vor den verderblichen Folgen der Wollust warnt. Vgl.
MATSCHE, ebanda S. 57-59 (Abb. 3a-b). Vgl. auch FRIEDLÄNDER/ROSENBERG, Cranach (zit. A n m . 27), Nr. 244f.,
247F., 395f., 398, 400 (mit Abb.) sowie, ausführlich, S. FOISTER, Cranachs Mythologien. Quellen und Originali-
tät, in: SCHADE, Cranach (zit. A n m . 56), S. 1 1 6 - 1 9 , hier S. i2of f .
1 0 4 KOEPPLIN/FALK, C r a n a c h (zit . A n m . 2 7 ) , 2 , 5 . 6 3 1 - 6 4 1 ( m i t A b b . ) . - FRIEDLÄNDER/ROSENBERG, e b e n d a ,
Nr. 1 1 9 Í , 402-404 (mit Abb.). - GRIMM, Cranach (zit. A n m . 37), S. 3I4Í. - 1 . LÜBBEKE, Early German Painting,
1 3 5 0 - 1 5 5 0 (The Thyssen-Bornemisza Collection), London 1991, S. 202-209.
105 Vgl. den Holzschnitt der ,Hypnerotomachia Polyphili', der als unmittelbare Vorlage von Cranachs Bilderfindung
gilt. Vgl. M . LIEBMANN, O n the Iconography o f the N y m p h o f the Fountain by Lucas Cranach the Elder, in:
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes XXXI, 1968, S. 4 3 4 - 4 3 7 (Abb. i ) . - Cranachs Gemälde von
1518 (heute Leipzig, Museum der Bildenden Künste) zeigt einen Satyr als Brunnenfigur. Vgl. FRIEDLÄNDER/RO-
SENBERG, Cranach (wie A n m . 27), Nr. 1 1 9 (mit Abb.).
106 Gemälde von ca. 1 5 3 0 - 3 4 in Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza (früher Castagnola/Lugano, Villa Favorita).
Vgl. LÜBBEKE, Early German Painting (zit. A n m . 104), S. 202-209. - A u f einem Tondo (Veste Coburg, Kunst-
sammlungen) wird die N y m p h e von einem mächtigen Hirsch begleitet, der - gleichsam als verwandelter Aktäon
- auf den Betrachter blickt. Vgl. KOEPPLIN/FALK, Cranach (zit. A n m . 27), 1, S. 297. - SCHADE, Cranach (zit.
A n m . 56), Kat. Nr. 68 (mit Abb.).
107 Z u den ,Sekundärbedeutungen' der Quel lnymphen vgl.: W. SCHADE, Die Malerfamilie Cranach, Dresden 1974,
S. 69Í - KOEPPLIN/FALK, ebenda, 1, S. 4 2 6 - 4 3 1 sowie 2, S. 6 3 1 - 6 4 1 . - LÜBBEKE, ebenda, S. 2o6ff; sowie jüngst
- mit dem Versuch einer Chronologie und mit Betonung des Betrachterbezugs - S. APPHUHN-RADTKE, ,Super
Rivam Danubii ' , Z u r Genese und Traditionsbildung der ruhenden Quel lnymphe bei Lucas Cranach d. Ä. , Vor-
trag am Wiener Institut für Kunstgeschichte, 13. 11 . 2002.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R 1 205
Μ k v u i ( J I I ^ C ì
15 Lucas Cranach, Ruhende Quellnymphe, ca. 1530-34. Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza
Cranachs Betrachter derartige ,Rollenspiele' tat-
sächlich praktizierten108.
Hans Baidung hat sich mit der erwähnten
(Neu-)Deutung des Sündenfalls, wonach nicht
Ungehorsam gegenüber dem Schöpfergott, son-
dern Adams Schwäche gegenüber Evas Sinn-
lichkeit als Ursprung der Sünde anzusehen ist,
auseinandergesetzt. Er hat den Betrachter, an
den Evas Sinnlichkeit appelliert, während ihn
Adams Vorbild abschreckt (und, wenn er den
sinnlichen Reizen erliegt, als Sünder entlarvt), in
den Diskurs um Sexualität und Sünde mitein-
bezogen109. Dies gilt für mehrere Graphiken 1 10 ,
für das Bildpaar der Straßburger Aktserie (um
1524/25, Abb. 9 a - b ) l u sowie für ein etwas
unterlebensgroßes Gemälde (ca. 1 5 3 1 , Abb.
108 Es heißt dort : „Einer der öfter gesehen der Helena ruhendes Abbild,/Welches mit göttlicher Kunst wurde gemalet
von Dir,/Weilete liebend und zog aus dem Herzen die tiefsten der Seufzer ;/Lieber, als das, was er war, wollte er
Paris doch sein." Koepplin/Falk haben Stingels Formulierung - als weitere Sekundärbedeutung - auf das Sujet der
Que l lnymphe bezogen, wonach dem Betrachter, als weitere, wiederum problematische Opt ion , die Identifikation
mit Paris zukommt. - Vgl . KOEPPLIN/FALK, Cranach (zit. A n m . 27) , 2, S. 6 3 4 ^
1 0 9 KOERNER, Self-Portraiture (zit. A n m . 43) , S. 295!?. - SCHOEN, A d a m und Eva (zit. A n m . 44), S. 1 9 0 - 1 9 4 .
1 1 0 Vgl . die Ze ichnung der Eva ( 1 5 1 0 ; H a m b u r g , Kunsthalle), die zum Betrachter blickt, ihm Körper und Apfe l glei-
chermaßen .darreicht', und ihn dadurch als A d a m (der innerbildlich fehlt) entlarvt. Vgl . DURIAN-RESS, Baidung
in Freiburg (zit. A n m . 5 8 ) , S . i 6 o f . (mit A b b . ) . - V g l . die Holzschnitte von 1 5 1 1 und 1 5 1 9 . Vgl . ebenda S. i 6 2 f . ,
168f . (mit Abb.) . - Vgl . eine Konturkopie nach Baidung (Veste C o b u r g , Kunstsammlungen) , auf der Eva mit dem
Betrachter kokettiert, während A d a m sie sexuell befriedigt. Vgl . KOERNER, ebenda, S. 298, Abb . 1 4 8 .
i n Gezeigt ist A d a m (mit Z ü g e n eines Satyrs), der sich der Schlange gegenüber behauptet, Evas - von Venus ver-
liehener - Verfuhrungskraft jedoch unterliegen wird. - Vgl . KOERNER, Self-Portraiture (zit. A n m . 43) , S. 298FF.
- SCHOEN, A d a m und Eva (zit. A n m . 44), S. 18 5 - 1 8 9 . D ie Ambiva lenz von Ver führung und Warnung (vor den
,Weiberlisten' und der — negativen — M a c h t von Venus und A m o r ) bestimmt — über die Tafeln der Ureltern hinaus
— das Gesamtprogramm der vier Aktbilder. - Vgl . SCHOEN, S. i 8 8 f . sowie K . LÖCHER, Germanisches National-
museum Nürnberg , Die G e m ä l d e des 1 6 . Jahrhunderts , Stuttgart 1 9 9 7 , S. 54.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
206 H A N N S - P A U L T I E S
i 6 ) 1 1 2 : Adam steht dicht hinter Eva, berührt ihre
Brust (die mit dem verbotenen Apfel gleichgesetzt
ist) und Hüfte. Evas frontal und komplett an-
sichtig gezeigter Körper sowie ihr Blick verfuhren
den Betrachter, fordern ihn auf, „die erste Sünde
stellvertretend fur Adam selbst zu begehen" 1 1 3.
Adams satyrhafte Erscheinung sowie sein Blick,
der seinem (und Evas) Spiegelbild114 wie dem Be-
trachter (als seinem Komplizen) zu gelten scheint,
dabei Begierde bzw. Warnung verkörpert (ebenso
wie die Schlange, die zum bloßen Sündenfall-
Attribut reduziert ist, und der düstere, wolkige
Bildgrund), entlarven die Problematik solch einer
Reaktion 1 15. Baidungs Darstellungen, die in einer
ähnlichen Hintereinanderstaffelung eine nackte
Frau mit der Personifikation des Todes koppeln
(und unter der Bezeichnung ,Tod und Mädchen'
bekannt sind), sind als Allegorien der Vanitas
und, zumal die Zeichnung von 1 5 1 5 und die bei-
den in Basel befindlichen Tafeln 1 16 , der Voluptas
zu lesen: Der jungen Frau werden Schönheit und
Eitelkeit zum Verhängnis. Der Betrachter, dem
der Blick des Todes (in der Zeichnung) wie der
Verweis auf das Grab (das Bild von 1 5 1 7 trägt
die Inschrift: „Hier mußt du hin") gelten, sieht
sich, wenn er angesichts der Bilder Begehrlich-
keiten entwickelt, mit dem Tod bzw. mit seinem
eigenen Leichnam gleichgesetzt. Er wird ge-
zwungen', den Zusammenhang von Sündenfall,
Wollust und Tod (und seine eigene „fallenness",
die Joseph Leo Koerner als das „true subject" der
Bilder bezeichnet hat) „within the experience of
the painting" zu reflektieren117. Auch Baidungs
Hexen-Darstellungen gehören in diesen Kontext:
Der Betrachter der Freiburger Zeichnungen von
1 5 1 4 / 1 5 1 1 8 sowie des Gemäldes von 1523 (mit
einer Rückenfigur, die zum Betrachter blickt und
sich, ebenso wie ihre Kumpanin, vor diesem bzw.
für diesen zu entblößen scheint)119 wird Zeuge,
wenn nicht potentieller Teilnehmer unverblüm-
ter Erotik. Zugleich wird er abgestoßen und in
seiner Sündhaftigkeit entlarvt: Die weibliche
Körperlichkeit ist - vom Thema her - negativ
konnotiert und zumal dort, wo Baidung auf die
Schilderung des Teufelspakts verzichtet, als Ur-
sache des Schadenzaubers ausgewiesen. Verschie-
1 1 2 Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza (früher Castagnola/Lugano, Villa Favorita). - Vgl. LÜBBEKE, Early German
Painting (zit. Anm. 104), S. 1 3 8 - 1 4 3 . - SCHOEN, ebenda, S. 1 9 0 - 1 9 2 .
1 1 3 SCHOEN, Adam und Eva (zit. Anm. 44), S. 190 .
1 1 4 KOERNER, Self-Portraiture (zit. Anm. 43), S. 298.
1 1 5 Baidungs extremste Fassung des Sündenfalls liefert ein Gemälde (ca. 1 5 3 0 ; Ottawa, National Gallery of Cana-
da), auf dem sich Adam im Moment, als er den Apfel pflückt bzw. Eva sinnlich begehrt, in einen verwesenden
Leichnam verwandelt: Adam erscheint als „Emblem seines Falls", als Verkörperung des Todes — der „Frucht und
Bestrafung" (Martin Luther) der Ursünde. - Vgl. VON DER OSTEN, Baidung (zit. Anm. 59), Kat. Nr. 54 (mit
Abb.). - KOERNER, ebenda, S. 292, 305 (Zitate), 309ÍF.
1 1 6 Berlin, Kupferstichkabinett bzw. Basel, Öffentliche Kunstsammlung. - Vgl. DURIAN-RESS, Baidung in Freiburg
(zit. Anm. 58), Abb. 24 bzw. Kat. Nr. 6¿f. (mit Abb.).
1 1 7 Auf dem Gemälde von ca. 1 5 1 8 - 2 0 ist die Engführung von Sexualität und Tod auf die Gleichzeitigkeit von Todes-
kuß bzw. -biß (der folgendes Wortspiel — „Der Tod, lateinisch ,mors', raubt das Leben durch einen Biß, lateinisch
,morsus'." — visualisieren könnte) und Entblößung der weiblichen Scham (vor dem Betrachter) zugespitzt. — Vgl.
KOERNER, Self-Portraiture (zit. Anm. 43), S. 293fr. (Zitate S. 294). - Zur Interpretation des Sujets vgl. außerdem
VON DER OSTEN, Baidung (zit. Anm. 59), Kat. Nr. 44, 48. - SCRIBNER, Sakralbild (zit. Anm. 77), S. 3 2 3 - 3 2 5 .
— C . KIENING, Der Tod, die Frau und der Voyeur, Bildexperimente der frühen Neuzeit, in: U. GAEBEL/E. KART-
SCHOKE (Hg.), Böse Frauen - gute Frauen, Darstellungskonventionen in Texten und Bildern des Mittelalters und
der Frühen Neuzeit, Trier 2 0 0 1 , S. 1 9 5 - 2 2 1 . - U . SÖDING, Hans Baidung Grien in Freiburg, Themenwahl und
Stilentwicklung, in: DURIAN-RESS, Baidung in Freiburg (zit. Anm. 58), S. 1 3 - 5 9 , hier S. 37ff . - DURIAN-RESS,
ebenda, S. 25off .
1 1 8 Paris, Louvre, Département des Arts Graphiques; Wien, Albertina; Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle. — Vgl. DU-
RIAN-RJESS, ebenda, Kat. Nr. 3 7 - 4 0 (mit Abb.).
1 1 9 Frankfurt, Staedelsches Kunstinstitut. Vgl. VON DER OSTEN, Baidung (zit. Anm. 59), Kat. Nr. 53 (mit Abb.).
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 2 0 7
d e n e M o t i v e - w i e die phal l i schen W ü r s t e , d ie
f ü r I m p o t e n z z a u b e r stehen - zeigen die W i r k u n g
dieses Z a u b e r s . D e r Bet rachter w i r d a u ß e r d e m ,
w i e K o e r n e r postul iert , mi t d e m T e u f e l g le ichge-
setzt, d e m einzigen , m ä n n l i c h e n ' W e s e n , das als
Z e u g e bzw. T e i l n e h m e r eines H e x e n - S a b b a t h s in
Frage k o m m t 1 2 0 . D a s G e m ä l d e einer , B a d e s t u b e '
schl ießl ich, das m i t B a i d u n g z u s a m m e n h ä n g t ,
k o m b i n i e r t - in der A k t f i g u r e iner B a d e d i r n e ,
d ie den Bet rachter v e r f ü h r t u n d zugle ich, m i t er-
h o b e n e m Z e i g e f i n g e r , a u f e inen syph i l i sk ranken
L iebes toren weis t - die Z u r s c h a u s t e l l u n g we ib l i -
cher Re ize m i t der W a r n u n g v o r d e n g e s u n d h e i t -
l ichen G e f a h r e n eines B a d e b o r d e l l s 1 2 1 .
W e i t e r e Be i sp ie le f ü r d i e A m b i v a l e n z v o n
E r o t i k u n d M o r a l finden s ich i m Πu v r e v o n J a n
G o s s a e r t u n d M a e r t e n v a n H e e m s k e r k : G o s -
saerts k l e i n e T a f e l m i t V e n u s u n d A m o r ( 1 5 2 1 )
ist d e n j e n i g e n C r a n a c h s e n g v e r w a n d t 1 2 2 . W i e -
d e r h o l t hat G o s s a e r t , ä h n l i c h w i e B a i d u n g , d e n
S ü n d e n f a l l als sexuel les V e r g e h e n i l l u s t r i e r t 1 2 3 .
H e e m s k e r k s T a f e l m i t V e n u s u n d A m o r ( v o n
1 2 2
123
Zur Interpretation von Baidungs Hexendarstellun-
gen vgl. S. SCHADE, Schadenzauber und die M a -
gie des Körpers, Hexenbilder der frühen Neuzeit,
Worms 1983 , S. 42ÍF. - DIES., Zur Genese des
voyeuristischen Blicks, Das Erotische in den He-
xenbildern Hans Baidung Griens, in: C. BISCHOFF
u.a. (Hg.), Frauen-Kunst-Geschichte, Gießen 1984,
S. 9 8 - 1 1 0 . - KOERNER, Self-Portraiture (zit. Anm.
43) , S. 323FR. - SÖDING, Ba idung in Freiburg (zit.
Anm. 1 1 7 ) , S. 4 1 - 4 5 . - DURIAN-RESS, Baidung in
Freiburg (zit. Anm. 58), S. I72f f .
Der Mann, eine von Syphilis-Flecken übersäte „ . , _ . , , _ ,_-,„ , , , . , 16 Hans Baidung Grien, Adam und Eva, um 1531. Madrid,
Rückenfieur, wird von einem zweiten, bekleideten D Museo Thyssen-Bornemisza
Bademädchen, dem er ins Dekollete blickt, sexuell befriedigt. Eine nackte, häßliche Alte, die sich alle
Mühe gibt, .verführerisch' zu wirken und, geradezu neidisch, auf ihre junge Gegenspielerin herabblickt, ergänzt
- als Parodie auf die Geilheit der Alten bzw. als Verweis auf die Vanitas - die moralische Komponente des Bildes.
— Das Gemälde, das sich z. Zt. in einer flämischen Privatsammlung befindet, wurde von Jan Op de Beeck, der es
2003 erstmals publizierte, Baidung zugeschrieben und um 1510—15 datiert. Die bescheidene Qualität (vgl. die
Figurendarstellung) spricht m. E. dafür, daß es sich um eine Kopie nach Baidung bzw. um die Arbeit eines Schü-
lers oder Nachahmers handelt. — Vgl. J . OP DE BEECK (Hg.), De Zotte Schilders, Moraalridders van het penseel
rond Bosch, Breuegel en Brouwer, Ausst. Kat., Gent 2003, S. 8 1 - 8 7 ( m ' t Abb.).
Brüssel, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. — Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. I74FF. (Abb. 97).
Ein Gemälde (Berlin, Schloß Grunewald) sowie vier Zeichnungen zeigen Adam und Eva beim zuweilen heftigen
Liebeswerben. - Vgl. ebenda, S. 1 4 0 - 1 4 8 (mit Abb.).
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
208 H A N N S - P A U L T I E S
1 5 4 5 , Abb. 17 ) kombiniert - was bislang un-
beachtet blieb - besagte Ambivalenz mit einer
präzisen Rollenzuweisung an den Betrachter:
Zur liegenden Venus - in der Art von Altdorfers
,'Tochter' bzw. der Aktgemälde Palma Vecchios
- treten Elemente der Mars-und-Venus-Ikono-
graphie: Der Mittelgrund zeigt die Schmiede
des Vulkan sowie Vulkan, wie er mit einem
Zyklopen das Netz trägt, mit dem er den Ehe-
bruch seiner Gattin Venus mit dem Kriegsgott
Mars offenkundig machen wird 1 2 4 . Venus zeigt
auf Vulkan und ermahnt Amor, seine „frechen
Pfeile" (so die Bildinschrift) zurückzuhalten 1 2 5 .
Die Tatsache, daß der sinnliche Frauenkörper
wie der (warnende?) Blick des Knaben an den
Betrachter appellieren, sowie die Anwesenheit
zweier Tauben (Symbole der Wollust), von de-
nen die eine links von Venus ruht, während die
andere - gleichsam von außerhalb des Bildes
- zu dieser herabschwebt, legen die Annahme
nahe, der Künstler habe dem Betrachter die (in-
nerbildlich unbesetzt gebliebene) Rolle des Mars
zugewiesen 1 2 6 .
Spätestens jetzt ist es notwendig, von den
,impliziten' zu den realen, historischen Betrach-
tern und zu deren .Wahrnehmung' der Bilder
überzugehen. Es gilt zu fragen, welche Funktion
solch ambivalenten Bildern zugedacht war, wie
denn ihre Stellung „im Spannungsverhältnis von
traditioneller Moralvorstellung und neuen äs-
thetischen Konzepten" 1 2 7 zu deuten sei. „Wenn
diese Bilder gedacht sind als Exempel zur War-
nung", schreibt Bätschmann in Bezug auf die
Lot-Darstellungen von Lucas van Leyden und
Altdorfer, „so führen sie doch eine Zweideutig-
keit mit sich, daß sie auch dem Lasziven eine
Rezeptionsmöglichkeit bieten" 1 2 8 .
Faßt man Altdorfers Bild als ,Exempel zur
Warnung' auf, stellt sich die Frage, wovor es
warnt. Warnt es ganz allgemein vor (zumal
weiblicher) Sexualität (und männlicher Lie-
bestorheit) sowie vor Trunkenheit und deren
124 R. GROSSHANS, Maerten van Heemskerk, Die Gemälde, Berlin 1980, S. 163-165. - MAI, Faszination Venus (zit. Anm. 33), S. 230. - Zur moralisierenden Deutung der Mars-und-Venus-Episode (als Beispiel dafür, daß jede Art von — z.B. sexuellem — Vergehen aufgedeckt und bestraft wird), welche die niederländischen, nicht jedoch die italienischen Versionen des Themas kennzeichnet, vgl. I. M. VELDMAN, Maarten van Heemskerck and Dutch humanism in the sixteenth century, Maarssen 1977, S.37-42. - SILVER/SMITH, Carnal Knowledge (zit. Anm. 60), S. 2 6 0 - 2 6 4 . - VELDMAN, Moral ische Funktion (zit. A n m . i o o ) , S. 3 8 4 - 3 8 6 .
125 „Die Mutter tadelte Amor mit folgenden Worten/es rasten (jetzt) der Bogen und die frechen Pfeile/da du manch-mal verspottest/diesen (meinen) Leib und Jupiter mit deinem Pfeil/du versündigst dich, weil du den frevelhaften (Pfeil) so oft abschießt/..." - Vgl. GROSSHANS, ebenda, S. 165, Anm. 5.
126 Gleiches könnte für zwei weitere Bilder gelten, die ,Venus und Amor' mit Elementen der Venus-und-Mars-Ikono-graphie, nicht aber Mars selbst zeigen : Für eine derjenigen Heemskerks eng verwandte Tafel Jan van Scorels (vgl. VELDMAN, Heemskerk [zit. Anm. 124], S. 40, Abb. 18), sowie für eineTafel des Georg Pencz (um 1526-29; vgl. MAI, Faszination Venus [zit. Anm. 33], S. 282, mit Abb.). — Weitere Beispiele ambivalenter Darstellungen (mit betontem Betrachterbezug) finden sich in der Graphik: Bereits im 15. Jahrhundert, etwa im Schaffen des Meisters E.S. (vgl. einen Stich der Luxuria, die dem Betrachter sein Spiegelbild, nämlich das eines Narren, vorhält; vgl. MOXEY, Master E.S. [zit. Anm. 46], S. 131 f., Abb. 8) sowie unter den frühen, erotischen Kupferstichen Dürers (vgl. ,Die vier Hexen', ,Der Traum des Doktors'; vgl. E. PANOFSKY, Albrecht Dürer, 2 Bde., Princeton 19452, hier: 1, S. 70-72; 2, S. 27 und Abb. 97f.); sodann, im 16. Jahrhundert, im Werk der Nürnberger Kleinmeister (vgl. J. L. LEVEY, The Erotic Engravings of Sebald and Barthel Beham : A German Interpretation of a Renaissance Subject, in: H. GODDARD [Hg.], The World in Miniature, Engravings by the German Little Masters, 1500-15 50, Ausst.-Kat., Kansas 1988, S. 40-5 3 [vgl. Abb. 21, 23, 24], Kat. Nr. 43, 44, 47, 48, 49 [mit Abb.]) oder des späten Lucas van Leyden (vgl. SILVER/SMITH, Carnal Knowledge [zit. Anm. 60]).
1 2 7 MENSGER, Gossaert (zit. A n m . 43) , S. 1 5 8 .
128 BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10), S. 176. — Im Folgenden konzentriere ich mich auf Altdorfers Gemälde, ziehe jedoch immer wieder Forschungsmeinungen heran, die in Bezug auf andere Werke ausgesprochen wurden. Dieser Beitrag ist nicht Ort, vielleicht aber Anstoß (zu) einer generellen Kritik mancher dieser Auffassungen.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R ' 2 0 9
17 Maerten van Heemskerk, Venus und Amor, 1545. Köln, Wallraf-Richartz-Museum
v e r m e i n t l i c h d e m ü t i g e n d e r , g e f a h r v o l l e r W i r -
k u n g 1 2 9 ? W a r n t es, als E x e m p e l der ,Weiber l i -
s ten ' , v o r d e r U m k e h r u n g der . g o t t g e w o l l t e n '
G e s c h l e c h t e r o r d n u n g 1 3 0 ? D i e n t es, g e m ä ß d e m
T o p o s des , U n g l e i c h e n Paars ' , d e r W a r n u n g v o r
u n r e c h t m ä ß i g e n B e z i e h u n g e n s o w i e - als n e -
gat ives G e g e n s t ü c k - d e r A u f w e r t u n g rechter ,
e h e l i c h e r L i e b e 1 3 1 ? D i e n t es, w i e J u t t a H e l d
b e z ü g l i c h der z a h l r e i c h e n L o t - D a r s t e l l u n g e n
des 1 6 . J a h r h u n d e r t s v e r m u t e t h a t , der B e k r ä f -
t i g u n g des Inzes tverbots , „ d u r c h dessen str ik-
tere H a n d h a b u n g der f a m i l i ä r e Z u s a m m e n h a l t
129 Zur (mittelalterlichen) Sexualitäts- und Frauenfeindlichkeit und ihren künstlerischen Zeugnissen vgl. SILVER/
SMITH, Carnal Knowledge (zit. Anm. 60); GRÖSSINGER, Picturing Women (zit. Anm. 79), S. 1 - 1 9 , 9 4 - 1 3 8 .
- BONNET, Akt bei Dürer (zit. Anm. 65), S. 4 1 - 5 1 · - Zur Misogynie im Zusammenhang von Hexenverfolgung
und -ikonographie vgl. SCHADE, Schadenzauber (zit. Anm. 120), vor allem S. 86fF. - KOERNER, Self-Portraiture
(zit. Anm. 43), S. 323fr. - Vgl. auch WOLF, Altdorfer (zit. Anm. 90), S. 1 4 1 - 1 7 2 . - RIESEL, Müssen wir alles
glauben? (zit. Anm. 8), S. 8 1 - 8 3 .
1 3 0 Zur Funktion und zeitgenössischen Wahrnehmung des Topos vgl. SILVER/SMITH, ebenda, S. 251 -255 ; STEWART,
Unequal Lovers (zit. Anm. 43), S. H3F. - HELD, Weibermacht (zit. Anm. 49), besonders S. 45. - SMITH, Power
o fWomen (zit. Anm. 49), S. 190-202 . - GRÖSSINGER, ebenda, v. a. S. 1 iofF. - HAMMER-TUGENDHAT, Judith (zit.
Anm. 51) , S. 351-353·
1 3 t Für eine Deutung von Lucas Cranachs ,Ungleichen Paaren' als .didaktische Ehebilder' vgl. E. BIERENDE, Die Lie-
bes- und Buhlschaftsbilder bei Lucas Cranach dem Älteren, Dipl.-Arb. München 1992. - Für eine entsprechende
Deutung der ,Weiberlisten'-Darstellungen vgl. T. VIGNAU-WILBERG, Höfische Minne und Bürgermoral in der
Graphik um 1500, in: H. VEKEMAN/J. MÜLLER HOFSTEDE (Hg.), Wort und Bild in der niederländischen Kunst
und Literatur des 16. und 17 . Jahrhunderts, Erfstadt 1984, S. 4 3 - 5 2 , hier S. 48ff.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
210 H A N N S - P A U L T I E S
möglicherweise gestützt werden sollte"132? Faßt man Altdorfers Bild als ,Exempel zur Warnung' auf, stellt sich andererseits die Frage, wie die moralische Absicht mit einer „Verpackung" zu vereinbaren ist, die „auf den ersten Blick [...] das Gegenteil der Botschaft" suggeriert133. Eras-mus von Rotterdam, das sei hier angemerkt, hätte einen solchen Umgang mit Exempeln ab-gelehnt bzw. an dessen Wirksamkeit gezweifelt: In den ,Ecclesiastes', einer Predigtlehre (1535), sprach er sich dagegen aus, sündhafte Dinge, darunter sexuelle Vergehen (z.B. „warum So-dom vernichtet wurde"!), „überaus sorgfältig" „auszumalen" (depingere), anstatt sie bloß, und „mit Abscheu", zu „erwähnen" (dicere) — „als sei es der Vorsatz, sie nicht so sehr zu verfluchen, als zu lehren"134. Franz Matsche und Joseph Leo Koerner haben hinsichtlich der Werke Cranachs bzw. Baidungs den Kontrast zwischen Absicht und .Verpackung' als integralen Bestandteil der, wie sie glauben, vorrangig moralischen Aussage gedeutet: Cranachs mythologische Darstellun-gen hatten, nach Matsche, die Funktion, analog
zu den „historischen und literarischen studia humanitatis" zur sittlichen Gestaltung des Le-bens, dem „recte vivere", beizutragen135. Ihre moralische Aussage „entspringt" weniger „einer gezwungenen Respektierung christlicher Moral-vorstellungen" als vielmehr „der Lebensweisheit und Ethik der Humanisten". Die Moral der Ve-nus-Bilder liegt, wenn ich Matsche richtig ver-stehe, nicht in einer klaren, warnenden Aussage im Sinne der Inschriften und gegen die Bilder (und deren sinnliche Rezeption), sondern in der Aufforderung an den Betrachter, angesichts des „echten Konflikts", den die Ambivalenz von Text und Bild vorführt, eine eigenständige und „selbstverantwortliche" Wahl zu treffen 136: Eine Entscheidung für das Bild (d.h. für die „vita vo-luptaria", die den Humanisten als eine, wenn auch letztlich zu überwindende Möglichkeit, „zur Glückseligkeit" zu gelangen, galt) scheint möglich, muß jedoch im Bewußtsein der Kon-sequenzen (d.h. der Gefahren sinnlicher Liebe) erfolgen137. Baidungs Betrachter hat, nach Ko-erner, keinerlei Wahl: „The viewer will have
132 HELD, Weibermacht (zit. Anm. 49), S. 46. Im frühen 16. Jahrhundert bemühten sich sowohl kirchliche wie weltliche Autoritäten verstärkt um die Förderung der Ehe bzw. um die Verschärfung des Inzestverbotes. - Vgl. U. RUBLACK, ,Viehisch, frech und onverschämpt', Inzest in Südwestdeutschland, ca. 1530-1700, in: O. ULBRICHT (Hg.), Von Huren und Rabenmüttern, Weibliche Kriminalität in der frühen Neuzeit, Köln u.a. 1995, S. 1 7 1 -2 1 3 .
133 VELDMAN, Moralische Funktion (zit. Anm. 100), S. 389. 134 J. CLERICUS (Hg.), Desiderii Erasmi (Roterodami) Opera Omnia, Tom. V, Leiden 1703 (Nachdruck Hildesheim
u.a. 2001), Sp. 890. - Zum Gebrauch von Tugend- und Laster-Exempeln in der Kunst und Literatur der nieder-ländischen Renaissance, zum Konflikt zwischen den Anforderungen der Humanisten und den - an der Antike orientierten - Gestaltungen der Künstler vgl. E. MULLER/J. M. NOEL, Kunst en moraal bij humanisten, in: R BANGE u.a. (Hg.), Tussen heks en heilige, Ausstellungskatalog, Nijmegen 198 5, S. 129—159, hier S. 135.
135 MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103), S. 46. 136 Ebenda S. 52ÍF. (ZitateS. 54, 55, 59). 137 Cranachs Bilder des Paris-Urteils entsprechen, nach Matsche, nicht der „lebensfeindlichen christlichen Moral-
lehre" (waren also nicht als warnende Exempel einer „fundamentalen Fehlentscheidung" gedacht), sondern der „human-verständnisvollen" Auffassung Marsilio Ficinos bzw. Conrad Celtis'. - Vgl. MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103), S. 52ff. (mit Abb.) - Edgar Bierende hat, gestützt auf reiches Quellenmaterial, die mytho-logischen Tafelbilder Cranachs als „gemalten Historienmythos" interpretiert - als bildliche Umsetzung jenes Wis-sens, das sich der sächsische Kurfürst und .seine' Humanisten über die lokale .Antike', die „germanisch-deutsche Vorzeit" angeeignet hatten (S. 157ff., 267FR.; hier S. 268). Bierende hat das Venus-Bild von 1509 bzw. die Quell-nymphen-Bilder mit dem Gründungsmythos der Stadt Magdeburg und dem von Julius Cäsar eingerichteten Ve-nus-Kult bzw. mit dem .vorzeitlichen', als Ort der Weissagung dienenden Quellheiligtum zu Meißen assoziiert. Er meint, die Bilder hätten der Bekundung des fürstlichen Machtanspruchs auf Magdeburg bzw. Meißen sowie der
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T ALTDORFERS ,LOT UND S E I N E TÖCHTER* 211
been damned from the moment he sets eyes on the image". Er kann nicht umhin, sich zu erregen, manch unklare Details als sexuelle An-spielungen zu deuten (vor allem angesichts der Hexenblätter), und dadurch seine in den Bil-dern selbst verurteilte Lüsternheit, Sündhaftig-keit und „fallenness" zu bekennen. „Instead of standing at the crossroads, the viewer suffers for a choice already taken in favour of vice, a choice whose inescapability is expressed as the image's experienced effect".138 Baidung habe die „Psy-cho-Tyrannei" der Beichtväter und Inquisitoren angewandt, ihre Methode, durch die Beschrei-bung von Sünden entsprechende Bekenntnisse zu erhalten, um den Betrachter zu verdammen und zur Reue aufzufordern139.
Im Zusammenhang mit der Feststellung, Altdorfers Gemälde enthalte eine Zweideu-tigkeit, durch die es auch „dem Lasziven eine Rezeptionsmöglichkeit" bietet, weist Bätsch-mann auf die Biographie des Doktor Niko-laus Gülchen, der das Bild um 1600 besaß140. Der Nürnberger Ratskonsulent und Advokat wurde im Jahre 1605 nach einem aufsehener-regenden Prozeß enthauptet. Es erscheint als höchst eigenartige geschichtliche Fügung, daß ihm vor allem schwerste Sittlichkeitsverbre-chen (mehrfacher Ehebruch, Inzest mit seinen
Nichten, Verfuhrung der Dienstmägde unter Anwendung von Zwang) zur Last gelegt wur-den. Man wird Winzinger zustimmen dürfen, der es „sehr aufschlußreich" fand, „daß sich ge-rade das Lotbild in den Händen dieses Mannes befand" und die Vermutung äußerte, „daß es nicht gerade die künstlerischen Werte der Ta-fel waren, deretwegen er sie erworben hatte"141. Auch die laut Baldass im 17. Jahrhundert er-folgte Übermalung des Bildes, aus der einzig die Akte ausgespart blieben, mag als Hinweis darauf gewertet werden, daß man die Ambiva-lenz, die im Zusammenspiel der Akte mit ihrer Umgebung, in der Diskrepanz von Form und - nunmehr unkenntlich gemachtem - Thema begründet lag, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wahrnahm (bzw. wahrnehmen wollte) und das Bild zum Erotikon reduzierte142. Wollte man annehmen, Altdorfers ,Lot' sei vorrangig als Erotikon, gleichsam als ,Pin-Up-Bild', inten-diert gewesen, so stellt sich die Frage, wie diese Funktion mit dem Thema bzw. mit den Moti-ven zu vereinbaren sei, die den erotischen Ge-nuß auf drastische Weise konterkarieren. Die in Bezug auf Cranach und die niederländischen Maler gängige (und auch in Bezug auf Altdorfer gebrauchte143) Antwort, die somit „heuchleri-sche"144 Moral der Gemälde diene als „Alibi",
Mahnung zur Mäßigung bzw. der Warnung gegen die Weissagung gedient. Bierendes im Wortsinn .historische' Erklärung für die Entstehung der Bilder ist faszinierend, seine Deutung des visuellen Befundes ob der Vernachläs-sigung der erotischen Qualitäten bzw. der Ambivalenz von Erotik und Moral hingegen problematisch (S. 2i3ff.). - Vgl. E. BIERENDE, Lucas Cranach d. Ä. und der deutsche Humanismus, Tafelmalerei im Kontext von Rhetorik, Chroniken und Fürstenspiegeln, München/Berlin 2002.- Für eine m.E. höchst problematische Deutung von Cranachs ,Venus mit Amor als Honigdieb'-Bildern im Lichte der lutherischen Bildertheologie (wobei u.a. Venus' Blick auf den Betrachter nicht als verführerisch, sondern als Appell, angesichts der Ambivalenz zwischen Erotik und Moral eine Entscheidung zu treffen, bzw. als Erinnerung an die „ständige Wahlsituation" des lutherischen Menschen interpretiert wird) vgl. H. K. POULSEN, Fläche, Blick und Erinnerung, Cranachs Venus und Cupido als Honigdieb im Licht der Bildtheologie Luthers, in: SCHADE, Cranach (zit. Anm. 56), S. 1 3 0 - 1 4 3 .
1 38 KOERNER, Self-Portraiture (zit. Anm. 43), S. 320.
139 Ebenda, S. 353ÍF. (Zitat S. 354). - Vgl. auch SCRIBNER, Sakralbild (zit. Anm. 77), S. 325. 1 4 0 BÄTSCHMANN, Lot (zit. Anm. 10), S. 1 7 6 , i83 f . , Anm. 50.
1 4 1 WINZINGER, Gemälde (zit. Anm. i ) , S. 105 .
142 L. BALDASS, Der Stilwandel im Werke Hans Baidungs, in: Münchner Jb. der Bildenden Kunst, N.E, III, 1929/30, S. 4-44, hier S. 33, Anm. 35.
143 Vgl. Anm. 7. 144 VELDMAN, Moralische Funktion (zit. Anm. 100), S. 391.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
212 H A N N S - P A U L TIES
der „Entschuldigung" bzw. „Legitimation" der
erotischen Darstellung, der Zusammenhang
von Thema und Darstellung sei demnach ein
rein .äußerlicher' 145, erscheint schon des-
halb problematisch, weil es - auch im Πu v r e
Cranachs sowie Gossaerts 1 4 6 - Gemälde gibt,
die ohne dieses .Alibi' auskommen 1 4 7 .
Es stellt sich die Frage, ob die Paradigmen
,Exempel zur Warnung' sowie ,Erotikon' aus-
reichen (bzw. überhaupt angemessen sind), um
die Funktion von Altdorfers ,Lot' zu erklären.
Spätestens dann, wenn man versucht weitge-
hend durch Analogieschlüsse eine Vorstellung
vom Auftraggeber (und .ersten Betrachter')
sowie vom ursprünglichen Bestimmungsort
des Gemäldes zu erhalten, erschließt sich mit
dem Konzept von ,Kunst', von .Sammler' und
.Sammlung' ein weiteres, grundlegendes Para-
digma 1 4 8 .
Als Auftraggeber kommt ein adeliger, geistli-
cher oder bürgerlicher, jedenfalls .humanistisch'
gesinnter .Kunstliebhaber' 149, als Bestimmungs-
ort eine .Kunstsammlung', die im Wohnbe-
reich des Besitzers150 oder in einer eigenen
.Kunstkammer' 1 5 1 (etwa in einem speziellen
.Nacketen-Kabinett' 1 5 2) untergebracht gewesen
145 Vgl. GRIMM, Cranach (zit. Anm. 37), S. 345. -VELDMAN, ebenda, S. 394. - MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 123. - MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103), S. 30, Anm.3, nennt mehrere Autoren, die Cranachs Akte als „Pornographie, kaschiert als humanistische Bildungsthemen" bewert haben.
146 Vgl. Cranachs zahlreiche Venus-Bilder, die keine moralisierenden Inschriften aufweisen (FRIEDLÄNDER/ROSEN-BERG, Cranach [zit. Anm. 27], Nr. 1 12b, u s f . , 24iff. , 246a-s, 399 - mit Abb.), weiters die Darstellungen der .Drei Grazien' (Nr. 250, 251). - Vgl. Gossaerts .Danae' (MENSGER, ebenda, S. 1 79- 185 , Abb. 101) .
147 Die Ansicht, jene moralische „Legitimation" sei ein Phänomen bzw. Bedürfnis der frühen Bilder, ein Ausdruck von „An-fangsskrupeln", die Künsder bzw. Auftraggeber „rasch ablegten" (B. HINZ, Lucas Cranach d. Ä., Reinbek bei Hamburg 1993, S. 97), müßte ebenfalls überprüft bzw. differenziert werden. Die Annahme einer linearen Entwicklung von mora-lisch affizierten zu eindimensional erotischen Darstellungen mag für Cranach zutreffen (vgl. MATSCHE, Humanistische Ethik [zit. Anm. 103], S. 3of., Anm. 4); im Falle Gossaerts ist sie weniger leicht nachzuvollziehen (vgl. MENSGER, Gossaert [zit. Anm. 43], S. 12 1 - 124 , i9of.). - Für Erwin Panofskys - in Bezug auf Dürers frühe, erotische Kupferstiche formu-lierte - These, der Künstler hätte den thematischen ,Vorwand' benötigt, um den konservativen, .leibfeindlich' geprägten Betrachtern die modernen, erouschen Formen .unterzujubeln', vgl. PANOFSKY, Dürer (zit. Anm. 126), 1, S. éçf.
148 Für eine (Neu-)Interpretation eines (viel diskutierten) Renaissance-Gemäldes, der die Bewußtmachung seines Status als eines frühen .Kunststücks' zugrunde liegt (was u.a. bedeutet, daß, obzwar es sich um ein biblisches Sujet handelt, „die Theologie die Regeln an die Kunst abgegeben" hat - S. 89), vgl. H. BELTING, Hieronymus Bosch - Garten der Lüste, München 2002.
149 Cranachs mythologische Akte entstanden fur den kursächsischen Hof, für Albrecht von Preußen, den Hochmeister des Deutschen Ordens, „für adelige Kunstliebhaber und wohl auch nichtadelige Humanisten". Vgl. MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103), S. 68. - Gossaert arbeitete für Philipp von Burgund, seit 1 5 1 7 Bischof von Utrecht, und dessen Hof. Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 117FR. - Für Baidungs Aktbilder nimmt man an, sie seien fur wohlhabende Straßburger Patrizier bzw. för den „Kreis der mit Baidung befreundeten Humani-sten" entstanden. Vgl. VON DER OSTEN, Baidung (zit. Anm. 59), S. 166, i68f., 203. Zu Baidungs Publikum vgl. auch SCHADE, Schadenzauber (zit. Anm. 120), S. 48ff. - KOERNER, Self-Portraiture (zit. Anm. 43), S. 3 57F.
150 Vgl. die privaten Gemächer Philipps von Burgund auf Schloß Wijk bei Duurstede, „in denen mehrere Darstel-lungen mit eindeutig erotischem Inhalt zu sehen waren." - Vgl. MENGSER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 124.
1 5 1 Vgl. das .cabinet emprès le jardin', ein „sehr früh dokumentiertes Beispiel eines Sammlungsraums nördlich der Alpen", in dem Margarete von Österreich die Hauptwerke ihrer Kunstsammlung, von der zwei Inventare aus 1 5 1 6 und 1523/24 erhalten sind, präsentierte. - Vgl. MENGSER, ebenda, S. 1 2 1 , i3off.
152 Vgl. das ,Nuditäten-Zimmer' des markgräflich Badischen Hofes zu Basel, in welchem sich (zumal im 18. Jahr-hundert) zwei .Frauenbad'-Tafeln von (bzw. in der Art) Baldung(s) - u.a. wohl das oben erwähnte .Badebordell' - befanden. - Vgl. VON DER OSTEN, Baidung (zit. Anm. 59), Anhang, Kop. 91 (mit Abb.), V. 1 18 . - OP DE BEECK, De Zotte Schilders (zit. Anm. 12 1 ) , S. 82. - Bonnet spekuliert in Bezug auf Cranachs Aktbilder, „ob sie in speziellen .Nacketen-Kabinetten', verdeckt in Truhen oder den Herrengemächern vorbehalten waren." Vgl. BONNET, Akt im Werk Cranachs (zit. Anm. 37), S. I47F.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 213
sein könnte, in Frage153. Die ältere Forschung beschränkte sich, wenn überhaupt, darauf, den Charakter des Bildes als ,Kunstwerk' zu benen-nen 154. Konfrontiert mit einer Epoche, in der sich die neue ,Mediasphäre' der ,Kunst' im Sinn von ,Sammlungskunst' (neben jener altherge-brachten des christlichen Kults') erst konstitu-ierte (und mit einem Künstler, der an dem Pro-zeß aktiv beteiligt war), halte ich es für lohnend, den Charakter des Bildes als .Kunstwerk' be-wußt und - in seinen vielfältigen Aspekten - für meine Fragestellung nutzbar zu machen155. Vor dem Hintergrund des neuen Kunstverständ-nisses erhalten jene Momente, welche die For-
schung (einschließlich meiner Ausführungen) als Qualitäten des Lot-Gemäldes ermittelt hat, eine spezifisch ,historische' Bedeutung156: Die Panegyriker der neuen Kunst, die kurz nach 1500 auch nördlich der Alpen auftraten, lobten - in der Nachfolge Leon Battista Albertis und der italienischen Kunsttheorie sowie im Rekurs auf das Kunstverständnis der Antike - die Fähig-keit der Maler zur Naturnachahmung mit dem Ziel der Sinnestäuschung157 sowie zur geistrei-chen' 158 Erfindung (inventione) - eine Fähigkeit, in der sich Eingebung (ingenium) manifestierte und die nach bisherigem Verständnis allein den Dichtern, deren Gelehrsamkeit und Freiheit die
1 5 3 Z u Kunstsammler und Kunstsammlung im frühen 16. Jahrhundert vgl. auch S. H. GODDARD, The Origin, Use,
and Heritage of the Small Engraving in Renaissance Germany, in: GODDARD, World in Miniature (zit. Anm.
126), S. 1 3 - 2 9 .
1 5 4 Bei Winzinger heißt es, „nach Darstellung, Malweise und Format" sei Altdorfers ,Lot' „geradezu das Musterbei-
spiel eines fürstlichen ,Kunstkammerstückes'". Vgl. WINZINGER, Gemälde (zit. Anm. i), S. 47.
1 5 5 Zum Begriff der ,Mediasphäre' vgl. SCHWARZ, Visuelle Medien (zit. Anm. 13) , S. 16. - Z u den Funktionen von
,Kunst' als ,Sammlungskunst' vgl. etwa H. BELTING, Bild und Kult, München 1990, S. 5 1 0 - 5 4 5 ; BÄTSCHMANN,
Anleitung zur Interpretation (zit. Anm. 13 ) , S. 2 i 7 f . - KEMP, Kunstwerk und Betrachter (zit. Anm. 96), S. 249ff.
- Würde man annehmen, Altdorfers Lot-Bild sei, ebenso wie manche (vgl. MENSGER, Gossaert [zit. Anm. 43],
S. 128) bzw. ein Großteil (vgl. KEMP, S. 252) der Bilder in den niederländischen Sammlungen des frühen 16.
Jahrhunderts, mit einem Bildervorhang ausgestattet gewesen, so erschiene das grüne Tuch, das die Figuren hinter-
fängt, welches außerhalb des Bildes aufgehängt zu sein scheint und am linken Bildrand eigenartig umschlägt, als
dessen gemaltes Pendant. - Zur Geschichte und Funktion des gemalten Bildervorhangs vgl. KEMP, S. 2 5 2ÍF.
1 5 6 Da es, anders als im Fall Gossaerts bzw. Cranachs, keinerlei Schriftquellen gibt, die über die zeitgenössische
Rezeption von Altdorfers Werken sowie über dessen Kontakte mit Humanisten informieren, bin ich - was die
folgenden Ausführungen betrifft - auf Analogieschlüsse angewiesen : Die ältere Forschung hat Altdorfers Kunst
„gerne als Ausdruck seiner scheinbar unverbildeten Natürlichkeit und Distanz zu Intellektualität und Wissen"
verstanden. Die rezente Literatur hingegen - und das ist die Folie, vor der mir diese Ausführungen legitim er-
scheinen - sieht gerade in der „Vielfalt und Freiheit" seiner nicht-religiösen Werke (unter denen, wie mir scheint,
dem Lot-Bild eine hervorragende Rolle zukommt) einen Beleg fur eine (.humanistische' ?) Bildung des Künstlers
(neben einer unbestreitbaren .pictorial intelligence') sowie für einen „florierenden Kunstmarkt und einen ver-
ständigen Abnehmerkreis". - Vgl. H. STEIN-KECKS, ,Des himmels porten ist verschlossen', Ein neuer Fund zu
Albrecht Altdorfer und Joseph Grünpeck, in: M . ANGERER, Ratisbona, Die königliche Stadt, Regensburg 2000,
S. 67-99 (Zitate S. 69f.). - Vgl. SCHWARZ, Visuelle Medien (zit. Anm. 13) , S. 2 5 8 - 2 6 1 (zum Begriff der .pictorial
intelligence'). - Für Überlegungen zu Altdorfers Publikum und Kontakten vgl. STEIN-KECKS (mit der älteren
Literatur sowie zwei neu entdeckten Quellen), sowie WOOD, Altdorfer (zit. Anm. 5), S. 234 -245 .
1 5 7 Christoph Scheurls Lobgedicht von 1509 enthält zahlreiche Anekdoten, die Cranachs Fähigkeit zur täuschend
echten Wiedergabe von Tieren, Früchten und Personen belegen und ihn mit Apelles, Zeuxis und anderen antiken
Malern gleichsetzen. — Vgl. H. LÜDECKE, Lucas Cranach der Ältere im Spiegel seiner Zeit. Aus Urkunden, Chro-
niken, Briefen, Reden und Gedichten, Berlin 1 9 5 3 , S. 49-55 .
158 Scheurl tituliert Cranach als „geistreichen, schnellen und vollendeten herzoglich-sächsischen Hofmaler". Vgl.
ebenda, S. 49. - MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103) , S. 37, 58-59 (Anm. 19) hat dazu aufgefordert,
das Epitheton .geistreich' nicht als bloße Schmeichelei abzutun, sondern als Verweis auf die Erfindungsgabe des
Malers ernst zu nehmen.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
214 H A N N S - P A U L T I E S
Maler fortan teilten, vorbehalten war 1 5 9 . Der
»Kunstliebhaber1, der Altdorfers ,Lot' besaß,
wird die in der Literatur immer wieder hervor-
gehobene malerische Virtuosität, die Vielfalt
der Malweise, die der Illusion von Stofflichkeit
dient (man betrachte die Akte, das Weinglas, das
,Stilleben' im rechten unteren Bildeck), ebenso
goutiert haben wie die in diesem Beitrag aufge-
zeigte Komplexität der .Erfindung', die vielfälti-
gen semantischen wie künstlerischen Referenzen
(etwa die .italienischen' Akte, die .niederländi-
sche' brennende Landschaft) 1 6 0 . Vor dem Hin-
tergrund des neuen Kunstverständnisses erhält
die Rezeption italienischer, also .welscher' bzw.
.antigischer' 16 1 Vorbilder ebensowie die ero-
tische Qualität des Gemäldes eine zusätzliche
Bedeutung: Altdorfers Fähigkeit, die Schön-
heit und Sinnlichkeit von Lots Töchtern - vor
allem der liegenden, nicht ganz lebensgroßen
,Venus-Tochter' - täuschend lebensecht vorzu-
führen und die Sinne des Betrachters zu erre-
gen, erscheint als Qualitätsmerkmal im Wett-
streit mit der Antike: Der antike Maler Apelles,
das ständige Vorbild, an dem die nordischen
(wie italienischen) Renaissancekünstler gemes-
sen wurden, hatte „in Bildern der Venus mit
Cupido die höchsten Möglichkeiten der Kunst
demonstriert" 1 6 2 . U m antike Aktdarstellungen
rankten sich Legenden, die ihre stimulierende
Wirkung belegen 1 6 3 . In der Renaissance wurden
die Legenden zitiert, um - mit dem Anspruch,
die antiken Beispiele zu übertreffen — die Qua-
lität zeitgenössischer Akte zu propagieren 164 .
Auch Altdorfers inventione kann als Ausdruck
159 Vgl. den Brief über die eccelentia de(lla) pittura, mit dem sich der Maler Jacopo de'Barbari ca. 1502 bei dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen von Sachsen (Cranachs späterem Auftraggeber) bewarb. - Vgl. BELTING, Bild und Kult (zit. Anm. 155), S. 61 Vgl. das Lobgedicht auf die Malerei, das Geraldus Geldenhauer, seit 1517 Hofchronist Philipps von Burgund, 1515 (und wohl in Hinblick auf Gossaert) an seinen späteren Arbeitgeber adressierte. - Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 108-110, 215E - Zum Begriff der inventione ν gl. LEVEY, Erotic Engravings (zit. Anm. 126), S. 5 of. - J . HELD/N. SCHNEIDER, Sozialgeschichte der Malerei vom Spätmit-telalter bis ins 20. Jahrhundert, Köln 19982, S. 66.
160 Wie Mensger gezeigt hat, verlangte das höfische Publikum, für das Gossaert arbeitete, nach immer neuen, teils kuriosen bis bizarren künstlerischen .Erfindungen': So schuf Gossaert ein Gemälde, das die beiden Zwerge des Königs von Dänemark nackt in den Rollen von Adam und Eva zeigte. - Vgl. MENSGER, ebenda, S. 13 if.
161 Beide Begriffe - der zweite wurde von Dürer verwendet - meinen den „an klassischen Vorbildern geschulten, modernsten italienischen Renaissancestil." - Vgl. M. BAXANDALL, Die Kunst der Bildschnitzer, München 19963, S. 144fr. - BONNET, Akt im Werk Cranachs (zit. Anm. 37), S. 139, 148 (Anm. 10, Zitat). - Für Künstler wie Auftraggeber nördlich der Alpen dürfte keine scharfe Trennung zwischen antiker und pseudo-antiker (d.h. ita-lienischer Renaissance-)Kunst bestanden haben: Die antikisierenden Darstellungen, welche nördlich der Alpen entstanden, gehen nur selten auf antike Originale, meist jedoch auf italienische Werke, die ihrerseits an antiken Vorlagen orientiert waren, zurück. - Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 75.
162 KOEPPLIN/FALK, Cranach (zit. Anm. 27), 2, S. 650. Auf den Vergleich mit Apelles dürften Cranachs Venus-Bilder, so jenes in Hannover, abzielen. - Vgl. MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103), S. 54 (Abb. 2). - ROBERT, Wahrheit (zit. Anm. 102), S. 112f. - Zum „sinnlichen Sujet des Frauenaktes" als „Metapher für die Schönheit der Malerei" vgl. BONNET, ebenda, S. 144. - MENSGER, ebenda, S. i89f. - Vgl. auch R. GOFFEN, Introduction, in: GOFFEN, Venus of Urbino (zit. Anm. 64), S. 1-22, hier S. I3f.
163 Vgl. die (Marmor-)Venus des Praxiteles, die „von solcher Schönheit" war, „daß die Menschen in gottlose Begierde verfielen und das Bild .masturbando' schändeten". - Vgl. HINZ, Cranach (zit. Anm. 147), S. 104.
164 Vgl. den Text zur Venus-Nymphe der ,Hypnerotomachia Poliphili' bzw. Ludovico Dolces Lob von Tizians ,Venus und Adonis'.- Vgl. BLUME, Beseelte Natur (zit. Anm. 62), S. 178ff. bzw. C. GINZBURG, Tiziano, Ovidio e i codici della figurazione erotica nel '500, in: TIZIANO E VENEZIA (zit. Anm. 64), S. 125-135, hier S. 128. - Wenn man die Fähigkeit des Bildes, Sinnlichkeit zu inszenieren bzw. hervorzurufen, als spezifisch künstlerische Leistung betrach-tet, erscheint die Warnung, die Altdorfers ,Lot' enthält, als „implizites Eingeständnis" bzw. als Bekräftigung jener Leistung. Der moralische Appell ist dann zweifach zu verstehen : Als Warnung vor den Gefahren sinnlicher Liebe im allgemeinen, aber auch als Warnung vor dem Bild selbst und vor dessen sinnlich-unmittelbarer Rezeption
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 215
des Wettstreits mit antiken bzw. italienischen
Vorbildern gelesen werden: Indem der Maler
die Protagonisten als Aktfiguren wiedergab, klei-
dete er sie ,all 'antica' 1 6 5 . Indem er die biblische
Episode gleich einer antiken Götterliebschaft
inszenierte, wetteiferte er mit einer Gattung, die
etwa Geraldus Geldenhauer, dem Panegyriker
Gossaerts, als hervorragendste Aufgabe eines
Malers galt: mit der Gattung der poesie (con
figure nude)', der Darstellung von Themen der
antiken Dichtung (mit Aktf iguren) 1 6 6 . Die Dar-
stellung der Lot-Geschichte im Gewand einer
poesia mag „ im Sinne einer Nobilitierung des
religiösen Stoffes, seiner Gleichsetzung mit an-
tiker Uberlieferung" verstanden worden sein 1 6 7 .
Die Tatsache, daß es sich um ein typisch g o r d i -
sches', der italienischen Kunst weitgehend frem-
des 1 6 8 Sujet handelt, wir f t die Frage auf, ob die
typisch ,nordische' Umsetzung der italienischen
Bildmuster (fur die es auch in Altdorfers gra-
phischem Œuvre Beispiele gibt) 1 6 9 , program-
matische Bedeutung im Sinne einer spezifisch
.deutschen' Alternative zur italienischen Kunst,
als Ausdruck des Nationalbewußtseins und des
antiitalienischen Kulturwettbewerbs der deut-
schen Humanisten, gehabt haben könnte 1 7 0 .
- einer Art der Rezeption, welche im traditionellen (christlichen) Bildverständnis nicht vorgesehen war. - Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 178. - Vgl. auch BONNET, Akt im Werk Cranachs (zit. Anm. 37), S. 142, 1 4 7 . - ROBERT, W a h r h e i t (zit. A n m . 1 0 2 ) , S . i n .
165 Vgl. die „verbreitete Vorstellung, antike Kunst sei vornehmlich eine Kunst der Aktmalerei gewesen". MENSGER, ebenda, S. 123.
166 Vgl. MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 108- 1 10 , 21 - Als poesie wurden Tizians mythologisch-erotische Darstellungen bezeichnet. Vgl. GINZBURG, Tiziano (zit. Anm. 164), S. 1 2 8 . - 1567 stellte der Italiener Ludovico Guicciardini rückblickend fest, Jan Gossaert sei der erste gewesen, che portò d'Italia in questi paesi [die Niederlande] l'arte del dipingere historie, e poesie con figure nude. Vgl. MENSGER, S. n o , 125 (Anm. 9).
167 BONNET, Akt im Werk Cranachs (zit. Anm. 37), S. I42F. (zu Cranachs Bildern mit Adam und Eva). 168 Die, soweit ich sehe, früheste italienische' Darstellung von Lots Trunkenheit (abseits der Buchillustration) findet
sich bezeichnenderweise im Einflußbereich des deutschen Kulturraums: Die Fresken, die Girolamo Romanino 15 3 2 im ,Revolto sotto la loza' des Bischofsschlosses zu Trient ausgeführt hat, zeigen - unter dem Vorzeichen von Liebestorheit — eine ,giorgioneske' ,Venus mit Cupido und Bär' (eine Allegorie der Luxuria?), eine ,Buhlschaft' von Landsknecht und Dirne, die Kastration eines Katers (zur Gewinnung von Kosmetika und Aphrodisiaka) sowie Lot und seine Töchter (wie die ,Buhlschaft' in der Art deutscher Graphiken). — Vgl. A. NOVA, Girolamo Romanino, Torino 1994, Kat. Nr. 61 (mit Abb). - H.-P. TIES, Il cardinale Cles e il „potere d'amore - Il program-ma iconografico degli affreschi di Gerolamo Romanino nel Castello del Buonconsiglio a Trento, in: Studi Trentini die Scienze Storiche, sez. 21, 2007 (im Druck) — Zu einer möglichen Kenntnis des Trientiner Schloßausstattung von Seiten Altdorfers vgl. N. RASMO, Il pittore Altdorfer e la Residenza Clesiana di Trento, in : Cultura Atesina, 9, 1955, S. 33-35. - AIKEMA/BROWN, Rinascimento (zit. Anm. 35), S. 360Í (mit weiterer Literatur).
169 Vgl. den Kupferstich von 1506, in dem die Prudentia eines italienischen Niello zur Vanitas umgedeutet erscheint. -Vg l . GODDARD, World in Miniature (zit. Anm. 126), Kat. Nr. 1 (mit Abb.).
170 Janey L. Levy hat die erotischen Kupferstiche der Brüder Beham, die - ähnlich wie Altdorfers ,Lot' - .italienische' Nacktheit mit typisch .nordischen', moralisierenden Sujets (und mit dem, nach Levy, ebenfalls typisch .nordi-schen' Modus der Satire) koppeln (und vielfach direkt deutsche Graphiken des 15. Jahrhunderts paraphrasieren), im Sinne jenes Renaissance-Nationalismus gedeutet. Vgl. LEVEY, Erotic Engravings (zit. Anm. 126), S. 40-53 (und die entsprechenden Katalogeinträge). - Mehrere für Altdorfer typische Sujets (vor allem die Landschaften und .Wilden Leute', die als Illustrationen des ,deutschen Waldes' und der germanischen Urbevölkerung gelesen wurden), legen die Annahme nahe, daß der Maler mit dem Patriotismus der Humanisten vertraut war. Vgl. L. SILVER, Germanic Patriotism in the Age of Dürer, in: D. EICHBERGER/C. ZIKA (Hg.), Dürer and his Culture, Cambridge u.a. 1998, S. 38-68, hier S. 55ff. - Auch der unklassische Stil Altdorfers und Wolf Hubers bzw. von Altdorfers Landschaften wurde als „gewollte Ausübung einer als deutsch geltenden ,maniera'" bzw. als ,national style' gedeutet. - Vgl. P. VÁISSE, Überlegungen zum Thema Donauschule, in: J. u. M. GUILLAUD (Hg.), Altdor-fer und der fantastische Realismus in der deutschen Kunst, Ausst.-Kat., Paris 1984, S. 149-164, hier S. i62f. -WOOD, Altdorfer (zit. Anm. 5), S. 128-202, vor allem S. 152fr.
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
216 H A N N S - P A U L T I E S
Vor dem Hintergrund des neuen Kunstver-ständnisses erscheint auch die Ambivalenz von Erotik und Moral ebenso wie die satirische Qua-lität des Bildes in neuem Licht: Ilija M. Veld-man, der eine vorrangig moralische Absicht der niederländischen ambivalenten Bilder postu-lierte, hat eine gängige Funktionsbestimmung von Kunst - die Horaz'sche Auffassung, die „Verbindung von delectare und monere, unter-halten und erbauen" sichere einem Kunstwerk den „größten Publikumserfolg" - zitiert, um das Parallellaufen von „fröhlichem Genuß" und „einer nicht mißzuverstehenden Warnung" zu rechtfertigen171. Hans Joachim Raupp hingegen hat in Bezug auf die satirische Kunst der nor-dischen Renaissance172 auf die Notwendigkeit verwiesen, den „öffentlichen oder privaten Cha-rakter" eines Kunstwerks bzw. „Bildungsgrad und Interessenlage der Rezipienten" bewußt zu machen, um die Funktion des Objektes zu be-stimmen: Diese ist, allgemein gesprochen, zwi-
schen den Polen von utilitas / .Nützlichkeit' (im Sinne didaktischer Exemplarik) und delectatio / .Unterhaltung1 zu suchen173. In Bezug auf jene Kupferstiche und Gemälde, die sich als „Kunst-stücke" an sozial hochgestellte, gebildete „Ken-ner" wandten, „die [...] sich über moralisierende Lehren [sowie über Betrachter, welche Beleh-rung „nötig" hatten] erhaben fühlen konnten" und primär „Witz und Spott" der Objekte gou-tierten, spricht Raupp von einer „Verselbstän-digung der Z)f/iftario-Funktion"174. Es scheint nahe liegend, in Bezug auf Altdorfers Lot-Ge-mälde (und gegenüber Veldman) die Hierarchie der Horaz'schen Begriffe umzudrehen sowie (im Sinne Raupps) anzunehmen, das Bild habe zu-nächst und vorrangig der delectatio gedient, und nebenher der Warnung - oder besser, es habe der Unterhaltung gedient und im Kontext dieser Funktion sei das moralische Element als integraler Bestandteil mit eingeschlossen gewesen, die Ambi-valenz produktiv umgesetzt worden175.
1 7 1 VELDMAN, M o r a l i s c h e F u n k t i o n (zit. A N M . 1 0 0 ) , S . 39OF.
1 7 2 Raupps Ausführungen beziehen sich auf die ,Bauernsatiren' in der deutschen und niederländischen Kunst (und
Literatur) des 15 . und 16 . Jahrhunderts, gelten jedoch fur satirische Kunst im allgemeinen.
1 7 3 RAUPP, Bauernsatiren (zit. Anm. 47), S. 127FR. (Zitate S. 128 , 130). Nach Paul von Blum bedien(t)en sich die
Künstler der Satire - prinzipiell - aus „many reasons", unter anderem „to entertain their audiences" bzw. „to
educate the public". Vgl. VON BLUM, Satire (zit. Anm. 48), S. 868.
1 7 4 RAUPP, ebenda, S. 98, 1 2 7 , 1 3 1 , 163 , 295 (Anm. 50). - Im Fall von Holzschnitten, die sich an ein breiteres,
weniger elitäres Publikum richten, ist eine vorrangig moralisch-didaktische Funktion eher anzunehmen. - Vgl.
GODDARD, Small Engraving (zit. Anm. 153) , S. 1 3 , I7F. - SILVER/SMITH, Carnal Knowledge (zit. Anm. 60),
S. 2 51 ff. (zur Graphik des Lucas van Leyden). - Ähnliches gilt für Bilder, die in größere Ausstattungsprogramme
eingebunden waren: Man denke an die Ausstattungen der sächsischen Schlösser in Wittenberg und Torgau, die
aufgrund 1508 bzw. 1 5 1 4 publizierter Beschreibungen bekannt sind. - Vgl. MATSCHE, Humanistische Ethik (zit.
Anm. 103) , S. 44fr. - Zur „Freude", dem „visuellen Genuß am Kunstwerk (delectatio)" (S. 1 2 7 ) und der damit
einhergehenden „Erholung" (u.a. „von den Staatsgeschäften" - S. 1 4 1 ) als zentralem Movens des Sammeins (so-
wie zu entsprechenden — italienischen — Textquellen) vgl. auch U. PFISTERER, Die Kunstliteratur der italienischen
Renaissance. Eine Geschichte in Quellen, Stuttgart 2002, S. I27Í. , 140—144.
1 7 5 Alison G. Stewart schrieb den Bildern ,Ungleicher Paare' eine primär unterhaltende Funktion zu. Vgl. STEWART,
Unequal Lovers (zit. Anm. 43), S. 1 0 6 - 1 0 8 . - In Holzschnitten wie Hans Sebald Behams Jungbrunnen und
Badhaus' (ca. 15 3 1 ) sah Stewart „popular forms of entertainment", wobei das Unterhaltende gerade in der Am-
bivalenz von Erotik und Moral bestanden habe: Die Graphiken hätten ihr Publikum „amused and titillated [. . .]
by stressing sexual acts [ . . . ] , and by adding a moralizing note to the amusement represented". Vgl. A. STEWART,
Sebald Beham's Fountain of Youth-Bathhouse Woodcut : Popular Entertainment and Large Prints by the Little
Masters, in: The Register of the Spencer Museum of Art, VI , Nr. 6, 1989, S. 64-88, hier S. 82 (mit Abb. ι ) .
- Nach Susan Foister „resultiert" auch das „Vergnügen" an Cranachs ,Venus mit Amor als Honigdieb'-Bildern ge-
rade „aus der Verbindung des amüsanten Themas mit der Moral der Verse." Vgl. FOISTER, Cranachs Mythologien
(zit. Anm. 1 0 3 ) , S. 1 2 2 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 217
Angesichts des Charakters des Lot-Bildes als
an einen .Liebhaber' adressiertes .Kunstwerk'
relativiert sich neben seiner D e u t u n g als , E x e m -
pel zur W a r n u n g ' auch diejenige als durch das
moralisierende Thema legitimiertes,Erotikori. D i e
D e u t u n g eines ,Sammlerstücks' als moralisches
Lehrbild, gleichsam als .Propagandabild' kirch-
licher bzw. weltlich-ethischer Anliegen erscheint
ebenso problematisch w i e die Vorstellung, ein
Kunstsammler als sozial hoch gestellte Persön-
lichkeit - als jemand, der „über den D i n g e n
s t a n d " 1 7 6 - habe sich (vor w e m auch immer) fur
den Besitz eines erotischen Gemäldes entschul-
digen bzw. rechtfertigen m ü s s e n 1 7 7 . D i e satiri-
sche Qualität des Gemäldes legt - darüber hin-
aus - nahe, daß die delectatio, die das L o t - B i l d
bot, weit mehr umfaßte als erotische Stimulie-
rung u n d ersatzweise T r i e b b e f r i e d i g u n g 1 7 8 : D i e
derb-humorvolle S c h i l d e r u n g 1 7 9 des alten, nicht
mehr recht fähigen - und noch dazu trunkenen
- Liebestoren (als eines Archetypen bildlicher
K o m i k 1 8 0 ) , die Metaphorik der Flasche sowie
die Semantik v o n Gebetsschal u n d S c h m u c k
werden (intellektuelles) Vergnügen bereitet u n d
Grund zur Belustigung geliefert h a b e n 1 8 1 .
E s scheint naheliegend, in Bezug auf das L o t -
1 7 6 BELTING, Hieronymus Bosch (zit. Anm. 148), S. 44.
1 7 7 Bezeichnenderweise unterlassen es die zahlreichen Autoren, welche die "These von Thema bzw. Moral als .Alibi'
erotischer Darstellungen vertreten oder trotz zunehmender Kritik und differenzierter Betrachtungen (vgl. SILVER/
SMITH, Carnal Knowledge [zit. Anm. 60]. - MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. Anm. 103]) an ihr festhalten,
zu fragen, weshalb bzw. vor wem sich die .Kunstliebhaber' für „die Einbeziehung der nackten jungen Damen in
ihren Lebensraum" rechtfertigen mußten. - Vgl. zuletzt, in Bezug auf Cranach, H. SPIELMANN, Cranach als Para-
meter, in: SCHADE, Cranach (zit. Anm. 56), S. 6 - 1 1 , hier S. 8, sowie zustimmend: G . SEIBT, Der erste deutsche
Eleganzmaler, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 95, 25.4. 2003, S. 1 5 .
178 Vgl. K. HOFFMANN, Antikenrezeption und Zivilisationsprozeß im erotischen Bilderkreis der frühen Neuzeit, in:
Antike und Abendland, 24, 1978, S. 1 4 6 - 1 5 8 , hier S. 1 5 2 (zu Cranachs .Venus und Amor').
179 Den „humorvollen Zug" des Lot-Bildes hat schon Baldass hervorgehoben. Vgl. BALDASS, Altdorfer (zit. Anm. 29),
S. 194. - Die Kategorie von .Ironie' bzw.,Humor' wurde, m. E. treffend, auf andere ambivalente Aktbilder ange-
wandt: Für Cranachs mythologische Akte vgl. D . KOEPPLIN, Humanistische Tendenzen in Cranachs Frühwerk,
in: P. H. FEIST u.a. (Hg.), Lukas Cranach, Künstler und Gesellschaft. Referate des Colloquiums zum 500. Ge-
burtstag Lukas Cranachs d. Ä., Wittenberg 1 9 7 3 , S. 68. - Für Baidungs Sündenfall-Bilder vgl. VON DER OSTEN,
Baidung (zit. Anm. 59), S. I72Í . - SCHOEN, Adam und Eva (zit. Anm. 44), S. 188. - Für Baidungs Hexen vgl.
SCHADE, S c h a d e n z a u b e r (zit. A n m . 1 2 0 ) , S . i i 2 f f . - VON DER O S T E N , S . 1 7 3 . - KOERNER, S e l f - P o r t r a i t u r e (zit.
Anm. 43), S. 344ff. - SÖDING, Baidung in Freiburg (zit. Anm. 1 1 7 ) , S. 44f. - DURIAN-RESS, Baidung in Freiburg
(zit. Anm. 58), S. 182.
180 Physiognomische Häßlichkeit (als Ausdruck von Lasterhaftigkeit) sowie alle „Dinge, die mit der Fleischeslust zu-
sammenhängen, wie die Schamteile, die lüsternen Begegnungen [ . . . ] und die Gleichnisse dafür", vor allem auch
die Lüsternheit alter Männer (bei deren gleichzeitiger Impotenz) zählten - zumal in der Kunst und Kunsttheorie
der italienischen Renaissance - zum Kernbestand „angenehmer Dinge [ . . . ] , die zum Lachen bringen". - Vgl. T.
FUSENIG, Liebe, Laster und Gelächter. Komödienhafte Bilder in der italienischen Malerei im ersten Drittel des
16. Jahrhunderts, Bonn 1997, S. 32ff. (das Zitat entspricht Fusenigs Übersetzung einer Passage aus Ludovico
Castelvetros Kommentar zur aristotelischen ,Poetik' von 1567 - vgl. S. 1 9 1 , Anm. 797). - Für Gabriele Paleotti
( 1582) waren es vor allem cause [...] viziose, darunter cose [...] di ubbriachezza, welche die komische Wirkung
von Bildern hervorriefen. - Vgl. B. W. MEIJER, Esempi del comico figurativo nel rinascimento lombardo, in: Arte
Lombarda, X V I , 1 9 7 1 , S. 259-266, hier S. 260.
1 8 1 Die Deutung des Lot-Bildes als satirisch-unterhaltendes .Kunstwerk' wirft die Frage auf, ob im Umfeld Altdor-
fers eine einigermaßen klar umrissene Vorstellung von satirischer bzw. komischer Kunst, ein Bewußtsein ihrer
Inhalte und Funktionsprinzipien, ihrer bildlichen wie literarischen Traditionen und ihres (auf der Autorität der
Antike beruhenden) kunsttheoretischen Rückhalts - und damit ein weiterer Maßstab, an dem der Betrachter
Altdorfers künstlerische Leistung messen konnte - existiert hat. - Z u m genus satiricum in der nordischen bzw. zu
den komischen, speziell „komödienhaften" Bildern in der oberitalienischen Renaissancekunst (und den jeweili-
gen kunsttheoretischen Grundlagen) vgl. RAUPP, Bauernsatiren (zit. Anm. 47), vor allem S. 1 2 6 - 1 3 3 , 3 1 0 - 3 1 6
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
218 H A N N S - P A U L T I E S
Bild eine Intention bzw. Funktion zu vermuten, in deren Zentrum weniger das negative Exempel bzw. die laszive Inszenierung - sowie Warnung bzw. Stimulierung—als solche standen. Es scheint plausibel, eine Wirkungsabsicht bzw. -weise an-zunehmen, fur welche gerade die Ambivalenz zentral war - sowie die delectatio, das ,pikante', Verstand und Sinne ergreifende Spiel, zu welchem sie Anlaß gab182: In der fiktiven, dennoch täu-schend echt in Erscheinung tretenden Sphäre der ,Kunst' konnte sich der Betrachter daran ergötzen, von den ,Weiberlisten' auf die Probe
gestellt zu werden, Begehrlichkeiten zu entwik-keln und - in der Konfrontation (und Identifi-kation) mit Lot sowie mit der bedrohten Idylle des .Bildes im Bild' — als Lüstling bzw. Sünder ertappt zu werden183. Er konnte (denn möglich waren beiderlei Reaktionen) besagte Indizien beherzigen, von den Begehrlichkeiten Abstand nehmen, eventuell Vorsätze fiir das reale Leben fassen184; er konnte die Warnung aber auch erst recht als Stimulans wahrnehmen und sich - in der Fiktionalität seiner Betrachterrolle - über sie hinwegsetzen185.
bzw. FUSENIG, ebenda. - Ist es legitim, von ,Nobilitierung' zu sprechen, wenn Altdorfer (aber auch Cranach und Baidung) mit der Kategorie der Satire bzw. der Funktion der ZWrcMft'o-Qualitäten, die bislang vor allem fiir die Kleinkunst (aber auch für die ,volkstümliche' Literatur) charakteristisch waren, in das Medium der (Tafel-)Ma-lerei übertrug(en) ? - Zum Begriff der ,Nobilitierung' in Bezug auf eine Hierarchie künstlerischer Medien vgl. RAUPP, S . 6 2 , 2 9 2 . - FUSENIG, S . 1 2 0 . - KOEPPLIN, Cranach-Pr inz ip (zit. A n m . 56), vor al lem S . 1 4 4 Í
182 Der Begriff des ,Spiels' wurde bereits mehrfach, wenn auch eher am Rande, auf die ambivalenten Bilder bezogen : LÜBBEKE, Early German Painting (zit. Anm. 104), S. 208, spricht bezüglich Cranachs ,Quellnymphen' von einem „artificial game"; BONNET, Akt im Werk Cranachs (zit. Anm. 37), S. 147, in Bezug auf Cranachs mythologische Akte von einem „intellektuellen Spiel für Eingeweihte"; MAI, Faszination Venus (zit. Anm. 33), S. 230 spricht von einem „reizvollen Paradoxon, da die Verführerin [Heemskerks Venus] vor der (eigenen) Verführung warnt"; SCHOEN, Adam und Eva (zit. Anm. 44), S. 190, vom „künstlerische(n) Spiel um die Verführungskraft (der Frau [der Eva von Baidungs Sündenfall der Thyssen-Sammlung] per se und der des Bildes)"; SCHADE, Genese (zit. Anm. 120), S. 108 bzw. SÖDING, Baidung in Freiburg (zit. Anm. 117), S. 37 in Bezug auf Baidungs Hexen-darstellungen von einem „Spiel mit der Entlarvung" und dem „voyeuristischen Blick" bzw. von einem „sehr manierierten Spiel mit den Interessen und Gelüsten des Betrachters". - Bei MENSGER, Gossaert (zit. Anm. 43), S. 178, heißt es: „Die provozierte Mißachtung des moralischen Gebots scheint sogar ein beabsichtigter Faktor im pikanten Spiel einer sinnlichen Rezeption des Bildes [Gossaerts .Venus'] zu sein." - ROBERT, Wahrheit (zit. Anm. 102), hat in Bezug auf die Ambivalenz von (erotischem) Scherz und Ernst in der „jokoseriösen" Literatur von einem „ernsten Spiel" (serio ludere) bzw. von „verschiedenen Schichten" gesprochen, die sich „nicht gegenseitig ausschließen, sondern ironisch ergänzen" (S. 109). In Bezug auf Cranachs Akte meint er, sie würden weniger auf „moralische Belehrung", als auf — innerhalb des künstlerischen Diskurses, der Ambivalenz von Täuschung und Ent-Täuschung angesiedelte — „Spiele und Illusionen eines reinen Sehens und Begehrens" abzielen (S. 1 13).
183 Nicht nur Lot, sondern auch der Betrachter erscheint - da er in das Geschehen miteinbezogen ist und, als be-gehrlich Blickender, mit Lot gleichgesetzt wird - als Objekt der Satire. Mit dem Lachen des Betrachters über Lot verbindet sich das Lachen über sich selbst.
184 Falls der (christliche) Betrachter die Warnung ernst nahm und sich der Verführung von Lots Töchtern wider-setzte, so erfuhr er - analog zu dem, was Raupp als wesentliche Funktion der (,Bauern-)Satire(n') anführt - eine „Bestätigung" seines „Überlegenheitsgefühls", seiner moralischen wie sozialen Distanz gegenüber (historischen wie zeitgenössischen) Liebestoren und Juden. — Vgl. RAUPP, Bauernsatiren (zit. Anm. 47), vor allem S. 317.
185 „Sich gegen die Warnung des Bildes [gemeint sind Cranachs ,Quellnymphen'] in eben dieses Bild - respektive Abbild - zu verlieben ist die Pointe, die für den Kenner, der sich jener damals wohlbekannten Plinius-Stelle [der Episode von der Venus des Praxiteles] erinnerte, den Reiz des leicht Verruchten besaß!" - Vgl. HINZ, Cranach (zit. A n m . 1 4 7 ) , S . I 0 5 Í . - V g l . auch MENSGER, Gossaert (zit. A n m . 4 3 ) , S . 1 7 8 .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R ' 219
4. Schlußbemerkung
Altdorfers Interpretation der Lot-Geschichte hat
mit dem biblischen Text bzw. der exegetischen
Tradition nur wenig bzw. fast gar nichts gemein.
Vielmehr verdankt sie sich der (Um-) Deutung,
die der biblische Stoff in der weltlichen Literatur
erfuhr, sowie der bewußten, bildlich umgesetz-
ten Assoziation mit den Topoi von,Weiberlisten'
und .Ungleichem Paar'. Zu den Besonderheiten,
die Altdorfers Gemälde von den zeitgenössi-
schen Lot-Darstellungen unterscheiden, zählt
die Wiedergabe der Protagonisten als Aktfiguren
- eine Idee, die sich der Kenntnis des veneziani-
schen Bildschemas der .Liegenden Venus', seiner
semantischen (liegender Akt als Venus-Pose) wie
rezeptionsästhetischen Qualitäten, verdanken
dürfte. Gleichermaßen ungewöhnlich ist das
Ausmaß, in dem der Maler das satirische Poten-
tial der Geschichte ausgeschöpft und - in der
Verhäßlichung Lots, in der Metaphorik von Ast
und Flasche sowie in der Semantik des Gebets-
schals — bildlich umgesetzt hat.
Die Ambivalenz von Erotik und Moral, die -
im Fall Altdorfers - aus der Inkriminierung der
italienischen Bildmuster durch das typisch gor-
dische', negativ besetzte Thema (sowie durch
spezifische visuelle ,Codes' negativ konnotierter
Sinnlichkeit) resultiert, sowie die direkte Ein-
bindung des Betrachters (dem häufig eine spe-
zifische, problematische Rolle, z.B. jene Lots,
zugewiesen wird) erscheinen, wie eine Reihe
von Vergleichen gezeigt hat, als Charakteristi-
ken der Aktmalerei der nordischen Renaissance.
Der mutmaßliche Kontext bzw. Auftraggeber,
eine .Kunstsammlung' bzw. ein .Kunstsamm-
ler' (sowie die satirisch-komischen Elemente des
Bildes), legen - zumal in Bezug auf Altdorfers
Lot-Gemälde - eine Funktion nahe, die sich mit
den Begriffen ,Exempel zur Warnung' oder aber
.Erotikon' nur unzureichend beschreiben läßt.
Der Charakter des Bildes als ,Kunstwerk' weist
auf einen Gebrauch, der den Genuß der maleri-
schen wie erfinderischen Qualitäten ebenso in-
kludierte wie das Vergnügen an der Komik der
Schilderung bzw. die Freude an dem ,pikanten',
Verstand und Sinne ergreifendem,Spiel', zu dem
das Gemälde aufforderte - an einem ,Spiel', in
dessen Rahmen die Ambivalenz von Erotik und
Moral produktiv umgesetzt wurde.
Was bleibt, ist die Frage, wie das Interesse,
welches die Betrachter - und zwar jene Deut-
schen und Niederländer, die sich in den ersten
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts als .Kunst-
sammler' betätigten — den ambivalenten Bildern
entgegenbrachten, letztlich zu erklären ist186.
Larry Silver und Susan Smith haben vor-
geschlagen, die ambivalenten Bilder (speziell
die Graphiken des Lucas van Leyden) als „Re-
flexe"187 eines für die kulturelle Entwicklung
Europas vom 12. bis zum 16. Jahrhundert fun-
damentalen Konflikts zu deuten: Als Reflexe
des Widerspruchs, der zwischen der „celebra-
tion of love, including sexual love between man
and women" (als Ausdruck der zunehmenden
Säkularisierung und Weltbejahung) und der
„condemnation of the pleasures of the flesh" (im
Sinne der christlichen Tradition des ,contemp-
tus mundi', der Verachtung alles Irdischen) als
zweier paralleler, einander wechselseitig ,hoch-
186 Die Beantwortung dieser Frage kann wohl nur im interdisziplinären Diskurs erfolgen und müßte — in breiterem
Maße - die Literatur des Zeitraums miteinbeziehen, in welcher die Ambivalenz von Erotik und Moral, gekoppelt
mit einer Vielzahl von Rezeptionsmöglichkeiten, ebenso anzutreffen ist. Vgl. - neben ROBERT, Wahrheit (zit.
Anm. 102) - T. KLEINSPEHN, Schaulust und Scham. Zur Sexualisierung des Blicks, in: Kritische Berichte, 3,
1989 (Der nackte Mensch), S. 29-48, hier S. 32f., 37. - H.-J. BACHORSKI, Ein Diskurs von Begehren und Versa-
gen, Sexualität, Erotik und Obszönität in den Schwanksammlungen des 16. Jahrhunderts, in: DERS./H. SCIURIE
(Hg.), Eros — Macht — Askese, Geschlechterspannungen als Dialogstrukturen in Kunst und Literatur, Trier 1996,
S. 305-341, vor allem S. 305-307, 32iff .
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
220 H A N N S - P A U L T I E S
schaukelnder' Tendenzen bestand188. War der
Konflikt in der italienischen Renaissance als
einem „important aspect" bzw. .Schauplatz' des
breiteren Phänomens der Säkularisierung189
zugunsten der „celebration of love" entschie-
den worden190, lebte er nördlich der Alpen, wo
die mittelalterliche Tradition des ,contemptus
mundi' dominierte, weiter: In der für die nor-
dische Kunst charakteristischen Kombination
der ,welschen' bzw. ,antigischen', ursprünglich
positiv konnotierten Nacktheit mit Themen wie
den ,Weiberlisten'-Episoden habe, so Silver und
Smith, der - diesen Themen ohnehin imma-
nente - Widerspruch, die „oscillation [...] bet-
ween affirmation and rejection of the flesh", eine
Steigerung „to an almost unbearable level", „to a
particularly acute stage" erfahren191.
Ariane Mensger hat darauf hingewiesen, daß
das Umfeld, in dem Gossaerts ambivalente Bil-
der entstanden, deren Ambivalenz „geradezu
beispielhaft" widerspiegelte: „Das Klima am
Hof des Philipp von Burgund war auf der einen
Seite geprägt von humanistischen Ambitionen."
Andererseits herrschte „eine moralische Offen-
heit, die sich vor allem in Fragen der Sittlichkeit
zeigte". Vom Bischof selbst wird berichtet, daß
er „der Venus sehr geneigt war", „in Liebschaf-
ten zu jungen Mädchen sehr entbrannte" und
zölibatäre Enthaltsamkeit als „abscheulichste
Schande der menschlichen Natur" auffaßte192.
Es liegt nahe, die Ambivalenz der Bilder mit
den realen Ambivalenzen, welche die zeitgenös-
sische Gesellschaft kennzeichneten, zu assoziie-
ren : mit dem Konflikt zwischen sinnenfreundli-
chen und -feindlichen Tendenzen bzw. mit der
.doppelten Moral' (der Widersprüchlichkeit von
Ideal und Praxis, von leib- und sinnenfeindlicher
christlicher Ethik und freizügiger, hedonistischer
Lebensführung), welche die Lebenswirklichkeit
- speziell jener Elite, der die Auftraggeber ange-
hörten193 - bestimmte. Es ist anzunehmen, daß
die Bilder mit Betrachtern rechneten, die von je-
187 SILVER/SMITH, Carnal Knowledge (zit. ANM. 60), S. 244.
188 Ebenda, S. 266-268 (Zitate S. 267).
189 Ebenda, S. 267.
190 Für Beispiele jener „celebration" sinnlicher Liebe sowie entsprechender Kunstwerke (in Kontexten, in denen die
christliche Leibfeindlichkeit ohne Bedeutung war) vgl. - neben dem venezianischen Venus-Kult und den giorgio-
nesken Venus-Akten — die Kultur und Kunst der oberitalienischen Höfe. Für den „eroticism" als Spezifikum der
Ferrareser Hofkunst unter Al fonso I. d'Esté vgl. J. MANCA, W h a t is Ferrarese about Bellini's Feast o f the Gods?, in:
DERS. ( H g . ) , T i t i a n 500 (Studies in the History o f Art , 45), Hanover ( N H ) / L o n d o n 1993, S. 3 0 1 - 3 1 3 , vor allem
S. 304fr. — Für die Mantuaner ,Sala di Psyche', deren forciert erotische Ausmalung Federigo II. Gonzagas Liebe
zu Isabella Boschetti feiert, vgl. R. SIGNORINI, La „Fabella" di Psiche e altra Mitologia, secondo l'interpretazione
pittorica di Giul io R o m a n o nel Palazzo del Te a Mantova, Mantova 1987. - S. CAVICCHIOLI, A m o r e e Psiche,
Milano 2002, S. i i 6 f f .
191 SILVER/SMITH, Carnai Knowlegde (zit. A n m . 60), S. 2Ö7F.
192 MENSGER, Gossaert (zit. A n m . 43), S. I 2 3 Í - Vgl . auch HELD/SCHNEIDER, Sozialgeschichte (zit. A n m . 159),
S. 8 1 - 8 4 . - Joseph Leo Koerner hat gemeint, die Ambivalenzen, die Baidungs ,Hexen' - ob der simultanen
Evokation und Inkriminierung weiblicher Erotik - kennzeichnen, würden heute „rather" als „ironies o f an un-
equal society" erscheinen. Sie seien die Folgen realer Widersprüche, beispielsweise zwischen "patriarchy's dream o f
self-sovereignty and the realities o f desire, here projected misogynistically onto the bodies o f w o m e n " . KOERNER,
Self-Portraiture (zit. A n m . 43), S. 356.
193 Z u Erotik und Sexualität in der Lebenswirklichkeit Wittenbergs vgl. MATSCHE, Humanistische Ethik (zit. A n m .
103), S. 40fr. - Z u Prostitution und Konkubinat in Regensburg vgl. WOLF, Altdorfer (zit. A n m . 90), S. I 4 t f f .
- Vgl. Baidungs Wiener Hexenblatt, das als satirischer Neujahrsgruß an einen Kleriker adressiert war: „The clergy
were often satirised for their pleasure-loving and womanising lifestyle, and the drawing may be a dig by Baldung
Grien at one easily bewitched by w o m e n , yet conscious o f his o w n weakness as a sinful human being, and there-
fore capable o f receiving this rude gift with a sense of humour." GRÖSSINGER, Picturing W o m e n (zit. A n m . 79),
S. 134; vgl. auch SCHADE, Schadenzauber (zit. A n m . 120), S. 1 1 2 - 1 1 8 (Abb. 51); KOERNER, ebenda, S. 344fF.,
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54
A L B R E C H T A L T D O R F E R S , L O T U N D S E I N E T Ö C H T E R * 2 2 1
nen realen Ambivalenzen betroffen waren - mit
(männlichen) Betrachtern, welche die wider-
sprüchlichen Haltungen, von denen die Bilder
Zeugnis geben, aus eigener Erfahrung kannten :
Die zwischen Faszination und Inkriminierung
schwankende Einstellung gegenüber Körper-
lichkeit und Sexualität, die zwischen Anziehung
und Angst vor ihrer vermeintlichen Gefährlich-
keit (sowie vor der Umkehrung des Geschlech-
terordnung) changierende Haltung des Mannes
gegenüber der Frau.
Ich schlage vor, weiterzugehen, als - eher all-
gemein - von analogen Phänomenen, ,Ref lexen '
und Spiegelungen' zu sprechen : Könnte es sein,
daß das Interesse, welches ihnen die Zeitgenos-
sen entgegenbrachten, gerade darin begründet
lag, daß die Bilder (jenseits bzw. mittels ihrer je-
weiligen Sujets) eben jene realen Ambivalenzen
zum Thema machten? D a ß die Betrachter Ge-
fallen daran fanden, in der vom ethischen Dis-
kurs wie vom Lebensalltag distanzierten Sphäre
der ,Kunst(-kammer)' und, zumal im Fall des
Lot-Bildes, auf satirisch-unterhaltende Weise
mit jenen realen Ambivalenzen konfrontiert zu
werden 1 9 4 ?
sowie — fur eine alternative Deutung, die jedoch nicht überzeugt — D U R I A N - R E S S , Baidung in Freiburg (zit. Anm. 58), Kat. Nr. 39.- Ein Mann, der - vor diesem Hintergrund einmal mehr - als Besteller des Lot-Bildes in Frage kommt, ist der Regensburger Bischofsadministrator Johann III., Pfalzgraf bei Rhein (gestorben 1538), der für seinen üppigen Lebenswandel bekannt war und für den Altdorfer im Regensburger Kaiserbad (erotische Sujets) und vielleicht auch in Schloss Wörth gearbeitet hatte. - Vgl. M. A N G E R E R (Hg.), Regensburg im Mittelalter, Katalog der Abteilung Mittelalter im Museum der Stadt Regensburg, Regensburg 1995, Kat. Nr. 26.2, 26.5 (zu Johann III.). — I. B Ü C H N E R - S U C H L A N D , Hans Hieber. Ein Augsburger Baumeister der Renaissance, München 1962, S. 70-72 (zu Schloss Wörth).
194 Und, um an die Ausführungen zur Funktion des Lot-Bildes anzuknüpfen: Könnte es sein, daß das Bild bzw. das ,pikante Spiel', zu dem es aufforderte, dem Auftraggeber als Stimulans diente, alleine oder aber im Gespräch (und Gelächter) mit Gästen, denen er seine Kunstsammlung zeigte (und aus einer männlichen, misogynen Sicht), über jene realen Ambivalenzen zu reflektieren? — Für einen (hypothetischen) Vorschlag, wie ein Sammler ein .Kunst-stück' (der nordischen Renaissance) vor seinen Gästen inszeniert' haben könnte, vgl. B E L T I N G , Hieronymus Bosch (zit. Anm. 148), S. 78.
Abbildungsnachweis: Abb. 1, 6, 14: Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien. — Abb. 2: nach Caviness, Visuali-zing Women (zit. Anm. 22). -Abb. 3, 12, 15 : nach Friedländer/Rosenberg, Cranach (zit. Anm. 27). -Abb . 4: nach E. Rettich u. a., Alte Meister, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart 1992. - Abb. 5 : nach Mai, Faszination Venus (zit. Anm. 33). - Abb. 7: nach Baldass, Altdorfer (zit. Anm. 29). - Abb. 8: nach Wood, Altdorfer (zit. Anm. 5). - Abb. 9 a und b, 16: nach von der Osten, Baidung Grien (zit. Anm. 59). - Abb. 10: nach Bätschmann, Lot (zit. Anm. 10). - Abb. 1 1 , 13 : nach Grössinger, Picturing Women (zit. Anm. 79). - Abb. 17 : nach Grosshans, Heemskerk (zit. Anm. 124).
Bereitgestellt von | Bayerische StaatsbibliothekAngemeldet | 194.95.59.195
Heruntergeladen am | 21.07.14 15:54