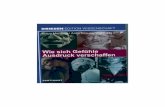Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer ...
HTBLuVA Mödling Ausbildungsschwerpunkt
HOLZTECHNIK
DIPLOMARBEIT
Bestimmung der Faserlänge und weiterer
holzanatomischer Merkmale selten genutzter
Holzarten
ausgeführt an der Höheren Technischen Bundeslehr–
und Versuchsanstalt Mödling
Abteilung Holztechnik
im Schuljahr 2015/16
durch
Katharina Tuschl
Neubaugasse 38/6
1070 Wien
Betreuer:
Dipl.-Ing. Dr. Josef Bodner
Mödling, 9. September 2016
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 2
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig
ohne fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis an-
gegebenen Quellen benutzt habe.
Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht ver-
öffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.
Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt
worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.
Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen
Prüfungsbehörde eingereicht worden.
Mödling, 9 September 2016
Katharina Tuschl
__________________________
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 3
Danksagung
Großen Dank möchte ich der BOKU für die Möglichkeit dieser Diplomarbeit, die
Proben und die offenen Rahmenbedingungen aussprechen. Im Speziellen be-
danke ich mich bei Konrad Mayer, Dr. Michael Grabner und dem Projektteam. Es
war für mich ein leichtes Arbeiten mit der Unterstützung und dem Vertrauen, das
mir entgegengebracht wurde.
Danke, Herr Professor Bodner, Herr Professor Fellner und Herr Professor Heili-
genbrunner, dass Sie mich im Rahmen des Projekts immer mit Rat und Tat, In-
formation, und Materialien unterstützt haben.
Bei meinen Klassenkollegen, die immer ein offenes Ohr für meine Sorgen und
Bedenken hatten und die mir Motivation und Denkanstöße mitgaben, bedanke
ich mich auch von Herzen. „Das ist spitze“…
Mein größter Dank geht an meine Familie, Sophie und Roman, die auf viel ge-
meinsame Zeit verzichten mussten. Sophie, nimm nicht meine Diplomarbeit als
Vorlage, es gibt sicher kürzere! Roman, danke für dein Verständnis, deine Unter-
stützung und alles andere. Du hast mindestens ein Lektorat für deine kom-
menden Arbeiten gut bei mir.
Carina, Jules, Ulli, ich danke euch für eure offenen Ohren und die anderen Sicht-
weisen, die ihr mir immer wieder aufzeigt. Es tut gut, zwischendurch Ablenkung
durch euch zu haben.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 4
Kurzfassung
Im Rahmen des Sparkling Science Projektes „Wert-Holz“ der Universität für Bo-
denkultur Wien, Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe Tulln
(BOKU), wurden in diesem Teilprojekt die Faserlängen von 16, zum Teil selten
genutzter, Holz- und Straucharten untersucht, sowie eine mikroskopische Ana-
lyse von 6 der 16 Holzarten durchgeführt.
Für die Untersuchungen wurden Proben der Nadelhölzer Douglasie
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), Tanne (Abies alba Mill.) und Thuje
(Thuja spp.) von der BOKU zur Verfügung gestellt.
Von gängigen Laubhölzern waren Esche (Fraxinus spp.), Rotbuche (Fagus syl-
vatica L.), Ahorn (Acer pseudoplatanus L.), Weide (Salix spp.) und Birne (Pyrus
spp.) vertreten.
Die meisten Holzarten, die hier untersucht wurden, waren seltene bzw. selten
genutzte Laubhölzer, wie gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris L.), blutroter
Hartriegel (Cornus sanguinea), gemeine Hasel (Corylus avellana L.), schwarzer
Holunder (Sambucus nigra L.), gewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris L.),
Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.), Sanddorn (Hippophae rhamnoides
L.) und Marille (Prunus armeniaca L.).
Im ersten Teil der Arbeit wurden die Hölzer mazeriert, d.h. durch Auflösen der
Mittellamelle der Gewebeverband u.a. in Einzelfasern aufgetrennt. Die Färbung
mit Methylenblau war notwendig, um sie für die weitere Vorgehensweise gut
sichtbar zu machen. Mit unterschiedlichen Vergrößerungen des Stereomikros-
kops (Zeiss Stemi 2000-C) wurden mithilfe der Software ZEN über eine Kamera
(Zeiss AxioCam ERc5s) Fotos der Fasern aufgenommen. Im Weiteren konnten
die Fasern mittels der open source Software „imageJ“, einem Vermessungstool
für digitalisierte Bilder, nach vorgenommener Kalibration der Fotos, in der Länge
vermessen werden.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 5
Die Ergebnisse der Faserlängenmessung wurden im Anschluss zusätzlich der
Rohdichte und der Zugfestigkeit gegenübergestellt. Es sollten eventuelle lineare
Korrelationen ermittelt werden.
Ebenso wurde ein Literaturabgleich der Faserlängen durchgeführt.
Um im zweiten Teil der Arbeit die Analyse holzanatomischer Merkmale durchfüh-
ren zu können, wurden zuerst Dauerpräparate der zu untersuchenden Holzarten
gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris L.), gemeine Hasel (Corylus avellana
L.), gewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris L.), Sanddorn (Hippophae rhamnoides
L.), Rotbuche (Fagus sylvatica L.) und Tanne (Abies alba Mill.) angefertigt.
Dafür wurden Mikroschnitte in 25 µm Dicke angefertigt. Diese Schnitte wurden
mit einer Doppelfärbung aus Safranin (rot) und Astrablau versehen, um zwischen
verholzten (rotgefärbten) und nicht verholzten (blaugefärbten) Zellen unter-
scheiden zu können. Die gefärbten Schnitte wurden abschließend mit Euparal
zwischen einem Objektträger und einem Deckglas eingebettet.
Die Analysen wurde v.a. mit dem Durchlichtmikroskop an der HTL Mödling (Nikon
Eclipse, E200) durchgeführt. Die Merkmalsausarbeitung war auf Bild-
beschreibung beschränkt. Es wurden die artentypischen Charakteristika unter-
sucht, die Holzzellen (Gefäße, Fasern, Holzstrahlen, Parenchymzellen) in ihren
Eigenschaften, Erscheinungen und Anordnungen differenziert analysiert und
beschrieben.
Die Ergebnisse wurden mit vorhandener, beschreibender Literatur abgeglichen.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 6
Abstract
This project, is a part of the „Sparcling Sciene Project“ „Wert-Holz“ conducted by
University of Natural Recources and Life Sciences Vienna, Institute of Wood
Technology and Renewable Materials Tulln (BOKU). The fiber length of 16 – in
part rarely used – wood and shrub species were analyzed. Furthermore, micro-
scopic analysis of 6 of these woods were carried out.
For this investigation samples of the following softwoods were provided by BOKU:
Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), fir (Abies alba Mill.) and thuja
(Thuja spp.)
The project scope contained following common hardwoods:
Ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus sylvatica L.), maple (Acer pseudoplatanus L.),
willow (Salix spp.)
Even rarely used hardwoods were analyzed within this diploma thesis:
Common barberry (Berberis vulgaris L.), dog-berry (Cornus sanguinea), hazel
(Corylus avellana L.), common elder (Sambucus nigra L.), syringa (Syringa vul-
garis L.), horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.), sea-buckthorn (Hippo-
phae rhamnoides L.), apricot-tree (Prunus armeniaca L.), pear-tree (Pyrus spp.).
In the first part of this project the fibers were macerated by a chemical solution
and colored with methylene blue for visibility during the next steps. Using different
magnifications under microscope (Zeiss Stemi 2000-C), for measuring photos of
the fibers were taken by a camera (Zeiss AxioCam ERc5s) and the help of the
software „ZEN“. Measurement of the fibers was performed by the software „im-
ageJ“, which is an open source program for scientific image analysis.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 7
Results of fiber length measurements were compared with bulk density (data pro-
vided by BOKU) and tensile strength (results of an associated diploma thesis).
A possible linear correlation between fiber length and bulk denisty or tensile
strength was investigated.
Comparisons with literature were conducted.
Microsections (cross, radial and tangential section), of the wood species common
barberry, hazel, syringa, sea-buckthorne, beech and fir have been made for mi-
croscopic analysis.
They were cut in a thickness of 25 µm, treated with safranin (red) and astra blue
as a double staining to be able to distinguish between lignified (red colored) and
unlignified (blue colored) cells. The cuttings were embedded in “Euparal”, a syn-
thetic resin, which bonded the microsections between the microscope slide and
the cover glass.
Analysis were performed by a transmitted light microscope, Nikon Eclips (E200),
provided at HTL Moedling.
Elaboration of specific features was restricted to image description. Therefore,
the characteristics of wood cells (vessels, fibers, rays, parenchyma), their pro-
perties, occurences and arrangements were analyzed and described.
Results of microscopic analysis were compared with existing literature.
HÖHERE TECHNISCHE BUNDES – LEHR- UND VER-SUCHSANSTALT MÖDLING
Abteilung: Ausbildungsschwerpunkt:
Holztechnik und Innenraumgestaltung Holztechnik
Katharina Tuschl Seite 8
DIPLOMARBEIT
Dokumentation
Name der Verfasser/innen Katharina Tuschl
Jahrgang / Klasse Schuljahr
4AKIHH 2015/16
Thema der Diplomarbeit Bestimmung der Faserlänge und anderer holz-anatomischer Merkmale selten genutzter Holz-arten
Kooperationspartner Universität für Bodenkultur Wien; Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe Tulln (BOKU)
Aufgabenstellung
Faserlängenmessung von 16 Holzarten, evtl. Zusammenhang mit Zugfestigkeit und Rohdichte untersuchen und Literaturabgleich Mikroanalyse von 6 der 16 Holzarten (Bild-beschreibung) und Literaturabgleich
Realisierung
Präparation der Mazerationsproben aus Zugfestigkeitsprüfkörpern; Mazeration der Fasern, Fotografie, Messung mittels Software „ImageJ“ Anfertigung Mikroschnitte (Dauerpräparate), Mikroanalyse (Bildbeschreibung) mittels mikroskopischer Untersuchung
Ergebnisse
Daten von 16 Holzarten über die Faserlänge und evtl. Zusammenhänge mit Zugfestigkeit und Rohdichte Bildbeschreibende Mikroanalyse von 6 dieser Holzarten
Typische Grafik, Foto, etc. (mit Erläuterung)
---
Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen, …
---
Möglichkeiten der Ein-sichtnahme in die Arbeit
jederzeit an der Abteilung für Holztechnik der HTBLuVA Mödling
HÖHERE TECHNISCHE BUNDES – LEHR- UND VER-SUCHSANSTALT MÖDLING
Abteilung: Ausbildungsschwerpunkt:
Holztechnik und Innenraumgestaltung Holztechnik
Katharina Tuschl Seite 9
Approbation (Datum / Unterschrift)
Prüfer/in DI Dr. Josef Bodner
Abteilungsvorstand / Direktor/in DI Dr. Josef Bodner (Abteilungsvorstand) Ing. Mag. Harald Hrdlicka (Direktor)
HÖHERE TECHNISCHE BUNDES – LEHR- UND VER-SUCHSANSTALT MÖDLING
Abteilung: Ausbildungsschwerpunkt:
Holztechnik und Innenraumgestaltung Holztechnik
Katharina Tuschl Seite 10
DIPLOMA THESIS
dokumentation
Author(s) Katharina Tuschl
Form Academic year
4AKIHH 2015/16
Topic determination of fiber length and other anatomi-cal characteristics of rarely used wood species
Cooperation Partners University of Natural Recources and Life Sci-ences Vienna, Institute of Wood Technology and Renewable Materials Tulln (BOKU)
Assignment of tasks
analyze fiber length of 16 wood species, inves-tigate possible correlations of fiber length with tensile strengh or bulk density and compare with literature microscopic analysis (image description) and comparison with literature of 6 of these wood species
Realization
preparation of samples, maceration of fibers, measurement by the software „imageJ“ durable preparations of microsections, micros-copic analysis (image description)
Results
data of 16 wood species: fiber length and their correlations between with bulk density or tensile strenght image description of anatomical features of 6 wood species
Illustrative graph, photo, … (incl. explanation)
---
Participation in competitions Awards
---
Inspection of diploma thesis An access to this diplomathesis at the technical college is possible at any time.
HÖHERE TECHNISCHE BUNDES – LEHR- UND VER-SUCHSANSTALT MÖDLING
Abteilung: Ausbildungsschwerpunkt:
Holztechnik und Innenraumgestaltung Holztechnik
Katharina Tuschl Seite 11
Approval (date / sign)
Examiner DI Dr. Josef Bodner
Head of department / Principal DI Dr. Josef Bodner (Head of department) Ing. Mag. Harald Hrdlicka (Principal)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 12
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG ............................................................................................................... 15
PROBLEMSTELLUNG ........................................................................................................... 15 ZIELSETZUNGEN ................................................................................................................ 15 ABGRENZUNG DER FRAGESTELLUNG ..................................................................................... 16 AUSBLICK ......................................................................................................................... 16
2 MATERIAL UND METHODE ......................................................................................... 17
PROBENMATERIAL ............................................................................................................. 17 2.1.1 Material der Faserlängen – Messung .................................................................... 17 2.1.2 Material der Dauerpräperate für holzanatomische Untersuchungen ................... 21 METHODE ........................................................................................................................ 25
2.2.1 Prüfungsablauf: Messung der Faserlängen ........................................................... 25 2.2.2 Untersuchung holzanatomischer Merkmale ......................................................... 28
3 ERGEBNISSE ............................................................................................................... 29
FASERLÄNGEN .................................................................................................................. 29 3.1.1 gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris L.) ....................................................... 34 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 34 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 36 3.1.2 blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) ............................................................... 37 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 37 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 39 3.1.3 gemeine Hasel (Corylus avellana L.) ...................................................................... 40 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 40 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 42 3.1.4 Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) ............................................... 43 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 43 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 45 3.1.5 Weide (Salix spp.) .................................................................................................. 46 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 46 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 48 3.1.6 schwarzer Holunder (Sambucus nigra L.) .............................................................. 49 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 49 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 51 3.1.7 gewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris L.) ............................................................. 52 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 52 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 54 3.1.8 amerikanische Thuje (Thuja spp.) .......................................................................... 55 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 55 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 57 3.1.9 Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.) ........................................................... 58 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 58 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 60 3.1.10 Sanddorn (Hippophae rhamnoides L.) ................................................................... 61 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 61
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 13
VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 63 3.1.11 Rotbuche (Fagus sylvatica L.) ................................................................................ 64 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 64 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 66 3.1.12 Ahorn (Acer pseudoplatanus L.) ............................................................................ 67 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 67 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 69 3.1.13 Tanne (Abies alba Mill.) ......................................................................................... 70 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 70 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 72 3.1.14 Marille (Prunus armeniaca L.) ............................................................................... 73 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 73 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 75 3.1.15 Esche (Fraxinus spp.) ............................................................................................. 76 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 76 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 78 3.1.16 Birne (Pyrus spp.) ................................................................................................... 79 FASERLÄNGEN ...................................................................................................................... 79 VERGLEICH ZUR LITERATUR ..................................................................................................... 81
LINEARE KORRELATIONEN MIT DER ROHDICHTE BZW. ZUGFESTIGKEIT......................................... 82 ROHDICHTE .......................................................................................................................... 82 ZUGFESTIGKEIT ..................................................................................................................... 88
ANATOMISCHE UNTERSUCHUNG DER DÜNNSCHNITTE ............................................................. 93 GLOSSAR ............................................................................................................................. 93 3.3.1 Berberitze (Berberis vulgaris L.) ............................................................................. 96 QUERSCHNITT ...................................................................................................................... 96 RADIALSCHNITT .................................................................................................................... 99 TANGENTIALSCHNITT ........................................................................................................... 101 VERGLEICH MIT DER LITERATUR ............................................................................................. 103 3.3.2 Hasel .................................................................................................................... 105 QUERSCHNITT .................................................................................................................... 105 RADIALSCHNITT .................................................................................................................. 107 TANGENTIALSCHNITT ........................................................................................................... 109 VERGLEICH MIT DER LITERATUR ............................................................................................. 112 3.3.3 Flieder (Syringa vulgaris L.) ................................................................................. 114 QUERSCHNITT .................................................................................................................... 114 RADIALSCHNITT .................................................................................................................. 117 TANGENTIALSCHNITT ........................................................................................................... 119 VERGLEICH MIT DER LITERATUR ............................................................................................. 121 3.3.4 Sanddorn ............................................................................................................. 123 QUERSCHNITT .................................................................................................................... 123 RADIALSCHNITT .................................................................................................................. 126 TANGENTIALSCHNITT ........................................................................................................... 128 VERGLEICH MIT DER LITERATUR ............................................................................................. 130 3.3.5 Rotbuche (Fagus sylvatica L.) .............................................................................. 132 QUERSCHNITT .................................................................................................................... 132 RADIALSCHNITT .................................................................................................................. 134 TANGENTIALSCHNITT ........................................................................................................... 136 VERGLEICH MIT DER LITERATUR ............................................................................................. 138
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 14
3.3.6 Tanne (Abies alba Mill.) ....................................................................................... 140 QUERSCHNITT .................................................................................................................... 140 RADIALSCHNITT .................................................................................................................. 142 TANGENTIALSCHNITT ........................................................................................................... 144 VERGLEICH MIT DER LITERATUR ............................................................................................. 146
4 DISKUSSION DER ERGEBNISSE.................................................................................... 148
FASERLÄNGEN ................................................................................................................ 148 4.1.1 Laubholz .............................................................................................................. 149 4.1.2 Nadelholz ............................................................................................................. 152 MIKROSKOPISCHE ANALYSE .............................................................................................. 153
5 ZUSAMMENFASSUNG................................................................................................ 157
SUMMARY ....................................................................................................................... 160
6 VERZEICHNISSE ......................................................................................................... 163
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ................................................................................................ 163 LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................................... 164 ABBILDUNGSVERZEICHNIS ................................................................................................. 165 GRAFIKENVERZEICHNIS ..................................................................................................... 169 TABELLENVERZEICHNIS ..................................................................................................... 170
7 ANHANG ................................................................................................................... 171
PROTOKOLLE .................................................................................................................. 171 BETREUUNGSPROTOKOLLE ................................................................................................ 174
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 15
1 EINLEITUNG
Im Rahmen des umfassenden Forschungsprojektes „Wert-Holz“ der BOKU
werden u.a. Daten z.T. selten genutzter Holzarten ermittelt und gesammelt. Im
Gesamten werden 60 Holzarten in allen ihren Eigenschaften, Bearbeitungs- und
Anwendungsmöglichkeiten untersucht.
Die Sammlung neuer bzw. aktueller Daten zu diesen Hölzern ist die Grundlage,
um eine Revitalisierung in der Anwendung zu forcieren.
Probenmaterial hierfür wurde seitens der BOKU zur Verfügung gestellt, es han-
delte sich um Hölzer, die eigens für das Projekt „Wert-Holz“ geworben und für die
einzelnen Untersuchungen speziell präpariert wurden.
Die Auswahl der zu untersuchenden Holzarten, einerseits gängige Baumarten,
andererseits auch selten bis kaum genutzte Kleinbaum- und Straucharten, wurde
für dieses Projekt in Kooperation mit der BOKU getroffen.
Problemstellung
Diese Arbeit war in zwei grundlegende Abschnitte unterteilt:
Faserlängenmessung und Abgleich mit charakteristischen Größen
bildbeschreibende Analyse holzanatomischer Merkmale
Zielsetzungen
Im ersten Teil dieser Arbeit wurden die Faserlängen von 16 Holzarten untersucht:
Probenpräparation und Mazeration des Holzes
Faserlängenmessung und Auswertung der Daten
Ergebnisvergleich / Untersuchung: mögliche lineare Korrelation zwischen
Faserlänge und der Rohdichte (gemittelte Daten bzw. direkte Ver-
gleichsdaten)
Ergebnisvergleich / Untersuchung: mögliche lineare Korrelation der
Faserlänge im direkten Vergleich mit der Zugfestigkeit derselben Probe
Ergebnisvergleich: ermittelte Faserlängen im Vergleich zur Literatur
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 16
Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde die Holzanatomie von 6 der o.a. Holzarten
mikroskopisch untersucht:
Anfertigung von Mikroschnitt - Dauerpräparaten
Mikroanalyse und Bildbeschreibung
Ergebnisvergleich: Mikroanalyse im Vergleich zur Literatur
Abgrenzung der Fragestellung
Nicht Teil dieses Projektes war, die Fasern in Früh- und Spätholz zu separieren
und getrennt zu vermessen. Nicht Ziel war, andere Holzzellen, wie zB. Gefäße,
zu vermessen.
Nicht im Projektumfang beinhaltet war, eine mikroskopische Analyse der Fasern
durchzuführen und den prozentuellen Faseranteil in der Holzgrundmasse zu un-
tersuchen.
Es wurden keine komplexen statistischen Auswertungen durchgeführt.
Nicht Teil der Aufgabenstellung der Mikroanalyse war, quantitative Messungen
an den Mikroschnitten vorzunehmen.
Ausblick
Offene Punkte, die als sinnvolle Ergänzungen zu den Ergebnissen oder als ei-
genständige Daten in weiteren Arbeiten u.U. untersucht werden könnten:
Mikroskopische Untersuchungen der Fasern
Anteile der Fasern an Grundmassen
Vermessung von anderen Holzzellen, u.a. in Mikroanalyse
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 17
2 MATERIAL UND METHODE
Probenmaterial
2.1.1 Material der Faserlängen – Messung
Um Fasern für die Mazeration, zu erhalten, wurden geprüfte Zugfestig-
keitsprüfkörper folgendermaßen präpariert:
Die Bruchstelle wurde vom Prüfkörper der Zugproben mit einer Bandsäge
abgetrennt. Aus dem Bruch wurden mit einem kleinen Stemmeisen etwa streich-
holzdicke, maximal 1cm lange Holzstücke entnommen, die in verschließbare
Eprouvetten gefüllt wurden. Die Beschriftung der Proben erfolgte analog der
Nummerierung des Gesamtprojektes:
Holzart . Individuum . Wiederholung
(zB. 05.10.8 Berberitze, 10. Individuum, 8. Wiederholung)
Das Projekt umfasste 16 Holzarten. Pro Holzart wurden aus den Zugfestigkeits-
Prüfkörper zufällig 3 Proben für diese Untersuchung ausgewählt.
Die Basis für die Faserlängen waren 48 Proben.
Mazeriert wurde nach Anleitung Schweingruber (Schweingruber & Gärtner, 2013):
Die präparierten Faserstücke wurden je Probe mit 50 ml Mazerationslösung in
einem Erlenmeyerkolben auf einer Heizplatte gekocht. Waren die Fasern voll-
ständig ausgebleicht, weiß und noch im Stück vorhanden, etwa nach 4-8 Stunden
Kochzeit, war das Holz ausreichend mazeriert und konnte für die nächsten
Schritte weiter behandelt werden.
Die chemische Lösung hierfür war eine Mischung, im Verhältnis 1:1:1, aus des-
tilliertem Wasser (H2O) : Wasserstoffperoxid (H2O2) : Essigsäure (CH3COOH),
diese wurde der Einfachheit halber immer für eine Holzart (á 3 Proben) gemischt.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 18
Abbildung 1: Holzpräparate in Eprouvetten Abbildung 2: Holzpräparate in Erlen-meyerkolben
Abbildung 3: Becherglas mit 50 ml der ferti-gen Mazerationslösung
Abbildung 4: Kochvorgang
Abbildung 5: mazeriertes Holz
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 19
Nach dem Abkühlen wurden die Fasern mit einer Pinzette dem Erlenmeyerkol-
ben vorsichtig entnommen und in eine verschließbare Eprouvette gefüllt. Um das
Chemikaliengemisch möglichst vollständig aus den Fasern zu waschen, wurden
diese bis zu 5 Mal mit etwa 20ml destilliertem Wasser gut gespült Anschließend
wurden die Fasern mit destilliertem Wasser bedeckt und einem Tropfen Methy-
lenblau gefärbt. Die Färbung war relevant für die bessere Sichtbarkeit der Fasern.
Abbildung 6: mazerierte Fasern während der Färbung
Abbildung 7: Arbeitsplatz Färbung und Spülung
Nach etwa 10 - 15 Minuten Einwirkzeit wurde die Farblösung wieder vorsichtig
abpipettiert und mit Wasser sooft gespült, bis die Flüssigkeit klar blieb. Die Eprou-
vetten mit nunmehr blau gefärbten Fasern wurden Ethanol – um Schimmelbil-
dung vorzubeugen – bedeckt. Mit einem Gummipfropfen fest verschlossen,
wurden die Fasern in der Eprouvette zu einem feinen Faserpulp verschüttelt und
danach mit passendem Schraubverschluss wieder gut verschlossen. Die Proben
waren fertig präpariert.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 20
Abbildung 8: Fasern in Färbelösung Abbildung 9: nach erster Spülung
Abbildung 10: fertig gespülte Fasern Abbildung 11: Faserpulp
Anschließend wurden die Fasern mittels Pipette oder Pinzette auf einen Ob-
jektträger aufgebracht, mit einem Tropfen Wasser gleichmäßig verteilt, und mit
einem großen Deckglas bedeckt. Es wurden für dieses Projekt keine Dauer-
präparate der Fasern hergestellt.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 21
2.1.2 Material der Dauerpräperate für holzanatomische Untersuchungen
Das Probenmaterial wurde von der BOKU zur Verfügung gestellt, die
Mikroschnitte wurden ebendort angefertigt. Aus den 16 Holzarten dieses Pro-
jektes wurden folgende 6 Arten für die Mikroanalyse ausgewählt:
Berberitze (Berberis vulgaris L.)
Hasel (Corylus avellana L.)
Flieder (Syringa vulgaris L.)
Sanddorn (Hippophae rhamnoides L.)
Rotbuche (Fagus sylvatica L.)
Tanne (Abies alba Mill.)
Die Bearbeitung des Holzes für Mikroschnitte erfolgte im Vorfeld, durchgeführt
von der BOKU. Es wurden Proben in den Dimensionen (B x H x L) 10 x 10 x 20
mm in einer Lösung, bestehend aus Wasser : Glycerin : Alkohol (60%), im Ver-
hältnis 1:1:1, eingelegt und im Exikkator mit einigen Zyklen Vakuum imprägniert.
Somit waren die Proben ausreichend behandelt bzw. langfristig erweicht, um
saubere Mikroschnitte anfertigen zu können.
Für die Anfertigung der Dauerpräparate wurden die Proben am Mikrotomschlitten
in 25 µm dicke Scheiben geschnitten. Von jeder Holzart wurden Schnitte in drei
Richtungen angefertigt: Quer-, Radial- und Tangentialschnitt. Es wurde darauf
geachtet, dass die Schnitte möglichst exakt in einer Ebene lagen, um Feinheiten
in der Untersuchung besser erkennen zu können. Dies wurde mit Abtragung
einiger Millimeter der Oberfläche und einer sehr präzisen und geraden Schnitt-
führung unter einem Schneidenwinkel von 9,5° erreicht.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 22
Die Schnitte wurden anschließend mit Safranin (rot) und Astrablau einer Dop-
pelfärbung (Gerlach, 1984) unterzogen. Die fertig gefärbten und mit Alkohol
entwässerten Mikroschnitte wurden mit Euparal, einem Kunstharz, zwischen
einem Objektträger und einem Deckglas eingebettet. Mit kleinen Metallzylindern
beschwert wurden die Dauerpräparate im Darrschrank bei 40°C ca. 24 – 48
Stunden getrocknet bzw. das Harz gehärtet.
Abbildung 12: Mikrotomschlitten Abbildung 13: Mikrotomschlitten mit Holzprobe und Mehrwegschneide
Abbildung 14: Färbestation
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 23
Für jeden Schritt der Doppelfärbung waren etwa 2 Minuten vorgesehen. Als „Puff-
erzone“ konnten Wasserlagerungen und die letzten, mehrstufigen Alkohollager-
ungen genutzt werden.
Alle notwendigen chemischen Lösungen waren wasserbasierend.
Bei einer Doppelfärbung färbte das Safranin die verholzten Zellen, das Astrablau
legte sich an lebenden, nicht verholzten Zellen an. Somit konnte unter dem
Mikroskop rasch zwischen diesen Zellarten differenziert werden.
Die Doppelfärbung wurde nach folgendem Ablauf durchgeführt:
Wasserlagerung – Auswaschen
Safranin – Rotfärbung der verholzten (lignifizierten) Zellen
Wasserlagerung
Differenzierungslösung – Entfernung von überschüssigem Farbstoff
Wasserlagerung
Astrablau – Blaufärbung der nicht lignifizierten Zellen
Wasserlagerung
Alkohol (60%) – Entzug von Wasser aus den Zellen
Alkohol (96%)
Alkohol (100%)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 24
Abbildung 15: frische, ungefärbte Schnitte Abbildung 16: Schnitte nach der Rotfär-bung
Abbildung 17: gewaschene Schnitte nach der Blaufärbung
Abbildung 18: fertige Dauerpräparate vor der Trocknung
Die Differenzierungslösung wurde als Zwischenschritt eingeführt, um nicht ver-
holzte Zellen vom roten Farbstoff zu entfärben. Die Differenziallösung bestand
aus 0,5 ml konzentrierter Salzsäure (HCl) in 70%igem Alkohol.
Der 100%ige Alkohol wurde erreicht, indem 96%igen Alkohol Kupfersulfat
zugefügt geworden ist, um dem Alkohol das restliche Wasser zu entziehen. Die
Nutzung von 100%igem Alkohol war bis zur Grünfärbung des Kupfersulfats
möglich, danach konnte jenes kein Wasser mehr aufnehmen.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 25
Methode
2.2.1 Prüfungsablauf: Messung der Faserlängen
Für die Messungen mussten Bilder der Fasern digitalisiert werden. Dazu wurden
Fasern mittels Pipette und / oder Pinzette der Eprouvette mit Fiberpulp entnom-
men. Die wenigen Fasern wurden auf einem gläsernen Objektträger aufgebracht,
mit einem Tropfen Wasser gleichmäßig darauf verteilt und mit einer großen,
dünnen Deckplatte fixiert.
Mit verschiedenen Vergrößerungen des Stereomikroskops (Zeiss Stemi 2000-C;
Zoomfaktoren 0,65 – 5,0-fach) konnten mithilfe die Software „ZEN” über die Ka-
mera (Zeiss AxioCam ERc5s) digitale Aufnahmen der Fasern erfolgen. Der
Zoomfaktor war sowohl für das Fotografieren als auch für die nachfolgende
Messung relevant. Derselbe Faktor wurde auch im Messprogramm für die Kali-
brierung herangezogen. Für die Skalierung diente ein Feinlineal, eine mikros-
kopische Skala, die im selben Zoomfaktor jeder Faserprobe fotografiert wurde.
(Abb. 19, 20)
Abbildung 19: Feinlineal 0,65-fach Zoom Abbildung 20: Feinlineal 5,0-fach Zoom
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 26
Die Messungen erfolgten mithilfe der open source Software „imageJ“, einem Ver-
messungstool für digitalisierte Bilder. In diesem Programm war es möglich, aus
segmentierten Längen die Fasern nachzuzeichnen und anhand derer zu vermes-
sen. Vorab wurde das Feinlineal im selben Faktor, mit dem auch das Bild aufge-
nommen wurde, in Millimeter vermessen und diese Länge als globale Maßgröße
voreingestellt.
Abbildung 21: Einstellung der globalen Maßgröße
Die Messungen wurden in mm durchgeführt und ausgewertet. In den Ergebnis-
sen und Diskussionen wurden Vergleiche u. U. auch in µm angeführt, da in
einigen Fällen Literatur in Mikrometer vorhanden war.
1 mm = 1.000 µm
(1 Millimeter = 1.000 Mikrometer)
Für dieses Projekt war ausschließlich eine Längenmessung relevant, andere
Maße einer Faser wurden nicht ermittelt.
Je Probe sollten mindestens 30 Fasern per Zufallsprinzip vermessen werden. Die
Messungen wurden im Programm in Listenform gespeichert und konnten ab-
schließend als Excel-File abgespeichert werden.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 27
Abbildung 22: Beispielbild Längenmes-sung der Fasern
Abbildung 23: Faserbild Nadelholz: Tanne, Probe Nr. 58.99.12; 1,25 x
Abbildung 24: Faserbild Laubholz: Sand-dorn, Probe Nr. 55.0.4; 2,5 x
Abbildung 25: Gefäße () und andere Holzzellen wurden nicht vermessen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 28
2.2.2 Untersuchung holzanatomischer Merkmale
Untersucht wurden die Dauerpräparate v.a. unter dem Durchlichtmikroskop Ni-
kon Eclipse (E200), mit dem Vergrößerungen 40-, 100-, 400- und 1.000-fach
möglich waren. Es wurden wenige Untersuchungen auch mit einem Olympus
Mikroskop (U-PMTVC) durchgeführt, mit welchem Vergrößerungen 40-, 100-,
200- und 400-fach möglich waren.
Die Untersuchung charakteristischer Merkmale erfolgte jeweils in radialer und
tangentialer Richtung sowie am Querschnitt. Gegenstand der Analyse waren der
anatomische Aufbau (Fasern, Gefäße, Holzstrahlen, Parenchym), Anordnung
und Struktur der Zellen und Einordnung nach Zugehörigkeiten (Nadel- /
Laubhölzer).
Die Merkmale der Holzarten wurden mit unterschiedlicher, ähnlich
beschreibender Literatur abgeglichen und eventuelle Abweichungen zu den
Ergebnissen der durchgeführten Analyse dokumentiert.
Die Bilder wurden mit einer externen Kamera durch ein Okular des Mikroskops
aufgenommen.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 29
3 ERGEBNISSE
Faserlängen
Fasern, oft auch als Grundgewebe bezeichnet, sind axial ausgerichtete, lang-
gestreckte Zellen, die bei Nadel- und Laubholz unterschiedliche Rollen inneha-
ben.
Nadelhölzer haben einen Faseranteil von rund 90-95%. Die Fasern sind als Tra-
cheiden ausgebildet und übernehmen die Leitungs- und Stützfunktion.
Laubholz ist komplexer und aus mehreren Zellarten aufgebaut. Die Fasern, als
Libriformfasern und Fasertracheiden ausgebildet, nehmen etwa 50-75% der
Holzsubstanz ein. Sie übernehmen vor allem die Stützfunktion.
Libriformfasern, die Hauptfaserart der Laubhölzer, bilden das Fasergrundge-
webe.
Fasertracheiden sind eine Übergangsform und nicht bei allen Holzarten auftre-
tend bzw. nur als Teil des Fasergewebes.
Selten sind bei Laubhölzern auch Gefäßtracheiden ausgebildet. Sie sind kürzer
und übernehmen Leitungsfunktionen.
Um einen möglichen linearen Zusammenhang mit charakteristischen Größen zu
erkennen, wurden die ermittelten Faserlängen wie folgt untersucht:
Vergleich mit der Rohdichte
Gemittelte Werte der Faserlängen wurden den gemittelten Rohdichtedaten
gegenübergestellt. Der Abgleich erfolgte je Individuum. Die Daten der Rohdichte
wurden von der BOKU zur Verfügung gestellt.
Vergleich mit der Zugfestigkeit
Daten der Zugfestigkeit derselben Prüfkörper wurden den ermittelten
Faserlängen direkt gegenübergestellt.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 30
Die Untersuchung beschränkte sich auf einen möglichen linearen Zusammen-
hang, andere statistische Abgleiche wurden hier nicht ausgewertet und / oder
berücksichtigt.
Ein linearer Zusammenhang galt in dieser Untersuchung bei einem Korre-
lationskoeffizienten nach Pearson (r) von mindestens 0,85 als gegeben.
Die ermittelten Zahlen wurden bei der Gegenüberstellung auf 2 Dezimalstellen
mathematisch gerundet, um den Vergleich mit der Literatur zu vereinfachen.
Bereichswerte der hier gemessenen Fasern wurden als Minimum – Maximum
angegeben.
Literaturwerte wurden nicht bei allen eindeutig als Minimum – Maximumg aus-
gewiesen. Die amerikanischen Daten wurden als durchschnittliche Länge aus-
gewiesen, die Literaturdaten der Douglasie als Minimum – Maximum. Die Art der
Angaben europäischer Daten waren einerseits Mittelwerte, andererseits
Bereichswerte (nicht genauer definiert).
Im Allgemeinen konnte festgestellt werden, dass die Fasern der Nadelhölzer,
Tracheiden, länger waren, als die Fasertracheiden bzw. Libriformfasern der
Laubhölzer.
Die Gesamtergebnisse konnten, wie folgt, grafisch festgehalten werden:
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 31
Grafik 1: Ergebnisse Faserlängen aller Holzarten
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 32
Grafik 2: Ergebnisse Faserlängen aller Laubholzarten
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 33
Grafik 3: Ergebnisse Faserlängen aller Nadelholzarten
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 34
3.1.1 gewöhnliche Berberitze (Berberis vulgaris L.)
Faserlängen
Tabelle 1: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Berberitze
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
5.10.6 1 0,452 5.10.8 1 0,270 5.13.11 1 0,267
5.10.6 2 0,380 5.10.8 2 0,366 5.13.11 2 0,477
5.10.6 3 0,423 5.10.8 3 0,473 5.13.11 3 0,466
5.10.6 4 0,368 5.10.8 4 0,305 5.13.11 4 0,414
5.10.6 5 0,465 5.10.8 5 0,319 5.13.11 5 0,408
5.10.6 6 0,471 5.10.8 6 0,301 5.13.11 6 0,407
5.10.6 7 0,576 5.10.8 7 0,303 5.13.11 7 0,417
5.10.6 8 0,446 5.10.8 8 0,398 5.13.11 8 0,515
5.10.6 9 0,450 5.10.8 9 0,375 5.13.11 9 0,399
5.10.6 10 0,479 5.10.8 10 0,402 5.13.11 10 0,424
5.10.6 11 0,430 5.10.8 11 0,464 5.13.11 11 0,479
5.10.6 12 0,439 5.10.8 12 0,351 5.13.11 12 0,424
5.10.6 13 0,430 5.10.8 13 0,305 5.13.11 13 0,349
5.10.6 14 0,338 5.10.8 14 0,386 5.13.11 14 0,449
5.10.6 15 0,331 5.10.8 15 0,320 5.13.11 15 0,439
5.10.6 16 0,445 5.10.8 16 0,400 5.13.11 16 0,519
5.10.6 17 0,472 5.10.8 17 0,453 5.13.11 17 0,475
5.10.6 18 0,431 5.10.8 18 0,425 5.13.11 18 0,439
5.10.6 19 0,483 5.10.8 19 0,535 5.13.11 19 0,470
5.10.6 20 0,360 5.10.8 20 0,446 5.13.11 20 0,455
5.10.6 21 0,405 5.10.8 21 0,418 5.13.11 21 0,440
5.10.6 22 0,409 5.10.8 22 0,366 5.13.11 22 0,361
5.10.6 23 0,381 5.10.8 23 0,472 5.13.11 23 0,518
5.10.6 24 0,480 5.10.8 24 0,447 5.13.11 24 0,478
5.10.6 25 0,417 5.10.8 25 0,401 5.13.11 25 0,466
5.10.6 26 0,442 5.10.8 26 0,386 5.13.11 26 0,464
5.10.6 27 0,427 5.10.8 27 0,477 5.13.11 27 0,438
5.10.6 28 0,402 5.10.8 28 0,437 5.13.11 28 0,695
5.10.6 29 0,478 5.10.8 29 0,437 5.13.11 29 0,477
5.10.6 30 0,431 5.10.8 30 0,387 5.13.11 30 0,412
5.10.6 31 0,484 5.10.8 31 0,533 5.13.11 31 0,394
MW 0,433 MW 0,399 MW 0,446
STABW 0,050 STABW 0,068 STABW 0,069
v 0,115 v 0,172 v 0,156
Faserlängen des Berberitze Individuums 5.10. im Mittel 0,40 mm und 0,43mm.
Faserlänge des Individuums 5.13. im Mittel 0,45 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 35
Tabelle 2: Datenauswertung Fasern Berberitze
5.10.6 5.10.8 5.13.11
MIN 0,331 0,270 0,267
MW 0,433 0,399 0,446
MAX 0,576 0,535 0,695
Kürzeste Faser des Individuums 5.10. 0,27 mm, längste Faser 0,58 mm.
Kürzeste Faser des Individuums 5.13 0,27 mm, längste Faser 0,70 mm.
Längenbereich der Berberitze – Fasern somit 0,27 mm – 0,70 mm.
Mittelwerte bei 0,40mm – 0,45 mm (0,43 mm).
Grafik 4: Faserlängen gewöhnliche Berberitze
5.10.6 5.13.11 5.10.8
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 36
Vergleich zur Literatur
Derzeit keine europäische Literatur vorhanden.
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016) :
durchschnittliche Faserlängen der Gattung Berberis:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,30 – 0,75 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,27 – 0,70 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 37
3.1.2 blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Faserlängen
Tabelle 3: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen blutroter Hartriegel
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
11.0.2 1 1,221 11.0.3 1 1,475 11.4.9 1 1,440
11.0.2 2 1,391 11.0.3 2 1,177 11.4.9 2 1,341
11.0.2 3 1,362 11.0.3 3 1,406 11.4.9 3 1,207
11.0.2 4 1,007 11.0.3 4 1,152 11.4.9 4 0,974
11.0.2 5 1,410 11.0.3 5 1,068 11.4.9 5 0,954
11.0.2 6 1,118 11.0.3 6 1,090 11.4.9 6 1,147
11.0.2 7 1,236 11.0.3 7 1,093 11.4.9 7 1,188
11.0.2 8 1,253 11.0.3 8 1,058 11.4.9 8 1,055
11.0.2 9 1,357 11.0.3 9 0,862 11.4.9 9 1,267
11.0.2 10 1,447 11.0.3 10 1,513 11.4.9 10 1,003
11.0.2 11 1,496 11.0.3 11 1,364 11.4.9 11 0,994
11.0.2 12 1,315 11.0.3 12 0,981 11.4.9 12 1,198
11.0.2 13 1,301 11.0.3 13 1,334 11.4.9 13 1,338
11.0.2 14 1,108 11.0.3 14 1,333 11.4.9 14 1,309
11.0.2 15 1,004 11.0.3 15 1,047 11.4.9 15 0,938
11.0.2 16 1,249 11.0.3 16 1,348 11.4.9 16 1,324
11.0.2 17 1,276 11.0.3 17 0,983 11.4.9 17 0,933
11.0.2 18 1,142 11.0.3 18 1,433 11.4.9 18 1,201
11.0.2 19 1,105 11.0.3 19 1,111 11.4.9 19 1,358
11.0.2 20 1,027 11.0.3 20 0,842 11.4.9 20 1,238
11.0.2 21 0,737 11.0.3 21 1,213 11.4.9 21 1,015
11.0.2 22 0,891 11.0.3 22 1,454 11.4.9 22 1,259
11.0.2 23 1,022 11.0.3 23 1,165 11.4.9 23 1,330
11.0.2 24 1,195 11.0.3 24 1,004 11.4.9 24 1,074
11.0.2 25 1,317 11.0.3 25 1,298 11.4.9 25 1,092
11.0.2 26 1,162 11.0.3 26 1,422 11.4.9 26 1,124
11.0.2 27 1,885 11.0.3 27 1,191 11.4.9 27 1,289
11.0.2 28 1,715 11.0.3 28 1,319 11.4.9 28 1,566
11.0.2 29 1,247 11.0.3 29 1,251 11.4.9 29 1,211
11.0.2 30 1,225 11.0.3 30 1,378 11.4.9 30 1,168
11.0.2 31 1,337 11.0.3 31 1,178 11.4.9 31 0,948
MW 1,244 MW 1,211 MW 1,177
STABW 0,224 STABW 0,182 STABW 0,162
v 0,180 v 0,150 v 0,138
Faserlängen des Hartriegel Individuums 11.0. im Mittel 1,21 mm und 1,24 mm.
Faserlänge des Individuums 11.4. im Mittel 1,18 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 38
Tabelle 4: Datenauswertung Fasern Hartriegel
11.0.2 11.0.3 11.4.9
MIN 0,737 0,842 0,933
MW 1,244 1,211 1,177
MAX 1,885 1,513 1,566
1
Kürzeste Faser des Individuums 11.0. 0,74 mm, längste Faser 1,89 mm.
Kürzeste Faser des Individuums 11.4. 0,93 mm, die längste Faser 1,57 mm.
Der Längenbereich der Hartriegel – Fasern somit 0,74 mm – 1,89 mm.
Mittelwerte bei 1,18 mm – 1,24 mm (1,21 mm).
Grafik 5: Faserlängen blutroter Hartriegel
11.0.2 11.4.9 11.0.3
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 39
Vergleich zur Literatur
Derzeit keine europäische Literatur vorhanden.
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Faserlängen Cornus sanguinea:
Bereichswerte InsideWood.: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 740 – 1.890 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
durchschnittliche Faserlängen der Gattung Cornus:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,80 – 2,20 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,74 – 1,89 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 40
3.1.3 gemeine Hasel (Corylus avellana L.)
Faserlängen
Tabelle 5: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Hasel
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
12.0.3 1 0,991 12.0.6 1 0,842 12.0.7 1 1,213
12.0.3 2 1,036 12.0.6 2 0,802 12.0.7 2 1,000
12.0.3 3 1,213 12.0.6 3 0,917 12.0.7 3 0,820
12.0.3 4 1,062 12.0.6 4 0,917 12.0.7 4 0,989
12.0.3 5 1,431 12.0.6 5 0,981 12.0.7 5 1,165
12.0.3 6 1,222 12.0.6 6 0,964 12.0.7 6 0,809
12.0.3 7 1,100 12.0.6 7 1,175 12.0.7 7 1,060
12.0.3 8 0,743 12.0.6 8 1,027 12.0.7 8 0,842
12.0.3 9 1,294 12.0.6 9 1,156 12.0.7 9 0,892
12.0.3 10 1,234 12.0.6 10 1,198 12.0.7 10 1,161
12.0.3 11 1,130 12.0.6 11 0,947 12.0.7 11 0,489
12.0.3 12 1,310 12.0.6 12 1,117 12.0.7 12 0,776
12.0.3 13 1,174 12.0.6 13 0,877 12.0.7 13 0,631
12.0.3 14 0,944 12.0.6 14 1,062 12.0.7 14 0,804
12.0.3 15 0,957 12.0.6 15 1,129 12.0.7 15 1,288
12.0.3 16 1,188 12.0.6 16 0,867 12.0.7 16 0,956
12.0.3 17 0,999 12.0.6 17 0,922 12.0.7 17 0,964
12.0.3 18 1,240 12.0.6 18 0,871 12.0.7 18 1,167
12.0.3 19 0,972 12.0.6 19 0,973 12.0.7 19 1,015
12.0.3 20 1,156 12.0.6 20 0,876 12.0.7 20 0,705
12.0.3 21 0,873 12.0.6 21 0,763 12.0.7 21 0,979
12.0.3 22 1,197 12.0.6 22 1,079 12.0.7 22 0,957
12.0.3 23 1,022 12.0.6 23 1,006 12.0.7 23 0,931
12.0.3 24 0,952 12.0.6 24 1,018 12.0.7 24 1,287
12.0.3 25 1,072 12.0.6 25 1,163 12.0.7 25 0,931
12.0.3 26 1,349 12.0.6 26 1,428 12.0.7 26 0,837
12.0.3 27 1,211 12.0.6 27 0,929 12.0.7 27 0,813
12.0.3 28 1,485 12.0.6 28 1,095 12.0.7 28 1,036
12.0.3 29 1,169 12.0.6 29 1,001 12.0.7 29 1,071
12.0.3 30 1,196 12.0.6 30 0,987 12.0.7 30 1,076
12.0.3 31 1,288 12.0.6 31 1,108 12.0.7 31 1,038
MW 1,136 MW 1,006 MW 0,958
STABW 0,165 STABW 0,139 STABW 0,183
v 0,145 v 0,138 v 0,191
Faserlängen des Hasel Individuums 12.0 im Mittel 0,96 mm bis 1,14 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 41
Tabelle 6: Datenauswertung Fasern Hasel
12.0.3 12.0.6 12.0.7
MIN 0,743 0,763 0,489
MW 1,136 1,006 0,958
MAX 1,485 1,428 1,288
Kürzeste Faser 0,49 mm, längste Faser 1,49 mm.
Der Längenbereich der Hasel – Fasern sohin 0,49 mm – 1,49 mm.
Mittelwerte bei 0,96 mm – 1,14 mm (1,03 mm).
Grafik 6: Faserlängen gemeine Hasel
11.0.2 11.4.9 11.0.3
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 42
Vergleich zur Literatur
Derzeit keine europäische Literatur vorhanden.
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016)
und amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A.
Western Wood Reference Collection Archive:, 2016):
Bereichswerte Literatur.: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 490 – 1.490 µm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 43
3.1.4 Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Faserlängen
Tabelle 7: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Douglasie
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
33.0.6 1 2,612 33.0.10 1 2,116 33.0.12 1 1,989
33.0.6 2 2,862 33.0.10 2 2,106 33.0.12 2 2,188
33.0.6 3 2,623 33.0.10 3 1,473 33.0.12 3 2,480
33.0.6 4 2,849 33.0.10 4 2,567 33.0.12 4 2,257
33.0.6 5 2,602 33.0.10 5 2,455 33.0.12 5 2,935
33.0.6 6 2,261 33.0.10 6 1,582 33.0.12 6 2,494
33.0.6 7 2,154 33.0.10 7 1,722 33.0.12 7 1,975
33.0.6 8 2,170 33.0.10 8 3,317 33.0.12 8 2,280
33.0.6 9 1,946 33.0.10 9 2,299 33.0.12 9 2,026
33.0.6 10 2,287 33.0.10 10 2,476 33.0.12 10 2,217
33.0.6 11 2,382 33.0.10 11 2,273 33.0.12 11 2,069
33.0.6 12 2,179 33.0.10 12 2,213 33.0.12 12 2,417
33.0.6 13 2,071 33.0.10 13 2,761 33.0.12 13 2,139
33.0.6 14 2,825 33.0.10 14 2,477 33.0.12 14 1,909
33.0.6 15 2,038 33.0.10 15 2,184 33.0.12 15 2,190
33.0.6 16 3,003 33.0.10 16 2,068 33.0.12 16 2,500
33.0.6 17 2,971 33.0.10 17 1,754 33.0.12 17 2,432
33.0.6 18 2,684 33.0.10 18 2,677 33.0.12 18 2,570
33.0.6 19 2,487 33.0.10 19 2,725 33.0.12 19 2,255
33.0.6 20 2,430 33.0.10 20 2,485 33.0.12 20 2,680
33.0.6 21 2,398 33.0.10 21 2,882 33.0.12 21 2,248
33.0.6 22 2,226 33.0.10 22 1,617 33.0.12 22 2,792
33.0.6 23 2,730 33.0.10 23 1,628 33.0.12 23 2,185
33.0.6 24 2,969 33.0.10 24 2,467 33.0.12 24 2,321
33.0.6 25 2,978 33.0.10 25 1,963 33.0.12 25 2,346
33.0.6 26 2,089 33.0.10 26 2,995 33.0.12 26 2,064
33.0.6 27 1,951 33.0.10 27 2,898 33.0.12 27 1,868
33.0.6 28 2,307 33.0.10 28 2,312 33.0.12 28 1,922
33.0.6 29 2,176 33.0.10 29 2,363 33.0.12 29 2,276
33.0.6 30 2,171 33.0.10 30 1,834 33.0.12 30 2,392
33.0.6 31 2,398 33.0.10 31 1,802 33.0.12 31 2,264
MW 2,446 MW 2,274 MW 2,280
STABW 0,331 STABW 0,463 STABW 0,255
v 0,135 v 0,204 v 0,112
Faserlängen des Douglasie Individuums 33.0. im Mittel 2,27 mm bis 2,45 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 44
Tabelle 8: Datenauswertung Fasern Douglasie
33.0.6 33.0.10 33.0.12
MIN 1,946 1,473 1,868
MW 2,446 2,274 2,280
MAX 3,003 3,317 2,935
Kürzeste Faser 1,47 mm, längste Faser 3,32 mm.
Längenbereich der Douglasie – Fasern somit 1,47 mm – 3,32 mm.
Mittelwerte bei 2,27 mm – 2,45 mm (2,33 mm).
Grafik 7: Faserlängen Douglasie
33.0.6 33.0.12 33.0.10
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 45
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 2.500 – 5.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 1.470 – 3.320 µm
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Bereichswerte Fiber Atlas: 1,70 – 7,00 mm
ermittelte Bereichswerte: 1,47 – 3,32 mm
Mittelwert Fiber Atlas: 3,9 mm
ermittelte Mittelwerte: 2,3 mm
Amerikanische Literatur Oregon State University, Master Thesis (Bodner, 1983):
Bereichswerte Bodner, FH: 2,25 – 3,80 mm
Bereichswerte Bodner, SH 3,30 – 4,40 mm
ermittelte Bereichswerte: 1,47 – 3,32 mm
Mittelwerte Bodner (FH – SH) 3,20 – 3,90 mm
ermittelte Mittelwerte: 2,27 – 2,45 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 46
3.1.5 Weide (Salix spp.)
Faserlängen
Tabelle 9: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Weide
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
39.0.1 1 1,159 39.0.3 1 1,071 39.0.7 1 1,159
39.0.1 2 0,971 39.0.3 2 1,186 39.0.7 2 1,618
39.0.1 3 1,106 39.0.3 3 0,975 39.0.7 3 0,978
39.0.1 4 1,841 39.0.3 4 0,951 39.0.7 4 0,880
39.0.1 5 2,211 39.0.3 5 1,026 39.0.7 5 0,842
39.0.1 6 1,115 39.0.3 6 1,254 39.0.7 6 0,859
39.0.1 7 1,008 39.0.3 7 1,108 39.0.7 7 0,878
39.0.1 8 1,166 39.0.3 8 1,121 39.0.7 8 1,210
39.0.1 9 1,214 39.0.3 9 1,051 39.0.7 9 1,205
39.0.1 10 0,913 39.0.3 10 1,088 39.0.7 10 0,834
39.0.1 11 1,211 39.0.3 11 1,147 39.0.7 11 1,104
39.0.1 12 1,093 39.0.3 12 1,187 39.0.7 12 1,046
39.0.1 13 0,866 39.0.3 13 1,005 39.0.7 13 1,019
39.0.1 14 0,996 39.0.3 14 1,406 39.0.7 14 0,562
39.0.1 15 0,860 39.0.3 15 1,142 39.0.7 15 1,185
39.0.1 16 1,051 39.0.3 16 1,270 39.0.7 16 0,986
39.0.1 17 0,975 39.0.3 17 1,233 39.0.7 17 0,738
39.0.1 18 1,007 39.0.3 18 1,022 39.0.7 18 0,881
39.0.1 19 0,933 39.0.3 19 1,204 39.0.7 19 1,041
39.0.1 20 0,944 39.0.3 20 1,205 39.0.7 20 1,016
39.0.1 21 0,958 39.0.3 21 1,007 39.0.7 21 0,923
39.0.1 22 1,204 39.0.3 22 0,853 39.0.7 22 0,948
39.0.1 23 1,035 39.0.3 23 0,999 39.0.7 23 1,032
39.0.1 24 1,311 39.0.3 24 0,954 39.0.7 24 0,587
39.0.1 25 1,213 39.0.3 25 1,038 39.0.7 25 0,862
39.0.1 26 1,118 39.0.3 26 1,106 39.0.7 26 0,960
39.0.1 27 1,207 39.0.3 27 0,971 39.0.7 27 1,085
39.0.1 28 1,113 39.0.3 28 1,071 39.0.7 28 0,903
39.0.1 29 0,967 39.0.3 29 1,272 39.0.7 29 0,785
39.0.1 30 1,175 39.0.3 30 1,443 39.0.7 30 1,049
39.0.1 31 1,072 39.0.3 31 1,250 39.0.7 31 0,995
MW 1,129 MW 1,117 MW 0,973
STABW 0,270 STABW 0,135 STABW 0,197
v 0,239 v 0,121 v 0,202
Faserlängen des Weide Individuums 39.0. im Mittel 0,97 bis 1,13 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 47
Tabelle 10: Datenauswertung Fasern Weide
39.0.1 39.0.3 39.0.7
MIN 0,860 0,853 0,562
MW 1,129 1,117 0,973
MAX 2,211 1,443 1,618
Kürzeste Faser 0,56 mm, längste Faser 2,21 mm.
Faserlängenbereich der Gattung Weide somit 0,56 mm – 2,21 mm.
Mittelwerte bei 0,97 mm – 1,13 mm (1,0,7 mm).
Grafik 8: Faserlängen Weide
39.0.7 39.0.3 39.0.1
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 48
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 830 – 1.300 µm
ermittelte Bereichswerte: 560 – 2.210 µm
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Mittelwert Fiber Atlas: 1,1 mm
ermittelter Mittelwert: 1,1 mm
Amerikanischen online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 560 – 2.210 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
Bereichswerte Cecilia A.: 0,90 – 1,30 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,56 – 2,21 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 49
3.1.6 schwarzer Holunder (Sambucus nigra L.)
Faserlängen
Tabelle 11: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Holunder
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
41.0.1 1 0,685 41.0.3 1 0,906 41.0.9 1 1,118
41.0.1 2 0,876 41.0.3 2 0,758 41.0.9 2 1,011
41.0.1 3 0,874 41.0.3 3 0,992 41.0.9 3 1,158
41.0.1 4 0,536 41.0.3 4 1,041 41.0.9 4 0,998
41.0.1 5 1,213 41.0.3 5 1,168 41.0.9 5 1,329
41.0.1 6 0,906 41.0.3 6 0,916 41.0.9 6 0,875
41.0.1 7 0,639 41.0.3 7 1,094 41.0.9 7 0,825
41.0.1 8 1,031 41.0.3 8 0,820 41.0.9 8 0,931
41.0.1 9 0,781 41.0.3 9 0,751 41.0.9 9 1,165
41.0.1 10 0,948 41.0.3 10 0,959 41.0.9 10 0,706
41.0.1 11 0,631 41.0.3 11 0,672 41.0.9 11 1,019
41.0.1 12 1,136 41.0.3 12 0,841 41.0.9 12 0,926
41.0.1 13 0,979 41.0.3 13 1,002 41.0.9 13 1,373
41.0.1 14 1,087 41.0.3 14 0,896 41.0.9 14 0,819
41.0.1 15 1,018 41.0.3 15 0,706 41.0.9 15 0,933
41.0.1 16 1,391 41.0.3 16 0,878 41.0.9 16 0,897
41.0.1 17 0,903 41.0.3 17 0,909 41.0.9 17 0,746
41.0.1 18 0,860 41.0.3 18 0,852 41.0.9 18 1,032
41.0.1 19 0,794 41.0.3 19 0,932 41.0.9 19 0,887
41.0.1 20 0,989 41.0.3 20 0,815 41.0.9 20 1,374
41.0.1 21 1,089 41.0.3 21 0,790 41.0.9 21 1,051
41.0.1 22 1,242 41.0.3 22 0,747 41.0.9 22 1,066
41.0.1 23 1,100 41.0.3 23 0,739 41.0.9 23 1,037
41.0.1 24 1,215 41.0.3 24 0,882 41.0.9 24 0,828
41.0.1 25 0,908 41.0.3 25 0,803 41.0.9 25 1,022
41.0.1 26 1,328 41.0.3 26 1,112 41.0.9 26 1,092
41.0.1 27 0,831 41.0.3 27 0,674 41.0.9 27 1,160
41.0.1 28 0,868 41.0.3 28 0,611 41.0.9 28 0,849
41.0.1 29 0,919 41.0.3 29 0,856 41.0.9 29 1,016
41.0.1 30 1,029 41.0.3 30 0,598 41.0.9 30 0,689
41.0.1 31 0,850 41.0.3 31 0,981 41.0.9 31 1,041
MW 0,957 MW 0,861 MW 0,999
STABW 0,202 STABW 0,142 STABW 0,175
v 0,211 v 0,165 v 0,175
Faserlängen des Holunder Individuums 41.0. im Mittel 0,86 mm bis 1,00 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 50
Tabelle 12: Datenauswertung Fasern Holunder
41.0.1 41.0.3 41.0.9
MIN 0,536 0,598 0,689
MW 0,957 0,861 0,999
MAX 1,391 1,168 1,374
Kürzeste Faser des Holunders 0,54 mm, längste Faser 1,39 mm.
Längenbereich der Holunder – Fasern somit 0,54 mm – 1,39 mm.
Mittelwerte bei 0,86 mm – 1,00 mm (0,94 mm).
Grafik 9: Faserlängen schwarzer Holunder
41.0.1 41.0.3 41.0.9
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 51
Vergleich zur Literatur
Derzeit keine europäische Literatur vorhanden.
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Durchschnittliche Längenangaben Sambucus spp.:
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 540 – 1.390 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
Durchschnittliche Längenangaben Sambucus spp.:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,80 – 1,80 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,54 – 1,39 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 52
3.1.7 gewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris L.)
Faserlängen
Tabelle 13: Gesamtergebnisse der Faserlängenmessungen Flieder
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
47.7.1 1 0,488 47.7.3 1 0,712 47.8.5 1 0,629
47.7.1 2 0,533 47.7.3 2 0,647 47.8.5 2 0,549
47.7.1 3 0,417 47.7.3 3 0,732 47.8.5 3 0,640
47.7.1 4 0,580 47.7.3 4 0,767 47.8.5 4 0,604
47.7.1 5 0,546 47.7.3 5 0,515 47.8.5 5 0,613
47.7.1 6 0,633 47.7.3 6 0,557 47.8.5 6 0,654
47.7.1 7 0,746 47.7.3 7 0,701 47.8.5 7 0,537
47.7.1 8 0,552 47.7.3 8 0,548 47.8.5 8 0,593
47.7.1 9 0,680 47.7.3 9 0,714 47.8.5 9 0,521
47.7.1 10 0,620 47.7.3 10 0,581 47.8.5 10 0,514
47.7.1 11 0,433 47.7.3 11 0,620 47.8.5 11 0,697
47.7.1 12 0,433 47.7.3 12 0,777 47.8.5 12 0,600
47.7.1 13 0,603 47.7.3 13 0,703 47.8.5 13 0,701
47.7.1 14 0,517 47.7.3 14 0,327 47.8.5 14 0,832
47.7.1 15 0,555 47.7.3 15 0,564 47.8.5 15 0,550
47.7.1 16 0,521 47.7.3 16 0,530 47.8.5 16 0,523
47.7.1 17 0,550 47.7.3 17 0,438 47.8.5 17 0,724
47.7.1 18 0,590 47.7.3 18 0,521 47.8.5 18 0,595
47.7.1 19 0,633 47.7.3 19 0,658 47.8.5 19 0,393
47.7.1 20 0,595 47.7.3 20 0,453 47.8.5 20 0,794
47.7.1 21 0,660 47.7.3 21 0,501 47.8.5 21 0,505
47.7.1 22 0,618 47.7.3 22 0,587 47.8.5 22 0,634
47.7.1 23 0,558 47.7.3 23 0,678 47.8.5 23 0,317
47.7.1 24 0,515 47.7.3 24 0,618 47.8.5 24 0,525
47.7.1 25 0,742 47.7.3 25 0,508 47.8.5 25 0,664
47.7.1 26 0,608 47.7.3 26 0,433 47.8.5 26 0,645
47.7.1 27 0,730 47.7.3 27 0,710 47.8.5 27 0,616
47.7.1 28 0,646 47.7.3 28 0,620 47.8.5 28 0,537
47.7.1 29 0,664 47.7.3 29 0,467 47.8.5 29 0,668
47.7.1 30 0,686 47.7.3 30 0,647 47.8.5 30 0,553
47.7.1 31 0,662 47.7.3 31 0,484 47.8.5 31 0,286
MW 0,591 MW 0,591 MW 0,588
STABW 0,087 STABW 0,111 STABW 0,117
v 0,147 v 0,188 v 0,199
Faserlängen der Flieder Individuen 47.7. und 47.8. im Mittel 0,59 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 53
Tabelle 14: Datenauswertung Fasern Flieder
47.7.1 47.7.3 47.8.5
MIN 0,417 0,327 0,286
MW 0,591 0,591 0,588
MAX 0,746 0,777 0,832
Kürzeste Faser des Individuums 47.7 0,33 mm, längste Faser 0,78 mm.
Kürzeste Faser des Individuums 47.8. 0,29 mm, längste Faser 0,83 mm.
Der Längenbereich der Flieder – Fasern somit 0,29 mm – 0,83 mm.
Mittelwert Faserlängen Flieder 0,59 mm.
Grafik 10: Faserlängen gewöhnlicher Flieder
47.7.1 47.8.5 47.7.3
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 54
Vergleich zur Literatur
Derzeit keine europäische Literatur vorhanden.
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 290 – 830 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
durchschnittliche Faserlängen Syringa spp.:.
Bereichswerte Cecilia A.: 0,80 – 1,45 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,29 – 0,83 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 55
3.1.8 amerikanische Thuje (Thuja spp.)
Faserlängen
Tabelle 15: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Thuje
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge [mm]
49.0.5 1 1,066 49.0.6 1 1,978 49.0.12 1 1,976
49.0.5 2 1,650 49.0.6 2 1,732 49.0.12 2 2,399
49.0.5 3 1,473 49.0.6 3 2,073 49.0.12 3 1,942
49.0.5 4 1,468 49.0.6 4 2,474 49.0.12 4 2,283
49.0.5 5 1,010 49.0.6 5 1,468 49.0.12 5 1,781
49.0.5 6 1,668 49.0.6 6 2,166 49.0.12 6 1,521
49.0.5 7 1,735 49.0.6 7 1,958 49.0.12 7 2,169
49.0.5 8 1,477 49.0.6 8 2,154 49.0.12 8 1,831
49.0.5 9 1,945 49.0.6 9 2,643 49.0.12 9 1,747
49.0.5 10 1,647 49.0.6 10 2,127 49.0.12 10 2,518
49.0.5 11 1,060 49.0.6 11 1,665 49.0.12 11 0,801
49.0.5 12 1,728 49.0.6 12 1,906 49.0.12 12 1,255
49.0.5 13 1,344 49.0.6 13 2,815 49.0.12 13 2,215
49.0.5 14 1,464 49.0.6 14 1,619 49.0.12 14 2,326
49.0.5 15 1,595 49.0.6 15 1,796 49.0.12 15 3,584
49.0.5 16 1,784 49.0.6 16 2,456 49.0.12 16 2,358
49.0.5 17 0,992 49.0.6 17 2,226 49.0.12 17 2,470
49.0.5 18 1,548 49.0.6 18 1,825 49.0.12 18 3,035
49.0.5 19 1,562 49.0.6 19 1,575 49.0.12 19 2,016
49.0.5 20 1,637 49.0.6 20 1,865 49.0.12 20 2,192
49.0.5 21 1,489 49.0.6 21 1,889 49.0.12 21 2,496
49.0.5 22 1,333 49.0.6 22 2,452 49.0.12 22 1,626
49.0.5 23 1,208 49.0.6 23 1,800 49.0.12 23 2,059
49.0.5 24 1,089 49.0.6 24 1,542 49.0.12 24 2,137
49.0.5 25 1,652 49.0.6 25 2,079 49.0.12 25 1,814
49.0.5 26 1,566 49.0.6 26 1,600 49.0.12 26 2,038
49.0.5 27 1,495 49.0.6 27 2,116 49.0.12 27 1,927
49.0.5 28 1,750 49.0.6 28 1,653 49.0.12 28 2,002
49.0.5 29 1,729 49.0.6 29 2,095 49.0.12 29 2,618
49.0.5 30 1,754 49.0.6 30 2,100 49.0.12 30 2,476
49.0.5 31 1,697 49.0.6 31 1,766 49.0.12 31 1,753
MW 1,504 MW 1,988 MW 2,109
STABW 0,253 STABW 0,335 STABW 0,509
v 0,169 v 0,168 v 0,241
Faserlängen des Thuje Individuums 49.0. im Mittel 1,50 mm bis 2,10 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 56
Tabelle 16: Datenauswertung Fasern Thuje
49.0.5 49.0.6 49.0.12
MIN 0,992 1,468 0,801
MW 1,504 1,988 2,109
MAX 1,945 2,815 3,584
Kürzeste Faser 0,80 mm, längste Faser 3,58 mm.
Faserlängenbereich der Gattung Thuje somit 0,80 mm – 3,58 mm.
Mittelwerte bei 1,50 mm – 2,11 mm (1,87 mm).
Grafik 11: Faserlängen amerikanische Thuje
49.0.5 49.0.12 49.0.6
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 57
Vergleich zur Literatur
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Faserlängen der Thuja plicata:
Bereichswerte Fiber Atlas: 1,40 – 5,90 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,80 – 3,58 mm
Mittelwert Fiber Atlas: 3,5 mm
ermittelte Mittelwerte: 1,9 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 58
3.1.9 Rosskastanie (Aesculus hippocastanum L.)
Faserlängen
Tabelle 17: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Rosskastanie
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
52.3.5 1 0,960 52.3.7 1 0,704 52.3.11 1 0,792
52.3.5 2 0,661 52.3.7 2 0,761 52.3.11 2 0,670
52.3.5 3 0,796 52.3.7 3 0,556 52.3.11 3 0,809
52.3.5 4 0,608 52.3.7 4 0,463 52.3.11 4 0,672
52.3.5 5 0,727 52.3.7 5 0,786 52.3.11 5 0,669
52.3.5 6 0,745 52.3.7 6 0,668 52.3.11 6 0,680
52.3.5 7 0,657 52.3.7 7 0,583 52.3.11 7 0,686
52.3.5 8 0,567 52.3.7 8 0,841 52.3.11 8 0,782
52.3.5 9 0,800 52.3.7 9 0,523 52.3.11 9 0,954
52.3.5 10 0,658 52.3.7 10 0,764 52.3.11 10 0,746
52.3.5 11 0,729 52.3.7 11 0,706 52.3.11 11 0,727
52.3.5 12 0,747 52.3.7 12 0,917 52.3.11 12 0,521
52.3.5 13 0,812 52.3.7 13 0,743 52.3.11 13 0,720
52.3.5 14 0,718 52.3.7 14 0,555 52.3.11 14 0,843
52.3.5 15 0,817 52.3.7 15 0,591 52.3.11 15 0,852
52.3.5 16 0,855 52.3.7 16 0,495 52.3.11 16 0,816
52.3.5 17 0,851 52.3.7 17 0,573 52.3.11 17 0,771
52.3.5 18 0,859 52.3.7 18 0,772 52.3.11 18 0,675
52.3.5 19 0,780 52.3.7 19 0,652 52.3.11 19 0,786
52.3.5 20 0,515 52.3.7 20 0,733 52.3.11 20 0,508
52.3.5 21 0,860 52.3.7 21 0,932 52.3.11 21 0,663
52.3.5 22 0,773 52.3.7 22 0,713 52.3.11 22 0,681
52.3.5 23 0,476 52.3.7 23 0,545 52.3.11 23 0,804
52.3.5 24 0,795 52.3.7 24 0,987 52.3.11 24 0,748
52.3.5 25 0,659 52.3.7 25 0,692 52.3.11 25 0,763
52.3.5 26 0,584 52.3.7 26 0,720 52.3.11 26 0,695
52.3.5 27 0,709 52.3.7 27 0,709 52.3.11 27 0,717
52.3.5 28 0,762 52.3.7 28 0,755 52.3.11 28 0,602
52.3.5 29 0,774 52.3.7 29 0,744 52.3.11 29 0,764
52.3.5 30 0,610 52.3.7 30 0,659 52.3.11 30 0,665
52.3.5 31 0,565 52.3.7 31 0,770 52.3.11 31 0,820
MW 0,724 MW 0,697 MW 0,729
STABW 0,114 STABW 0,126 STABW 0,093
v 0,157 v 0,181 v 0,128
Faserlängen des Rosskastanie Individuums 52.3. im Mittel 0,70 mm bis 0,73 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 59
Tabelle 18: Datenauswertung Fasern Rosskastanie
52.3.5 52.3.7 52.3.11
MIN 0,476 0,463 0,508
MW 0,724 0,697 0,729
MAX 0,960 0,987 0,954
Kürzeste Faser 0,46 mm, längste Faser 0,99 mm.
Längenbereich der Rosskastanie – Fasern somit 0,46 mm – 0,99 mm.
Mittelwerte bei 0,70 mm – 0,73 mm (0,72 mm).
Grafik 12: Faserlängen Rosskastanie
52.3.5 52.3.11 52.3.7
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 60
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 640 – 1.660 µm
ermittelte Bereichswerte: 460 – 990 µm
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 460 – 990 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
Bereichswerte Cecilia A.: 0,60 – 0,90 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,46 – 0,99 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 61
3.1.10 Sanddorn (Hippophae rhamnoides L.)
Faserlängen
Tabelle 19: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Sanddorn
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
55.0.4 1 0,702 55.2.6 1 0,623 55.6.12 1 0,666
55.0.4 2 0,583 55.2.6 2 0,693 55.6.12 2 0,657
55.0.4 3 0,650 55.2.6 3 0,492 55.6.12 3 0,787
55.0.4 4 0,634 55.2.6 4 0,607 55.6.12 4 0,491
55.0.4 5 0,626 55.2.6 5 0,579 55.6.12 5 0,601
55.0.4 6 0,696 55.2.6 6 0,807 55.6.12 6 0,538
55.0.4 7 0,493 55.2.6 7 0,762 55.6.12 7 0,713
55.0.4 8 0,698 55.2.6 8 0,440 55.6.12 8 0,393
55.0.4 9 0,619 55.2.6 9 0,788 55.6.12 9 0,447
55.0.4 10 0,295 55.2.6 10 0,594 55.6.12 10 0,453
55.0.4 11 0,747 55.2.6 11 0,538 55.6.12 11 0,647
55.0.4 12 0,707 55.2.6 12 0,640 55.6.12 12 0,583
55.0.4 13 0,566 55.2.6 13 0,688 55.6.12 13 0,620
55.0.4 14 0,437 55.2.6 14 0,693 55.6.12 14 0,581
55.0.4 15 0,625 55.2.6 15 0,603 55.6.12 15 0,698
55.0.4 16 0,572 55.2.6 16 0,492 55.6.12 16 0,601
55.0.4 17 0,500 55.2.6 17 0,592 55.6.12 17 0,570
55.0.4 18 0,646 55.2.6 18 0,616 55.6.12 18 0,924
55.0.4 19 0,630 55.2.6 19 0,308 55.6.12 19 0,603
55.0.4 20 0,620 55.2.6 20 0,702 55.6.12 20 0,777
55.0.4 21 0,525 55.2.6 21 0,506 55.6.12 21 0,590
55.0.4 22 0,651 55.2.6 22 0,417 55.6.12 22 0,535
55.0.4 23 0,683 55.2.6 23 0,618 55.6.12 23 0,612
55.0.4 24 0,611 55.2.6 24 0,620 55.6.12 24 0,644
55.0.4 25 0,605 55.2.6 25 0,528 55.6.12 25 0,563
55.0.4 26 0,567 55.2.6 26 0,830 55.6.12 26 0,784
55.0.4 27 0,685 55.2.6 27 0,647 55.6.12 27 0,660
55.0.4 28 0,566 55.2.6 28 0,556 55.6.12 28 0,753
55.0.4 29 0,561 55.2.6 29 0,565 55.6.12 29 0,587
55.0.4 30 0,650 55.2.6 30 0,572 55.6.12 30 0,784
55.0.4 31 0,580 55.2.6 31 0,709 55.6.12 31 0,578
MW 0,604 MW 0,607 MW 0,627
STABW 0,090 STABW 0,115 STABW 0,114
v 0,149 v 0,190 v 0,182
Faserlänge des Individuums 55.0. im Mittel 0,60 mm, des Individuums 55.2. im
Mittel 0,61 mm und des Individuums 55.6. 0,63 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 62
Tabelle 20: Datenauswertung Fasern Sanddorn
55.0.4 55.2.6 55.6.12
MIN 0,295 0,308 0,393
MW 0,604 0,607 0,627
MAX 0,747 0,830 0,924
Kürzeste Faser des Sanddorns 0,30 mm, längste Faser 0,92 mm.
Faserlängenbereich des Sanddorns somit 0,30 mm – 0,92 mm.
Mittelwerte bei 0,60 mm – 0,63 mm (0,61 mm).
Grafik 13: Faserlängen Sanddorn
55.0.4 55.6.12 55.2.6
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 63
Vergleich zur Literatur
Derzeit keine europäische Literatur vorhanden.
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 300 – 920 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
durchschnittliche Faserlängen Hippophae spp.:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,50 – 0,90 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,30 – 0,92 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 64
3.1.11 Rotbuche (Fagus sylvatica L.)
Faserlängen
Tabelle 21: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Rotbuche
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
56.0.1 1 0,756 56.0.8 1 1,100 56.0.11 1 1,245
56.0.1 2 0,837 56.0.8 2 1,034 56.0.11 2 0,954
56.0.1 3 1,279 56.0.8 3 1,356 56.0.11 3 1,165
56.0.1 4 1,231 56.0.8 4 1,550 56.0.11 4 1,162
56.0.1 5 1,391 56.0.8 5 1,792 56.0.11 5 1,099
56.0.1 6 0,793 56.0.8 6 1,461 56.0.11 6 0,847
56.0.1 7 0,744 56.0.8 7 1,702 56.0.11 7 0,949
56.0.1 8 1,398 56.0.8 8 1,537 56.0.11 8 1,616
56.0.1 9 1,159 56.0.8 9 1,545 56.0.11 9 1,386
56.0.1 10 1,120 56.0.8 10 1,226 56.0.11 10 1,193
56.0.1 11 1,024 56.0.8 11 1,394 56.0.11 11 1,452
56.0.1 12 1,145 56.0.8 12 1,567 56.0.11 12 1,108
56.0.1 13 0,956 56.0.8 13 1,320 56.0.11 13 0,789
56.0.1 14 1,228 56.0.8 14 1,312 56.0.11 14 1,311
56.0.1 15 0,986 56.0.8 15 1,360 56.0.11 15 1,034
56.0.1 16 0,764 56.0.8 16 1,275 56.0.11 16 0,964
56.0.1 17 0,980 56.0.8 17 1,464 56.0.11 17 0,663
56.0.1 18 0,896 56.0.8 18 1,497 56.0.11 18 0,757
56.0.1 19 1,022 56.0.8 19 1,565 56.0.11 19 1,407
56.0.1 20 1,180 56.0.8 20 1,621 56.0.11 20 1,197
56.0.1 21 1,021 56.0.8 21 1,293 56.0.11 21 1,000
56.0.1 22 0,814 56.0.8 22 1,692 56.0.11 22 0,947
56.0.1 23 0,874 56.0.8 23 1,687 56.0.11 23 0,998
56.0.1 24 1,283 56.0.8 24 1,327 56.0.11 24 1,211
56.0.1 25 0,807 56.0.8 25 1,498 56.0.11 25 0,860
56.0.1 26 0,995 56.0.8 26 1,281 56.0.11 26 1,379
56.0.1 27 1,218 56.0.8 27 1,550 56.0.11 27 0,937
56.0.1 28 1,382 56.0.8 28 1,429 56.0.11 28 0,768
56.0.1 29 0,915 56.0.8 29 1,299 56.0.11 29 0,833
56.0.1 30 1,354 56.0.8 30 1,669 56.0.11 30 1,184
56.0.1 31 1,026 56.0.8 31 1,534 56.0.11 31 1,031
MW 1,051 MW 1,450 MW 1,079
STABW 0,205 STABW 0,180 STABW 0,230
v 0,196 v 0,124 v 0,214
Faserlängen der Rotbuche Individuen 56.0. im Mittel 1,05 mm bis 1,45 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 65
Tabelle 22: Datenauswertung Fasern Rotbuche
56.0.1 56.0.8 56.0.11
MIN 0,744 1,034 0,663
MW 1,051 1,450 1,079
MAX 1,398 1,792 1,616
Kürzeste Faser 0,66 mm, längste Faser 1,79 mm.
Faserlängenbereich der Rotbuche somit 0,66 mm – 1,79 mm.
Mittelwerte bei 1,05 mm – 1,45 mm (1,19 mm).
Grafik 14: Faserlängen Rotbuche
56.0.1 56.0.11 56.0.8
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 66
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 600 – 1.300 µm
ermittelte Bereichswerte: 660 – 1.790 µm
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Bereichswerte Fiber Atlas: 0,50 – 1,70 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,66 – 1,79 mm
Mittelwert Fiber Atlas: 1,2 mm
ermittelte Mittelwerte: 1,2 mm
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 660 – 1.790 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
durchschnittliche Faserlängen Fagus spp.:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,75 – 1,75 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,66 – 1,79 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 67
3.1.12 Ahorn (Acer pseudoplatanus L.)
Faserlängen
Tabelle 23: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Ahorn
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
57.0.5 1 1,032 57.0.10 1 0,827 57.0.12 1 0,887
57.0.5 2 1,067 57.0.10 2 0,929 57.0.12 2 0,893
57.0.5 3 0,997 57.0.10 3 0,821 57.0.12 3 0,809
57.0.5 4 0,923 57.0.10 4 0,959 57.0.12 4 0,572
57.0.5 5 1,033 57.0.10 5 0,905 57.0.12 5 0,849
57.0.5 6 0,725 57.0.10 6 0,841 57.0.12 6 0,759
57.0.5 7 0,824 57.0.10 7 0,932 57.0.12 7 0,582
57.0.5 8 0,746 57.0.10 8 0,742 57.0.12 8 0,786
57.0.5 9 0,811 57.0.10 9 1,097 57.0.12 9 0,999
57.0.5 10 0,880 57.0.10 10 0,818 57.0.12 10 0,989
57.0.5 11 0,885 57.0.10 11 0,823 57.0.12 11 0,958
57.0.5 12 0,860 57.0.10 12 0,988 57.0.12 12 0,865
57.0.5 13 0,985 57.0.10 13 1,075 57.0.12 13 0,833
57.0.5 14 0,806 57.0.10 14 0,966 57.0.12 14 0,876
57.0.5 15 0,760 57.0.10 15 0,697 57.0.12 15 0,948
57.0.5 16 0,875 57.0.10 16 0,796 57.0.12 16 1,074
57.0.5 17 0,850 57.0.10 17 0,925 57.0.12 17 0,819
57.0.5 18 0,765 57.0.10 18 0,871 57.0.12 18 0,966
57.0.5 19 0,739 57.0.10 19 0,962 57.0.12 19 1,020
57.0.5 20 1,033 57.0.10 20 0,819 57.0.12 20 0,840
57.0.5 21 0,968 57.0.10 21 0,977 57.0.12 21 1,114
57.0.5 22 0,714 57.0.10 22 0,909 57.0.12 22 0,931
57.0.5 23 0,807 57.0.10 23 0,876 57.0.12 23 0,883
57.0.5 24 0,889 57.0.10 24 0,854 57.0.12 24 0,821
57.0.5 25 0,977 57.0.10 25 0,864 57.0.12 25 0,925
57.0.5 26 0,962 57.0.10 26 0,965 57.0.12 26 0,793
57.0.5 27 1,015 57.0.10 27 0,880 57.0.12 27 0,735
57.0.5 28 0,851 57.0.10 28 0,906 57.0.12 28 0,842
57.0.5 29 0,908 57.0.10 29 1,037 57.0.12 29 0,909
57.0.5 30 0,798 57.0.10 30 1,003 57.0.12 30 0,972
57.0.5 31 0,680 57.0.10 31 0,880 57.0.12 31 0,832
MW 0,876 MW 0,901 MW 0,874
STABW 0,109 STABW 0,091 STABW 0,119
v 0,125 v 0,101 v 0,136
Faserlängen der Ahorn Individuen 57.0. im Mittel 0,87 mm bis 0,90 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 68
Tabelle 24: Datenauswertung Fasern Ahorn
57.0.5 57.0.10 57.0.12
MIN 0,680 0,697 0,572
MW 0,876 0,901 0,874
MAX 1,067 1,097 1,114
Kürzeste Faser 0,57 mm, längste Faser 1,11 mm.
Faserlängenbereich der Gattung Ahorn somit 0,57 mm – 1,11 mm.
Mittelwerte bei 0,87 mm – 0,90 mm (0,88 mm).
Grafik 15: Faserlängen Ahorn
57.0.5 57.0.12 57.0.10
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 69
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 670 – 1.080 µm
ermittelte Bereichswerte: 570 – 1.110 µm
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Mittelwert Fiber Atlas: 0,70 – 1,10 mm
ermittelte Mittelwerte: 0,87 – 0,90 mm
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 570 – 1.110 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
Bereichswerte Cecilia A.: 0,60 – 0,90 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,56 – 1,11 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 70
3.1.13 Tanne (Abies alba Mill.)
Faserlängen
Tabelle 25: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Tanne
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
58.99.6 1 3,446 58.99.11 1 3,601 58.99.12 1 3,695
58.99.6 2 2,521 58.99.11 2 2,615 58.99.12 2 4,886
58.99.6 3 3,289 58.99.11 3 2,641 58.99.12 3 3,803
58.99.6 4 3,679 58.99.11 4 2,967 58.99.12 4 3,865
58.99.6 5 4,613 58.99.11 5 2,940 58.99.12 5 4,128
58.99.6 6 3,692 58.99.11 6 3,762 58.99.12 6 3,762
58.99.6 7 3,893 58.99.11 7 3,123 58.99.12 7 4,754
58.99.6 8 3,405 58.99.11 8 3,971 58.99.12 8 3,009
58.99.6 9 3,438 58.99.11 9 2,808 58.99.12 9 3,786
58.99.6 10 4,050 58.99.11 10 4,542 58.99.12 10 3,747
58.99.6 11 3,791 58.99.11 11 2,904 58.99.12 11 3,537
58.99.6 12 2,954 58.99.11 12 3,527 58.99.12 12 3,614
58.99.6 13 3,067 58.99.11 13 3,083 58.99.12 13 5,105
58.99.6 14 4,709 58.99.11 14 4,029 58.99.12 14 5,114
58.99.6 15 4,691 58.99.11 15 2,388 58.99.12 15 4,466
58.99.6 16 3,134 58.99.11 16 3,566 58.99.12 16 4,770
58.99.6 17 2,073 58.99.11 17 3,166 58.99.12 17 4,207
58.99.6 18 3,022 58.99.11 18 3,352 58.99.12 18 4,894
58.99.6 19 3,738 58.99.11 19 3,280 58.99.12 19 3,576
58.99.6 20 3,377 58.99.11 20 2,447 58.99.12 20 5,034
58.99.6 21 3,221 58.99.11 21 3,364 58.99.12 21 4,398
58.99.6 22 4,488 58.99.11 22 3,198 58.99.12 22 4,749
58.99.6 23 3,783 58.99.11 23 1,781 58.99.12 23 4,264
58.99.6 24 3,304 58.99.11 24 3,155 58.99.12 24 4,321
58.99.6 25 3,245 58.99.11 25 2,281 58.99.12 25 3,683
58.99.6 26 2,635 58.99.11 26 3,042 58.99.12 26 4,410
58.99.6 27 4,551 58.99.11 27 4,024 58.99.12 27 4,329
58.99.6 28 3,708 58.99.11 28 4,181 58.99.12 28 4,780
58.99.6 29 2,668 58.99.11 29 3,134 58.99.12 29 4,337
58.99.6 30 3,034 58.99.11 30 5,055 58.99.12 30 4,809
58.99.6 31 3,424 58.99.11 31 3,485 58.99.12 31 3,537
MW 3,505 MW 3,271 MW 4,238
STABW 0,652 STABW 0,684 STABW 0,563
v 0,186 v 0,209 v 0,133
Faserlängen der Tanne Individuen 58.99. im Mittel 3,27 mm bis 4,24 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 71
Tabelle 26: Datenauswertung Fasern Tanne
58.99.6 58.99.11 58.99.12
MIN 2,073 1,781 3,009
MW 3,505 3,271 4,238
MAX 4,709 5,055 5,114
Kürzeste Faserlänge der Tanne 1,78 mm, längste Faser 5,11 mm.
Faserlängenbereich der Tanne somit 1,78 mm – 5,11 mm.
Mittelwerte bei 3,27 mm – 4,24 mm (3,67 mm).
Grafik 16: Faserlängen Tanne
58.99.6 58.99.12 58.99.11
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 72
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 3.400 – 4.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 1.780 – 5.110 µm
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Bereichswerte Fiber Atlas: 1,60 – 5,70 mm
ermittelte Bereichswerte: 1,78 – 5,11 mm
Mittelwert Fiber Atlas: 3,70 mm
ermittelte Mittelwerte: 3,70 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 73
3.1.14 Marille (Prunus armeniaca L.)
Faserlängen
Tabelle 27: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Marille
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
61.0.3 1 0,923 61.0.4 1 0,621 61.0.7 1 0,583
61.0.3 2 0,449 61.0.4 2 0,546 61.0.7 2 0,542
61.0.3 3 0,774 61.0.4 3 0,944 61.0.7 3 0,712
61.0.3 4 0,524 61.0.4 4 1,210 61.0.7 4 0,869
61.0.3 5 0,515 61.0.4 5 0,748 61.0.7 5 0,538
61.0.3 6 0,758 61.0.4 6 0,664 61.0.7 6 0,756
61.0.3 7 1,020 61.0.4 7 0,467 61.0.7 7 0,649
61.0.3 8 0,876 61.0.4 8 0,716 61.0.7 8 0,958
61.0.3 9 1,219 61.0.4 9 0,879 61.0.7 9 0,630
61.0.3 10 1,113 61.0.4 10 0,545 61.0.7 10 0,991
61.0.3 11 0,716 61.0.4 11 1,095 61.0.7 11 1,128
61.0.3 12 0,793 61.0.4 12 0,788 61.0.7 12 0,615
61.0.3 13 1,158 61.0.4 13 0,395 61.0.7 13 1,039
61.0.3 14 0,759 61.0.4 14 0,639 61.0.7 14 0,934
61.0.3 15 0,905 61.0.4 15 0,778 61.0.7 15 0,736
61.0.3 16 0,411 61.0.4 16 0,524 61.0.7 16 0,692
61.0.3 17 0,588 61.0.4 17 1,171 61.0.7 17 0,664
61.0.3 18 0,657 61.0.4 18 0,529 61.0.7 18 1,086
61.0.3 19 0,781 61.0.4 19 0,395 61.0.7 19 1,020
61.0.3 20 0,590 61.0.4 20 0,951 61.0.7 20 0,666
61.0.3 21 0,480 61.0.4 21 0,465 61.0.7 21 0,458
61.0.3 22 0,896 61.0.4 22 0,588 61.0.7 22 1,353
61.0.3 23 0,556 61.0.4 23 0,901 61.0.7 23 1,082
61.0.3 24 0,705 61.0.4 24 0,631 61.0.7 24 0,887
61.0.3 25 0,981 61.0.4 25 0,349 61.0.7 25 0,691
61.0.3 26 0,664 61.0.4 26 0,755 61.0.7 26 0,752
61.0.3 27 0,980 61.0.4 27 0,614 61.0.7 27 1,082
61.0.3 28 1,284 61.0.4 28 0,496 61.0.7 28 0,833
61.0.3 29 1,331 61.0.4 29 0,434 61.0.7 29 0,939
61.0.3 30 0,654 61.0.4 30 0,513 61.0.7 30 0,761
61.0.3 31 0,932 61.0.4 31 0,333 61.0.7 31 0,654
MW 0,806 MW 0,667 MW 0,816
STABW 0,249 STABW 0,235 STABW 0,212
v 0,308 v 0,353 v 0,260
Faserlängen der Marille Individuen 61.0 im Mittel 0,67mm bis 0,82 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 74
Tabelle 28: Datenauswertung Fasern Marille
61.0.3 61.0.4 61.0.7
MIN 0,411 0,333 0,458
MW 0,806 0,667 0,816
MAX 1,331 1,210 1,353
Kürzeste Faser der Marille 0,33 mm, längste Faser 1,35 mm.
Faserlängenbereich der Marille somit 0,33 mm – 1,35 mm.
Mittelwerte bei 0,67 mm – 0,82 mm (0,76 mm).
Grafik 17: Faserlängen Marille
61.0.3 61.0.7 61.0.4
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 75
Vergleich zur Literatur
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
durchschnittliche Faserlängender Prunus spp.:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,90 – 1,60 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,33 – 1,35 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 76
3.1.15 Esche (Fraxinus spp.)
Faserlängen
Tabelle 29: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Esche
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
67.1.6 1 0,845 67.1.9 1 0,993 67.1.11 1 1,204
67.1.6 2 0,589 67.1.9 2 0,736 67.1.11 2 1,083
67.1.6 3 1,125 67.1.9 3 0,750 67.1.11 3 1,091
67.1.6 4 1,069 67.1.9 4 0,578 67.1.11 4 1,105
67.1.6 5 0,654 67.1.9 5 0,982 67.1.11 5 0,757
67.1.6 6 0,943 67.1.9 6 0,926 67.1.11 6 0,964
67.1.6 7 0,801 67.1.9 7 0,712 67.1.11 7 0,746
67.1.6 8 1,364 67.1.9 8 0,814 67.1.11 8 0,754
67.1.6 9 1,060 67.1.9 9 1,030 67.1.11 9 1,041
67.1.6 10 0,946 67.1.9 10 0,815 67.1.11 10 1,070
67.1.6 11 1,268 67.1.9 11 0,844 67.1.11 11 1,069
67.1.6 12 0,564 67.1.9 12 1,002 67.1.11 12 1,145
67.1.6 13 0,798 67.1.9 13 0,846 67.1.11 13 1,002
67.1.6 14 1,047 67.1.9 14 0,816 67.1.11 14 0,560
67.1.6 15 0,692 67.1.9 15 0,970 67.1.11 15 0,766
67.1.6 16 1,131 67.1.9 16 1,111 67.1.11 16 0,694
67.1.6 17 0,711 67.1.9 17 0,959 67.1.11 17 0,896
67.1.6 18 0,759 67.1.9 18 0,811 67.1.11 18 0,775
67.1.6 19 1,160 67.1.9 19 0,903 67.1.11 19 0,935
67.1.6 20 0,905 67.1.9 20 0,659 67.1.11 20 0,828
67.1.6 21 1,095 67.1.9 21 1,030 67.1.11 21 0,975
67.1.6 22 0,925 67.1.9 22 0,732 67.1.11 22 0,857
67.1.6 23 0,985 67.1.9 23 0,930 67.1.11 23 1,213
67.1.6 24 0,821 67.1.9 24 0,783 67.1.11 24 0,904
67.1.6 25 1,221 67.1.9 25 0,645 67.1.11 25 0,994
67.1.6 26 1,070 67.1.9 26 1,033 67.1.11 26 0,860
67.1.6 27 1,236 67.1.9 27 0,795 67.1.11 27 0,732
67.1.6 28 0,863 67.1.9 28 0,964 67.1.11 28 1,164
67.1.6 29 0,733 67.1.9 29 0,740 67.1.11 29 0,541
67.1.6 30 0,859 67.1.9 30 0,713 67.1.11 30 1,086
67.1.6 31 0,596 67.1.9 31 0,672 67.1.11 31 0,825
MW 0,930 MW 0,848 MW 0,924
STABW 0,215 STABW 0,137 STABW 0,178
v 0,231 v 0,162 v 0,193
Faserlängen der Esche Individuen 67.1. im Mittel 0,85 mm bis 0,93 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 77
Tabelle 30: Datenauswertung Fasern Esche
67.1.6 67.1.9 67.1.11
MIN 0,564 0,578 0,541
MW 0,930 0,848 0,924
MAX 1,364 1,111 1,213
Kürzeste Faser 0,54 mm, längste Faser 1,36 mm.
Faserlängenbereich der Esche somit 0,54 mm – 1,36 mm.
Mittelwerte bei 0,58 mm – 0,93 mm (0,89 mm).
Grafik 18: Faserlängen Esche
67.1.6 67.1.11 67.1.9
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 78
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 150 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 540 – 1.360 µm
Fiber Atlas: (Sisko & Pfäffli, 1995):
Bereichswerte Fiber Atlas: 0,40 – 1,50 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,54 – 1,36 mm
Mittelwert Fiber Atlas: 0,9 mm
ermittelte Mittelwerte: 0,9 mm
Amerikanische online Datenbank InsideWood: (University, 2016):
Bereichswerte InsideWood: 900 – 1.600 µm
ermittelte Bereichswerte: 540 – 1.360 µm
Amerikanische Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
durchschnittliche Faserlängen Fraxinus spp.:
Bereichswerte Cecilia A.: 0,80 – 1,45 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,54 – 1,36 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 79
3.1.16 Birne (Pyrus spp.)
Faserlängen
Tabelle 31: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Birne
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
Probe Nr.
Nr. Faserlänge
[mm]
71.99.5 1 1,230 71.99.8 1 0,985 71.99.10 1 1,529
71.99.5 2 1,206 71.99.8 2 0,971 71.99.10 2 1,174
71.99.5 3 0,905 71.99.8 3 1,044 71.99.10 3 0,999
71.99.5 4 0,825 71.99.8 4 0,931 71.99.10 4 0,906
71.99.5 5 0,926 71.99.8 5 1,288 71.99.10 5 1,117
71.99.5 6 0,786 71.99.8 6 0,911 71.99.10 6 1,051
71.99.5 7 0,747 71.99.8 7 1,746 71.99.10 7 0,742
71.99.5 8 0,977 71.99.8 8 0,905 71.99.10 8 0,711
71.99.5 9 1,073 71.99.8 9 1,512 71.99.10 9 0,951
71.99.5 10 0,634 71.99.8 10 1,395 71.99.10 10 1,323
71.99.5 11 1,009 71.99.8 11 0,975 71.99.10 11 0,997
71.99.5 12 0,945 71.99.8 12 0,853 71.99.10 12 1,194
71.99.5 13 0,843 71.99.8 13 1,142 71.99.10 13 1,212
71.99.5 14 1,284 71.99.8 14 0,989 71.99.10 14 1,290
71.99.5 15 1,284 71.99.8 15 1,017 71.99.10 15 0,889
71.99.5 16 1,230 71.99.8 16 1,151 71.99.10 16 1,263
71.99.5 17 0,746 71.99.8 17 1,110 71.99.10 17 1,023
71.99.5 18 1,324 71.99.8 18 0,930 71.99.10 18 0,823
71.99.5 19 0,962 71.99.8 19 0,865 71.99.10 19 1,246
71.99.5 20 0,977 71.99.8 20 1,304 71.99.10 20 1,306
71.99.5 21 0,913 71.99.8 21 1,098 71.99.10 21 1,116
71.99.5 22 0,894 71.99.8 22 1,010 71.99.10 22 0,945
71.99.5 23 1,155 71.99.8 23 1,058 71.99.10 23 1,068
71.99.5 24 1,402 71.99.8 24 1,176 71.99.10 24 1,181
71.99.5 25 1,156 71.99.8 25 0,927 71.99.10 25 0,891
71.99.5 26 0,919 71.99.8 26 1,062 71.99.10 26 1,198
71.99.5 27 1,080 71.99.8 27 1,223 71.99.10 27 1,387
71.99.5 28 1,307 71.99.8 28 0,687 71.99.10 28 1,312
71.99.5 29 1,174 71.99.8 29 0,967 71.99.10 29 1,207
71.99.5 30 1,234 71.99.8 30 1,050 71.99.10 30 0,809
71.99.5 31 1,092 71.99.8 31 0,928 71.99.10 31 0,808
MW 1,040 MW 1,071 MW 1,086
STABW 0,199 STABW 0,210 STABW 0,205
v 0,191 v 0,196 v 0,189
Faserlängen der Birne Individuen 71.99 im Mittel 1,04 mm bis 1,09 mm.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 80
Tabelle 32: Datenauswertung Fasern Birne
71.99.5 71.99.8 71.99.10
MIN 0,634 0,687 0,711
MW 1,040 1,071 1,086
MAX 1,402 1,746 1,529
Kürzeste Faser der Birne 0,63 mm, längste Faser 1,75 mm.
Faserlängenbereich der Birne somit 0,63 mm – 1,75 mm.
Mittelwerte bei 1,04 mm – 1,09 mm (1,07 mm).
Grafik 19: Faserlängen Birne
71.99.5 71.99.10 71.99.8
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 81
Vergleich zur Literatur
Holzatlas: (Wagenführ, 5. Auflage, 2000):
Bereichswerte Holzatlas: 800 – 1.000 µm
ermittelte Bereichswerte: 630 – 1.750 µm
Amerikanischen Literatur von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016):
Bereichswerte Cecilia A.: 0,90 – 1,60 mm
ermittelte Bereichswerte: 0,63 – 1,75 mm
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 82
Lineare Korrelationen mit der Rohdichte bzw. Zug-festigkeit
Rohdichte
Der Abgleich erfolge mit gemittelten Daten der Faserlänge und der Rohdichte.
Im Vergleich der Daten aller Holzarten konnte kein eindeutig linearer Zusammen-
hang zwischen Faserlänge und Rohdichte festgestellt werden.
Es wurden alle Holzarten separat auf eine mögliche lineare Korrelation unter-
sucht, die Holzarten mit einem Korrelationskoeffizient r ≤ 0,85 waren blutroter
Hartriegel, schwarzer Holunder, gewöhnlicher Flieder und Rosskastanie.
Die Ergebnisse der gesamten Gegenüberstellungen:
Grafik 20: Gesamtgrafik Gegenüberstellung aller Faserlängen - Rohdichte
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
0,800
0,900
1,000
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Rohdichte
Berberitze Hartriegel Hasel Douglasie Weide
Hounder Flieder Thuje Rosskastanie Sanddorn
Rotbuche Tanne Marille Esche
y = -0,1751x + 0,8642 R² = 0,313 r = -0,5596
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 83
Grafik 21: Gegenüberstellung Faserlänge – Rohdichte der Nadelhölzer
Grafik 22: Gegenüberstellung Faserlänge – Rohdichte Laubhölzer
Douglasie
Thuje
Tanne
y = 0,0041x + 0,453R² = 0,0008r = 0,0283
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und RohdichteNadelhözer
Berberitze
Hartriegel
Hartriegel
Hasel
Weide
Holunder
Flieder
Rosskastanie
Sanddorn Rotbuche
Ahorn
Marille
Esche
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und RohdichteLaubhölzer
y = -0,195x + 0,8805 R² = 0,1478 r = -0,3844
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 84
Ergebnisse des Laubholzes unterteilt nach Porigkeit:
Grafik 23: Faserlänge – Rohdichte ringporige Laubhölzer
Grafik 24: Faserlänge – Rohdiche halbporige Laubhölzer
Berberitze 10
Berberitze 13
Sanddorn 0
Sanddorn 2Sanddorn 6
Esche
y = -0,1714x + 0,8655R² = 0,0941r = -0,3068
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Rohdichteringporige Laubhölzer
Flieder 7
Flieder 8
MarilleRotbuche
y = -0,3709x + 1,094R² = 0,5297r = -0,7278
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Rohdichtehalbringporige Laubhölzer
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 85
Grafik 25: Faserlänge – Rohdichte zerstreutporige Laubhölzer
Die Ergebnisse der Einzelergebnisse mit einem Korrelationskoeffizienten r ≤ 0,85
Grafik 26: Faserlänge – Rohdichte blutroter Hartriegel
Holunder
Rosskastanie
Hartriegel 0
Hartriegel 4
Hasel
Weide
Ahorn
y = 0,3861x + 0,2542R² = 0,2804r = 0,5295
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Rohdichtezerstreutporige Laubhölzer
11.4.90,84
11.0.30,74 11.0.2
0,73
y = -1,6926x + 2,8199R² = 0,8256r = -0,9086
0,70
0,75
0,80
0,85
1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240 1,250
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Korrelation von Faserlänge und Rohdichteblutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 86
Grafik 27: Faserlänge – Rohdichte schwarzer Holunder
41.0.30,72
41.0.10,70
41.0.90,70
y = -0,156x + 0,8532R² = 0,9094r = -0,9536
0,67
0,69
0,71
0,73
0,75
0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Korrelation von Faserlänge und Rohdichteschwarzer Holunder (Sambucus nigra L.)
47.7.10,95
47.7.30,97
47.8.50,90
y = 16,964x - 9,0653R² = 0,8906r = 0,9437
0,85
0,90
0,95
1,00
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Korrelation von Faserlänge und Rohdichtegewöhnlicher Flieder (Syringa vulgaris L.)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 87
Grafik 28: Faserlänge – Rohdichte gewöhnlicher Flieder
Grafik 29: Faserlänge – Rohdichte Rosskastanie
0,55
0,53
0,54
y = -0,53x + 0,9194R² = 0,7264r = -0,8523
0,50
0,52
0,54
0,56
0,58
0,70 0,70 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,74
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Korrelation von Faserlänge und RohdichteRosskastanie (Aesculus hippocastanum L.)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 88
Zugfestigkeit
Der Abgleich erfolge in der direkten Gegenüberstellung der ermittelten
Faserlänge und der Daten derselben Zugprobe.
Im Vergleich der Daten aller Holzarten konnte kein eindeutig linearer Zusammen-
hang zwischen Faserlänge und Rohdichte festgestellt werden.
Es wurden alle Holzarten separat auf eine mögliche lineare Korrelation unter-
sucht, die Holzarten mit einem Korrelationskoeffizient r ≤ 0,85 waren gewöhnliche
Berberitze und Esche.
Ergebnisse der gesamten Gegenüberstellungen:
Grafik 30: Gesamtgrafik Gegenüberstellung aller Faserlängen - Zugfestigkeit
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Zugfestigkeit
Berberitze Hartriegel Hasel Douglasie Weide HolunderFlieder Thuje Rosskastanie Sanddorn Rotbuche AhornTanne Marille Esche Birne
y = -7,9832x + 104,17 R² = 0,0347 r = -0,1863
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 89
Grafik 31: Faserlänge – Zugfestigkeit Nadelhölzer
Grafik 32: Faserlänge – Zugfestigkeit Laubhölzer
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Zugfestigkeitaller Laubhölzer
Berberitze Hartriegel Hasel Weide Holunder
Flieder Rosskastanie Sanddorn Rotbuche Ahorn
Marille Esche Birne
y = 40,867x + 65,288 R² = 0,0893 r = 0,2988
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 90
Ergebnisse des Laubholzes unterteilt nach Porigkeit:
Grafik 33: Faserlänge – Zugfestigkeit ringporiger Laubhölzer
Grafik 34: Faserlänge – Zugfestigkeit halbringporiger Laubhölzer
Berberitze
Berberitze
Sanddorn
Sanddorn
Sanddorn
EscheEsche
30
50
70
90
110
130
150
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Zugfestigkeitringporiger Laubhölzer
Flieder
Flieder
Rotbuche
Rotbuche
Rotbuche
MarilleMarille
Marille
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Zugfestigkeithalbringporiger Laubhölzer
y = 1,4931x + 91,819 R² = 0,0001 r = 0,0100
y = 35,129x + 66,691 R² = 0,042 r = 0,2049
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 91
Grafik 35: Faserlänge – Zugfestigkeit zerstreutporige Laubhölzer
Die Ergebnisse der Einzelergebnisse mit einem Korrelationskoeffizienten r ≤ 0,85
Grafik 36: Faserlänge – Zugfestigkeit Berberitze
40
60
80
100
120
140
160
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Faserlänge und Zugfestigkeitzerstreutporiger Laubhölzer
Hartriegel Hasel Weide Holunder Rosskastanie Ahorn Birne
5.10.8143,71
5.10.682,06
5.13.1179,29
y = -1440,3x + 715,26R² = 0,9462r = -0,9727
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45
Zugf
est
igke
it [
N/m
m²]
Faserlänge [mm]
Korrelation von Faserlänge und ZugfestigkeitBerberitze (Berberis vulgaris)
y = 74,036x + 33,513 R² = 0,1877 r = 0,4332
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 92
Grafik 37: Faserlänge – Zugfestigkeit Esche
67.1.9105,45
67.1.11100,15
67.1.699,68
y = -70,293x + 165,07R² = 1
r = -1,00
98,00
99,00
100,00
101,00
102,00
103,00
104,00
105,00
106,00
0,840 0,860 0,880 0,900 0,920 0,940
Ro
hd
ich
te [
g/cm
³]
Faserlänge [mm]
Korrelation von Faserlänge und ZugfestigkeitEsche (Fraxinus spp.)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 93
Anatomische Untersuchung der Dünnschnitte
Glossar
aliformes Parenchym Parenchymscheiden, die sich seitlich flügelförmig er-weitern, auch augen- oder flügelförmig genannt
apotracheales Parenchym Parenchyme im Gewebe ohne direkten Kontakt zu den Gefäßen
diffuses Parenchym einzelne Parenchymzellen oder kleine Zellgruppen unregelmäßig über den Querschnitt verteilt
diffus gehäuftes Parenchym Parenchyme in kurzen tangential angeordneten Bän-dern oder Reihen zwischen den Holzstrahlen oder in netzförmiger Anordnung
Durchbrechung, einfach Verbindungsstellen zwischen den zusammengesetz-ten Gefäßen, durch vollständige Auflösung der End-wände, mit lochförmiger Öffnung
Durchbrechung, leiterförmig Verbindungsstellen zwischen den zusammengesetz-ten Gefäßen, durch teilweise Auflösung der End-wände, mit Vielfachöffnungen, die als parallele Spros-senleitern erscheinen
Fasern Sammelbegriff für jede langgestreckte, englumige Zelle, ausgenommen Gefäß und Parenchym
Fasertracheiden Übergangsform der Tracheide zur Libriformfaser; Festigungselement; meist dickwandige und englu-mige, an den Enden zugespitzte Zelle
Frühholz (FH) erstwachsender Jahrringteil, oft locker, dünnwandig weitlumig und / oder mit großen Poren, Aufgabe: Wassertransport
gebändert / konzentrisch Parenchymzellen, die netzförmige (über den Holz-strahl hinaus) oder leiterförmige (zwischen den Holz-strahlen) unterschiedlich breite Reihen oder Bänder bilden
Gefäße Röhrenartige Zellreihen, die an den Quer- / Endwän-den miteinander verbunden sind; Wasserleitung
halbringporiges Laubholz Sonderstellung zwischen ringporigem und zerstreut-porigem Laubholz; Ausprägungen unterschiedlich, z.B. Gefäße im Frühholz größer und häufiger als im Spätholz oder kein Gefäßkranz zu Beginn des Früh-holzes, …
heterogener Holzstrahl Zusätzlich zu den liegenden Zellen ein- oder beidsei-tig als letzte bzw. letzte zwei Zellreihe aufrechte oder quadratische Zellen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 94
Holzstrahlen (HS) übereinanderliegende (ein- oder mehrreihige) Zellen, die in der Höhe variabel sind; lebende Zellen mit radi-aler Ausdehnung; zur Stoffleitung und Speicherung
homogener Holzstrahl Holzstrahl, der ausschließlich aus liegenden Zellen besteht
intervaskuläre Tüpfelung beidseitig behöfte Tüpfel zwischen Gefäßen
Jahrring (JR) jährlicher, ringförmiger Zuwachs des Baumes im Um-fang
konfluent / aliform konfluentes Parenchym
aliforme Bänder, die zu einem Bandstück vereint mehrere Poren umschließen
Kreuzungsfeldtüpfel Öffnungen der Längstracheiden oder Gefäßen zu den Zellen des Holzstrahles; in unterschiedlichen Ausbil-dungsformen
Längstracheiden Langgestreckte Zellen, die an den Enden zugespitzt sind; Wasser- oder Luftführung
Libriformfasern langgestreckte, dickwandig (dicker als Fasertrach-eide) und englumige (enger als Fasertracheide) Zelle mit zugespitzten Enden
Lumen, Lumina Hohlraum der röhrenförmigen Zellen
marginales Parenchym einzelne Parenchymzellen oder Zellreihen, die in wechselnder Breite entweder am Jahrringbeginn oder am Jahrringende auftreten
paratracheales Parenchym Parenchymzellen mit direktem Kontakt zu den Gefä-ßen
Parenchym, Längsparenchym Dünnwandige, backsteinförmig oder isodiametrische Zellen, die der Stoffspeicherung dienen;
Parenchymstrang aus 2 oder mehr Zellen besthend; fusiformes Parenchym: stockwerkartig angeordnete Zellen mit gespitzten Endzellen, selten vorkommend
Poren Darstellungen der Gefäße im Querschnitt
Querschnitt (Qs) Hirnschnitt, Schnittrichtung senkrecht zur Stammachse
radiale Anordnung vertikale Anordnung
Radialschnitt (Rs) Schnittrichtung parallel zur Stammachse
Ringporiges Laubholz Im Frühholz mit Gefäßkranz, danach Gefäße in Größe und Häufigkeit zum Spätholz hin deutlich (meist rapide) erkennbar abnehmend
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 95
Scheinholzstrahlen schmale eng gedrängte, beinahe zusammengewach-sene, Holzstrahlen, die von Fasern oder Parenchy-men, jedoch nicht durch Gefäßstränge voneinander getrennt sind
Schraubenverdickung an den Innenwänden von Fasern und Gefäßen als Gefäßwandverstärkung
Septen einschichtige Zwischenwände der Fasertracheiden o-der Libriformfasern, die erst nach den Innenwand-schichten der Fasern gebildet werden
Spärliches Parenchym einzelne Parenchymzellen, die direkt an den Gefäßen liegen oder unvollständige Umrandung der Gefäße
Spätholz (SH) letztzuwachsender Jahrringteil, oft mit dickwandigen, englumigen Zellen, wenigen, kleinen Gefäßen, Auf-gabe: Festigung
Stockwerkbau der HS Holzstrahlen, die in regelmäßigen, horizontalen Rei-hen angeordnet sind (Tangentialschnitt)
tangentiale Anordnung horizontale Anordnung
Tangentialschnitt (Ts) Schnittrichtung längs zur Stammachse
Thyllen, Verthyllung Gefäße, die im Zuge der Verkernung mit Kerninhalts-stoffen gefüllt oder durch Zellmembran aus dem Ver-sorgungssystem ausgeschlossen werden
Tracheiden Langgestreckte Zellen, die an den Enden zugespitzt sind; dünnwandig und geringe Lumenweite
Tüpfelung Öffnungen in der Zellwand, die aus einer Tüpfelhöhle und einer Tüpfelmembran besteht, als Verbindung zwischen den Lumina der Zellen; in unterschiedlichen Formen
unilaterales Parenchym einseitig an das Gefäß gelagerte Parenchymzellen; entspricht einseitig paratracheal,
vasizentrisches Parenchym Parenchymzellen umranden Gefäße vollständig
vasizentrische Tracheiden kurze, unregelmäßig geformte Tracheiden direkt ne-ben Gefäßen
zerstreutporig Gefäße in ähnlich gleicher Größe, die über den ge-samten Jahrring gleichmäßig verteilt sind, Jahrring-grenzen oftmals undeutlich oder nahezu verschwim-mend
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 96
3.3.1 Berberitze (Berberis vulgaris L.)
Die Berberitze wurde den ringporigen Holzarten zugeordnet.
Querschnitt
Ein- bis zweireihiger Porenkreis am Jahrringbeginn. Poren länglich oval, z.T.
auch rund. Nachkommende Poren sofort viel kleiner, in schräger bis tangentialer
Anordnung, in kurzen Bändern. Spätholzporen in Häufigkeit abnehmend.
Jahrringe sehr unterschiedlich breit. Jahrringgrenze deutlich, unregelmäßig,
gebogen verlaufend.
Holzstrahlen häufig und z.T. nur wenige Frühholzporen entfernt, breit, vereinzelt
schmale Holzstrahlen führend, sehr hoch. (Abb. 26-29)
Abbildung 26: ringporig mit tangentialer Ge-fäßanordnung, 3 ganze JR; Qs, 40x
Abbildung 27: 4 ganze JR mit unregel-mäßig verlaufender Grenze; Qs, 40 x
Abbildung 28: 2 JR, große FH-Poren, Ge-fäße im SH kleiner; Qs, 100 x
Abbildung 29: 1 JR, schräge bis tangen-tiale Gefäßanordnung; Qs, 100 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 97
Frühholzporen selten einzeln, meist paarig oder in Nestern ausgebildet, z.T. ver-
thyllt, kaum Inhaltsstoffe.
Spätholzporen direkt nach dem Porenkreis weitaus kleiner, in Reihen oder Nest-
ern angeordnet, vorwiegend in tangentialer Richtung oder schräg.
Fasern des Frühholzes englumig und dickwandig, z.T. weitlumig. Im Spätholz
englumige und dickwandige Fasern. Hauptsächlich Librifomfasern und im Früh-
holz auch wenige Fasertracheiden.
Parenchym paratracheal spärlich. (Abb. 30-32)
Abbildung 30:FH-Poren an der JR-Grenze, Parenchymzellen (); Qs, 400 x
Abbildung 31: SH-Poren; Qs, 400 x
Abbildung 32: FH-Pore mit Verthyllung; Qs, 1.000 x
Holzstrahlen meist breit, an den Jahrringgrenzen leicht verdickt. Vereinzelt auch
schmälere Holzstrahlen. (Abb. 33-36)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 98
Abbildung 33: HS –Zellen, Parenchyme; Qs, 400 x
Abbildung 34: HS an der JR-Grenze leicht verdickt (); Qs, 400 x
Abbildung 35: HS; Qs, 1.000x Abbildung 36: schmaler HS; Qs, 1.000 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 99
Radialschnitt
Vorwiegend breite, hohe Holzstrahlen, vereinzelt nur wenige Zellen hohe
Holzstrahlen. Hauptschlich homogen, vereinzelt heterogener Art mit aufrechten
und / oder quadratischen Kantenzellen. (Abb. 37-40)
Abbildung 37: hohe HS; Rs, 40 x, Abbildung 38: weniger hoher HS, Ge-fäßstrang; Rs, 100 x,
Abbildung 39: heterogener HS, Gefäß-stänge; Rs, 400 x,
Abbildung 40: auftrechte / quadratische Kantenzellen () des HS; Rs, 1.000 x
Gefäße mit kräftigen Spiralverdickungen, einfachen Durchbrechungen und alter-
nierender intervaskulären Tüpfelung.
Im Frühholz dünnwandigere Fasertracheidenn, im Spätholz dickwandige Libri-
formfasern. Spiralverdickungen der Gefäße und der Fasern. (Abb. 41-44)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 100
Abbildung 41: Gefäßstrang mit diagonaler Tüpfelung und einfachen Durchbrechun-gen; Rs, 400 x
Abbildung 42: einfache Durchbrechun-gen, Tüpfelung der Fasern und Gefäße; Rs, 400 x
Abbildung 43: Gefäße und Fasern mit Schraubenverdickungen: Rs, 1.000 x,
Abbildung 44: alternierende intervasku-läre Tüpfelung, einfache Durchbrechun-gen; Rs, 1.000 x,
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 101
Tangentialschnitt
Hauptsächlich mehrreihige, hohe Holzstrahlen, meist 4- bis 10-reihig, vereinzelt
auch 1- bis 2-reihige. Holzstrahlen meist eng nacheinander gereiht. (Abb. 45-48)
Abbildung 45: eng gereihte HS; Ts, 40x Abbildung 46: vorwiegend mehrreihige, selten 1- bis 2-reihige HS, Ts, 100x
Abbildung 47: HS und Gefäßstränge; Ts, 100 x
Abbildung 48: homogene HS Reihe, Ge-fäße mit Spiralverdickungen, dickwan-dige Fasern; Ts, 400 x
Holzstrahlen überwiegend homogen, selten auch heterogen vorhanden, mehr-
reihige Holzstrahlen teilweise mit Scheidenzellen.
Fasern hauptsächlich dickwandig, im Spätholz, wie Gefäße, oftmals mit Spiral-
verdickungen. (Abb. 49-54)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 102
Abbildung 49: mehrreihiger HS mit Schei-denzellen, 2-reihiger HS, Ts, 400 x
Abbildung 50: HS m. Scheidenzellen, dickwandige Fasern, Ts, 400 x
Abbildung 51: HS heterogen; Ts, 400 x Abbildung 52: HS homogen; Ts, 1.000x
Abbildung 53: Spiralverdickungen, dick-wandige Libriformfasern; Ts, 1.000 x
Abbildung 54: Scheidenzellen (), Spi-ralverdickungen; Ts, 1.000 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 103
Vergleich mit der Literatur
Grosser (Grosser, 1977) : halbringporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Gefäße:
Frühholz Porenkreis 1- bis 2-reihig;
folgende Gefäße merklich kleiner, enger, locker
verteilt, in kurzen radialen Gruppen oder in schrä-
gen bis tangential Reihen;
Form: rundlich, länglich oval (FH); eckig, klein (SH);
einfache Durchbrechungen, englumig mit Spiralver-
dickungen
Parenchym:
fehlend oder äußerst spärlich;
häufig, paratracheal spärlich
Holzstrahlen:
undeutlich heterogen, mit kaum auffallenden
Scheidenzellen;
breit, 8- bis 10-reihig;
oft sehr hoch (über 1 mm hoch);
homogen, vereinzelt heterogen;
deutliche Scheidenzellen
Fasern:
dickwandig aus Libriformfaser- und Fasertrache-
idkomplexen;
öfter mit Septen;
Tracheiden in schrägen, tangentialen Gefäßreihen;
mit Spiralverdickungen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 104
Schweingruber (Schweingruber F. H., 2011) : ringporig – halbringporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Querschnitt:
lockerer Frühholz-Porenring;
SH-Poren und Gefäßtracheiden in Nestern;
schräg bis flammenartig angeordnet;
Parenchym apotracheal diffus
breite Holzstrahlen, an JR-Grenze leicht verdickt
Jahrringgrenze deutlich, gewellt;
Parenchym paratracheal spärlich
Radialschnitt:
einfache Durchbrechungen der Gefäße
HS homogen, selten heterogen mit 1 bis 2 ver-
größerten Kantenzellen
Gefäße mit deutlichen Schraubenverdickungen
Tangentialschnitt:
breite, 4- bis 8-reihige HS, selten schmaler oder
breiter, praktisch keine einreihigen HS;
sehr hohe Holzstrahlen (Höhe bis 1 cm);
zuweilen andeutungsweise mit Scheidenzellen;
nur Libriformfasern und keine Fasertracheiden
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 105
3.3.2 Hasel
Die Hasel wurde den zerstreutporigen Holzarten zugeordnet. Erkennungsmerk-
mal: ausgeprägte Scheinholzstrahlen.
Querschnitt
Der Querschnitt durchzogen von langen radialen Porensträngen. Poren er-
scheinen vorwiegend oval bis eckig.
Im Frühholz etwas größere Poren und längere Stränge, vereinzelt mit Thyllen
oder Inhaltsstoffen, sehr hohe Häufigkeit. Zum Spätholz hin kleiner werdende
Gefäße und kürzere Stränge mit geringerem Auftreten. Jahrringgrenze deutlich,
leicht gewellt.
Holzstrahlen sehr dicht, oftmals nur durch eine Pore / einen Porenstrang
getrennt, mit Einlagerung. (Abb. 55, 56)
Abbildung 55: zerstreutporig; Qs, 40 x; Abbildung 56: JR Grenze und hohe An-zahl HS; Qs, 100x;
Holzstrahlen meist 1- bis 2-reihig, hoch, sehr häufig. Runde, große Tüpfelungen
z.T. gut erkennbar, an der Jahrringgrenze leicht verdickt.
Fasern im Frühholz etwas dünnwandiger und weitlumiger (Fasertracheiden) als
Spätholzfasern, dickwandig mit engen Lumen (Libriformfasern).
Parenchyme apotracheal diffus - diffus gehäuft zwischen den Fasern. (Abb. 57-
62)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 106
Abbildung 57: Poren des FH vereinzelt mit Einlagerungen / Thyllen; Qs, 100 x;
Abbildung 58: FH: große Poren, weitlu-migere Fasern, HS an JR-Grenze ver-dickt; Qs, 400 x;
Abbildung 59: Poren des SH; Qs, 100 x; Abbildung 60: SH: weniger, kleinere Gefäße, dickwandige Fasern, diffuse Parenchmzellen (); Qs, 400 x;
Abbildung 61: Tüpfelung im HS; Qs, 1.000 x;
Abbildung 62: Libriformfasern im SH, Fasertracheiden im FH; Qs, 1.000 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 107
Radialschnitt
Unterschiedlich hohe Holzstrahlen, eng gereiht. (Abb. 63,64)
Abbildung 63: HS mit unterschiedlicher Höhe, sehr zahlreich; Rs, 40 x;
Abbildung 64: HS sehr eng stehend; Rs, 100 x;
Kreuzungsfeldtüpfel von klein und rund bis sehr vergrößert und rund.
Holzstrahlen mit vielen Ein- bzw. Anlagerungen von Inhaltsstoffen in den Zellen.
Heterogene Art überwiegend mit quadratischen Kantenzellen.
Fasern vorwiegend dickwandig, im Frühholz etwas weitlumiger als im Spätholz.
Gefäße mit zarten bis kräftigen, leiterförmigen Durchbrechungen und opponierter
intervaskulärer Tüpfelung. (Abb. 65-70)
Abbildung 65: Tüpfelungen in den Kreu-zungsfeldern; Rs, 400 x;
Abbildung 66: Kantenzellen quadratisch (); Rs, 400 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 108
Abbildung 67: HS mit Anlagerungen und großen Tüpfeln; Rs, 400 x;
Abbildung 68: Inhaltsstoffe, Zellwände HS; Rs, 1.000 x;
Abbildung 69: opponierte Tüpfel; Rs, 1.000x;
Abbildung 70: leiterförmige Durchbre-chungen; Rs, 1.000 x;
Durchbrechungen in zwei Arten (Abb. 70):
Engstehende, dichte, Sprossen, im Durchschnitt 15-20 Stück, bei kleineren Ge-
fäßdurchbrechungen.
Sehr weitstehende, wenige (bis max. 10) Sprossen bei großen Gefäßen.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 109
Tangentialschnitt
Engstehende 1- bis 2-reihige Holzstrahlen meist ab 10 Zellen hoch, überaus hohe
Anzahl an Scheinholzstrahlen, u.a. in einem musterartigen Band. (Abb. 71-74)
Abbildung 71: HS mit unterschiedlicher Höhe, sehr zahlreich; Ts, 40 x;
Abbildung 72: musterartiges Band aus Scheinholzstrahlen; Ts, 40 x;
Abbildung 73: HS meist ab 10 Zellen hoch; Ts, 100 x;
Abbildung 74: ausgeprägte Scheinholz-strahlen; Ts, 100 x;
Holzstrahlen heterogen mit 1-2 Reihen Kantenzellen, diese mit großen Tüpfeln.
Fasern vorwiegend dickwandige Libriformfasern. Dünnwandigere Fasertra-
cheiden zwischen den Scheinholzstrahlen. Beide teilweise septiert.
Scheinholzstrahlen in Höhe und Breite sehr variable, auch musterartig. (Abb. 75-
78)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 110
Abbildung 75: vereinzelte 2-reihige HS; Ts, 400 x;
Abbildung 76: Scheinholzstrahlen mus-terförmig; Ts, 400 x;
Abbildung 77: ausgeprägte Scheinholz-strahlen; Ts, 400 x;
Abbildung 78: Scheinholzstrahlen, Fa-sern mit Septen (); Ts, 400 x;
Gefäße und Fasern teilweise mit zarten Spiralverdickungen.
Holzstrahlen reichlich mit Inhaltsstoffen gefüllt. Kantenzellen der Holzstrahlen oft-
mals mit vergrößerten Tüpfeln. (Abb. 79-84)
c
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 111
Abbildung 79: Scheinholzstrahlen zw. Fasern; Ts, 1.000 x;
Abbildung 80: heterogene HS; Ts, 400x;
Abbildung 81: opponierte Tüpfel, Fasern mit Septen; Ts, 400 x;
Abbildung 82: zarte Spiralverdickungen; Ts, 1.00 x;
Abbildung 83: große Tüpfel in Kantenzel-len der HS; Ts, 1.000 x;
Abbildung 84: leiterförmige Durchbre-chung; Ts, 1.000 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 112
Vergleich mit der Literatur
Grosser (Grosser, 1977) : zerstreutporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Gefäße:
zahlreich, vorwiegend in radialen Gruppen und in
kleinen Nestern;
im Spätholz weniger und locker verteilt;
Form: eckig, klein;
leiterförmige Durchbrechung mit wenigen, groben
Sprossen, in engen Gefäßen auch mehrere;
öfter mit zarten Spiralverdickungen
Parenchym:
sehr zahlreich: apotracheal diffus bis diffus gehäuft
Holzstrahlen:
ein- bis 2-reihig in Scheinstrahlen auch breiter;
Höhe variabel, meist zwischen 10-30 Zellen hoch;
Heterogen;
Kantenzellen öfter mit großen Tüpfeln;
sehr zahlreich
Fasern:
Grundgewebe aus Libriformfasern;
wenige Fasertracheiden, häufig Übergangsformen
dazwischen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 113
Schweingruber (Schweingruber F. H., 2011) : zerstreutporig, z.T. leicht halbringp.
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Querschnitt:
Poren mit dichten, radialen Reihen oder Gruppen;
Jahrringgrenzen meist wellig;
Parenchym apotracheal zerstreut;
selten in kleinen Gruppen zusammengesetzte
Holzstrahlen;
deutlich ausgeprägte Scheinholzstrahlen;
Jahrringgrenze deutlich
Holzstrahlen sehr enggestellt
Radialschnitt:
Leiterförmige Durchbrechung der Gefäße mit 5-10
kräftigen Sprossen, oft mit feiner Spiralverdickung;
Holzstrahlen meist heterogen mit 1-2 Reihen quad-
ratischer Kantenzellen;
Tüpfel in Kreuzungsfeldern z.T. leicht vergrößert;
hauptsächlich Libriformfasern, selten Fasertra-
cheiden (Unterscheidung oft schwierig)
Holzstrahlen eng nacheinander gereiht
Tangentialschnitt:
einreihige Holzstrahlen;
Scheinholzstrahlen 2- bis 3-reihig;
Höhe 10-25 Zellen, selten bis 40;
Ein- bis 2-reihige Holzstrahlen überwiegend;
Scheinholzstrahlen in Höhe und Breite variabel
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 114
3.3.3 Flieder (Syringa vulgaris L.)
Der Flieder wurde den halbringporigen Holzarten zugeordnet.
Querschnitt
Frühholz Porenkreis, locker, 1- bis 2-reihig, Gefäße einzeln bis paarig, selten in
Nestern. Folgende Poren stetig in Größe abnehmend. Form rund bis länglich
oval.
Spätholzporen kleiner, rund, meist einzeln, z.T. auch in kleinen Nestern vor-
kommend, gleichmäßig verteilt bis an die Jahrringgrenze reichend. Gefäße im
Kernholz oftmals mit Inhaltsstoffen gefüllt und / oder verthyllt.
Fasergewebe im Früh- und Spätholz von gleichem, dickwandigem Aufbau.
Holzstrahlen meist sehr enggestellt, ab und an nur durch eine Frühholzpore
getrennt, vorwiegend schmal und eher niedrig.
Jahrringgrenze sehr schmal, deutlich. (Abb. 85-88)
Abbildung 85: halbringporig; Qs, 40 x; Abbildung 86: 1- bis 2-reihiger Poren-kreis; Qs, 40 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 115
Abbildung 87: JR-Grenze; Qs, 100 x; Abbildung 88: 1-reihige, z.T. sehr eng-gestellte HS; Qs, 100 x;
Porengröße an Jahrringgrenze mit deutlichem Größenunterschied.
Paratracheal spärliches Parenchym.
Spätholzfasern direkt an der Jahrringgrenze beinahe lumenlos, im angrenzenden
Frühholz sehr weitlumig, Vorwiegend dickwandige Fasertracheiden, u.U. wenige
Libriformfasern. (Abb. 89-92)
Abbildung 89: JR-Grenze, Fasern von gleichem Aufbau; Qs, 200 x;
Abbildung 90: JR-Grenze mit SH- und FH-Poren; Qs, 400x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 116
Abbildung 91: JR-Grenze, sehr englu-mige SH-Fasern; Qs, 1.000 x;
Abbildung 92: paratracheal spärliche Parenchymzellen / -stränge; Qs, 400x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 117
Radialschnitt
Heterogene Holzstrahlen niedrig, meist um die 10 Zellen hoch. Kreuzungs-
feldtüpfel oftmals vergrößert. Kantenzellen quadratisch, hauptsächlich einreihig.
(Abb. 93-96)
Abbildung 93: wenig hohe HS; Rs, 40 x; Abbildung 94: HS niedrig, dichtes Fa-sergewebe; Rs, 40 x;
Abbildung 95: HS heterogen; Rs, 100 x; Abbildung 96: HS mit großen Kreu-zungsfeldtüpfeln (); Rs, 100 x;
Gefäße mit einfachen Durchbrechungen und zarten, weitstehenden Spiralver-
dickungen.
Fasertracheiden dickwandig, dichtes Gewebe, zahlreiche Tüpfel.
Holzstrahlen heterogen mit beidseitig einreihigen Kantenzellen, meist quadra-
tisch. Vergrößerte Tüpfel in Kreuzungsfeldern. (Abb. 97-102)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 118
Abbildung 97: HS 3 Zellen hoch, beidsei-tig quadratische Kantenzellen; Rs, 200x;
Abbildung 98: Fasertracheiden mit Tüp-fel im SH; Rs, 200x;
Abbildung 99: große Tüpfel in HS-Zellen, HS 8 Zellen hoch; Rs, 400 x;
Abbildung 100: einfache Duchbre-chung; Rs, 400 x;
Abbildung 101: opponierte Tüpfel der Gefäße; Rs, 1.000 x;
Abbildung 102: Spiralverdickung, einfa-che Durchbrechung, Tüpfel der Fasern; Rs, 1.000x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 119
Tangentialschnitt
Dicht gesetzte Holzstrahlen, meist 1- bis 4-reihig, heterogen. Unterschiedliche
Höhe, meist um die 10 Zellen, max. 15-20, hoch. (Abb. 103-106)
Abbildung 103: dicht gesetzte HS; Ts, 40x;
Abbildung 104: HS vorwiegend 1- bis 4-reihig; Ts, 100x;
Abbildung 105: Höhe der HS relativ nied-rig; Ts, 200 x;
Abbildung 106: heterogene HS, Spiral-verdickung Gefäße; Ts, 400 x;
Unterschiedliche Typen (nach Kribs I - III) der Heterogenität der Holzstrahlen.
Gefäße mit spiraligen Verdickungen und einfachen Durchbrechungen.
Fasern dickwandig, relativ weitlumig (Fasertracheiden), reichlich getüpfelt und
oftmals mit Spiralverdickungen. (Abb. 107-110)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 120
Abbildung 107: unterschiedliche Hetero-genität; Ts, 400 x;
Abbildung 108: breitere, 3- bis 4-reihige HS; Ts, 400x;
Abbildung 109: 3-reihiger HS; Ts, 1.000 x;
Abbildung 110: Spiralverdickung Ge-fäße, Dickwandige Fasertracheiden ge-tüpfelt; Ts, 1.000 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 121
Vergleich mit der Literatur
Grosser (Grosser, 1977) : halbringporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Gefäße:
Frühholz Porenkreis geschlossen, 1- bis 3-reihig;
Spätholzgefäße gleichmäßig verteilt, zahlreich,
einzeln, z.T. paarig, meist eckig, klein;
einfache Durchbrechungen, zarte Spiralverdickung
und hellgelbe Inhaltsstoffe
Parenchym:
nur sehr spärlich ausgebildet
Holzstrahlen:
ein- bis 4-reihig, 2-reihig stark überwiegend;
relativ niedrig (max. 20-25 Zellen hoch);
zahlreich
heterogen mit 1 Reihe Kantenzellen
gewöhnlich mit hellgelben Inhaltsstoffen;
oft auch mit zahlreichen Kristallen
Fasern:
dickwandige, reichlich getüpfelte Fasertracheiden;
Libriformfasern weniger häufig;
mit Spiralverdickungen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 122
Schweingruber (Schweingruber F. H., 2011) :halbringporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Querschnitt:
Porengröße nach Frühholz-Porenring rasch abneh-
mend;
Gefäße im Kernholz mit gelblichen Inhaltsstoffen;
Poren meist einzeln, klein, dicht verteilt;
Jahrringgrenze deutlich
Grundgewebe dickwandig;
Parenchym paratracheal spärlich
Radialschnitt:
einfache Durchbrechung und deutliche Schrauben-
verdickung der Gefäße;
Holzstrahlen heterogen mit meist 1 Reihe quadrat-
ischer Kantenzellen;
Kreuzungsfeldtüpfel leicht vergrößert;
zuweilen Kristalle in Holzstrahlen an JR-Grenze;
meist Fasertracheiden, Libriformfasern spärlich
Tangentialschnitt:
Holzstrahlen hauptsächlich 2-reihig, oft einreihig, sel-
ten 3-reihig;
Höhe der Holzstrahlen im Durchschnitt 8-15 Zellen;
Dicht gesetzte Holzstrahlen 1- bis 4-reihig
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 123
3.3.4 Sanddorn
Der Sanddorn wurde den ringporigen Holzarten zugeordnet. Erkennungsmerk-
mal: stockwerkartig aufgebaute Holzstrahlen
Querschnitt
Im Frühholz 1- bis 3-reihiger Porenkreis mit großen, einzelnen oder paarig an-
geordneten Poren, oftmals mit Inhaltsstoffen angelagert oder gefüllt. Erste Ge-
fäße nicht die größten, diese erst in zweiter oder dritter Reihe. Form rund bis
länglich oval.
Im Spätholz sehr kleine Poren und in der Häufigkeit zunehmend. Poren vorwie-
gend rund und meist einzeln, selten paarig.
Deutlich abgegrenzte Jahrringgrenze, leicht wellig.
Sehr engstehende, wenig hohe Holzstrahlen, die mit Inhaltsstoffen gefüllt sind.
Holzstrahlen oftmals nur durch eine Frühholzpore / ein Porenpaar voneinander
getrennt. (Abb. 111-114)
Abbildung 111: 1- bis 3-reihiger Poren-kreis; Qs, 40 x;
Abbildung 112: größte Gefäße in 2. od. 3. Reihe; Qs, 100 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 124
Abbildung 113: Poren vorwiegend ein-zeln oder paarig; Qs, 40 x;
Abbildung 114: HS und Poren mit In-haltsstoffen; Qs, 100 x;
Netzartig erscheinende Fasern im Frühholz, sehr dünnwandige und überaus
weitlumige Tracheiden. Spätholz aus dünnwandigen und weitlumigen Fasertra-
cheiden bestehend.
Schmale, meist nicht lange, Holzstrahlen gefüllt mit Inhaltsstoffen,
Parenchym sowohl apotracheal diffus, als auch paratracheal spärlich vor-
kommend. (Abb. 115-122)
Abbildung 115: netzartig erscheinende Tracheiden im FH; Qs, 400 x;
Abbildung 116: Fasertracheiden im SH mit diffusen Parenchymzellen; Qs, 400x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 125
Abbildung 117: HS stockwerkartig aufge-baut; Qs, 400 x;
Abbildung 118: paratracheal spärlicher Parenchymstrang (); Qs, 400 x;
Abbildung 119: JR-Grenze, sehr eng ste-hende HS; Qs, 400x;
Abbildung 120: verthylltes Gefäß, diffus gehäuftes Parenchym; Qs, 400x;
Abbildung 121:FH-Pore, paratracheal spärliches Parenchym; Qs, 1.000 x;
Abbildung 122: SH mit kleinen Poren; Qs, 1.000 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 126
Radialschnitt
Stockwerkartige, enggestellte Anordnung der Holzstrahlen, sehr wenige Zellen
hoch, annähernd gleich schmal. (Abb. 123, 124)
Abbildung 123: enggestellte HS; Rs, 40 x;
Abbildung 124: nur wenige Reihen breit und wenige Zellen hoch; Rs, 100 x;
Holzstrahlen homogen und heterogen, mit Inhaltsstoffen gefüllt. Bei heterogenen
Holzstrahlen beidseitige Kantenzellen, quadratisch bis leicht aufrecht.
Engere Gefäße mit engen, zarten Spiralverdickungen und einfachen Durch-
brechungen.
Fasern mit runden bis schlitzförmigen Tüpfeln. (Abb. 125-130)
Abbildung 125: HS, beidseitige Kanten-zellen, Inhaltsstoffe, dickwandige Fasern; Rs, 400 x;
Abbildung 126: HS homogen und hete-rogen; Rs, 400 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 127
Abbildung 127: Gefäße mit Schrauben-verdickung, einfache Durchbrüche, Fa-sern getüpfelt; Rs, 400 x;
Abbildung 128: runde bis schlitzförmige Tüpfelung, Spiralvedickung der Fasern; Rs, 1.000 x;
Abbildung 129: beidseits einreihige Kan-tenzellen; Rs, 1.000 x;
Abbildung 130: reichlich Inhaltsstoffe; Rs, 1.000 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 128
Tangentialschnitt
Sehr niedrige, meist 2- bis 3-reihige Holzstrahlen, dicht angeordnet. Homogen
selten, hauptsächlich heterogen. Stockwerkartige Anordnung.
Fasergewebe sehr dickwandig, meist Fasertracheiden.
Gefäße mit engen Spiralverdickungen und einfachem Durchbruch. (Abb. 131-
134)
Abbildung 131: engstehende HS; Ts, 40x;
Abbildung 132: HS sehr niedrig und schmal; Ts, 100 x;
Abbildung 133: vorwiegend heterogene HS; Ts, 400 x;
Abbildung 134: Spiralverdickung, dich-tes Fasergewebe; Ts, 400 x;
Heterogene Holzstrahlen (Typ II, III nach Kribs) teilweise mit Scheidenzellen.
Meist 2- reihig, selten auch 1- oder 3-reihige.
Fasern reichlich, vorwiegend rund getüpfelt. (Abb. 135-138)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 129
Abbildung 135: vorwiegend heterogene HS; Ts, 400 x;
Abbildung 136: Fasern getüpfelt; Ts, 1.000 x;
Abbildung 137: selten 3-reihige HS; Ts, 1.000 x;
Abbildung 138: Spiralverdickung und einfacher Durchbruch; Ts, 1.000 x;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 130
Vergleich mit der Literatur
Grosser (Grosser, 1977) : ringporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Gefäße:
Frühholzgefäße äußerst dicht gelagert, breiter und
mehrreihiger Porenkreis;
größte Poren nicht direkt an Jahrringgrenze
einzeln, paarig und in kurzen, tangentialen Gruppen;
Form: meist oval, z.T. auch rund;
Spätholzporen ungleich kleiner und gleichmäßig
locker verteilt, fast einzeln;
Spiralverdickung, in engen Gefäßen sehr deutlich;
häufig gelb-braune Inhaltsstoffe
Parenchym:
apotracheal diffus
paratracheal spärlich
Holzstrahlen:
Ein- bis 2-reihig, äußerst selten 3-reihig;
bemerkenswert niedrige Höhe (≤ 10 Zellen);
sehr enggestellt im Frühholz;
sehr regelmäßige stockwerkartige Anordnung;
homogen bis schwach heterogen;
heterogen (Typ II und III nach Kribs), selten homogen
Fasern:
Reichlich getüpfelte Fasertracheiden-Komplexe;
Im Frühholz-Porenkreis Tracheiden-Komplexe
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 131
Schweingruber (Schweingruber F. H., 2011) : ringporig – halbringporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Querschnitt:
größte Gefäße nicht unmittelbar an Jahrringgrenze;
Frühholzporen einzeln und in Nestern;
oft andeutungsweise tangentiale Anordnung;
selten gelbe Inhaltsstoffe
Parenchym apotracheal diffus, selten paratracheal;
Fasern im Frühholz auffallend dünnwandig;
Parenchym v.a. paratracheal spärlich, häufig apotra-
cheal diffus; Anordnung Poren diffus
Inhaltsstoffe in Poren sehr häufig
Radialschnitt:
einfache Durchbrechung, Schraubenverdickung der
Gefäße
Holzstrahlen homogen bis leicht heterogen mit quad-
ratischen bis leicht stehenden Kantenzellen;
nur Fasertracheiden, keine Libriformfasern;
Tangentialschnitt:
Holzstrahlen meist 2-reihig, häufig 1-reihig, selten 3-
reihig;
Höhe im Durchschnitt 5-15 Zellen;
stockwerkartige Anordnung
heterogen (Typ II und III nach Kribs), selten homogen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 132
3.3.5 Rotbuche (Fagus sylvatica L.)
Diese Rotbuche wurde als halbringporig - zerstreutporig eingeordnet.
Querschnitt
Große, länglich-ovale Frühholzporen, paarig oder in Gruppen angeordnet, z.T.
verthyllt, sehr zahlreich. Kein ausgeprägter Porenring an der Jahrringgrenze.
Spätholzporen ähnlich groß, rund bis länglich oval, im letztenSpätholz rasch an
Größe und Häufigkeit abnehmend. Letzten wenigen Zellreihen des Spätholzes
annähernd porenfrei.
Fasern dickwandig und englumig, dichtes Gewebe.
Holzstrahlen breit und sehr hoch, an der Jahrringgrenze deutlich verdickt.
Jahrringgrenze deutlich, unregelmäßig, wellig. (Abb. 139, 140)
Abbildung 139: JR-Struktur mit breitem und langem HS; Qs, 40 x;
Abbildung 140: Porengröße und Häufig-keit im letzten SP abnehmend; Qs, 100x;
Im letzten Spätholzbereich Poren von kleinerer Größe und weniger häufig auftre-
tend. Poren einzeln oder in Gruppen angeordnet. Wenige Poren mit Thyllen.
Fasern dickwandig und sehr englumig, Libriformfasern. Die letzten Spätholzrei-
hen beinahe ohne Lumen.
Parenchyme sehr häufig, apotracheal diffus gehäuft, beinahe gebändert.
(Abb. 141-146)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 133
Abbildung 141: JR-Grenze, 1-3 Zellrei-hen porenfrei, viele Parenchyme; Qs, 400 x
Abbildung 142: JR-Grenze mit Fasern beinahe lumenfrei; Qs, 1.000 x
Abbildung 143: Porengruppe zu Beginn des JR im FH; Qs, 400 x
Abbildung 144: JR-Grenze, Pa-renchym häufig; Qs, 400 x
Abbildung 145: einzelne Poren verthyllt; Qs, 1.000 x
Abbildung 146: schmaler HS an JR-Grenze verdickt; Qs, 1.000 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 134
Radialschnitt
Die Holzstrahlen sehr breit und sehr hoch, auch makroskopisch ein gut sichtbares
Erkennungsmerkmal. Dazwischen auch schmälere und einreihige Holzstrahlen
vorkommend. Heterogen mit beidseitigen Kantenzellen, aufrecht bis quadratisch.
Tüpfel in den Kreuzungsfeldern z.T. vergrößert. (Abb. 147-150)
Abbildung 147: breiter HS unten, schmaler HS oben; Rs, 40 x
Abbildung 148: 1 breiter und 1 schmale HS; Rs, 100 x
Abbildung 149: mehrreihiger heterogener HS; Rs, 400 x
Abbildung 150: einreihiger, heterogener HS; Rs, 1.000 x
Intervaskuläre Tüpfel der Gefäße opponiert oder z.T. auch scalarifom, Durch-
brechungen einfach oder leiterförmig.
Fasertracheiden dickwandig, englumig als Grundgewebe. (Abb. 151-156)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 135
Abbildung 151: Gefäße mit opponierter bis scalariformer intervaskulären Tüpfelung; Rs, 400 x
Abbildung 152: Gefäße mit scalarifor-mer, intervaskulären Tüpfelung, einfa-che Durchbrechung; Rs, 400 x
Abbildung 153: 1-reihiger HS, leiterförmige Durchbrechungen; Rs, 400 x
Abbildung 154: dickwandige Fasern, septiert; Rs, 400 x
Abbildung 155: leiterförmige Durchbrechung des Gefäßes; Rs, 1.000 x
Abbildung 156: zahlreich getüpfelte Fa-sern (); Rs, 400 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 136
Tangentialschnitt
Holzstrahlen unterschiedlich breit und hoch, wobei überwiegend mehr als 2
Zellen breite Holzstrahlen, einreihige selten. (Abb. 157-160)
Abbildung 157: Typische HS: unterschiedli-che Breite und Höhe; Ts, 40 x
Abbildung 158: verschieden breite und hohe HS; Ts, 40 x
Abbildung 159: einreihige bis mehrreihige HS; Ts, 100 x
Abbildung 160: unterschiedlich breite HS; Ts, 100 x
Holzstrahlen homogen und heterogen (Typ II nach Kribs).
Fasern zahlreich getüpfelt, vorwiegend dickwandig und englumig, Fasertra-
cheiden bis Libriformfasern, z.T. septiert. (Abb. 161-164)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 137
3
Abbildung 161: ein- und mehrreihige HS; Ts, 1.000 x
Abbildung 162: Faser septiert (); Ts, 1.000 x
Abbildung 163: mehrreihiger, homogener HS; Ts, 400 x
Abbildung 164: mehrreihiger, heteroge-ner HS; Ts, 400 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 138
Vergleich mit der Literatur
Grosser (Grosser, 1977) : zerstreutporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Gefäße:
Zahl und Größe zum Spätholz hin abnehmend, sehr
zahlreich, einzeln und in kleinen Gruppen;
Form: rundlich bis oval;
überwiegend einfache, auch leiterförmige (bis zu 20
Sprossen) Durchbrechungen;
intervaskuläre Tüpfel opponiert oder schwach scalar-
iform;
Thyllen und Inhaltsstoffe bei Kernholzbildung
Parenchym:
reichlich, apotracheal diffus, diffus gehäuft
Holzstrahlen:
in zwei Größen: einreihige und ab 2-reihige;
sehr breite HS an Jahrringgrenze angeschwollen;
Höhe sehr variabel (einige mm – cm hoch)
homogen, gelegentlich schwach heterogen;
große Tüpfel gegen Gefäße;
heterogene HS Typ II nach Kribs
Fasern:
Grundgewebe überwiegend dickwandige Libriformfa-
sern;
geringer Anteil Fasertracheiden, einzelne Tracheiden
dickwandig, meist englumig
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 139
Schweingruber (Schweingruber F. H., 2011) :halbringporig – zerstreutporig
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Querschnitt:
viele Poren in Frühholz-Porennestern, einzelne im
Spätholz;
Frühholzporen mit gummiartigen Einlagerungen oder
Thyllen;
Holzstrahlen z.T. sehr breit, an Jahrringgrenze ver-
dickt
Holzstrahlen zuweilen an Jahrringgrenze zurück-
versetzt (Keilwuchs)
Parenchym apotracheal zerstreut, in lockeren tan-
gentialen bis schrägen Bändern
Fasern dickwandig
Radialschnitt:
einfache, selten leiterförmige Durchbrechung der Ge-
fäße;
Holzstrahlen homogen, selten heterogen mit quadrat-
ischen Kantenzellen;
Tüpfel in Kreuzungsfeldern mit großen Aperturen;
Fasertracheiden als Grundgewebe;
Fasern dickwandig, meist englumig, viele Tüpfel;
Holzstrahlen homogen und heterogen
Tangentialschnitt:
Holzstrahlen ein- bis vielreihig (bis zu 20 Reihen);
Höhe variabel, bis zu 5 mm;
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 140
3.3.6 Tanne (Abies alba Mill.)
Querschnitt
Übergang von Frühholz zum Spätholz allmählich. Frühholzanteil größer als Spät-
holzanteil. Jahrringgrenze deutlich.
Keine Harzkanäle.
Holzstrahlen einreihig, sehr hoch, z.T. mit Inhaltsstoffen gefüllt. (Abb. 165, 166)
Abbildung 165: HS mit Einlagerungen von Inhaltsstoffen, Qs Tanne, 40x
Abbildung 166: 1 ganzer JR mit HS und gespeicherten Inhaltsstoffen; Qs, 1.000x
Frühholztracheiden dünnwandig und sehr weitlumig, Spätholztracheiden dick-
wandig und sehr englumig.
Im Spätholz vereinzelt auftretende terminale (am Jahrringende) Längsparen-
chymzellen.
Die Holzstrahlen mit kleinen Tüpfelungen und minimalen Ablagerungen und auch
durchgehend mit Inhaltsstoffen gefüllten Zellen. (Abb. 167-172)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 141
Abbildung 167: JR-Grenze, Qs, 100 x Abbildung 168: JR-Grenze mit Zellunter-schieden, Qs, 400 x
Abbildung 169: allmählicher Übergang FH-SH, Qs, 400 x
Abbildung 170: FH dünnwandig und sehr weitlumig, Qs, 400 x
Abbildung 171: SH dickwandig und englu-mig, Qs, 400 x
Abbildung 172: JR-Grenze terminales Längsparenchym, Qs, 1.000 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 142
Radialschnitt
Holzstrahlen meist mehr als 10 Zellen hoch, häufig mit wenigen Zellen Höhe.
Tracheiden mit einreihigen Tüpfeln. (Abb. 173-176)
Abbildung 173: i.d.R. hohe HS mit ≤ 10 Reihen; Rs, 40 x
Abbildung 174: unterschiedlich hohe HS, Tüfelung der Fasern; Rs, 100 x
Abbildung 175:; deutlich einreihige Tüpfe-lung der Tracheiden; Rs, 400 x
Abbildung 176: einreihige Tüpfelung; Rs, 1.000 x
Kreuzungsfeldtüpfelungen im Frühholz taxodioid, im Spätholz piceoid.
Holzstrahlen homozellular, glattwandig, Ansatzstellen horizontal mit Vertiefungen
und Verbindungsstellen vertikal geknotelt. In einigen Zellen prismatische, kristal-
line Einschlüsse vorhanden. (Abb. 177-182).
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 143
Abbildung 177: homogene HS mit Tüpfe-lung; Rs, 400 x
Abbildung 178: niedriger HS Inhalts-stoffe in den Zellen, Rs, 400 x
Abbildung 179: piceoide Tüpfelung im SH; Rs, 1.000 x
Abbildung 180: taxodioide Tüpfelung im FH; Rs, 1.000 x
Abbildung 181: geknotelte Anschlüsse, ho-rizontal vertieft; Rs, 1.000 x
Abbildung 182: kristalline Einschlüsse, Rs, 1.000 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 144
Tangentialschnitt
Homozellulare Holzstrahlen, oftmals mit Einlagerungen.
Die Holzstrahlen sind überwiegend mind. 10 Zellen hoch, vereinzelt auch sehr
hohe und sehr niedrige Holzstrahlen. (Abb. 183-186)
Abbildung 183: nur einreihige, vorwiegend hohe HS, vereinzelt auch kürzere; Ts, 40 x
Abbildung 184: oftmals Einschlüsse in den ersten Zellen der HS; Ts, 100 x
Abbildung 185: hoher und niedrige HS; Ts, 400 x
Abbildung 186: i.d.R. ca. 10 Zellen hohe HS; Ts, 400 x
Anfangszellen bzw. einzelne Zellen der Holzstrahlen oftmals mit eingelagerten
Inhaltsstoffen und / oder vielfachen Tüpfelungen. (Abb. 187-189)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 145
Abbildung 187: Anfangszelle eines HS mit Einlagerungen, 1.000 x
Abbildung 188: einzelne Zelle im HS mit Inhaltsstoffen; Ts, 400 x
Abbildung 189: Anfangszelle mit vielfacher Tüpfelung; Ts, 1.000 x
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 146
Vergleich mit der Literatur
Grosser (Grosser, 1977) : Nadelholz
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Tracheiden:
Jahrringe deutlich voneinander abgesetzt;
weitlumig, dünnwandige Tracheiden im Frühholz;
englumige und dickwandige Spätholztracheiden;
innerhalb des Jahrringes allmählicher Übergang vom
Früh- zum Spätzholz
Parenchym:
äußerst spärlich, vereinzelt marginal an Jahrring-
grenze
Holzstrahlen:
Einreihig, homozellular;
überwiegend hohe Holzstrahlen ab 10 Zellen;
Horizontal- und Radialwände dick, reichlich getüpfelt;
Endwände mit zahnradartigem Aussehen;
Kreuzungsfeldtüpfelung taxodiodid (FH) und z.T. pic-
eoid (SH);
Kantenzellen mitunter mit rechteckigen Kristallen
Harzkanäle:
keine, außer bei Wundgewebe
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 147
Schweingruber (Schweingruber F. H., 2011) : Nadelholz
Beschreibung Literatur Ergebnisse
Querschnitt:
gleitender bis krasser Übergang von Früh- zu Spät-
holz;
keine Harzkanäle, selten traumatische;
selten wenige terminale Parenchymzellen
Radialschnitt:
Hoftüpfel auf Längstracheiden meist einreihig;
homozellulare Holzstrahlen mit knotenförmigen Tan-
gentialwänden, Horizontalwände dick, glatt bis
zahnradförmig;
Tüpfel im Frühholz taxodiodid, im Spätholz piceoid;
2-4 Tüpfel pro Kreuzungsfeld;
selten Kristalle in Kantenzellen
Tangentialschnitt:
Holzstrahl durchschnittlich 15-25 Zellen hoch;
Vorwiegend hohe Holzstrahlen ab 10 Zellen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 148
4 DISKUSSION DER ERGEBNISSE
Faserlängen
Wie auch in Grafik 1 ersichtlich, konnte nachgewiesen werden, dass die Nadel-
hölzer längere Fasern aufweisen als die Laubhölzer. D.h., die Nadelholz-Tra-
cheiden waren länger als die Libriformfasern bzw. Fasertracheiden der
Laubhölzer.
Spannend waren die Untersuchungen und Ergebnisse der seltenen Holzarten
bzw. Kleinbaum- und Straucharten, denn hierfür gab es im Vorhinein kaum An-
haltspunkte aus Erfahrungswerten oder Literatur.
Eine Auffälligkeit beim Literaturabgleich war jedoch, dass die amerikanischen
Daten durchgängig einen ähnlichen Längenbereich wie die Ergebnisse aufwie-
sen jedoch der untere Grenzwert bereits höher angesetzt war. Die Ergebnisse
lagen in etwa um 0,05 mm bis 0,8 mm unter diesem Grenzwert.
Europäische Literatur zu selten genutzten Laubholzarten (v.a. Kleinbäume und
Sträucher) war bis dato nicht vorhanden. Vergleiche konnten daher nur
gegenüber amerikanischer Daten gezogen werden.
Europäische Literatur zu Nadelhölzern gab es hingegen ausreichend, weshalb
nur im Fall der Douglasie ein zusätzlicher Vergleich mit amerikanischer Literatur
vorgenommen wurde.
Generell war nicht bei jeder Literatur erkennbar, welche Grenzwerte angegeben
wurden. Die untersuchten Fasern wurden in einem Minimum-Maximum – Bereich
den Literaturwerten gegenübergestellt.
Eine Möglichkeit der Abweichungen könnte durchaus eine unterschiedliche Dar-
stellung der Grenzwerte der Faserlängen sein.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 149
4.1.1 Laubholz
Wie in Grafik 2 zu erkennen war, bildete die Berberitze die untere und die Rot-
buche die obere Grenze der Faserlängen dieser Untersuchungen. Die meisten
Laubhölzer wiesen Fasern in einer Länge von 0,7 mm – 1,3 mm auf.
Es ließ sich ein grober Größenbereich der Faserlängen, differenziert zwischen
ring-, halbring- und zerstreutporigen Laubholzarten, feststellen:
Tendenziell kürzere Fasern wiesen die ringporigen Holzarten auf, die zerstreut-
porigen vorwiegend längere. Die Fasern der halbringporigen Holzarten deckten
den gesamten Übergangs- bzw. Zwischenbereich ab.
Einzig die Rotbuche war hier nicht eindeutig als halbring- oder zerstreutporig ein-
zuordnen, sie nahm zudem einen beinahe eigenen Längenbereich ein (Einteilung
siehe Grafik 28). Die Unterteilung der Laubholzarten in ring-, halbring- und zer-
streutporig war auch in der Literatur nicht immer einheitlich.
Nachfolgende Grafik zeigt die Faserlängenbereiche der untersuchten Laubhol-
zarten:
Grafik 38: Übersicht Faserlänge Laubhölzer mit Unterteilungen
ringporig
0,27 – 1,36 mm
halbringporig
0,29-1,1,79 mm
zerstreutporig
0,46 mm – 2,21 mm
Rotbuche
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 150
Besonders bei der amerikanischen Datenbank „InsideWood“ (University, 2016) fiel
auf, dass bei allen zu vergleichenden Holzarten entweder keine Daten zu den
Faserlängen oder „allgemeine Faserlängen“ von 0,9 mm - 1,6 mm angegeben
war. Diese Angabe dürfte als allgemeiner Richtwert für diverse Holzarten gelten.
Bezöge man sich auf diese Daten, könnten die einzelnen Ergebnisse präzisiert
werden.
Im Abgleich mit den Daten von Cecilia A. (University of Liverpool: Cecilia A. Western
Wood Reference Collection Archive:, 2016) wurden bei allen vergleichbaren Hol-
zarten ähnliche Faserlängenbereiche ermittelt. Teilweise könnten die Grenzwerte
aufgrund der Messergebnisse geringfügig ausgedehnt werden. Die gemessenen
Faserlängen waren im Durchschnitt 0,05 mm - 0,5 mm unter den in der Literatur
angegebenen Grenzwerten angesetzt.
Inwiefern Abweichungen zwischen Amerika und Europa in Klima- und
Wachstumsverhältnissen sowie Artenunterschiede und daraus folgend der
Ergebnisse relevant sind, wurde in diesen Gegenüberstellungen nicht
berücksichtigt.
Es wäre jedoch ein wesentlicher Aspekt dies zu berücksichtigen bzw. die
Grundlagen für europäische Holzeigenschaften anzugleichen, zumal es derzeit
kaum Literatur gibt.
Gegenüber den europäischen Daten aus dem Holzatlas (Wagenführ, 5. Auflage,
2000) müssten die Daten aufgrund der Ergebnisse präzisiert werden. Bei den
meisten Holzarten waren die Grenzwerte der Ergebnisse etwa um 0,05 mm – 0,3
mm nach unten verschoben. In wenigen Fällen ergaben die Messungen größere
Faserlängenbereiche, somit müssten die Grenzwerte nach unten und oben an-
gepasst werden. Einige Ergebnisse waren exakt im Rahmen der Literaturdaten.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 151
Die Daten des Fiber Atlas (Sisko & Pfäffli, 1995) waren den Ergebnissen aus
diesem Projekt sehr ähnlich, mit wenigen, geringfügigen Abweichungen analog
den o.a..
Da in diesem Projekt keine mikroskopische Untersuchung der Fasern vorge-
nommen wurde, waren Rückschlüsse auf die Art der vermessenen Fasern nicht
möglich. Somit wäre es möglich, dass vorrangig Fasertracheiden vermessen
wurden und wenige bzw. keine Libriformfasern. Dies hätte u.U. Auswirkungen auf
die Ergebnisse.
Laut Literatur (Grosser, 1977) sind Libriformfasern um bis zu 0,3 – 0,4 mm länger
als Fasertracheiden.
Es wurde keine signifikante lineare Korrelation zwischen Faserlänge und
Rohdichte beim Holzartenvergleich festgestellt, eine Tendenz eines Zusammen-
hanges war ableitbar. (Grafik 20-25)
Zwischen Faserlänge und Zugfestigkeit waren keine signifikante linearen Korre-
lationen in der direkten Gegenüberstellung der Daten erkennbar. (Grafik 30-35)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 152
4.1.2 Nadelholz
Wie in Grafik 1 ersichtlich, lagen die Faserlängen der Nadelhölzer über den
Faserlängen der Laubhölzer. Grafik 3 zeigt ausschließlich die Ergebnisse der un-
tersuchten Nadelhölzer:
Die kürzesten Fasern wies die Thuje auf, die längsten Fasern konnten bei der
Tanne gemessen werden.
Die Literaturabgleiche wurden gegen europäische Daten vorgenommen. Die
Daten der Douglasie wurden zusätzlich mit amerikanischer Literatur verglichen.
Gegenüber den Daten aus dem Holzatlas müssten die Daten aufgrund der
Ergebnisse präzisiert werden. Bei allen Holzarten waren die Grenzwerte der
Ergebnisse etwa um 1,0 mm – 1,4 mm nach unten verschoben. Weiters ergaben
die Messungen andere bzw. verschobene Faserlängenbereiche, somit müssten
die oberen Grenzwerte ebenso angepasst werden.
Die Daten des Fiber Atlas waren den Ergebnissen aus diesem Projekt ähnlich,
mit wenigen, geringfügigeren Abweichungen analog den o.a..
Besonders bei den amerikanischen Literaturdaten (Bodner, 1983) waren große
Abweichungen zu den hier erzielten Ergebnissen ersichtlich. Die amerikanischen
Daten waren separiert in Frühholz- und Spätholzfasern, die jeweils komplett un-
terschiedliche Längenbereiche und Grenzwerte aufwiesen. Ein Vergleich zu den
europäischen Daten war hier kaum möglich, dazu hätten die Fasern analog die-
ser Arbeit separiert werden müssen.
Da hier keine mikroskopische Untersuchung der Fasern vorgenommen wurde,
waren Rückschlüsse auf die Art der vermessenen Fasern nicht möglich. Somit
wäre es möglich, dass vorrangig Frühholzfasern vermessen wurden jedoch nur
wenige bzw. keine Spätholzfasern. Dies hätte u.U. deutliche Auswirkungen auf
die Ergebnisse.
Laut o.g. Datenerhebung Bodner sind Spätholzfasern um bis zu 1,1 – 1,5 mm
länger als Frühholzfasern.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 153
Mikroskopische Analyse
Es wurden zwei Arten von ringporigem, ein halbringporiges und ein zerstreu-
poriges Laubholz analysiert. Eine Holzart mit Übergangsform halbring- bis zer-
streutporig und ein Nadelholz wurden ebenso untersucht.
Nadelhölzer haben gegenüber den Laubhölzern den simpleren anatomischen
Aufbau. Hier gab es weniger Zellarten zu unterscheiden. Differenzierungen erfol-
gten durch Anordnung und Aussehen von Zellverbänden und Vorkommen bzw.
nicht Auftreten von bestimmten Zellverbänden.
Die Tanne erwies sich als überaus einfach aufgebautes Exemplar, dessen Merk-
male eindeutig und ident der Literatur waren:
keine Harzkanäle
deutlich abgegrenzte Jahrringgrenzen;
sukzessiver Übergang von Früh- zu Spätholz;
Parenchymzellen marginal / terminal am Jahrringende
einreihige, hohe, homozellulare Holzstrahlen mit geknotelten Endwänden;
Hoftüpfel einreihig;
Kreuzungsfeldtüpfel im Frühholz taxodiodid, piceoid im Spätholz;
kristalline Ablagerungen in den Holzstrahlen
Bei den Literaturvergleichen der Laubhölzer ab und an geringfügige Abwei-
chungen zu den Ergebnissen der Untersuchung.
Die häufigsten Differenzen gab es in der Anordnung der Parenchyme und in der
Unterscheidung der Faserarten Libriformfaser bzw. Fasertracheiden. Diese bei-
den Faserarten waren nicht leicht zu unterscheiden und lagen bei einigen Hol-
zarten ferner als Übergangsformen oder Gewebeverband beider Arten vor.
Holzstrahlentypologie wurde ab und an ebenso divers analysiert.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 154
Die Literatur war sich bei der Zuordnung von ring-, halbring- oder zerstreutporig
oftmals nicht einig. Beschrieben wurden z.T. auch Misch- bzw. Über-
gangsformen.
Als ringporiges Laubholz wurde der Sanddorn untersucht. Es konnten folgende
Besonderheiten herausgearbeitet werden:
Tracheiden im mehrreihigen Frühholz-Porenkreis;
Anordnung der Zellen im Frühholz-Porenkreis: größte Gefäße nicht direkt
an der Jahrringgrenze anschließend, sondern etwas entfernt;
stockwerkartiger Aufbau der Holzstrahlen;
Holzstrahlen meist 2-reihig, sehr dicht gereiht, äußerst niedrig, vorwiegend
heterogen (Typ II und III nach Kribs);
reichlich angelagerte Inhaltsstoffe in Zellen und Gefäßen;
kleine Gefäße mit engen, zarten Spiralverdickungen
Die Berberitze, als Gegenstand der Untersuchung einer weiteren ringporigen
Holzart, brachte folgende Besonderheiten hervor:
ein- bis 2-reihiger Gefäßkranz am Jahrringbeginn, folgende Gefäße deut-
lich kleiner und in schrägen bis tangentialen Reihen / Bändern angeordnet;
unregelmäßig verlaufende Jahrringgrenze;
Holzstrahlen sehr breit und hoch, an Jahrringgrenze leicht verdickt;
Holzstrahlen vorwiegend homogen, wenige heterogene, öfter mit
Scheidenzellen;
Gefäße mit kräftigen Spiralverdickungen, einfachen Durchbrechungen
und alternierenden intervaskulären Tüpfel;
Fasern vorwiegend dickwandig und englumig, mit Spiralverdickungen
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 155
Als halbringporiges Laubholz wurde der Flieder identifiziert. Folgende Merkmale
konnten analysiert werden:
Lockerer, 1- bis 2-reihiger Frühholz-Porenring, folgende Gefäße stetig in
Größe und Häufigkeit abnehmend, jedoch relativ dicht verteilt;
Jahrringgrenze deutlich;
Kernholz mit Thyllen, Inhaltsstoffen und z.T. kristalline Ablagerungen
Zellen der Holzstrahlen;
Häufiges Parenchym paratracheal spärlich;
Holzstrahlen unterschiedlich heterogen (Typ I – III nach Kribs), sehr eng-
gestellt, schmal (meist 2-reihig) und relativ niedrig; Tüpfel in Kreuzungs-
feldern vergrößert;
Gefäße und Fasern mit Spiralverdickungen
Die zerstreutporige Hasel wies folgende Besonderheiten auf:
Querschnitt durchzogen von langen, radialen Porensträngen, über den
Jahrring gleichmäßig verteilt;
Jahrringgrenze deutlich;
Holzstrahlen 1- bis 2-reihig, hoch, sehr enggestellt, an Jahrringgrenze
leicht verdickt, mit Inhaltsstoffen gefüllt;
heterogene Holzstrahlen, quadratische Kantenzellen mit großen Tüpfeln;
unzählige Scheinholzstrahlen in unterschiedlichsten Höhen und Breiten,
hier als musterartiges Band;
Parenchym apotracheal diffus bis diffus gehäuft;
Fasern dickwandig und englumig; teils mit Septen
Gefäße mit kräftigen, leiterförmigen Durchbrüchen und opponierter inter-
vaskulärer Tüpfelung, selten mit zarter Spiralverdickung
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 156
Die schwierigste Analyse war die der Rotbuche. Sie wurde letztlich als halbring-
bis zerstreutporig eingeordnet. Folgende Merkmale wurden herausgearbeitet:
kein ausgeprägter Porenring zu Beginn des Jahrringes;
Gefäße groß, länglich oval bis rundlich, relativ gleichmäßig dicht gesetzt;
mit leiterförmigen oder einfachen Durchbrechungen und opponierten bis
scalariformen intervaskulären Tüpfeln;
im letzten Spätholz Größe und Häufigkeit der Gefäße abnehmend, die
letzten Spätholz - Zellreihen annähernd porenfrei;
Parenchymzellen häufig, apotracheal diffus gehäuft, beinahe bänderartig;
sehr breite und sehr hohe Holzstrahlen, deutlich verdickt an Jahrring-
grenze, dazwischen schmälere und weniger hohe; Spektrum der
Holzstrahlen sehr vielfältig;
Holzstrahlen meist heterogen (Typ II nach Kribs) mit vergrößerten Tüpfeln
in Kantenzellen; vereinzelt homogene, einreihige Holzstrahlen vertreten;
Fasern reichlich getüpfelt, dickwandig und englumig, mitunter septiert
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 157
5 ZUSAMMENFASSUNG
Die Nadelhölzer (NH) wiesen generell längere Tracheiden (Fasern) auf, als die
Libriformfasern bzw. Fasertracheiden des Laubholzes waren. Faserlängen der
Laubhölzer konnten außerdem gruppiert werden in (zp) zerstreutporige, (hp) hal-
bringporige und (rp) ringporige Arten.
Einzig die Rotbuche konnte der Faserlänge nach nicht eindeutig als halbringporig
oder zerstreutporig zugeordnet werden, sie nahm eine Zwischenform ein.
Spannende Ergebnisse bargen die Fasermessungen selten genutzten Holzarten.
Da bis dato keine europäische Literatur dazu existierte, gab es vorab keine An-
haltspunkte oder Erfahrungswerte, die eine Richtung vorgeben hätten können.
Eine Übersicht der Ergebnisse aller untersuchten Holzarten (Tab. 49):
Tabelle 33: Gesamtübersicht der Faserlängenmessungen
HA Nr.
Holzart Name
Art Min. [mm]
Max. [mm]
MW
[mm] Median
[mm]
5 Berberitze hp 0,25 0,70 0,43 0,42
11 Hasel zp 0,75 1,90 1,21 1,21
12 Hartriegel hp 0,50 1,50 1,03 1,04
33 Douglasie NH 1,50 3,30 2,33 2,32
39 Weide zp 0,55 2,20 1,07 1,06
41 Holunder zp 0,55 1,40 0,94 0,93
47 Flieder hp 0,30 0,85 0,59 0,59
49 Thuje NH 0,80 3,60 1,87 1,86
52 Rosskastanie zp 0,45 1,00 0,72 0,73
55 Sanddorn rp 0,30 0,90 0,61 0,61
56 Rotbuche hp-zp 0,65 1,80 1,19 1,17
57 Ahorn zp 0,55 1,10 0,88 0,89
58 Tanne NH 1,80 5,10 3,67 3,64
61 Marille hp 0,35 1,35 0,76 0,72
67 Esche rp 0,55 1,35 0,89 0,89
71 Birne zp 0,65 1,75 1,07 1,05
Die ringporigen Holzarten wiesen Fasern im Bereich zwischen 0,50 – 1,15 mm
auf. Die Fasern der halbringporigen Hölzer waren zwischen 0,30 – 1,0 mm lang
und die der zerstreutporigen Arten in einem Bereich von 0,55 – 1,40 mm an-
gesiedelt.
Einzig Fasern der Rotbuche nahmen einen Bereich zwischen 0,9 – 1,55 mm ein.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 158
Die Messungen der untersuchten Nadelholzfasern ergaben Faserlängen
zwischen 1,10 mm und 5,10 mm, was einen deutlichen Unterschied zu den
Laubhölzern ergab. Tanne-Fasern waren die längsten. Die kürzesten Fasern
waren die der Thuje.
Die Untersuchungen zur Korrelation der Faserlänge mit der Rohdichte aller Hol-
zarten ergaben auf Individuen-Ebene keine signifikanten Ergebnisse. Ringporige
Laubhölzer korrelierten mit einem höheren Korrelationskoeffizient (r = 0,7578,
Grafik 24). Auf einzelnen Holzarten betrachtet, konnten signifikante Korrelationen
mit einem Korrelationskoeffizient r ≤ 0,85 festgestellt warden (Grafik 26-29).
Die Untersuchung zur Korrelation der Faserlänge mit der Zugfestigkeit alle Hol-
zarten keine ergab keine signifikanten Ergebnisse. Ein Abgleich erfolgte in der
direkten Gegenüberstellung der Daten. (Grafik 30)
Zwei Holzarten korrelierten mit einem signifikanten Korrelationskoeffizient ≤ 0,85
(Grafik 36,37)
Die mikroskopische Untersuchung der Rotbuche war im Vergleich zu den
weiteren untersuchten Arten, am schwierigsten und aufwendigsten. Letztlich
konnte dieses Individuum als halbringporig bis zerstreutporig eingeordnet
werden. Als charakteristische Merkmale wurden die überaus breiten und hohen
Holzstrahlen, die selbst makroskopisch ein Erkennungsmerkmal darstellen,
eingeordnet.
Im Weiteren wurden die Berberitze und der Sanddorn den ringporigen Holzarten
zugeordnet.
Die Berberitze wies als mikroskopisches Charakteristikum Scheidenzellen in den
Holzstrahlen und eine unregelmäßig, beinahe gewellte, Jahrringgrenze auf.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 159
Charakteristisches Merkmal des Sanddorns waren die stockwerkartigen, sehr
niedrigen Holzstrahlen. Auch waren die Größenanordnungen der Gefäße im
Frühholz-Porenring markant.
Zu den halbringporigen Holzarten wurde in dieser Untersuchung der Flieder ger-
eiht. Hier konnten als Charakteristika einerseits die Schraubenverdickungen an
Fasern und Gefäßen und andererseits die sehr dicht und regelmäßig an-
geordneten 2 Reihen breiten Holzstrahlen deklariert werden.
Von den zerstreutporigen Holzarten wurde die Hasel analysiert. Hier waren vor
allem die überaus zahlreichen Scheinholzstrahlen ein markantes Merkmal. Diese
fielen, angeordnet in einem breiten, musterartigen Band im Tangentialschnitt,
umgehend auf. Die Fasern der Hasel waren mitunter mit zarten Spiralver-
dickungen und führten Septen.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 160
SUMMARY
In general, softwood fibers (SW, tracheids) were longer than the fibers (libriform
fibers or fiber-tracheids) of determined hardwoods. Furthermore, hardwoods
could be classified in diffuse-porous (dp), semi-ring-porous (sp) and ring-porous
species even due to their fiber lengths.
The only species, which could not be classified exactly was beech, it was rated
as semi-ring-porous to diffuse-porous.
Results of fiber length measurements of rarely used wood species were exciting.
Until now there has been no literature of fiber lengths and even no clues or expe-
riences to lead the way.
Results of all fiber length measurements that have been investigated within this
project are shown in the table below:
Tabelle 34: results of fiber length measurements
nr. wood species type min. [mm]
max. [mm]
mean value
[mm] median value
[mm]
5 barberry sp 0,25 0,70 0,43 0,42
11 hazel dp 0,75 1,90 1,21 1,21
12 dog-berry sp 0,50 1,50 1,03 1,04
33 douglas fir SW 1,50 3,30 2,33 2,32
39 willow dp 0,55 2,20 1,07 1,06
41 common elder dp 0,55 1,40 0,94 0,93
47 syringa sp 0,30 0,85 0,59 0,59
49 thuja SW 0,80 3,60 1,87 1,86
52 horse-chestnut dp 0,45 1,00 0,72 0,73
55 sea buckthorne rp 0,30 0,90 0,61 0,61
56 beech sp-dp 0,65 1,80 1,19 1,17
57 maple dp 0,55 1,10 0,88 0,89
58 fir SW 1,80 5,10 3,67 3,64
61 apricot tree sp 0,35 1,35 0,76 0,72
67 ash rp 0,55 1,35 0,89 0,89
71 pear tree dp 0,65 1,75 1,07 1,05
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 161
Fibers of ring-porpous wood species achieved lengths in a range of 0,50 – 1,15
mm. Fibers of semi-ring-porous woods had typical lengths of 0,30 – 1,0 mm. Fiber
lengths in a range of 0,55 – 1,40 mm were the results oft he measurements of
diffuse-porous woods.
Only the fibers of beech took a range of 0,9 – 1,55 mm for their own.
Measurements of softwood fibers delivered lengths of 1,10 – 5,10 mm. This made
a significant difference to fiber lengths of hardwoods. The longest fibers pertained
to fir, shortest fibers belonged to thuja.
The investigation did not reveal significant linear correlation between fiber length
and bulk density, comparison based on the individuals (graph 20).
Ring-porous woods were in direction to correlate significantly (r = 0,7578, graph
24) and some wood species correlated with a correlation coefficient ≤ 0,85
(graphs 26-29)
The investigation did not reveal significant linear correlation between fiber length
and tensile strength, based on direct comparison (graph 30). The tensile streght
was not significantly dependent on fiber length, regardless of wether softwoods
or kind of hardwoods.
Some wood species correlated with a correlation coefficient ≤ 0,85 (graphs 36,37)
Microanalysis of beech was very complex and laborios. At least this individuum
could be classified as semi-ring-porous to diffuse-porous woods. Characteristic
features were the extremely wide and high rays, in addition they are visible in
macroscopic scale and a main feature.
Common barberry and sea-buckthorne were classified as ring-porous woods.
Significant features of barberry were sheath cells in the cell structure of rays.
Another characteristic was the uneven, nearly wavey, growth ring boundaries.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 162
Microscopic analysis of sea-buckthorn showed rays, built storied and few cells
high. Even the arrangement of wide vessels within the earlywood pore ring was
very distinct.
One of analyzed semi-ring-porous woods was syringa. It´s characteristic proper-
ties included the screw thickenings of vessels and fibers as well as the regularly
and closely arranged double-tier rays.
As a representative of diffuse-porous woods the hazel was analyzed. The ex-
tremely abundant arising aggregate rays were a significant feature. They ap-
peared in a patterned band and could be immediately noticed on tangential sec-
tion. The septated fibers also showed srew thickenings occasionally.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 163
6 VERZEICHNISSE
Abkürzungsverzeichnis
bzw. beziehungsweise
d.h. das heißt
et.al. et altera
evtl. eventuell(e)
FH Frühholz
HS Holzstrahl(en)
i.d.R. in der Regel
JR Jahrring
o.a. oben angeführt(e/n)
o.g. oben genannte(n)
Qs Querschnitt
Rs Radialschnitt
SH Spätholz
spp. mehrere Arten zu einer Gattung gehörig
Ts Tangentialschnitt
u. und
u. a. unter anderem
u.U. unter Umständen
zB. zum Beispiel
z.T. zum Teil
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 164
Literaturverzeichnis
Bodner, J. (06 1983). Effect of Thinning and Fertilization on Wood Properties and Intra-Ring Characteristics in Young Douglas-fir (Master Thesis). USA, Oregon.
Gerlach, D. (1984). Botanische Mikrotechnik Eine Einführung. Georg Thieme Verlag.
Grosser, D. (1977). Die Hölzer Mitteleuropas; Ein mikrophotographischer Lehratlas (Reprint der 1. Auflage 1977 Ausg.). Deutschland: Verlag Dr. Kessel.
Schweingruber, F. H. (2011). Anatomie europäischer Hölzer. Deutschland: Kessel.
Schweingruber, F. H., & Gärtner, H. (2013). Microscopic Preparation Techniques for Plant Stem Analysis. D-53424 Remagen-Oberwinter: Verlag Dr. Kessel.
Sisko, M., & Pfäffli, I. (1995). Fiber Atlas; Identification of Papermaking Fibers. Deutschland: Springer Verlag.
University of Liverpool: Cecilia A. Western Wood Reference Collection Archive:. (14. 08 2016). Abgerufen am 14. 08 2016 von http://pcwww.liv.ac.uk/~easouti/Cecilia%20A.%20Western%20Wood%20Reference%20Collection%20Notebook.html
University, n. -N. (13. 03 2016). insidewood. Abgerufen am 03. März 2016 von (http://pcwww.liv.ac.uk/~easouti/Cecilia%20A.%20Western%20Wood%20Reference%20Collection%20Notebook.html)
Wagenführ, R. (5. Auflage, 2000). Holzatlas. Deutschland: Fachbuchverlag Leipzig.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 165
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Holzpräparate in Eprouvetten .................................................................18 Abbildung 2: Holzpräparate in Erlenmeyerkolben ........................................................18 Abbildung 3: Becherglas mit 50 ml der fertigen Mazerationslösung .............................18 Abbildung 4: Kochvorgang ..........................................................................................18 Abbildung 5: mazeriertes Holz .....................................................................................18 Abbildung 6: mazerierte Fasern während der Färbung ................................................19 Abbildung 7: Arbeitsplatz Färbung und Spülung ..........................................................19 Abbildung 8: Fasern in Färbelösung ............................................................................20 Abbildung 9: nach erster Spülung ................................................................................20 Abbildung 10: fertig gespülte Fasern ...........................................................................20 Abbildung 11: Faserpulp .............................................................................................20 Abbildung 12: Mikrotomschlitten ..................................................................................22 Abbildung 13: Mikrotomschlitten mit Holzprobe und Mehrwegschneide .......................22 Abbildung 14: Färbestation ..........................................................................................22 Abbildung 15: frische, ungefärbte Schnitte ..................................................................24 Abbildung 16: Schnitte nach der Rotfärbung ...............................................................24 Abbildung 17: gewaschene Schnitte nach der Blaufärbung .........................................24 Abbildung 18: fertige Dauerpräparate vor der Trocknung ............................................24 Abbildung 19: Feinlineal 0,65-fach Zoom ....................................................................25 Abbildung 20: Feinlineal 5,0-fach Zoom ......................................................................25 Abbildung 21: Einstellung der globalen Maßgröße ......................................................26 Abbildung 22: Beispielbild Längenmessung der Fasern ..............................................27 Abbildung 23: Faserbild Nadelholz: Tanne, Probe Nr. 58.99.12; 1,25 x .......................27 Abbildung 24: Faserbild Laubholz: Sanddorn, Probe Nr. 55.0.4; 2,5 x .........................27 Abbildung 25: Gefäße () und andere Holzzellen wurden nicht vermessen ................27 Abbildung 26: ringporig mit tangentialer Gefäßanordnung, 3 ganze JR; Qs, 40x .........96 Abbildung 27: 4 ganze JR mit unregelmäßig verlaufender Grenze; Qs, 40 x ...............96 Abbildung 28: 2 JR, große FH-Poren, Gefäße im SH kleiner; Qs, 100 x ......................96 Abbildung 29: 1 JR, schräge bis tangentiale Gefäßanordnung; Qs, 100 x ...................96 Abbildung 30:FH-Poren an der JR-Grenze, Parenchymzellen (); Qs, 400 x .............97 Abbildung 31: SH-Poren; Qs, 400 x .............................................................................97 Abbildung 32: FH-Pore mit Verthyllung; Qs, 1.000 x ....................................................97 Abbildung 33: HS –Zellen, Parenchyme; Qs, 400 x .....................................................98 Abbildung 34: HS an der JR-Grenze leicht verdickt (); Qs, 400 x .............................98 Abbildung 35: HS; Qs, 1.000x .....................................................................................98 Abbildung 36: schmaler HS; Qs, 1.000 x .....................................................................98 Abbildung 37: hohe HS; Rs, 40 x, ................................................................................99 Abbildung 38: weniger hoher HS, Gefäßstrang; Rs, 100 x,..........................................99 Abbildung 39: heterogener HS, Gefäßstänge; Rs, 400 x, ............................................99 Abbildung 40: auftrechte / quadratische Kantenzellen () des HS; Rs, 1.000 x ..........99 Abbildung 41: Gefäßstrang mit diagonaler Tüpfelung und einfachen Durchbrechungen; Rs, 400 x ................................................................................................................... 100 Abbildung 42: einfache Durchbrechungen, Tüpfelung der Fasern und Gefäße; Rs, 400 x ................................................................................................................................ 100 Abbildung 43: Gefäße und Fasern mit Schraubenverdickungen: Rs, 1.000 x, ........... 100 Abbildung 44: alternierende intervaskuläre Tüpfelung, einfache Durchbrechungen; Rs, 1.000 x, ..................................................................................................................... 100 Abbildung 45: eng gereihte HS; Ts, 40x .................................................................... 101 Abbildung 46: vorwiegend mehrreihige, selten 1- bis 2-reihige HS, Ts, 100x ............ 101 Abbildung 47: HS und Gefäßstränge; Ts, 100 x ........................................................ 101
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 166
Abbildung 48: homogene HS Reihe, Gefäße mit Spiralverdickungen, dickwandige Fasern; Ts, 400 x ...................................................................................................... 101 Abbildung 49: mehrreihiger HS mit Scheidenzellen, 2-reihiger HS, Ts, 400 x ............ 102 Abbildung 50: HS m. Scheidenzellen, dickwandige Fasern, Ts, 400 x ....................... 102 Abbildung 51: HS heterogen; Ts, 400 x ..................................................................... 102 Abbildung 52: HS homogen; Ts, 1.000x .................................................................... 102 Abbildung 53: Spiralverdickungen, dickwandige Libriformfasern; Ts, 1.000 x ............ 102 Abbildung 54: Scheidenzellen (), Spiralverdickungen; Ts, 1.000 x ......................... 102 Abbildung 55: zerstreutporig; Qs, 40 x;...................................................................... 105 Abbildung 56: JR Grenze und hohe Anzahl HS; Qs, 100x; ........................................ 105 Abbildung 57: Poren des FH vereinzelt mit Einlagerungen / Thyllen; Qs, 100 x; ........ 106 Abbildung 58: FH: große Poren, weitlumigere Fasern, HS an JR-Grenze verdickt; Qs, 400 x; ........................................................................................................................ 106 Abbildung 59: Poren des SH; Qs, 100 x; ................................................................... 106 Abbildung 60: SH: weniger, kleinere Gefäße, dickwandige Fasern, diffuse Parenchmzellen (); Qs, 400 x; ................................................................................ 106 Abbildung 61: Tüpfelung im HS; Qs, 1.000 x; ............................................................ 106 Abbildung 62: Libriformfasern im SH, Fasertracheiden im FH; Qs, 1.000 x; .............. 106 Abbildung 63: HS mit unterschiedlicher Höhe, sehr zahlreich; Rs, 40 x; .................... 107 Abbildung 64: HS sehr eng stehend; Rs, 100 x; ........................................................ 107 Abbildung 65: Tüpfelungen in den Kreuzungsfeldern; Rs, 400 x;............................... 107 Abbildung 66: Kantenzellen quadratisch (); Rs, 400 x; ........................................... 107 Abbildung 67: HS mit Anlagerungen und großen Tüpfeln; Rs, 400 x; ........................ 108 Abbildung 68: Inhaltsstoffe, Zellwände HS; Rs, 1.000 x; ........................................... 108 Abbildung 69: opponierte Tüpfel; Rs, 1.000x; ............................................................ 108 Abbildung 70: leiterförmige Durchbrechungen; Rs, 1.000 x; ...................................... 108 Abbildung 71: HS mit unterschiedlicher Höhe, sehr zahlreich; Ts, 40 x; .................... 109 Abbildung 72: musterartiges Band aus Scheinholzstrahlen; Ts, 40 x; ........................ 109 Abbildung 73: HS meist ab 10 Zellen hoch; Ts, 100 x; .............................................. 109 Abbildung 74: ausgeprägte Scheinholzstrahlen; Ts, 100 x; ....................................... 109 Abbildung 75: vereinzelte 2-reihige HS; Ts, 400 x; .................................................... 110 Abbildung 76: Scheinholzstrahlen musterförmig; Ts, 400 x; ...................................... 110 Abbildung 77: ausgeprägte Scheinholzstrahlen; Ts, 400 x; ....................................... 110 Abbildung 78: Scheinholzstrahlen, Fasern mit Septen (); Ts, 400 x; ....................... 110 Abbildung 79: Scheinholzstrahlen zw. Fasern; Ts, 1.000 x; ....................................... 111 Abbildung 80: heterogene HS; Ts, 400x; ................................................................... 111 Abbildung 81: opponierte Tüpfel, Fasern mit Septen; Ts, 400 x; ................................ 111 Abbildung 82: zarte Spiralverdickungen; Ts, 1.00 x; .................................................. 111 Abbildung 83: große Tüpfel in Kantenzellen der HS; Ts, 1.000 x; .............................. 111 Abbildung 84: leiterförmige Durchbrechung; Ts, 1.000 x; .......................................... 111 Abbildung 85: halbringporig; Qs, 40 x; ....................................................................... 114 Abbildung 86: 1- bis 2-reihiger Porenkreis; Qs, 40 x; ................................................. 114 Abbildung 87: JR-Grenze; Qs, 100 x; ........................................................................ 115 Abbildung 88: 1-reihige, z.T. sehr enggestellte HS; Qs, 100 x; .................................. 115 Abbildung 89: JR-Grenze, Fasern von gleichem Aufbau; Qs, 200 x; ......................... 115 Abbildung 90: JR-Grenze mit SH- und FH-Poren; Qs, 400x; ..................................... 115 Abbildung 91: JR-Grenze, sehr englumige SH-Fasern; Qs, 1.000 x; ......................... 116 Abbildung 92: paratracheal spärliche Parenchymzellen / -stränge; Qs, 400x; ............ 116 Abbildung 93: wenig hohe HS; Rs, 40 x; ................................................................... 117 Abbildung 94: HS niedrig, dichtes Fasergewebe; Rs, 40 x; ....................................... 117 Abbildung 95: HS heterogen; Rs, 100 x; .................................................................... 117 Abbildung 96: HS mit großen Kreuzungsfeldtüpfeln (); Rs, 100 x; .......................... 117
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 167
Abbildung 97: HS 3 Zellen hoch, beidseitig quadratische Kantenzellen; Rs, 200x; .... 118 Abbildung 98: Fasertracheiden mit Tüpfel im SH; Rs, 200x; ...................................... 118 Abbildung 99: große Tüpfel in HS-Zellen, HS 8 Zellen hoch; Rs, 400 x; .................... 118 Abbildung 100: einfache Duchbrechung; Rs, 400 x; .................................................. 118 Abbildung 101: opponierte Tüpfel der Gefäße; Rs, 1.000 x; ...................................... 118 Abbildung 102: Spiralverdickung, einfache Durchbrechung, Tüpfel der Fasern; Rs, 1.000x; ...................................................................................................................... 118 Abbildung 103: dicht gesetzte HS; Ts, 40x; ............................................................... 119 Abbildung 104: HS vorwiegend 1- bis 4-reihig; Ts, 100x;.......................................... 119 Abbildung 105: Höhe der HS relativ niedrig; Ts, 200 x; ............................................. 119 Abbildung 106: heterogene HS, Spiralverdickung Gefäße; Ts, 400 x; ....................... 119 Abbildung 107: unterschiedliche Heterogenität; Ts, 400 x; ........................................ 120 Abbildung 108: breitere, 3- bis 4-reihige HS; Ts, 400x; .............................................. 120 Abbildung 109: 3-reihiger HS; ................................................................................... 120 Abbildung 110: Spiralverdickung Gefäße, Dickwandige Fasertracheiden getüpfelt; Ts, 1.000 x; ..................................................................................................................... 120 Abbildung 111: 1- bis 3-reihiger Porenkreis; Qs, 40 x; ............................................... 123 Abbildung 112: größte Gefäße in 2. od. 3. Reihe; Qs, 100 x; ..................................... 123 Abbildung 113: Poren vorwiegend einzeln oder paarig; Qs, 40 x; .............................. 124 Abbildung 114: HS und Poren mit Inhaltsstoffen; Qs, 100 x; ..................................... 124 Abbildung 115: netzartig erscheinende Tracheiden im FH; Qs, 400 x; ...................... 124 Abbildung 116: Fasertracheiden im SH mit diffusen Parenchymzellen; Qs, 400x; ..... 124 Abbildung 117: HS stockwerkartig aufgebaut; Qs, 400 x; .......................................... 125 Abbildung 118: paratracheal spärlicher Parenchymstrang (); Qs, 400 x; ................ 125 Abbildung 119: JR-Grenze, sehr eng stehende HS; Qs, 400x; .................................. 125 Abbildung 120: verthylltes Gefäß, diffus gehäuftes Parenchym; Qs, 400x; ................ 125 Abbildung 121:FH-Pore, paratracheal spärliches Parenchym; Qs, 1.000 x; ............... 125 Abbildung 122: SH mit kleinen Poren; Qs, 1.000 x; ................................................... 125 Abbildung 123: enggestellte HS; Rs, 40 x; ................................................................ 126 Abbildung 124: nur wenige Reihen breit und wenige Zellen hoch; Rs, 100 x; ............ 126 Abbildung 125: HS, beidseitige Kantenzellen, Inhaltsstoffe, dickwandige Fasern; Rs, 400 x; ........................................................................................................................ 126 Abbildung 126: HS homogen und heterogen; Rs, 400 x; ........................................... 126 Abbildung 127: Gefäße mit Schraubenverdickung, einfache Durchbrüche, Fasern getüpfelt; Rs, 400 x; .................................................................................................. 127 Abbildung 128: runde bis schlitzförmige Tüpfelung, Spiralvedickung der Fasern; Rs, 1.000 x; ..................................................................................................................... 127 Abbildung 129: beidseits einreihige Kantenzellen; Rs, 1.000 x; ................................. 127 Abbildung 130: reichlich Inhaltsstoffe; Rs, 1.000 x;.................................................... 127 Abbildung 131: engstehende HS; Ts, 40x; ................................................................ 128 Abbildung 132: HS sehr niedrig und schmal; Ts, 100 x; ............................................ 128 Abbildung 133: vorwiegend heterogene HS; Ts, 400 x; ............................................. 128 Abbildung 134: Spiralverdickung, dichtes Fasergewebe; Ts, 400 x; .......................... 128 Abbildung 135: vorwiegend heterogene HS; Ts, 400 x; ............................................. 129 Abbildung 136: Fasern getüpfelt; Ts, 1.000 x; ........................................................... 129 Abbildung 137: selten 3-reihige HS; Ts, 1.000 x; ....................................................... 129 Abbildung 138: Spiralverdickung und einfacher Durchbruch; Ts, 1.000 x; ................. 129 Abbildung 139: JR-Struktur mit breitem und langem HS; Qs, 40 x; ............................ 132 Abbildung 140: Porengröße und Häufigkeit im letzten SP abnehmend; Qs, 100x; ..... 132 Abbildung 141: JR-Grenze, 1-3 Zellreihen porenfrei, viele Parenchyme; Qs, 400 x ... 133 Abbildung 142: JR-Grenze mit Fasern beinahe lumenfrei; Qs, 1.000 x...................... 133 Abbildung 143: Porengruppe zu Beginn des JR im FH; Qs, 400 x ............................. 133
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 168
Abbildung 144: JR-Grenze, Parenchym häufig; Qs, 400 x ......................................... 133 Abbildung 145: einzelne Poren verthyllt; Qs, 1.000 x ................................................. 133 Abbildung 146: schmaler HS an JR-Grenze verdickt; Qs, 1.000 x ............................. 133 Abbildung 147: breiter HS unten, schmaler HS oben; Rs, 40 x .................................. 134 Abbildung 148: 1 breiter und 1 schmale HS; Rs, 100 x .............................................. 134 Abbildung 149: mehrreihiger heterogener HS; Rs, 400 x ........................................... 134 Abbildung 150: einreihiger, heterogener HS; Rs, 1.000 x .......................................... 134 Abbildung 151: Gefäße mit opponierter bis scalariformer intervaskulären Tüpfelung; Rs, 400 x ................................................................................................................... 135 Abbildung 152: Gefäße mit scalariformer, intervaskulären Tüpfelung, einfache Durchbrechung; Rs, 400 x ......................................................................................... 135 Abbildung 153: 1-reihiger HS, leiterförmige Durchbrechungen; Rs, 400 x ................. 135 Abbildung 154: dickwandige Fasern, septiert; Rs, 400 x ........................................... 135 Abbildung 155: leiterförmige Durchbrechung des Gefäßes; Rs, 1.000 x .................... 135 Abbildung 156: zahlreich getüpfelte Fasern (); Rs, 400 x ....................................... 135 Abbildung 157: Typische HS: unterschiedliche Breite und Höhe; Ts, 40 x ................. 136 Abbildung 158: verschieden breite und hohe HS; Ts, 40 x ........................................ 136 Abbildung 159: einreihige bis mehrreihige HS; Ts, 100 x .......................................... 136 Abbildung 160: unterschiedlich breite HS; Ts, 100 x .................................................. 136 Abbildung 161: ein- und mehrreihige HS; Ts, 1.000 x ................................................ 137 Abbildung 162: Faser septiert (); Ts, 1.000 x .......................................................... 137 Abbildung 163: mehrreihiger, homogener HS; Ts, 400 x ........................................... 137 Abbildung 164: mehrreihiger, heterogener HS; Ts, 400 x .......................................... 137 Abbildung 165: HS mit Einlagerungen von Inhaltsstoffen, Qs Tanne, 40x ................. 140 Abbildung 166: 1 ganzer JR mit HS und gespeicherten Inhaltsstoffen; Qs, 1.000x .... 140 Abbildung 167: JR-Grenze, Qs, 100 x ....................................................................... 141 Abbildung 168: JR-Grenze mit Zellunterschieden, Qs, 400 x ..................................... 141 Abbildung 169: allmählicher Übergang FH-SH, Qs, 400 x ......................................... 141 Abbildung 170: FH dünnwandig und sehr weitlumig, Qs, 400 x ................................. 141 Abbildung 171: SH dickwandig und englumig, Qs, 400 x ........................................... 141 Abbildung 172: JR-Grenze terminales Längsparenchym, Qs, 1.000 x ....................... 141 Abbildung 173: i.d.R. hohe HS mit ≤ 10 Reihen; Rs, 40 x .......................................... 142 Abbildung 174: unterschiedlich hohe HS, Tüfelung der Fasern; Rs, 100 x ................ 142 Abbildung 175:; deutlich einreihige Tüpfelung der Tracheiden; Rs, 400 x .................. 142 Abbildung 176: einreihige Tüpfelung; Rs, 1.000 x ..................................................... 142 Abbildung 177: homogene HS mit Tüpfelung; Rs, 400 x ........................................... 143 Abbildung 178: niedriger HS Inhaltsstoffe in den Zellen, Rs, 400 x ............................ 143 Abbildung 179: piceoide Tüpfelung im SH; Rs, 1.000 x ............................................. 143 Abbildung 180: taxodioide Tüpfelung im FH; Rs, 1.000 x .......................................... 143 Abbildung 181: geknotelte Anschlüsse, horizontal vertieft; Rs, 1.000 x ..................... 143 Abbildung 182: kristalline Einschlüsse, Rs, 1.000 x ................................................... 143 Abbildung 183: nur einreihige, vorwiegend hohe HS, vereinzelt auch kürzere; Ts, 40 x .................................................................................................................................. 144 Abbildung 184: oftmals Einschlüsse in den ersten Zellen der HS; Ts, 100 x .............. 144 Abbildung 185: hoher und niedrige HS; Ts, 400 x ..................................................... 144 Abbildung 186: i.d.R. ca. 10 Zellen hohe HS; Ts, 400 x ............................................. 144 Abbildung 187: Anfangszelle eines HS mit Einlagerungen, 1.000 x ........................... 145 Abbildung 188: einzelne Zelle im HS mit Inhaltsstoffen; Ts, 400 x ............................. 145 Abbildung 189: Anfangszelle mit vielfacher Tüpfelung; Ts, 1.000 x ........................... 145
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 169
Grafikenverzeichnis
Grafik 1: Ergebnisse Faserlängen aller Holzarten .......................................................31 Grafik 2: Ergebnisse Faserlängen aller Laubholzarten ................................................32 Grafik 3: Ergebnisse Faserlängen aller Nadelholzarten ...............................................33 Grafik 4: Faserlängen gewöhnliche Berberitze ............................................................35 Grafik 5: Faserlängen blutroter Hartriegel ....................................................................38 Grafik 6: Faserlängen gemeine Hasel .........................................................................41 Grafik 7: Faserlängen Douglasie .................................................................................44 Grafik 8: Faserlängen Weide .......................................................................................47 Grafik 9: Faserlängen schwarzer Holunder .................................................................50 Grafik 10: Faserlängen gewöhnlicher Flieder ..............................................................53 Grafik 11: Faserlängen amerikanische Thuje ..............................................................56 Grafik 12: Faserlängen Rosskastanie ..........................................................................59 Grafik 13: Faserlängen Sanddorn ................................................................................62 Grafik 14: Faserlängen Rotbuche ................................................................................65 Grafik 15: Faserlängen Ahorn .....................................................................................68 Grafik 16: Faserlängen Tanne .....................................................................................71 Grafik 17: Faserlängen Marille ....................................................................................74 Grafik 18: Faserlängen Esche .....................................................................................77 Grafik 19: Faserlängen Birne .......................................................................................80 Grafik 20: Gesamtgrafik Gegenüberstellung aller Faserlängen - Rohdichte ................82 Grafik 21: Gegenüberstellung Faserlänge – Rohdichte der Nadelhölzer .....................83 Grafik 22: Gegenüberstellung Faserlänge – Rohdichte Laubhölzer .............................83 Grafik 23: Faserlänge – Rohdichte ringporige Laubhölzer ...........................................84 Grafik 24: Faserlänge – Rohdiche halbporige Laubhölzer ...........................................84 Grafik 25: Faserlänge – Rohdichte zerstreutporige Laubhölzer ...................................85 Grafik 26: Faserlänge – Rohdichte blutroter Hartriegel ................................................85 Grafik 27: Faserlänge – Rohdichte schwarzer Holunder ..............................................86 Grafik 28: Faserlänge – Rohdichte gewöhnlicher Flieder.............................................87 Grafik 29: Faserlänge – Rohdichte Rosskastanie ........................................................87 Grafik 30: Gesamtgrafik Gegenüberstellung aller Faserlängen - Zugfestigkeit ............88 Grafik 31: Faserlänge – Zugfestigkeit Nadelhölzer ......................................................89 Grafik 32: Faserlänge – Zugfestigkeit Laubhölzer .......................................................89 Grafik 33: Faserlänge – Zugfestigkeit ringporiger Laubhölzer ......................................90 Grafik 34: Faserlänge – Zugfestigkeit halbringporiger Laubhölzer ...............................90 Grafik 35: Faserlänge – Zugfestigkeit zerstreutporige Laubhölzer ...............................91 Grafik 36: Faserlänge – Zugfestigkeit Berberitze .........................................................91 Grafik 37: Faserlänge – Zugfestigkeit Esche ...............................................................92 Grafik 38: Übersicht Faserlänge Laubhölzer mit Unterteilungen ................................ 149
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 170
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Berberitze ..............................34 Tabelle 2: Datenauswertung Fasern Berberitze ...........................................................35 Tabelle 3: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen blutroter Hartriegel .................37 Tabelle 4: Datenauswertung Fasern Hartriegel ...........................................................38 Tabelle 5: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Hasel .....................................40 Tabelle 6: Datenauswertung Fasern Hasel ..................................................................41 Tabelle 7: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Douglasie ..............................43 Tabelle 8: Datenauswertung Fasern Douglasie ...........................................................44 Tabelle 9: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Weide ....................................46 Tabelle 10: Datenauswertung Fasern Weide ...............................................................47 Tabelle 11: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Holunder ..............................49 Tabelle 12: Datenauswertung Fasern Holunder ..........................................................50 Tabelle 13: Gesamtergebnisse der Faserlängenmessungen Flieder ...........................52 Tabelle 14: Datenauswertung Fasern Flieder ..............................................................53 Tabelle 15: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Thuje ...................................55 Tabelle 16: Datenauswertung Fasern Thuje ................................................................56 Tabelle 17: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Rosskastanie .......................58 Tabelle 18: Datenauswertung Fasern Rosskastanie ....................................................59 Tabelle 19: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Sanddorn .............................61 Tabelle 20: Datenauswertung Fasern Sanddorn .........................................................62 Tabelle 21: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Rotbuche .............................64 Tabelle 22: Datenauswertung Fasern Rotbuche ..........................................................65 Tabelle 23: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Ahorn...................................67 Tabelle 24: Datenauswertung Fasern Ahorn ...............................................................68 Tabelle 25: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Tanne ..................................70 Tabelle 26: Datenauswertung Fasern Tanne ...............................................................71 Tabelle 27: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Marille ..................................73 Tabelle 28: Datenauswertung Fasern Marille ..............................................................74 Tabelle 29: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Esche ..................................76 Tabelle 30: Datenauswertung Fasern Esche ...............................................................77 Tabelle 31: Gesamtergebnisse Faserlängenmessungen Birne ....................................79 Tabelle 32: Datenauswertung Fasern Birne ................................................................80 Tabelle 33: Gesamtübersicht der Faserlängenmessungen ........................................ 157 Tabelle 34: results of fiber length measurements ...................................................... 160 Tabelle 35: Stundenprotokoll ..................................................................................... 171
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 171
7 ANHANG
Protokolle
Tabelle 35: Stundenprotokoll
Datum Stunden Tätigkeit / Beschreibung weitere Personen
02.07.2015 3,0 Themenbesprechung DA, Projektumriss Mayer, Szmid, u.a.
15.09.2015 4,0 Probenvorbereitung: Katalogisierung (Über-nahme von BOKU); Ablaufplanung und Festlegung Projektschritte
Szmid
15.09.2015 0,5 Einreichung des Themas der Diplomarbeit über Plattform
Szmid, Dr. Bodner
17.09.2015 2,0 Probenvorbereitung: Anfertigung der Backen für die Zugproben
Szmid
13.10.2015 5,5 Durchführung der ersten Zugprüfungen (je Holzart eine Probe)
Szmid
20.10.2015 4,0 Zugprüfungen; Besprechung weitere Vorge-hensweise => Verschieben der weiteren Projektschritte um etwa 1 Monat
Szmid
23.10.2015 2,5 Zugprüfungen Szmid
05.11.2015 2,5 Zugprüfungen und Dokumentation Szmid
06.11.2015 1,5 Zugprüfungen und Dokumentation Szmid
17.11.2015 4,0 Dokumentation der Zugproben
18.11.2015 6,0 Tabellenstruktur Zugfestigkeit und Faserlän-gen
20.11.2015 1,5 Besprechung für Dokumentation der Bruch-bilder und der erstellten Vorlage der DA
Szmid
24.11.2015 6,5 Dokumentation der Bruchbilder (Fotos, Lis-teneintragung)
25.11.2015 1,5 Erstellung eines Layouts und Formatvorla-gen
04.12.2015 1,0 Verpackung der Bruchproben für Transport
07.12.2015 8,5
BOKU: Präparation der Bruchproben für die Mazeration (Werkstattarbeit), Mazeration der ersten Faserproben (Labortätigkeit), Li-teraturbesprechung; kurze Besprechung Mikroanalyse
Mayer, Dr. Grabner
05.01.2016 9,0 BOKU: Präparation der Faserproben, Foto-grafieren der Fasern für Messungen; Down-load, Erklärung und Einschulung imageJ,
Mayer
06.01.2016 4,0 Einarbeitung Programm; Fasermessungen 2 Holzarten (5, 11)
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 172
12.01.2016 1,0 Besprechung Auswertung Zugfestigkeit, Ko-ordination Datentransfer => einrichten eines Dropbox Accounts; Zugriffe auch für BOKU
Szmid
15.01.2016 2,5 Fasermessung 3 Proben (33, 39, 41)
16.01.2016 5,0 Fasermessung (47, 49, 52) und Literatur-recherche
17.01.2016 3,0 Literaturrecherche
23.01.2016 5,0 Fasermessungen (55, 56, 57, 58, 61)
24.01.2016 6,0 Fasermessung (67, 71) und Literaturrecher-che
17.02.2016 3,0 Literaturrecherche, Kommunikation mit BOKU wegen weiterer Faserbilder, Literatur, Mikroanalyse
20.02.2016 3,5 Fasermessung (5), Stukturierung Auswer-tung, Erstellung Tabellen
21.02.2016 3,5 Fasermessung (33,58), Tabellen
29.02.2016 1,0 Fasermessung (11)
01.03.2016 7,0 Datenkontrolle Zugfestigkeit; Datenbereini-gung und -aufbereitung
02.03.2016 4,5 Fasermessung, Formatvorlagen und Struk-tur
03.03.2016 2,5 Besprechung über Arbeitserfolge, Weiterfüh-rung, Aufgabenteilungen; Daten von Zugfes-tigkeit wiederholt eingefordert
Szmid, Bodner
10.03.2016 2,0 Fasermessung
15.03.2016 5,5 Datenauswertung Recherche, Grafikvorla-gen erstellen, Dateneingabe
23.03.2016 8,0 Fasermessung
24.03.2016 5,0 Fasermessung, Dateneingabe
25.03.2016 6,5 Dateneingabe, Optimierung Tabellen, Grafi-ken
26.03.2016 6,0 Fasermessung, Dateneingabe
07.04.2016 2,0 Literaturrecherche
14.04.2016 2,5 Fasermessung, Dateneingabe
18.04.2016 9,0 BOKU, Einschulung Mikroschnitte, Färben (Doppelfärbung) und Kleben von Dauerprä-paraten, Literaturbesprechung
Mayer, Dr. Grabner
21.04.2016 1,0 Fasermessung
25.04.2016 2,5 Besprechung Bodner: DA Text, Gliederung, Aufbau; Datenauswertung, Grafiken, Litera-tur und Weiterführung mit Mikroanalyse
Dr. Bodner
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 173
28.04.2016 5,0 Fasermessung, Dateneingabe, Text verfas-sen
01.05.2016 2,0 Datenauswertung
02.05.2016 3,5 Datenauswertung
05.05.2016 5,0 Datenauswertung
11.05.2016 6,0 Datenauswertung, Text verfassen
17.05.2016 8,5 Anfertigung Dauerpräparate, BOKU Mayer, Dr. Grabner
09.06.2016 3,0 Mikroskopie, Fotos
27.06.2016 7,0 Mikroskopie, Fotos
28.06.2016 3,5 Mikroskopie, Fotos
29.06.2016 6,0 Datenauswertung
30.06.2016 4,5 Datenauswertung
01.07.2016 3,5 Mikroskopie, Fotos
07.08.2016 8,0 Datensatz aufbereiten, Grafiken, Literaturab-gleich
08.08.2016 3,0 Datensatz aufbereiten, Grafiken,
08.08.2016 1,0 Besprechung Bodner: bisherige Ergebnisse und Korrelationen; weiterer Aufbau und Aus-blick der Arbeit und Ergebnisse
Dr. Bodner
09.08.2016 9,0 Datensatz aufbereiten, Grafiken, Text ver-fassen
10.08.2016 5,5 Mikroskopie, Fotos
11.08.2016 5,0 Mikroanalyse, Literatur
12.08.2016 8,0 Mikroanalyse, Literatur
13.08.2016 8,0 Mikroanalyse, Datenbanken Recherche
14.08.2016 10,0 Mikroanalyse, Text verfassen
15.08.2016 8,5 Mikroanalyse, Text verfassen
16.08.2016 9,0 Mikroanalyse, Text verfassen
17.08.2016 2,0 Text verfassen
18.08.2016 4,0 Text verfassen
19.08.2016 8,0 Mikroanalyse, Text verfassen
20.08.2016 6,5 Mikroanalyse, Text verfassen
21.08.2016 9,5 Mikroanalyse, Text verfassen
22.08.2016 10,5 Mikroanalyse, Text verfassen
23.08.2016 9,5 Text verfassen
24.08.2016 5,0 Überarbeitung Text, Formatierungen
28.08.2016 7,5 Überarbeitung Text, Formatierungen
29.08.2016 11,0 Überarbeitung Text, Formatierungen
30.08.2016 10,5 Überarbeitung Text, Formatierungen
02.09.2016 3,0 Korrekturen Text
03.09.2016 9,0 Korrekturen Text
04.09.2016 12,0 Korrekturen Grafiken
05.09.2016 3,0 Korrekturen Grafiken, Layout
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 174
05.09.2016 1,0 Besprechung letzte Änderungen, Finalisie-rung
Dr. Bodner
06.09.2016 4,5 Erstellung Poster für Präsentation BOKU; Aufbereitung und Zusammenstellung für Druck und Bindung
09.09.2016 1,0 Abgabe, Abschlussbesprechung Dr. Bodner
Summe 415,0
Betreuungsprotokolle
Protokoll BOKU: Auftakt Projektbesprechung 02.07.2015
Betreuungsprotokoll 15.09.2015
Betreuungsprotokoll 03.03.2016
Betreuungsprotokoll 08.08.2016
Betreuungsprotokoll 05.09.2016
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 175
Protokoll zur Besprechung
Diplomarbeiten 2015/16 an der HTL Mödling
Datum 2.Juli 2015 Ort: UFT BOKU, Tulln beteiligte Personen: Josef Fellner (HTL Möd-ling), Konrad Mayer (BOKU), Schüler der HTL-
Mödling: Schrammel Lukas, Weiss Gerald, Wolf Stefan, Kreitner Simon, Hartl Maximi-lian,
Wiklicky Markus, Szmid Filip, Tuschl Katharina
Diplomarbeiten:
• Themenfeld “Sorption, Quell- und Schwindmaße”:
Die bereits fertig präparierten Proben mit den Maßen 10x10x20mm (für die Ermittlung der Quell- und Schwindmaße) wurden an die Schüler übergeben. Aus diesem Material werden in weiterer Folge einzelne Wiederholungen zur Erstellung von Mikroschnitten aussortiert und an Fr. Katharina Tuschl weiter gegeben.
Das für die Erstellung der Sorptionskurven benötigte Probenmaterial wird bis frühes-tens Ende August seitens der BOKU vorbearbeitet (zu Probenkörpern mit den Maßen 20x20x60mm) und dann von den Schülern an der HTL Mödling zu Kammproben weiter verarbeitet. Die Schüler besprechen mit ihrem Betreuer Ernst Gautsch die in der DA zu bearbeitende Anzahl an Holzarten sowie den Probenumfang – dafür wird seitens der BOKU eine Liste mit dem verfügbaren Material in der entsprechenden Stärke bereit ge-stellt.
• Themenfeld „Oberflächeneigenschaften: Härte/Kratzfestigkeit/Abrieb“:
Der auf der BOKU verfügbare instrumentierte Prüfaufbau zur Bestimmung der Härte soll im Rahmen der Diplomarbeit genutzt werden. Außerdem wäre die Bestimmung der Kratzfestigkeit auf dem individuellen Prüfaufbau auf der BOKU möglich. Die Schüler haben bzgl. eines Termins in der ersten Septemberwoche für die Durchführung der Prüfung der Härte und Kratzfestigkeit angefragt – dieser muss noch seitens der BOKU organisiert werden und wird in weiterer Folge per Email bestätigt. Probenmaterial zur Durchführung der Härtebestimmung wird seitens der BOKU bis zum Termin präpariert. Vorzüglich sollen 2 cm starke Bretter verwendet werden, bei Holzarten wo diese Art von Prüfkörper nicht möglich ist sollen zwei 1cm dicke Bretter mit Kunstharz zu den entsprechenden Probendimensionen verleimt werden.
• Themenfeld „Zugfestigkeit – Bruchbild – Faserlänge“:
Die Schüler besprechen mit Prof. Bodner die Holzartenauswahl sowie die Probenanz-ahl – diese werden in weiterer Folge mittels CNC-Fräse auf der BOKU bis frühestens Ende August präpariert. Eine Liste mit Vorschlägen zur Holzartenwahl basierend auf der Bruchbildbeurteilung im vorangegangenen Biegeversuch (Bachelorarbeit), anato-mischen und technologischen Gesichtspunkten wird seitens der BOKU per email über-mittelt. Die taillierten Zugproben (mit einem zu prüfenden Querschnitt von 10x5mm) werden an der HTL Mödling von Filip Szmid an den Einspannungen mit Verstärkungen aus Buchenholz versehen und geprüft.
Beide Schüler werden im Herbst die geprüften Zugproben an der BOKU mazerieren und unter dem
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 176
Mikroskop Faserlängen messen. Durch den hohen mit diesem Arbeitsschritt verbunde-nen Zeitaufwand werden nicht alle Reste im Zeitrahmen der Diplomarbeit bearbeitbar sein. Alle nicht von den Schülern bearbeiteten Reste werden durch Mitarbeiter der BOKU übernommen und die Daten zur weiteren Verwendung in der DA zur Verfügung gestellt.
Katharina Tuschl hat um einen Termin an der BOKU angefragt um bei Michael Grabner Expertise zur Herstellung von Dauerpräparaten einzuholen – dieser wird sich diesbe-züglich per Email melden.
Aktionstag in Mödling 9. und 10 September:
• geplantes Programm Mittwoch: 8:00-11:30 Uhr
◦ Projektvostellung: ca. 1/2h Präsentation seitens der BOKU
◦ interaktive Ausarbeitung der Bestimmungsmerkmale: Die Schüler der zwei
ersten Klassen werden in 10 Gruppen geteilt (ca. 4 Schüler pro Gruppe) und bekommen je
Gruppe eine Holzart zugeteilt. Sie sollen unter Zuhilfenahme von Literatur (BOKU) und
Internetquellen ein von Konrad Mayer (BOKU) vorgefertigtes Formular zu den Bestimmungsmerkmalen der jeweiligen Holzart erarbeiten. Eine Liste der für eine Beprobung interessanten Holzarten wird seitens der BOKU übermittelt.
• geplantes Programm Donnerstag: halbtags Start 8:00 Uhr
◦ Die Schüler suchen in Gruppen nach mehreren Individuen der jeweiligen am
Vortag erarbeiteten Holzarten. Unterstützung bei der Betreuung der einzel-nen Gruppen wird durch einzelne Schüler der vierten Klasse gegeben, wel-che neben den vergebenen DA auch über die Unterstützung beim Aktions-tag in das Projekt eingebunden werden. Die gefundenen Hölzer sollen so-wohl mit einem Band markiert (noch nicht festgelegt wer sich um dieses kümmert) als auch über GPS-Wegpunkte festgehalten werden. Josef Fell-ner bespricht mit Hrn. Rauch vom Stadtgartenamt Mödling ob eine Bepro-bung im Rahmen des Aktionstages möglich ist – in diesem Fall werden so-wohl seitens der BOKU als auch der HTL Mödling Beprobungsmaterial (Säge, Schutzausrüstung etc.) zur Verfügung gestellt. Außerdem wird eine mögliche Unterstützung seitens eines Vertreters des Stadtgartenamtes be-grüßt. Die BOKU wird an diesem Aktionstag mit 3-4 Mitarbeitern vertreten sein.
Treffen im Rahmen der Profilschwerpunktbildung 17.September 9:00-12:00
Am Treffen werden 5 Vertreter der HTL Mödling (Bodner, Gautsch, Heiligenbrunner, Fellner, Anderl), 3 Vertreter der Forstschule Bruck/Mur ( Erich Gutschlhofer, Sebastian Slovik, Alfred Pongruber) sowie 6 Vertreter der BOKU teilnehmen.
Eine offizielle Einladung mit Vorstellung der Ziele und Inhalte des Treffens wird von Konrad Mayer (BOKU) ausgesendet.
Nach Möglichkeit wäre eine Führung durch die Räumlichkeiten der HTL Mödling Holz-technik /Sägewerk/Werkstätten wünschenswert.
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 177
BETREUUNGSPROTOKOLL DIPLOMARBEIT
Datum: Dienstag, 15.09.2015
Ort: HTL Mödling
Anwesende: Szmid, Tuschl, Dr. Bodner
Thema: Projektplanung;
Einreichung der Diplomarbeit
erledigtes: Zielsetzung lt. Protokoll v. 2.7.2015 (BOKU); grober Projektplan und Einteilung der Themengebiete; Einreichung der Diplomarbeit über die Plattform
to Do´s:
Szmid (eigene Protokolle) Tuschl: Timelines erstellen; Themenbereiche und Arbeitsgebiete konkretisieren; Zielsetzung der Einzelarbeiten; Termine mit BOKU für weitere Arbeiten planen
timelines:
Szmid (eigene Protokolle) Tuschl: Beginn mit Faserlängen und Mikroschnitten nach Abschluss der Zug-prüfungen Szmid (Plan: Ende Oktober 2015); erste Daten der Auswertung Faserlängen im Februar 2016; mikroskopische Analysen mit Erhalt der Dauerpräparate der BOKU; Layout und Draft der Arbeit im Mai 2016 Abgabetermin: 09.09.2016
Folgetermin: nach Bedarf
Unterschriften:
Katharina Tuschl DI Dr. Josef Bodner
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 178
BETREUUNGSPROTOKOLL DIPLOMARBEIT
Datum: Donnerstag, 03.03.2016
Ort: HTL Mödling
Anwesende: Szmid, Tuschl, Dr. Bodner
Thema: Zwischenbericht Arbeitserfolge
erledigtes:
Szmid: Zugprüfungen beendet, Daten jedoch noch nicht freigegeben; Tuschl: Daten von Szmid bereits wiederholt eingefordert, inkl. richtiger Probenzu-ordnung; Mazeration im Jänner an der BOKU: einen Teil davon selbst erledigt, der Rest wird mazeriert und Fotos der Fasern zur Messung übermittelt; Messprogramm "imageJ" dafür in Verwendung; Faserlängenmessungen voll im Gange, einige bereits vollständig abge-schlossen; Abgleich mit der Zugfestigkeit nach Erhalt der Daten möglich; Dauerpräparate Mikroschnitte werden auch auf der BOKU angefertigt, Termin dazu folgt; Layout für Arbeit und Tabellen erstellt;
to Do´s:
Szmid: Daten übermitteln Tuschl: Faserlängenmessung abschließen und Abgleiche mit der Zugfestigkeit vornehmen (nur mögliche lineare Korrelation); Termine für Mirkoschnitte ausmachen; Literatur zur Faserlänge relativ schwierig, evtl. mehr dazu in der Papier-industrie oder auch auf der BOKU? Arbeiten Szmid und Tuschl werden separat weitergeführt, auch die Titel der Arbeiten werden dementsprechend abgeändert
timelines: Termin mit BOKU für Mikroschnitte im April; Fasermessungen und Vergleiche bis Ende April; erster Draft der Arbeit evtl. im Mai möglich
Folgetermin: nach Bedarf
Unterschriften:
Katharina Tuschl DI Dr. Josef Bodner
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 179
BETREUUNGSPROTOKOLL DIPLOMARBEIT
Datum: Donnerstag, 03.03.2016
Ort: HTL Mödling
Anwesende: Tuschl, Dr. Bodner
Thema: Zwischenbericht Arbeitserfolge Fertigstellung und Ergebnisse
erledigtes:
Faserlängenmessungen, Abgleich mit der Zugfestigkeit und der Roh-dichte erledigt; Mikroschnitte (Ende Mai erhalten) erst wenige analysiert; Layout der Arbeit und Gliederung fertig;
to Do´s:
Analysen werden im August fertig; Arbeit im Draft bis Ende August (dropbox) - Feedback der BOKU vo-rauss. 1. Septemberwoche; Abgabe 9.9.16 geht sich aus; Gliederung der Arbeit ok, die mikroskopische Analyse noch komplett ein-arbeiten; einige Grafiken im Teil Faserlängen überarbeiten; Präsentation der Wert-Holz Studie am 16.9. in Tulln - Poster über die Er-gebnisse (DA) und Präsentation dort
timelines:
Ende August - Arbeit fertig; 1. Septemberwoche: Feedback BOKU - Änderungen einarbeiten; Abgabe 9.9.16; Präsentation der Arbeit (in Form einer Poster-Station) am Fr, 16.9.16 auf der BOKU Tulln
Folgeter-min:
nach Bedarf / Abgabetermin
Unterschriften:
Katharina Tuschl DI Dr. Josef Bodner
Bestimmung der Faserlänge und weiterer holzanatomischer Merkmale
selten genutzter Holzarten
Katharina Tuschl Seite 180
BETREUUNGSPROTOKOLL DIPLOMARBEIT
Datum: Montag, 5.9.16 Freitag, 9.9.16
Ort: HTL Mödling
Anwesende: Tuschl, Dr. Bodner
Thema: Abgabe der überarbeiteten Version - Finalisierungen;
Abgabe der Diplomarbeit
erledigtes: Arbeit fertiggestellt und Änderungen der BOKU bereits umgesetzt; Feed-back und Korrekturen von Herrn Dr. Bodner erwünscht
to Do´s:
detaillierte Grafiken einfügen; Betreuungsprotokolle und Stundenlisten anfügen; Druck und Binden der Arbeit (BOKU nur digital)
timelines: Abgabe 9.9.2016
Unterschriften:
Katharina Tuschl DI Dr. Josef Bodner