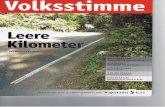Stand der Normung und Standardisierung der hybriden Wertschöpfung
Perge und seine Akropolis: Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit ...
-
Upload
uni-giessen -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Perge und seine Akropolis: Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit ...
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı
EUERGETESFestschrift für
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma EnstitüsüSuna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma EnstitüsüSuna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı
EUERGETESFestschrift für
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag
II. Cilt
(Ayrıbasım/Offprint)
Yayına Hazırlayanlar
İnci DELEMEN Sedef ÇOKAY-KEPÇE
Aşkım ÖZDİZBAY Özgür TURAK
SUNA - İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜSUNA & İNAN KIRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS
Armağan Kitaplar Dizisi: 1
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı
EUERGETES
Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag
II. Cilt
Yayına Hazırlayanlar
İnci DELEMENSedef ÇOKAY-KEPÇE
Aşkım ÖZDİZBAYÖzgür TURAK
ISBN 978-605-4018-00-0
© Suna - ‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2008
Bu kitapta yayınlanan bildirilerin yayım hakkı saklıdır. AKMED ve yazarlarının yazılı izni olmaksızın
hiçbir yolla çoğaltılamaz, basılamaz, yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the AKMED and the authors.
Yaz›ma Adresi / Mailing Address
Barbaros Mah. Kocatepe Sok. No. 25Kaleiçi 07100 ANTALYA – TÜRKİYE
Tel: 0 (242) 243 42 74 • Fax: 0 (242) 243 80 [email protected]
www.akmed.org.tr
Yap›m / Production
Zero Prodüksiyon Ltd.
İçindekiler
II. Cilt
Kaan İren The Necropolis of Kyme Unveiled: Some Observations on the New Finds ........................................................................................................................................................ 613
Havva İşkan Patara’dan bir “Demos” Kabartması ............................................................................................................................................................. 639
Ülkü İzmirligil Tarihi Süreç içinde Koruma ve Güncel Sorunlar ......................................................................................................................... 649
Deniz Kaptan Sketches on the Archaeology of the Achaemenid Empire in Western Turkey ....................................... 653
Şehrazat Karagöz Travma Tarihi (Travmalogos) .............................................................................................................................................................................. 661
Ute Kelp „Darüber wachen Verderben und Schrecken und Todeslos“ Erinyen als Grabwächter: Zum Eunuchengrab in Anazarbos (Kilikien) ................................................................................................................................... 675
Zeynep Koçel Erdem İmparator Hadrianus Dönemi Mimari Süslemeleri: Sütun Yivleri arasındaki Vazo Benzeri Motifler .............................................................................................................................. 699
Wolf Koenigs Die Erscheinung des Bauwerks. Aspekte klassischer und hellenistischer Oberflächen ............... 711
Taner Korkut Adak Sunaklar Işığında Likya’da Artemis Kültü ............................................................................................................................ 727
R. Eser Kortanoğlu Phrygia’da Makedonia Kalkan Bezemeleri ile Süslenmiş bir Kaya Mezarı ve Mezar Sahibinin Kökeni Üzerine ..................................................................................................................................................................... 735
Veli Köse Dionysos – Felicitas – Bereket Küçük Asya Taş Ustalarının Roma Mimarlık Süslemelerine Katkısına bir Örnek: Kıvrımlı Sarmaşık Dalı ................................................................................................................................................................................................... 747
Hasan Kuruyazıcı İstanbul’da Beyazıt Meydanı: Oluşumu – Gelişimi – Değişimi .................................................................................... 759
Ingrid Laube Eine frühkaiserzeitliche Büste in Tübingen ....................................................................................................................................... 773
VI
Wolfram Martini Perge und seine Akropolis: Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit .................................................................. 779
Friederike Naumann-Steckner Eine glückbringende Pressblechfibel im Römisch-Germanischen Museum der Stadt Köln .......................................................................................................................................................................................................................... 799
E. Emine Naza-Dönmez İznik Yeşil Camii ve Türk Mimarisindeki Yeri ................................................................................................................................... 807
Mihriban Özbaşaran 9000 Yıllık Bezemeli Kireçtaşları ....................................................................................................................................................................... 833
Aşkım Özdizbay Pamphylia - Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi Öncesi Perge’nin Gelişimi: Güncel Araştırmalar Işığında Genel bir Değerlendirme .................................................................................................... 839
Eylem Özdoğan Trakya’da bir Tümülüs Mezarlığı: Dokuzhöyük ............................................................................................................................ 873
Mehmet Özdoğan Kırklareli Aşağı Pınar Kazısında Bulunan Arkaik Döneme ait bir Zar ............................................................... 883
Ramazan Özgan Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Klasik Çağ Sonlarına ait bir Mezar Taşı .................................... 891
Hüseyin Murat Özgen Latmos Dağları’nda bir Sınır Yerleşimi Güzeltepe ..................................................................................................................... 899
Mehmet Özhanlı Alanya Müzesi’ndeki Kilikya Kaynaklı Tunç Çağı Pişmiş Toprak Figürinleri ........................................... 911
Mehmet Özsait – Nesrin Özsait – H. Işıl Özsait Kocabaş Senitli Stelleri ............................................................................................................................................................................................................................ 923
Hatice Pamir Antakya (Antiocheia ad Orontes)’daki Bazı Hamam Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesi F Hamamı, Narlıca Hamamı ve Çekmece Hamamı .................................................................................................................. 945
David Parrish A Selection of Late Roman and Early Byzantine Mosaics from Constantinople-Istanbul: A Prelude to the Corpus of the Mosaics of Turkey .................................................................................................................... 963
Urs Peschlow Das Südtor von Perge ...................................................................................................................................................................................................... 971
Felix Pirson Akzidentelle Unfertigkeit oder Bossen-Stil? Überlegungen zur siebten Basis der Ostfront des Apollontempels von Didyma ................................. 989
Jeroen Poblome – Markku Corremans – Philip Bes – Kerlijne Romanus – Patrick Degryse It is never too late… The Late Roman Initiation of Amphora Production in the Territory of Sagalassos ..................... 1001
Richard Posamentir Ohne Mass und Ziel? Bemerkungen zur Säulenstrasse von Anazarbos im Ebenen Kilikien ............................................................. 1013
VII
Friedhelm Prayon Ein Felsdenkmal in Kappadokien ................................................................................................................................................................. 1035
Wolfgang Radt Ein ungewöhnliches Pfeilerkapitell in Pergamon .................................................................................................................... 1045
Wulf Raeck Ein attischer Skyphos mit Perserdarstellung ................................................................................................................................... 1051
Matthias Recke Zwei parische Sphingen aus Kleinasien: Eine archaische Doppelweihung an Artemis Pergaia .......................................................................................................... 1057
Frank Rumscheid Ein in situ entdecktes Kohlenbecken aus dem Haus des Lampon in Priene: Neues zur Verwendung, Chronologie, Typologie und technischen Entwicklung hellenistischer Kohlenbecken ........................................................................................................................................................................... 1077
Turgut Saner Karaman-Başdağ’da Hellenistik(?) Yapı Grubu II .................................................................................................................... 1091
Mustafa H. Sayar Karasis Kalesi’nin (Kozan, Adana) Tarihlenmesi ve İşlevi üzerine Düşünceler .................................. 1097
Hakan Sivas Eskişehir Karatuzla Nekropolü ......................................................................................................................................................................... 1105
M. Baha Tanman Anadolu Türk Mimarlığında Kullanılmış bir Silme Türünün Kökeni ve Gelişimi hakkında ..................................................................................................................................................................................................... 1123
Mete Tapan Yapı Boyutunda Koruma ve Uygarlık İlişkisi üzerine ........................................................................................................... 1135
Oğuz Tekin A Small Hoard of Drachms of Ariobarzanes I and II from Tire Museum .................................................. 1137
Recai Tekoğlu On the Epichoric Inscription from Perge .......................................................................................................................................... 1143
Veysel Tolun Assos Nekropolü’nden Tahtta Oturan Kadın Heykelcikleri ....................................................................................... 1147
Özgür Turak Perge Batı Nekropolisi’nden bir Mezar: Artemon’un Kenotaphionu ............................................................ 1157
Taciser Tüfekçi Sivas Karakaya Frig Kaya Mezarı ..................................................................................................................................................................................... 1169
Füsun Tülek Kilikya Aşk Öyküleri: Mozaikte İmgelenmiş Antik Yazın ................................................................................................. 1177
Müjde Türkmen Perge Aşağı Şehir Surları ......................................................................................................................................................................................... 1187
Mükerrem Usman Anabolu Tokat Müzesi’ndeki Mermer Trophaion Tasviri ........................................................................................................................ 1201
Burhan Varkıvanç Antalya Kaleiçi’nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe ilişkin bir Gözlem ............................................ 1205
Remzi Yağcı A Grave at Soli Höyük from the Hittite Imperial Period ................................................................................................. 1217
Oya Yağız Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ndeki Ainos ve Maroneia Sikkeleri .............................................................................. 1227
Levent Zoroğlu Kelenderis ve Karaçallı Nekropolleri: Klasik Çağa ait İki Mezarlık hakkında Düşünceler .................................................................................................................. 1235
I. Cilt
Suna - İnan KıraçSUNUŞ ............................................................................................................................................................................................................................................ XIII
İnci Delemen – Sedef Çokay-Kepçe – Aşkım Özdizbay – Özgür TurakPergeli bir Euergetes’e ................................................................................................................................................................................................... XV
M. Taner TarhanAnılar .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1
Özgen AcarPerge’de Pandora’nın Kutusu .................................................................................................................................................................................. 17
Mustafa AdakWinde am Pamphylischen Golf .............................................................................................................................................................................. 45
Hüsamettin Aksu“Satrap Lahdi”nin Transkripsiyonu ................................................................................................................................................................... 55
Yıldız Akyay MeriçboyuAkhaemenid’lerden Osmanlı’ya Üç Benek Motifi ......................................................................................................................... 61
N. Eda Akyürek ŞahinEine neue Ehrung für den Kaiser Domitian aus Bursa ............................................................................................................. 79
Güven Arsebük~ M.S. 1492 Yılı Öncesi Dönemde Kuzey Amerika’da Tarihöncesi Toplumlar (Kızılderililer) .............................................................................................................................................................................................................................. 83
Sümer AtasoyZonguldak - Filyos (Tios/Tieion/Tion/Tianos/Tieum) Kurtarma Kazısı ....................................................... 91
İ. Akan Atila1993 Yılı Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi Kazısı Ön Raporu ............................................................................................. 99
M. Nezih AytaçlarThe Collaboration of the Painters on Some South Ionian Orientalizing Vases .................................... 109
Martin BachmannLichtvolle Perspektiven. Ein Fensterglasfund aus Bau Z in Pergamon ............................................................. 117
Nur Balkan-AtlıObsidiyenin Geçmişten Günümüze Yolcuğu. Yarı Bilimsel Yarı İçrek (Ezoterik) bir Yazı ....... 127
Cevat BaşaranParion’dan Persia’ya Yol Gider ........................................................................................................................................................................... 133
Daniş BaykanAssos Athena Tapınağı’nın Herakles-Kentauroslar Frizi için Yeni bir Tümleme Önerisi ......... 139
Oktay BelliDoğu Anadolu Bölgesi’nin En Eski ve Özgün Banyo Odası: Van-Yoncatepe Saray Banyosu ve Küveti .................................................................................................................................................. 145
Handan Bilici – Binnur GürlerKaystros Ovasında Roma İmparatorluk İmajı: Buluntularla Kültür ve Kimliği Tanımlamak ..................................................................................................................................... 159
Jürgen Borchhardt – Erika BleibtreuVon der Pferdedecke zum Sattel: Antike Reitkunst zwischen Ost und West ............................................. 167
Christine Bruns-Özgan„Notre âme est heureuse et notre coeur en joie!“ Zu einer neuen Stockwerkstele aus Harran ........................................................................................................................................ 217
Selma Bulgurlu GünDie Nischen der Plancia Magna an der Aussenmauer der Palästra der Südthermen in Perge ...................................................................................................................................................... 233
Mustafa Büyükkolancı Side Dionysos Tapınağı’na ilişkin Yeni Bulgular .......................................................................................................................... 259
Hüseyin Cevizoğlu İonia’da Arınma Gereçleri: Louterion, Perirrhanterion, Asamynthos / Pyelos .................................... 283
Ayşe Çalık Ross Bir Kadın Portresi: Agrippina Maior (?) ................................................................................................................................................. 309
A. Vedat Çelgin Termessos’tan Sorunlu bir Agon’a Işık Tutan bir Agonistik Yazıt Fragmenti ............................................ 315
Nevzat Çevik Kitanaura: Doğu Likya’da bir Kent ................................................................................................................................................................ 327
Altan Çilingiroğlu Urartu Tapınakları Kutsal Odalarında Taht Var Mıdır? ..................................................................................................... 341
Sedef Çokay-Kepçe Saç İğnesi? Maryonet? Öreke? Perge’de Bulunmuş Aphrodite Betimli bir Eser üzerine Tanımlama Denemesi ................................. 347
Özgü Çömezoğlu Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Bulunan Cam Hacı Şişeleri ............................................................. 351
Natalie de ChaisemartinHeros cavaliers et Eros chasseurs sur un sarcophage d’Aphrodisias .................................................................... 359
İnci Delemen Perge’den bir Yemek Sahnesinde Batı Yankıları ........................................................................................................................... 371
Ali Dinçol – Belkıs Dinçol Neue hethitische Siegelabdrücke aus den Ausgrabungen von Soli und aus der Privatsammlung Halûk Perk ..................................................................................................................... 383
Meltem Doğan-Alparslan Hititçe Metinlerde “Reverans Yapmak”: aruwai- ve hink- Fiilleri üzerine bir Deneme ................... 389
Şevket Dönmez Halûk Perk Müzesi’nden Orta-Kuzey Anadolu Kökenli bir Grup Metal Eser .......................................... 405
Turan Efe Demircihüyük ve Küllüoba İTÇ I-II Katlarında Ele Geçirilmiş Olan bir Grup Boyunlu Çömlek ........................................................................................................................................................................................ 413
Yılmaz Selim Erdal Perge’den bir Trepanasyon: Olası Nedenleri ................................................................................................................................... 421
Rifat Ergeç Gaziantep’te Geçmişten Bugüne Ölü Gömme Gelenekleri ............................................................................................ 435
Gürkan Ergin Geography-Human Relationships in Ancient Sources: Some Remarks on Geopolitics and Environmental Determinism .......................................................................... 449
Norbert Eschbach Eine ungewöhnliche Hydria von der Akropolis in Perge .................................................................................................. 463
Axel Filges Die Münzbilder der Artemis Pergaia Bemerkungen zu Tradierung und Wandel von Motiven ................................................................................................... 479
Turan Gökyıldırım Etenna Definesi (1991) ................................................................................................................................................................................................ 505
Emre GüldoğanAşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi Kesiciler ve Diğer Araç, Silah ve Aletler Grubu ......................... 521
Ahmet Güleç İ.Ü. Rektörlüğü Mercan Kapısı Çeşmelerinde Koruma Uygulamaları .............................................................. 531
Reha Günay Side Antik Tiyatrosu Sahne Binası 1992-2006 Yılları Çalışmaları Sonucu Ön Rapor ...................... 541
Bilge Hürmüzlü Remarks on Local Imitations of Import Pottery in the Sixth Century B.C.: Clazomenian Chalices .................................................................................................................................................................................................... 557
Fahri IşıkMopsos Mitosu ve Bilimsel Gerçekler: Perge ve Karatepe’nin Kuruluşu üzerine ................................ 571
Gül Işın Patara’dan Terrakotta bir Portre-Büst ........................................................................................................................................................ 587
Zühre İndirkaş Gustave Moreau Tarihselci Resim ve “Oidipus ve Sfenks” üzerine İkonografik Yorumlar ........................................................ 601
Perge und seine Akropolis Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit
Wolfram Martini*
War früher die Beschäftigung mit Perge weitgehend auf die Stadt in der Ebene konzentriert, deren reiche Bausubstanz und vielfältige Geschichte durch Deine
fruchtbare leitende Grabungstätigkeit seit 1988, lieber Haluk, uns in vieler Hinsicht immer deutlicher wird1, so hat unser gemeinsames Projekt der Erforschung
der Akropolis von 1993 bis 2004 2 auch den Blick von der Akropolis auf die späthellenistisch-kaiserzeitliche Stadt in der Ebene eröffnet und vermag vielleicht das
Verständnis von Perge als Ganzem zu vertiefen. Zugleich sei es als Metapher für unsere von Freundschaft und gegenseitiger Wertschätzung getragene gemeinsame
Arbeit trotz räumlicher Trennung gedacht.
Die Errichtung der Stadtmauer mit Toren und Türmen in hellenistischer Zeit in der Ebene südlich des Tafelbergs mit der alten Stadt (Abb.1) und das Aufblühen monumentaler Architek-tur im neuen Stadtgebiet seit der frühen Kaiserzeit3 einerseits und der stark ruinöse sowie früh-byzantinische Oberflächenbefund der Akropolis andererseits haben die Vorstellung gefördert, dass bei der Verlagerung der Stadt in späthellenistischer Zeit von der Akropolis in die Ebene die Akropolis weitgehend verlassen worden sei. Die bessere Anbindung an die Handels- und Verkehrswege, die Nähe zu den agrarischen Flächen der weiten fruchtbaren Schwemmebene und die bessere Trinkwasserversorgung boten zweifellos günstigere Lebensbedingungen in der Ebene, die sich in der reichen Architektur der Stadt widerspiegeln, die seit der frühen Kaiserzeit aufblühte. Die pax Romana mag einen zusätzlichen Anreiz geboten haben, die stark befestigte Akropolis zu verlassen und das urbane Leben in der offenen Neustadt zu genießen. Diesem sich auch bei dem heutigen Besuch von Perge aufdrängenden Bild sollen die dafür relevanten For-schungsergebnisse, die im Rahmen des Akropolis-Projekts gewonnen werden konnten, gegen-über gestellt werden, um zu verstehen, welche Rolle die Akropolis in der Kaiserzeit inne hatte.
Doch zuvor einige Überlegungen zum Zeitpunkt der Anlage der Neustadt und ihrer Orientie-rung. Denn wann die Neustadt mit ihrer geradlinigen Stadtmauer angelegt worden ist, ist immer noch umstritten, auch wenn sich eine Datierung um 200 v.Chr. durchgesetzt hat4. Diese Datie-rung auf der Grundlage der militärischen Geschichte von Perge in hellenistischer Zeit erscheint durchaus plausibel, berücksichtigt jedoch nicht, dass das ältere Perge auf dem Tafelberg seit dem 5. Jh.v.Chr. oder noch früher befestigt war und daher der Sitz der seleukidischen Garnison
* Prof.Dr. Wolfram Martini, Justus-Liebig-Universität Giessen, Institut für Altertumswissenschaften, Klassische Archäologie, Philosophikum 1 Haus D, Otto-Behagel-Straße 10, D-35394 Giessen - Deutschland.
1 Zuletzt Abbasoğlu 2001.2 Martini 2003b.3 Abbasoğlu 2001; Heinzelmann 2003.4 Zuletzt McNicholl 1997: 130f.
Wolfram Martini780
nach 213 v.Chr. gewesen sein dürfte5. Die komplexe Geschichte der Akropolisbefestigung mit ihren ständigen Veränderungen vor allem seit ca. 300 v.Chr. spiegelt zum Einen die wechselvolle Geschichte von Perge, zum Anderen die ständige Weiterentwicklung einer offensiven Verteidi-gungsstrategie6. Es ist also ebenso wahrscheinlich, dass sich die Überlieferung zum befestigten hellenistischen Perge auf die befestigte Stadt auf dem Tafelberg, die Akropolis, bezieht. Daher seien die archäologischen Argumente für die Datierung der Stadtmauer der Neustadt geprüft.
Die bisherigen Grabungsmaßnahmen haben keine datierenden Befunde erbracht und spre-chen eher gegen eine hochhellenistische Datierung. Während es denkbar ist, dass die Stadt-mauer im Bereich der Südthermen abgerissen bzw. in das Mauerwerk der Thermen integriert worden ist7, kann das völlige Fehlen der Kurtine im Bereich des Macellums bis in eine Tiefe von mind. 2 m8 schwerlich durch eine völlige Ausraubung erklärt werden, denn der große Raub-graben hätte angetroffen werden müssen. Auch die beiden von S. Bulgurlu im Rahmen ihrer Bearbeitung des Haupttors mit den runden Türmen (Südtor)9 1998 durchgeführten Sondagen quer zur Stadtmauer westlich der Südthermen erbrachten selbst im Fundamentbereich der vor-handenen spätkaiserzeitlichen Kurtine keine hellenistischen Reste, sondern nur kaiserzeitliche bzw. byzantinische Spolien. Diese Beobachtungen lassen nur den Schluss zu, dass es in diesem Bereich keine hellenistischen Kurtinen gegeben hat10.
Andererseits kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass das Südtor mit den runden Tür-men vor der frühen Kaiserzeit errichtet worden ist, da der sekundäre Einbau des schmuckhaften Torbaus zwischen den beiden Türmen und der erste Umbau des runden Torhofs in das frühe 1. Jh.n.Chr. zu datieren sind11. Die große Mehrzahl der Türme und einige wenige Kurtinen sind dagegen in hellenistischer Mauerwerkstechnik ausgeführt, wie auch die Untersuchungen von Türkmen12 gezeigt haben, und daher vor den Beginn der pax Romana in Pamphylien ab 25 v.Chr. zu datieren. Einen ergänzenden Datierungshinweis bietet der dorische Fries des obersten Geschosses der Türme des Südtors (Abb. 2) mit seiner Abtreppung am oberen Ende der Trigly-phe und der fehlenden Ausarbeitung der Ohren, wie sie in der östlichen Ägäis erst im späten 2. Jh.v.Chr. aufkommt13.
Daraus ergibt sich, dass die Stadtmauer der Neustadt vermutlich erst im Lauf des 1. Jhs.v.Chr. begonnen worden ist14, dass zuerst die Türme errichtet wurden und dass der größte Teil der Kurtinen erst in der späten Kaiserzeit aus Spolien errichtet worden ist. An der Südseite sind die Kurtinen seitlich des Südtors auf der Macellumseite offenbar nie ausgeführt worden. Denn
5 Martini 2003c: 183f.
6 Martini 2003b: 17-38.
7 Die mächtige Mauer aus teils bossierten, teils glatten Quadern in der Trasse der Kurtine im nördlichen Teil der Thermen dürfte Teil der Stadtmauer gewesen sein, ist aber aufgrund ihrer „Mischtechnik“ kaum hochhellenistisch zu datieren. Diese Mauer band auch nicht in das große Stadttor ein, sondern war durch eine große Öffnung westlich des Tors unterbrochen. Den Hinweis verdanke ich S. Bulgurlu.
8 Sondage von H. Abbasoğlu (Bulgurlu 1999: 3, 31). 9 Bulgurlu 1999.10 Zu diesem Ergebnis führte die Diskussion mit S. Bulgurlu während der Kampagne 1998.11 Ebenda.12 Türkmen 2001.13 Martini 1984: 82f. Tabelle D.14 Mitchell 1992: 16 datiert die „späthellenistische Stadtmauer“ von Perge in das späte 2. oder frühe 1. Jh.v.Chr. Wann al-
lerdings unter den schwierigen Bedingungen des 1. Jhs.v.Chr. mit den mithradatischen Kriegen, dem Piratenwesen und den anschließenden Feldzügen der Bürgerkriegsarmeen in der Provinz Asia das Stadtmauerprojekt begonnen worden ist, bedürfte gezielter Untersuchung; vgl. Anm. 30.
Perge und seine Akropolis 781
während die Orientierung der Südthermen in der vespasianischen Phase auf den geplanten Ver-lauf der Kurtine bezogen ist und diese vielleicht in die Thermen integriert worden ist, nimmt das Macellum überhaupt keine Rücksicht auf einen möglichen Mauerverlauf.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach dem Zeitpunkt der Neuorientie-rung der Neustadt nach Süden. Die bisher dominante Ausrichtung von Perge nach Osten zum Flusshafen und nach Westen zur späteren via Sebaste ist durch die Errichtung des Südtors und des breiten cardo maximus erheblich verändert worden. Für die Neustadt war die Anbindung nach Süden offenbar wichtiger geworden als die nach Osten an den Flußhafen, obwohl Stra-bons Wegbeschreibung nach Perge aus augusteischer Zeit den Seeweg und anschließend den Flussweg auf dem Kestros wählt15; allerdings ist sein Ziel das Heiligtum der Artemis mit seinem alljährlichen Fest, das aus dieser Perspektive tatsächlich auf einer Anhöhe außerhalb der südlich der Straße sich erstreckenden Stadt lag.
Wie wichtig diese Neuorientierung gewesen ist und worauf sie sich bezieht, geben die ge-planten Kurtinen bzw. die Verbindungslinie zwischen dem östlichen und westlichen Eckturm, die exakt mittige Lage des Südtors mit den hoch aufragenden Türmen dazwischen und seine Ausrichtung zu erkennen, die den eigenartig asymmetrischen Grundplan der Neustadt verur-sacht haben. Die Südseite der Neustadt wurde nicht wie seit der mittleren Kaiserzeit an den Himmelsrichtungen orientiert, sondern schiefwinklig zu den relativ genau nach Norden verlau-fenden Stadtmauern der Ost- und Westseite angelegt. Die Achse des Südtors, dessen Flucht von der westlichen Begrenzung durch die Südthermen und die severischen Nymphäen aufgegrif-fen worden ist, führt daher nicht exakt nach Süden wie das spätkaiserzeitliche Stadttor, das auf eine offenbar erst später, im Lauf der Kaiserzeit wichtige “Hauptstraße” mit einem Sakralbezirk als Zielpunkt ausgerichtet wurde16. Vielmehr ist das Südtor leicht nach Südwesten ausgerichtet und seine Achse erstreckte sich an Stadion und Theater vorbei in Richtung auf den Seehafen Magydos17. Er liegt genau in dieser Richtung dort am Meer, wo die Sinterkalkterrassen östlich von Attaleia flach auslaufen18. Reste eines großen Straßendurchbruchs durch eine landeinwärts gelegene Sinterkalkterrasse dokumentieren noch heute diese Straßenverbindung (Abb. 3), die offenbar ziemlich geradlinig ohne besondere Rücksicht auf die bis 64 m hohen Travertinpla-teaus auf kürzester Strecke nach Magydos führte. Jedenfalls ist diese geradlinige Schneise durch das anstehende Gestein in ca. 5,5 km Entfernung von dem Südtor von Perge, an die sich ein früher auf 2,3 km sichtbarer kerzengerader Straßenverlauf anschließt19, nur max. 250 m von der Ideallinie entfernt. In geringem Maß wurde offenbar auf topographische Gegebenheiten Rück-sicht genommen. So ist die dammartige Brücke20, die sich ca. 200 m nördlich auf ca. 30 m Länge erhalten hat, um ca. 40 m nach Westen versetzt und nähert sich der Ideallinie. Auch ca. 1800 m
15 Strab. 14.4.2; Bestätigungen dieser Angabe bei Pomponius Mela (1.79) „Cestro navigari facilis“ und im Stadiasmos Maris Magni 219.
16 Mansel 1975: 92-96; Şahin 1999: 27f. Anm. 29ff. Aufgrund der ursprünglichen, vermutlich späthellenistischen Ausrichtung des Stadttors mit den Rundtürmen ist die Lokalisierung des Heiligtums der Artemis Pergaia südlich der Neustadt sehr un-wahrscheinlich, denn angesichts der hohen Bedeutung des Heiligtums wäre eine Ausrichtung der Stadt darauf zu erwarten gewesen.
17 Diese Beobachtungen können jetzt durch die ausgezeichneten Satellitenbilder in Google Earth 2007 gut nachvollzogen werden.
18 Lanckoronski 1890: 19. 19 Der noch 1980 sichtbare und im Messblatt von Antalya dokumentierte Straßenverlauf ist heute aufgrund intensiver Ge-
ländenutzung im südlichen Abschnitt nur noch teilweise zu erkennen. Die hier angegeben Maße sind Google Earth 2007 entnommen, wo der Straßendurchbruch (Nordende 36o 54’ 34.27’’ N / 30 49’ 55.81’’ O) und die Brücke (Nordende 36o 54’ 41.94’’ N / 30 49’ 58.33’’ O) gut zu erkennen sind. Die Kenntnis von Trasse und Brücke wird gemeinsamen Ausflügen mit Mitarbeitern von H. Abbasoğlu und ihm selbst verdankt.
20 Hinweis M. Recke.
Wolfram Martini782
südlich von Perge weicht die vermutliche Trasse um ca. 130 m östlich von der Ideallinie ab, da dort die fast senkrechte Nordflanke des ca. 64 m hohen Hügels (Çalkaya) aus grobem Kiesel-konglomerat der tertiären Flussablagerungen keine Wegführung ermöglichte. In der einzigen natürlichen, rasch ansteigenden Schneise ca. 130 m östlich befindet sich auch heute ein Weg auf das Plateau. Verbindet man diese Schneise mit dem Südtor, entspricht diese Linie exakt der Achse des Südtors und dürfte dessen Ausrichtung bedingt haben.
Über den Zeitpunkt der Anlage dieser Straße oder des Seehafens Magydos (heute Lara) selbst ist leider nichts Genaues bekannt, doch seine Erwähnung im Periplous des Skylax21 und helleni-stische Münzen von Magydos mit der Artemis von Perge22 sichern seine nicht unbedeutende Exi-stenz als Seehafen von Perge bereits seit dem 4. Jh.v.Chr.23. Ob er allerdings schon in hellenisti-scher Zeit durch die überaus geradlinige und aufwendig angelegte Straße mit Perge verbunden war oder ob er vorrangig dem Umladen der Fracht und Passagiere von seetüchtigen Schiffen auf flache Schiffe diente, die für den Kestros und das Treideln geeignet waren, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Allerdings legt das ausgezeichnete, annähernd isodome Quader-werk des Brückendamms überwiegend aus Läufern mit Tendenz zur Fugenkonkordanz (Abb. 4) auch im Vergleich zum Quaderwerk der Befestigung der Akropolis eine Datierung noch im 4. Jh.v.Chr., auf jeden Fall aber deutlich vor der Anlage der Neustadt nahe. Wenn die Straße von Magydos aber älter als die Anlage der Neustadt und des Südtors ist, kann sich diese Achse nur auf die Akropolis bezogen haben, die von den höheren Plateaus zwischen Magydos und Perge aus gesehen werden konnte. Verlängert man den letzten Abschnitt der vermuteten Straße von dem nördlichsten Plateau (Çalkaya) bis zum Südtor bis zur Akropolis24, so trifft diese Flucht mitten in das südöstliche Heiligtum, das Heiligtum der Artemis von Perge. Das mag Zufall sein, aber es würde die exakte Position des Südtors in der OW-Achse definieren und damit auch die schief-winklige Südseite der Neustadt begründen. Der Seehafen, das Haupttor der Neustadt und das Heiligtum der Artemis würden dadurch in sehr konsequenter Weise und durchaus erfahrbarer Weise aufeinander bezogen25, denn vom nördlichsten Plateau (Çalkaya) aus waren sowohl die Neustadt und die Akropolis als auch bei klarem Wetter das 11 km entfernte Magydos zu sehen.
Das erst um die Mitte des 2. Jhs.v.Chr. als Militärhafen der Attaliden angelegte Attaleia dage-gen scheint trotz seiner nicht wesentlich größeren Entfernung von 16 km für die Straßenachsen keine Bedeutung gehabt zu haben. Zwar dokumentiert eine Brücke mit römischem Kern nahe der Ideallinie vom Hadrianstor in Attaleia nach Perge26 den Anschluss an die via Sebaste bzw. konkret aus topographischen Gründen vermutlich an die Straße Magydos-Perge einige 100 m südlich des Theaters27, doch dürfte sich der neue Hafen von Attaleia angesichts seiner tiefen
21 Ps.-Skyl. 100; vgl. auch Klaudios Ptolemaios (Geogr. 5.522) mit genauer Lokalisierung zwischen den Mündungen des Kata-raktes und des Kestros; s.a. Adak - Atvur 1999: 53-68.
22 z.B. SNG BN Paris 350; SNG PFPS 229.23 Die rechtwinklig angeordneten, vermutlich kaiserzeitlichen Molen von 225 und 340 m Länge lassen den Hafen als “größten
geschützten Hafen Südkleinasiens” erscheinen (Adak - Avtur 1999: 55).24 Hinweis von Ph. Kobusch (Gießen).25 Darüber hinaus ließe sich der merkwürdig gebrochene Verlauf des cardo maximus besser verstehen. Der Aufgang zur Akro-
polis in dieser Achse, die praktisch dem ersten Abschnitt der Säulenstraße entspricht, wäre aufgrund des weiter westlich gelegenen Einschnitts in der Akropolis nur mit gewaltigem Aufwand zu leisten gewesen; außerdem hätte diese Achse die Neustadt in zwei ganz ungleiche Hälften geteilt. Die Ausrichtung der Säulenstraße nach Norden im mittleren Abschnitt und zur Aufgangsmulde im letzten Abschnitt erscheinen daher zwar im Plan zwar als merkwürdige, in der urbanen Kon-zeption jedoch durchaus plausible Lösung.
26 36°56’35.73”N / 30°49’34.30”O nach Google Earth 2007.27 Ob die von Manlius Aquillius 129 v.Chr. erbaute Straße nach Side auf dieser Trasse oder südlich der Sinterkalkterrassen
und nördlich der Sanddünen dichter am Meer verlief und die Straße von Magydos nach Perge südlich des erhaltenen Ab-schnitts kreuzte, bedürfte genauer Untersuchung der erhaltenen Reste von Straßen in diesem Gebiet.
Perge und seine Akropolis 783
Einsenkung in die 50 m hohen Sinterterrassen und der etwas größeren Distanz zu Perge auch in der Folgezeit nicht als Handelshafen geeignet haben28. Ob sich überhaupt vor der Niederschla-gung des Piratenwesens an der südkleinasiatischen Küste durch P. Servilius Vatia Isauricus 77/76 v.Chr. bzw. endgültig durch Pompeius 67 v.Chr. ein größerer Handelsverkehr zwischen Attaleia und Perge entwickelt hat, erscheint daher sehr zweifelhaft.
Ein weiteres Argument gegen eine Datierung der Stadtmauer der Neustadt um 200 v.Chr. bie-tet der Typus der geradlinigen Befestigung ohne Rücksicht auf die Topographie mit dem westlich nur 2- 300 m entfernten Koca Belen, von dem aus die Stadt leicht hätte beschossen werden kön-nen. Die Türme mit geringem Querschnitt von ca. 6 x 8 m, mit kleinen Schlitzen im 2. Geschoss und mit großen Fenstern im 3. Geschoss waren für größere Geschütze ungeeignet; Ausfallpfor-ten konnten kaum beobachtet werden. Vergleicht man dagegen die raffinierte Befestigung des Südhangs der Akropolis29 (Abb. 5), so erscheint die geradlinige Stadtmauer der Neustadt eher als eine repräsentative Begrenzung der Stadt, die natürlich gegen Piratenüberfälle ausgezeichne-ten Schutz hätte bieten können. Vor allem die schmuckhafte Gestaltung der Türme durch die Kombination von bossierten Quadern für die Sockel und geglätteten Quadern für die oberen Ge-schosse, durch das umlaufende Gesims und durch die großen Fenster verlieh zusammen mit der Monumentalität besonders des Südtors der Stadt ein machtvoll repräsentatives Erscheinungsbild, dessen Wirkung auf Ankommende aus Richtung Süden wohl kalkuliert war.
Denn die von Magydos kommende Straße führte rechtwinklig und genau mittig auf das mo-numentale als Haupttor errichtete Südtor mit seinen 15 m hohen Türmen und bot dem Besu-cher von Perge, wenn er von Magydos kommend den nördlichsten, 64 m hohen Hügel über-quert hatte, auf den letzten zwei Kilometern den Anblick einer beeindruckenden Stadt, deren Wehrhaftigkeit durch die je fünf geplanten Türme und Kurtinen in einer Länge von jeweils 270 m auf beiden Seiten höchst wirkungsvoll demonstriert worden wäre, wenn sie vollständig zur Ausführung gelangt wären. Warum die Ausführung unterbrochen wurde, bleibt rätselhaft.
Vielleicht ließ die pax Romana den weiteren Ausbau der Kurtinen als unnötig erscheinen. Doch zeigen der Einbau eines dekorativen Torbogens zwischen den Rundtürmen des Südtors im frühen 1. Jh.n.Chr. und die Öffnung des jetzt oval gelängten Torhofs nach Norden30, dass der fortifikatorische Aspekt zwar an Bedeutung verloren hatte, dass aber dennoch wie vielerorts im gesamten Imperium Romanum das Stadttor als repräsentativer Eingang in die Stadt und als Abgrenzung nach draußen auch durch seinen Bauschmuck und hochwertiges Baumateri-
28 Dennoch existierte zumindest in der Kaiserzeit etwa auf der Linie vom Hadrianstor in Attaleia zum Südtor von Perge eine Straße, die durch die kaiserzeitliche Brücke ca. 3 km westlich von Perge und nördlich der großen Autostraße nachgewiesen ist; 36°56’36.43”N / 30°49’35.05”O nach Google Earth 2007.
29 Martini 2003b: Beilage 2.30 Bulgurlu 1999; S. Bulgurlu konnte durch Sondagen nachweisen, dass der ursprünglich kreisrunde Torhof, wie ihn Lauter
(BJb 172,1972: 1-11) rekonstruiert hat, in tiberischer oder claudischer Zeit umgebaut worden ist. Damit ist ein terminus ante quem für die Stadtmauer gegeben; einen terminus post quem bietet der dorische Fries für das späte 2. Jh.v.Chr. Wann die Befestigung der Stadt erfolgte, aus der keine Spuren eines größeren hellenistischen oder augusteischen Bauwerks bisher nachgewiesen sind, hängt von der Bewertung des mehr fortifikatorischen oder mehr repräsentativen Charakters ab. Der Stadtmauerbau könnte auch als Reaktion auf die unruhige Situation seit dem III. mithradatischen Krieg und den Seeräu-berkriegen nach 76 v.Chr. im Kontext der Neuordnung unter Pompeius und der darauf folgenden kurzen Blütephase Kleinasiens vor den finanziellen Lasten der Bürgerkriegsarmeen in der 2. Hälfte des 1.Jhs. begonnen worden sein; vgl. allgemein Brandt - Kolb 2005: 20f. Andererseits erscheint fraglich, ob Perge angesichts der vermutlich hohen wirtschaftli-chen Belastungen bis zum Schuldenerlass durch Octavian 25 v.Chr. dazu überhaupt fähig gewesen sein kann (Broughton 1959: 579-590). Einen bildlichen Reflex dieser schweren Zeit bietet der Reliefschmuck der Panzerstatue des Augustus auf der Akropolis (Anm. 33). Analog zu z.B. der repräsentativen Befestigung von Merida (Trillmich 1990: 302-304) wäre auch eine Errichtung der Stadtmauer von Perge in augusteischer Zeit denkbar, doch bliebe die Bauunterbrechung des rein repräsentativen Bauwerks unerklärlich. Zu Augustus als Stifter von Stadtmauern Pfanner 1990: 85-88.
Wolfram Martini784
al gegenüber den bossierten Rundtürmen hervorgehoben wurde. Wenn die Stadtbefestigung tatsächlich primär repräsentativen Charakter hatte, wäre die pax Romana allerdings kein Grund gewesen, den Bau nicht weiterzuführen.
Was geschah jetzt mit der Akropolis, nachdem die Neustadt sich entfaltete und sich primär nach Süden zu dem Seehafen Magydos und vermutlich auch nach Attaleia hin orientierte? Zwar stand bei unserem Akropolis-Projekt die Erforschung der vorrömischen Siedlungsgeschichte von Perge im Mittelpunkt, dennoch wurden im Rahmen des Gesamtsurveys auch die Baureste der Kai-serzeit und byzantinischen Zeit erfasst (Abb. 5)31. Sie zeigen, dass in der Kaiserzeit sowohl ältere Bauten in repräsentativer Weise weiter genutzt wurden, als auch neue, zum Teil monumentale Bauwerke errichtet worden sind. In dem Peristylbau am Südrand der Akropolis32 („Hellenistisches Peristyl I“), der im 2. Jh.v.Chr. vermutlich als Agora erbaut worden war, wurde eine sehr qualität-volle Panzerstatue des Augustus aus Marmor33 gefunden, deren genauer Standort unbekannt ist. Ob diese mit ca.42 x 45 m relativ kleine, aber durch die Inkrustation aus weißem Marmorstuck im Quaderstil nobilitierte Agora Ort des zu vermutenden Kaiserkults für Augustus34 war und mit der inschriftlich überlieferten Sebaste agora (forum Augustum) zu identifizieren ist35, muss offen bleiben. Doch die Aufstellung der Statue mit ihrem programmatische Reliefschmuck auf dem Panzer mit der Errettung von Perge vor den Barbaren durch Augustus im Gewand des Herakles-Nessos-Mythos in Sichtweite des mutmaßlichen Artemisheiligtums signalisiert, dass sich noch in augusteischer Zeit das religiöse und politische Zentrum von Perge auf der Akropolis befand.
Nach einem schweren Erdbeben im 2. Jh.n.Chr. fand eine umfassende Renovierung dieser Agora mit Kreuzgewölben in den westlichen Räumen statt, bevor der Bau erneut durch ein Erd-beben im 4. Jh.n.Chr. zerstört und offenbar aufgegeben wurde. In ähnlicher Weise dokumen-tiert eine mannshohe kaiserzeitliche Basis aus Marmor für einen Dreifuß36 im „Hellenistischen Peristyl II“ am Fuß des Westhügels das repräsentative Weiterleben der Akropolis in der Kaiser-zeit. Unmittelbar südlich und südöstlich veranschaulichen zwei kaiserzeitliche Großbauten mit bis zu 48 x 53 m umbauter Fläche37 ebenso wie ein nördlich gelegener Peristylbau mit Resten eines Gebälks severischer Zeit aus Marmor beträchtliche bauliche Aktivitäten.
Auch die drei bisher auf der Akropolis lokalisierten Heiligtümer weisen kaiserzeitliche Baumaß-nahmen auf und bezeugen eine kultische Kontinuität durch die Kaiserzeit hindurch. Während im Heiligtum in „Fläche 2“ auf dem Westhügel die letzte große Baumaßnahme in Form eines Antentempels bereits um 50 v.Chr. anzusetzen ist, aber kaiserzeitliche Weihgaben die kultische Kontinuität sichern, sind für das Heiligtum in „Fläche 1“ am westlichen Fuß des Osthügels mind. eine frühkaiserzeitliche und eine spätkaiserzeitliche bauliche Erweiterung nachgewiesen. Das sog. südöstliche Heiligtum mit einer flächigen Ausdehnung von ca. 60 x 100 m, das m.E. mit dem be-rühmten Artemis-Heiligtum von Perge zu identifizieren ist38, lässt aufgrund verschiedener Bauglie-der und Bauphasen ebenfalls eine intensive Bautätigkeit während der Kaiserzeit erkennen.
31 Martini 2003b.32 Martini 2003b: 65-70.33 Laube 2003; 2006: 9-16, 199-204.34 Laube 2006: 204. Nach den bisher bekannten Inschriften ist der Kaiserkult in Perge allerdings erst seit vespasianischer Zeit
bezeugt (Şahin 1999: 55-61 Nr. 42-48).35 Şahin 1999: 37-43 Nr. 23; A. Özdizbay (Istanbul), der die Geschichte und Topographie von Perge als Dissertationsvorha-
ben bearbeitet, zieht eine entsprechende Identifizierung in Erwägung (mündlich 10.10.06), ähnlich I. Laube (mündlich 23.1.07).
36 Mansel – Akarca 1949: 66 Abb. 90.37 Martini 2003b: 57-60.38 Martini 2003a.
Perge und seine Akropolis 785
Die archäologischen Beobachtungen werden durch die auf der Akropolis oder am Südabhang gefundenen großformatigen Inschriften39 ergänzt. Besonders die Errichtung eines Bauwerks auf der Akropolis durch die mäzenatischen Brüder Demetrios und Apollonios, die auch den Do-mitiansbogen an der Kreuzung von cardo maximus und decumanus maximus errichtet haben, aber auch eine Ehrung traianischer Zeit für denselben Apollonios, einen der bedeutendsten Mäzene von Perge, vielleicht ebenfalls an diesem Bau auf der Akropolis, dokumentieren die hohe Bedeu-tung der Akropolis noch am Ende des 1. bzw. zu Beginn des 2. Jhs.n.Chr.
Ein Jahrhundert später sind zwei Inschriften an Ares zu datieren, die aus Dank für eine ta-dellose Dienstzeit von Mitgliedern der Wachmannschaft der Akropolis gestiftet worden sind40. Die eine der beiden Inschriften, befindet sich unmittelbar nördlich des oberen Tors zur Akro-polis („Akropolistor“), von dem nur noch die Fundamente erhalten sind. Doch der Fund der Inschrift und ihre Form als tabula ansata lassen vermuten, dass sie am „Akropolistor“ angebracht war, folglich dieses samt der heute teilweise erhaltenen, angrenzenden Kurtine in der Kaiser-zeit noch existierte. Die Situation war hier also ganz anders als an der Südseite der Stadt, wo in der frühen Kaiserzeit das hellenistische Haupttor mit den Rundtürmen schmuckhaft verändert worden war und seine angrenzenden Kurtinen vielleicht in die Südthermen integriert bzw. im Gebiet des Macellums noch gar nicht errichtet worden waren41. Während also mit Beginn der pax Romana ab 25 v.Chr. die Stadt geöffnet wurde oder geöffnet blieb, wurde die Befestigung der Akropolis beibehalten. Offenbar galt die Akropolis als etwas besonders Schutzwürdiges, was ihre anhaltende Bedeutung für Perge unterstreicht. Weitere Inschriftreste byzantinischer Zeit auf qualitätvollen Baugliedern im südlichen oberen Hangdrittel der Akropolis unterstreichen die bis in die frühbyzantinische Zeit anhaltende intensive Nutzung der Akropolis als repräsentativer Teil von Perge42.
Das scheint auch der Stadtplan von Perge (Abb. 1) mit seiner überraschend ungleichen Grö-ße der durch cardo maximus und decumanus maximus gebildeten Stadtviertel zu bestätigen. Der Schnittpunkt der beiden Hauptachsen ist weit nach Norden verschoben und legt die Überlegung nahe, dass quasi die Akropolis die beiden nördlichen Stadtviertel einnahm, und dass Stadt und Akropolis bei der Anlage des decumanus maximus als ein zusammenhängendes Ganzes konzipiert worden sind. Des weiteren zeigt der Stadtplan, dass der letzte Abschnitt der großen Säulenstraße, die als urbanes Rückgrat die Neustadt von Süden nach Norden durchzieht, von dem südlich an-schließenden Abschnitt leicht nach Nordwest abweicht, obwohl er bereits nach ca. 100 m in dem Nymphäum endet. In seiner Flucht liegt das einzige stadtseitige Tor der Befestigung der Akro-polis, und auch der große Einschnitt im Rand der Akropolis mit dem Akropolistor befindet sich in dieser Achse. Die mind. 6 m hohen Säulenhallen und das abschließende Nymphäum lenkten und begrenzten den Blick so, dass von dem hellenistischen Tor nichts zu sehen war (Abb. 6); stattdessen wurde der Blick der Passanten unmittelbar auf den Einschnitt oberhalb gelenkt, in dem sich der durch das Akropolistor geschützte Zugang zu Akropolis befand, und damit das Ziel des Wegs durch das Nymphäum hervorgehoben. Noch eindeutiger als die Ausrichtung des ersten, südlichen Abschnitts der Säulenstraße auf die Akropolis43 ist die Bezugnahme des cardo maximus in seinem nördlichen Abschnitt auf die Akropolis; sie unterstreicht die konzeptionelle Einheit von Stadt und Akropolis.
39 Şahin 2003.40 Şahin 1999: 271f. Nr. 234/5.41 s.o. Anm. 7-10.42 Şahin 2003.43 Martini 2003a: 485f.
Wolfram Martini786
Diesem engen Zusammenhang scheint die konkrete urbanistische Verbindung durch die Straßen zwischen der Stadt in der Ebene und der Akropolis zu widersprechen. Die prachtvolle Hauptgeschäftsstraße von Perge mit ihren fast endlosen Portiken und dem mittigen Wasserkanal bildete zweifellos die Hauptader des kaiserzeitlichen Perge. Gesäumt seit hadrianischer Zeit44 von Säulen aus hellgrauem Granit auf Postamenten und Basen aus prokonnesischem Marmor, hinter denen sich Geschäfte, Büros und sakrale Räume reihten, und bekrönt von korinthischen Kapitellen und Gebälk aus Marmor zu Seiten der beiden Fahrbahnen mit dem hellen ockergel-ben Paviment, die durch die lange Reihe der Brunnenbecken mit frischem, kühlendem Wasser geteilt wurden, repräsentierte der cardo maximus den Glanz und Luxus der blühenden kaiserzeit-lichen Stadt. Ihren nördlichen Abschluss bildete das monumentale zweigeschossige Nymphäum, das die ca. 500 m lange, alle 8 m durch einen kleinen Katarakt belebte Brunnenfolge speiste. Zwar beschloss das Nymphäum durch seine nach Süden orientierte Fassade die Säulenstraße, diente jedoch gleichzeitig dank seiner zwei breiten Durchgänge seitlich des eigentlichen Brun-nens in der Achse der Fahrbahnen als Propylons zum Südhang derAkropolis. Dieser Bereich ist zwar wegen hoher Verschüttung und byzantinischer Treppenreste nicht zugänglich, doch entspricht der rekonstruierbare Befund durchaus der recht schmucklosen Rückseite des Nym-phäums.
Nach gut 20 m ragte in den Achsen beider Torbögen ein Teil der Befestigung der Akropolis, eine heute noch gut 22 m lange, schräg verlaufende Mauer, ca. 20 m über das Durchgangsni-veau auf und versperrte den Blick auf die dahinter aufsteigende Akropolis. Dieser Wehrmauer entspricht westlich eine ähnliche Mauer, mit der sie eine Art Trichter bildet, der sich zum Nym-phäum hin öffnet und in der Achse der westlichen Fahrbahn eine max. 5,60 m breite Öffnung aufweist, die jedoch wegen der weiteren Erstreckung der westlichen Mauer nach Nordosten kei-nen Durchblick bot. Die anschließende Rampe erreicht nach 55 m und knapp 20 Höhenmetern die auf die Akropolis führende, von Osten kommende Hauptstraße. Das bedeutet, dass die an die Säulenstraße anschließende Straße nach Norden wegen des Höhenunterschieds als Rampe von relativ geringer Breite (max. 5,60 m) ausgestaltet werden musste, deren Steigungswinkel von 20o keinen Fahrverkehr erlaubte; ebenso dokumentiert ihre winklige Streckenführung zwischen den abweisenden hohen Befestigungsmauern den enormen Unterschied zur innerstädtischen Säulenstraße.
Eine zweite Straße verband den westlichen Teil der Stadt nördlich des decumanus maximus mit der auf die Akropolis führenden Hauptstraße. Sie war dicht gesäumt von Läden und führte ziemlich geradlinig vom Westtor der Stadt zum Südwesttor der Akropolis45. Ihre Breite von 9,50 m in der Kaiserzeit und ihr sanfter Anstieg von ca. 5o kennzeichnen sie als eine auch für den Fahr-verkehr geeignete Straße. Aber abgesehen von einer möglichen, ebenfalls steilen Straße westlich der Palästra des Cornutus bot sie keine direkte Anbindung an die Stadt in der Ebene, sondern ver-band die Akropolis mit dem Westtor, so wie die Oststrasse als Hauptstraße die Akropolis mit dem Hafentor verband; beide Fahrstraßen auf die Akropolis kamen also aus dem Gebiet außerhalb der Stadt. Zweifellos handelt es sich um ältere Zugangstraßen zur Akropolis, wie auch die monumen-talen Toranlagen im Südwesten (Südwesttor) und Osten (Hafentor) der Akropolis bezeugen46.
44 Vermutlich sind auch die Portiken wie das Nymphäum erst in hadrianischer Zeit entstanden, wie die in Arbeit befindliche Dissertation von A. Özdizbay (Istanbul) zeigen wird; vgl. Heinzelmann 2003: 204f. Dass bereits in tiberischer Zeit eine erste Porticus errichtet worden ist, wie S. Şahin (1999: 25-30) mit plausiblen Argumenten vermutet, ist jedoch durchaus mög-lich.
45 “SWTor”: Martini 2003b: 27-2946 Die Toranlage an der Ostseite, das ”Hafentor” ist nur unter dem ca. 17 m hohen Schutthügel in der Achse der “Oststraße”
zu erahnen; der bescheidene Rest einer Turmecke scheint an der SOEcke erhalten.
Perge und seine Akropolis 787
Die erwähnte Hauptstraße auf die Akropolis, die diese mit dem 4 km entfernten Flusshafen bei dem heutigen Ort Solak verband47, zeichnete sich nicht nur durch ihre große Breite von 22 m im Ostteil und 17 m unmittelbar vor dem Akropolistor aus, sondern war in ihrem östlichen Abschnitt auf mind. 180 m als prachtvolle Säulenstraße mit Säulen aus weißem Marmor gestal-tet48. Ihre in fast gleicher Länge erhaltene, hellenistische Terrassierungsmauer zeigt, dass in die-sem Bereich keine Verbindung zur Stadt in der Ebene existiert hat. Lediglich in einem Bereich von gut 90 m Länge östlich der Säulenstraße ist trotz eines Höhenunterschieds von ca. 6-8 m eine Anbindung an das Straßensystem der Stadt grundsätzlich möglich. Allerdings fällt bei die-sem Areal im nordöstlichen Zwickel von cardo maximus und decumanus maximus das Fehlen der üblichen hohen Verschüttung auf, so dass die Annahme einer großen Platzanlage Plausibilität besitzt. Şahin vermutet daher dort die inschriftlich bezeugte Sebaste agora (forum Augustum)49.
Betrachtet man die Beziehung zwischen Stadt und Akropolis auf der Grundlage der urbani-stischen Verkehrsverbindungen (Abb.1), so überrascht wie sowohl die nach Westen zum Westtor führende westliche Straße als auch die wesentlich bedeutendere und prächtigere östliche Straße in Richtung Hafen aufgrund ihrer völlig anderen Orientierung geradezu eine Grenze zwischen Akropolis und Stadt bilden. Die wesentlichen Verkehrsanbindungen der vorrömischen Zeit zur via Sebaste einerseits und über den Hafen am Kestros zum mare Pamphylicum andererseits wurden ohne nennenswerten Bezug zur Neustadt beibehalten. Diese wurde gemäß ihrem eigenen Stra-ßennetz durch den decumanus maximus mit dem neuen Westtor bzw. dem neuen Osttor der spät-hellenistischen Stadtmauer an die bisherigen Hauptverkehrswege angebunden und wesentlich nach Süden nach Magydos ausgerichtet.
Diese leichte südwestliche Orientierung seit späthellenistischer Zeit wurde durch die Südther-men aufgegriffen und noch bei den Nymphäen severischer Zeit an der Westseite beibehalten. Die Ostseite des Platzes südlich des späthellenistischen Stadttors dagegen weist eine völlig ande-re Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen auf, die sich im nördlich anschließenden Straßen-system fortsetzt. Vermutlich im Kontext mit der eindrucksvollen Umgestaltung des Torhofs in hadrianischer Zeit als Ort der Inszenierung der Gründungsmythen von Perge wurde durch den Einbau einer Treppe eine neue Verkehrsachse mit Hauptabwasserkanal neben dem späthelleni-stischen Stadttor erforderlich, worauf Heinzelmann hingewiesen hat50. Diese neue Achse, die an ihrer Ostseite durch eine Portikus begleitet wird, hat offenbar das Achsensystem des Macellums und des gesamten Ostteils der Stadt einschließlich der Insulae mit den Wohnhäusern von Perge bestimmt, während in der Westhälfte der Stadt anscheinend die alten Achsen weitgehend beibe-halten wurden. Dieser Neuorientierung trug auch die Säulenstraße nach Süden Rechnung, die zu dem 850 m entfernten Heiligtum mit dorischem Antentempel und einem weiteren Sakralbau in ionischer Ordnung führte51 und spätestens mit Errichtung des spätkaiserzeitlichen (?) Stadt-tors zur neuen Hauptachse geworden war. Wenn sich die Architravreste mit Grabinschrift für Magna Plancia tatsächlich noch in situ befinden, lag ihr Grabbau ca. 165 m südlich vom Südtor exakt an dieser neuen Säulenstraße52. Das bestärkt die Vermutung, dass die Neuorientierung
47 Die Lokalisierung des antiken Flusshafens von Perge bei Solak beruht auf der topographischen und geologischen Situation sowie auf zahlreichen Spolien vor allem der Kaiserzeit, die bei gemeinsamem Survey mit H. Brückner und D. Kelterbaum untersucht bzw. beobachtet wurden.
48 Jedenfalls konnten einzelne entsprechende Säulenreste beobachtet werden.49 Şahin 1999: 37-42.50 Heinzelmann 2003: 203f.51 Mansel 1975: 92-96. Ob der nach Westen (Säulenstraße?) orientierte dorische Antentempel mit abgeplatteten Kannelurgra-
ten tatsächlich späthellenistisch zu datieren ist, müsste gesondert untersucht werden.52 Den Hinweis verdanke ich M. Recke. Mansel 1956: 120 Anm. 87; Şahin 2004: 70-72 Nr. 355 und 356.
Wolfram Martini788
mit weitreichenden Folgen für das urbane Gefüge der Osthälfte von Perge unter Magna Plancia stattgefunden hat und sie in der Tat ein höchst veritabler Ktistes gewesen ist53.
Auch nach der vermutlich hadrianischen Neugestaltung großer Teile der östlichen Neustadt blieb die Verbindung zur Stadt marginal; in ambivalenter Weise wurde sie durch das propylonar-tige Nymphäum einerseits durch seine zwei Durchgänge am nördlichen Ende der Säulenstraße akzentuiert und andererseits durch die der Säulenstraße zugewandte Fassade gleichzeitig redu-ziert. Nach wie vor war die Akropolis nach Westen und vor allem nach Osten orientiert, während für die Neustadt der Bezug nach Süden zentrale Bedeutung hatte.
Dieser verkehrsmäßigen Zweiteilung entspricht das bauliche Erscheinungsbild von Stadt und Akropolis in der Kaiserzeit. Zumindest seit hadrianischer Zeit präsentierte sich das neue Perge in der Ebene mit seinen großzügigen, aufwendig ausgestatteten Hauptverkehrsachsen, eindrucks-vollen öffentlichen Bauten, Plätzen und Nymphäen mit reichem Statuenschmuck54 dank lokaler Euergeten wie C. Iulius Cornutus, Demetrios und Apollonios, Magna Plancia oder Claudius Piso. Weiß strahlender Marmor und leuchtender hellgrauer Granit verliehen Perge den Glanz einer wohlhabenden Metropole, der sich auch in der seit 1998 durch H. Abbasoğlu ausgegrabenen Nekropole mit eindrucksvollen Grabbauten mit reicher Ausstattung und prachtvollen Sarkopha-gen spiegelte55.
Durchschritt der Bürger von Perge das Nymphäum am Nordende der großen Säulenstraße (Abb. 7)56, so verließ er diese Welt der Eleganz und des Luxus und sah sich bis zu 10 m hohen Mau-ern aus rustikal bossierten Quadern gegenüber, die ihn hangwärts trichterartig in einen schma-len Durchgang zur großen Fahrstrasse auf die Akropolis zwangen. Auch dort begrenzten hohe Mauern, die die dem Hang abgewonnene Straße stützten, seinen Blick; lediglich nach Osten bot sich 130 m entfernt der Anblick einer weiteren, aufgrund der Säulen aus weißem Marmor noch prächtigeren Säulenstraße, die jedoch nach Osten zum Hafentor führte (Abb. 5). Zur Akropolis hinauf setzte sich die durch die stadtseitig ca. 4-5 m hohe Wehrmauer und hangseitig bis zu 15 m hohe Stütz- und Wehrmauer begrenzte Straße fort. Sie führte den Passanten wie in einer Schlucht von allerdings ca. 17 m Breite langsam zu der Kehre nahe dem Südwesttor und schließlich zum Akropolistor nach insgesamt fast 300 m ständig bergauf, ohne Blick auf Akropolis oder Stadt, ein-gepfercht zwischen den hohen Mauern, die in der warmen Jahreshälfte die von den Mauern aus weißlich-gelblichem Sinterkalk reflektierte Hitze speicherten und keinen Windzug eindringen lie-ßen. Ein größerer Gegensatz zu der von schattigen Portiken mit abwechslungsreichen Geschäften begrenzten und durch die kühlenden fast endlosen Wasserbecken geprägten Säulenstraße in der Stadt ist kaum denkbar. Die Straße auf die Akropolis führte in eine andere, eher abweisende Welt, die sich wiederum nach Durchschreiten des Akropolistors signifikant änderte.
Auch wenn die Frage des für das Erscheinungsbild so wichtigen Bewuchses ohne Grabung nicht geklärt werden kann, erlaubt es der heute noch wahrnehmbare obertägige Befund, eine grundle-gende Vorstellung der Situation zu gewinnen. Hinter dem Tor öffnete sich im sanft ansteigenden Hang eine annähernd 40 x 40 m große gepflasterte Fläche (Abb. 8), die sich nach Westen als 11 m breite Strasse fortsetzte und an ihrer Nordseite von einer bis zu 7,50 m hohen Felswand über dem Straßenpflaster begrenzt wurde. Von diesem platzartigen Bereich, innerhalb dessen der anstehen-de Fels mit zerklüfteter Oberfläche den Naturcharakter dieses Areals betonte, führte östlich der
53 Es ganz allerdings nicht völlig ausgeschlossen werden, dass bereits in der frühen Kaiserzeit bei dem Umbau des runden Hofs des späthellenistischen Stadttors in ein Oval der nördliche Abschluss als Treppe gestaltet wurde. Der Befund bietet keine eindeutige Aussage, wie mir S. Bulgurlu mitgeteilt hat.
54 Abbasoğlu 2001: 213-215.55 Ebenda 215.56 Paintbrush von K. Wolter (Essen) nach Entwurf von W. Martini.
Perge und seine Akropolis 789
Felswand eine Treppe durch eine 20 m breite Mulde nach Norden auf die Ostkuppe der Akropolis hinauf, während eine gepflasterte Rampe in östlicher Richtung Zugang zu dem „südöstlichen Hei-ligtum“ auf dem steil aufragenden, senkrecht abgearbeiteten Felsplateau bot.
Der Blick in der Achse des Akropolistors fiel auf das östliche Ende der Felsbarre mit einer ca. 7 m breiten Grotte und darüber auf ein eigenartiges Monument auf der unebenen Oberseite der gewaltigen Felsstufe (Abb. 9)57. In den hellgrau verwitterten Felsgrund war eine insgesamt 2,45 m hohe flache Stele aus gelbbraunem Kalksandstein 1 m tief eingelassen. Hinsichtlich des auffälligen Materialwechsels gleicht sie dem früheisenzeitlichen Baitylos im Heiligtum in „Fläche 1“ und lässt eine analoge Datierung und Funktion als „heiliger Stein“ vermuten58. In diesen Kontext passt auch das stark abgewitterte Relief einer (über-)lebensgroßen Darstellung einer oder eines bekleidetet Sitzenden (?) westlich daneben, das eine sorgfältig ausgehauene, gestufte Nische flankiert59. Für die Deutung des auffälligen Monuments als „heiliger Stein“ spricht auch die Gesamtsituation in diesem Areal. Die Felsbarre (Abb. 10) weist in ihrer senkrecht abgearbeiteten Südwand auf 95 m nach Westen, bis sie im Gelände verläuft, eine kontinuierliche Reihe von Grotten bis zu 15 m Brei-te und 6 m Tiefe auf, die ursprünglich Wasser führten. Oberhalb und zwischen den überwiegend natürlichen Grotten dokumentieren Nischen, dass hier Reliefs eingelassen waren. Außerdem war die nach Norden leicht ansteigende Oberseite der Felsbarre zu kleinen, flachen Terrassen abge-arbeitet, auf denen Votive aufgestellt wurden, die nach Aussage weniger Fragmente aus Marmor und Kalkstein bis zu 4 m Höhe erreichen konnten. Auch die Lage des „heiligen Steins“ exakt in der Achse des letzten Abschnitts der Säulenstraße passt gut in diesen Kontext (Abb. 1 und 6). Zumindest bis zur Errichtung des Akropolistors mit seiner ca. 4-5 m hohen westlichen Kurtine im 5. Jh.v.Chr. (?) war die Stele von der Ebene aus zu sehen. Natürlich kann dies auch Zufall sein, da es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass bereits in archaischer Zeit eine entsprechende südliche Zuwegung zur Akropolis existierte; die bisherige Datierung der ältesten Befestigungsreste an dem untersten Tor („Stadttor“, Phase 3) schwankt zwischen dem späten 5. und späten 4. Jh.v.Chr.60.
Unabhängig davon ist dieser gesamte Bereich mit seinen zahlreichen Grotten, der östlich etwa mit dem „heiligen Stein“ endete, als sakraler Bereich zu interpretieren, der als „Naturland-schaft“ vermutlich den Nymphen oder eher Artemis als Beschützerin der Quellen geweiht war.
Auch die östlich anschließende Mulde (Abb. 8) war weitgehend naturbelassen, lediglich zu beiden Seiten waren aus dem Felsen einzelne größere rechteckige Einraumbauten von bis zu 7 x 10 m ausgehauen, deren meterhohe rohe Außenwände den ursprünglichen Charakter dieses Areals betonten. Auch die Westseite des “südöstlichen Heiligtum“, des mutmaßlichen Heiligtums der Artemis Pergaia, war vollständig bis in eine Mindesthöhe von ca. 3 m im Bereich des dreitori-gen Zugangs zu dem unteren Peristyl des Heiligtums aus dem anstehenden Felsen gewonnen.
Ab wann dieses „Naturheiligtum“ kultisch genutzt wurde, ist mangels datierender Befunde nicht zu entscheiden. Da der nördlich angrenzende Einraumbau wie vermutlich der gesamte östlich anschließende Bereich einschließlich des monumentalen Zugangs zum „südöstlichen Heiligtum“ zu einem frühen Zeitpunkt der großräumigen Bebauung (6. oder 5. Jh.v.Chr.?) aus
57 Rekonstruktion von M. Recke.58 Die nächsten Parallelen auf Zypern, die sog. Aphroditesteine mit gleichem hochrechteckigem Ausschnitt in der Mitte werden
zwar als Lager für Pressbalken von Ölmühlen interpretiert (Hadjisavvas 1992: 85-114; Hinweis M. Recke) , die als arbores seit klassischer Zeit überliefert sind, doch fehlen in Perge zum Einen die dazu gehörigen Becken, zum Anderen ist auch kein Platz auf der schmalen Felsterrasse für den Pressbalken etc. Trotz des eindeutigen Befunds der zyprischen „Aphroditesteine“ als Ölmühlen halte ich daher eine gleiche Funktion in Perge für unwahrscheinlich. Eher wäre denkbar, dass die häufigen „Aphroditesteine“, die ihren Namen offenbar nach zwei besonders großen Monolithen im Aphroditeheiligtum in Altpaphos - Kouklia (Hadjisavvas 1992: 85-97) haben, auch auf Zypern ursprünglich eine sakrale Funktion besessen haben.
59 Zuerst von M. Recke wahrgenommen. 60 Martini 2003b: 38.
Wolfram Martini790
dem Felsen gearbeitet sein dürfte, aber später als die Stele entstanden ist, ist eine früh- oder frühesteisenzeitliche Datierung (10.-7. Jh.v.Chr.) für den „heiligen Stein“ und damit eine sakrale Funktion dieser Grottenlandschaft wahrscheinlich.
Hatte man also nach dem anstrengenden Aufstieg zwischen den abweisenden hohen Mauern das Akropolistor durchschritten, befand man sich in einer „Naturlandschaft“ (Abb. 7), die sich auf je ca. 115 m zu beiden Seiten und 70 m nach Norden erstreckte. Seine zahlreichen Grotten mit kühlendem Wasser und seine zahllose Weihgeschenke mit der anikonischen Stele prägten diese Sakrallandschaft und verliehen ihr eine angenehme, erfrischende und ursprünglich anmu-tende Atmosphäre. Erst wenn man diesen altehrwürdigen heiligen Ort in nördlicher Richtung durchquert hatte, gelangte man in die überwiegend durch enge, oft gekrümmte Gassen struk-turierte Altstadt, deren Mauern des 5. Jhs.v.Chr. teilweise noch in frühbyzantinischer Zeit den Häusern als Außenwände entlang den Strassen dienten (Abb. 5). Nur in der westlich gelegenen großen Mulde, die durch eine 11 m breite gepflasterte Plateia mit dem „südöstlichen Heiligtum“ verbunden war, repräsentierten die bereits erwähnten weiter genutzten hellenistischen Peristyl-bauten, die elegante Agora mit der Statue des Augustus, großformatige Neubauten und marmor-ne Ehrenmonumente die kaiserzeitliche Blüte von Perge. Im übrigen Gebiet der Akropolis, z.B. auch in den detaillierter untersuchten Heiligtümern in „Fläche 1“ und „Fläche 2“ wurden in der Kaiserzeit nur geringe Veränderungen vorgenommen, die den Altbestand nicht wesentlich ver-änderten. Auch die Nekropole auf dem Nordhügel der Akropolis (Abb. 5) wurde nach Ausweis der erhaltenen Grabterrassen des 4. Jhs.v.Chr.61, vieler Sarkophagfragmente und des in frühby-zantinischer Zeit weiter verwendeten Coemeteriums weitgehend unverändert beibehalten.
Insgesamt bot die Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit das Bild einer Jahrhunderte alten Altstadt, bei der lediglich der Bereich der öffentlichen Bauten neben den beiden großen und eleganten, mit Marmor stuckierten hellenistischen Peristylen ein wenig modernisiert worden war, wobei der aufwendige Bau der Brüder Demetrios und Apollonios mit seiner 3,5 m langen Bauin-schrift in dorischer Bauordnung offenbar der hellenistischen Architektur angeglichen wurde.
Neben der allgemeinen Bedeutung als altehrwürdige Altstadt ist der sakrale Charakter der Akropolis hervorzuheben, der sich nicht nur in der Zahl von bisher drei lokalisierten Heiligtü-mern und vielleicht der Sebaste agora als Stätte des Kaiserkults - in der Neustadt selbst ist dagegen keines bekannt -, sondern vor allem in ihrer Qualität äußert. Das kleinste der drei Heiligtümer etwa in der Mitte der Akropolis („Fläche 1“) zeichnet sich durch seine bauliche Kontinuität seit zumindest der späten Bronzezeit aus. Bis in die Spätantike wurde das Temenos respektiert, das alte anikonische Kultmal verehrt. Das ebenso wenig identifizierte Heiligtum in „Fläche 2“ auf der Kuppe des Westhügels breitete sich auf immerhin fast 100 x 100 m aus und beherrschte mit dem späthellenistischen Neubau des 10 x 15 m großen Antentempels und den bis zu 36 m langen Säulenhallen des 5. und 4. Jhs.v.Chr. den Westteil der Akropolis. Den ersten und überra-genden Eindruck für den Besucher der Akropolis bot allerdings die weiträumige, sich auf 250 m ausbreitende naturbelassene Sakrallandschaft mit dem östlich anschließenden Temenos im mitt-leren südlichen Bereich und verlieh der Akropolis ihre ausgesprochen sakrale Aura.
Die wegemäßige Erschließung dieses sakralen Areals auch in der Kaiserzeit durch die alten Straßen von Westen, der Anbindung an die via Sebaste, und von Osten, der Anbindung an den Kestros und damit an das Mittelmeer, verdeutlicht den weiterhin überregionalen Charakter der Akropolis (Abb. 1). Während die Weststrasse62 vom späthellenistischen Westtor zum alten Südwesttor der Akropolisbefestigung mit einer Breite von ca. 9,50 m, dicht gesäumt von Läden,
61 Martini 2003b: 71f.62 Martini 2003b: 27.
Perge und seine Akropolis 791
aber ohne begleitende Portiken, relativ schmal und von geringerer Bedeutung war, war die ins-gesamt 22 m breite Oststrasse ähnlich aufwendig und prächtig wie der cardo maximus gestaltet63. Dadurch erweist sich diese über 500 m lange Plateia vom Hafentor aus als fast gleichbedeutende Magistrale, deren ausschließliches Ziel die Akropolis war; denn für den Hafenverkehr in die kaiserzeitlich Neustadt diente der in seinem östlichen Abschnitt völlig geradlinig verlaufende decumanus maximus von dem ca. 180 m südlich gelegenen Osttor aus.
Das konkrete Ziel auf der Akropolis kann nur das „südöstliche Heiligtum“, das mutmaßliche Heiligtum der Artemis Pergaia gewesen sein. Die Identifizierung der anderen beiden Heiligtü-mer scheint nicht möglich, auch wenn eine der Basen der hadrianischen Ausstattung des helle-nistischen Rundtors ein Heiligtum des Zeus Machaonios auf der Akropolis oder andere Inschrif-ten die Verehrung weiterer Gottheiten bezeugen64.
Diese Heiligtümer, aber auch die repräsentativen kaiserzeitlichen Bauwerke einschließlich der monumentalen Plateia kennzeichnen die Akropolis nach wie vor als Stätte der Wahrung und Ausübung des Kults und seiner Festtraditionen für die gesamte Region65 und begründen die hohe Wertschätzung, die die Akropolis noch in der Kaiserzeit als schutz- und pflegewürdige, sa-kral konnotierte Keimzelle der ihrer langen Tradition durchaus bewussten Stadt genoss. Obwohl die Akropolis sich durch die topographische Situation, das Straßensystem, ihre Befestigung und ihre Bebauung als eigenständiger Teil gegenüber der Neustadt in jeder Beziehung unterschied, blieb sie als sakrales Zentrum fester Bestandteil von Perge. Bei den großen Festen mit Agonen aller Art wie z.B. dem jährlichen Fest für Artemis Pergaia oder den seit flavischer Zeit bezeugten großen penteterischen Kaiserspielen66 verbanden die Prozessionen Theater und Stadion mit dem Heiligtum der Artemis auf der Akropolis als zentrale Stätten und schlossen räumlich und als Identität stiftende Rituale die gesamte Stadt und ihre Bürger mit ein.
Städtebaulich war die Akropolis z.B. durch die Plazierung des Bogens von Demetrios und Apol-lonios in der Achse des Zugangs aus der Richtung des Hafens an der Kreuzung von cardo maximus und decumanus maximus nahe dem Aufgang zur Akropolis, aber auch durch die Ausrichtung des südlichen und nördlichen Abschnitts des cardo maximus mit ihren Blickachsen fest mit der Neustadt verknüpft. Darüber hinaus war die „Altstadt“ durch die programmatische Inszenierung des pergä-ischen Gründungsmythos, der Ktisteis von Perge, in hadrianischer Zeit durch Plancia Magna am ehemaligen Eingangstor in die Neustadt67 tief im kulturellen Gedächtnis der Bürger, das bis in die dunkle Zeit des trojanischen Kriegs zurückreichte, verankert und damit konstituierendes Element der Stadt. So wie im hadrianischen Torhof den ruhmreichen Gründungsheroen einer mythischen Vergangenheit die mäzenatischen „Gründer“ der Gegenwart gegenüber gestellt waren, so lagen sich die Altstadt mit ihren Heiligtümern als Trägerin ruhmvoller und frommer Vergangenheit und Tradition und die Neustadt als Abbild glanzvoller kommerzieller und euergetischer Gegenwart als verheißungsvolle Konzeption für eine blühende Zukunft gegenüber.
Floreat Perge!68
63 Martini 2003b: 23.64 Apollon Pamphylos Soter (Şahin 1999: Nr. 56); Apollon Kerykeios, Priesterweihung (Şahin 1999: Nr. 264); Ares (Şahin 1999:
Nr. 234/5); Asklepios Soter (Şahin 1999: Nr. 242); Athena, Weihung einer Priesterin (Şahin 1999: Nr. 173); Demeter, Wei-hung einer Priesterin (Şahin 1999: Nr. 65, vgl. 118, 120f.,123-125); Zeus Poliuchos, Priesterweihung (Şahin 1999: Nr. 232).
65 MacKay 1990: 2059-2066; s.a. z.B. die zahlreichen Stifter aus ganz Pamphylien in der Inventarliste des Heiligtums der Arte-mis (Şahin 1990: Nr. 10, 6-12).
66 Şahin 1999: 55-61. 67 Weiss 1984: bes. 181f.; Şahin 1999: 135-145.68 Rouechè 1989; Şahin 2004: 52-58 Nr. 331 col. 2.
Wolfram Martini792
BibliographieAbbasoğlu, H.2001 “The Perge Excavations”, Istanbul Universi-
ty’s Contributions to Archaeology in Turkey, ed. O. Belli, Istanbul: 211-216.
2003 “Zur Geschichte der Ausgrabungen in Perge”, Abbasoğlu – Martini 2003: 1-12.
Abbasoğlu – Martini (Hrsg.)
2003 Die Akropolis von Perge 1. Survey und Sond-agen 1994-1997, Mainz.
Adak, M. – O. Atvur 1999 “Epigraphische Mitteilungen aus Antalya II:
Die pamphylische Hafenstadt Magydos”, EpigrAnat 31: 53-68.
Brandt, H. – F. Kolb, 2005 Lycia et Pamphylia. Eine römische Provinz
im Südwesten Kleinasiens, Mainz.
Broughton, T.R.S. 1959 “Roman Asia”, An Economic Survey of An-
cient Rome 4, Hrsg. T. Frank, New Jersey: 499-916, 579-590.
Bulgurlu, S. 1999 “Perge Kenti Hellenistik Güney Kapısı ve
Evreleri”, Ph.D. Diss., Istanbul.
Hadjisavvas, S. 1992 Olive Oil Pressing on Cyprus from the Bronze
Age to the Byzantine Period, Nicosia.
Heinzelmann, H. 2003 “Städtekonkurrenz und kommunaler Bürger-
sinn. Die Säulenstraße von Perge als Beispiel monumentaler Stadtgestaltung durch kolle-ktiven Euergetismus”, AA: 197-220.
Lanckoronski, K.G. 1890 Die Städte Pamphyliens und Pisidiens 1.
Pamphylien, Wien.
Laube, I. 2003 “Die frühkaiserzeitliche Panzerstatue”,
Abbasoğlu – Martini 2003: 151-155.2006 Thorakopohoroi. Gestalt und Semantik des
Brustpanzers in der Darstellung des 4. bis 1 .Jhs.v.Chr., Tübingen.
MacKay, Th.S. 1990 “The Major Sanctuaries of Pamphylia and
Cilicia”, ANRW 2/18,3: 2048-2082.
Mansel, A.M. 1956 “Bericht über die Ausgrabungen und Un-
tersuchungen in Pamphylien in den Jahren 1946 - 1955”, AA: 34-120.
1975 “Ausgrabungen in Perge”, AA: 49-96.1975 “Die Nymphäen vonPerge”, IstMitt 25:
397-372.
Mansel, A.M. – A. Akarca1949 Perge’de Kazılar ve Araştırmalar, Ankara.
Martini, W. 1984 Das Gymnasion von Samos. Samos XVI.2003a “Zur Lage des Artemis-Heiligtums von
Perge”, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan. Anadolu’da Doğdu, ed. T. Korkut, İstanbul: 479-492.
2003b “Topographie und Architektur”, Abbasoğlu – Martini 2003: 13-78.
2003 c “Historische Schlußfolgerungen”, Abbasoğlu – Martini 2003: 179-186.
Mitchell, S. 1992 “Hellenismus in Pisidien”, Forschungen in
Pisidien, Hrsg. E. Schwertheim, AMS 6: 1-27.
McNicholl, A.W.1997 Hellenistic Fortifications from the Aegean to
the Euphrates, Oxford.
Pfanner, M. 1990 “Modelle römischer Stadtentwicklung am
Beispiel Hispaniens und der westlichen Pro-vinzen”, Stadtbild und Ideologie. Monumen-talisierung hispanischer Städte zwischen Re-publik und Kaiserzeit, Koll. Madrid 1987, W. Trillmich – P. Zanker, München: 59-116.
Roueché, Ch. 1989 “Floreat Perge”, Images of Authority. Papers
presented to Joyce Reynolds on the occasion of her seventieth birthday, ed. M.M. Macken-zie - Ch. Roueché, Cambridge: 206-228.
Şahin, S. 1999 Die Inschriften von Perge 1, IK 54.2003 “Die Inschriften”, Abbasoğlu – Martini 2003:
167-174. 2004 Die Inschriften von Perge 2, IK 61.
Trillmich, W. 1990 “Colonia Augusta Emerita, die Hauptstadt
von Lusitanien”, Hrsg. W. Trillmich – P. Zanker, Stadtbild und Ideologie. Monumen-talisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Koll. Madrid 1987, München: 299-318.
Türkmen, M. 2001 “Perge Aşağı Şehir Surlarinda Roma Dönemi
Uygulamarına ilişkin Gözlemler”, M.A. The-sis, Istanbul.
Weiss, P. 1984 “Lebendiger Mythos”, WürzbJb 10: 179-211.
Wolfram Martini794
Abb. 2 Perge. Haupttor der Neustadt. Dorischer Fries
Abb. 3 Trasse der Straße von Magydos nach Perge (Foto Recke)
Abb. 4 Brücke nach Magydos (Foto Recke)
Perge und seine Akropolis 795
Abb. 5 Perge, Akropolis. Gesamtplan
Abb. 6 Akropolis, Südhang. Sichtbereiche
Wolfram Martini796
Abb. 7 Perge. Rekonstruierte Ansicht der Südseite der Akropolis
Abb. 8 Perge, Akropolis. Felsbarre mit „heiligem Stein“ und „südöstlichem Heiligtum“
Perge und seine Akropolis 797
Abb. 9 „Heiliger Stein“ (Montage Recke)
Abb. 10 Perge, Akropolis. Östlicher Abschnitt der Felsbarre