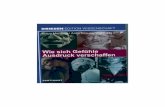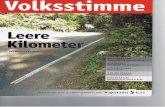Immersions- und Emotionsforschung, Kernelemente der Bildwissenschaft
Böhmen in der Spätantike und der Völkerwanderungszeit unter besonderer Berücksichtigung der...
Transcript of Böhmen in der Spätantike und der Völkerwanderungszeit unter besonderer Berücksichtigung der...
Hrsg.: Hubert Fehr
Irmtraut Heitmeier
Die Anfänge BayernsVon Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria
Galt die Frühgeschichte Bayerns vor zwei Jahrzehnten als fast geklärt, so wirft sie im Licht der jüngeren For schung mehr Fragen auf denn je. Um diese aus interdisziplinärer Sicht zu diskutieren, trafen sich im März 2010 Vertreter der Archäologien, der Geschichts- und Sprachenwissenschaften in Benediktbeuern.Der kritische Blick auf die Über-lieferung in Verbindung mit
neu gewonnenen methodischen Einsichten brachte manch ältere ‚Gewissheit‘ ins Wanken, zeigte aber auch neue, zum Teil überraschende Perspektiven auf. Die Beiträge des vorliegenden Bandes bilanzieren den aktuellen Forschungsstand. Dabei werden nicht nur zahlreiche neue Denk-ansätze präsentiert, sondern auch verschiedene, konkurrierende und zum Teil sich sogar widersprechende Standpunkte vertreten.
ISBN 3830675488
9 7 8 3 8 3 0 6 7 5 4 8 8
Die
Anf
änge
Bay
erns
Vo
n Ra
etie
n un
d N
oric
um z
ur f
rühm
itte
lalter
liche
n Bai
ovar
iaH
rsg.
: H
uber
t Fe
hr u
nd Irm
trau
t H
eitm
eier
herausgegeben von Hubert Fehr und
Irmtraut Heitmeier
Die Anfänge BayernsVon Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria
Galt die Frühgeschichte Bayerns vor zwei Jahrzehnten als fast geklärt, so wirft sie im Licht der jüngeren For schung mehr Fragen auf denn je. Um diese aus interdisziplinärer Sicht zu diskutieren, trafen sich im März 2010 Vertreter der Archäologien, der Geschichts- und Sprachenwissenschaften in Benediktbeuern.Der kritische Blick auf die Über-lieferung in Verbindung mit
neu gewonnenen methodischen Einsichten brachte manch ältere ‚Gewissheit‘ ins Wanken, zeigte aber auch neue, zum Teil überraschende Perspektiven auf. Die Beiträge des vorliegenden Bandes bilanzieren den aktuellen Forschungsstand. Dabei werden nicht nur zahlreiche neue Denk-ansätze präsentiert, sondern auch verschiedene, konkurrierende und zum Teil sich sogar widersprechende Standpunkte vertreten.
ISBN 3830675488
9 7 8 3 8 3 0 6 7 5 4 8 8
Die
Anf
änge
Bay
erns
Vo
n Ra
etie
n un
d N
oric
um z
ur f
rühm
itte
lalter
liche
n Bai
ovar
iaH
g.: H
uber
t Fe
hr u
nd Irm
trau
t H
eitm
eier
benediktbeuern_umschlag_02_07_201 1 02.07.2012 12:32:54
herausgegeben von Hubert Fehr und
Irmtraut Heitmeier
Die Anfänge BayernsVon Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria
Galt die Frühgeschichte Bayerns vor zwei Jahrzehnten als fast geklärt, so wirft sie im Licht der jüngeren For schung mehr Fragen auf denn je. Um diese aus interdisziplinärer Sicht zu diskutieren, trafen sich im März 2010 Vertreter der Archäologien, der Geschichts- und Sprachwissenschaften in Benediktbeuern.Der kritische Blick auf die Über-lieferung in Verbindung mit
neu gewonnenen methodischen Einsichten brachte manch ältere ‚Gewissheit‘ ins Wanken, zeigte aber auch neue, zum Teil überraschende Perspektiven auf. Die Beiträge des vorliegenden Bandes bilanzieren den aktuellen Forschungsstand. Dabei werden nicht nur zahlreiche neue Denk-ansätze präsentiert, sondern auch verschiedene, konkurrierende und zum Teil sich sogar widersprechende Standpunkte vertreten.
ISBN 3830675488
9 7 8 3 8 3 0 6 7 5 4 8 8
Die
Anf
änge
Bay
erns
Vo
n Ra
etie
n un
d N
oric
um z
ur f
rühm
itte
lalter
liche
n Bai
ovar
iaH
g.: H
uber
t Fe
hr u
nd Irm
trau
t H
eitm
eier
benediktbeuern_umschlag_02_07_201 1 02.07.2012 12:32:54
herausgegeben von Hubert Fehr und
Irmtraut Heitmeier
Die Anfänge BayernsVon Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria
Galt die Frühgeschichte Bayerns vor zwei Jahrzehnten als fast geklärt, so wirft sie im Licht der jüngeren For schung mehr Fragen auf denn je. Um diese aus interdisziplinärer Sicht zu diskutieren, trafen sich im März 2010 Vertreter der Archäologien, der Geschichts- und Sprachenwissenschaften in Benediktbeuern.Der kritische Blick auf die Über-lieferung in Verbindung mit
neu gewonnenen methodischen Einsichten brachte manch ältere ‚Gewissheit‘ ins Wanken, zeigte aber auch neue, zum Teil überraschende Perspektiven auf. Die Beiträge des vorliegenden Bandes bilanzieren den aktuellen Forschungsstand. Dabei werden nicht nur zahlreiche neue Denk-ansätze präsentiert, sondern auch verschiedene, konkurrierende und zum Teil sich sogar widersprechende Standpunkte vertreten.
ISBN 3830675488
9 7 8 3 8 3 0 6 7 5 4 8 8
Die
Anf
änge
Bay
erns
Vo
n Ra
etie
n un
d N
oric
um z
ur f
rühm
itte
lalter
liche
n Bai
ovar
iaH
g.: H
uber
t Fe
hr u
nd Irm
trau
t H
eitm
eier
benediktbeuern_umschlag_02_07_201 1 02.07.2012 12:32:54
Die Anfänge BayernsVon Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria
benediktbeuern_innenteil_22_06_21 1 22.06.2012 17:16:39
Bayerische Landesgeschichte und europäische Regionalgeschichte
herausgegeben vom Institut für Bayerische Geschichte – LMU MünchenFerdinand Kramer und Dieter J. Weiß
Band 1
in Verbindung mit dem Bayerischen Landesamt für DenkmalpflegeEgon Johannes Greipl
benediktbeuern_innenteil_03_07_22 2 03.07.2012 15:13:29
Die Anfänge Bayerns
Von Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria
herausgegeben von
Hubert FehrIrmtraut Heitmeier
EOS Verlag, St. Ottilien 2012
benediktbeuern_innenteil_22_06_23 3 22.06.2012 17:16:39
Die Herausgeber danken dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege,
dem Institut für Bayerische Geschichte der LMU München sowie der Michael-Doeberl-Stiftung und Eginhard-und-Franziska-Jungmann-Stiftung,
die die Durchführung des Kolloquiums und die Drucklegung des Tagungsbandes ermöglicht haben.
Für den reibungslosen Ablauf des Kolloquiums und die angenehme Tagungsatmosphäre sei den Mitarbeitern des „Zentrums für Umwelt und Kultur“ im Maierhof des Klosters Benediktbeuern besonders gedankt.
Für vielfältige Unterstützung gilt unser Dank zudem den Kollegen der Archäologischen Staatssammlung München und den Mitarbeitern des Instituts für Bayerische Geschichte.
Außerdem danken wir für die freundliche Überlassung von Publikationsrechten der Bayerischen Staatsbibliothek, München, und dem Cornelsen-Verlag, Berlin.
Abbildungen:Für die Abbildungen gilt der Nachweis der Bildunterschriften.
Zusätzlich: Umschlag Handschrift: ASP, Hs. A 5, fol. 3v (Erzabtei St. Peter Salzburg); Vorsatzkarte: Bearbeitung der Karte „Die spätrömischen Provinzen Raetia Secunda, Noricum Ripense und Noricum Mediterraneum im 5. Jh. n. Chr.“ von Arno Rettner u. Bernd Steidl, in: Ludwig Wamser
(Hg.), Karfunkelstein und Seide, 2010, 47; Nachsatzkarte: Bearbeitung der Karte „Das Bairische Stammesherzogtum 788“ in: Hermann Dannheimer – Heinz Dopsch (Hg.), Die Bajuwaren, 1988, 163.
Umschlag, Gestaltung und Satz: Elisabeth Lukas-Götz M.A., Thomas Böck
Druck und Bindung: EOS-Druck, St. Ottilien
Gedruckt auf säurefreiem, chlorfreiem Werkdruckpapier „Alster gelblichweiß“unter Verwendung der Rotis Serif W1G
Bibliographische Information der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie;
detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt und verbreitet werden.
1. Auflage 2012Deutsche Erstausgabe
Copyright © 2012 by EOS Verlag, St. [email protected]
ISBN 978-3-8306-7548-8
benediktbeuern_innenteil_22_06_24 4 22.06.2012 17:16:41
Vorwort
Die Diskussion um die Anfänge Bayerns in den Transformationsprozessen vom 4. bis 8. Jahrhundert n. Chr. hat in den letzten beiden Jahrzehnten vor allem durch bemerkenswerte archäologische Funde und Befunde, durch ei-nen multiperspektivischen, interdisziplinären sowie in europäischen Bezü-gen vergleichenden Ansatz, außerdem durch die neue Sensibilität für kultur-wissenschaftliche Fragestellungen in den Geschichtswissenschaften neue Impulse bekommen. Vor diesem Hintergrund haben auf Initiative von Dr. Irm-traut Heitmeier und Dr. Hubert Fehr das Bayerische Landesamt für Denkmal-pflege und das Institut für Bayerische Geschichte der LMU München 2010 im „Zentrum für Umwelt und Kultur“ in Benediktbeuern eine Tagung veranstal-tet, deren Ergebnisse in diesem Band präsentiert werden.
Zur Ausstattung des Bandes trug wesentlich die Abteilung Frühgeschicht-liche Archäologie und Archäologie des Mittelalters des Instituts für Archäo-logische Wissenschaften der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bei, die die aufwändige Erstellung der Karten durch Herrn Michael Kinsky ermöglichte. Frau Elisabeth Lukas-Götz M.A. wirkte maßgeblich an der Endkorrektur der Beiträge und durch die Gestaltung des Bandes mit.
Wir danken allen für die engagierte Mitarbeit! Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, Bayerisches Landesamt für DenkmalpflegeProf. Dr. Ferdinand Kramer, Institut für Bayerische Geschichte – LMU München
benediktbeuern_innenteil_22_06_25 5 22.06.2012 17:16:41
Inhaltsverzeichnis
5 Vorwort
10 Abkürzungsverzeichnis
13 HubertFehr,IrmtrautHeitmeier Ein Vierteljahrhundert später …
21 MichaelaKonrad Ungleiche Nachbarn. Die Provinzen Raetien und Noricum
in der römischen Kaiserzeit
73 RolandSteinacher Zur Identitätsbildung frühmittelalterlicher Gemeinschaften.
Überblick über den historischen Forschungsstand
125 JochenHaberstroh Der Fall Friedenhain-Přešťovice – ein Beitrag zur Ethnogenese
der Baiovaren?
149 LudwigRübekeil Der Name Baiovarii und seine typologische Nachbarschaft
163 AlheydisPlassmann Zur Origo-Problematik unter besonderer Berücksichtigung der Baiern
benediktbeuern_innenteil_22_06_27 7 22.06.2012 17:16:41
�
183 BrittaKägler „Sage mir, wie du heißt ...“: Spätantik-frühmittelalterliche Eliten
in den Schriftquellen am Beispiel der frühen Agilolfinger
197 ChristaJochum-Godglück Walchensiedlungsnamen und ihre historische Aussagekraft
219 AndreasSchorr Frühmittelalterliche Namen an Iller, Donau und Lech. Ihr Aussagewert
für eine transdisziplinäre Kontinuitäts- und ‚Ethnogenese‘-Diskussion
245 BrigitteHaas-Gebhard Unterhaching – Eine Grabgruppe der Zeit um 500 n. Chr.
273 ArnoRettner Zur Aussagekraft archäologischer Quellen am Übergang
von der Antike zum Frühmittelalter in Raetien
311 HubertFehr Friedhöfe der frühen Merowingerzeit in Baiern – Belege für die
Einwanderung der Baiovaren und anderer germanischer Gruppen?
337 BarbaraHausmair Kontinuitätsvakuum oder Forschungslücke? Der Übergang
von der Spätantike zur Baiernzeit in Ufernoricum
359 JaroslavJiřík Böhmen in der Spätantike und der Völkerwanderungszeit unter
besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu Baiern und Thüringen
403 EvaKropf Möglichkeiten und Grenzen der Anthropologie, dargestellt am Beispiel
des frühmittelalterlichen Gräberfeldes von Enkering (Lkr. Eichstätt)
413 JosefLöffl Wirtschaftshistorische Grundgedanken zum bairischen Raum
in der Spätantike
425 StefanEsders Spätantike und frühmittelalterliche Dukate. Überlegungen zum
Problem historischer Kontinuität und Diskontinuität
benediktbeuern_innenteil_22_06_28 8 22.06.2012 17:16:41
�
463 IrmtrautHeitmeier Die spätantiken Wurzeln der bairischen Noricum-Tradition.
Überlegungen zur Genese des Herzogtums
551 PhilippeDepreux Auf der Suche nach dem princeps in Aquitanien (7.–8. Jahrhundert)
567 ChristianLater Zur archäologischen Nachweisbarkeit des Christentums im frühmittel-
alterlichen Baiern. Methodische und quellenkritische Anmerkungen
613 RomanDeutinger Wie die Baiern Christen wurden
Runder Tisch: Regensburg im frühen Mittelalter. Aktuelle Perspek-tiven aus archäologischer, namenkundlicher und historischer Sicht
633 Einführung 634 SilviaCodreanu-Windauer
Zum archäologischen Forschungsstand in und um Regensburg 640 ArnoRettner
Historisch-archäologische Überlegungen zur Bedeutung Regensburgs im 6. und 7. Jahrhundert
653 WolfgangJanka Der Raum Regensburg – namenkundlicher Forschungsstand und Perspektiven
658 AloisSchmid Probleme der Frühgeschichte Regensburgs aus historischer Sicht
663 Autorenverzeichnis
benediktbeuern_innenteil_22_06_29 9 22.06.2012 17:16:41
10
Abkürzungsverzeichnis
Adj. Adjektivahd. althochdeutschANRW Aufstieg und Niedergang des Römischen WeltreichsBayHStA Bayerisches HauptstaatsarchivBearb. BearbeiterBez. BezirkBHL Bibliotheca Hagiographica LatinaBLfD Bayerisches Landesamt für DenkmalpflegeBSB Bayerische StaatsbibliothekCAH2 The Cambridge Ancient History, 2. Aufl.CIL Corpus Inscriptionum LatinumCSIR Corpus Signorum Imperii Romanidt. deutsched. ediert/herausgegebenF. Femininumfol. folioFSGA Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. Ausgewählte Quellen
zur deutschen Geschichte des MittelaltersGde. Gemeindegerm. germanischGewN Gewässername griech. griechischHg. Herausgeber/-in, herausgegebenHONB Historisches Ortsnamenbuch von Bayern
benediktbeuern_innenteil_22_06_210 10 22.06.2012 17:16:41
Hzg. Herzogidg. indogermanischJh. JahrhundertKop. KopieKr. Kreislat. lateinischLdkr./Lkr. LandkreisM. MaskulinumMGH Monumenta Germaniae HistoricaMGH AA Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimiMGH Capit. Monumenta Germaniae Historica, CapitulariaMGH Conc. Monumenta Germaniae Historica, ConciliaMGH DD Monumenta Germaniae Historica, DiplomataMGH Epp. Monumenta Germaniae Historica, EpistolaeMGH LL Monumenta Germaniae Historica, LegesMGH SS Monumenta Germaniae Historica, Scriptoresmhd. mittelhochdeutschN NordenNdr. NachdruckNF Neue FolgeO OstenOK Oberkante eines Befundes (in m und NN)ON Ortsname Or. OriginalpdF plastisch dekorierte FeinkeramikPN PersonennameProv. ProvinzQuE Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichter. regiertRAC Reallexikon für Antike und ChristentumRed. RedaktionRGA2 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl.S Südensc. (scilicet) d. h. (das heißt)SEG Supplementum Epigraphicum GraecumSN SiedlungsnameSt. StadtSUB Salzburger UrkundenbuchTr. Traditionenvlat. vulgärlateinisch W Westen
11
benediktbeuern_innenteil_22_06_211 11 22.06.2012 17:16:41
Böhmen in der Spätantike und der Völkerwanderungszeit unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu
Baiern und Thüringen
Jaroslav Jiřík
Einleitung
Das Altbairische ist eindeutig eine westgermanische Sprache, mit klaren Be-zügen zum Alemannischen und Thüringischen, aber auch mit interessanten ostgermanischen Einflüssen, besonders auf lexikalischer Ebene, wie z. B. in den Wörtern Ergetag „Dienstag“ (von gotisch *arjausdags, „Tag des Ari-us“), Pfinztag „Donnerstag“ (von gotisch *pinta-dags, „der fünfte Tag“), Maut „Zoll“ (von gotisch Mota), Dult „Volksfest“, Pfoad „Hemd“, etc.1.
1 Der vorliegende Aufsatz wurde für diesen Band aus dem englischen Originalmanuskript des Autors ins Deutsche übersetzt. In ihn flossen die Ergebnisse zweier Forschungsprojekte ein, die öffentlich gefördert wurden: 1) Pro Archaelogia Saxoniae 253: Prunk, Luxus und Sparsamkeit in der Grabausstattung der Völkerwanderungszeit am Beispiel der Nekropole Prag-Zličín, und 2) Czech Science Foundation P405/11/2511: Interregional contacts of Bohemia in the Migration Pe-riod. Evidence of precious metal jewellery and luxury glass vessels. — Zu den sprachwissenschaft-lichen Überlegungen siehe beck, Bajuwaren, 601–606. Diese Beobachtungen zu den Beziehungen zwischen dem Altbairischen und dem Gotischen gehen auf Friedrich Kluge zurück. Dieser publi-zierte 1910 eine Studie über eine Anzahl frühchristlicher Begriffe sowie Namen von Wochentagen, von denen er annahm, dass sie über gotische Vermittlung letztlich aus dem Griechischen entlehnt
EINLEITUNG_359 | KONTAKTE ZWISCHEN NORDBÖHMEN UND SÜDDEUTSCHLAND WÄHREND
DER SPÄTRÖMISCHEN STUFEN C3/D1_361 | DIE VINAřICE-GRUPPE UND DIE KONTAKTE MIT
DEM MAIN-GEBIET_370 | DAS GEBIET SÜD- UND WESTBÖHMENS UND DAS PROBLEM DER
GRUPPE FRIEDENHAIN-PřEšT OVICE_376 | DAS PROBLEM DER BESIEDLUNG SÜD- UND WEST-
BÖHMENS WÄHREND DER MEROWINGERZEIT_384 | DER ELBGERMANISCHE KULTURKREIS
WÄHREND DER MEROWINGERZEIT – THÜRINGER, LANGOBARDEN, BAIOVAREN UND DIE ROL-
LE DES BÖHMISCHEN GEBIETS_386 | FAZIT_392
benediktbeuern_innenteil_22_06_2359 359 22.06.2012 17:19:48
360
Die Forschung, die sich mit der ältesten Geschichte Baierns beschäftigt, hat in der Vergangenheit verschiedene Theorien vorgeschlagen, wie dieser sprachwissenschaftliche Befund zu erklären sei. Man ging vielfach davon aus, dass der Ursprung der Bevölkerung Baierns in Böhmen zu finden sei, entsprechend einer vermuteten Verbindung zwischen den beiden Gebieten, die aufgrund der Etymologie des Landes- bzw. Volksnamens vorausgesetzt wurde.
Von besonderen Kontakten zwischen Baiern und Süd- bzw. Westböhmen im späten 4. und 5. Jahrhundert – und zwar in Form der so genannten Frie-denhain-Přešťovice-Gruppe – geht auch das derzeit bekannteste Modell zur Ethnogenese der Baiovaren aus. Den letzten Überblick über den gegenwär-tigen Forschungsstand hat Hubert Fehr vorgelegt2. In einigen neueren Arbei-ten wird zudem die Bedeutung des Fortlebens der römischen Provinzialbe-völkerung von der Spätantike zum Frühmittelalter betont3. Ich habe kürzlich ein etwas abweichendes Modell zur Beziehung Baierns und Böhmens am Ende der Spätantike vorgeschlagen4. Der wesentliche Unterschied zwischen meinem und dem von Fehr skizzierten Modell betrifft die Ersterwähnung der Baiovaren bei Jordanes5. Fehr nimmt die Entstehung einer Identität der Baiovaren erst ab der Mitte des 6. Jahrhunderts an; Ausgangspunkt sei die Reorganisation des Gebiets durch das Frankenreich gewesen sowie die Ent-stehung des Dukats in Baiern. Die erste sicher datierte Erwähnung der Ba-iovaren durch Jordanes wird dabei als nahezu gleichzeitig angesehen. In meinem kürzlich veröffentlichten eigenen Modell6, das die Erwähnung der Baiovaren bei Jordanes ebenfalls mit berücksichtig, wird dagegen die Tat-sache betont, dass sich die Ersterwähnung auf eine ältere Begebenheit be-zieht, und zwar auf Ereignisse in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, die mit der Flucht des Suebenkönigs Hunimunds in die Alamannia zusam-menhängen7. Diese beiden auf den ersten Blick unterschiedlichen Ansätze
worden sind, zum Beispiel gr. κυριακόν („Gotteshaus“) im 4. Jhd. > got. *kyrikó > deutsch Kirche. Kluge wies ebenfalls darauf hin, dass der oberdeutsche Sprachraum einschließlich Österreichs eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung dieser Lehnworte in das Althochdeutsche bereits im 5. Jahrhun-dert gespielt habe: kluGe, Gotische Lehnworte, 158. In diesem Zusammenhang ist der Fund einer Bleiplatte aus Grab 5 des Friedhofs von Hács-Béndekpuszta in Pannonien bemerkenswert. Diese trug eine fragmentarische Inschrift der gotischen Übersetzung des Neuen Testaments. Das Grab da-tiert in das Ende des 5. Jahrhunderts, d. h. in die Periode, in der die Goten den schriftlichen Quellen zufolge von der Balkan-Halbinsel nach Italien zogen. harmatta, Fragments, 1–24. – Aus aktueller sprachwissenschaftlicher Sicht vgl. dazu auch haubrichs, Baiern, Romanen und Andere, bes. 399.
2 Fehr, Am Anfang war das Volk?. 3 rettner, Baiuaria romana, 269–271. 4 Jiřík, Bohemian Barbarians 265–319.5 Iordanes, Getica 280 f., ed. mommsen 130. 6 Jiřík, Bohemian Barbarians, 311–316.7 Iordanes, Getica 116–123, ed. mommsen 35 f. Tatsächlich wäre dies nicht die einzige Stelle,
an der Jordanes so argumentiert. Zum Vergleich sei auf die Textstelle Iordanes, Getica 116–123,
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2360 360 22.06.2012 17:19:48
361
zu den Anfängen der Baiovaren könnten jedoch eine gemeinsame Lösung besitzen, wenn wir eine mehrstufige Ethnogenese voraussetzen, wie sie etwa für die völkerwanderungszeitlichen Vandalen, Sachsen und andere Grup-pen angenommen wird8. Als indirektes Argument hierfür könnte der oben erwähnte westgermanische Charakter des Altbairischen mit seinen beson-ders engen Beziehungen zum Alemannischen und Thüringischen angeführt werden. Demzufolge entwickelte sich die baiovarische Identität nicht erst unter fränkischer Herrschaft, sondern entstand bereits früher, und zwar in jenem Kontext, der aus archäologischer Perspektive während der römischen Epoche und der Völkerwanderungszeit den so genannten elbgermanischen Kulturraum bildet.
In diesem Sinne behandeln die folgenden Überlegungen die Kontakte zwischen Baiern und Böhmen und den weiteren elbgermanischen Gebieten während der Spätantike und der Völkerwanderungszeit.
Kontakte zwischen Nordböhmen und Süddeutschland während der spätrömischen Stufen C3/D1
Im Zusammenhang dieser Fragestellung haben die Belege handgemachter Keramik und anderer Objekte im provinzialrömischen Friedhof von Neuburg an der Donau9 sehr große Bedeutung (Abb. 1). Andere Beispiele ähnlicher elbgermanischer Funde aus der spätrömischen Periode stammen aus dem Grenzkastell von Abusina/Eining10. Dazu zählt die typische handgemachte elbgermanische Feinkeramik sowie Grobkeramik mit Fingereindrücken und einfachen Riefen – Funde, die im Böhmischen Becken nicht ungewöhnlich sind. Besonders wichtig sind Exemplare der typischen Keramik mit Oval-facetten, die zum so genannten Typ Friedenhain-Přešťovice gehören. Gleich-falls elbgermanischer Herkunft sind eine Anzahl von Fibeln Almgren Klasse VI, Nr. 174–176, bronzene Beschläge mit Vergleichen im reichen Grab von Scheßlitz oder Kämme mit dreieckiger Griffplatte der Gruppe II nach Thomas (Abb. 2).
Diese Beispiele zeigen die wechselseitige Beeinflussung von provinzial-römischer und elbgermanischer Welt in der zweiten Hälfte des 4. Jahr-
ed. mommsen 114 f. verwiesen, die die Ereignisse im nordpontischen Raum nach der Ankunft der Hunnen im späten 4. Jahrhundert schildert. Ähnlich arbeitete beispielsweise auch Paulus Diaco-nus, Historia Langobardorum I, 19, ed. Georg Waitz 56 f., als er das Gebiet Noricums während des späten 5. Jahrhunderts beschrieb.
8 Vgl. z. B. Quast, Hippo Regius, 237–315.9 keller, Neuburg, 56 und 64; Taf. 2.5-6 und 6.2-3. – Für weitere Informationen zum Ausse-
hen und der Herstellungsweise der elbgermanischen Keramikgefäße während der späten Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit siehe etwa heGeWisch, Plänitz.
10 GschWinD, Eining, 91–135.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2361 361 22.06.2012 17:19:49
362
hunderts – inklusive (oder vielleicht besonders?) des Böhmischen Beckens. Eine wichtige Frage betrifft das chronologische Verhältnis eines möglichen gleichzeitigen Aufkommens allgemein elbgermanischer Funde und der typi-schen Formen der so genannten Friedenhain-Přešťovice-Keramik: Bedingt beides sich gegenseitig oder liegt hier lediglich ein chronologischer Zusam-menhang vor?
jaroslaV jI r ÍK
Abb.1:BeispieleelbgermanischerFlaschenderKlassenA-DundihreVerbreitung,elbgermani-
benediktbeuern_innenteil_22_06_2362 362 22.06.2012 17:19:51
363
Andere Kontakte zwischen Böhmen und Süddeutschland während der Stu-fe C3 können in der Alamannia aufgespürt werden. Typologische Untersu-chungen der Siedlungen und der Grabkeramik aus der frühalemannischen Periode während des 4. Jahrhunderts zeigen die Kontakte der germanischen Siedler in Südwestdeutschland deutlich auf.
Die betreffenden Typen besitzen Analogien allgemein im elbgermanischen Kulturraum, der sich vom südwestlichen Mecklenburg bis ins Böhmische Be-
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
schesInventardesGrabs10vonNeuburganderDonau(nachkeller,Neuburg,Abb.3).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2363 363 22.06.2012 17:19:53
364
cken erstreckt und im Gebiet nördlich des Harzes und des Thüringer Walds besonders ausgeprägt ist11.
Die Funde von Fibeln, Halsringen und Keramik sind eindeutig geeignet, den Ursprung mancher Siedlungen in der Alamannia noch im fortgeschritte-nen 4. Jahrhundert anzusetzen. Entsprechend der allgemein vorausgesetzten Herleitung von Teilen der materiellen Kultur von elbgermanischen Vorbil-dern ist es nicht überraschend, dass etwa eine Fibel von der spätrömischen Höhenstation auf dem Geißkopf ihre besten Parallelen in einem Grab in Žizelice in Nordwestböhmen besitzt. Diese Befunde verdeutlichen die fort-dauernden Kontakte zwischen den elbgermanischen Gebieten und der Ala-mannia während der ganzen spätrömischen Epoche12.
Ein weiteres charakteristisches Merkmal, das im gesamten elbgerma-nischen Raum seit der Periode C2–C3 auftritt, sind die Fibeln der Klasse VI nach Almgren13. Für das Böhmische Becken stellte Eduard Droberjar die letzte Kartierung zusammen14. Neufunde aus Siedlungen der Stufen C3 und C3/D1 in Prag-Hloubětín und Prag-Dejvice, Podbaba, Grubenhaus 1, zeigen die intensive Verbreitung dieses Fibeltyps auch im Böhmischen Becken – die Konzentration in diesem Raum ist numerisch vergleichbar mit den Verbrei-tungsschwerpunkten in Mittel- und Südwestdeutschland.
Um die Enddatierung dieser Fibelklasse zu ermitteln, sind die Silberfibel des Typs A VI,2 175 aus Dienstedt mit sorgfältiger Verzierung und die we-niger prunkvolle Fibel aus Körner derselben Serie wichtig. Beide Stücke sind jeweils mit einer Fibel des Typs Wiesbaden aus dem Anfang des 5. Jahrhun-dert vergesellschaftet15. Neben weiteren Indizien belegen diese Fibeln laut ih-rem charakteristischen Auftreten an der Unterelbe, in Mitteldeutschland, im
11 schach-DörGes, Zusammengespülte und vermengte Menschen, 84 f. und Abb. 65. 12 hoeper – steuer, Geißkopf, 197.13 voss, Quellen 143 Abb. 10.14 DroberJar, Některé Problémy, 133 f., Abb. 1. 15 Werner, Gaukönigshofen, 226 f., 234, Abb. 2.
jaroslaV jI r ÍK
Abb.2:Abusina-Eining:AuswahlderelbgermanischenFunde(nachgSchWinD,EiningTaf.91–135).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2364 364 22.06.2012 17:19:53
365
Böhmischen Becken und in Südwestdeutschland den heterogenen Ursprung der sich neu formierenden alemannischen Bevölkerung, zu der verschiedene elbgermanische oder allgemein germanische Gruppen beigetragen haben16. Die Beziehungen zwischen dem alemannischen Gebiet und dem Böhmischen Becken während der Spätantike zeigen sich auch an der Bearbeitung der in Nordwestböhmen gefundenen Keramik und deren Entsprechungen in Süd-westdeutschland, so z. B. in Liběšovice und Mengen sowie Besno bei Louny und Großkuchen17.
Als Hinweise auf Kontakte in entgegengesetzter Richtung – d. h. von der Alamannia bzw. Raetien und Noricum – können wir z. B. einige Münzen des gallischen Sonderreichs vom Ende des 3. Jahrhunderts nennen, die aus Cerhýnky und štítary stammen, zwei Fundorten im Bezirk Kolín in Zentral-böhmen18. Die Anwesenheit von Truppen aus dem südlichen Teil des elbger-manischen Kulturraums im Grenzgebiet des Römischen Reichs in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts verdeutlicht vielleicht der Altfund einer Fibel des Typs Peukendorf (Spiralplattenfibel) in Český Dub, Bezirk Trnava, in Nord-ostböhmen, deren Analogien an der Rhein- und Donaugrenze (Provinzen Germania I und Raetia) weit verbreitet sind. In der Germania finden wir
16 brather, Römer und Germanen, 12 f., Abb. 3. – Siehe auch steuer, Theorien zur Herkunft, 316 f.
17 Jiřík, Vybrané sídlištní situace 543; schach-DörGes, Zusammengespülte und vermengte Menschen, Abb. 65.
18 pochitonov, Nálezy, 155, Nr. 573 und No. 574.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Abb.3:Stradonice–links:AusdehnungdesehemaligenkeltischenOppidums(nachNatálieVen-cloVá[Hg.],ArcheologiepravěkýchČech.Svazek7–dobalaténská,2008,Abb.12:5);rechts:Aus-wahlderspätrömischenFunde(nachpíč,StarožitnostizeměčeskéII.,Taf.12:25,17:3,28:6).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2365 365 22.06.2012 17:19:55
366
Belege für diesen Typ als Importfund auch in Thüringen und dem mittleren Maintal, während es in dem für Rom feindlichen Umfeld der Alamannia nur spärliche Funde gibt19. Auch der Ursprung der seltenen Drehscheibenkera-mik ist möglicherweise in den Kontakten zwischen dem Böhmischen Becken und den Rheinprovinzen unter Vermittlung des Maintals zu suchen, oder, in geringerem Ausmaß, möglicherweise auch des Böhmischen Beckens mit Mit-teldeutschland. Auf Verbindungen des Maingebiets mit dem Böhmischen Be-cken in der Stufe C3 deuten die Funde spätrömischer Terra Nigra-Ware in der Siedlung von Nesuchyně bei Rakovník, dem Bestattungsplatz von Plotiště nad Labem und jüngst auch sehr wahrscheinlich in Prag-Hloubětín20 hin.
In spätrömischer Zeit ist es ferner möglich, die Besiedlung von Höhen nachzuweisen, wie die Altfunde aus dem ehemaligen keltischen Oppidum von Stradonice21 (Abb. 3) und der (frühmittelalterlichen) Höhenbefestigung
19 schulze-Dörrlamm, Germanische Spiralplattenfibeln oder romanische Bügelfibeln, 602 Abb. 3.20 DroberJar, Plaňanských, 6 Taf. 24: 8, 10, 12; huŠták – Jiřík, Osídlení, Taf. 4:5.21 píč, Starožitnosti II, Taf. 12: 25, 28:6; pochitonov, Nálezy, 164 Nr. 627.
Abb.4:StaráKouřim–links:AusdehnungderHöhensiedlungdesspäterenFrühmittelaltersmitMarkt,spätömischerBefundNr.43,1-3)FundeausdemBefund43(nachŠolle,Stará
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2366 366 22.06.2012 17:19:56
367
von Stará Kouřim, Bezirk Nymburk22, zeigen (Abb. 4). Funde spätrömischer Münzen stammen ferner von der Höhensiedlung Libušák in Prag–Libeň23. Einige Funde kamen zudem in Žatec, Bezirk Louny, zu Tage, aus einem Grab, das eine Münze Gordians III. enthielt, sowie jüngst auch aus einem Gruben-haus24 (Abb. 5). Die Struktur dieser Fundplätze ist jedoch aufgrund des ge-ringen Kenntnisstandes noch unklar. Vielleicht besaßen sie einen ähnlichen Charakter wie die Siedlungen in den westlich benachbarten Gebieten in der Alamannia und dem Maingebiet – dafür könnten die vereinzelten spätrö-mischen Importfunde von diesen Fundplätzen sprechen, wie die Armbrust-fibeln und Zwiebelknopffibeln, die aus Stradonice, Stará Kouřim und viel-leicht Žatec25 bekannt sind, sowie die oben erwähnten Münzen (Stradonice,
22 Šolle, Stará Kouřim, 56–58, Abb. S. 157; pochitonov, Nálezy, 164 Nr. 628; DroberJar, Mladší doba římská Abb. 81:7.
23 pochitonov, Nálezy, 176, Nr. 694. – Vgl. auch DroberJar, Praha germánská, 831.24 pochitonov, Nálezy, 146 Nr. 530; Jiřík, Vybrané sídlištní situace, 545. 25 sakař, Spony, 430 f.; Abb. 1; 2/1-6.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Kouřim,Abb.5u.7),4)RömischeZwiebelknopffibel(nachSakař,Spony,Abb.2:4).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2367 367 22.06.2012 17:19:57
36�
Prag-Liběň, Žatec und Stará Kouřim). Die künftigen Erkenntnismöglichkeiten für die böhmischen Fundplätze werden jedoch eingeschränkt durch jüngere Störungen durch mittelalterliche Siedlungen (Stará Kouřim und Žatec) oder durch die frühen Ausgrabungen des 19. Jahrhunderts (Stradonice).
Auf der Höhensiedlung von Stará Kouřim wurde der Phosphatgehalt des Bodens untersucht, ähnlich wie bei den Analysen in der alemannischen Hö-henstation auf dem Geißkopf26. Die gemessenen Konzentrationen auf der Bergkuppe erbrachten jedoch keinen eindeutig interpretierbaren Befund. Verantwortlich hierfür ist die Vielphasigkeit des Fundplatzes, in dem Fund-material des Endneolithikums, der späten Bronzezeit und des Frühmittelal-ters vorherrscht27.
Die archäologische Forschung konnte die regional unterschiedlichen Datie-rungen der spätrömischen und völkerwanderungszeitlichen Höhensiedlungen deutlich herausarbeiten. Die ältesten Beispiele stammen aus Südwestdeutsch-land, wahrscheinlich schon aus dem 4. Jahrhundert; die Höhensiedlungen im nordöstlichen Österreich können in die Stufe D datiert werden. Ihre Funktion ist darin zu sehen, dass sie ein Gegengewicht zu den römischen Befestigungen
26 hoeper – steuer, Geißkopf 203–209 und Abb. 13.27 Šolle, Stará Kouřim, 27–32.
Abb.5:Žatec–links:DerFundortdeshalbeingetieftenGrubenhauses,rechts:1-5)DieKeramik,6)RömischeZwiebelknopffibel(nachJiřík,Vybranésídlištní,Abb.9-11u.23:9-14;Sakař,Spony,Abb.2:1).
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2368 368 22.06.2012 17:19:58
36�
am Rhein- und Donaulimes bildeten. Die Höhensiedlungen im Inneren des Barbaricums dienten vielleicht als Residenzen lokaler Eliten oder als stra-tegisch wichtige Punkte in Zeiten der Unruhe und Gewalt: Zu nennen sind das obere Maintal, die (nord-)karpatische Gruppe, u. U. auch die böhmischen Fundplätze der spätrömischen Zeit und auch der späteren Vinařice-Gruppe28.
Böhmen ist in diesem Zusammenhang einerseits interessant als Tran-sitregion für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die sich am großen Rheinübergang 406/407 beteiligten, besonders wenn wir die Angaben des Hieronymus berücksichtigen, dem zufolge die zentraleuropäischen Sueben, Vandalen und andere Gruppen in die gallischen Provinzen abwanderten29.
Die Völkerwanderungszeit ist darüber hinaus bemerkenswert wegen der großen, durch ethnische Gewalt ausgelösten Bevölkerungsverschiebungen wie z. B. die Kriegszüge der Hunnen, die aus dem Raum nördlich des Schwarzen Meers in den frühen 370er Jahren vorstießen und später in den mittleren Do-nauraum wanderten. Solche Bewegungen bewirkten eine Reihe einander an-stoßender Ereignisse, die zur Wanderung der Alanen, Sueben und Vandalen 406/407 nach Gallien und später dann auf die Iberische Halbinsel führten.
An vielen Fundorten in Böhmen ist es vielleicht möglich, abschließende Fundhorizonte aus der Phase D1 herauszuarbeiten: Jenišův Ujezd, Liběšovice, Trmice, Dobroměřice, Prag-Dolní Chabry, Prag-Čimice, Prag-Hloubětín und wahrscheinlich auch Prag-Kbely, wo die Besiedlung in der folgenden Phase D2 offenbar abbricht30 (Abb. 6). Dieser Befund wird jedoch stark beeinflusst von unserem generell geringen Kenntnis- bzw. Forschungsstand, der oft nur einen Teil der ursprünglichen Siedlung umfasst.
In Prag-Dejvice, sladovny Podbaba, war es vermutlich möglich, den ab-schließenden Horizont der Stufe D1 zu beobachten. Im Fall der Siedlungs-struktur im Raum von Prag-Dejvice/Bubeneč kann dagegen sicher beobachtet werden, dass die Landschaft in den Zeitphasen D2, D3 und E weiter besie-delt war. Darüber hinaus zeigen Fundplätze wie Prag-Ruzyně das Fortleben von Traditionen aus spätrömischer Zeit. Besonders deutlich ist dies anhand der Keramikproduktion zu erkennen, sogar an verschiedenen Fundplätzen in Zentralböhmen31. Funde von Keramik des so genannten Typs Friedenhain-Přešťovice am westlichen Rand von Prag verdeutlichen wohl ebenfalls die heterogene Bevölkerung im Böhmischen Becken.
In Böhmen kann während der Zeitstufe D1 innerhalb des Fundspektrums eine Anzahl von Gräbern mit osteuropäischen Einflüssen beobachtet werden:
28 hoeper – steuer, Geißkopf, 185–246; stuppner, Oberleiserberg, 202–205; pieta, Anfänge, 171–189; maDyDa-leGutko – tunia, Beskid Mts, 227–248; haberstroh, Reisberg.
29 steinacher, Heruls, 330.30 Jiřík, Vybrané sídlištní situace, 543–545; Jiřík – kostka, Dolních Chabrech; huŠták – Jiřík,
Osídlení; reszczyńska, New Materials; procházka, Praze – Čimicích; beneŠ, Dobroměřice. 31 kuchařík u. a., Nové poznatky, 341–372
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2369 369 22.06.2012 17:19:58
370
Beroun-Závodí (Abb. 7), das ein gemischtes Inventar mit elbgermanischen und östlichen Artefakten darstellt32, sowie das Kriegergrab von Vliněves33 und die Siedlungsbestattung von Trmice34, die beide mit Kämmen der Klasse III nach Thomas ausgestattet waren. Spuren solcher Veränderungen kön-nen teilweise auch innerhalb des Fundspektrums der Siedlungen beobachtet werden. An dem oben erwähnten Fundplatz Prag-Dejvice Podbaba finden sich Belege für kulturelle Einflüsse aus dem Bereich der Przeworsk-Kultur in Form typischer Vorratsgefäße (Kraussengefäße)35 (Abb. 6, unten).
Die Vinařice-Gruppe und die Kontakte mit dem Main-Gebiet
Die Entstehung und Entwicklung der Vinařice-Gruppe in Nordböhmen zu Beginn des 5. Jahrhunderts wurde bereits an anderer Stelle behandelt. In diesem Zusammenhang hat man erstmals die Beziehungen zum mittleren
32 DroberJar, Mladší doby římská, 12733 Die Publikation des Grabes wird gegenwärtig von Petr Limburský und Jaroslav Jiřík vor-
bereitet. 34 reszczyńska, New materials, Abb. 1.35 Jiřík – kuchařík, Praze-Dejvicích.
Abb.6:KeramikensemblederStufeD1inZentralböhmen:JenišůvÚjezdundLiběšovice(nachJiřík,Vybrané sídlištní,Abb.17-22),Prag-Kbely (Zeichnung: JaroslavJiřík);Prag-Dejvice, sladovnyPodbaba(nachJaroslavJiřík–Milankuchařík,Sídlištězkoncedobyřímské,inVorbereitung).
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2370 370 22.06.2012 17:19:59
371
Donauraum und besonders zur so genannten Föderatenkultur herausgear-beitet36.
Zur Beurteilung der Entwicklung Böhmens im 5. Jahrhundert und der Beziehungen zu den westlich angrenzenden Regionen sind die Belege für Kontakte zwischen dem Böhmischen Becken und dem unteren Maintal wäh-rend der Zeitphase D2b (D2/D3) des 5. Jahrhunderts von größter Bedeutung (Abb. 9, rechts).
Die Analyse des Bestattungsplatzes von Eschborn im hessischen Unter-maingebiet hat klar gezeigt, dass hier in der frühesten Belegungsphase wahr-scheinlich zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen bestattet wurden. Die Keramik und die Fibeln der ersten Gruppe mit den zentralen Gräbern 27, 29 und 43 zeigen, dass die westliche Gruppe ihre Wurzeln im Böhmischen Becken haben könnte, während die zweite Gruppe keine vergleichbaren Be-ziehungen aufweist. Ähnliche Kontakte zu Böhmen sind bei der ältesten Phase des Friedhofs von Pleidelsheim zu beobachten37. Auch das Grab 231 des Friedhofs von Wenigumstadt, das noch in die Phase SD 1 nach Koch datiert, ist mit Fibeln des Typs Niederflorstadt-Wiesloch ausgestattet, die ein Charakteristikum der Vinařice-Gruppe darstellen. Das Grab 115 desselben Gräberfelds enthielt einen Kamm mit halbrundem Griff des Typs Thomas III,
36 teJral, Vinařice Kulturgruppe; Jiřík, Bohemian Barbarians, 277–288.37 Quast, Vom Einzelgrab zum Friedhof, 175.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Abb.7:1)VerbreitungderspätrömischenBrand-undKörpergräberinBöhmen,2)KriegergrabausBeroun–Závodí(nachEduardDroberJar,EncyklopedieřímskéagermánskéarcheologievČecháchanaMoravě,2002,Abb.S.17;EduardDroberJar,NeueErkenntnissezudenFürstgräbernderGruppeHassleben-Leuna-GommerninBöhmen,in:Přehledvýzkumů48[2007]93–103,Abb.1).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2371 371 22.06.2012 17:20:00
372
der wahrscheinlich von ostgermanischen Prototypen abzuleiten ist, aber im Böhmischen Becken während des 5. Jahrhunderts häufig vorkommt38.
Die regionale Bedeutung der „Vinařice-Bevölkerungsgruppe“, die in Esch-born bestattete, wird zudem durch den Fund einer Perlenkette in Grab 16 unterstützt, die aus 16 runden Perlen „ägyptischer“ Formtradition aus opa-kem Glas mit hellen gesprenkelten Auflagen besteht. Eine identische Kette ist aus dem alemannischen Friedhof von Hemmingen aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts bekannt, die meisten Analogien stammen jedoch aus dem Donauraum, z. B. Smolín, Schletz, Viminacium, Grab 28, und darüber hinaus bis in das nördliche Kaukasusgebiet (z. B. Mokraja Balka, Klin-Jar, Korsun, Lermontovskaja Skala, Grab 2). Diese Perlenketten sind frühbyzantinischer Herkunft und setzen syrische Werkstatttraditionen fort39.
Darüber hinaus belegt eine breite Vielfalt von Keramikformen die Bezie-hungen zwischen Nordböhmen und dem Untermaingebiet. Dies zeigen etwa die Funde mehrerer sich jeweils entsprechender Grabinventare: Pchery u Slaného
38 stauch, Wenigumstadt, Taf. 90, 155. 39 kazanski – mastykova, Machtzentren, 174–180.
Abb.8:InterregionaleKontaktezwischenBöhmenunddemUntermaingebietwährendderStufenD2,D2-D3anhandderKeramikfunde:1)Vinařice,2)PlotištěnadLabem,3)Vinařice,KahlamMain,4)PcheryuSlaného,5)BadHomburg,6)KahlamMain,7)Eschborn,8)KahlamMain(nachSVoboDa,Čechyvdobě,Taf.75:1,24:15und25:5;AlenaryboVá,PlotištěnadLabem.EineNekropoleausdem2.-5.Jahrhundertu.Z.,1.Teil,in:Památkyarcheologické70[1979]353–489,Abb.71:4;teichner,KahlamMain,Taf.56u.60:16u.56;SteiDl,Wetterau,Taf.5:17;Her-manament,DasalamannischeGräberfeldvonEschborn[Main-Taunus-Kreis],1992,Taf.10:2).
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2372 372 22.06.2012 17:20:01
373
– Kahl am Main, Grab 219, sowie Kahl am Main, „Lange Hecke“40; Vinařice – Bad Homburg-Gonzenheim, Grab 941 (Abb. 8). Eine interregionale Verbreitung zeigen besonders die Schüsseln mit Zackenkranz. Die Funde später Argonnen-sigillata und afrikanischer Sigillata im Untermaingebiet und in Nordböhmen42 sowie Gefäße aus rheinischen Werkstätten verdeutlichen wohl den Handels-weg, auf dem die Stücke aus dem Westen nach Böhmen gelangten. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Gräber 217 und 218 von Kahl am Main, im ersten Fall durch die Kombination einer Argonnensigillata mit einem goldenen Anhänger des Typs Úherce, der sehr charakteristisch für die böhmischen Fundplätze ist, und im zweiten Fall die Kombination einer Schale mit Schrägkanneluren, afrikanischer Feinkeramik (African Red Slip Ware) und einer Riemenzunge „ostgermanischer“ Herkunft43.
Im Zuge der Bearbeitung des Friedhofs von Gültlingen beobachtete Dieter Quast ebenfalls überregionale Bezüge. Innerhalb des so genannten Childe-rich-Horizontes – auch Horizont Flonheim-Gültlingen genannt – herrschen generell Grabausstattungen mit östlich-donauländischen Merkmalen vor. Im Gegensatz dazu dominieren seit dem Beginn des darauf folgenden so ge-nannten Chlodwig-Horizontes Grabbeigaben mit westlich-fränkischen Bezü-gen. Auf dem Bestattungsplatz Gültlingen/Buchen konnten ferner Einflüsse aus dem Böhmischen Becken und Thüringen beobachtet werden: Keramik mit Ovalfacetten, kosmetische Geräte mit einer Analogie aus dem Grab von Měcholupy in Nordwestböhmen aus der Mitte des 5. Jahrhunderts, Fibeln des Typs Heilbronn-Böckingen, gemeinsam mit Importstücken aus dem Mit-telmeerraum, z. B. das Grab von 1901, das noch dem Horizont Apahida-Tournai-Rüdern angehört – es enthielt unter anderem einen Helm des Typs Baldenheim, eine Bergkristallschnalle byzantinischer Provenienz und eine Goldgriffspatha44
Eine zentrale Forschungsaufgabe stellen die Siedlungsstrukturen dar und be-sonders die Frage nach Plätzen mit zentralörtlicher Funktion, seien sie nun von regionaler oder überregionaler Bedeutung. Dabei ist es wichtig, deren Rolle als handwerkliche Produktionszentren zu berücksichtigen sowie das Entstehen eines überregional wirksamen Austauschnetzwerks. In Mitteleu-ropa haben wir hierfür jedoch bislang keine klaren Anhaltspunkte. Analo-gien aus Südskandinavien, insbesondere Fundplätze wie Bäckby und Helgö, informieren uns trotz der geographischen Distanz über die Modalitäten der
40 svoboDa, Čechy v době, Taf. 75:1; teichner, Kahl am Main Abb. 13:4, Taf. 60:16. 41 svoboDa, Čechy v době, Taf. 24:15, 17; steiDl, Wetterau Taf. 5:17. 42 teichner, Kahl am Main, 90–92, Taf. 10:2, 21:23-27, 51:5-6, 56:13, 56:26, 63:12; steiDl,
Wetterrau, Taf. 5:16, 6:11, 51:15-16, 54:2, 55:4; motyková – DrDa – rybová, Imports, 56–63.43 teichner, Kahl am Main, Taf. 56.44 Quast, Gültlingen, 82–84, 100, 104.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2373 373 22.06.2012 17:20:01
374
Produktion von Luxusgütern und die reziproken Beziehungen von Siedlun-gen unterschiedlicher hierarchischer Positionen45.
In Böhmen muss besonders in der zentralen Region um das heutige Prag mit einer solchen Siedlung gerechnet werden, vor allem wenn man die Funde von Edelmetallschmuck berücksichtigt, die von verschiedenen Bestattungs-plätzen stammen (Fibeln der Typen Niederflorstadt-Wiesloch und Groß-Um-stadt, goldene Fibeln des Typs Zličín, Anhänger des Typs Úherce etc.)46, für die eine lokale Herstellung in Zentralböhmen angenommen werden kann – all dies deutet darauf hin, dass zentrale Plätze existierten, in denen Edel-metall verarbeitet und kostbarer Schmuck hergestellt wurde.
In diesem Zusammenhang ist die Verbreitung der Anhänger des Typs Úherce von besonderem Interesse. Diese treten einerseits in Böhmen auf, in Prag-Zličín, Prag-Podbaba, Juliska und Prag-Holešovice, Úherce. Anderer-
45 hJärthner-holDar – lamm – maGnus, Metalworking and Central Places. 46 vávra u. a., Pohřebiště, Abb. 11, 16.
Abb.9:VerbreitungderGoldblechanhänger(nachteichner,KahlamMain,Taf.72);VerbreitungderVinařice-FundeaußerhalbBöhmens(nachHorstW.böhme,ZurBedeutungdesspätrömischen
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2374 374 22.06.2012 17:20:06
375
seits gibt es auch vereinzelte Entsprechungen auf dem Oberleiserberg, am Runden Berg bei Urach, auf der Gelben Bürg bei Dittenheim, in Lezoux in Zentralfrankreich, im Frauengrab 43 von Eschborn und in einem Grab in Kahl am Main47. (Abb. 9, links).
Ein Platz mit zentralörtlicher Funktion befand sich in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts auf der ‚Akropolis‘ und in der Nähe des Tors D des ehe-maligen keltischen Oppidums von Závist. Hier legte man eine Reihe eben-erdiger Gebäude sowie Grubenhäuser frei, die an eine hofartige Anordnung denken lassen48. Die Siedlung von Závist ist nicht notwendigerweise der ein-zige bekannte Fundplatz dieser Art in der Region. Streufunde sind ebenfalls bekannt von der zeitgleichen Siedlung von Prag-Kobylisy (zwei halb ein-getiefte Hütten, die laut Datierung und Lage zu dem seit langem bekannten
47 svoboDa, Čechy v době, Taf. 42:2-3; teichner, Kahl am Main, 225 und Taf. 72; stuppner, Amulette, 381 f.
48 Jansová, Hradiště, 135–176; motyková – DrDa – rybová, Závist, 182 mit Abb. 52.2.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
MilitärdienstesfürdieStammesbildungderBajuwaren,in:Walterbachran–HermannDannhei-mer,DieBajuwaren.VonSeverinbisTassilo488–788,1988,23–37,fig.10).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2375 375 22.06.2012 17:20:09
376
Friedhof des 5. Jahrhunderts gehören)49 und möglicherweise auch aus den Siedlungen von Prag-Petřín und dem oben genannten Žatec (wahrscheinlich ein halb eingetieftes Grubenhaus, das entweder in spätrömische Zeit oder in die frühe Völkerwanderungszeit datiert)50.
Das Aushängeschild der völkerwanderungszeitlichen Feldforschung in Böhmen ist zur Zeit zweifellos die Ausgrabung des Friedhofs von Prag-Zličín, die von Milan Kuchařík und Jiři Vávra vom Stadtmuseum Prag und in der Folge von der Grabungsfirma Labrys o.p.s in den Jahren 2005 bis 2008 durchgeführt wurde. Diese Ausgrabung hat allmählich unseren gesamten archäologischen Kenntnisstand erweitert, nicht nur hinsichtlich der Ausdeh-nung von Gräberfeldern dieser Zeitstellung, sondern auch über ihre Struktur, Belegungsdauer und Typen des Grabbaus. Unter Einsatz neuester Dokumen-tationsgeräte und Grabungstechnik wurden mehr als 177 Gräber aus dem 5. Jahrhundert freigelegt. Die Veröffentlichung des Friedhofs wird gegenwärtig durch ein international kooperierendes Team vorbereitet51.
Anhand zahlreicher Beispiele ist es nun möglich, weitergehende Schlüsse bezüglich der Bestattungen der gesamten Vinařice-Gruppe zu ziehen. Die detaillierte Analyse des Fibelspektrums sowie der Schnallenformen zeigt eindeutig, dass viele Friedhöfe dieser Gruppe später enden als bislang an-genommen (Vinařice, Lužec nad Vltavou, Prag-Zličín, Prag-Kobylisy, mög-licherweise Zbuzany etc. – Tabelle 1). Aus diesem Grund können wir nicht nur die chronologischen Verbindungen ins Untermaingebiet während der Stufe D2b besser herausarbeiten, sondern ebenfalls diejenigen nach Baiern während der Stufe E1 (Tabelle 1).
Das Gebiet Süd- und Westböhmens und das Problem der Gruppe Friedenhain-Přešťovice
Die Entwicklung Südböhmens hängt einerseits natürlich mit der bereits be-handelten Situation im nördlichen Landesteil zusammen, darüber hinaus aber auch mit kulturellen Veränderungen und historischen Ereignissen im mittleren Donaugebiet, d. h. dem südlichen Mähren und der südwestlichen Slowakei.
Mit der Entwicklung des mittleren Donaugebiets in römischer Zeit hat sich zuletzt Jaroslav Tejral auseinandergesetzt. Seine wichtigen Arbeiten konzentrieren sich auf die drei wichtigen abschließenden Fundhorizonte, die historischen Ereignissen entsprechen. Die Phase B2/B2–C1 entspricht der Periode der Markomannenkriege, die Phase C1 verbindet er mit Wande-
49 svoboDa, Čechy v době, Taf. 27, 26:3, 5, 10-11, 13. – Frolík u. a., Sídliště vinařické. 50 DroberJar, Praha germánská, 833, 839, Abb. S. 792:1-2; Jiřík, Vybrané sídlištní situace, 545. 51 vávra u. a., Pohřebiště, 565–577; Jiřík – vávra, Druhá etapa, 241–254; vávra u. a.,Výzkum
pohřebiště, 209–230.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2376 376 22.06.2012 17:20:09
377böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Tabelle1:ChronologischerVergleichderFundeinderAlamannia,BaiernundderVinařice-Grup-peinBöhmen:1-3)Prag-Zličín(FotoMartinUrbánekundJaroslavJiřík), 4-5)Prag-Kobylisy,6-8)Vinařice(allenachSVoboDa,Čechyvdobě,Taf.27:2,6,24:1,4,7-8,10),9-10)LužecnadVltavou(nachRastislavkorený–OlgakytlicoVá,DvěpohřebištězdobystehovánínároduvLužcinadVltavou,okr.Melník,in:ArcheologievestredníchCechách11[2007]387–444,Abb.12u.7),11) KahlamMain(nachteichner,KahlamMain,Taf.45:1),12)Stehelčeves(nachBedřichSVoboDa,DvahrobyzdobystěhovánínárodůveStehelčevsiuSlaného,in:Památkyarcheologické66[1975]133–151,Abb.3:5-10),13)Mochov(nachSVoboDa,Čechyvdobě,Taf.70:10),14)Wenigumstadt(nachJochenhaberStroh,ZeitendesUmbruchs–dieVölkerwanderungszeit,in:C.SebastianSommer[Hg.],ArchäologieinBayern.FensterzurVergangenheit,2006,240–243,Abb.32),15)Böhmen(nachSVoboDa,Čechyvdobě,Taf.19:8),16)Pliening(nachcoDreanu-WinDau-er,Pliening,Taf.19:2),17)Eschborn(nachHermanament,DasalamannischeGräberfeldvonEschborn[Main-Taunus-Kreis],1992,Taf.4:2),18)HorníKšely(nachSVoboDa,Čechyvdobě,Taf.19:7),19)Regensburg-Burgweinting(nachSilviacoDreanu-WinDauer–RamonaSchleuDer,DiefünftefrühmittelalterlicheNekropolevonBurgweinting,in:DasArchäologischeJahrinBay-ern2008[2009]104f.,Abb.150),20)Niederflorstadt(nachJaroslavteJral,NeueAspektederfrühvölkerwanderungszeitlichenChronologie imMitteldonauraum, in: JaroslavteJral –HerwigFrieSinger–MichelkazanSki [Hg.],NeueBeiträgezurErforschungderSpätantike immittlerenDonauraum,1997, 321–392,Abb. 28:2),21) Bräunlingen (nach:AlfriedWieczorek –Patrickpérin [Hg.], DasGoldderBarbarenfürsten,SchätzeausPrunkgräberndes5.Jahrhundertsn.Chr.zwischenKaukasusundGallien,2001,61,170f.u.Abb.4.15.2.1),22)München-Perlach(nachStephaniezintl,DasfrühmerowingischeGräberfeldvonMünchen-Perlach,in:BerichtderBayeri-schenBodendenkmalpflege45/46[2004/05]281–370,Abb.11:2.3),23)Monsheim(nachteJral,NeueAspekte,Abb.28:3)24)Basel-Kleinhüningen(nachUlrikegieSler-müller,Dasfrühmittelal-terlicheGräberfeldvonBasel-Kleinhüningen,1992,Taf.4:30.2),25)Unterhaching(nachLudwigWamSer [Hg.],KarfunkelsteinundSeide.NeueSchätzeausBayernsFrühzeit,2010,Abb.34a).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2377 377 22.06.2012 17:20:14
37�
rungsbewegungen in verschiedenen Teilen des Barbaricums in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts, die Phase C3–D1/D1 entspricht schließlich den so genannten spätsuebischen Siedlungen des Zlechov-Horizontes, der in das frühe 5. Jahrhundert datiert und der teilweise mit der Wanderungswelle im Vorfeld des Rheinübergangs 406/07 verbunden werden kann. Dieses Modell schlug Tejral ursprünglich begrenzt für eine bestimmte Region vor. In den letzten Jahren hat er es auf der Basis der Publikationen zu neuen Siedlungen im mittleren Donauraum weiterentwickelt, verfeinert und abgewandelt.
Diese neuen Grabungsergebnisse erbrachten neue Gesichtspunkte zu einem abschließenden Fundhorizont in Mähren und der südwestlichen Slo-wakei, der bis in die spätrömischen Phasen C2–C3 zurückreicht und für den das vollkommene Fehlen von Terra Sigillata-Funden charakteristisch ist. Die-se endet in der Mitte des 4. Jahrhunderts und tritt niemals zusammen mit scheibengedrehter suebischer Keramik auf. Ein ähnliches Bild zeigten die Siedlungsgrabungen in Branč in der südwestlichen Slowakei, wo scheiben-gedrehte Keramik lokaler barbarischer Herstellung zusammen mit provinzi-alrömischen Importfunden einschließlich glasierter Keramik vorkommt; hier bildet eine Münze des Claudius II. Gothicus den allgemeinen terminus post quem. Im Fall der Siedlung von Nová Ves, Befund 3/1996, wird die Nut-zungszeit der Siedlung vielleicht durch drei Münzen des Septimius Severus, Claudius II. Gothicus und Diocletian markiert. Die chronologische Stellung dieses neu definierten Siedlungshorizontes ist gegenwärtig noch nicht ganz geklärt. Es ist möglich, dass diese Phase um das Jahr 400 endet52.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verbindung dieses spätrömischen Fund-horizontes mit kriegerischen Aktivitäten des quadischen Königs Araharius in den Jahren 357/5853. Möglich wäre aber auch ein Zusammenhang mit einer Strafexpedition Kaiser Valentinians gegen die Quaden im Jahr 37554.
In Südböhmen können einerseits die Auswirkungen dieser Ereignisse in Form der so genannten Gruppe Friedenhain-Přešťovice beobachtet werden, die wahrscheinlich in einen elbgermanischen Kontext einzuordnen ist. Da-bei ist sie zweifellos von neu angekommenen Migranten von der mittleren Donau beeinflusst. Dies zeigt sich bei den Siedlungen an den Formen schei-bengedrehter Keramik und anderer Funde, die unmittelbar darauf hindeuten, dass kurz zuvor neue Ansiedler aus dem Osten angekommen sind55.Wichtige Befunde in diesem Zusammenhang sind die Siedlungen von Sedlec (Abb.
52 teJral, Ke zvláštnostem, 68, 92 f. 53 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, XVII, 12.2-26, ed. Wolfgang seyFarth Bd. 1,
239–243.54 Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, XXX 5.13-14, ed. Wolfgang seyFarth Bd. 4,
223.55 zavřel, Der gegenwärtigen Forschungsstand, 260–264, Abb. 1-6; teJral, Die spätantiken
militärischen Eliten, 243, Abb. 32.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2378 378 22.06.2012 17:20:14
37�
10:1-5) und Zliv (Abb. 10:6-9), die beide im Bezirk České Budějovice liegen. In beiden Siedlungen fand sich scheibengedrehte Keramik der so genannten Jiříkovice-Tradition56 des so genannten Zlechov-D1-Horizonts, obwohl auch andere scheibengedrehte Keramik der Stufe C3 mit Verbindungen zum mitt-leren Donauraum vertreten ist57. Abgesehen von der ovalfacettierten Keramik des so genannten Typs Friedenhain-Přešťovice zeigt sich im Fundspektrum der Siedlung von Zliv jedoch nicht nur die scheibengedrehte Keramik, sondern auch handaufgebaute Gebrauchskeramik, besonders Gefäße mit groben gezo-genen Ecken, die mit tiefen Fingereindrücken oder Riefen verziert sind, und die Funden aus den Siedlungen in der Südwestslowakei der Stufe C2–C3 ent-sprechen: Bratislava-Trnávka, Zadné, Bratislava-Vajnory und Veľký Meder58. Das publizierte Inventar des halb eingetieften Grubenhauses 16/17 in Sedlec erbrachte ebenfalls ein scheibengedrehtes Vorratsgefäß mit einfachen horizon-talen Wellenlinien. Dieses besitzt enge Parallelen in der Siedlung von Bratisla-va-Dúbravka, Befund 126/92, und datiert wahrscheinlich ebenfalls in die Stufe C359. Ein weiterer wichtiger Importfund aus dem mittleren Donauraum ist die eingliedrige Fibel mit spitz auslaufendem Fuß, die ebenfalls aus dem Befund 16/17 in Sedlec stammt60, und deren Parallelen in die jüngste Phase, C3, der Siedlung von Branč in der südwestlichen Slowakei datieren61 (Abb. 11).
Die Funde und Befunde verdeutlichen den Beginn des Einflusses aus dem mittleren Donauraum in den Siedlungen von Sedlec und Zliv während der spätrömischen Phase C3; in diesem Zusammenhang sollte man jedoch den
56 Für weitere Informationen zu diesem Typ Drehscheibenkeramik mit Wellenbanddekor sie-he teJral, Drehscheibenkeramik.
57 břicháček – braun – koŠnar, Sedlec, 128 Abb. 3; zavřel, Der gegenwärtigen Forschungs-stand, Abb. 6; zavřel, Doba římská, 84 und Abb. 12-13.
58 Zusammenfassung teJral, Ke zvláštnostem, 90 f., Abb. 16. 59 elschek, Siedlungslandschaft, Abb. 8:12; teJral, Die spätantiken militärischen Eliten, Abb.
24:14.60 koŠnar – břicháček, Erkenntnisse, Abb. 3:2. – Siehe auch zeman, Severní Morava, 288 und
Abb. 87. 61 kolník – varsik – vlaDár, Branč, 29, Abb. 13:3
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Abb.10:1-5) Sedlec,Bez.ČeskéBudějovice,6-9)Zliv,Bez.ČeskéBudějovice(nachPavelbřicháče – Peterbraun–LubomírkoŠnar,Sedlec,Abb.3;zaVřel,Dobařímská,Abb.12-13).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2379 379 22.06.2012 17:20:14
3�0
neu definierten und oben bereits erwähnten abschließenden Siedlungshori-zont in Veľký Meder, Bratislava-Trnávka, Zadné, Branč und an anderen Fundplätzen nicht vergessen62. Wenn diese Annahme zutrifft – und dieser ebenfalls eine Auswirkung der Ereignisse in Zusammenhang mit dem Feld-zug Kaiser Valentinians gegen die Sueben bzw. Quaden war –, dann könnte der Beginn des Einflusses aus dem mittleren Donauraums nach Südböh-men bis in das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts zurückdatiert werden. Diese Datierung ist möglicherweise sehr bedeutsam, um die Kontakte zwischen Quaden bzw. Sueben und der elbgermanischen Bevölkerung chronologisch einzuordnen, für die unter anderem die handgemachte Keramik mit Ovalfa-cetten charakteristisch ist, die auch in Zliv gefunden wurde.
Im Vergleich zu den benachbarten Siedlungen von Sedlec und Zliv scheint die Siedlung von Zbudov jünger zu sein. Sie ist anhand der Keramikprodukti-on aus den so genannten Jiříkovice-Werkstätten, d. h. scheibengedrehter Ke-ramik der Stufen D1 oder D2, relativ gut datiert63. Die Siedlung von Zbudov stellt deshalb einen Beleg dar für die zunehmenden Einflüsse aus dem mittle-ren Donaugebiet nach Südböhmen zu Beginn der Völkerwanderungszeit.
62 Zusammenfassend zum Fundplatz: teJral, Ke zvláštnostem, 90–92, Abb. 16.63 zavřel, Der gegenwärtige Forschungsstand, Abb. 5, 9.
Abb. 11: Funde der spätrömischen Stufen C3 in der südwestlichen Slowakei: Bratislava–Dú-bravka,Branč,Zadné,VeľkýMeder(nachkolník–VarSik–VlaDár,Branč,Abb.13;teJral,Kezvláštnostem,Abb.16;elScheck, Siedlungslandschaft,Abb.8:12).
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2380 380 22.06.2012 17:20:15
3�1
Möglicherweise deuten diese Funde mittel-donauländischen Ursprungs gemeinsam mit der Keramik des Typs Friedenhain-Přešťovice, die von ver-schiedenen Fundorten bekannt ist, auf einen heterogenen Ursprung der Be-wohner Südböhmens in spätrömischer Zeit hin, allerdings auf gemeinsamer elbgermanischer Wurzel.
Wie im Falle Südböhmens tauchen auch in Westböhmen in jüngerer Zeit neue Funde des Typs Friedenhain-Přešťovice auf. Diese Funde stammen hauptsächlich aus den Sammlungen von Milan řezač, Milan Metlička und Pavel Břicháček, die jüngst bearbeitet und zur Publikation vorbereitet wur-den. Zusätzlich zu den bislang bekannten Funden aus Pilsen-Radobyčice, Garten des Hauses Nr. 124 von 193964 (Abb. 12), gibt es eine Neuentdeckung vom selben Fundplatz (Pilsen-Radobyčice II) sowie aus Vochov65, Pilsen-Vi-nice und Nýřany, alle im Bezirk Pilsen-Süd gelegen.
Die Keramik dieses Typs tritt jedoch auch außerhalb dieses Gebiets auf, nämlich in Zentralböhmen während des 5. Jahrhunderts, wo auf den Be-stattungsplätzen das typische Material der Vinařice-Gruppe vorherrscht. Bei Ausgrabungen in den Fundplätzen Prag-Dolni Liboc I und II (Abb. 13:1-2) traten Funde zu Tage, die eindeutig den Funden der Friedenhain-Přešťovice in Süd- und Westböhmen sowie im benachbarten Baiern entsprechen. Ge-meinsam mit dem Fund einer ovalfacettierten Schale aus dem Grab 7 von
64 maličký, Předslovanská hradiště, 33 f.; svoboDa, Čechy v době, 64, 257; ŠalDová, Westböh-men, 14.
65 Mehr zum Fundplatz bei břicháček, Nové nálezy.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Abb.12:Pilsen–Radobyčice.TopographiemitLokalisierungderFundstelleundvölkerwanderungs-zeitlicheKeramikmitOvalfacetten(Zeichnung:KarelVávraundJaroslavJiřík).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2381 381 22.06.2012 17:20:16
3�2
Litovice (Abb. 13:4), Bezirk Prag-West66, und einem bislang unpublizierten ähnlichen Stück aus Prag-Zličín (Abb. 13:3) sind nun vier Fundorte dieser charakteristischen Ware am westlichen Stadtrand von Prag bekannt. Auf die enge Verbindung insbesondere bei den Keramikformen zwischen dem Fried-hof von Přešťovice und der Vinařice-Gruppe hatte bereits Bedřich Svoboda hingewiesen67.
In diesem Zusammenhang ist es darüber hinaus von besonderem Interes-se, dass in vielen Fundplätzen im Maintal und in Südwestdeutschland, bei denen Einflüsse der Vinařice-Gruppe nachgewiesen werden können, gleich-zeitig auch Keramik vorkommt, die mit der Friedenhain-Přešťovice-Gruppe verbunden wird – zum Beispiel in Kahl am Main68. Auch Dieter Quast und Max Martin beobachten in diesen Gebieten intensive Einflüsse des „elbger-manischen Formenkreises“, deren Ursprung im Böhmischen Becken liegt69. Eine Reihe von Indizien deutet darüber hinaus darauf hin, dass zwischen den beiden Gebieten der Vinařice- und der Friedenhain-Přešťovice-Gruppe nicht nur formale Beziehungen bestanden, d. h. im Sinne von Einflüssen im Bereich der materiellen Kultur, sondern möglicherweise auch eine machtpo-litische Abhängigkeit: Zu nennen sind vor allem die fortlaufenden Einflüsse
66 pleinerová, Litovice, Abb. 10; kuchařík u. a., Nové poznatky, Abb. 2. 67 svoboDa, Čechy v době, 101–103.68 teichner, Kahl am Main 111 und Taf. 5:7 und 4569 Quast, Höhensiedlungen, 277; martin, Mixti Alamannis, 218 f.
Abb.13:KeramikfundedesTypsPřešťovice-FriedenhaininZentralböhmen:1)Prag-DolníLibocII,2)Prag-DolníLibocI(beidenachkuchařík u. a.,Novépoznatky,Abb.2:1,5),3)Prag-Zličín(FotoMartinUrbánek),4) Litovice(nachpleineroVá,Litovice,Abb.10).
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2382 382 22.06.2012 17:20:20
3�3
in den Gebieten westlich der Grenzen Böhmens, das Auftreten der Keramik des Typs Friedenhain-Přešťovice innerhalb des Verbands der Vinařice-Guppe Zentralböhmens (bemerkenswerterweise in einer nur geringen räumlichen Distanz zum Eliten-Bestattungsplatz von Prag-Zličín) sowie das Fehlen von Machtzentren in Süd- und Westböhmen sowie schließlich auch bei den so genannten Friedenhain-Přešťovice-Fundplätzen in Bayern (das Kriegergrab von Kemathen70 repräsentiert nicht den höchsten sozialen Rang).
Ähnlich wie in Bayern wird auch das Auftreten von Friedenhain-Přešťo-vice-Keramik im Unteren Maintal mitunter durch eine Zuwanderung aus dem elbgermanisch geprägten Milieu Böhmens erklärt. In Verbindung mit dem Typ Friedenhain-Přešťovice sind die Funde der charakteristischen ovalfacet-tierten Gefäße in den Gräbern von Odenheim, Edingen, Gültlingen und der Siedlung von Nebringen bemerkenswert. Der Ansicht Dieter Quasts zufolge handelte es sich lediglich um eine kleine Gruppe von Neuankömmlingen, da keine Anzeichen für eine Entvölkerung des Böhmischen Beckens vorliegen, was allerdings für den südlichen Teil Böhmens im Laufe des 5. Jahrhunderts in Frage zu stellen wäre. Quast zufolge seien die Neuankömmlinge in den Dienst der römischen Armee getreten und hätten sich anschließend auf ale-mannischem Boden niedergelassen71.
Hubert Fehr weist zurecht auf die Verbreitung nahezu identischer Kera-mikformen der Friedenhain-Přešťovice-Gruppe und der ovalfacettierten Pro-duktion der Černjachov-Kultur in der Ukraine, Moldawien und Rumänien hin, wie ich dies auch an anderer Stelle getan habe72. Es bestehen jedoch signifikante Unterschiede bei der Herstellungstechnik. Die Stücke aus der Černjachov-Kultur sind scheibengedreht, während die Keramik in Böhmen und Baiern handgemacht ist. Die Stücke aus der Černjachov-Kultur datieren in die zweite Hälfte des 4. Jahrhundert, die jüngsten Stücke mit dieser Ver-zierung stammen vom Beginn des 5. Jahrhunderts73. Ein Hauptmerkmal der Keramik in Südwestböhmen und in Baiern ist jedoch die Kombination fein-keramischer Gefäße mit ovalen Facetten und Formen mit Schrägkanneluren im Stil der elbgermanischen Keramikmorphologie74. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage nach der Verbreitung und der Interpretation der so genann-ten Keramik Friedenhain-Přešťovice, die zuletzt von Hubert Fehr aufgewor-fen wurde – eine alternative Erklärung bietet noch immer die Ansicht Dieter Quasts75. Die methodische Frage der Definition einer menschlichen Iden-titätsgruppe (besonders ethnischer oder linguistischer Identitäten) anhand
70 steiDl, Zeitgenosse der Nibelungen.71 Quast, Vom Einzelgrab zum Friedhof, 175. 72 Jiřík, Entstehung, 135.73 levinschi, Gräberfeld, 23–32; schultze – strocen, Ovalfacettierte Keramik, 326 f., Abb. 13.74 svoboDa, Čechy v době, Taf. 3-11.75 Quast, Vom Einzelgrab zum Friedhof, 175.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2383 383 22.06.2012 17:20:20
3�4
der Verbreitung von Keramikgruppen – im vorliegenden Fall der Gefäße mit Schrägkanneluren und Ovalfacetten – wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert, in jüngster Zeit nicht zuletzt auch anhand des Beispiels des so genannten Prager Typs und dessen möglicher Verbindung mit der frühsla-wischen Besiedlung76.
Das Problem der Besiedlung Süd- und Westböhmens während der Merowingerzeit
Das Problem der Siedlungskontinuität während des späten 5. und des 6. Jahr-hunderts ist von besonderer Bedeutung für die Frage der überregionalen Be-ziehungen Böhmens. Im Westteil des Landes kennen wir lediglich den Fried-hof von Pilsen-Doudlevce77, der in die Merowingerzeit datiert. Im südlichen Böhmen sind Funde dieser Zeitstellung ebenfalls äußerst rar78. Das größte Problem für unsere Kenntnis dieser Zeit, besonders im Falle der Siedlungen, ist die Identifizierung der zugehörigen materiellen Kultur. Dieses Problem kann exemplarisch anhand zweier Scherben scheibengedrehter Gefäße mit Einglättverzierung in Form von Gittermustern und Zickzack-Bändern ver-deutlicht werden. Die Scherben stammen aus Zvíkov (im Deutschen als Burg Klingenberg bekannt), einem mehrphasigen Fundplatz, der vor allem in der Bronzezeit, der Latènezeit und besonders dem Mittelalter und der Neuzeit besiedelt war. Im Falle der beiden erwähnten Scherben stehen einer erfolg-reichen Bestimmung gleich mehrere Probleme entgegen: Das Erste ist die Tatsache, dass die beiden Scherben an einem Fundplatz geborgen wurden, von dem auch Funde der Latènezeit bekannt sind, weshalb die Anwesen-heit von ähnlich geformter scheibengedrehter Keramik vorausgesetzt werden muss. Darüber hinaus stammen die beiden Fragmente aus sekundärer Lage innerhalb von Siedlungsschichten, so dass über die ursprüngliche Deponie-rung im Boden nur spekuliert werden kann79 (Abb. 14:4-5).
Anhand der Untersuchung vergleichbarer Formen sowie der Durchsicht des gesamten Fundmaterials konnte jedoch der Schluss gezogen werden, dass beide Fragmente der Keramikproduktion des späten 5. und des frü-hen 6. Jahrhunderts entsprechen. Ähnliche Stücke finden sich vor allem in den Keramiktypen der Serie Kaschau 6 und Altenerding-Aubing sowie bei den scheibengedrehten Formen der vorlangobardischen Phase des mittleren Donauraumes. Als Vergleichsstücke seien die Beispiele aus Traismauer (Öster-
76 curta, Utváření Slovanů; proFantová, Kultura; curta, Early Slavs. 77 svoboDa, Čechy v době, 257, Taf. 66.78 Für weitere Informationen siehe militký, Nálezy keltských, 54; zavřel, Doba římská, 85.79 Jiřík – simota, Nálezy keramiky, 131 f.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2384 384 22.06.2012 17:20:20
3�5
reich), Gyirmót-Homokdombon (Ungarn) oder Straning-Lettnäcker (Öster-reich) genannt80 (Abb. 14:1-3).
Andere analoge Formen zu den Scherben von Zvíkov legte Silvia Codrea-nu-Windauer bei der Analyse des Fundmaterials aus Grab 151 von Pliening, etwa 20 km östlich von München, vor. Das Kriegergrab war ausgestattet mit einer Lanzenspitze, einer Wurfaxt, einem Messer und einer scheibenge-drehten Flasche. Datiert ist es jedoch vor allem anhand einer cloisonnierten Eisenschnalle, die mit Silbertauschierungen und Goldfolie geschmückt ist und einen massiven Dorn besitzt, der ebenfalls mit Goldfolie sowie einer Einlage aus grünem Glas verziert ist. Ähnliche Schnallen fanden sich im Grab bei St. Severin in Köln sowie in Acquasanta; beide Stücke stammen wahrscheinlich aus einer süddeutschen Werkstatt, die unter ostgotischem Einfluss in der Zeit um 500 arbeitete. Die Keramikschale selbst ist graubraun mit dunkler Oberfläche, während der obere Teil des Gefäßes eine Einglättver-zierung in Form horizonaler Streifen trägt. Analogien sind bislang vor allem aus dem mittleren Donauraum bekannt, z. B. aus Laa an der Thaya sowie besonders aus dem Umland von Brünn in Mähren, beispielsweise aus Grab 7 von Vyškov oder ein weiteres Exemplar aus Nový šaldorf81. Unter den Kera-mikformen des Böhmischen Beckens, die zur selben Gruppe gehören, ist eine scheibengedrehte Schale mit einglättverzierter Zickzack-Linie aus Most in Nordwestböhmen zu nennen82, ähnlich der zweiten Scherbe aus Zvíkov.
Die Funde von Zvíkov repräsentieren ein klassisches Beispiel für die Schwierigkeit bei der Bearbeitung von Keramikinventaren. Einzelfunde von mehrphasigen Siedlungsplätzen stellen gewissermaßen eine Art Erkenntnis-
80 Jiřík – simota, Nálezy keramiky, 133.81 coDreanu-WinDauer, Pliening, 50–54, 103–105, Abb. 18, Taf. 19. 82 svoboDa, Čechy v době,Taf. 40:6.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
Abb.14:ScheibengedrehteKeramikdesspäten5.undfrühen6.JahrhundertsausdemDonauraumundSüdböhmen:1) Trais-Mauer(Österreich),2)Gyirmót-Homokdombon(Ungarn),3)Straning-Lettn-äcker(Österreich),4-5)Zvíkov(nachJaroslavJiřík–VlastimilSimota,Nálezykeramiky,Abb.1-2).
benediktbeuern_innenteil_22_06_2385 385 22.06.2012 17:20:21
3�6
falle dar – es ist möglich, dass eine ganze Anzahl weiterer Stücke uner-kannt innerhalb anderer frühgeschichtlicher Siedlungsplätze verborgen ist oder übersehen in Museumssammlungen schlummert. Ähnliche Siedlungen der Latènezeit, die in der Spätantike bzw. der Völkerwanderungszeit wieder besiedelt wurden, sind die Oppida von Závist bei Zbraslav und Stradonice. Auch in diesen Fällen könnte die strategisch günstige Lage der Grund für die Wiederbesiedlung gewesen sein. Im Falle von Zvíkov dürfte ferner die gün-stige Lage am Zusammenfluss von Otava und Moldau eine wichtige Rolle gespielt haben.
Trotz des sporadischen Auftretens von Siedlungsbelegen während des spä-ten 5. und frühen 6. Jahrhunderts ist Südböhmen ein Randgebiet und dürfte nur eine geringe Rolle für die so genannten Ethnogenese der Baiovaren ge-spielt haben.
Der elbgermanische Kulturkreis während der Merowingerzeit – Thüringer, Langobarden, Baiovaren und die Rolle des böhmischen Gebiets
In den Jahrzehnten um das Jahr 500 ereigneten sich zahlreiche bedeuten-de historische Ereignisse, wie die Machtentfaltung des Thüringerreichs oder – folgt man deutlich jüngeren Quellen wie der Historia Langobardorum des Paulus Diaconus – auch die Wanderung der Langobarden aus dem Elbegebiet nach Pannonien. Möglicherweise in diesem Zusammenhang ist das Auftreten der typischen thüringischen materiellen Kultur in Böhmen zu sehen83. Das archäologische Bild Mitteleuropas ändert sich um 500 radikal. Im mittleren Donauraum ist der vollständige Abbruch der Friedhöfe festzustellen. Glei-ches gilt für die Siedlungen und Werkstätten für scheibengedrehte Keramik. Die neu aufkommende materielle Kultur ist dagegen elbgermanisch geprägt. Zu nennen sind z. B. Fundplätze wie Holubice oder Lužice in Südmähren, die sich allmählich zu üblichen Friedhöfen des so genannten östlich-merowingi-schen Kulturkreises entwickelten. An diesen Plätzen zeigt das Fundmaterial vor allem Beziehungen zum mittleren und unteren Elbegebiet. Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind jedoch auch die Beziehungen zum Böhmischen Becken hervorzuheben, die sich zum Beispiel anhand der Fibeln und der Ke-ramik von Hořín bei Mělník, Doudlevce, Prag-Podbaba, Pnětluky, Lochenice und anderen Fundplätzen im Böhmischen Becken zeigen. Bemerkenswerte Kontakte nach Mähren verdeutlichen ebenfalls die Metallfunde der südbaye-rischen Fundplätze Altenerding und München-Perlach84.
83 DroberJar, Thüringische und Langobardische Funde; Jiřík, Bohemian Barbarians, 301–311.84 teJral, Abriss der frühmerowingerzeitlichen Entwicklung im mittleren Donauraum.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2386 386 22.06.2012 17:20:21
3�7
Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang eine Beobachtung Jan Bem-manns, die aber im Prinzip der oben erwähnten Diskontinuität der materiel-len Kultur des vorangegangenen ostgermanisch-danubischen Horizontes des späten 5. Jahrhunderts und dem folgenden elbgermanischen Horizont nicht entgegen steht – letzterer wurde von Jaroslav Tejral beobachtet und den Lan-gobarden zugeschrieben. Ausgehend von archäologischen Beobachtungen konstatierte Bemmann, dass die langobardischen Funde im mittleren Do-nauraum lediglich allgemein elbgermanisch geprägt seien und entsprechend einen Teil des überregional verbreiteten östlich-merowingischen Reihengrä-berkreises bildeten. Dagegen sei es nicht möglich, eine bestimmte Herkunfts-region der sich an der mittleren Donau neu formierenden Langobarden zu identifizieren, wie dies viele historische Karten mit Pfeildarstellungen von der Unteren Elbe über Böhmen in den mittleren Donauraum nahelegen85. Ein nicht gelöstes Problem bleibt jedoch die Frage des Fortlebens eines lokalen suebischen Substrats mit Wurzeln in spätrömischer Zeit, wie es im Falle des neu untersuchten Friedhofs der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts und des frühen 6. Jahrhunderts von Tesárske Mlyňany, Bezirk Zlaté Moravce, in der südwestlichen Slowakei vorausgesetzt wird86.
Ein bemerkenswerter Beleg für die Kontakte der Germanen im Böhmischen Becken und den allgemein als Langobarden bezeichneten Zuwanderern im Mitteldonauraum ist eine handgemachte Schüssel elbgermanischer Formtra-dition aus Dör, Distrikt Gyor-Moson-Sopron, in Ungarn. Diese trägt eine ei-genartige ‚Karten‘-Verzierung87, deren engste Analogie der Dekor eines Kera-mikgefäßes aus dem Friedhof von Jiřice ist88. Die Identifizierung spezifischer Landschaften auf dieser Darstellung ist jedoch spekulativ. (Abb. 15).
Seit dem Beginn des 6. Jahrhunderts, so ist festzustellen, haben sich die Beziehungen der materiellen Kultur Nordböhmens nicht nur in den mittleren Donauraum sondern auch nach Baiern erstreckt. Zudem könnte der Nordteil Böhmens als Vermittlungsraum für ein weiteres kulturelles Element gedient haben, das kürzlich im Friedhof von Prag-Zličín identifiziert wurde. Es han-delt sich um Gräber des 5. Jahrhunderts, die mit so genannten Kopfnischen ausgestattet sind, in denen Keramik- oder Glasgefäße platziert waren89. Sil-via Codreanu-Windauer suchte die Ursprünge dieses Phänomens im Osten, insbesondere im südlichen Russland, der Ukraine, dem Karpatenbecken und in Pannonien. Seit der Periode D2–D3 ist dieses Element auch im Untermain-gebiet belegt (Pleidelsheim, Eschborn, Hemmingen), das, wie bereits gezeigt, einige Beziehungen zur Vinařice-Gruppe aufweist. Seit der Zeitphase E1
85 bemmann, Mitteldeutschland, 203.86 ruttkay, Tesárske Mlyňany; teJral, Hunnenreich, 111. 87 tomka, Langobardok, 17 Abb. S. 18. 88 svoboDa, Čechy v době, 176 Abb. 58.89 Jiřík – vávra, Druhá etapa 526, Abb. 10, 12.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2387 387 22.06.2012 17:20:21
3��
kommt dieses Merkmal auch in Baiern vor: namentlich in München-Perlach, Straubing-Bajuwarenstraße, Unterhaching, Barbing-Irlmaut und Altener-ding90.
In verschiedenen Fällen konnten mögliche unmittelbare Kontakte zwi-schen Böhmen und Baiern nachgewiesen werden. Im Falle des Grabs 12 von München-Perlach deutet etwa die Strontiumisotopenanalyse auf eine Her-kunft aus Böhmen hin, möglicherweise aus der Nähe von Mariánské Lázně oder Všeruby. Zur Vorsicht mahnt jedoch Grab 18 (maturus) desselben Fund-platzes, das mit einer Fibel ausgestattet war, die hauptsächlich in Böhmen und Thüringen gefunden wurde; die Strontiumisotopenanalyse deutet jedoch auf einen lokalen Ursprung des Toten hin91 – allerdings ist die Aussagekraft dieser Methode gegenwärtig noch sehr umstritten92.
In anderen Fällen ist es schwierig, die Herkunftsregion zu identifizieren, besonders in jenen, die mit der langobardischen Wanderung verbunden wer-den. Weitere Belege für Beziehungen zwischen den danubischen Langobar-den und den Thüringern bzw. elbgermanischen Bevölkerungsgruppen, die von der thüringischen Kultur beeinflusst wurden, bietet die Fibel thürin-gischen Ursprungs in der langobardischen Nekropole von Kranj in Slowe-nien aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts93. Ein anderes Beispiel ist die thüringische Fibel aus dem gestörten langobardischen (?) Grab von der Porta San Giovanni in Cividale del Friuli94.
Weitere Funde außerhalb von Zentraleuropa können sowohl mit den Langobarden als auch den Thüringern verbunden werden, im zweiten Fall dienten diese vielleicht als Krieger im ostgotenzeitlichen Italien. Als Beispiel
90 coDreanu-WinDauer, Pliening, 25–28.91 haebler – zintl – Grupe, Lebensbedingungen, 55–58. 92 Vgl. dazu pollarD, Isotopes, 631–638, und den Beitrag von Eva Kropf in diesem Band. 93 vinsky, Rovašenim fibulama, Taf. 1:3 und 5. 94 vinsky, Rovašenim fibulama, Taf. 12:71.
Abb.15:Keramikgefäßmiteingeritzter‚Landkarte‘:1)Dör,DistriktGyőr-Moson-Sopron,2)Jiříce,DistriktMělník(nachtomka,Langobardok,Abb.S.18;SVoboDa,Čechyvdobě,Abb.58).
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2388 388 22.06.2012 17:20:24
3��
sei auf den Schnallendorn aus der Siedlung auf der Insel S. Andrea im Lop-piosee im Trentino (Italien) verwiesen. Der Fundkontext von Sektor A wurde von seicht eingetieften Pfostenbauten gebildet, die allerdings teilweise von späteren Bauaktivitäten gestört wurden. Er kann allgemein in die Zeit zwi-schen der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts und dem frühen 7. Jahrhundert datiert werden – darauf deuten etwa das Fragment einer Late Roman Am-phora 2, ein Zweilagenkamm sowie eine spätantike Gürtelschnalle hin. Ein Schnallendorn mit Parallelen in Weimar wurde aus der Crypta Balbi in Rom publiziert, ein weiteres Exemplar stammt aus der befestigten Siedlung von S. Antonio in Ligurien95.
Wenn man die ostgermanischen Gepiden sowie die Gruppen, die im heuti-gen Polen fortbestanden und deren Ethnizität umstritten ist96, innerhalb des östlich-merowingischen Reihengräberkreises der Stufe E1 ausklammert, so zeigt sich, dass eine weite Zone von der unteren und mittleren Elbe über Baiern, Böhmen, Mähren und Pannonien von elbgermanischen Bevölke-rungsgruppen besiedelt wurde. Mit einiger Berechtigung kann man von einer Art ‚elbgermanischer Renaissance‘ sprechen, welche die ostgermanisch-mittel-danubische Vorwärtsbewegung der vorangegangenen Phase D3 ersetzte. Wäh-rend der Stufe E1 erreichte der elbgermanische Kulturraum erneut die groß-flächige Ausdehnung, die er bereits während der spätrömischen Zeit besessen hatte. Für die Besiedlung neuer Gebiete in Pannonien und Baiern kann ein bestimmtes Herkunftsgebiet nicht festgemacht werden. Innerhalb der Bevöl-kerungsgruppen, die hier bestattet wurden, können lediglich allgemein elb-germanische Einflüsse festgestellt werden. In beiden Fällen zeichnet sich ein Modell ab, das für den westdeutschen Raum anhand des Fallbeispiels der Entstehung der Alemannen in spätrömischer Zeit entwickelt wurde. Wie oben bereits erwähnt, war dort an der Wanderung eine heterogene elbgermanische Bevölkerung mit Wurzeln sowohl in Böhmen als auch im Elbegebiet betei-ligt. Während es letztlich unmöglich ist, die Motive der Wanderung, die zur späteren Ethnogenese der Baiovaren und Langobarden führten, zu rekonstru-ieren, lassen sich bestimmte Möglichkeiten benennen, die als Motive für das Zustandekommen der Wanderung nicht ausgeschlossen werden können.
Diese Erkenntnisse stimmen zudem im Prinzip mit den historischen Über-legungen überein. An diesem Punkt ist es möglich, auf einige frühere Über-legungen aufzubauen, welche die Ethnogenese der Baiovaren mit politischen Interessen der Thüringer und Ostgoten in Verbindung bringen – beide ver-suchten das politische Vakuum in Raetien und – nach dem Untergang des Herulerreiches – auch im mittleren Donauraum auszufüllen. In diesem Zu-sammenhang sei nochmals an das Problem der langobardischen Tradition
95 De vinGo – Fossati, Elementi da cintura, 477–479, Taf. 65:6; maurina – postinGer – battisti, Ricerche, 29, 38, fig. 6, 9, 11, 19-20.
96 mączyńska, Culture de Przeworsk.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2389 389 22.06.2012 17:20:24
3�0
einer Ansiedlung in Böhmen unter König Wacho erinnert. Eine elegante Lö-sung hierfür wurde von Dušan Třeštík entwickelt, der darauf hinwies, dass Wacho zu einer Gruppe von Königen mit kurzen Namen gehörte, wie Claffo und Tato. Diese ungewöhnliche Namenform erscheint unter den Langobar-den nach ihrer Ankunft in Rugiland. Möglicherweise wurden sie von ethnisch nicht-langobardischen Elbgermanen aus Böhmen getragen, deren Anführer unter unklaren Umständen die königliche Macht erlangten, was möglicher-weise die königlich-langobardische Tradition einer Residenz in Böhmen in-spirierte. Die elbgermanische Ansiedlung in Böhmen hätte auf diese Weise eine besondere Rolle für ethnogenetische Prozesse gespielt, da es eine Art Reservoir für eine elitäre Bevölkerung bildete, vermutlich Kriegergruppen, die möglicherweise sowohl zu Baiern wie zu Langobarden wurden97.
Die Epoche nach dem Fall des Hunnenreichs in der Mitte des 5. Jahrhunderts war in Mitteleuropa gekennzeichnet von einer politischen Zersplitterung des Barbaricums in eine Anzahl regionaler, sich gegenseitig bekämpfender po-litischer Einheiten von begrenzter territorialer Ausdehnung, etwa die Herr-schaftsgebiete der Heruler, der Donausueben, der Skiren, Sarmaten und Ost-goten. In der folgenden Periode um das Jahr 500 ist ein entgegengesetzter Konsolidierungsprozess in größere Herrschaftseinheiten zu verzeichnen. Am Ende dieses Prozesses verblieben auf dem politischen Schachbrett Mitteleuro-pas lediglich zwei Spieler, die Franken und die Langobarden.
Um die Machtstrukturen in der Mitte des 6. Jahrhunderts abzuschätzen, sind die Entwicklungen in den benachbarten Räumen ein wichtiger Faktor. Die an Nordbaiern angrenzenden Gebiete geraten nach der Niederlage der Thüringer 531 unter fränkischen Einfluss. Allerdings kennen wir für das fort-geschrittene 6. Jahrhundert aus dem oberen Maintal nur vereinzelte Sied-lungsbefunde, etwa in Eggolsheim, Forchheim und Unterheid98. Eine deutlich andere Situation entwickelte sich dagegen an der bayerischen Donau, wo zahlreiche Fundplätze des 6. und 7. Jahrhunderts bekannt sind. Als Beispiel sei der Friedhof von Künzing-Bruck genannt, in dem Anne Sibylle Hanni-bal-Deraniyagala sowohl östlich-merowingische als auch westlich-merowin-gische Einflüsse feststellte. Parallelen im langobardenzeitlichen Pannonien und Slowenien besitzen etwa die S-Fibeln aus Grab 134 oder die Lanzenspitze des Typs Vörs in Grab 129 sowie die Keramikgefäße aus den Gräbern 263 and 248. Westlich-merowingische Entsprechungen besitzen beispielsweise dage-gen die Keramikgefäße aus Grab 160 und die Lanzenspitze aus Grab 276.
Hannibal-Deraniyagala zufolge stellt der von ihr bearbeitete Friedhof ei-nen Komplex von Beigaben höchst heterogenen Ursprungs dar – insgesamt
97 třeŠtík, Počátky Přemyslovců, 36, 49; kuna – proFantová, Počátky raného, 222. 98 haberstroh, Germanische Stammesverbände, 18 f. Abb. 9:7-8.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2390 390 22.06.2012 17:20:24
3�1
ist die Situation dem generellen Erscheinungsbild der archäologischen Quel-len in Böhmen nicht unähnlich. Das Böhmische Becken befindet sich entwe-der in unmittelbarer Nähe des sich entfaltenden Frankenreichs oder ist sogar ein Teil von ihm. Die Schriftquellen informieren uns darüber recht eindeu-tig. Der Machtanspruch des Frankenreichs in Mitteleuropa wird deutlich in einem Brief des Königs Theudebert an den byzantinischen Kaiser Justinian, der vermutlich um 546/47 datiert und der die Ausdehnung von Theudeberts Machtbereich bis zur Donau und an die Grenzen Pannoniens beschreibt:
Dominoinlustroetpraecellentissimodomnoetpatri,IustinianoImpera-tore,TheudebertRex.
DeinostrimisericordiamfelicitersubactisThoringiiseteorumprovinciisadquisitia, exextinctis ipsorum tunc tempore regibus, Norsavorum itaquegentemnobisplacatamaiestate,collasubdentibusedictisideoque,Deopro-pitio,Wesigotis,incolomesfranciae,septentrionalemplagamItaliaequePan-noniaecumSaxonibus,Euciis,quisenobisvoluntatepropriatradiderunt,perDanubiumetlimitemPannoniaeusqueinoceanislitoribuscustodienteDeodominationostraporrigetur.99
Bedauerlicherweise ist diese Quelle nicht sehr ausführlich und bezieht sich auf den sich neu herausbildenden Dukat im bayerischen Donauland. Welche der zentraleuropäischen Mächte – d. h. Franken oder Langobarden – das Machtvakuum im Böhmischen Becken ausfüllte, das sich aus der Niederlage der Thüringer ergab, kann anhand der historischen Quellen nicht eindeutig geklärt werden. Für das 6. Jahrhundert ist es nicht möglich, ambivalente Machtstrukturen unter den Bewohnern Böhmens auszuschließen. Die archä-ologischen Quellen als indirekte Hinweise geben bedauerlicherweise eben-falls keine eindeutige Antwort auf derartige Fragen.
Zuletzt behandelte Eduard Droberjar die Entwicklung während der frühen Völkerwanderungszeit. In diesem Zusammenhang definierte Droberjar die Pha-se E2 genauer, besonders anhand der relevanten Fibeln. Anhand typologischer Merkmale können diese in vier grundlegende Gruppen unterteilt werden.
Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Fibeln des östlich-merowin-gischen Reihengräberkreises, innerhalb dessen die Fibeln in Niedersachsen, dem Rheinland und Niederösterreich weit verbreitet sind. Es handelt sich um die Typen Eischleben (Funde aus Lochenice), Chessel Down (Fund aus Sola-ny), Rittersdorf (Prag Podbaba) und Goethes Fibel Serie B (Záluží-Čelákovice und wahrscheinlich Veltruby bei Kolín). Die zweite Gruppe besteht aus rein fränkischen Typen, z. B. aus Lovosice, wo ein Stück entsprechend Pleidels-heim F38 geborgen wurde. Zahlreich vertreten ist ferner die dritte Gruppe, die langobardischen Fibeln. Diese umfassen die Typen Světec-Szentendre-
99 MGH, Epistolae Merovingici et Karolini aevii I, Bd. III: Epistolae Austriacae, ed. Wilhelm GunDlach 20, 133.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2391 391 22.06.2012 17:20:25
3�2
Lucca-Belfort, Várpalóta-Udine-Čelákovice, Záluží-Várpalota, Schwechat-Podbaba, Holubice-Cividale-Cela und Radovesice. Die letzte Gruppe besteht aus allgemein merowingischen Fibeln, wie die kerbschnittverzierten Vogel-fibeln mit Glas- und Almandineinlagen der Typen Thiry 387 und 227 aus Prag-Podbaba, die Vogelfibel aus Zbuzany, die rhombischen kerbschnittver-zierten Fibeln des Typs Pleidesheim X110 aus Radovesice und Prag-Podbaba sowie die Scheibenfibel mit Almandineinlagen des Typs AS Feinzo aus Roud-nice nad Labem100. Wie im benachbarten Baiern fällt es auch in Böhmen schwer, die Objekte östlich-merowingischer, westlich-merowingischer und langobardischer Provenienz sicher zu interpretieren.
Fazit
Der vorliegende Beitrag hat versucht, die neuen Funde und Erkenntnisse zur Spätantike und Völkerwanderungszeit in Böhmen zusammenzufassen. Die Friedenhain-Přešťovice-Gruppe – oder besser gesagt die entsprechenden Keramiktypen – werden hier neu interpretiert als lokale Einwicklung allge-mein elbgermanischer Keramiktraditionen. Für Südböhmen sind (suebische) Einflüsse aus dem mittleren Donauraum in spätrömischer Zeit hervorzu-heben. Besonders wichtig ist auch das Aufkommen der charakteristischen Keramik des Typs Friedenhain-Přešťovice im Gebiet der Vinařice-Gruppe Nordböhmens, das in das 5. Jahrhundert datiert werden kann. Die Vinařice-Gruppe entwickelt sich während des 5. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Machtzentrum mit Bezügen in das untere Maintal während der Stufe D2b. Eine Zuschreibung zu einer der aus den Schriftquellen bekannten ethnischen Gruppe ist im Falle der Vinařice-Gruppe – oder besser gesagt Nordböhmens – jedoch problematisch; allerdings können wir einige Lösungen etwa im Zusammenhang mit der baiovarischen Ethnogenese anbieten101. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts ist ein Niedergang der Friedhöfe der Vinařice-Gruppe zu verzeichnen. Diese Entwicklung kann mit einem generellen Prozess verbun-den werden, der allgemein in den elbgermanischen Gebieten stattgefunden hat und der mit dem Aufstieg des Thüringerreichs und der langobardischen Wanderung zusammenhängt. In Bezug auf die böhmisch-baiovarischen Beziehungen können wir zwei Phasen des Kontakts konstatieren: Die erste Phase kann in spätrömische Zeit datiert werden (z. B. Neuburg a. d. Donau und Eining/Abusina etc.). Inwieweit diese Phase mit dem Aufkommen der Keramik des Typs Friedenhain-Přešťovice zu verbinden ist, bleibt fraglich. Die zweite Stufe ist enger verbunden mit der Formierung der baiovarischen
100 DroberJar, Thüringische und Langobardische Funde, 238–241, Abb. 8; DroberJar, Některé problemy, 139–141, Abb. 8.
101 Jiřík, Bohemian Barbarians, 311–316.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2392 392 22.06.2012 17:20:25
3�3
Identität und fällt in die Merowingerzeit. Während des späten 5. Jahrhun-derts und im frühen 6. Jahrhundert ist es möglich, einige Kontakte zwischen böhmischen und bairischen Fundorten nachzuweisen. Jedoch muss hinzuge-fügt werden, dass diese Kontakte nicht besonders prominent sind.
Quellen
Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum – Römische Geschichte, ed. Wolf-gang seyFarth, 1983–1986.
Iordanes, Getica, ed. Theodor mommsen, in: MGH AA 5, 1882/1982, 53–138.
Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, ed. Georg Waitz, in: MGH SS rer. Langobardorum 1, 1878, 12–187.
Epistolae Austriacae, ed. Wilhelm GunDlach, in: MGH, Epistolae Merovingici et Karolini aevii I, Bd. III, 1888.
Literatur
Heinrich beck, Bajuwaren– Philologisches, in: RGA² 1 (1973) 601–606.
Jan bemmann, Mitteldeutschland im 5. Jahrhundert – Eine Zwischenstati-on auf dem Weg der Langobarden in mittleren Donauraum?, in: bemmann – schmauDer, Kulturwandel, 145–227.
Jan bemmann – Michael schmauDer (Hg.), Kulturwandel im Mitteleuropa. Lan-gobarden – Awaren – Slawen, 2008.
Zdeněk beneŠ,Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova – dvě sídliště doby římské v severozápadních Čechách, Diss. Masch. Karls-Universität Prag 2009.
Sebastian brather, Römer und Germanen. Ethnogenesen und Identität in der Spätantike, in: teJral, Barbaren im Wandel, 11–27.
Pavel břicháček, Nové nálezy z Vochova, in: Pěší zóna 10. Revue pro památ-kovou péči, archeologii, historii, výtvarné umění a literaturu (2002) 15 f.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2393 393 22.06.2012 17:20:25
3�4
Pavel břicháček – Péter braun – Lubomír koŠnar, Sedlec, district of České Budějovice – A Settlement of the late Roman Period, in: charvát, Archaeo-logy, 126–129.
Petr charvát (Hg.), Archaeology in Bohemia 1985–1990, 1991.
Silvia coDreanu-WinDauer, Pliening im Frühmittelalter. Bajuwarisches Grä-berfeld, Siedlungsbefunde und Kirche, 1997.
Florin curta, Utváření Slovanů (se zvláštním zřetelem k Čechám a Moravě) – The making of the Slavs (with a special emphasis on Bohemia and Mora-via), in: Archeologické rozhledy 60 (2008) 643–694.
Florin curta,The early Slavs in Bohemia and Moravia: a response to my critics – Počátky Slovanů v Čechách a na Moravě: odpověď mým kritikům, in: Archeologické rozhledy 61 (2009) 725–754.
Florin curta (Hg.), Neglected Barbarians. Studies in the Early Middle Ages, 2011.
Eduard DroberJar, Od plaňanských pohárů k vinařické skupině. Kulturní a chronologické vztahy na území Čech v době římské a v časné době stěhování národů, in: Sborník Národního muzea v Praze, series A-Historie 53/1-2 (1999) 1–58.
Eduard DroberJar, Praha germánská, in: Michal lutovský – Lubor smeJtek (Hg.), Praha pravěká, 2005, 777–841.
Eduard DroberJar, Některé problémy mladší doby stěhování národů v Čechách, in: niezabitoWska-WiśnieWska u. a., Turbulent Epoch, 133–147.
Eduard DroberJar, Mladší doba římská, in: Vladimír salač (Hg.) Doba římská a stěhování národů (Archeologie pravěkých Čech 8), 2008, 127–155.
Eduard DroberJar, Thüringische und Langobardische Funde und Befunde in Böhmen. Zum Problem der späten Phasen der Völkerwanderungszeit, in: bemmann – schmauDer, Kulturwandel, 229–248.
Kristian elschek, Siedlungslandschaft des 4. Jhs n. Chr nördlich von Car-nuntum im Lichte von systematischer Prospektion und Grabung, in: študijné Zvesti Archeologického ústavu SAV 36 (= Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-turen in der Frühgeschichte) (2004) 239–255.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2394 394 22.06.2012 17:20:25
3�5
Hubert Fehr, Am Anfang war das Volk? Die Entstehung der bajuwarischen Identität als Problem der archäologischen und interdisziplinären Frühmit-telalterforschung, in: Walter pohl – Mathias mehoFer (Hg.), Archäologie der Identität. Methodenprobleme der Frühmittelalterforschung, 2010, 211–231.
Jan Frolík u. a., Sídliště vinařické skupiny z Prahy-Kobylis, in: Eduard Drober-Jar (Hg.), Archeologie barbarů 2010: hroby a pohřebiště Germánů mezi La-bem a Dunajem (im Druck).
Karlheinz Fuchs (Hg.), Die Alamannen, Ausstellungskatalog Stuttgart, 1997.
Henri GaillarD De sémainville, À propos de l’Implantation des Burgondes. Réflexions, Hypothéses et Perspectives, in: Françoise passarD u. a. (Hg.), Bur-gondes, Alamans, Francs et Romains. Dans ľest de la France, le sud-ouest de ľAllemagne et la Suisse Ve-VIIe aprés J.-C., 2003, 17–39.
Markus GschWinD, Abusina. Das römische Auxiliarkastell Eining an der Do-nau vom 1. bis 5. Jahrhunderts n. Chr., 2004.
Jochen haberstroh, Germanische Stammesverbände an Obermain und Reg-nitz. Zur Archäologie des 3.–5. Jahrhunderts in Oberfranken, in: Archiv für Geschichte von Oberfranken 75 (1995) 7–40.
Jochen haberstroh, Der Reisberg bei Scheßlitz-Burgellern in der Völkerwan-derungszeit. Überlegung zum 5. Jahrhundert n. Chr. in Nordbayern, in: Ger-mania 81 (2003) 201–262.
Kristin haebler – Stephanie zintl – Gisela Grupe, Lebensbedingungen und Mobilität im frühmittelalterlichen Perlach, in: Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie 12 (2006) 47–62.
János harmatta, Fragments od Wulfilus Gothic Translation od the New Te-stament from Hács-Béndekpuszta, in: Acta Antiqua Akad. Scien. Hungaricze 37 (1996/97) 1–24.
Wolfgang haubrichs, Baiern, Romanen und Andere. Sprachen, Namen, Grup-pen südlich der Donau und in den östlichen Alpen während des frühen Mit-telalters, in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 69 (2006) 395–465.
Morten heGeWisch, Plänitz. Ein kaiser- und völkerwanderungszeitliches Grä-berfeld im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Zugleich eine Studie zur Entwicklung der spätkaiserzeitlichen elbgermanischen Keramik, 2007.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2395 395 22.06.2012 17:20:25
3�6
Eva hJärthner-holDar – Kristina lamm – Bente maGnus, Metalworking and Central Places, in: Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Uppåkrastudier 6 (2002) 159–183.
Michael hoeper – Heiko steuer, Eine völkerwanderungszeitliche Höhenstation am Oberrhein – der Geißkopf bei Berghaupten, Ortenaukreis. Höhensiedlung, Kultplatz oder Militärlager, in: Germania 77 (1999) 185–246.
pavel huŠták – Jaroslav Jiřík, Osídlení z doby římské v Praze – Hloubětíně „Zahrady nad Rokytkou“, in: karWoWski – DroberJar, Archeologia Barbarzyń-ców 2008, 305–351.
Libuše Jansová, Hradiště nad Závistí v období pozdně římském a v době stěhování národů – Hradiště ob Závist in der späten römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit, in: Památky archeologické 62 (1971) 135–176.
Jaroslav Jiřík, Vybrané sídlištní situace mladší doby římské až časné fáze doby stěhování národů v severozápadních Čechách, in: Eduard DroberJar – Ondřej chvoJka (Hg.), Archeologie barbarů 2006, 2007, 535–564.
Jaroslav Jiřík, Entstehung und Entwicklung der sogenannten Vinařice-Grup-pe im Nordteil des Böhmischen Beckens. Forschungstand und Interpretation-versuch, in: teJral, Barbaren im Wandel, 121–145.
Jaroslav Jiřík, Bohemian Barbarians. Bohemia in Late Antiquity, in: curta, Barbarians, 265–319.
Jaroslav Jiřík – Michal kostka, Germánské sídliště v Dolních Chabrech, in: Archeologie ve středních Čechách 10 (2006) 713–742.
Jaroslav Jiřík – Milan kuchařík, Sídliště z konce doby římské v Praze-Dej-vicích, sladovny Podbaba (in Vorbereitung).
Jaroslav Jiřík – Vlastimil simota, Nálezy keramiky doby stěhování národů ze Zvíkova (okr. Písek), in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22 (2009), 131–136.
Jaroslav Jiřík – Jiří vávra, Druhá etapa výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Zličíně, in: Eduard DroberJar – Balázs komoróczy – Dagmar vachůtová (Hg.), Barbarská sídliště. Chronologické a historické aspekty je-jich vývoje ve světle nových výzkumů. Archeologie barbarů 2007, 2008, 241–254.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2396 396 22.06.2012 17:20:25
3�7
Maciej karWoWski – Eduard DroberJar (Hg.), Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim – Archäologie der Barbaren 2008: Beziehungen und Kontakte in der barbarischen Welt, 2009.
Michel kazanski – Anna mastykova, Machtzentren und Handelswege in West-alanien im V.–VI. Jahrhundert, in: teJral, Barbaren im Wandel, 173–200.
Erwin keller, Das spätrömische Gräberfeld von Neuburg an der Donau, 1979.
Titus kolník – Vladimír varsik – Ján vlaDár, Branč, Germánská osada z 2. až 4. století – Eine germanische Siedlung vom 2. bis zum 4. Jahrhundert, 2007.
Friedrich kluGe, Gotische Lehnworte im Althochdeutschen, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 35 (1910) 124–160.
Lubomír koŠnar – Pavel břicháček, Neuere Erkenntnisse zur Besiedlung Süd-böhmen in der römischen Kaiserzeit, in: Achim leube (Hg.), Haus und Hof im östlichen Germanien, 1998, 160–163.
Milan kuchařík u. a., Nové poznatky k osídlení západního okraje Prahy v 5. století, in: Eduard DroberJar – Balázs komoróczy – Dagmar vachůtová (Hg.), Barbarská sídliště. Chronologické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových výzkumů. Archeologie barbarů 2007, 2008, 341–372.
martin kuna – Naďa proFantová, Počátky raného středověku v Čechách. Archeologický výzkum sídelní aglomerace kultury pražského typu v Roz-tokách, 2005.
Alexandru levinschi, Gräberfeld der späten Sîntana de Mures-Černjachov-Kultur, in: Gudrun Gomolka-Fuchs (Hg.), Die Sîntana de Mures-Černjachov-Kultur, 1999, 23–32.
Magdalena mączyńska, La fin de la culture de Przeworsk, in: teJral – pilet – kazanski, L`Occident romain, 141–170.
Renata maDyDa-leGutko – Krzysztof tunia, Late Roman and Early Migration Period in Polish Beskid Mts., Carpathians. Settlement Aspect, in: niezabitoWs-ka-WiśnieWska u. a., Turbulent Epoch, 227–248.
Josef maličký, Předslovanská hradiště v jižních a západních Čechách, in: Památky archeologické 43 (1950) 21–42.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2397 397 22.06.2012 17:20:25
3��
Max martin, MixtiAlamannisSuevi? Der Beitrag der Alamanischen Gräber-felder am Basler Rheinknie, in: teJral, Probleme, 195–223.
Barbara maurina – Carlo postinGer – Maurizio battisti, Ricerche archaeologi-che a Loppio, Isola di S. Andrea (TN). Relazioni preliminare sulla campagna di scavo 2004, in: Annali del museo civici Rovereto 20 (2004) 23–51.
Jiří militký, Nálezy keltských a antických mincí v jižních Čechách, in: Zlatá stezka 2 (1995) 34–67.
Karla motyková – Petr DrDa – Alena rybová, Závist. Keltské hradiště ve středních Čechách, 1978.
Karla motyková – Petr DrDa – Alena rybová, Some notable imports from the end of the Roman Period at the site of Závist, in: charvát, Archaeology, 56–63.
Barbara niezabitoWska-WiśnieWska u. a. (Hg.), The Turbulent Epoch. New ma-terials from the Late Roman Period and the Migration Period, Bd. 1, 2008.
Josef L. píč, Starožitnosti země české II. Čechy na úsvitě dějin. Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, 1903.
Karol pieta, Anfänge der Völkerwanderungszeit in der Slowakei. (Fragestel-lungen der zeitgenössischen Forschung), in: teJral – pilet – kazanski, L`Oc-cident romain, 171–189.
Ivana pleinerová, Litovice (okr. Praha-západ): hroby vinařického stupně doby stěhování národů, in: Eduard DroberJar – Michal lutovský (Hg.), Archeologie barbarů 2005. Sborník příspěvků z 1. protohistorické konference „Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení“, 2006, 483–498.
Eugen pochitonov, Nálezy antických mincí, in: Emanuela noheJlová-prátová (Hg.), Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1955, 35–314.
A. Mark pollarD, Isotopes and impact: a cautionary tale, in: Antiquity 85 (2011) 631–638.
Jan procházka, Osídlení pozdní doby římské v Praze – Čimicích, in: karWoWs-ki – DroberJar, Archeologia Barbarzyńców 2008, 353–362.
Naďa proFantová, Kultura s keramikou pražského typu a problém šíření sla-vinity do střední Evropy. K článku Florina Curty – The Prague-type pottery
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2398 398 22.06.2012 17:20:25
399
culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe. On the article by Florin Curta, in: Archeologické rozhledy 61 (2009) 303–330.
Dieter Quast, Merowingerzeitliche Grabfunde aus Gültlingen, 1993.
Dieter Quast, Vom Einzelgrab zum Friedhof. Beginn der Reihengräbersitte im 5. Jahrhundert, in: Fuchs, Alamannen, 171–190.
Dieter Quast, Höhensiedlungen – donauländische Einflüsse – Goldgriffspathen. Veränderungen im archäologischen Material der Alamannia im 5. Jahrhundert und deren Interpretation, in: tejral, Probleme, 273–295.
Dieter Quast, Völkerwanderungszeitliche Frauengräber aus Hippo Regius (Annaba/Bône) in Algerien, in: Jahrbuch des RömischGermanischen Zentralmuseums 52 (2005) 237–315.
Agnieszka reszczyńska, New materials from the Migration Period at the settlement TrmiceÚstí nad Labem in northwestern Bohemia, in: Niezabitowska-wiśNiewska u. a., Turbulent Epoch, 285–290.
Arno rettNer, Baiuaria romana. Neues zu den Anfängen Bayerns aus archäologischer und namenkundlicher Sicht, in: Gabriele GraeNert u. a. (Hg.), Hüben und drüben. Räume und Grenze in der Archäologie des Frühmittelalters. Festschrift Max Martin, 2004, 255–286.
Matej ruttkay, Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld in Tesárske Mlyňany, Bez. Zlaté Moravce, in: tejral, Barbaren im Wandel, 321–338.
Vladimír sakař, Spony s cibulkovými knoflíky ve střední Evropě, in: Památky archeologické 52 (1961) 430–435.
Věra Šaldová, Westböhmen in der späten Bronzezeit. Befestigte Höhensiedlungen, 1981.
Helga schach-dörGes, „Zusammengespülte und vermengte Menschen“. Suebische Kriegerbünde werden sesshaft, in: Fuchs, Alamannen 79–102.
Erdmute schultze – Bogdan stroceN, Ovalfacettierte Keramik – eine Untersuchung zur Chronologie der ČernjachovKultur, in: Niezabitowska-wiśNiewska u. a., Turbulent Epoch, 315–327.
Böhmen in der Spätantike und der VölkerwanderungSzeit
benediktbeuern_innenteil_03_07_2399 399 03.07.2012 15:18:39
400
Mechthild schulze-Dörrlamm, Germanische Spiralplattenfibeln oder romani-sche Bügelfibeln? Zu den Vorbildern elbgermanisch-fränkischer Bügelfibeln, in: Archäologische Korrespondenzblatt 30 (2000) 599–613.
Miloš Šolle, Stará Kouřim a projevy velkomoravské hmotné kultury v Čechách 1966.
Eva stauch, Wenigumstadt. Ein Bestattungsplatz der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters im nördlichen Odenwaldvorland, 2004.
Bernd steiDl, Die Wetterau vom 3. bis 5. Jahrhundert n. Chr., 2000.
Bernd steiDl, Zeitgenosse der Nibelungen – Der Krieger von Kemathen, in: c. Sebastian sommer (Hg.), Archäologie in Bayern. Fenster zur Vergangenheit, 2006, 234.
Roland steinacher, The Herules: The fragments of a history, in: curta, Bar-barians, 321–363.
Heiko steuer, Theorien zur Herkunft und Entstehung der Alemannen. Ar-chäologische Forschungsansätze, in: Dieter Geuenich (Hg.), Die Franken und die Alemannen bis zur „Schlacht bei Zülpich“ (496/97), 1998, 270–324.
Alois stuppner, Amulette und Anhänger vom Oberleiserberg bei Ernstbrunn, NÖ, in: Klára kuzmová – Karol pieta – Ján raJtár (Hg.), Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift Titus Kolník, 2002, 377–384.
Alois stuppner, Oberleiserberg bei Ernsbrunn – Ein Herrschaftszentrum des 5. Jahrhunderts n. Chr. im mittleren Donauraum, in: Rom und die Barbaren. Europa zur Zeit der Völkerwanderung, 2008, 202–205.
Bedřich svoboDa, Čechy v době stěhování národů, 1965.
Felix teichner, Kahl am Main. Siedlung und Gräberfeld der Völkerwande-rungszeit, 1999.
Jaroslav teJral, Spätrömische und völkerwanderungszeitliche Drehscheiben-keramik in Mähren, in: Archaeologia Austriaca 69 (1985) 105–145.
Jaroslav teJral, Die spätantiken militärischen Eliten beiderseits der norisch-pannonischen Grenze aus der Sicht der Grabfunde, in: Thomas Fischer –
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2400 400 22.06.2012 17:20:26
401
Gundolf precht – Jaroslav teJral (Hg.), Germanen beiderseits des spätantiken Limes, 1999, 217–292.
Jaroslav teJral (Hg.), Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonau-raum, 2002.
Jaroslav teJral, Vinařice Kulturgruppe, in: RGA2 32 (2006) 414–423.
Jaroslav teJral, Das Hunnenreich und die Identitätsfragen der barbarischen „gentes“ im Mitteldonauraum aus der Sicht der Archäologie, in: teJral, Bar-baren im Wandel, 55–119.
Jaroslav teJral (Hg.), Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur- und Identi-tätsumbildung in der Völkerwanderungszeit, 2007.
Jaroslav teJral, Ke zvláštnostem sídlištního vývoje v době římské na území severně od středního Dunaje, in: Eduard DroberJar – Balázs kamoróczy – Dagmar vachůtová (Hg.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007), 2008, 67–98.
Jaroslav teJral, Abriss der frühmerowingerzeitlichen Entwicklung im mittle-ren Donauraum bis zum Anfang des 6. Jahrhunderts, in: bemmann – schmau-Der, Kulturwandel, 268–276.
Jaroslav teJral – Christian pilet – Michel kazanski (Hg.), L`Occident romain et l`Europe centrale au début de l`époque des Grandes Migrations, 1999.
Péter tomka, Langobardok a Kisalföldön – Langobardi na Podunajskej nížine, in: Attila molnár – Andrea naGy – Péter tomka (Hg.), Jöttek - mentek. Lango-bardok és avarok a Kisalföldön. Kiállításvezető. – Prišli a odišli. Langobardi a Avari na Podunajskej nížine. Sprievodca výstavy, 2008, 8–29.
Dušan třeŠtík, Počátky Přemyslovců, 1997.
Jiří vávra u. a., Pohřebiště z doby stěhování národů v Praze-Zličíně, ul. Hro-zenkovská – průběžná zpráva o metodice a výsledcích výzkumu, in: Eduard DroberJar – Ondřej chvoJka (Hg.), Archeologie barbarů 2006, 2007, 565–577.
Jiří vávra u. a.,Výzkum pohřebiště z doby stěhování národův Praze – Zličíně v letech 2005–2008, in: Archaeologia Pragensia 19 (2009) 209–230.
böHmen In der spätantIKe und der VölKerwanderungsZeIt
benediktbeuern_innenteil_22_06_2401 401 22.06.2012 17:20:26
402
Paolo De vinGo – Angelo Fossati, Gli elementi da cintura, in: Tiziano mannoni (Hg.), S. Antonino: un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, 2001, 475–483.
Zdenko vinsky, O rovašenim fibulama Ostrogota i Tirinžana povodom rijet-kog tirinškog nalaza u Saloni, in: Vjestnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3/6-7 (1972–73) 177–227.
Hans-Ulrich voss, Archäologische Quellen, Quellenlage und -auswahl im Ar-beitsgebiet, in: Berichte der Römisch-Germanischen Kommission 79 (1998) 123–157.
Joachim Werner, Zu einer elbgermanischen Fibel des 5. Jahrhunderts aus Gaukönigshofen, Ldkr. Würzburg. Ein Beitrag zu den Fibeln vom ‘Typ Wiesbaden’ und zur germanischen Punzornamentik, in: Bayerische Vorge-schichtsblätter46 (1981), 224–254.
Petr zavřel, Der gegenwärtigen Forschungsstand der spätrömischen Zeit und der Völkerwanderungszeit in Südböhmen, in: Jaroslav teJral – Herwig Frie-sinGer – Michel kazanski (Hg.), Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, 1997, 259–272.
petr zavřel, Doba římská a doba stěhování národů v jižních Čechách. Současný stav, výzkum a výhled, in: Ondřej chvoJka – Rudolf kraJíc (Hg.), Archeologie na pomezí, 2007, 79–109.
Jiří zeman, Severní Morava v mladší době římské, 1961.
jaroslaV jI r ÍK
benediktbeuern_innenteil_22_06_2402 402 22.06.2012 17:20:26