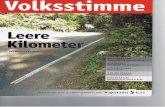Immersions- und Emotionsforschung, Kernelemente der Bildwissenschaft
Transcript of Immersions- und Emotionsforschung, Kernelemente der Bildwissenschaft
Bibllographische lnfonnation der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Dalen sind im Internet Ober http:Udnb.ddb.de abrulbar.
Alie Rechte vorbehalten ©Verlag Dr. H. H. Driesen GmbH, Taunusstein, 2007
Lektorat, Text und Umschlaggestaltung: Albrecht Driesen
Cover unter Veiwendung der Einladungskarte tor die Ausstellung Aufruhr der GefOhle. Leidenschaflen in der zeifgenassischen Fotografie und Videokunst, Museum filr Fotografie, Braunschweig 2004 mil Cindy Shemian, UntiUed Film Still, #27 (1979), courtesy Cindy Sherman, Metro Pictures, New York, Monika Spriith Philomena Magers, Kiiln, Miinchen, London, des Prograrrvns des E'111-steinforums in Potsdam, Okt-Dez. 2004 mil Louis-Leopold BoiUy, Reunion de trente-cinq tetes d'expression, Tourcoing, Musee des Beaux-Arts, zweier Programmhefte aus dem Musee de la Musique in Paris und eines Versandkatalogs von Frohlich und Kaufmann 2001.
Das Werk einschlieBlich aner seiner TeHe isl urheberrechUich geschiitzl. Jede Verwertung aurierhalb der engen Grenzen des Urheberrechls· gesetzes isl ohne Zuslimmung des Verlags unzulassig und stralbar. Das gilt insbesondere fiir Vervielfiitligungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Elnspeicherung und Verarbeitung in elektron~ schen Systemen.
http://www.driesen-online.de E-Mail: [email protected]
Druck und Buchbinder: SOL Druck und Verlag, Berlin Printed In Germany
ISBN 976-3-936328-76-9
Oliver Grau »Vorsicht! Es scheint, dall er direkt auf die Dunkelheit zustiirzt, in der Sie sitzen.« Immersions- und Emotionsforschung, Kernelemente der Bildwissenschaft
Niemals zuvor hat sich die Welt der Bilder so rasant veriindert wie in den
letzten Jahren: Waren Bilder frtiher Ausnahmeerscheinungen, weitgehend
dem Ritual, dem Kult, spiiter der Kunst und dem Museum vorbehalten, sind
wir im Zeitalter von Kino, Fernsehen und Internet mittlerweile eng von
Bildem umsponnen. Das Bild dringt in neue Segmente: Nicht nur das Fem
sehen wandelt sich zum Zappingfeld, Grol3bildleinwiinde ziehen in unsere
Stadte, Infografik durchsetzt die Printmedien, Handys versenden Micromo
vies in Echtzeit. Wir erleben den Aufstieg des Bildes zum computergenerier
ten virtuellen Raumbild, das sich scheinbar »autonom« zu wandeln und eine
lebensecht, visuell-sensorische Sphare ztl formulieren vermag. Interaktive
Medien veriindem unsere Vorstellung vom Bild ztl einem multisensorischen,
interaktiven Erfahrungsraum im zeitlichen Ablauf. Bildwelten, welche zt1r
zeit nur mit teueren Stand-Alone-Systemen erzeugbar sind, die jedoch schritt
weise ins Internet einziehen, sobald dies die Bandbreiten, Dbertragungs- und
Kompressionsraten gewiihrleisten. Ehedem nicht darstellbare Objekte, Bild
riiume und Prozesse werden optional, die Raumzeitparameter beliebig wan
delbar und das Virtuelle als Modell- und Erfahnmgsraum nutzbar. Es entste
hen polysensuell erfahrbare Bildriiume interaktiver Kunstrezeption, welche
Prozessualitiit, Narration und Performanz fdrdem und damit nicht zt1letzt der
Kategorie des Spiels neue Bedeutung verleihen.
Im Verlauf der neuerlichen, nun digitalen Medien- und Bildrevolution
erfuhren die neuen Bildwelten auf der einen Seite zwar ebenso feiemde
Zukunftsprognosen1, wie andererseits platonisch klagende2 oder gar apoka
lyptische Szenarien.3 Die tatsiichlichen kulturellen Effekte des Medien
wandels sind allerdings erst ansatzweise analysiert. Unter dem Titel The
Coming and Going of Images veriiffentlichte im Jahr 2000 Rudolf Am
heim ein eindrucksvolles Pliidoyer fiir die Integration der neuen interaktiv-
263
prozessualen Bildwelten in den Kontext der Sch!itze, Erfahrungen und
Einsichten, die uns die Kunst der Vergangenheit hinterlassen hat.4 Wie ein
Ruf nach einer interdiszipliniiren Bildwissenschaft lesen sich seine Worte -
und genau daraufzielte der fast 100-Jiihrige.5
Der vorliegende Beitrag moge als Versuch angesehen werden, diesem Projekt
einen Haustein hinzuzufilgen.6 Im Mittelpunkt,steht die. These, dass in der Ge
schichte der Illusions- und Imrnersionsbildmedien eine Relation, eine Abhangig
keit zwischen den jeweils neuen suggestiven Bildtechniken und den inneren
Distanzierungskriiften dee Betrachter festgestellt wenlen kann. Diese stehen in
einem relativen Zusammenhang und hangen von der fiber die Zeit erwor
benen Medienerfahrung oder -kompetenz der Bildkonsumenten ab.7
Emotionen mochte ich in diesem Zusammenhang mit Wolfgang Lenzen8
und Hermann Schmitz9 als gerichtetes, verkorperlichtes, doch schwer
lokalisierbares Phanomen definieren. Gewiss lassen sich Emotionen teilweise durch Herzschlag, Blutdruck oder AdrenalinausschUttungen nach
weisen oder moglicherweise korrelierte neuronale Aktivitiiten visuell
reprasentieren, was aber letztlich Emotionen sind, entzieht sich weitgehend
der Messung und bleibt als psychisches Phiinomen auf Deutung angewie
sen. Daher zieht diese Untersuchung drei Bild- und zum Teil Tonmedien
der Mediengeschichte heran, um Ubereinstimmungen, aber durch die
Reihung eben auch Unterschiede fassbar zu machen. Aile drei Gegenstiin
de basieren auf den jeweils modernsten und im Sinne des Illusionismus
avanciertesten Bildmedien und -techniken ihrer Zeit; es sind durchweg
Auftragswerke. Die jUngeren zwei beruhen auf Regierungsauftriigen -
wenngleich giinzlich verschiedener Staaten. Nur mit hohem konzeptionel
lem und finanziellen Aufwand konnten die Bildwelten realisiert werden,
die zwei jUngsten setzten zudem generalstabsmiiBig organisierte technischc
Apparate voraus, die zum Erreichen ihrer Botschaft alle Register der Sti
mulans von Emotionen zogen, die in ihrer Zeit bekannt und technisch
moglich waren. Auf dieser Ebene - so die Hoffnung - eroffnet der Ver
gleich zwischen einem religiosen Altarwerk mit einem als Dokumentatioo
deklarierten Gesamtwerk der Propaganda und einem in unserer Zeit als
Spiel geltendes Gesamtkunstwerk suggestiver Werbung ftlr den Kriepdienst fruchtbare Erkenntnisse filr eine historisch ausgerichtete Emotions
forschung. Zugleich spielen damit drei markante medienhistorischc BrO-
264
che. tavolutionlire lnnovationen, eine Rolle: die Erfindung der Perspektive,
die 1eheinbare Bewegung des Bildes (Kinematographie) und die scheinba
re Reaktion des Bildes auf Aktionen der Benutzer (lnteraktion). In der
tflckschau wissen wir um die Verbrechen, die von der Ideologie des NS
'1Jsgingen - Verbrechen, die gewollt oder ungewollt <lurch die Bilderspra
che der Leni Riefenstahl vorbereitet wurden. Umgekehrt ist es uns nicht
ml:lglich, aus der Gegenwart eine Prognose abzugeben, zu welchen Ergeb
nissen die suggestiven Anstrengungen filhren, die in Verbindung mit dem
Genre der Kriegssimulation und damit z.B. dem Computergame America's
Army stehen. Sicher scheint allein, dass die visuelle Potenz, die emotionale
Stimulanz und die ideologische Autladung wenig Gutes verheiBen.
Der Jsenheimer Altar
Heute noch bewirkt der Isenheimer Altar mit seiner grauenhaften Vision des
Gekreuzigten einen bedr!ingenden Eindruck und es bedarf einiger Minuten,
um Abstand von den Emotionen zu finden, die das mitreiBende Bilderlebnis
in uns hervorruft. Grunewalds Passion, sich aus einer langen Tradition ent
wickelt hatte, wurde als Schnittpunkt zwischen der Geisteswelt des ausge
henden Mittelalters und der beginnenden Renaissance charakterisiert.
Fast ganzlich entzieht sich das Leben des Matthias Grunewald unserer
Kenntnis10, sicher istjedoch, dass sein zwischen 1512 bis 1516 geschaffener
Fliigelaltar unter Einsatz aller verfiigbaren Kenntnisse und Bildtechniken
seiner Zeit entstand. Dieses Streben nach Illusion zur Flirderung emotionaler
Wirkung wird uns in den anderen Gegenstiinden, die inhaltlich mit dem Altar
nichts zu tun haben, wieder begegnen. Jener ist ein Amalgam christlicher,
humanistischer und alchimistischer Symbolik, welcher die Zeit wie in einem
Brennglas fokussiert - ein Schlagbild im Sinne des Wortes.
Im Zentrum, weit iiber seine Proportionen hinausweisend, hangt schwer
und riesenhaft Christus, seine ·Last spannt den Querpfahl wie eine Arm
brust - eine emotionale Visualisierung, die in ihrer Zeit ihresgleichen
suchte (Abb. I). Grunewald erschafft einen graugrtln-fahl gl!inzenden,
geschundenen Leib, hager-sehnig und verkrampft, nahezu zerfetzt, iibersat
mit otfenen Wunden und gespickt mit domigen Rutenspitzen. Und Grune
wald war ein wahrer Farbenmagier, der die Szene durch die Lichtfiihrung
265
Abb. 1: Mathias Gronewald, lsenheimer Altar, um 1513-1516, Hilhe mu. 355 cm, Gesamtbrelte In geschloSJenem Zusland 498 cm, Brelte der beweglkhen Flllgel lnsge1. 295 cm, Colmar, Musee des Unterllnden
expressiv weiter zu steigem vennochte. Lebendig noch mtlndet der emiedrig
te Christuskorper in ein Knauel Obereinander geschlagener Ftll3e, an <lessen
blau geflirbten Zehen augenscheinlich die Verwesung bereits eingesetzt hat.
Aufgabe des in der Isenheimer Kirche des Krankenpflegerordens der Antoniter1 1 aufgestellten Altars war es, dies ist in der Forschung unstrittig, durch die
visuell-magische Verbindung zu Christus filr Infizierte von Pest und Antonius
feuer Heilung zu bewirken oder zumindest, den Sterbenden durch die Hoff
nung aufbaldige Auferstehung ihr Los zu erleichtem. So berichtet die Oberlioferung der Zeit, dass die Begegnung mit den Bildem wiederholt Heilungen
bewirkte wie sie das Mittelalter sonst etwa in der Beriihrung bedeutendct
Reliquien suchte.12 Traditionsgemlill wurden die Kranken daher in der Hoff·
nung auf ein Wunder vor den Altar gebracht, dem mithin therapeutische Funk·
tion zugeschrieben wurde. Erst im Anschluss daran erhielten die Krankelt durch die Ordenslirzte auch medikamentose Behandlung.13 Noch vor der Me-
266
dizin rangierte mithin der Glaube an den wundertlitigen Chrisn1s und die me
diale Verbindung des Bildes, das, um physische Heilung auszu!Osen, die Kran
ken im Innersten emotional bertlhren musste. Entgegen der in Karlsruhe aufbewahrten, grausigeren Version, die den Kar
per noch starker entstellt, ihn verkrampft und ungleich menschlicher wieder
gibt, ist der Christus von Colmar ein erschlaffier Schrnerzensmann. Das traditionelle Gedr!inge von Kriegern und Schaulustigen ist aus dem Bild getilgt. Um
das Kreuz stehen, ungleich kleiner, Johannes, eine auBergewohnlich schone
und junge Madonna, die weiB gekleidet und verschleiert, totenblass, mit offenem Mund. einer Ohnmacht nahe dasteht und Maria Magdalena. Wahrschein
lich ist, class das Programm auf ein enges Zusammenwirken Grtlnewalds mit dem Auftraggeber Guido Guersi zurilckgeht, dem Abt des Klosters, in dessen Kirche das Bild aufgestellt werden sollte. Wie jedoch der KUnstler die Umset
zung entwickelte, ist in hohem MaBe innovativ und war sicher nicht Gegenstand des Auftrags: Die engen Raumbegrenzungen !assen das groBe Bildformat eine ilbeiwiiltigende Wirkung entfalten. Die Frontalitiit, das Vorziehen der
Szene bis zur Rahrnenschwelle, zwingt uns in eine planmiiBige Untersicht, die
den Betrachtem das dramatische Geschehen korperlich annlihert und eine distanzierte Rezeption nahezu unmoglich macht. Der Hintergrund, die Tiefe
der Landschaft, wird im Augenblick des Obertritts vom Leben in den Tod von einer Sonnenfinstemis verdunkelt, so dass wir der biihnenartigen Niihe des
dramatischen Geschehens kaum zt1 entgehen vermogen. Immer wieder wurde der Altar mit dem Antoniusfeuer in Verbindung ge
setzt, dem ignis sacer, einer der verheerendsten Seuchen des Mittelalters. Mit
schneidendem Brandschrnerz tlberzog dieses die Gliedmassen, bis <las erkrankte Glied unter bedrilckendem Kl!ltegefilhl abstarb. Die Erlosung im Tod, in der Auferstehung, mag, um dem inneren Feuerschmerz zu entgehen, herbeigesehnt
worden sein. Nahezu fotorealistisch, als Attribut der Welt der Kranken, rl\ckt
Grunewald gleich unter dem Gekreuzigten das GefaB mit der legendiiren Medizin der Antoniter14 zentral ins Bild. Die Heilungs- und Auferstehungskrlifte, die
dem Elixier nachgesagt wurden15, gewann es durch Berilhrung mit den Gebei
nen des heiligen Antoniui;, Uber dje es gegossen wurde. Insbesondere die De
tailstudien, mit denen einfilhlsam die Krankheit wiedergegeben wurde, sind durch Chronikbefunde und ein Wiederauftlackem der vergessenen Krankheit in den I 950er Jahren in Siidfrankreich bis in Einzelheiten bestiitigt worden.16
So wie Chrisn1s die Leiden der Welt auf sich nahrn, so zog Antonius die
267
Krankheit seiner Pfleglinge auf sich. Im Hauptmotiv des Altares, der Mensch
werdung von Christus im Moment der Erlosung, findet sich die visuelle Ent
sprechung zu Bedeutung und Sinn des Hospizes.
Auf der Rilckseite des Altars entsteigt dem Sarkophag geheilt und leuchtend,
· machtvoll und prlisent, Christus, einer Sonne gleich. Zeit- und raumlos schwebt
er in der sternilbersiiten Nacht- ilbrig sind einzig die Wundmale, die nun selbst
zum Quell des Lichts der Auferstehung werden. Grunewald hat am Beispiel der
darunter zu Boden gegangenen Soldaten virtuose Experimente mit der dritten
Dimension angestellt, die jenen Paolo Uccellos kaum nachstehen. Detailgenau
erstreckt sich Grilnewalds Realismus von Engeln bis zu grandiosen Diimonen
und Ungeheuern, die trotz ihrer Fantastik natilrlicher Zoologie zu entstammen
scheinen. Die Betrachter werden »ins Bild« versetzt, so dass uns die Kreuzi
gung mit »einer unentrinnbaren Eindringlichkeit umklammert«17• Diese immersive Gestaltung steigert in Verbindung mit der starken Untersicht und
ihrem einzigartigen Realismus die emotionale Wirkung.
Film a/s suggestives Medium
Obgleich die Lenkung der Zuschauergefilhle letztlich ilber den Erfolg von
Filmen entscheidet, ist die Frage, wie Filme bei ihren Zuschauem Emotionen
erzeugen, erst in den letzten Jahren verstiirkt thematisiert worden. 18 Dabei
waren die Pfade, auf denen <las Massenmedium Film in die Bildgeschichte
eintrat, von Beginn an diesem Ziel verpflichtet: Auf der Weltausstellung von
1894 wurde der Offentlichkeit das Stereopticon vorgestellt, das mit Hilfe von
16 Diaprojektoren rasch und sukzessiv Rundbilder zu projizieren vermochte.
1900, im Cineorama (Abb. 2), verschmolz <las alte Medium Panorama mit
der neuen Technologie des Films: Das Cineorama, zuerst auf der groBen
Pariser Weltausstellung priisentiert, war ein Hybridmedium, das zehn syn
chron gezeigte 70-mm-Filme zur geschlossenen 360°-Bildform vereinigte
und die Betrachter mit bewegten Filmbildern eines Ballonaufstiegs vom
Marsfeld in einer illusionierten Gondel konfrontierte und in Aufregung
versetzte. 19 Dberdeutlich erschien zun!ichst noch die Niihe zum Panorama,
<lessen weiB ilbertilnchte Rotundenwiinde20 als Priisentationsort dienten und
die <las Geburtsszenario des Films zugleich in die Niihe immersiver Bildriiu
me rilckten. Die Weltausstellungen, die bis heute ihre Besucher mit dem
jeweils aktuellsten Bildmedien emotional adressieren, pressten das neue
Medium mithin in cine symbolische Form, die jeder distanzierten Rezepti
onskultur entgegen stand.
Abb. 2: Das Clneorama auf der Weltausstellung von 1900 In Paris, Klnematographlsches Panorama, Konstrukteur: Raoul Grlmson-Sanson
Im Fokus der Kinematografie standen anfangs kleinste Sujets: Der Auf
schlag von Wellen auf den Strand, wiegende BHitter im Wind oder die
Einfahrt eines Zuges. Als untrennbare Verflechtung von Legende und
Sensationsreport erscheinen die Berichte um die ersten Vorftlhrungen von
Auguste und Louis Lumiere. Wie zuvor das Panorama, setzte der Film zur
Verdeutlichung seines Medienpotenzials zunlichst auf eine Verdoppelung
des in der Welt Erfahrbaren. Arrivee d'un train von 1895 veranlasste die
Zuschauer, so zahlreiche Dberlieferungen, Zll Panik, besrtlrzter Flucht, gar
Ohnmacht.21 Maxim Gorki, der im Sommer des folgenden Jahres den
Cinematographen Lumiere in Novgorod erlebte, publizierte seine Eindrtlk
ke im Feuilleton: »Auf der Leinwand erscheint ein Eisenbahnzug. Er rast
wie ein Pfeil direkt auf Sie zu - Vorsicht! Es scheint, daB er direkt auf die
Dunkelheit zusrtirzt, in der Sie sitzen, und aus Ihnen einen zerfetzten Sack
aus Haut macht, angeftlllt mit zerquetschtem Fleisch und zerrnahlenen
Knochen, und daB eF diesen .Saal in Schutt und Asche verwandelt und
dieses Haus zerstlirt.«22 Derartige Emotionen waren mutmaB!ich Resultat
des erstmals wahrgenommenen Effekts der Dbereinstimmung von Kame
raobjektiv und Betrachterauge, den James Gibson in seinem Ansatz zur
okologischen Wahrnehmungstheorie Uber achtzig Jahre spater beschrieb.23
269
Aus heutiger Sicht erscheinen uns Reflexe dieser Natur auf schwarzweiBe
Stummfilmbilder kaum nachvollziehbar, rUckblickend allenfalls durch die
Neuartigkeit des Illusionsmediums und sein noch ungekanntes temporiir
wirksames Suggestionspotenzial erkHirbar. ~er Film ,traf beim Publikum
aufunvorbereitete Wahrnehmungsapparate und ein Bewusstsein, das nicht
auf die Verarbeitung bewegter, simulierter Bilder vorbereitet war. BerUck
sichtigt man jedoch die llhnlich drastischen Reaktionen, welche die ersten
Panoramen bei ihren Rezipienten ausgelOst hatten, und bedenken wir
weiterhin die Uberlieferte Kette immer neuer Bildsuggestionen, die aus den
Innovationen kunsthistorischer Illusionsmedien resultierten, so wird die
iiberraschende Wirkung des neuen Bildmediums, welches die nicht filmso
zialisierten Seher getlluscht und ihre innere, psychologische Distanzie
rungskraft kurzfristig Uberwllltigt hatte, in einem relativen Zusammenhang
erkennbar. Diese Erkenntnis ist filr eine komparatistische Immersions- und
Emotionsforschung von zentraler Bedeutung. Die Korrelation zwischen
technisch gestalteter Illusionsinnovation und bedrllngtem inneren Distan
zierungsverml!gen kann filr einen gewissen Zeitraum, der sowohl vom
Suggestionspotenzial des neuen Illusionsmediums als auch von der indivi
duellen Disposition der Betrachter abhllngig ist, bewusst erfahrene Illusion
in unbewusste wandeln und dem Schein die Wirkung des Realen verlei
hen. 24 So offnet sich bei Einftlhrung eines neuen Illusionsmediums die
Schere zwischen bildlicher Wirkungsmacht und reflektiert bewusster Di
stanznahme, die sich nach stetem, bald ilberlegtem Umgang wieder ver
engt. Gewl!hnung schleift die Illusion ab, diese besitzt bald nicht mehr die
Kraft, das Bewusstsein zu bestechen, wird endlich schal und findet gegen
Uber ihrer tliuschenden Funktion abgestumpfte Betrachter. Ein Kompetenz
schaffender Umgang mit dem Medium scheint mithin Voraussetzung filr
inhaltlich-reflexive und kUnstlerische Verwendung, bis dieser souverine
Umgang schlie.Blich durch ein neues Medium von Mherem Sinnenreiz und machtvollerem Suggestionspotenzial unterbrochen wird und die Betracbter
emeut in den Bann der Illusion eingescblossen werden. Dieser Mechania
mus, das Wechselspiel zwischen neuen Illusionsmedien und Distanzio
rungskrliften manifestiert sich in der europliischen Kunst- und Mediengo
schichte seit dem ausgehenden Mittelalter mit BrUchen und Umwegeo
immer wieder. Wir betrachten historische Illusionsmedien auf der Basis
270
unserer gewachsenen Medienkompetenz der Gegenwart und empfinden ihr
Buggestionspotential oftmals als gering, was jedoch keineswegs den Erfah
nmgen der zeitgenOssischen Betrachter entsprechen muss. Es ist anzuneh
men, dass aufgrund der geringeren Vorerfahrung das Suggestionspotential
und damit der emotionale Stimulus historischer Illusionsmedien oftmals
st!rker wirken konnte, als jene Medien dies heute vermuten !assen. Diese
Wirkungsrelativitlit der Illusionsmedien hlingt folglich von der medialen
Vorerfahrung der Betrachter ab.
Ein so heterogenes Medienfeld, wie es unter dem Begriff Film subsu
miert wird, verschlieBt sich dem Versuch einer allgemeinen Definition.
Filmgeschichte bedeutet permanenten Wandel und es scheint, als sei Film
geschichte vie! eher zwischen den Hunderttausenden von Filmen aufzusu
chen als in prlizisen und noch so reflektierten Einzelanalysen. Schlicht
unmOglich ist es, ein homogenes Obersichtsbild von dem, was Film ge
nannt wird, festzulegen. Dennoch soil hier der Charakterisierung Andrey
Tarkovskys gefolgt werden, der den Film als »emotionale Realitiit« defi
nierte, die den Zuschauer mit einer »zweiten Realitiit« konfrontiere: »A
film is an emotional reality, and that is how the audience receives it as a
second reality. The fairly widely held view of cinema as a system of signs
therefore seems to me profoundly and essentially mistaken.«25 Kino sei auf
unmittelbare sensuelle und emotionale Perzeption angelegt, die dem Regis
seur unweigerlich Macht Uber die Gefilhle der Zuschauer eintrage und in
manchem Filmschaffenden gar die unbewusste Selbsttiiuschung eines
Demiurgen hervorrufe. Diese suggestive Energie des Films ist es, die
Macht des Bildmediums mitsamt seinem immersiven Potenzial, aus der
dem Regisseur und dem Techniker Verantwortung erwiichst.
Eine solche Perspektive erst, ein ikonisches Filmverst!indnis, erkliirt die
immer wieder konstatierbaren polysensualistischen Bestrebungen der Film
geschichte. Diese folgen der Grundtendenz, die Illusionsfunktion der Bilder
auszuweiten und vom Auge auf andere Sinne zu lenken. So !asst das Medium
Film Uber das gesamte Jahrhundert in immer neuen Anlliufen den Versuch
erkennen, die 2-D-Leinwan~projekti.on zu Uberwinden, um die Suggestions
wirkung auf die Betrachter zu intensivieren: Bereits in den Zwanzigerjahren
hielt in den Vereinigten Staaten mit dem Film Teleview (1921) das 3-D
Format Einzug.26 Farbige Lichtprojektionen, die durch Zweifarbglliser be-
271
trachtet wurden, schufen rliwnliche Eindrilcke.27 Auch Abel Gances epocha
ler Film Napoleon (1926/27) sah zunllchst 3-D-Segmente vor: Stlirker noch als der eindrucksvolle panoramatische Effekt, der von bis zu drei simultan bespielten Leinwiinden herrUhrte, wurden bei intemen Vorfllhrungen die 3-
D-Szenen als zu ilberwllltigend empfi?nden. U~ den Gesamteindruck des 2-D-Filmanteils nicht zu sehr zu schmlllem, sah sich Gance schlieBlich ge
zwungen, die rliumlichen Passagen wieder herauszuschneiden. 28
Oberraschendeiweise geh6rt auch Sergej M. Eisenstein zu den Visionllren neuer Illusionskunstmedien. Aus der Perspektive der Vierzigerjahre bewerte
te er den Film als <las h6chste Stadium der Kunstentwicklung. In dem kurz
vor seinem Tod verfassten Aufsatz Ober den Raum.film (1947) zeichnete
Eisenstein die Vision einer unmittelbar bevorstehenden Revolution des Kinoerlebnisses: Das kilnftige, als »reale Dreidimensionalitlit« empfundene
Bild - technische Erklllrungen bot Eisenstein nicht - ergiejJe sich aus der Leinwand in den Zuschauerraum.29 »AuBerste Notwendigkeit« erwachse in diesem Zusammenhang dem Raumton. 30 Dieser ermogliche der Regie, die
Zuschauer »gefangenzunehmen«, und umgekehrt dem Publikum, »v611ig in
die Klanggewalt [ .•. ) einzutauchen.«31 Bereits 1940 hatte Eisenstein, inspi
riert durch Walt Disneys Fantasia, die Idee, das Kinopublikum mit Lautsprechem einzukreisen. Keine Silbe verwendet der sowjetische Regisseur auf
einstige Kemaussagen, wonach Ton und Bild als voneinander unabhiingige Montageelemente zu verstehen seien. Was Eisenstein hier mit Worten, die keinen Widerspruch zulieBen, vorzeichnete, war keine virtuelle Realitlit im
Sinne panoramatischer Bilder. Nichtsdestominder prognostizierte er filr <las Bild ein ungekanntes Potenzial an Plastizitlit und Bewegung - eine Potenz und BUndelung, die den Zuschauer im Raumfilm psychologisch aus seiner tatsllchlichen Umgebung in diejenige der Bildwelt fort trUge. Vokabeln des
Distanzverlustes wie eintauchen, gefangennehmen, hereinbrechen, ergiejlol deuten unmissverstlindlich auf die Kemidee - die Erwartung, schon bald den
Besitz eines Mediums zu erlangen, welches die Wahmehmungsapparate und das Bewusstsein der Zeitgenossen in einer Immersion mit dem Bild ver
schmelzen konne: »Und <las, was wir bisher als Bild auf der Leinwandt11cbo zu sehen gewohnt waren, >schluckt< uns pl6tzlich in eine fiiiher nie erbliclde, hinter der Leinwand sich auftuende Ferne, oder es >dringt< in uns mit einer
nie so ausdrucksstark realisierbar gewesenen >Heranfahrt<.«32
272
Triumph des Willens
zwolf Jahre vor Eisensteins Publikation entstand eines der bedrilckendsten
Zeugnisse kalkulierter Produktion von Emotionen durch Bildmedien. Triumph des Willens ist in fast der gesamten Literatur mit dem Etikett »wir
kungsmllchtigster Propagandafilm des 20. Jahrhunderts« versehen. »Im
visuellen Bereich« - so der Zeitgenosse Siegfried Kracauer - »wird viel
davon Gebrauch gemacht, dass Bilder direkt unser Nervensystem anspre
chen. Viele Mittel werden nur eingesetzt, um beim Publikum bestimmte
Emotionen wachzurufen.«33 Fiir Leni Riefenstah134 war Triumph des Willens nach Sieg des Glaubens von 1933 bereits der zweite Film Uber einen Reichs
parteitag. Ats Dokumentation deklariert, wurde der Film von der NSDAP
produziert, die zudem in beispielloser Weise die Regie bei den Dreharbeiten
unterstlltzte. Leni Riefenstahls Diktum: »Noch nie in der Welt hat sich ein
Staal derartig filr einen Film eingesetzt«35 stimmte. So bestand das Kemteam
aus 170 Mann, darunter allein 35 Kameramiinner und -assistenten. Um den
reibungslosen Ablauf der Dreharbeiten zu unterstiltzen, stellten SA und SS
hunderte von Ordnem, um Parteiapparat und filmischen Apparat eng zu
verschalten.36 Belichtet wurden insgesamt 128.000 Meter Film37, so dass zur
Veriirgerung von Goebbels die Wochenschau ihr Filmmaterial abzugeben
hatte und Uber Wochen nicht produzieren konnte. Das Bildmaterial wurde
noch um das der intemationalen Wochenschauen ergiinzt, das Riefenstahl zur
Verfilgung gestellt erhielt.38 Das Endergebnis umfasste lediglich ein FUnfzig
stel <lessen, 113 Minuten Tonfilm, der in einer ausgreifenden Pressekampa
gne propagiert wurde und <lessen Besuch durch die Parteifilhrung zur »Eh
ren-Bilrger-Pflicht« erhoben wurde. Zeitgleich in Uber 70 deutschen Stiid
ten39 lief Triumph des Willens im Verleih der UFA im April 1935 als insze
nierter Staatsakt an, wurde bis in die hintersten Winkel Deutschlands verbrei
tet und verzeichnete mit Uber 20 Mio. Besuchem Rekordergebnisse - Zahlen,
mit denen Filme unserer Zeit nicht konkurrieren kllnnen. Bemerkenswert
erscheint, dass zur BefOrdenmg eines immersiven Erlebnisses viele Kinos
schon im Eingangsbereich mit dioramatischer Parteitags-Szenographie aus
gestaltet wurden und' durch Musik, Reden und den Verzicht auf ein Beipro
gramm die emotionale Wirkung bei den zeitgenossischen Betrachtem zusatz
lich befOrdert wurde (Abb. 3).
273
Abb. 3: Szeoographle an der Fassade des UFA Palastes am Tag der Premiere von Triumph des Willens
Ziel des Kinoerlebnisses war es, den Zuschauer in dauerhafter Ergriffenheit
und Begeisterung zu halten, ihn zu flberwliltigen und einzuschtlchtem, um
seine Zustimmung zu organisieren und zu stabilisieren. Riefenstahl selbst
beschrieb ihre Aufgabe folgendermal3en. »Zwei Millionen konnen sich wohl
in Nflmberg, der Stadt der Reichsparteitage versammeln, 60 Millionen Deut
sche sollen Zeuge werden dieses gewaltigen Aufmarsches, nacherleben und
mitfilhlen das Aufwilhlende dieser Kundgebung.«40 Und weiter heil3t es zur
Wirkung: »lch habe den Film so gestaltet, dass er den Horer und Zuschauer
von Akt zu Akt, von Eindruck zu Eindruck tlberwiiltigeoder emporreilll Die
innere Dramatik solcher Nachgestaltung ist da, sobald das Filmmaterial von
Nflmberg geformt ist. Sobald sich Rede und Sentenz, Massenbild und K6pfe,
Mll.rsche und Musiken, Bilder von Niimbergs Nacht und Morgen so sinfo
nisch steigem, dass sie dem Sinn von Ntlmberg gerecht werden.«41
Diesem Ziel folgend liisst Riefenstahl die zeitliche Strukturierung des filmischen Parteitages von der historischen abweichen: Tatsiichlich erstreckto
sich die Veranstaltung Uber sieben Tage, wohingegen d!'lr Film ein artifiziel• les Zeitkontinuum von drei Tagen bildet, welche jeweils durch eine nachtli•
che Veranstaltung klar voneinander unterschieden werden und in Filmstati°'
274
nen, die vom Anflug Hitlers bis zur Abschlussveranstaltung des Parteitages
reichen, unterteilt ist. Es flillt auf, dass Triumph des Willens weder die Erei
gnisse des Parteitages kommentiert, noch Angaben Ober Veranstaltungsver
lauf, Teilnehmerzahlen oder einzelne Programmpunkte macht, nicht einmal
Zeitangaben oder Ortshinweise werden dem Zuschauer angeboten. Die
Handlung konstituiert die Regisseurin aus einer Folge von UmzUgen und
Aufmllrschen, Begrilflungsritualen, Redeausschnitten und genrehaften Stim
mungsbildern. Der zeitlichen Verdichtung entspricht die riiumliche Zusam
menfassung der Veranstaltungsorte ztl den idealen SchaupHitzen Strasse,
Halle und Feld, obgleich der Film keine riiumlichen Begrenzungen andeutet
und damit zugleich einen Etfekt von Unendlichkeit und Uberzeitlichkeit
erzielt. Der hohe symbolische Wert der alten Kaiserstadt in seiner Mischung
aus politischen, sakralen, volkstilmlichen und militiirischen Elementen wurde
bekanntlich vom NS kalkuliert ausgespielt und Nilmberg zur Fassade redu
ziert, aus der Alltag, Industrie und Wohnquartiere ausgespart wurden, wiih
rend sic <lurch arrangierte Bildsymbolik, Autofahrten und Aufmiirsche mit
einem pseudosakral inszenierten Hitler verschmolzen wurde.
Riefenstahl zeigt die Volksmasse nicht vollstiindig anonymisiert, d.h. als
pures Ornament der Masse. Immer wieder werden einzelne Physiognomien
hervorgehoben, die im Sinne der Rasselehre zt1meist unter massivem
Lichteinsatz als arische Profile oder als Heroen aus Untersicht gefilmt
werden. Besonders die tief emotionalen, ja im Gegenschnitt mit Hitler
erotisch aufgeladenen Frauengesichter spiegeln die Hingabe und dienen
den Zuschauem als Projektionsfliichen ihrer eigenen Attraktion. Bemer
kenswert ist, dass Riefenstahl niemals Personen zeigt, die direkt in die
Kamera blicken. Durch die Bewegung des Kameraauges erscheint der
Raum, dies bestiitigt auch der Zeitzeuge Panofsky, dynamisiert.42 Mit Hilfe
der Montage, bzw. einer extensiv genutzten Gegenschnitt-Technik, werden
artifizielle Blickbeziehungen hergestellt, die sich fast ausschliefllich auf
Hitler konzentrieren. Riefenstahl verstiirkt und iiberhoht die Ikone Hitler in
mythischer Weise. Mehr noch - <lurch cine Kamera, die ihr Objekt um
kreist, steigert sic d~ssen Pr~senz und schafft den Eindmck, der Fiihrer
konne Uber die unmittelbare visuelle und akustische Anwesenheit im Film
hinausgreifen.43 Uns Heutigen selbstverstiindliche und weitaus rasanter
begegnende emotionale Gestaltungsmittel wurden (inspiriert <lurch sowje-
275
tische Regisseure) erstmals in dieser Intensitlit von Riefenstahl eingesetzt.
Insbesondere diese filmische Engftlhrung der Personen wurde von den
Zuschauem als tiberwiiltigend geschildert. Gleichfalls spektakuUlr wurden
die aus groBer HCihe gemachten Aufnahmen empfunden, die etwa bei der
Totenehrung (Abb. 4) den Zuschauem einen weiten Blick Uber die 160.000
in schweigenden Karrees angettetenen SA-Minner verschaffte.44 In ihrer
roboterhaften Synchronizitllt - derartige Aufnahmen entstUnden heutzutage
als Computeranimation - werden die geometrisierten Massen durch immer
neu variierte Aufnahmen zum Trliger des Rituals. Die schier unendlichen
Gliederungen, Reihungen und Wiederholungen schufen einen bislang
ungesehenen Ausdruck autoritllrer Lenkung, der auch visuell die Uber
macht Hitlers klarstellte. Umgekehrt ermCiglichte erst der Film dem Zu
schauer, der auf dem Parteitag Hitler als winzige Figur aus der Ferne erleb
te, den FUhrer in starker Untersicht leinwandftlllend zu erleben. Die weiten
R!iume des speerschen Parteitagsgel!indes, von Stadt, Firmament und
raumloser Nacht rufen zudem auch heute noch fast zwangslllufig die bur
kesche Kategorie des Erhabenen auf und auch den daraus resultierenden
Schauder.45 Die Massenrituale des NS und ihr totalitilrer Hintergrund
erscheinen uns heute abgeschmackt, die »omamentierte Masse«, die sym
bolische Form des Totalitarismus, wie sie in den 30er Jahren auch in Un
dem Anziehung entfaltete, die weitgehend demokratisch blieben46, lost
heute sogleich AbstoBungseffekte aus, stellen sich doch reflexhaft vor
unserem inneren Auge Bilder von Auschwitz ein. Die tatsilchliche Wir
kung des monumentalen Films auf seine Zeitgenossen ist aufgrund der
propagandistischen Nutzung der Presse letztlich nicht in vollem MaBe zu
ermessen47, doch ist die kritische Beschllftigung zahlreicher in die Emigia.
tion gezwungener Wissenschaftler und Kililstler, mit der machtvollca
Wirkungskraft, die der Bildpolitik des NS zugeschrieben wurde, bereits
Indiz genug.48 Auch viele Stimmen irn Ausland, das totalitllre Bildwelteo
aus Italien oder der Sowjetunion kannte, konnten sich anfangs noch nicht
eindeutig distanzieren.49 Durch die Formel »Schauder und Idylle« der Psychotherapeutin Gudrun Brockhaus nicht vollstllndig erfasst. stellte
Riefenstahl die durch die Krisen der Weimarer Republik immcr noch
diffuse Geftlhlswelt der meisten deutschen Kinozuschauer vor eine un-
276
Abb. 4: Trl11111ph da Willens, GroDappell der SA, Totenehrung
missversUlndliche und brutale visuelle Alternative: Marschiert mit uns, gebt uns
Bahn und euch geschieht nichts - stellt Ihr Euch aber gegen diesen »Volkskfir
per«, so werdet ihr beseitig - der Fememord an Rfihm war noch frisch.50 Die
mediale Botschaft zielte mi thin auf Euphoric, bis hin zu Omnipotenzgefilhlen
bei NSDAP-Anhiingern und Einschllchtenmg bei denen, die anderes wollten.
Unter diesen Konditionen ging es nicht mehr um Inhalte oder Verantwortung,
sondem einzig um Selbstaufgabe, die sich selbst Inhalt genug zu sein hatte.
Der Film sollte die polysensuelle Immersion des Parteitags durch seine
technischen Mittel nachbilden, ja dem Kinobesucher erstmals emotionale
Machtphantasien verschaffen, die in dieser Dichte von keinem Parteitagsbesu
cher erfahren werden konnten. So erscheint die Kamera omnipriisent, stilisie
rend und massiv an der Verwischung von Realem und Imaginiirem beteiligt:
Ungeplantes und Banalitllten, die filr eine Veranstalrung dieser Dimension
typisch sind, wurden vollkominen ausgeblendet. Erst das technische Reper
toire des Films, mit Zeit- und Gegenschnitt, Oberschau, Lichtregie und die
permanente Montage von Massen oder Individuen mit Close Ups von Hitler,
dessen einsrudierte, demagogische Suggestionsmacht auf diese Weise voll zur
Gelrung kam und mit Wochenschaukonventionen brach, vermochte den
277
gewilnschten suggestiven, beute wilrden wir sagen »immersiven Eindruck« zu erzeugen. Ein Gesamtkunstwerk, das Bildkomposition, Choreographie, Musik, Architektur, Lichtfilhrung, Drama und bewegliche Kamerafilhrung im Dunkel des Kinosaals zu einer totalen Erfahrung verschmolz und mtiglicherweise das emotionale Erlebnis des Parteitags noch verdichtete.
Wenngleich sich der Film den Anschein gibt, mit der Originalmusik der Festakte zu arbeiten, wurde die Musik doch tlberwiegend im Studio syncbronisiert. Mlirsche von Herbert Wind, der spllter Olympia vertonte, rhythmisieren die Zuschauer und steigem die suggestive Wirkung der Leinwandereignisse zugunsten einer Schwlichung kritischer Distanzierungskrlifte. Hitler selbst werden Wagner und das Stakkato des Badenweiler Marschs zugeordnet. Als Hauptdarsteller beherrscht Hitler etwa ein Drittel der Filmbilder; frontale GroBaufnabmen zeigen ihn in unge"."ohnlicher Nlihe oder extrem Oberhtiht, ein Effekt, der durch die stark untersichtige Anbringung damaliger Kinoleinwlinde noch verstlirkt wurde. Fast die gesamte erste Hiilfte des Films wird darauf verwendet, Hitlers Erscheinen vorzubereiten. Das »Wir wollen unseren Ftlhrer sehn« entbehrt filr uns Heutige nicht einer makaberen Komik, diese Handlungsfilbrung steigerte jedoch <lurch das hinausgeztigerte Erscheinen des Ftlbrers den Spannungsbogen immer weiter, so dass Hitler schlieBlich zum leinwandbeherrschenden Akteur gesteigert werden konnte.
Aus emotionaler Perspektive bewirkt der monumentale Rahmen, je nacb ideellem Standpunkt der Betrachter, eine einschtlchternde, feierlich-bedrtlck~ ja erhabene Gefiihlslage und reiht sich damit in Hitlers Theorie zur Propag~ da: »Gerade darin liegt die Kunst der Propaganda, class sie, die gefilhlsmliBiF Vorstellungswelt der gro&m Massen begreifend, in psychologisch richtiger Form den Weg zur Aufinerksamkeit und weiter zum Herzen der breiten Masae findet.«51 Oberzeugungsarbeit hatte primlir mit sensuellen, d.h. vor allem oplischen und akustischen Mitteln geleistet zu werden. Wie wir wissen, war es Hitler selbst, der die Grundlagen des praktizierten Propaganda- und Demonstrationsstils entwickelte. Als tlberzeugter Leser von Gustave Le Bons Psycho
logie der Massen erlcannte er in der Rede das wichtigste Agitationsinstrumlll!lll sab und ihren nachhaltigsten Wirkungsort in der Massenversammlung. Uod so hatte Hitler, von dem auch der Titel des Films stammte52
, die Schneidearbeilel Riefenstahls verfolgt.53 Im Film wird er selbst als »Medium« in Szene gesetzt, das expressive Worthtllsen formuliert und, so die medienideologiscbe Vorsdlung, dem Volkswillen Kanai und Ausdruck verschaffi.
278
Riofenstahls Film bringt das Ftlhrerprinzip visuell auf den Punkt. Volk
und Partei werden tlber ihr Bekenntnis bedingungsloser Treue und Gefolg
schaft aufHitler bezogen und visuell zu einem Volkskorper verschmolzen,
der sich der Autorit1it zu unterwerfen hat. Die Monumentalit1it zeigt sich
ftlr denjenigen bedrohlich, der seine rationale individuelle Perspektive
nicht der Emotionen produzierenden Bilderwelt anvertrauen will.
America's Army
Mit einem Jahresumsatz von Uber l 0 Mrd. Dollar Uberflilgelte die Compu
tergame-Industrie in den letzten Jahren Hollywoodfilm und Musikindustrie
und stieg nahezu unbemerkt zur globalen Nummer I der Bildproduktion
auf. Wohl niemals zuvor lie!! sich Krieg so aufwendig und scheinbar so
realistisch trainieren wie in der Computersimulation, womit wir in das
Bild- und Medienfeld der Gegenwart eintreten: Mit America's Army hat
erstmals ein Staat die Produktion eines Computergames der Popularkultur
mit brillanter Graphik zum Zweck strategischer Kommunikation mit der
l>ffentlichkeit in Auftrag gegeben und <lurch ein neugegrilndetes Institut
realisiert. Das Milit1ir der Vereinigten Staaten adressiert mit AA die mitt
lerweile in die Millionen gehende Zielgruppe von Spielern. AA ist ein
Recruting Game, das vom Modeling, Simulation and Virtual Environments
Institute (MOVES) der Naval Postgraduate School in Monterey mit einem
staatlichen Budget von 45 Millionen Dollar realisiert wurde und insbeson
dere Teenager mit hohen technischen Fahigkeiten ansprechen soil. Ein
Ego-, vielmehr Teamshooter, der realistischen Kampf, ja eine ganze Lauf
bahn beim Militar wird simuliert (Abb. 5).
Stand vor wenigen Jahren das Internet noch fiir einen utopischen Raum,
so entwickelt es sich mittlerweile zur telematischen Erweiterung des exi
stierenden offentlichen Raumes und schreibt Machtverhaltnisse der physi
kalischen Sphiire in audiovisueller Kommunika~ion fort. So bietet die
Army nicht nur den kostenlosen Download, es werden zudem die Treffer
quoten der virtuellen Krieger registriert. Die raffinierte Informationsarchi
tektur eroffuet detailgenaue statistische Auswertung des Kampfverhaltens
und mi.!ndet konsequenterweise in das Online-Recruting.
279
Abb. 5: America's Army, Scr11enshot, Nacbtslcbtgerflt, 2005
Festzuhalten ist, class America's Army eine ganze Welle von Computer
spielen reprlisentiert, deren millionenfacher Absatz, so Timothy Lenoir,
auch aus einer neuartigen personellen und finanziellen Verbindung zwischen Unterhaltungsindustrie und Militllr zum »Military-Entertainment
Complex« resultiere, dessen Budgets mittlerweile ttber 10% der nicht
geringen R1lstungsausgaben der Vereinigten Staaten ausmache.54
Die Entwicklung von Computergrafik, Netzwerken und kilnstlicher In
telligenz wurde in den letzten 30 Jahren stets von den Erfordernissen mili
tiirischer Trainings- und Simulationstechnik angetrieben, aus der zugleic
eine sich ubiquitllr ausbreitende Popkultur entstand.
Mit welchen neuartigen suggestiven Komponenten jedoch erzeugt Amerk
ca's Army emotionale Erregungszustiinde? Charakteristiken des Spiels sind
realistische militllrische Aktionen und das Training militiirischer Techni"
ken.55 In der Grundausbildung steht auf dem Schieflstand der Umgang mit hochrealistischen Waffen, wie dem Ml6 Sturrngewehr auf dem Programqa
Zielt man ttber Kimme und Korn, kann man den eigenen Atem hOren, es
!assen sich etwaige Ladehemmungen beheben und fl.Ir exakte Treffer heillt
es, bis kurz nach dem Ausatmen zu warten. Wer bereits w!ihrend des ersten
280
Trainings 36 von 40 Treffern erzielt, kann zum Sniper aufsteigen. Es folgen
Team-Trainings und schlieBlich »echte« Eins!ltze, die online und in Echtzeit
mit mehreren Beteiligten gespielt werden: Diese etwa 10-mintltigen Missio
nen, in denen das Heimatland verteidigt, Stiidte durchkiimmt, Geiseln befreit
und gegen Terroristen gekiimpft wird, sind Kem des Spiels. Bei ihnen
komrnt es in erster Linie auf taktisches Verhalten im Team an, das bis zur
Solbstopferung gehen kann: So lesen wir im zugehOrigen PDF-Handbuch
unter dem Stichwort Granaten: »your body may absorb enough of the blast
and fragments to allow the rest to escape damage and avenge your heroic
death.« 2002 bereits ziihlte die Army Statistik 185 Mio. Missions.56 Es gibt
Missionen bei Tag und bei Nacht, bei bester Sicht und bei Nebel, im Sommer
oder im Schnee. Manche Missionen erfordern einen Fallschirmsprung, in
anderen haben die Spieler Nachtsichtgeriite und praktisch alle Waffen und
Granaten zur Verftlgung; wieder andere Missionen erlauben Uberhaupt keine
Waffen. Ftlr get6tete Gegner und befreite Geiseln gibt es Auszeichnungen, so
dass sich die Brust langsam mit virtuellen Orden filllt, mit Abzeichen, welche
die absolvierte Laufbahn fiir alle Mitspieler dokumentieren. In virtuellen
Einslltzen wird natilrlich scharf geschossen, wenngleich Blut kaum ztl sehen
ist. Laut Entwickler sind fiir die n!lchsten vier Jahre dutzende Updates ge
plant mit vielen neuen Funktionen und Maps. Alie vier bis sieben Wochen
soil es ein neues Update geben. The Army is rollin on.
Die Immersion wird insbesondere durch die Reaktion des audiovisuellen Er
eignisraums in Echtzeit, die Interaktion und die Kommunikation mit den Mit
spielem befOrdert. Asthetisches Erleben resultiert mithin nicht aus dem objekt
haften Gegenilber eines stehenden Bildes und der daran m6glichen inneren
Distanznahme, sondem findet in einem artifiziellen und polysensuellen Ereig
nisraum statt, dessen Suggestionen intensive Emotionen auslost, gesteigert
nicht zuletzt durch die involvierende Kraft der Musik. Kommuniziert wird mit
der eigenen Truppe und den Gegnem durch Handsignale oder Online-Chat,
hinzu treten diverse Funk-Verbindungen, die den. Team-FUhrem zt1r Verftlgung
stehen, am besten kommt der immersive Surround Sound natilrlich mit dem
Headset zur Geltung. Michael Zyda vom MOVES Instin1te betont die besonde
re Bedeutung des 'sound fiir die Erzeugung von Emotionen: »In conversations
with experts at THX, Lucasfilm, Skywalker Sound and Dolby we were repe-
281
Abb. 6: America's Army, Screenshot, Nftchtlicher Kampr 2005
tedly told, »sound is emotion«. Und weiter: »The sound design for AA:O is
incredibly rich and textured. Weapons sounds are modeled for a combination of
sonic accuracy and emotionality.«57 Physiologische Messungen der Hauttem
peratur, Heizrate, etc, belegen dies.58 Dennoch hat sich in der Szene ein Trend,
ja ein Kult entwickelt, Missionen mit stimulierender, zum Tei! brutaler Rock
musik zu unterlegen, ein Vorgang iibrigens, der stark den Gewohnheiten der
US-Truppen im Irak folgt, die, wie Michael Moore in Fahrenheit 9/11 berich
tet, sich vor dem Kampf mit Musik enthemmen. So existieren im Netz Hunder
te von Videos »erlebter« Missions, die innerhalb der AA-Kultur ein neues
Genre fiir den emotionalen Erfahrungsaustausch begrtindet haben (Abb. 6).59
Liest man amerikanische Forschungsarbeiten, die Hunderte von AA·
Webforen durchleuchtet haben, dann miissen Zitate von Spielern, wie die
folgende oral history, als reprlisentativ gelten: »The war (Irak) has only
affected me in the way that I want to play more. I guess it's an adrenaline
thing ... watching the war and then playing AA ... it also made me wish I was
shooting at the French (since they had opposed the war).«60 Und: »The
thought in my mind was >there would be no way in hell they do this in the
army< ... from that moment on I played less AA and started looking for more
282
info on the (real) Army ... after all the wins and victories I had I didn't feel as
good when around (people) who were veterans and (when I said) >ya. I'm so
good at this army game< and they just look at you like motherfuckers, it's just
a game .. I actually sat back and said I know I can do this in real life.«61 Der
immer st!rkere Einsatz von Videobildern des Gegners, welche die Perspekti
ve der Computergames fortsetzen, verwischen zunehmend die Ditferenz
zwischen virtuellem und physikalischem Raum. Trotz aller emotional
lmmersiven Distanzlosigkeit zeichnet den erfolgreichen Kampfer im Spiel
und in der Schlacht die Fahigkeit aus, den Dberblick zu behalten.
Immersive Bildmedien, die wieder und wieder Momente des Dionysi-
1chen inszenieren, sind sicher eine KerngrC>Be zum Verstiindnis medialer
Bntwicklung ttberhaupt. Und selbstverstandlich besteht zwischen kritischer
Distanz und Immersion nicht ein schlichter Zusammenhang im Sinne eines
»Entweder-Oder«. Die Verbindungen sind vielmehr vielschichtig verwo
ben, dialektisch, teilweise widersprtlchlich, in jedem Falle aber von der
Disposition der Betrachter abhlingig, ihrer historisch gewachsenen Medi
enkompetenz, die bis in unsere Gegenwart gewachsen ist. Immersion kann
ein geistig aktiver Prozess sein, in den meisten Fallen jedoch - in der
lllteren Kunstgeschichte wie der jtlngsten Gegenwart - ist Immersion men
tale Absorbierung, die einen Prozess, eine Passage auslC>st. Kennzeichen ist
die Minderung kritischer Distanzierung und eine emotionale Involvierung,
die kaum Raum ftlr gemischte Gefiihle bieten.
Zur Relativitiit von Suggestionspotentialen und Distanzier11ngskrliften
AA mit Triumph des Willens gleichzusetzen ware absurd, zu unterschied
lich sind die Staaten, die diese Bildwelten hervorgebracht haben, zu abwei
chend die ideologischen Gnmdlagen und die technischen Mittel. Dennoch
gibt es Parallelen, die in der immersiven Konstrukt!on einer Wertegemein
schaft durch Bildwelten liegen. AA konstruiert gezielt das Geftlhl, Teil
einer groBen, ilberlegenen Sache zu sein und zieht hierfiir alle Register
durch ein suggestives Gemisch ·aus emotionssteigemder Musik und Bi Idem
von Realismus und Action. Im Unterschied zu Riefenstahls filmischer
Immersion in den Parteitag werden die suggestiven Eindrilcke in AA <lurch
Interaktion in einem in Echtzeit berechneten audiovisuellen Ereignis- und
283
Kommunikationsraum hoher Auflosung erzielt, einer virtuellen Sphare,
belebt mit Avataren von Freund und Feind, die einen pennanenten Wandel
der Perspektiven bietet und immer neue unvorhersehbare Situationen
erzeugt. Asthetisch reflektiertes Erleben im cassirerschen Sinne, das kriti
sche Distanz zum Objekt bedingt62, um i.iberhaupt ein listhetisches, ein
reflektiertes Erleben zu erfahren, weicht einer polysensuellen Ansprache in
einem belebte~ Bildraum, der emotionale Erregung, Action und das Gefilhl
vennitteln soil, Teil einer Sache zu sein, filr die sich Krieg lohnt. Letztlich
zielt auch Triumph des Willens auf ein Recruting: Angesprochen sind das
Biirgertum, die Sozialdemokratie, Kommunisten und andere Nicht
Parteimitglieder. So besteht ein widerspriichlicher Unterschied innerhalb
der immersiven Mechanik: Hebt Riefenstahl die Distanz auf, bricht schein
bar das lndividuum ins Nichts und zwingt es visuell in die Volksgemein
schaft, so bleiben in AA Restwerte des Individuums erhalten, denn nur
derjenige, der als Einzelner die Ubersicht behiilt, iiberlebt das Spiel. Beide
audiovisuellen GroBversuche zielen auf Affektkulturen der Unifonnitat,
Superioritlit, ja Omniprasenz, und beider Konsequenz ist Krieg und den
noch: Obgleich AA filr uns Europlier eine bedenkliche Mischung aus
Adrenalin, hegemonialem Patriotismus und christlichem Fundamentalis
mus transportiert, bleibt doch der kardinale Unterschied zur Gleichschal
tungskultur des NS bestehen, die Moglichkeit des Abschaltens.
Computergestiltzte virtuelle Spielwelten vollziehen keine Revolution,
wie ihre Protagonisten postulieren, nichtsdestotrotz werden sie innerhalb
der kulturgeschichtlichen Evolution der Medien als einschneidende Weg
marke erkennbar. Seit Pong oder DOOM I sind eine Vielzahl von invol
vierenden, Emotionen produzierenden Games entwickelt worden und auch
fiir die Interfaces gilt: Es werden wohl noch viele Prototypen ersonnen
werden, bis sich Standards filr die Mensch-Maschine-Schnittstelle etablie
ren - sofern der Gedanke langfristiger Standards nicht von vornherein der
evolutionaren Phlinomenologie der Medien und ihrem Telos widerspricht.
Es ist filr diesen Zusammenhang unerheblich, ob letztlich ein spezifisches
technisches Geriit existieren wird, das mehr oder minder groBe Anteile
jener Utopievorstellungen erfiillt. Bedeutsamer ist die sich in einer Viel·
zahl von unterschiedlichen Medien manifestierende Suche nach einer
illusionliren, letztlich unmerklichen Verbindung zum Bild.
284
Venuchen wir aus der rllckblickenden Distanz heraus die bisherige Ge
achichte der Bildmedien als Ganzes ztt erfassen, dann erweist sich der
Gewinn an Suggestionsmacht als ein Hauptziel und Motivationskern der
Bntwicklung neuer Illusionsmedien. Wie ein Mechanismus scheint dies der
Antrieb zu sein. Mit immer neuen Suggestionspotenzialen wird die Macht
t1ber die Betrachter wieder und wieder erneuert, um immer neue Regime
der Wahrnehmung zu errichten. Dennoch ist die Vorstellung, der Mensch
kOnne in einen vorsymbolisch und vormedial erlebten Naturzustand im
Sinne Rousseaus zurl1ckkehren, also symbolische Vermitteltheit zum
Verschwinden bringen und bildmediale Unmittelbarkeit finden, letztlich
Illusion. Die Entwicklung visueller Medien - von Altarbildern, wie dem
aus Isenheim, Ober Panorama, Cineorama, Stereoskop, Laterna Magics,
Diorama, Phantasmagoria, Stumm-, Farb-, Gemchs- und Tonfilm, wie dem
Triumph des Willens, IMAX und Telematische Medien bis Computerga
mes, wie America's Army und dem Virtuellen Bildraum - erscheint aus
dieser Perspektive als Geschichte sich kontinuierlich wandelnder Maschi
nen, Organisationsformen und Materialien, die immer wieder vorangetrie
ben wird von der Faszination der Illusionssteigerung. Wir erkennen einen
schier unendlichen Strom, in dem sich bei nliherer Betrachtung selbst
vermeintlich gesicherte Entitliten wie das Kino als Zusammenfilgung sich
immer neu arrangierender Splitter in einem Kaleidoskop evolutioniirer
Kunstrnedienentwicklung offenbaren. Die Gesamtschau erst verdeutlicht
die unabl!lssigen Energien, die mit der Suche und Erzeugung immer neuer
Illusions- und Immersionsrliume zur Steigerung der visuellen Macht ilber
andere verbunden waren. Unter diesen Voraussetzungen wird nunmehr
cine Evolutionsgeschichte der visuellen Medien mtsglich, in Verbindung zu
den Emotionen, die sie hervorriefen - eine Evolutionsgeschichte, die zu
gleich auch ihre Verirrungen, Widersprl1che und Abwege umfasst.
~ N~rbert Bolz, Eine kurze Geschichte des Schein~, MOnchen 1991 . D1etmar Kamper, Der Ja1111skopf der Medie11. Asthetisierimg der Wirklichkeit. E11tri/s11111g der
flnne, in: Digita/er Schei11, hg. von Florian R!llzer, Frankfun a. M. 1991, 93-99. Jean Baudrillard, J?as pe1fektf! Verbreche11, Monchen 1996.
: Rudo If Amheim, The Coming a11d Going of Images, in: Leonardo 3 (2000), 167-168. Rudolf Amheim in einem Brief vom 5. 8. 2000 aus Ann Arbor an den Verfasser.
6 JUngst: W J .T. Mitchell, What Do Pictures Want? '111e Lives and Loves of Images, Chicago 2005;
Oliver Grau, Virtual Art, From ll/11sion to Immersion, Cambridge 2003; Felice Frankel, Envisioning Science, The Design and Craft of the Science Image, Cambridge 2002; Barbara Stafford, Devices of Wonder, From the World in a Box to Images on a Screen, Getty Research Institute 2001.
285
7 Ausflihrlich hierzu die Ableitung des historisch-mathematischen Modells fllr das Bildwissenschaftliche Kolloquium in Magdeburg, Oliver Grau, Zwisclren Bilds11ggeslio11 1111d Distmugewi1111, in: Vom Realisnms der Bilder, /111erdiszipli11lire Forsclr1111ge11 zrw Sema11tik bildliclrer Darstell1111gsfom1e11, hg. von Klaus Sachs-Hombach, Magdeburg 2001, 213-227. Vgl. ebenfalls, James Elkins, Pictures a11d Tears. A Histo•J' of People Who Have Cried in Frolll of Paintings, New York 2001 . 8 Wolfgang Lenzen, Grrmdziige ei11er plri/osoplrischen Tlreorie der Gefiihle, in: Patlros -Affekt -Gefiilrl. Die Emoti011e11 i11 de11 Ki/11ste11, hg .. von Klaus,HerdinglBemhard Stumplbaus, Berlin 2004, 80-103. 9 Hermann Schmitz, Spiire11 1111d Se/1e11 a/s Zrrgli11ge zrrm Leib, in: Qrrel corps? Ei11e Frage der Repriise111a1i011, hg. von Hans Belting u. a., MUnchen 2002, 429-438. 10 So vermutete ZUJch im Namen Grunwald ein MissversHlndnis Joachim von Sandrats, der 1675-79 erstmals biographische Dalen zum KUnstler vertlffentlichte. Vgl. Dcrs., L'Academia Todesco de/la Arclritectrrra Scrrl111ra et Pictrrra, Oder Terr/Scire Academie der Etlle11 Barr, Bild rrrrd Malerei-Ki/rrste, Ntimberg 1679. 11 Der Orden der Antoniter blickte auf cine lange bis ins FrOhchristentum zurtickreichende Tradition der Ptlege Schwerkranker zurtick, die insbesondere der Linderung von Seuchen wie der Pest oder dem »Antoniusfeuer« gait. 12 Zurn Bilderglauben die fundamentalen Studien von Hans Belting, Bild 1111d K11/1, Ei11e Gesc/1icl11e des Bi/des 1•or dem aitalter der K1111st, Miinchen 1991. Man muss nicht die Legende vom Goldenen Kalb bemiihen, ein unschlagbarer zeitgenllssischer Beleg filr den Rausch von GefUhlen, religios aufgeladene Bildwerke ist Ostendorfers zeitnaber Holzschnitt Die Wallfalrrt zur Sc/1011e11 Maria i11 Rege11sbrrrg, der, einer Reportage gleich, das hingebungsvolle aber auch 11,eschllftige Treiben um ein wundertlltiges Madonnenbildnis dokumentiert.
Franziska Sarwey, Grii11e11"a/d St11die11, Z111· Realsymbolik des lse11/1eimer Altars, hg. und bearbeitel von Harald Mohring, Stuttgart 1983, 86. Ebenfalls, Andree Hayum, 77re /senlreim Altarpiece, God's Medicirre a11d the Painter's Visio11, Princeton 1989. 14 Ein wunderkrllftiges Heilelixier in einer Glaskaraffe, das jedes Jahr am Auferstehungstag im Mutterkloster St.-Antoine-en-Viennois feierlich eingeholt und Uber die Gebeine des aus Byzanz dorthin gebrachten heiligen Antonius gegossen wurde. Auf diese Weise erreichte e.~ einen besonderen Weihegrad. 15 Wolfgang KUhn verfasste einen ganzen Artikel iiber »GrUnewalds lsenheimer Altar als Darstellung mittelalterlicher Heilkrlluler« und lieferte damit eindruckvolle lndizien fur dessen aullergewohnlich prllzisen Realismus. Ders., in: Kosmos 44 (1948), 327-333. 16 Sarwey [Anm. 13), 97. 17 Vgl. Wilhelm Fraenger, Mathias Grii11ewald i11 sei11e11 Werke11, Ei11 pl1ysiog110111isc/1er Vers11ch, Berlin 1936, 128. 18 Vgl. u.a., Maximilian Le Cain, Emotiorr, in: Senses of Cinema, A11 0111i11e Film Jo11111al, Devoted lo tire Seriorrs a11d Eclectic Discussion of Ci11ema 13 (200 I) sowie Carl Plantinga/Greg M. Smith, Passio11ate Views. Film, Cog11itio11, a11d Emotion, Baltimore/London 1999. 19 Hierzu, Georg Malkowsky, Die Pariser We/ta11ss/ell1111g ill Wort 1111d Bild, Berlin 1900, sowic: Anne Friedberg, Wirrdow Shoppi11g, Cinema and the Postmodem, Berkeley 1993, 84f. Einc auffiillige Korrelation existiert zwischen der Geschichte der Weltausstellungen und der Einftlbrung neuer lmmersionsmedien - ein Forschungsfeld, das noch am Anfang steht. 20 Vgl. Silvia Bordini, Arte, lmilazio11e, lll11sio11e, Doc11111e11ti e note sulla pillrrra dei ,Pa11oraml' (1787-1910), in: Di111e11sio11i, Strrdi srrlle /11/eraziorri Ira Arie, Scie11za e Teclrnolagia I, La Costn1Zio11e delle /111agi11i, Rom 198 I , I 0 I ff. 21 Vgl. Kevin Brownlow, Piorriere des Films, Basel 1997, 26; Jerzy Toeplitz, Gesclric/1/e des Filw 1895-1928, Miinchen 1979, 18, oder: Emmanuelle Toulet, Pimriere des Ki11os, Ravensburg 1995, 17; insbesondere der eindrucksvolle Artikel von Stephen Bottomore, T71e Pa11icki11g Audience? Early ci11e111t1 arrd the 1h·ai11 ~{feel<, in: Histol1cal Jorrmal o/Fi/111, Radio a11d Tefevisio11 XIX/2 (1999), 177· 216; Abweichend, Martin Loiperdinger, u1111ie1"1?S A11/a111ft des Zliges, in: K!Ntop J ( 19%), 37-70. 22 Vgl. I. M. Pacatus, Fl1icl1tige Notize11, in: Nizegorodskij listok, Niwij-No1gorod 182 (4, 7. 1896), zit. nach K/Ntop 4 ( 1995). 13. Auch Jahrzehnte spftter war diese Wirkung auf Menschen, die zum ersten Mal mil dem Medium konfrontiert wurden, kaum anders, So zHhlte man 1931 im rumllnischen Dorf Goerovesti, nach einer Panik, die von den Bildem der ersten Filmvorfilhrwti ausging, ein Dutzend Verletzte. 23 »Die Illusion des Darbeiseins kann noch verslllrkt werden, wenn die Kamera den Deobachtungsort eines Darstellers in der Handlung einnimmt.« James J. Gibson, 1Valrmehm11ng und Umwe/t, Der okologisclre Ansatz irr der vis11el/e11 1Valrmel11111mg, Miinchen 1982 (1979). 321. 24 Auf der Weltausstellung von 1900 kehrten die Lumieres noch einmal zum Panoramaformat zur11Clr. Dort zeigten sie ihr Photorama, die panoramatische Diaprojektion eines 90 cm langen, 11 cm hohen Filmstreifens, eine Rundaufuahme, in Form eines Zylinders von etwa 29 cm Durchmesser. ZwOlf~
286
,...ir. '9bundene Objektive umkreisten das Diapositiv und warfen das Bild StOck um StOck mit dilllliacr Ocschwindigkeit auf die Wand, dass der Eindruck eines geschlossenen Rundbildes entstand. VIII. Pli«lrich von l.glinicki, Der Weg de.r Films, Hildesheim 1979 ( 1956), I 06. :ll'AndreyTarkovsky, Sc11/pti11g In. Time, ~~flexio11s. on Cinema! Austin, Texas. 1986, 176. . • n.n Stere0film ging das »1llumhch« prOJtz1erte Ota voruus. Dte Laterna Mag1ca verbrettete dtese Bilder seit elem 17. Jahrhundert weltweit und gewann im Phantasmagoria nahezu 30-Qualitlit. Vgl.
Rob· son, '171e Lantem Image, /conogmphy of the Magic Lall/em 1420-1880, Nutnay 1993. Zur ichte des Kinos auch, Laurent Mannoni, The Great An of light and Shadow, Archaeology
Cfnema, Exeter 2000, jilngst, Erkki Huhtamo, Elements ofScreeno/ogy, Towards an ArchaeliJIJlw of the Screen, in: /conics 7 (2004) (=The Japan Society of Image Arts and Sciences), 3 l-82. ff£ M. Hayes, 3·D Movies, A History and Fi/mography of Stereoscopic Cinema, Jefferson, NC 1989,S. •Ebd.,9. • Seqcj Eisenstein, Ober den Ra11mfilm, in: ders., Das dynamische Q11adrat, Schriften z11m Film, hg. von Oksana Bulgakova u.a., Leipzig 1988, 196-261, bier 199. JO Ebel., 235. ,. Ebd.,23S. J2 Ebd., 201. " Siegfried Kracauer, Von Caligari z11 Hitler, Eine psychologische Geschichte des De11tschen l't/tn1, Frankfurt a. M. 1977 (1947), 326. Erfreulich ist, dass Kracauers honorierte Schrift Mosse und Propaganda, die unter dem Eindruck der NS Bildwelten im Pariser Exit entstand, Vldlff'endicht wird. :w KUnlich, Karin Wieland, Die utz1e, uni Riefe11sta/JI 1111d das 20. Jahrlmndert, in: Merk11rDeut1che Zeitsc/1rlftfiir E11ropliisc/1es De11ken 54112 (2000), 1193-1202. 11 Leni Riefenstahl, Wieder Fi/111 vom Reicl1sparteitag e111s1e/11. Noc/111ie ill der We/1 /1a1 sk/1 ei11 Staal derartig fiir ei11e11 Film ei11gesem, Eine Unterredung mit Leni Riefenstahl, in: Magdeb11r-1•r Ta1UV!it1111g (13.1.1935). Vgl. die Analyse bei Frank P. Tomasulo, T/1e Mass Psychology of Ft11cisl Cinema, l..eni Riefenstahl's Tri11111p/1 of the Will, in: Close Readi11gs of Doc11111et11ary Film and Video, hg. von Barry Keith Grant, Detroit 1998, 99-118. 16 Vgl. Claudia Lenssen, U111erwoife11e Gefiih/e, Na1io11a/sozialistisc/ie Mobi/isierimg und tmotiona/e Manip11/atio11 der Masse11 i11 de11 Parteitagsfilmen l..e11i Riefe11s1ahls, in: E11101io11alillll. Zur Geschic/11e der Gefiihle, hg. von Claudia Benthien u.a., Ki!ln 2000, 198-212; ebenfalls: M. Loiperdinger, Tri11mp/1 des Willens - VI. Reic11spartei1ag der NSDAP i11 Niimberg, 4.-10. September 1934, (lnstitut fUr den Wissenschaftlichen Film Gottingen), Publikationen zu Wissenachaftlichen Filmen, Sektion Geschichte Publizistik 6/4 (1989). n Val. Deutsche Allgemei11e Zei11111g vom 15.12.1934, »Aus 128 000 Metem werden 3000. Mit Leni Riefenstahl an der Arbeit«. : So stellten Fox, Tobis-Melo, Paramount u.a. ihr gesamtes Filmmaterial zur VerfUgung.
Triumph des Willens vo//e11de1. Fest/iche Ura11.lfiilm111g i11 Berlin, Am 5. April Ersta11ffilhn111g in 70 deutsche11 S1/Jdte11, in: Vo/kisc/1er Beobacfller, Norddeutsche Ausgabe (23.3.1935) . .. Leni Riefenstahl in: Der De11tsclie (17.1.1935), zit. nach Herbert Heinzelman, Die Heilige Messe des Reic/1sparteilages, Zur Zeidiempache vo11 le11i Riefe11stahls Triumph des Willens, in: 1111ienienmg der Macht, iisthetische Faszi11atio11 des Fasc/iismus, hg. von der Neuen Gesellschaft fllr Bildende Kunst, Berlin 1987, 161-169, bier 163. 41 Ebd. 41
Erwin Panofsky, Style and Medium i11 the Motion Pictures (1936), hier in: 17iree Essays 011 ~lyl~, hg. von Irving Lavin, Cambridge 1995, 96.
Hier-Lu Kracauer: » ••• schwelgt >Triumph des Willens< in endlosen Bewegungen ... Bewegung, die, dun:h die Kamera produziert wird, ergilnzt die der Objekte. Es wird standig zur Seite, nach oben und unten geschwenkt und gefahren - so daB die Zuschauer nicht nur eine fieberhafte Well vorbeiziehen sehen, sondern sich in ihr enlwuralt ftlhlen. Die allgegehwartige Kamera zwingt sie, auf den unmi!glichsten Wegen zu gehen, und die Schnitte treiben sie noch weiter ... Hier scheint vi!llige Bewegung die Substanz verschlungen zu haben, Leben gibt es nur im Obergangszustand.« Vgl. Kracauer (Anm. 33), 355. Den Diskussionen mit meinen Studenten an der Humboldt-Universitm zu Berlin und der Universitflt Siegen verdanke ich in diesem Zusammenhang wichtige Beobachtungen. "" Die innovativen Flugaufnahmen, die vom Luftschiff D/PN30 und aus einer Klemm-Maschine ~emacht wurden, waren gleichfalls spektakulllr.
Edmund Burke, A Philosophical Enq11i1y into the origi11 of our ideas of the sublime a11d Bea11tif11I, London 1757. 46 As1011i1/iil1g Nuremberg Scenes, Leader's spec1ac11/ar Entry To Co11gress, in: The Daily Telegraph (6.9.1934) oder: W. Duesberg, U11 Film •kolossal«, in: la Revue, Lausanne (10.4.1935).
287
47 Dennoch la•sen die immer wieder ge.<ehilderten spontnnen Beifallskundgebungen wiihrend der Fihnvorftlhrung - filr uns heutige unvor.;tellbar- auf die emotionale Ausdehnung des ReiclLspruteitags in den Kinosaal schlie6en. Vgl. Triumph tiber die Herom, in: Fi/111-Kmier, Berlin (29.3.1935), I; sowie: Eitr Epoclrales Fi/111dokr1111ent, Triumplr des Willens, in: lie/rt Bild Bii/111e, Berlin (29.3.1935), I. 48 Vgl. auch die umfassende Darstellung von Hilmar Hoffmann, »U11d die Fah11efiihrt 1111.r i11 die Ewigkeit•, Propaga11da im NS-Film, Frankfurt a. M. 1988, 79ff. 49 Schwedische Filmstudenten in Berlin zu Gast, baten den eindrucksvollen Film ein zweites Mal sehen zu konnen. Schwedische Film•tudenten in Berlin, Begeisterung Uber den ReichsparteitagsFilm, in: lic/1t-Bild-Bi//111e (18.4.1935); sowie: R.R., Le11i Riefeiutahl a prese11te im~tes, Le triom11l1e de la volollle, in: l'intro11signearrt (5.7.1937), 10; Die japanische Regierung setzte Tri11111p/r des Willens ein, um die politische Annllherung an den ehemaligen Kriegsgegner Deutschland in der Offentlichkeit zu befdrdem, in Osterreich, in Schweden oder Danzig wurde der Film als Bild vom neuen Deutschland prllsentiert; ebenfalls: Corriere delta Sera, I film proiettati o Ve11el.ia, Fredda accolie11za a •la Maso/le•. II documellfario nazi.rta • Trio11fo de/la Vololllir• (24.8.1935). '
0 Im Volkisc/1e11 Beobaclrter schwelgte Ewald von Demanclowski: »Was man auch bi sher an filmischen Leistungen je gesehen hat, seien es die Monstre-Filme der Amerikaner, die Ausstattungs- und Historien-Filme jeder Herkunft, sie verblassen alle gegen dieses epochale Filmwerk, von dem man mit Stolz sagen kann, >Es isl das GroBte, was wir je gesehen haben!«< Der Reichsparteitagsfilm, Ei11 eiltmaliges Erlebnis in ei11111aliger Gestalt1111g, in: VOlkiscl1er Beobacluer, Berliner Ausgabe (29.3.1935). 51 A. Hitler, Mein Kampf. 198. 52 Tri11111ph des Willens, Der Fiilrrer prligt de11 Name11 filr de11 Reiclisparteitags-Fi/111 1934, in: Kinematograp/1 (26.9.1934). 53 Der Fiilrrer bei den Sc/meide-Arbeiten Le11i Riefenstaltls filr •Triumph des Willens•, in: Fil111k11rier (7 .12.1934 ). ,. Timothy Lenoir, Fashio11i11g the Military-E11te11ai11me111 Complex, in: Correspo11de1ice. An brtemational Review of Culture and Society 2002/2003, 14-16, ausfilhrlich, James Der Derian, Vi1111011s War. Mapping the Mililary-lml11sflial-Media-E11te11ai11111e111 Netwo•*• Westview Press 2001, ebenfalls: Kiystian Woznicki, Das g/obale Ob1111gsdoif, in: Vi11uelle Welte11- reale Gewalt, hg. von Florian Rotzer, Hannover 2003, 68-79. Der Austausch zwischen Mililllr und Entertainment lndustrie lasst sich personell festmachen. So etablieren sich zunehrnend Karrieren, die zwischen Simulationslabor und Disney hin und bcrpendeln. Anliisslicb der Erllffuung des erwllhnten Anny Institute for Creative Technology betonte der zustilndige Leiter Louis Caldera: »We could never hope to get the expertise of a Steven Spielberg ... working on Anny Projects.« Doch das neue lnstitut werde, so Caldera: »a win-win for everyone«. 54 Die dam it verbundene Neubewertung und einschneidende tbeoretiscbe Neuorientierung des Spiels zwischen Militiir und Unterhaltungsindustrie (auch in seiner scheinbar trivialen Natur) gilt es bier festzuhalten. " Allein 19 Militllrbasen wurden in der Planungsphase des Spiels von den Entwicklem besucht. 56 Vgl. statistische Oaten unter: www.amerjcasarmy com (Aug. 2003). 57 Russell Shilling u.a., /111roduci11g Emotion into Military• Sim11/atio11 and Videogame Desig11, Americas An11y, Operotio11s a11d VIRTE, in: Proceedings of the Game011 Ca1rfere11ce, London, 30. Nov. 2002, 151-154, bier 152. " Vgl., R. Sanders u.a., n1e Effect of Sound Delivery Methods 011 tire User's Se11se of Presence i11 a Virtual E11vironmelll, MOVES Institute, Naval Postgraduate School, Monterey 2002. 59 httpl/americasanny.filefront.com/files/Americas ArmWMedia!Video; 953 .. Vgl., Zhan LI, Potellfial of America's An11y tire Video Game as Civilia11-Military Public Sflrere (Master's Thesis), MIT 2003, 61. 6 Ebd. 62. 62 Vgl. Ernst Cassirer, /11dil'idr111m mrd Kosmos, Darmstadt 1963 (1927), 179.
288