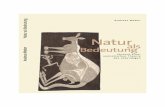Pragmatistische Bedeutungstheorien und das Prinzip der Autonomie der Bedeutung
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Pragmatistische Bedeutungstheorien und das Prinzip der Autonomie der Bedeutung
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 1
Pragmatistische Bedeutungstheorien und das
Prinzip der Autonomie der Bedeutung
Jasper Liptow
Ziel dieses Aufsatzes ist die Kritik einer bestimmten Form pragmatistischen Denkens in der
gegenwärtigen Sprachphilosophie, die man als „pragmatistische Bedeutungstheorie“
bezeichnen kann. Robert Brandom kommt das Verdienst zu, einen Ansatz dieser Art nicht nur
im Detail ausgearbeitet, sondern auch eine Vielzahl der methodischen Implikationen
ausdrücklich ins philosophische Bewusstsein gehoben zu haben. Die folgenden Überlegungen
sind daher primär in Auseinandersetzung mit Gedanken und Überlegungen Brandoms
entstanden. Ziel ist es aber, einen allgemeinen sprachphilosophischen Ansatz zu kritisieren,
eine Form sprachphilosophischen Denkens, von der Brandoms Theorie nur eine Variante
darstellt. Grob gesprochen handelt es sich bei einer pragmatistischen Bedeutungstheorie um
den Versuch, die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke im Rahmen einer philosophischen
Erklärung auf eine bestimmte Form ihres Gebrauchs zurückzuführen.
Es geht mir dabei nicht darum, eine Binsenweisheit anzuzweifeln. Dass die Bedeutung
sprachlicher Ausdrücke konstitutiv von ihrem Gebrauch durch Sprecherinnen und Sprecher
abhängt, möchte ich nicht bestreiten. Es geht darum, eine bestimmte Form von
Sprachphilosophie zu kritisieren. Denn aus der genannten Binsenweisheit folgt natürlich
nicht, dass sprachliche Bedeutung im Rahmen einer philosophischen Erklärung auf den
Gebrauch sprachlicher Ausdrücke zurückgeführt werden kann.
Ich werde ein zentrales Problem für Ansätze dieser Art präsentieren und argumentieren, dass
die Aussichten, dieses Problem zu umgehen, düster sind. Das Problem kann man – wiederum
grob – wie folgt formulieren: Es gehört zu unserem alltäglichen Begriff der Sprache, dass die
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke gegenüber ihrer Verwendung zur Verwirklichung
bestimmter Zwecke in einem bestimmten Sinn autonom ist. Donald Davidson hat behauptet,
dass dieses „Prinzip der Autonomie der Bedeutung“ – wie er es nennt – ein wesentlicher Zug
menschlicher Sprache ist. Ich werde zeigen, dass erstens diese Behauptung gerechtfertigt ist
und dass zweitens dieses Prinzip bei näherer Betrachtung strikt inkompatibel mit der Art von
Erklärung sprachlicher Bedeutung ist, durch die sich das Unternehmen einer pragmatistischen
Bedeutungstheorie definiert.
Ich gehe dabei folgendermaßen vor: Im ersten Abschnitt erläutere ich das Unternehmen einer
pragmatistischen Bedeutungstheorie, indem ich seine grundlegenden theoretischen
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 2
Festlegungen mit Bezug auf den Zusammenhang von Bedeutung und Gebrauch darlege. Im
zweiten Abschnitt verweise ich auf einige pragmatische Phänomene, die diesen Festlegungen
zuwiderzulaufen scheinen und identifiziere zwei mögliche Strategien, wie eine
pragmatistische Bedeutungstheorie mit diesen Phänomenen umgehen kann. Im dritten
Abschnitt rekonstruiere ich Davidsons Prinzip der Autonomie sprachlicher Bedeutung in
seiner Anwendung auf einen bestimmten Fall und zeige, warum dieses Prinzip ein
Wesensmerkmal unserer sprachlichen Praxis darstellt. Abschließend weise ich nach, dass die
beiden Strategien daran scheitern, dass sie mit dem Prinzip der Autonomie entweder direkt
oder zusammen mit einer grundlegenden theoretischen Festlegung pragmatistischer
Bedeutungstheorien unvereinbar sind.
1. Was ist eine pragmatistische Bedeutungstheorie?
Die Rede von einer pragmatistischen Bedeutungstheorie, wie sie sich in den letzten
Jahrzehnten vor allem durch die Arbeiten Robert Brandoms etabliert hat, ist sicherlich
erklärungsbedürftig. In diesem Abschnitt möchte ich Grundzüge dieses Unternehmens in
einer Weise herausarbeiten, die einerseits allgemein genug sein soll, um eine große Klasse
von konkreten Vorschlägen abzudecken, andererseits spezifisch genug, um Angriffsflächen
für eine substanzielle Kritik zu bieten.
1.1 Der Gedanke der Zurückführung von Bedeutung auf Gebrauch
Wer bei den klassischen Pragmatisten nach Ansichten sucht, die sich als Vorläufer einer
pragmatistischen Bedeutungstheorie in dem von mir intendierten Sinn interpretieren lassen,
kann sich an die Konzeption des Gehalts mentaler Akte und Zustände halten, die Charles
Sanders Peirce im Gewand einer Auffassung des Wesens von Überzeugungen (beliefs)
entwickelt und die William James seiner Auffassung des Pragmatismus zugrunde legt. In der
berühmten Passage, in der Peirce die „pragmatische Maxime“ zur Klärung unserer Ideen
formuliert, gründet er diese auf folgende Auffassung von Überzeugungen:
Das Wesen der Überzeugung ist die Einrichtung einer Verhaltensweise, und verschiedene
Überzeugungen unterscheiden sich durch die verschiedene Art der Handlungen, die sie
hervorbringen. Wenn Überzeugungen sich in dieser Hinsicht nicht unterscheiden, wenn sie
denselben Zweifel zur Ruhe bringen, indem sie dieselbe Regel des Handelns erzeugen, dann
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 3
können keine bloßen Unterschiede in der Art des Bewußtseins von ihnen sie zu verschiedenen
Überzeugungen machen […].1
Diese Passage enthält offenbar eine These über die Individuierung von Überzeugungen: Was
eine Überzeugung zu der Überzeugung macht, die sie ist, so der Gedanke, ist die „Art der
Handlungen“, (mode of action), „Regel des Handelns“ (rule of action) oder, wie Peirce meist
sagt, „Verhaltensweise“ (habit), die sie hervorbringt. Die Allgemeinheit, die in der Rede von
„Arten“, „Regeln“ oder „Weisen“ liegt, ist dabei entscheidend. Wenn zwei Überzeugungen
bereits dann identisch wären, wenn sie faktisch dasselbe Verhalten hervorbringen, müssten
etwa alle Überzeugungen, die sich niemals in unserem Verhalten manifestieren, miteinander
identisch sein. Das, was Peirce als „Verhaltensweise“ bezeichnet, ist dagegen (oder beinhaltet
zumindest) eine Verhaltensdisposition. Diese ist aber selbst kein Verhalten, sondern, eher die
Ursache von Verhalten, und zwar eine Ursachen von Verhalten, die dadurch bestimmt ist, in
welcher Art von Verhalten sie sich unter welcher Art von (aktualen oder bloß möglichen)
Umständen manifestiert.2 Zwei Überzeugungen sind Peirce zufolge also genau dann identisch,
wenn sie uns dazu disponieren, unter genau denselben (faktischen und kontrafaktischen)
Umständen genau dasselbe Verhalten an den Tag zu legen.
Nun sind die Überzeugungen einer Person auch durch ihre Gehalte individuiert. Was eine
Überzeugung zu der Überzeugung macht, die sie ist, ist ihr Gehalt, das also, was wir in Sätzen
der Form „S glaubt, dass p“ durch den Ausdruck angeben, für den „p“ steht. Wir können
daher die Peirce’sche These über die Individuierung von Überzeugungen als folgende These
über den Gehalt von Überzeugungen lesen: Zwei Überzeugungen haben genau dann
denselben Gehalt, wenn sie uns dazu disponieren, unter denselben (faktischen und
1 Charles Sanders Peirce, „Wie unsere Ideen zu klären sind“, in: Schriften zum Pragmatismus und
Pragmatizismus, 2. Aufl., Frankfurt/M. 1976, S. 182-209, hier S. 191 (CP 5.398). Das Verhältnis zwischen
diesem Gedanken und der pragmatischen Maxime ist nicht völlig durchsichtig. Peirce und James legen beide
dieselbe verwirrende Tendenz an den Tag, kommentarlos von dem Gedanken, dass der Gehalt eines Begriffs
durch diejenigen Konsequenzen für unser Handeln bestimmt ist, die wir dadurch an den Tag legen, dass wir
diesen Begriff anwenden, zu dem ganz anderen Gedanken überzugehen, dass der Gehalt eines Begriffs durch
diejenigen Konsequenzen für unser Handeln bestimmt ist, die (unserer Auffassung zufolge) die Gegenstände
an den Tag legen, die unter diesen Begriff fallen. James etwa referiert zunächst den im Text rekonstruierten
Gedanken von Peirce: „Peirce weist darauf hin, daß unsere Überzeugungen tatsächlich Regeln für unser
Handeln sind, und sagt dann, daß wir, um den Sinn eines Gedankens herauszubekommen, nichts anderes tun
müssen, als die Handlungsweise bestimmen, die dieser Gedanke hervorzurufen geeignet ist. Die
Handlungsweise ist für uns die ganze Bedeutung dieses Gedankens.“ (William James, Der Pragmatismus.
Ein neuer Name für alte Denkmethoden, Hamburg 1977, S. 28) Nur um zwei Sätze weiter daraus die
Schlussfolgerung zu ziehen: „Um so vollkommene Klarheit in unsere Gedanken über einen Gegenstand zu
bringen, müssen wir nur erwägen, welche praktischen Wirkungen dieser Gegenstand in sich enthält, was für
Wahrnehmungen wir zu erwarten und was für Reaktionen wir vorzubereiten haben. Unsere Vorstellung von
diesen Wirkungen, mögen sie unmittelbare oder mittelbare sein, macht dann für uns die ganze Vorstellung
des Gegenstandes aus.“ (ebd., S. 29). 2 Vgl. Peirce, „Wie unsere Ideen zu klären sind“, S. 192f. (CP 5.400).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 4
kontrafaktischen) Umständen dasselbe Verhalten an den Tag zu legen. Und es liegt nahe,
hieraus folgende Konsequenz für die Konstitution des Gehalts von Überzeugungen zu ziehen:
Der Gehalt einer Überzeugung wird dadurch bestimmt, zu welchem Verhalten sie uns unter
welchen (faktischen und kontrafaktischen) Umständen disponiert.3 Es ist nun nicht schwer,
diesen Gedanken in eine Auffassung der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke zu transponieren,
die dann auch „pragmatistisch“ genannt zu werden verdiente. Dieser Auffassung zufolge
würde die Bedeutung eines Aussagesatzes durch die Verhaltens- oder Handlungsdispositionen
bestimmt, die wir haben, wenn wir diesem Satz zustimmen (oder ihn für wahr halten oder
Ähnliches).
Robert Brandom hat darauf hingewiesen, dass diese klassisch-pragmatistische Auffassung des
Gehalts (sei es von Überzeugungen oder von Sätzen) mindestes aus zwei Gründen zu kurz
greift. Erstens bezieht sie nur die praktischen Folgen des Habens einer Überzeugung oder der
Anerkennung eines Satzes ein und nicht auch die Folgen, die sich für den Rest unserer
Überzeugungen oder sprachlichen Dispositionen ergeben. Zweitens beschränkt sie sich auf
die Folgen des Habens von Überzeugungen oder der Anerkennung von Sätzen und
vernachlässigt die Umstände, unter denen wir zu einer Überzeugung oder der Zustimmung zu
einem Satz gelangen.4
Brandom hat aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass die klassisch-pragmatistische
Auffassung des Gehalts zu einem Typ von Auffassungen gehört, den man aufgrund
bestimmter Merkmale noch in einem anderen Sinn als „pragmatistisch“ bezeichnen kann,
weshalb das Scheitern der klassisch-pragmatistischen Auffassung nicht bedeutet, dass sich
nicht doch eine Auffassung entwickeln lässt, die zurecht als pragmatistisch gelten kann. Bei
der Auffassung, die Brandom vorschwebt, handelt es sich um eine Erklärung des Gehalts von
Überzeugungen in Begriffen der Rolle, die sie im Rahmen einer bestimmten Praxis spielen.5
Es ist diese Art von Erklärung mentalen Gehalts oder sprachlicher Bedeutung – eine
Erklärung bestimmter Eigenschaften einer Art von Dingen in Begriffen unseres Gebrauchs
dieser Dinge oder unseres Umgangs mit diesen Dingen –, für die Brandom letztlich das
Etikett „pragmatistisch“ verwendet:
3 Soweit ich sehe, legen sich weder Peirce noch James ausdrücklich auf das Primat des Verhaltens gegenüber
der Überzeugung fest, das in dieser Formulierung steckt. 4 Vgl. Robert B. Brandom, Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und diskursive Festlegung,
Frankfurt/M. 2000, S. 196. 5 Brandom bezeichnet diese Art von Pragmatismus daher auch als eine Form des Funktionalismus (vgl.
Robert B. Brandom, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in den Inferentialismus, Frankfurt/M. 2001,
S. 13).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 5
Ein Pragmatismus mit Blick auf das Begriffliche versucht zu verstehen, was es heißt, explizit zu
sagen oder zu denken, daß etwas der Fall ist, und zwar im Rückgriff auf [in terms of] das implizite
Wissen-wie, das man besitzen muss (also anhand dessen, was man implizit zu tun imstande sein
muss).6
Eine pragmatistische Bedeutungstheorie in diesem Sinn ist also der Versuch einer Erklärung
sprachlicher Bedeutung in Begriffen ihrer Rolle im Rahmen einer Praxis. Etwas genauer
handelt es sich um den Versuch, die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in Begriffen der
pragmatischen Signifikanz von Äußerungen, die diese Ausdrücke beinhalten, zu erklären.
„Erklären“ von X „in Begriffen“ von Y muss dabei in einem anspruchsvollen Sinn verstanden
werden. Die bloße Auffassung, dass sich sprachliche Bedeutung nicht ohne Bezug auf den
Gebrauch sprachlicher Ausdrücke erklären lässt, impliziert nicht den Gedanken, dass sie sich
in Begriffen des Gebrauchs erklären lässt. „X in Begriffen von Y zu erklären“ bedeutet für
den pragmatistischen Bedeutungstheoretiker, X theoretisch auf Y zurückzuführen.7
Im einfachsten Fall lässt sich ein Vokabular oder eine Theorie auf ein anderes Vokabular oder
eine andere Theorie dadurch zurückführen, dass die grundlegenden Begriffe des ersten
Vokabulars explizit durch Begriffe des zweiten Vokabulars definiert werden können. (Das
scheint zumindest in einigen Fällen auch die Art von theoretischer Zurückführung zu sein, die
Brandom vorschwebt.) Zumindest aber muss eine strikte Korrelation zwischen den
grundlegenden Begriffen des ersten Vokabulars und Begriffen des zweitens Vokabulars in der
Weise hergestellt werden können, dass sich für jeden der grundlegenden Begriffe des ersten
Vokabulars notwendige und hinreichende Bedingungen seines Zutreffens auf Gegenstände
durch Begriffe des zweiten Vokabulars angeben lassen. Für unseren Fall der Zurückführung
von Bedeutung auf Gebrauch handelt es sich bei dem ersten Vokabular um denjenigen
Zusammenhang von Begriffen, mit dem wir sprachlichen Ausdrücken semantische
Eigenschaften zuschreiben, also um Begriffe wie die des Satzes, der Bedeutung, des
propositionalen Gehalts, der Wahrheit, der Bezugnahme, des Zutreffens auf Gegenstände und
so weiter. Das zweite Vokabular ist dasjenige, das von der pragmatistischen
Bedeutungstheorie selbst bereitgestellt wird. Es ergibt sich somit eine erste Bedingung für das
Gelingen dieses Unternehmens:
6 Brandom, Begründen und Begreifen, S. 31. 7 Man kann eine pragmatistische Bedeutungstheorie daher auch als eine „reduktive Bedeutungstheorie“
bezeichnen (vgl. Jasper Liptow, Regel und Interpretation. Eine Untersuchung zur sozialen Struktur
sprachlicher Praxis, Weilerswist 2004, 52ff., wo auch auf prinzipielle Probleme dieser Art von Theorie
hingewiesen wird, die ich hier nicht diskutiere).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 6
(B1) Für jeden grundlegenden semantischen Begriff S muss eine pragmatistische
Bedeutungstheorie eine (eventuell komplexe) Bedingung P formulieren können,
sodass gilt, dass ein sprachlicher Ausdruck genau dann S ist, wenn eine
Äußerung dieses Ausdrucks P ist.8
Um eine Zurückführung handelt es sich hier allerdings nur, wenn zusätzlich die Bedingung
erfüllt ist, dass die Begriffe, die die pragmatistische Bedeutungstheorie selbst verwendet, um
die pragmatische Signifikanz von Äußerungen zu beschreiben, nicht ihrerseits wieder von
semantischen Begriffen abhängen. Das führt uns zu einer zweiten grundlegenden Bedingung:
(B2) Das theoretische Vokabular, das eine pragmatistische Bedeutungstheorie zur
Beschreibung der pragmatischen Signifikanz von Äußerungen verwendet, muss
ohne jeden Bezug auf semantische Begriffe (und – wegen ihres engen
Zusammenhangs mit diesen – auch ohne jeden Bezug auf intentionale oder
mentale Begriffe) verständlich sein.
1.2. Die pragmatische Signifikanz von Äußerungen und die Bedeutung von Sätzen
Damit die Diskussion beherrschbar wird, werde ich mich im Weiteren auf eine besondere
Klasse von pragmatistischen Bedeutungstheorien beschränken. Diese lässt sich durch die
grundlegende Festlegung abgrenzen, dass die theoretisch grundlegende Form des Gebrauchs
sprachlicher Ausdrücke in der Äußerung vollständiger Sätze besteht.9 Wir klassifizieren
Äußerungen von Sätzen durch Begriffe wie den der Behauptung, der Frage, des Versprechens,
der Bitte, des Befehls usw. Die Beschränkung, die ich vornehmen möchte, lässt sich daher
auch so formulieren, dass die pragmatistischen Bedeutungstheorien, um die es mir geht,
davon ausgehen, dass die theoretisch grundlegenden Formen sprachlicher Praxis, mit Bezug
8 Zwei Kommentare zu (B1), die für das Folgende keine Rolle spielen, sind wichtig, um diese Formel nicht
vorschnell abzulehnen: Zum einen kann eine pragmatistische Bedeutungstheorie mit Bezug auf einige
vorgeblich grundlegende semantische Ausdrücke behaupten, dass diese tatsächlich gar keine grundlegenden
semantischen Begriffe ausdrücken und insofern auch nicht auf pragmatische Begriffe zurückgeführt werden
müssen. Brandom etwa wendet diese Strategie auf die in seinen Augen nur scheinbaren Begriffe der
Wahrheit und der Bezugnahme an (vgl. Brandom, Expressive Vernunft, Kap. 5). Zum anderen muss nicht
verlangt werden, dass sich die semantischen Begriffe einzeln in dieser Weise mit pragmatischen Begriffen in
Beziehung setzen lassen. Eine Reduktion muss sich eventuell auf Mengen von Begriffen oder gar ganze
Vokabulare oder Theorien auf einmal richten (vgl. David Lewis, „Psychophysische und theoretische
Gleichsetzungen“, in: Die Identität von Körper und Geist, Frankfurt/M. 1989, S. 21-38, für einen Vorschlag,
wie das in dem verwandten Fall der Zurückführung mentaler Begriffe aussehen könnte). 9 Das ist keine große Beschränkung, da pragmatistische Bedeutungstheorien typischerweise den Gebrauch von
Sätzen theoretisch privilegieren, aber es ließe sich sicherlich auch für pragmatistische Bedeutungstheorien
ein anderer Ausgangspunkt vorstellen (vgl. Brandom, Begründen und Begreifen, S. 24f.).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 7
auf deren pragmatische Signifikanz die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke erklärt werden
soll, Akte mindestens einer der genannten Art sind.
Hier ist allerdings bereits Vorsicht geboten. Denn vortheoretisch begreifen wir Behauptungen,
Fragen usw. als absichtliche Handlungen. Und genau diese Annahme macht auch die
Sprechakttheorie im Anschluss an Austin und Searle. Sie konzipiert Äußerungen als Akte, die
mit Gründen und aus Gründen vollzogen werden, wobei diese Gründe in Form von
Überzeugungen, Wünschen und Absichten von Sprecherinnen und Sprechern vorliegen.
Gemäß (B2) steht pragmatistischen Bedeutungstheorien unser alltägliches Verständnis
sprachlicher Äußerungen als absichtliche Handlungen und seine theoretische Ausarbeitung im
Rahmen der Sprachakttheorie aber nicht zur Verfügung. Hieraus folgt zwar nicht, dass eine
pragmatistische Bedeutungstheorie ohne Begriffe wie den der Behauptung oder der Frage
auskommen muss. Aber es folgt, dass sie diese Begriffe in einer unüblichen Weise
interpretieren muss, die nicht bereits mentale oder intentionale Begriffe ins Spiel bringt.
Wenn ich daher im Folgenden den Ausdruck „Sprechakt“ verwende, soll dieser so verstanden
werden, dass nicht bereits impliziert ist, dass es sich bei Sprechakten um absichtliche
Handlungen handelt.
Die Beschränkung auf pragmatistische Bedeutungstheorien, die als die primären sprachlichen
Einheiten Sätze und als die primären Elemente sprachlicher Praxis Sprechakte ansetzen, ist
sinnvoll, weil sich auf diese Weise eine sehr viel genauere Bestimmung der Form und der
Probleme pragmatistischer Bedeutungstheorien vornehmen lässt. Das liegt daran, dass der
Zusammenhang von sprachlicher Bedeutung und pragmatischer Signifikanz von Sprechakten
dem Unternehmen einer pragmatistischen Bedeutungstheorie einige grundlegende
Bedingungen auferlegt. Das möchte ich im Folgenden kurz ausführen.
Betrachten wir die folgenden drei Sätze:
(1) Marlowe wird eine Orange schälen.
(2) Marlowe, schäle eine Orange!
(3) Wird Marlowe eine Orange schälen?
Wie jede plausible Theorie der sprachlichen Bedeutung muss auch eine pragmatistische
Bedeutungstheorie anerkennen, dass zwischen den Sätzen (1) bis (3) in semantischer Hinsicht
eine Gemeinsamkeit besteht. Zum einen darf man annehmen, dass die Bedeutung von
„Marlowe“, „schälen“, „eine“ und „Orange“ in allen drei Fällen dieselbe ist. Aber nicht nur
das, auch der semantische Zusammenhang zwischen diesen Ausdrücken scheint in einem
bestimmten Sinn derselbe zu sein: Es geht in allen drei Fällen um das bevorstehende Schälen
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 8
einer Orange durch Marlowe. Üblicherweise trägt man diesen beiden Tatsachen dadurch
Rechnung, dass man sagt, die drei Äußerungen hätten denselben propositionalen Gehalt,
nämlich, dass Marlowe eine Orange schälen wird. Die Syntax der Sätze (1) bis (3) wird
üblicherweise so aufgefasst, dass dieser semantischen Gemeinsamkeit eine syntaktische
Gemeinsamkeit entspricht. Was die Sätze (1) bis (3) in syntaktischer Hinsicht voneinander
unterscheidet, ist ihr Modus.10 (1) besitzt einen deklarativen, (2) einen imperativen und (3)
einen interrogativen Modus.11 Es ist für meine Zwecke nicht wichtig, in welchen Merkmalen
– Modus des Verbs, Wortstellung, Satzzeichen usw. – sich diese Unterscheidung manifestiert.
Man kann einfach die Gesamtheit der Merkmale eines Satzes, in denen sich sein Modus
manifestiert, unter dem Titel „Modusregler“ zusammenfassen.12 Jeder Satz besteht dann aus
zwei voneinander unabhängigen aber unselbstständigen syntaktischen Einheiten: einem
Modusregler und dem Rest. Der Modusregler enthält alle Elemente oder Aspekte des Satzes,
in denen sich der Satz-Modus manifestiert, aber nichts, was zum Ausdruck des
propositionalen Gehalts des Satzes beiträgt. Der Rest des Satzes, das „Satzradikal“, enthält
alle Elemente oder Aspekte des Satzes, die den propositionalen Gehalt des Satzes zum
Ausdruck bringen, aber nichts, in dem sich der Modus manifestiert.13 Diesem Bild zufolge
haben wir es in (1) bis (3) jeweils mit demselben Satzradikal (und daher mit demselben
propositionalen Gehalt) zu tun, das sich mit einen jeweils unterschiedlichen Modusregler zu
einem vollständigen Satz verbindet. Ich werde im Folgenden voraussetzen, dass dieses Bild
im Wesentlichen zutrifft.14
10 „Modus“ in diesem Sinn bezeichnet also keine Eigenschaft des Verbs (ob es im Indikativ, Imperativ oder
Konjunktiv steht) sondern des Satzes. Zur Vermeidung von Missverständnissen ist daher gelegentlich
vorgeschlagen worden, hier von „Satztyp“ anstelle von „Modus“ zu reden (vgl. etwa Stephen C. Levinson,
Pragmatics, Cambridge 1983, S. 243. Ich begnüge mich mit dieser Fußnote. 11 Dies sind die fundamentalen Satz-Modi, die in den meisten natürlichen Sprachen vorkommen (vgl.
Levinson, Pragmatics, 242, und die dortigen Verweise). 12 „Modusregler“ ist der Ausdruck, den Davidson (bzw. Davidsons Übersetzer) in Donald Davidson, „Modi
und performative Äußerungen“, in: Wahrheit und Interpretation, Frankfurt/M. 1986, S. 163-180, wählt; in
der Literatur sind noch viele andere Namen im Umlauf. 13 Vgl. Erik Stenuis, Wittgenstein's Tractatus, Oxford 1960, S. 159-164 und Erik Stenuis, „Mood and
Language-Game“, in: Synthese 17 (1967), S. 254-274, wo auch der Ausdruck „Satzradikal“ geprägt wird.
Alternativ kann man den Indikativ theoretisch privilegieren und davon ausgehen, dass der gemeinsame
Kern, der den propositionalen Gehalt zum Ausdruck bringt, in einem indikativischen Satz besteht. Sätze
anderer Modi bestehen dann aus einem indikativischen Kern und einen Modusregler (vgl. Davidson, „Modi
und performative Äußerungen“, S. 177; Gabriel Segal, „In the Mood for a Semantic Theory“, in:
Proceedings of the Aristotelian Society 91 (1990/1991), S. 103-118, hier S. 112. 14 Bisher war nur von der semantischen Funktion des Satzradikals die Rede. Wie sollen wir die semantische
Funktion des Modusreglers verstehen? Hier lassen sich zwei theoretische Traditionen unterscheiden: Zum
einen die Auffassung, dass dem Modusregler keine semantische Funktion zukommt, sondern er allein die
Aufgabe hat, die illokutionäre Kraft der entsprechenden Äußerung festzulegen (vgl. etwa Michael Dummett,
Frege. Philosophy of Language, London 1973, Kap. 10; für weitere Nachweise und eine eingehende Kritik
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 9
Was folgt hieraus für das Unternehmen einer pragmatistischen Bedeutungstheorie? Zunächst
eine einfache Adäquatheitsbedingung: Eine pragmatistische Bedeutungstheorie muss den
Gebrauch sprachlicher Ausdrücke in einer Weise begreifen, die eine Erklärung der Idee eines
identischen propositionalen Gehalts von Äußerungen, die sich in ihrer pragmatischen
Signifikanz unterscheiden, erlaubt. Dass das keine triviale Bedingung ist, kann man leicht
einsehen. Nehmen wir an, dass (1) dazu verwendet wird, um die Behauptung zu machen, dass
Marlowe eine Orange schält, (2), um den Befehl zu geben, dass Marlowe eine Orange schälen
soll, und (3), um die Frage zu stellen, ob Marlowe eine Orange schält. (Dass sich diese
Verbindung von Satz-Modus und Äußerungs-Typ nicht von selbst versteht, wird noch
Gegenstand der Diskussion sein.) Wir haben es dann mit drei Äußerungen zu tun, die sich in
ihrer pragmatischen Signifikanz drastisch unterscheiden werden, ganz unabhängig davon, wie
diese Signifikanz im Detail theoretisch konzeptualisiert wird: Sie sind in unterschiedlichen
Situationen angemessen, sie sind unter ganz verschiedenen Bedingungen akzeptabel, mit
ihnen werden unterschiedliche Festlegungen eingegangen, sie sind unterschiedlich zu
rechtfertigen usw. Wenn der propositionale Gehalt eines Satzes durch die pragmatische
Signifikanz von Äußerungen bestimmt sein soll, dann muss als erstes eine Erklärung dafür
her, wie Äußerungen einer ganz unterschiedlichen Signifikanz Äußerungen von Sätzen mit
demselben propositionalen Gehalt sein können.
Ein naiver Vorschlag könnte lauten, dass man einfach zwei voneinander unabhängige
Elemente oder Aspekte der pragmatischen Signifikanz einer jeden Äußerung unterscheiden
kann: Die pragmatische Signifikanz des Satz-Modus (die so genannte illokutionäre Kraft) auf
der einen Seite; und das, was man die pragmatische Signifikanz des propositionalen Gehalts
nennen könnte, auf der anderen Seite. Eine pragmatistische Bedeutungstheorie würde dann
einfach aus zwei Teilen bestehen: Einer Theorie der pragmatischen Signifikanz der
unterschiedlichen Modi und einer Theorie der pragmatischen Signifikanz der
unterschiedlichen propositionalen Gehalte. Bei genauerem Hinsehen erweist sich dieser
Gedanke aber als eine Sackgasse. Der Grund ist, dass er voraussetzt, dass dem Gedanken der
pragmatischen Signifikanz eines propositionalen Gehalts ganz unabhängig von seiner
vgl. Michael Pendlebury, „Against the Power of Force. Reflections on the Meaning of Mood“, in: Mind 95
(1986), S. 361-372). Zum anderen die Auffassung, dass der Modusregler sehr wohl eine Bedeutung hat, die
allerdings, anders als die Bedeutung anderer Satzelemente, nichts zum propositionalen Gehalt des Satzes
beiträgt (vgl. für unterschiedliche Ansätze dieser Art Davidson, „Modi und performative Äußerungen“;
Pendlebury, „Against the Power of Force“ oder Segal, „In the Mood for a Semantic Theory“). Wir müssen
uns hier nicht entscheiden, sondern können die Frage nach der semantischen Funktion des Modusreglers
offen lassen. Es bleibt daher auch offen, ob sich die Bedeutung eines Satzes in seinem propositionalen
Gehalt erschöpft, oder ob der propositionale Gehalt nur ein (selbstständiger) Teil der Bedeutung eines Satzes
ist.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 10
Verknüpfung mit irgendeiner illokutionären Kraft ein verständlicher Sinn abgerungen werden
kann. Das aber würde voraussetzen, dass wir in der Lage sind, für jeden propositionalen
Gehalt ganz unabhängig davon, mit welcher Kraft er ausgedrückt wird, ein eigenständiges
Stück sprachlicher Praxis ausfindig zu machen, das sich in nicht-semantischen und nicht-
intentionalen Begriffen beschreiben lässt. Doch wie sich an einem einfachen Beispiel
verdeutlichen lässt, scheint das kaum möglich zu sein: Wenn man etwa glaubt, dass die die
Bedeutung bestimmenden Aspekte der pragmatischen Signifikanz etwas mit der
Akzeptabilität von Äußerungen zu tun haben, wird man den propositionalen Gehalt einer
Behauptung etwa davon abhängig machen wollen, dass die Sprecherin weitere Behauptungen
akzeptiert, aus denen die fragliche Behauptung folgt, und dass sie die entsprechende
Folgerung anerkennen würde. Der propositionale Gehalt einer entsprechenden Frage
allerdings kann davon nicht in dieser Weise abhängen. Wer bereits Behauptungen akzeptiert,
aus denen sich die Antwort auf eine Frage folgern lässt, und bereit ist, diese Folgerung zu
ziehen, kennt die Antwort auf seine Frage in einem gewissen Sinn bereits und schmälert
insofern seine Berechtigung, die Frage überhaupt zu stellen. Allgemein gesprochen scheint
sich die pragmatische Signifikanz von Äußerungen nicht in der simplen Weise in Bestandteile
aufteilen zu lassen, wie das die naive Auffassung verlangt.15
Es bleibt aber noch eine weitere Möglichkeit, den Zusammenhang von pragmatischer
Signifikanz und propositionalem Gehalt zu begreifen. Grob gesprochen ist der Gedanke der,
dass propositionale Gehalte zwar in dem Sinn unabhängig von illokutionären Kräften sind,
dass sie sich in einzelnen Fällen mit verschiedenen Kräften verbinden können, dass sie aber
dennoch konstitutiv von einer bestimmten illokutionären Kraft abhängig sind. Dieser Ansatz
vermeidet den Fehler der naiven Auffassung, dem propositionalen Gehalt einen von jeder
illokutionären Kraft unabhängigen Bestandteil der pragmatischen Signifikanz von
Äußerungen zuzuerkennen. Ihm zufolge sind propositionale Gehalte ihrem Wesen nach die
Gehalte einer bestimmten – theoretisch ausgezeichneten – Art von Sprechakten. Dass
Sprechakte verschiedener Arten denselben propositionalen Gehalt haben, wird dann nicht
dadurch erklärt, dass ihre pragmatische Signifikanz einen identischen Bestandteil aufweist,
sondern dadurch, dass sie eine bestimmte Beziehung zu einem Sprechakt der ausgezeichneten
15 Es lässt sich natürlich ganz unproblematisch eine Gemeinsamkeit der drei Äußerungen, die ihrem
identischen Gehalt entspricht, begrifflich festmachen, aber nur dann, wenn man dabei bereits semantisches
Vokabular verwendet: Wenn es einen propositionalen Akt (Searle) gibt, der im Zuge des Machens aller drei
Äußerungen vollzogen wird, dann den des Äußerns von Worten, die den propositionalen Gehalt haben, dass
Marlowe eine Orange schälen wird. Aber um zu verstehen, was es heißt, einen solchen Akt zu vollziehen,
müssen wir natürlich immer schon verstanden haben, was es für Sätze heißt, einen propositionalen Gehalt zu
haben.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 11
Art aufweisen, der diesen Gehalt besitzt. An einem einfachen Beispiel: Die Gemeinsamkeit
der Behauptung, dass p, und der Frage, ob p, sollte von der naiven Auffassung so erklärt
werden, dass dem propositionalen Gehalt, dass p, eine bestimmte Signifikanz zugewiesen
wird, die dann beliebigen Sprechakten gemeinsam sein kann. Die plausiblere Auffassung
bestimmt dagegen die Gemeinsamkeit so, dass sie in einem ersten Schritt den propositionalen
Gehalt als den Gehalt von, sagen wir, Behauptungen bestimmt und angibt, welche
pragmatische Signifikanz eine Behauptung haben muss, um den Gehalt, dass p, zu besitzen; in
einem zweiten Schritt kann dann erklärt werden, dass eine Frage denselben propositionalen
Gehalt hat wie eine entsprechende Behauptung, wenn, sagen wir, eine bejahende Antwort auf
die Frage dieselbe pragmatische Signifikanz besitzt wie diese Behauptung. Die Idee einer
unabhängig von jeder illokutionären Kraft bestimmbaren pragmatischen Signifikanz des
propositionalen Gehalts kommt in der plausibleren Erklärung nicht mehr vor.
Wenn diese Überlegungen zutreffen, dann wird jede pragmatistische Bedeutungstheorie auf
folgende Weise vorgehen müssen: In einem ersten Schritt gibt die Theorie an, was es für
Sprechakte heißt, Sprechakte einer bestimmten – der theoretisch privilegierten – Art zu sein.
Da es aus verschiedenen Gründen, denen ich hier nicht nachgehen werde, zwingend ist, das
Privileg auf die Behauptungen fallen zu lassen, geht es hier darum, die pragmatische
Signifikanz von Behauptungen als solchen zu bestimmen, und zwar in einer Weise, die keine
semantischen oder intentionalen Begriffe voraussetzt.
In einem zweiten Schritt wird dann ein Begriff des Gehalts der privilegierten Art von
Sprechakten eingeführt. Wenn es sich bei der privilegierten Art um die Behauptungen
handelt, kann man diese theoretische Festlegung dadurch explizit machen, dass man
propositionalen Gehalt als „behauptbaren Gehalt“ bezeichnet – wie das etwa Brandom tut.16
Zu diesem Zweck müssen Behauptungen in pragmatischen Begriffen so fein individuiert
werden, dass sich alle Unterschiede des Gehalts als Unterschiede in der pragmatischen
Signifikanz verschiedener Behauptungen einfangen lassen.
Erst im dritten Schritt wird der entscheidende Übergang von einer Theorie der pragmatischen
Signifikanz von Sprachakten zu einer Theorie der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke
vollzogen. Zu diesem Zweck muss auf die in (B1) dargelegte Weise der Begriff des Satzes in
die Theorie eingeführt und der Begriff des propositionalen Gehalts von Sätzen durch den des
(„behauptbaren“) Gehalt von Behauptungen definiert werden. Dieser Schritt ist von einer
nicht zu überschätzenden Bedeutung, denn erst mit ihm kann die pragmatistische
16 So spricht Brandom auch davon, dass Gehalte „wegen ihrer Behauptbarkeit propositionale Gehalte“ sind
(Brandom, Expressive Vernunft, 282).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 12
Bedeutungstheorie Anspruch darauf erheben, eine systematische semantische Erklärung der
kompositionalen Struktur sprachlicher Bedeutung zu geben. Semantik zu betreiben bedeutet –
unter anderem –, zu erklären, was es für Sätze heißt, eine bestimmte Bedeutung zu haben,
und wir die Bedeutung von Sätzen sich zueinander und zu der Bedeutung der Teile, aus denen
sie bestehen, und der Form ihrer Zusammensetzung verhält. Wie jede andere
Bedeutungstheorie muss auch eine pragmatistische Bedeutungstheorie eine Konzeption des
semantischen Gehalts entwickeln, die sich nicht nur auf Äußerungen, sondern auch auf Sätze
beziehen lässt, die geäußert werden. Für jeden möglichen Gehalt muss ein Satz identifiziert
werden können, der diesen Gehalt zum Ausdruck bringt, und für jeden Satz muss der Gehalt
spezifiziert werden können, den er zum Ausdruck bringt.
Schließlich muss die Theorie in weiteren Schritten zum einen eine Auffassung davon
entwickeln, was es für Sprechakte nicht-privilegierter Arten heißt, einen bestimmten
semantischen Gehalt zum Ausdruck zu bringen. Nach dem Bisherigen ist diese Erklärung nur
so möglich, dass man eine eindeutige Beziehung jeder Äußerung einer nicht-privilegierten Art
zu einer bestimmten Behauptung herstellt. Zum anderen muss die Erklärung des Gehalts
sprachlicher Ausdrücke dahin gehend erweitert werden, dass nicht nur Sätzen, sondern auch
Ausdrücken unterhalb der Satzebene Gehalt zugesprochen wird. Hier geht es darum, in
Begriffen pragmatischer Signifikanz eine plausible Auffassung des Gehalts verschiedener
Arten von Ausdrücken zu entwickeln und zu erklären, wie sich der Gehalt von Ausdrücken
unterhalb der Satzebene zum Gehalt der Sätze verhält, in denen sie vorkommen.
Es ist der dritte theoretische Schritt, der Übergang von einer Theorie der pragmatischen
Signifikanz von Sprechakten zu einer Theorie der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, den ich
im Folgenden problematisieren möchte. Betrachten wir den dritten Schritt einer
pragmatistischen Erklärung sprachlicher Bedeutung noch einmal etwas genauer. Wir
verfügen, so nehmen wir an, an dieser Stelle bereits über eine Theorie der pragmatischen
Signifikanz von Behauptungen, die sowohl sagt, was eine bestimmte Verhaltensweise zu einer
Behauptung macht, als auch, was eine Behauptung zu einer bestimmten Behauptung, zu einer
Behauptung mit einem bestimmten behauptbaren Gehalt, macht. Eingeführt werden muss der
grundlegende semantische Begriff des Satzes und eine Erklärung dessen, was es für einen
bestimmten Satz heißt, eine bestimmte Bedeutung zu haben. Die einfachste Möglichkeit, das
in Begriffen der pragmatischen Signifikanz von Äußerungen zu tun, wäre wohl eine
Definition wie etwa die folgende:
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 13
(SB) Ein sprachlicher Ausdruck x ist genau dann ein (deklarativer) Satz, der
bedeutet, dass p, wenn jede (potenzielle) Äußerung eines Vorkommnisses von x
das Aufstellen der Behauptung, dass p, ist.
Um die Dinge möglichst einfach zu halten, werde ich mich im Folgenden auf jenen Teil
dieser Definition beschränken, der den Begriff des (deklarativen) Satzes ganz unabhängig von
dessen Bedeutung bestimmt:
(S) Ein sprachlicher Ausdruck x ist genau dann ein (deklarativer) Satz, wenn jede
(potenzielle) Äußerung eines Vorkommnisses von x das Aufstellen einer
Behauptung ist.17
Ich werde im Rest dieses Aufsatzes zu zeigen versuchen, dass eine pragmatistische
Bedeutungstheorie an der Bedingung scheitert, auf der Basis einer Theorie des Behauptens
eine Bestimmung deklarativer Sätze zu geben, die von semantischem und intentionalem
Vokabular unabhängig ist.
2. Einige aufsässige pragmatische Phänomene
Nun ist die Definition (S) anscheinend keine ernsthafte Kandidatin, da sie offensichtlich
inadäquat ist, wenn wir sie mit unserer alltäglichen sprachlichen Praxis vergleichen. Da wir
im Rahmen dieser Praxis für jeden sprachlichen Ausdruck einige (potenzielle) Äußerungen
finden, die keine Behauptungen sind, wäre das Ergebnis, dass unsere Alltagssprache keine
(deklarativen) Sätze enthält!18 Dass das so ist, liegt unter anderem an folgenden Phänomenen,
die in unserer sprachlichen Praxis vorkommen:
„Indirekte Sprechakte“ – Wir äußern laufend deklarative Sätze, nicht um Behauptungen zu
machen, sondern um Sprechakte anderer Arten zu vollziehen. Wahrscheinlich werden Sätze
17 Entsprechend heißt es bei Brandom: „Der elementare Zug im Spiel des Lieferns und Forderns von Gründen
ist das Aufstellen einer Behauptung […]. Weitere theoretisch wichtige Begriffe werden auf dieser Grundlage
definiert: die sprachliche Praxis dadurch, daß sie einigen Akten die Signifikanz von Behauptungen zuweist,
und (Aussage-)Sätze als Ausdrücke, deren Äußerungen, Niederschriften oder sonstige Verwendungsfälle im
Normalfall als Behauptungen gelten.“ (Brandom, Expressive Vernunft, 219f.) Ich werde weiter unten auf die
Einschränkung zu sprechen kommen, dass (deklarative) Sätze als solche Äußerungen definiert werden, die
„im Normalfall“ Behauptungen sind. 18 Außerdem müssten wir sagen, dass alle Arten von Sätzen deklarativ sind, da wir mit allen Arten von Sätzen
Behauptungen aufstellen können.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 14
wie „Du wirst jetzt sofort dein Zimmer aufräumen“ oder „Wenn Du das tust, dann kannst Du
was erleben“ kaum je mit behauptender Kraft geäußert.
Performative Äußerungen – Das gilt insbesondere für die so genanten „explizit
performativen“ Äußerungen, also Äußerungen wie „Ich befehle Dir, dein Zimmer
aufzuräumen“ oder „Ich verspreche Dir, dein Zimmer aufzuräumen“, bei denen es sich
vielleicht um eine Unterklasse der indirekten Sprechakte handelt.
Äußerungen im Kontext fiktionalen Diskurses – Wenn eine Autorin einen fiktionalen Text
schreibt oder veröffentlicht oder ein Vater seinem Kind eine Gutenachtgeschichte erzählt,
werden viele deklarative Sätze geäußert, aber keine Behauptungen gemacht. Es wäre nicht
angemessen, die Wahrheit der geäußerten Sätze anzufechten, Rechtfertigungen einzufordern
oder die Sprecherinnen und Sprecher als jemanden zu behandeln, die oder der diese Sätze für
wahr hält.
Äußerungen auf der Bühne – Wenn eine Schauspielerin auf der Bühne einen deklarativen Satz
äußert, macht sie in der Regel keine Behauptung, sondern stellt höchstens eine Person dar, die
eine Behauptung macht. (Es kann natürlich auch sein, dass sie eine Person darstellt, die durch
die Äußerung eines deklarativen Satzes ein Versprechen gibt.).
Einige andere Phänomene – Wenn jemand einen Witz erzählt, entbehren seine Äußerungen
deklarativer Sätze oft der behauptenden Kraft. Dasselbe gilt für Äußerungen deklarativer
Sätze im Rahmen von Beispielen oder Gedankenexperimenten in philosophischen oder
anderen wissenschaftlichen Texten. Und selbst im Kontext von strikt logischen Argumenten
können deklarative Sätze ohne behauptende Kraft geäußert werden, etwa als Annahmen, die
ad absurdum geführt werden sollen.
Die genannten Phänomene zerfallen grob in zwei Klassen: Im Fall der indirekten Sprechakte
und der explizit performativen Äußerungen ist der deklarative Modus mit einer anderen Kraft
verbunden als der des Behauptens. Ich werde Äußerungen, für die dies gilt, im Folgenden
pauschal unter dem Titel „indirekte Sprechakte“ zusammenfassen. Im Fall der fiktionalen
Rede, des Schauspiels und der anderen Phänomene sollte vielleicht eher bezweifelt werden,
dass die Äußerungen überhaupt eine illokutionäre Kraft im üblichen Sinn haben. Nur um ein
Etiketten bei der Hand zu haben, werde ich Äußerungen dieser Art im Folgenden als
„unernsthafte Sprechakte“ bezeichnen.
Wie kann eine pragmatistische Bedeutungstheorie mit diesen Phänomenen umgehen? Wenn
ich recht sehe, stehen ihr zwei Strategien zur Verfügung. Die erste Strategie besteht darin, die
genannten Phänomene als in irgendeinem Sinn abgeleitete oder sekundäre Fälle zu begreifen
und die Definition auf die ursprünglichen oder primären Fälle zu begrenzen. Das muss
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 15
natürlich mit einiger Umsicht getan werden, damit sichergestellt ist, dass die Bestimmung der
ursprünglichen oder primären Fälle die Definition weder zirkulär werden lässt, noch implizit
semantisches oder intentionales Vokabular verwendet.
Die beste mir bekannte Möglichkeit einer solchen Präzisierung der Definition (S) bedient sich
des Gedankens, dass Sätze einer bestimmten Art „im Normalfall“ („by default“) eine
bestimmte Kraft besitzen, was dann so erklärt wird, dass ein Satz genau dann „im
Normalfall“ eine bestimmte Kraft besitzt, wenn er diese Kraft solange besitzt, wie keine
besonderen Hinweise auf die illokutionäre Kraft vorliegen. Modifizieren wir also (S)
entsprechend:
(S*) Ein sprachlicher Ausdruck x ist genau dann ein (deklarativer) Satz, wenn eine
(potenzielle) Äußerung eines Vorkommnisses von x im Normalfall (d. h. wenn
keine besonderen Hinweise vorliegen) das Aufstellen einer Behauptung ist.19
Die zweite Strategie, die eine pragmatistische Bedeutungstheorie angesichts der Existenz der
theoretisch aufsässigen Phänomene einschlagen könnte, besteht darin, die Existenz dieser
Phänomene zu einem oberflächlichen oder akzidentellen Merkmal unserer sprachlichen Praxis
zu erklären. Der Gedanke wäre dann, dass unsere sprachliche Praxis zwar tatsächlich so
beschaffen ist, dass sie Phänomene enthält, die sich mit den Mitteln einer pragmatistischen
Bedeutungstheorie nicht erfassen lassen, dass das aber kein Merkmal dieser Praxis als einer
sprachlichen Praxis ist und dass es entsprechend eine sprachliche Praxis geben könnte, die
diese Phänomene nicht enthält und für die dann die Definition (S) ohne Modifikation
angemessen wäre. Eine pragmatistische Bedeutungstheorie wäre dann zu verstehen nicht als
eine Beschreibung und Erklärung unserer alltäglichen sprachlichen Praxis, sondern als eine
Beschreibung und Erklärung eines idealisierten Modells dieser Praxis.
Ich werde diese beiden Strategien nun über den Umweg der Diskussion eines
sprachphilosophischen Prinzips kritisieren, dass sich in den Arbeiten Donald Davidsons unter
dem Titel „Prinzip der Autonomie der Bedeutung“ vertreten findet. Die Diskussion dieses
Prinzips und eines nahe liegenden Einwands gegen dieses Prinzip wird mich in die Lage
versetzen, zuerst die zweite und dann auch die erste mögliche Strategie pragmatistischer
Bedeutungstheorien, mit den Phänomenen der indirekten und der unernsthaften Sprechakte
umzugehen, zurückzuweisen.
19 Dies entspricht nun tatsächlich Brandoms Definition in Brandom, Expressive Vernunft, 219f. (siehe oben
Anm. 17). Die These, dass die Verbindung von Modus und Kraft „im Normalfall“ vorliegt, findet sich auch
in Segal, „In the Mood for a Semantic Theory“, 117; Segal geht es dabei allerdings nicht um das Problem
der Definition des Begriffs des (deklarativen) Satzes in Begriffen pragmatischer Signifikanz.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 16
3. Das Prinzip der Autonomie der Bedeutung
In diesem Abschnitt möchte ich die These erläutern und verteidigen, dass der Versuch, die
Bedingungen, unter denen die Verwendung eines Satzes einer bestimmten Art den Vollzug
eines Sprechakts einer bestimmten Art darstellt, in nicht-intentionalen Begriffen zu
spezifizieren, nicht gelingen kann. Der Grund, warum er misslingen muss, ist, dass eine
konstitutive Unabhängigkeit bestimmter Aspekte sprachlicher Bedeutung von den nicht-
intentional spezifizierbaren Umständen ihres Gebrauchs zu unserem Begriff der Sprache
dazugehört.
Der Gedanke einer bestimmten Art von Unabhängigkeit von Bedeutung und Gebrauch, um
den es mir geht, wurde meines Wissens erstmals ausdrücklich von Donald Davidson unter
dem Titel des „Prinzips der Autonomie der Bedeutung“ gefasst.20 Davidson führt dieses
Prinzip im Kontext einer Untersuchung der Frage ein, ob es eine Konvention geben kann, die
die illokutionäre Kraft einer Äußerung konstituiert. Davidson verneint diese Frage aufgrund
eines Arguments, das, wie er sagt, das Prinzip der Autonomie der Bedeutung
veranschauliche.21
Sein Argument lässt sich für unsere Zwecke wie folgt rekonstruieren: Ein konventionelles
Merkmal eines sprachlichen Ausdrucks ist ein syntaktisch-semantisches Merkmal, das
hinsichtlich seiner Funktion von den jeweiligen Absichten der Sprecherin unabhängig ist. Der
deklarative Modus eines Satzes ist so ein Merkmal. Wie die aufsässigen Phänomene zeigen,
kann er allein aber nicht dafür Sorge tragen, dass ein Satz eine Behauptung ist. Darüber
hinaus kann aber auch nichts anderes, was sich in Form eines konventionellen Zeichens zum
Ausdruck bringen lässt, dazu verwendet werden, den Modus so zu „verstärken“, dass die
entsprechende Äußerung die Kraft einer Behauptung besitzen muss. Denn „jeder Spaßvogel,
Märchenerzähler und Schauspieler wird sich sogleich den verstärkten Modus zunutze machen,
um Behauptungen vorzutäuschen“22. Also kann gar kein syntaktisch-semantisches Merkmal
des Geäußerten, das hinsichtlich seiner Funktion von den jeweiligen Absichten der Sprecherin
20 Vgl. Davidson, „Modi und performative Äußerungen“; vgl. vor allem auch Davidson, „Kommunikation und
Konvention“. Davidson geht es primär um die These, dass die Modi von Sätzen mit den illokutionären
Kräften von Sprechakten durch Konventionen verbunden sind, aber seine Überlegungen lassen sich ohne
Schwierigkeiten verallgemeinern. 21 Vgl. Davidson, „Modi und performative Äußerungen“, 169. 22 Davidson, „Modi und performative Äußerungen“, 169.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 17
unabhängig ist, dafür Rechnung tragen, dass eine entsprechende Äußerung eine Behauptung
ist.23 Er fährt fort:
Was durch dieses Argument veranschaulicht wird, ist ein Grundzug der Sprache; man mag ihn die
Autonomie der sprachlichen Bedeutung nennen. Sobald ein Merkmal der Sprache auf
konventionelle Weise zum Ausdruck gebracht wird, kann man es zu vielen außersprachlichen
Zwecken verwenden; jede enge Verknüpfung mit einem außersprachlichen Zweck wird durch die
symbolische Darstellung unweigerlich zerrissen.24
Bevor ich mich mit der Frage der Begründung dieses Prinzips zuwende, möchte ich
versuchen, das Prinzip selbst allgemeiner zu formulieren. Ein erster Vorschlag könnte lauten:
(PAB1) Es kann keine enge Beziehung zwischen syntaktisch-semantischen Merkmalen
eines Satzes, die hinsichtlich ihrer Funktion von den jeweiligen Absichten der
Sprecherin unabhängig sind, und den außersprachlichen Zwecken, zu denen der
Satz gebraucht werden kann, geben.
Aber die Rede von „außersprachlichen“ Zwecken ist in diesem Zusammenhang verwirrend.
So formuliert, betrifft das Prinzip eher den Zusammenhang zwischen der Bedeutung eines
Satzes und dem, was Austin den perlokutionären Akt genannt hat. Die Beziehung, die uns
interessiert, ist jedoch die zwischen Bedeutung und illokutionärer Kraft. (Wenn das Prinzip
für die illokutionäre Kraft gilt, gilt es auch für die perlokutionären Zwecke, da der
illokutionäre Akt per definitionem ein Mittel zur Erreichung der perlokutionären Zwecke
darstellt. Aber das Umgekehrte ist nicht der Fall.) Wir möchten Vielleicht den Zweck, ein
Bier zu bekommen, einen „außersprachlichen“ Zweck nennen, den Zweck, eine Behauptung
zu machen, aber wohl eher nicht.25 Modifizieren wir (PAB1) entsprechend, gelangen wir zu:
(PAB2) Es kann keine enge Beziehung zwischen syntaktisch-semantischen Merkmalen
eines Satzes, die hinsichtlich ihrer Funktion von den jeweiligen Absichten der
Sprecherin unabhängig sind, und den illokutionären Kräften der Sprechakte, die
mit dem Äußern des Satzes vollzogen werden können, geben.
23 In einer bekannten Passage illustriert Davidson denselben Sachverhalt am Beispiel eines Schauspielers, der
versucht, das Publikum von der Existenz eines Feuers zu überzeugen: „Malen wir uns folgende Situation
aus: Der Schauspieler mimt eine Szene, in der ein Feuer ausbrechen soll (z. B. Albees Tiny Alice). Seine
Rolle verlangt, daß er möglichst überzeugend jemanden darstelle, der andere vor einem Feuer zu warnen
versucht. ‚Feuer!‘ ruft er, und vielleicht fügt er noch auf Anweisung des Autors hinzu: ‚Ich meine es ernst!
Seht doch, der Qualm!‘ usw. Und nun bricht ein wirkliches Feuer aus, und der Schauspieler versucht
vergebens, das wirkliche Publikum zu warnen. ‚Feuer!‘, ruft er, ‚ich meine es ernst! Seht doch, der Qualm!‘
usw.“ (Davidson, „Kommunikation und Konvention“, S. 378f.). 24 Davidson, „Modi und performative Äußerungen“, 169. 25 Davidson trägt dieser Tatsache Rechnung in Davidson, „Kommunikation und Konvention“.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 18
Aber dieses Prinzip ist unter einer gewissen Lesart dessen, was hier mit einer „engen
Beziehung“ gemeint ist, falsch und nicht einmal mit Davidsons eigener Auffassung des
Zusammenhangs von Satz-Modus und illokutionärer Kraft verträglich.
Für unsere Zwecke lässt sich der Grundgedanke von Davidsons Auffassung dieses
Zusammenhangs wie folgt darstellen:26 Der Modusregler hat, wie das Satzradikal, eine
bestimmte Bedeutung; und wie das Satzradikal bedeutet er, dass etwas der Fall ist. Während
das Satzradikal den propositionalen Gehalt des geäußerten Satzes zum Ausdruck bringt,
bringt der Modusregler zum Ausdruck, dass die Äußerung des ganzen Satzes eine bestimmte
illokutionäre Kraft hat (auch dieser Gehalt hat eine propositionale Form, aber ich werde den
Titel „propositionaler Gehalt“ weiterhin für den Gehalt des Satzradikals reservieren). Der Satz
(2) etwa hat also, wenn er bei einer bestimmten Gelegenheit geäußert wird, den
propositionalen Gehalt, dass Marlowe eine Orange schälen wird, aber er hat darüber hinaus
noch die Bedeutung, dass es sich bei dieser Äußerung um einen Befehl handelt. Wenn es sich
um einen Befehl handelt, ist die Proposition, die der Modusregler zum Ausdruck bringt, wahr,
sonst falsch.27
Was auch immer man von dieser Auffassung hält, sie impliziert auf jeden Fall, dass es in
einem bestimmten Sinn eine „enge Beziehung“ zwischen den syntaktisch-semantischen
Merkmalen von Sätzen und der illokutionären Kraft von Sprechakten, die mit diesen
Äußerungen vollzogen werden, gibt. Diese Beziehung besteht darin, dass die Äußerungen
sich durch die Bedeutung des Modus der Sätze, mit denen sie vollzogen werden, als
Äußerungen darstellen, die eine bestimmte Kraft haben.
Der Punkt, um den es Davidson geht, kann besser so ausgedrückt werden, dass es keine
konstitutive Beziehung zwischen den syntaktsich-semantischen Merkmalen von Sätzen und
der illokutionären Kraft der mit ihnen vollzogenen Äußerungen geben kann:
(PAB3) Es kann keine konstitutive Beziehung zwischen syntaktisch-semantischen
Merkmalen eines Satzes, die hinsichtlich ihrer Funktion von den jeweiligen
Absichten der Sprecherin unabhängig sind, und der illokutionären Kraft des
Sprechakts, der mit dem Äußern des Satzes vollzogen wird, geben.
26 Davidsons eigene Auffassung weicht von dieser Darstellung insofern ab als er die Trennung in Modusregler
und Satzradikal nicht vornimmt, sondern Sätze im Indikativ als Träger des propositionalen Gehalts begreift,
sodass dem indikativischen Modus auf der Ebene der logischen Form kein Modusregler entspricht. Aber
dieser Unterschied betrifft nicht den Punkt, um den es mir hier geht. 27 Dies darf nicht dahin gehend missverstanden werden, dass mit der Äußerung des Modusreglers behauptet
würde, dass die Äußerung ein Befehl ist. Nur mit vollständigen Sätzen lässt sich ein Sprechakt vollziehen
und die Äußerung des Modusreglers ist bloß ein Aspekt der Äußerung eines vollständigen Satzes.
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 19
Aber warum ist das so? Davidson begründet dieses Prinzip zwar durch den Fall der
Schauspielerin und es Witze-Erzählers, er erklärt aber nicht, welche Rolle dieses Prinzip für
unsere sprachliche Praxis spielt. Eine solche Erklärung ist aber wichtig. Denn ansonsten
könnte man zugestehen, dass unsere sprachliche Praxis zwar faktisch so beschaffen ist, dass
sie dem Prinzip der Autonomie der Bedeutung gehorcht, dass das aber auch schon alles ist
und es sich bei diesem Prinzip nicht um einen Wesenszug sprachlicher Praxis überhaupt
handelt. Davidson aber möchte offenbar behaupten, dass sprachliche Ausdrücke und
sprachliche Äußerungen ihrem Wesen nach so beschaffen sind, dass zwischen der Form und
Bedeutung von ersteren und der Kraft von letzteren keine konstitutive Beziehung bestehen
kann. Immerhin nennt der das Prinzip einen „Grundzug der Sprache“.
Wir können uns einem Verständnis der Rolle, die das Prinzip der Autonomie der Bedeutung
für unsere sprachliche Praxis spielt, annähern, indem wir einen nahe liegenden Einwand
dagegen betrachten, den R. M. Hare formuliert hat.28 Hare verweist zunächst darauf, dass es
offensichtlich bestimmte Fälle sprachlicher Äußerungen wie etwa das Unterzeichnen eines
Vertrags oder die Aussage vor Gericht gibt, für die Normen existieren, die besagen, dass die
Äußerung eines bestimmten Ausdrucks als Vollzug eines Sprechaktes mit einer bestimmten
Kraft gilt. Jemand, der einen Vertrag unterzeichnet hat, kann sich nicht damit herausreden,
dass er nur einen Witz gemacht habe.29 Es scheint daher völlig angebracht zu sagen, dass in
diesen Fällen die syntaktisch-semantischen Merkmale des geäußerten Ausdrucks die Kraft der
Äußerung konstituieren.
Hare behauptet nun, dass es sehr wohl möglich sei, ein Gesetz oder eine sprachliche
Konventionen einzuführen, die besagt, dass alle und nur die Äußerungen, denen ein
bestimmtes Zeichen vorangestellt wird, ernsthafte Sprechakte sind und damit die illokutionäre
Kraft haben, von denen – wenn Davidson Recht hat – die Modusregler sagen, dass sie sie
haben. Ein solches Zeichen würde – zusammen mit dem Modusregler – die illokutionäre
Kraft eines Sprachakts konstituieren und das Prinzip der Autonomie der Bedeutung würde für
diese sprachliche Praxis nicht mehr gelten. Hare sagt, dass die Existenz eines solchen
Gesetzes die Schauspielerei unmöglich machen würde. Das ist übertrieben. Die
28 R. M. Hare, „Some Sub-Atomic Particles of Logic“, in: Mind 98 (1989), S. 23-37. 29 Vgl. Hare, „Some Sub-Atomic Particles of Logic“, 26f. Hare formuliert den Punkt um den es geht, etwas
anders, da er eine systematische Unterscheidung trifft zwischen Modusreglern, die zwischen den
verschiedenen illokutionären Kräften zu unterscheiden erlauben sollen, und einem Zeichen, das zwischen
Äußerungen unterscheiden soll, die überhaupt eine illokutionäre Kraft im engeren Sinn haben, und solchen,
wie denen der Schauspielerin oder des Witzeerzählers, für die das nicht gilt. Ihn beschäftigt daher die Frage,
ob es ein Zeichen der Ernsthaftigkeit von Sprechakten geben kann oder muss, das er „sign of subscription“
nennt (S. 25).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 20
Schauspielerin könnte, um jemanden darzustellen, der eine Behauptung macht, immer noch
all die nicht-konstitutiven Anzeichen ernsthaften Behauptens verwenden, die wir, denen das
Ernsthaftigkeits-Zeichen fehlt, verwenden, wenn wir signalisieren wollen, dass wir es Ernst
meinen. Sie könnte nur nicht das Ernsthaftigkeits-Zeichen selbst verwenden, denn dann würde
sie aufhören, jemanden zu spielen, der eine Behauptung macht, und selbst eine machen.
Man könnte einwenden, dass eine sprachliche Praxis, die von einem Ernsthaftigkeits-Gesetzes
beherrscht wird, sehr viel restriktiver wäre als unsere tatsächliche sprachliche Praxis. Aber
das ist kein Einwand, da es nicht impliziert, dass es eine solche Praxis nicht geben kann. Und
das besagt ja das Prinzip der Autonomie der Bedeutung in seiner Anwendung auf den Fall der
illokutionären Kraft.
Wenn Hare mit seinem Einwand gegen das Prinzip der Autonomie der Bedeutung Recht hat,
ist die zweite mögliche Strategie pragmatistischer Bedeutungstheorien, mit den aufsässigen
Phänomenen umzugehen, gangbar, Diese bestand ja gerade in dem Zugeständnis, dass in
unserer tatsächlichen sprachlichen Praxis Äußerungen deklarativer Sätze nicht immer (oder
auch nur „im Normalfall“) Behauptungen sind, dass man aber ein idealisiertes Modell unserer
sprachlichen Praxis konstruieren könne, in dem das – per Setzung – der Fall ist.
Mir scheint aber, dass Hares Einwand und die imaginierte Reaktion der pragmatischen
Bedeutungstheorie beide grundlegend verfehlt sind. Das Prinzip der Autonomie der
Bedeutung besagt nicht, dass wir uns keine soziale Praxis vorstellen können oder dass keine
soziale Praxis existieren kann, die unserer sprachlichen Praxis in vielerlei Hinsicht gleicht,
sich von ihr aber dadurch unterscheidet, dass illokutionäre Kraft durch syntaktisch-sematische
Merkmale konstituiert wird. Es besagt vielmehr, dass eine solche Praxis – hinsichtlich genau
dieses Punkts – nicht länger als eine Form sprachlicher Praxis erkennbar wäre.
Um die volle Kraft dieser Antwort würdigen zu können, müssen wir klären, was genau wir
verlieren würden, wenn wir das Prinzip der Autonomie der Bedeutung aufgäben. Und mm das
zu sehen, müssen wir uns klarmachen, wie unserem vortheoretischen Verständnis sprachlicher
Praxis zufolge die illokutionäre Kraft von Sprechakten mit den jeweiligen Absichten und
anderen mentalen Zuständen von Sprecherinnen und Sprechern verbunden ist: Wenn man
behauptet, dass p, stellt man sich als jemanden dar, der oder die glaubt, dass p, und gute
Gründe hat zu glauben, dass p. Gute Gründe für die Wahrheit einer Aussage sind nun in dem
Sinn objektiv, dass wir, wenn jemand gute Gründe hat zu glauben, dass p, auch sagen können,
dass es gute Gründe gibt, zu glauben, dass p, und dass in diesem Sinn für alle gute Gründe
existieren zu glauben, dass p. Dass bedeutet, dass man mit der Behauptung, dass p,
mindestens folgendes tut: Erstens berechtigt man diejenigen, an die die Behauptung adressiert
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 21
ist, (auf der Basis von Hörensagen) zu glauben, dass p; zweitens berechtigt man sie damit
auch dazu, in der Konversation mit anderen zu behaupten, dass p; drittens dazu, auf der Basis
der Überzeugung, dass p, zu handeln; und viertens dazu, andere zu entsprechenden
Handlungen zu veranlassen. Wir können das auch kurz so formulieren, dass wir dadurch, dass
wir eine Behauptung machen, eine Garantie dafür, dass es sich so verhält, wie wir sagen, oder
kurz: eine Wahrheitsgarantie übernehmen.
Nun scheint mir, dass diese Funktionen – der Transfer von Wissen und das damit verbundene
Liefern von Handlungsgründen – für unsere sprachliche Praxis dermaßen zentral sind, dass
eine soziale Praxis, die keine Akte enthält, die diese Funktion erfüllen, sich wesentlich von
unserer sprachlichen Praxis unterschiede. Wir hätten allen Grund zu bezweifeln, dass es sich
hierbei tatsächlich um eine sprachliche Praxis handelt.
Wenn das stimmt, dann lässt sich nun der Grund benennen, warum es kein Ernsthaftigkeits-
Zeichen im Sinn eines syntaktisch-semantischen Merkmals, dessen Vorkommnis unabhängig
von den jeweiligen Absichten der Sprecherin die illokutionäre Kraft einer Äußerung
konstituiert, geben kann. Nehmen wir an, ein solches Zeichen würde es geben. Wenn man es
verwendete, hätte man eine Behauptung gemacht, und zwar ausschließlich deswegen, weil
man es verwendet – völlig unabhängig davon, ob man beabsichtigt hat, eine Behauptung zu
machen, und damit auch völlig unabhängig davon, ob man glaubt, was man sagt. Aber wenn
es eine Behauptung ist, die man gemacht hätte, dann hätte man, wenn das Vorangegangene
korrekt ist, eine Garantie für die Wahrheit dessen übernommen, was man gesagt hat, und
Verantwortung für Handlungen, die ausgeführt werden, weil jemand aufgrund von
Hörensagen glaubt, was man gesagt hat. Aber das ist absurd: Die Berechtigung dafür,
jemanden als jemanden zu behandeln, der bestimmte Absichten und Überzeugungen hat, kann
doch sinnvollerweise nur auf Belegen für das Vorhandensein dieser Absichten oder
Überzeugungen beruhen und nicht einfach auf der Gegenwart irgendeines davon
unabhängigen Merkmals seiner Äußerung. Das lässt sich vielleicht besonders leicht einsehen,
wenn wir den Fall aus der Perspektive einer Hörerin betrachten. Selbst wenn es sich bei dem
Sprecher um eine Person handelt, die die Hörerin für vertrauenswürdig hält, wäre es zutiefst
irrational, wenn sie ihre Handlungen auf Wahrheitsgarantien stützen würde, die dem Sprecher
allein deswegen zugeschrieben werden, weil er das Ernsthaftigkeits-Zeichen äußert, und also
unabhängig davon, ob er die Bedeutung des Zeichens kennt, glaubt, dass seine Hörerin sie
kennt, das Zeichen absichtlich geäußert hat und so weiter.
Nun könnte man einwenden, dass sich die Lücke zwischen der Verwendung des
Ernsthaftigkeits-Zeichen und der Ernsthaftigkeit, für die sie ein Zeichen sein soll, dadurch
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 22
schließen lässt, dass man die Bedingung hinzufügt, dass Sprecher und Hörerin das
Ernsthaftigkeits-Zeichen kennen und voneinander wissen müssen, dass sie es kennen. Aber
das hieße natürlich, dass das Ernsthaftigkeits-Zeichen alleine gerade nicht mehr konstitutiv
für die illokutionäre Kraft einer Äußerung wäre. Ob Sprecher und Hörerin eine Äußerung
eines Satzes mit Ernsthaftigkeits-Zeichen zurecht als eine Behauptung behandeln, hinge dann
zusätzlich davon ab, ob Sie gute Gründe dafür haben zu glauben, dass der jeweils andere
dieses Zeichen und seine Bedeutung kennt und weiß, dass der jeweils andere das Zeichen und
seine Bedeutung kennt.30 Dann unterschiede sich das Ernsthaftigkeits-Zeichen aber nicht
mehr wesentlich von den vorhandenen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, um zum
Ausdruck zu bringen, dass eine Äußerung ernst gemeint ist.
4. Das Scheitern der pragmatistischen Strategien
Das Ergebnis dieser Diskussion impliziert, so möchte ich behaupten, dass keine der beiden
Strategien, mit denen eine pragmatistische Bedeutungstheorie auf die aufsässigen Phänomene
der indirekten und unernsthaften Sprechakte reagieren könnte, gangbar ist. Das ist
offensichtlich für die zweite Strategie, die darin besteht, Unernsthaftigkeit als ein
akzidentelles Merkmal unserer sprachlichen Praxis abzutun. Wir hatten dagegen gesehen,
dass die Möglichkeit der Unernsthaftigkeit konstitutiv damit zusammenhängt, dass
Behauptungen ihre für unsere sprachliche Praxis wesentliche Funktion der Weitergabe von
Wissen und des Lieferns von Handlungsgründen spielen können.
Daraus ergibt sich aber auch, warum die erste Strategie scheitert. Diese Strategie besteht
darin, sich in der Definition des deklarativen Satzes (S*) auf den „Normalfall“
zurückzuziehen, der dadurch gekennzeichnet ist, dass keine besonderen Hinweise auf die
illokutionäre Kraft vorliegen. Wir müssen nun fragen, was denn die Rede von „besonderen“
Hinweisen eigentlich besagen soll? Wenn Behauptungen ihre Funktion erfüllen können
sollen, dann müssen wir die „besonderen“ Hinweise, die dazu führen könnten, dass die
Äußerung eines deklarativen Satzes keine Behauptung ist, gerade als Hinweise darauf
begreifen, dass die Sprecherin nicht beabsichtigt, die Wahrheitsgarantie zu übernehmen, die
30 Und tatsächlich sind auch die bei uns vorhandenen Gesetze der Ernsthaftigkeit, die Hare erwähnt, von
solchen Annahmen abhängig. Es kann daher auch unbestimmt viele Gründe dafür geben, die Äußerung eins
Satzes im Zeugenstand nicht als ernsthaft aufzufassen: Von mangelnder Zurechnungsfähigkeit über
Unkenntnis unserer Praxis der Rechtsprechung bis hin zu raffinierten Irrtümern (einer Person etwa, die allen
Grund hat zu glauben, sich bloß in einer inszenierten Gerichtsverhandlung und nicht in einer echten zu
befinden).
Erscheint in: Die Gegenwart des Pragmatismus, hg. v. M. Hartmann, J. Liptow u. M.
Willaschek, Berlin: Suhrkamp 2013, 166-192 23
eine Behauptung darstellt. Es sind damit Hinweise, die sich nicht in der Anwesenheit von
syntaktisch-semantischen oder anderweitigen kontextuellen Merkmalen erschöpfen können,
deren Funktion von den jeweiligen Absichten der Sprecherin unabhängig ist. Wie sollte es
auch anders sein: Wenn syntaktisch semantische Merkmale, deren Funktion von den
jeweiligen Absichten der Sprecherin unabhängig ist, nicht ausreichen, um die illokutionäre
Kraft einer Äußerung zu konstituieren, dann kann allein die Abwesenheit weiterer solcher
Merkmale nichts Wesentliches an der Situation ändern. Damit aber hängt (S*) implizit von
semantischen oder intentionalen Begriffen ab und verletzt die Bedingung (B2).
Davidsons sagt: „Die Misere des Schauspielers verläßt uns nie.“31 Ich habe zu zeigen
versucht, dass das nicht nur tatsächlich so ist, sondern dass das so sein muss, damit unsere
sprachlichen Äußerungen einige jener Funktionen erfüllen können, die wir für Sprache
überhaupt als wesentlich erachten. Und ich habe zu zeigen versucht, dass dies sich nicht mit
den reduktionistischen Ambitionen vereinbaren lässt, durch die pragmatistische
Bedeutungstheorien definiert sind.
31 Davidson, „Kommunikation und Konvention“, 379.