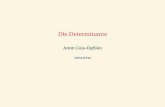Die Bedeutung der (deutsch-tschechischen) Grenze im 21. Jahrhundert. Die Grenze als Kulturform zur...
Transcript of Die Bedeutung der (deutsch-tschechischen) Grenze im 21. Jahrhundert. Die Grenze als Kulturform zur...
3
Die Bedeutung der (deutsch-tschechischen) Grenze im 21. Jahrhundert.
Die Grenze als Kulturform zur Entwicklung des öffentlichen Kritizismus, demokratischer
Integration und Gestaltung positiver Identitäten
Karel B. Müller, Prag
Abstract
The article argues that Europeans need to treat both territorial and symbolic borders as specific cultural forms which enable them to exercise and practise cross border communication. Such communication should allow a better understanding of differ-ences rather than constructing and perpetuating them. The notion of “active borders” is introduced as a concept which supports and produces social integration without generating antagonisms towards those “behind borders”. Contrary to this, “passive borders” entrench stereotypical negative identities, and create a significant hindrance in positive identities formation. The article draws inspiration from Edwards Shils’ ty-pology of collective identities, Erik Erikson’s concept of identity formation and Antho-ny Giddens’ concept of active/passive trust.
1. Einleitung
Der Sinn der europäischen Integration sollte nicht darin bestehen, die Verschie-denheit zu bewahren.1 Offen gesagt halte ich das Motto „Einheit in Vielfalt (d. h. Verschiedenheit)“ für falsch. Ein weitaus besseres Motto wäre meines Er-achtens die „Einheit in Freiheit“. Jede freie Gesellschaft erzeugt folgerichtig Verschiedenheit. Was Europa meines Erachtens vor allem nötig hat, ist die
1 Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Förderprojekts MSM6138439909 „Gover- nance v kontextu globalizované ekonomiky a spole�nosti“ („Governance im Kontext der glo- balisierten Wirtschaft und Gesellschaft“) der Fakultät für Internationale Beziehungen an der Wirtschaftsuniversität in Prag.
4
Stärkung des Diskurses über die Einheit und Freiheit zugleich. Falls die Sorge vor einer kulturellen Homogenisierung europäischer Gesellschaften zu Bestre-bungen führt, die kulturelle Verschiedenheit zu erhalten, führt dies eher zu einer Einschränkung von Freiheiten und nicht zu ihrer Entfaltung. Die Bewahrung der Verschiedenheit führt nämlich zur Beibehaltung der Grenze zwischen den ein-zelnen gesellschaftlichen Gruppen. Im Alltag erfolgt dies auf der symbolischen Ebene mittels der so genannten Etikettierung. Die Etikettierung stellt eine be-deutsame Einschränkung der persönlichen Freiheit dar, da sie den Anderen be-stimmte Merkmale und Identitäten zuschreibt, ohne dabei Rücksicht auf ihre Bestrebungen oder Handlungen zu nehmen. Somit stellt sie auch eine bedeuten-de Hürde für eine freie Identitätsgestaltung bzw. Identitäts(re)konstruktion dar.
Wesentlich wichtiger als die Bewahrung der Verschiedenheit ist die Stärkung von Garantien dafür, dass die Europäer über ihre Verschiedenheit zu diskutieren imstande sind und bestrebt sein werden, ihre Verschiedenheiten zu verstehen. Gerade deshalb halte ich die Einheit des Diskurses für absolut ausschlaggebend, da ein gewisser gemeinsamer Diskursraum gewährleistet werden muss, welcher die Kommunikation und das Verständnis der Verschiedenheit ermöglicht. In meinem Beitrag möchte ich die Bedeutung der „Grenze“ als Bestandteil des Diskursraums, welcher die Chancen zur Kommunikation und zum Verständnis der Verschiedenheit bietet, überdenken. Ich möchte zugunsten der These argu-mentieren, dass die Grenze eine spezifische Kulturform darstellen kann, die ei-nerseits das Gefühl der Einheit stiftet, und andererseits das Verständnis und die Kommunikation der Verschiedenheit ermöglicht. Meines Erachtens müssen wir in Europa solche Grenzen handhaben (treat) und institutionell absichern, die das Kommunizieren und Kennenlernen der Verschiedenheit ermöglichen und diese nicht erzeugen oder herstellen. Wir brauchen Grenzen, die als Ressource der kri-tischen Selbsterkenntnis und nicht als Quelle von unbegründeten Vorurteilen und stereotyper Abgrenzung dienen. Die Bedeutung von Grenzen in Europa sollte daher unter anderem zweierlei sein: 1) sie sollten das Kommunizieren und Verstehen der Verschiedenheit ermöglichen, 2) sie sollten als Ressourcen für kritisches Denken und (Selbst-)Erkenntnis dienen.
Die Annahme, man könnte Grenzen einfach abschaffen, formuliert eine zwar auf den ersten Blick sympathische, allerdings auch etwas utopische Erwartung. Ob-wohl wir uns aus normativer Sicht hinter diese kosmopolitische Forderung
5
stellen könnten, ist auch die Tatsache zu bedenken, dass das „Sich-Unter- scheiden“ wahrscheinlich ein unauslöschlicher und bedeutender Merkmal der menschlichen Identität ist. Es erscheint wahrscheinlich, dass kein soziales Gan-zes (Organisation, Gemeinschaft, Gesellschaft) ohne eine gewisse Abgrenzung existieren kann. Die Folgen des Erlebens der Grenze können jedoch ambivalent sein, da die Grenze sowohl die Verschiedenheit als auch die Einheit erzeugt. Es kommt jedoch auf die Art des Unterscheidens und auf dessen politische und so-ziale Folgen an, wie weiter unten gezeigt werden soll. Man kann sich jedoch der Meinung anschließen, dass das Konstruieren und Verfestigen von Grenzen in „Köpfen und Herzen“ von Menschen sehr negative politische und soziale Folgen nach sich ziehen kann. Die sozialen und psychologischen Folgen des Erlebens, der Handhabung oder Betreuung der Grenze können sowohl positiv als auch ne-gativ sein. Zu den negativen zählen soziale Ausgrenzung, Diskriminierung oder Gewalt. Andererseits kann die Grenze als gelebte Unterschiedlichkeit auch als eine Ressource für Selbstreflexion dienen, die es möglich macht, die eigenen Irrtümer und Fehler aufzudecken und zu korrigieren. Sie kann als Trägerin der Interessen-, Meinungs- und Kulturpluralität fungieren und als Ressource für öf-fentliches Lernen sowie institutionelle Innovationen dienen.
In meinem Beitrag verwende ich sowohl Edward Shils‘ Typologie der kol-lektiven Identität und Konzeptualisierung2 als auch Erik Eriksons (nach Hoover 1997) Schlussfolgerungen aus der Forschung formativer Identitätsprozesse.3 Diese zwei Ansätze kombiniere ich mit dem eigenen Konzept der aktiven Gren-ze, welche ich als einen untrennbaren Bestandteil der Europäisierung von Öf-fentlichkeit (i. S. v. public sphere) in Europa interpretiere. Das Konzept der ak-tiven Grenze geht insbesondere auf Anthony Giddens‘ Definition des Konzepts des aktiven / passiven Vertrauens (trust),4 das er in Bezug auf die Handhabung von Expertensystemen der Moderne thematisiert, sowie auf sein im Kontext der Diskussion über die Notwendigkeit einer territorialen Abgrenzung der Europäi-schen Union eingeführtes Konzept der durchlässigen Grenze zurück.
2 Shils, Edward (1975): Center and Periphery. Essays in Macro-Sociology, Chicago. 3 Nach Hoover, Kenneth R. (1997): The Power of Identity. Politics in a New Key, Chat- ham, N.J. 4 Giddens, Anthony (2007): Europe in the Global Age. Cambridge; ders. (1998): D�sledky modernity, Praha.
6
2. Die Grenze, ihre Funktionen und Verwandlungen
Zu unterscheiden sind einerseits die geografischen (oder territorialen) Grenzen, welche das Werk von Vermessern oder gar Maurern sind, und die sozial-psycho- logischen Grenzen, welche wiederum soziale Konstrukte sind. Die erstgenann-ten können in Gestalt von Mauern oder Stacheldrahtzäunen daherkommen, die zweitgenannten in Gestalt von sozialen Stereotypen, Vorurteilen oder Kommu-nikationshemmnissen. Die Effektivität von territorialen Grenzen wurde durch die Globalisierung in Frage gestellt. Aus den vielen bedeutenden sozialen Theo-rien, die sich mit diesem Infragestellen befassen, seien hier neben Giddens z. B. diejenigen von Zygmunt Bauman5 und Manuel Castells6 erwähnt, die sich in vielen Teilen überlappen. Bauman weist auf die Freiheit der Akteure hin, vor den Folgen ihres Handelns zu fliehen, Castells wiederum auf die Tatsache, dass die Organisation der sozialen Beziehungen heutzutage der Logik eines Netz-werks (und nicht der Grenze) folgt, und Giddens gelingt es überzeugend zu zei-gen, dass das Hauptprinzip der Moderne die Entbettung (disembedding) des menschlichen Handelns aus lokalen Zusammenhängen mittels der so genannten Expertensysteme und symbolischer Zeichen (symbolic tokens) ist.
Die territorialen Grenzen, deren eingebildete (imagined) Exaktheit erst dank der Entwicklung von modernen Institutionen möglich wurde, besaßen bereits im Altertum und im Mittelalter einen hohen symbolischen Stellenwert. Im Verlauf der Entstehung von modernen Nationalstaaten kam es jedoch zu einer grundle-genden Durchdringung von territorialen und psychologischen Grenzen.7 Diese Durchdringung wird gegenwärtig durch die Globalisierung gestört, oder, wie Giddens sagen würde, durch das Wirken von so genannten Enbettungsmechanis- men einer sich globalisierenden Moderne und der damit einhergehenden Infor-mations- und Wissensmobilität.8 Auf der anderen Seite wird diese Durchdrin-
5 Bauman, Zygmunt (2004): Europe. An Unfinished Adventure, Cambridge; ders. (2002): Te- kutá modernita, Praha. 6 Castells, Manuel (2001): The Internet Galaxy. Reflection on the Internet, Business, and So- ciety, Oxford. 7 Zum Beispiel in einer traditionellen Gesellschaft waren die meisten politischen Gebilde eher durch ihre Zentren denn durch ihre Grenzen definiert; ebenso große religiöse Systeme haben meistens einen universalistischen Charakter und werden nicht vorrangig durch „Grenzen“ definiert; vgl. Anderson, Benedict (2003): Pomyslná spole�enství, in: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus, Praha, S. 239-269, hier: S. 245, 254. 8 Giddens (1998): D�sledky modernity.
7
gung immer noch in einem gewissen Maße durch die politische Mobilisierung von Massen (politischen Populismus) oder durch den nicht versiegenden Natio-nalismus (insbesondere) der Boulevardmedien reproduziert.9
Infolge der Globalisierung findet nämlich nicht nur eine Störung der Wirksam-keit von territorialen Grenzen statt, sondern auch eine Stärkung der Kommuni-kationskapazität beim Konstruieren von Grenzen und vor allem ihrer symboli-scher Bedeutung. Die Reaktionen von Regierungen und bürgerlichen Gesell-schaften fallen zwar sehr unterschiedlich aus, in der Regel sind sie jedoch ent-weder vom Optimismus / Akzeptanz oder vom Pessimismus / Widerstand ge-genüber den mit der Globalisierung einhergehenden Veränderungen durchdrun-gen. Es kann sich hierbei um partikuläre Maßnahmen handeln, wie z. B. die Ein-führung eines neuen Wahlkreises „Großbritannien und Nordwesteuropa“ durch Frankreich (da Schätzungen zufolge in London bis zu 400.000 französische Staatsangehörige leben), aber auch um komplexe Entwicklungen, wie z. B. die sukzessive Integration europäischer Staaten. Das Konstruieren kann auch mit einem retrospektiven Anspruch geschehen, wie es bei der Diskriminierung von deutschen Staatsbürgerinnen muslimischen Glaubens der Fall war, denen die Teilnahme an einem Bildungsprogramm zum Holocaust mit der Begründung verweigert wurde, es würde sie nichts angehen.10
Wie zumindest die Entwicklung im Westen zeigt, sind Ethnien (Nationalitäten i. S. v. Volksgruppen) heutzutage territorial stärker verstreut. Daher können Staatsangehörigkeit bzw. Staatsbürgerschaft, Nationalität (i. S. der ethnischen Zugehörigkeit) und Territorium nicht (mehr) gleichgesetzt werden.11 Auf dem Gebiet aller Staaten steigt die Zahl der der dort lebenden „Nicht-Bürger“. Dop-pelte Staatsangehörigkeit / -bürgerschaft, doppelte Aufenthalts- / Niederlas-sungstitel und ähnliche Phänomene, die in ihrer Folge wachsende Zweifel an der Gültigkeit der Gleichung „demos = ethnos = topos“ wecken, kommen mit 9 Risse, Thomas (2010): A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, NY/London. 10 The past is another county. Teaching German immigrants history, in: The Economist, 22. Januar 2011, S. 38. 11 Vgl. Beck, Ulrich (2007): Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha; ders. (2004): Riziková spole�nost. Na cest� k jiné modern�, Praha; Fraser, Nancy (1990): Rethin- king the Public Sphere. A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy, in: Social Text, Nr. 25/26, S. 56-80; Habermas, Jürgen (2001): The Postnational Constellation. Political Essays, Cambridge; Morley, David (2000): Home Territories. Media, Mobility and Identity, London/New York, NY.
8
zunehmender Häufigkeit vor. Die Grenzen der Nationalsprachen sind immer weniger mit den Staatsgrenzen deckungsgleich.
Wie bereits erwähnt, werden infolge der Globalisierung einerseits die territoria-len Grenzen in Frage gestellt. Andererseits kommt der psychologischen oder mentalen Abgrenzung eine immer größere Bedeutung zu. Zwecks Reflexion über die Bedeutung der psychologischen Grenzen, die auf dem Bewusstsein der kollektiven Identität basieren, wird es von Vorteil sein, zunächst die Funktionen der territorialen Grenzen von Nationalstaaten einer Bewertung zu unterziehen. Auf den ersten Blick wird deutlich, dass der Hauptsinn von territorialen Grenzen im Schutz der Gemeinschaft bestand, wie es am Beispiel der Verteidigungsbun-keranlagen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet oder von Stacheldrähten zur Trennung von verfeindeten Ethnien zu sehen ist. Die im Schutz der Gemein-schaft liegende Bedeutung wurde (und wird) in der Regel durch die Abschre-ckungsfunktion der Grenze verstärkt. Wie Morley anmerkt, bezeichnet das Ter-ritorium (terra, terrere) einen Ort, der diejenigen abschrecken soll, die sich jen-seits der Grenze befinden.12 Diese Abschreckungsfunktion wurde einerseits durch die Industrialisierung des Krieges und die Entwicklung von Massenver-nichtungswaffen gewissermaßen relativiert und andererseits dank der wachsen-den internationalen medialen Kommunikation und steigenden Informationspro-duktion einem Wandel unterzogen.
Eine weitere soziale Funktion der Grenze besteht darin, sozialen Zusammenhalt zu erzeugen. Die Bedeutung der Grenzen liegt darin, dass sie die Loyalität ge-genüber anderen, innerhalb der Grenzen lebenden Menschen und gegenüber den politischen Institutionen begründen. Grenzen bringen soziale Solidarität, die Fä-higkeit zum freiwilligen Selbstverzicht, wie es von Raymond Aron genannt wird,13 oder zur freiwilligen Opferbereitschaft, von der Habermas spricht, her-vor. Grenzen schaffen Voraussetzungen für die Gestaltung der kollektiven Iden-tität sowie für die Konstruktion des Erlebnisses einer abstrakt definierten Heimat (homeland). Die Vorstellung der Grenze von Nationalstaaten (oder Nationen) vermochte das Gefühl der sozialen Solidarität und institutionellen Loyalität in-nerhalb von millionenstarken Bewohnergruppen zu erzeugen und ermöglichte dadurch das Erreichen eines hohen Niveaus der sozialen Organisation. Im Zuge
12 Morley (2000): Home Territories, S. 248. 13 Aron, Raymond (2003): Demokracie a totalitarismus, Brno.
9
der Demokratisierungsprozesse wurden die Voraussetzungen für die auf der Gleichheit vor dem Recht sowie auf Freiheiten (liberties) basierende soziale In-tegration geschaffen und die Bedeutung der gemeinsamen Sprache gestärkt. Im positiven Sinne bedeutete die Entwicklung des Nationalstaates die Entwicklung des Glaubens an die Wirkungskraft der gemeinsamen Sprache, den Stellenwert des Diskurses und die Verbindlichkeit des Gesellschaftsvertrags. Die politische Autorität ist in einer Demokratie weitaus stärker als in autoritären Regimen an ihre Fähigkeit gebunden, andere Menschen mithilfe der vorgelegten Informatio-nen und Argumente in der Diskussion zu überzeugen. Andererseits darf man vor den Auswirkungen der bereits erwähnten Ambivalenz der Grenze die Augen nicht verschließen, weil die nationale Identität auch zum Träger des Nationalis-mus und zum Ursprung der Mobilisierung von Massen für einen totalen Krieg zwischen diesen sich intern demokratisierenden Gruppen wurde.
Eine weitere bedeutende Funktion der territorialen Grenze, die quasi die Rück-seite der vorgenannten Funktion darstellt, ist die Form der Selbstreflexion einer „eingegrenzten“ Gemeinschaft. Für diese Funktion ist es jedoch erforderlich, die Grenze von Zeit zu Zeit zu überwinden und mit der Andersheit außerhalb der Grenze konfrontiert zu werden. Dies hängt mit der allgemein akzeptierten Vo-raussetzung der sozialen Identitätstheorie zusammen, wonach sich dominante Gruppen durch eine schwächere Gruppenidentität auszeichnen (Cohen 2000).14 Die kollektive Dimension der Identität tritt an die Oberfläche und verändert sich im Augenblick der erlebten Verschiedenheit, d. h. in einem Augenblick, in dem man keine anderen Dimensionen der eigenen Identität anwenden kann. Gehört man beispielsweise einer vielköpfigen, ethnisch dominanten Gruppe an, erlebt man die empfundene Verschiedenheit nicht so oft wie der Angehörige einer kleinen, nicht dominierenden ethnischen Gruppe. Das heißt, die eigene kollekti-ve Identität ist in einem solchen Fall weniger zugespitzt und das Verhältnis der Solidarität zu den anderen Mitgliedern der eigenen Gruppe ist schwächer ausge-prägt.
Der Kontakt mit der Andersheit kann auch mittelbar erfolgen. Es ist offenkun-dig, dass die Entwicklung der Massenmedien hierbei bedeutende neue Möglich-keiten eröffneten. Die Konfrontation mit Alterität kann dank der Massenmedien
14 So etwa Cohen, Anthony P. (2000): Signifying Identities. Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values, London.
10
täglich direkt in die Wohnzimmer übermittelt werden. Der Nationalismus des 20. Jahrhunderts hat es geschafft, diese Mobilisierungsmöglichkeiten vollum-fänglich auszunutzen. Man kann sagen, dass die politischen Kampagnen, die die Unterschiede zwischen den europäischen Nationen konstruierten und sie an-schließend ausbeuteten und deren gegenseitige Antagonismen, Rivalitäten und Hass verstärkten, eine konstitutive Bedeutung für die Herausbildung der europä-ischen Nationen hatten und schließlich maßgeblich auch zu ihrer katastrophalen Dezimierung in einer Serie von totalen Kriegen beitrugen.
Im Mittelpunkt unseres Interesses wird die selbstreflexive Funktion der Grenze stehen. Dieses Attribut kommt auch bei den psychologischen bzw. mentalen Grenzen voll zur Anwendung. Wie zahlreiche Sozialwissenschaftler zeigen, wird jeder Gestaltungsprozess der kollektiven Identität notwendigerweise durch das Konstruieren von so genannten „constitutive others“ dem so genannten „constitutive outside“ begleitet.15 Im Entstehungsprozess der modernen Natio-nen war es auch nicht anders. Die innere Integration geht Hand in Hand mit der Ausgrenzung (Exklusion) derjenigen, die jenseits der Grenze sind. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Gruppenzusammenhalt durch das Konstruieren von Anderen, die als feindlich gesinnt und gefährlich geschildert werden, ge-stärkt werden. Ein solches Vorgehen kann jedoch rasch in eine innere Intoleranz gegenüber denjenigen im „Inneren“, die uns an die jenseits der Grenze befindli-chen erinnern, umschlagen. Die Stärkung des Gruppenzusammenhalts oder der politischen Macht mittels einer stereotypischen Viktimisierung und Etikettie-rung der Anderen ist, wie weiter unten gezeigt wird, für den politischen Popu-lismus überall auf der Welt äußerst verlockend.
3. Kollektive Identität, Politik und das Bedrohungsgefühl
Die Identität kann ein Artefakt der (politischen) Macht sein, und sofern sie tat-sächlich dazu wird, hat derjenige die größte (politische) Macht, der den Kontext der Identitätsformung am meisten beeinflusst. Die Identität wird ausdrücklich nicht vom Staat gestiftet, sondern ihre Entwicklung erfolgt vorrangig eher im
15 Vgl. Hoover (1997): The Power of Identity; Calhoun, Craig (1994): Social Theory and the Politics of Identity, in: ders. (ed.): Social Theory and the Politics of Identity, Cambridge, MA/ Oxford, S. 9-36.
11
Bereich der Familie, der Zivilgesellschaft und des Marktes. Der Staat übt jedoch einen bedeutenden Einfluss auf die Umwelt, durch die die Identität geformt wird, mithilfe der Bildungs- und Kulturpolitik, der Wirtschaftsaufsicht, der Kin-der- und Gesundheitspolitik usw. aus. Die Identität ist jedoch zwangsläufig so-wohl für das individuelle Streben als auch für die politische Agitation offen, denn laut Calhoun bleibt die sie stets zum Teil ein Projekt; sie ist in unseren mo-ralischen Ansprüchen verwurzelt, die umzusetzen uns nur teilweise gelingt.16 Jede Politik ist daher bestrebt, die Identität, welche für sie eine konstituierende Bedeutung hat und gleichwohl in einem gewissen Maße fiktiv für sie bleibt, (aus-) zu nutzen und gelegentlich versucht sie gegenüber den Wählern eine „Forderung“ nach einer Identität zu erheben.17
Wie die berühmte These von Carl Schmitt besagt, steht hinter allen politischen Entscheidungen die Unterscheidung von Freund und Feind.18 Und in der Tat: Um den Zusammenhalt und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen zu stärken, die beide zur Mobilisierung von Bürgern ge- bzw. missbraucht werden können, um deren politische Unterstützung zu gewinnen und die eigene politi-sche Macht auszubauen, gibt es kein wirksameres Mittel als die Benennung des gemeinsamen Feindes. Die Weltpolitik des 20. Jahrhunderts bietet unzählige Beispiele dafür, wie sich Regierungen, Nachrichtenagenturen und Medien zum Konstruieren von primitiven, simplifizierenden Darstellungen des Feindes ver-stiegen haben. Obwohl in der Wirtschaft und in der Kultur alles Nationale und Ethnische an Bedeutung verliert, scheinen Nationalismus und Extremismus trotzdem einen Aufschwung zu erleben, weil die Globalisierung die lokalen Kontexte zerrüttet und ein als stark empfundenes Bedürfnis nach einer Identität weckt, „von dem schlechte Politiker profitieren, indem sie falsche Feinde erfin-den.“19 Besonders mit der wachsenden terroristischen Bedrohung nach dem 11. September 2001 kommt es in der Praxis zu einer maßlosen Anwendung der „Politik der Angst“, wie es Michael Moores engagierte und bereits einen Kultstatus genießende Dokumentarwerke „Bowling for Columbine“ und „Fah-renheit 9/11“ am Beispiel der USA überzeugend zeigen.
16 Calhoun (1994): Social Theory, S. 29. 17 Ebd., S. 19; Hoover (1997): The Power of Identity, S. 64. 18 Schmitt, Carl (2007): Pojem politi�na, Brno/Praha. 19 B�lohradský, Václav (1992): Kapitalismus a ob�anské ctnosti, Praha, S. 38.
12
Auch in der Geschichte der Identitätsformung in Amerika spielte die Identitäts-politik eine Schlüsselrolle.20 Die Identität der Amerikaner wurde im Laufe der Zeit gegen die Ureinwohner (natives), Engländer, Afrikaner (Schwarz-/Afro- amerikaner), Kommunisten und schließlich Terroristen definiert. Die nationale Identität wird mithilfe der Politik in einer Atmosphäre der Bedrohung konstru-iert, deren Mittel die „Unterscheidung“ ist und deren Ressource die „Anderen“ sind. Nach David Campbell treffe es nicht zu, dass eine legitime Politik von ei-ner vorgegebenen Identität abhängig sei; vielmehr handele es sich um ein refle-xives Verhältnis. Die kollektive Identität wird durch den politischen Diskurs in Verbindung mit gezielten medialen Strategien, deren inhärenter Teil auch die Konstruktion der „Anderen“ ist, gestaltet. Die schlechte Politik sei nach Václav B�lohradský von einer guten Politik dadurch zu unterscheiden, dass sie die „An-deren“ erfindet, d. h. einen falschen Feind konstruiert. Ein guter Politiker erfin-det keinen Feind, sondern benennt den wirklichen Feind. Das Konstruieren von psychologischen Grenzen wird also – ähnlich wie bei territorialen Grenzen – durch das Gefühl der Bedrohung oder Verunsicherung ausgelöst.21
Auf einer allgemeinen Ebene kann man argumentieren, die Entstehung von nati-onalen Identitäten sei eine Reaktion auf die durch die Modernisierungsprozesse hervorgerufene Identitätskrise und Gefühle der Verunsicherung. Die Moderni-sierungsprozesse führten zu einem schnellen Wandel in den Kontexten der Iden-titätsformung, oder, anders ausgedrückt, die Formungsprozesse der kollektiven Identitäten sahen sich mit der Tatsache der hohen sozialen Veränderbarkeit kon-frontiert. Laut Robert Picht ist es mit der Identität wie mit der Gesundheit: beide versetzen uns erst dann in Unruhe, wenn wir ihre Bedrohung erleben.22
Was bedeutet eigentlich Identität? Die menschliche Identität ist ein kontextuel-les und sehr vielschichtiges soziales und psychologisches Phänomen. Vom den jeweiligen Augenblick und von der Art der menschlichen Tätigkeit hängt ab, welcher der Identitätsfaktoren gerade dominiert. Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Umwelt und der Tätigkeit können sich sowohl die Identitätsformen als auch ihre Inhalte verändern. Als ein sich im Ausland aufhaltender Tscheche 20 Vgl. Campbell, David (1992): Writing Security. United States Foreign Policy and the Poli- tics of Identity, Manchester. 21 B�lohradský (1992): Kapitalismus a ob�anské ctnosti, S. 38. 22 Picht, Robert (1993): Disturbed Identities. Social and Cultural Mutations in Contemporary Europe, in: Garcia, Soledad (ed.): European Identity and the Search for Legitimacy, London, S. 81-94, hier: S. 82.
13
verteidige ich oft unbewusst das „Tschechentum“, während ich, wenn ich zu Hause bin, dem „Tschechentum“ meistens ziemlich kritisch gegenüberstehe. Es könnte darauf zurückzuführen sein, dass wenn man mit dem ‘Tschechentum’ zu Hause konfrontiert wird, man dabei die Anderen sieht, während das Kon- frontiertsein damit im Ausland bedeutet, sich selbst vor Augen zu haben. Die einzelnen Dimensionen unserer Identität melden sich in dem Augenblick zu Wort, in dem die anderen versagen. Viele Autoren unterscheiden zwischen kol-lektiver und persönlicher Identität oder sprechen von zwei Dimensionen der menschlichen Identität: der kollektiven und der persönlichen.23 Beim genaueren Hinsehen stellt man fest, dass die beiden Identitäten bzw. ihre Dimensionen (die kollektive und die persönliche) sehr eng miteinander verknüpft sind. Daher halte ich es für nicht produktiv, sie getrennt zu untersuchen. Beide sind Teile einer individuellen Identität, die notwendigerweise subjektive Identität sein muss.
Gleichwohl könnte die kollektive Identität als die Schnittmenge der subjektiven Identitäten von Einzelnen definiert werden.24. Bei der Untersuchung von kol-lektiven Identitäten entsteht hierbei jedoch ein Problem infolge der Dialektik zwischen der subjektiven Identität und den sozial zugeschriebenen Identitäten. Diesbezüglich stimme ich Peter L. Berger und Thomas Luckmann zu, dass die Verwendung des Begriffs „kollektive Identität“ höchst problematisch sei, da er zu einer falschen verdinglichenden Hypostasierung der Identität führen könne.25 Die Kategorien der kollektiven Identität können als eine Art „Lebensszenari-en“26 dienen, die die jeweiligen Kulturmuster und Stereotypen wiedergeben und eine (selbst-)reflexive Identitätsbildung verhindern, wodurch häufig Gruppenan-tagonismen und -konflikte geschaffen oder erhalten werden.27 Alberto Melucci weist darauf hin, dass wenn man von der kollektiven Identität spricht, man sich bewusst sein muss, dass die kollektive Identität kein „Ding“, „reale Tatsache“
23 Etwa Taylor, Charles (1989): Source of the Self. The Making of Modern Identity, Cam- bridge, MA. 24 So Appiah, Kwame Anthony (2001): Identita, autenticita, p�ežití. Multikulturní spole�nosti a sociální reprodukce, in: Taylor, Charles/Gutmann, Amy (ed.): Multikulturalismus. Zkoumá- ní politiky uznání, Praha, S. 163-178, hier: S. 165. 25 Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (1999): Sociální konstrukce reality. Pojednání o socio- logii v�d�ní, Brno, S. 198. 26 Appiah (2001): Identita, autenticita, p�ežití. 27 Lesaar, Henrik Richard (2001): Semper Idem? The Relationship of European and National Identities, in: Drulák, Petr (ed.): National and European Identities in EU Enlargement, Praha, S. 179-194, hier: S. 181.
14
oder gar „statische Größe“ sei, sondern eine Art Konzept oder Analyseinstru-ment, von seiner Wesensart her der optischen Kameralinse nicht unähnlich, mit dessen Hilfe wir die Wirklichkeit wahrnehmen und interpretieren.28 Wie im Zu-sammenhang mit der problematischen Natur der kollektiven Identitäten von Ap-piah treffend angemerkt wird, gibt es zwischen der Politik der Anerkennung und der Politik des Zwangs keine klare Abgrenzung.29 Die dilemmatische Natur der Beziehung von kollektiven Identitäten liegt also darin, dass sowohl ihre Aner-kennung als auch ihre Anzweiflung zu einer gewissen Geringschätzung der Identität und dadurch in einem gewissen Sinne zu Einschränkungen in der freien Identitätsbildung führt.
Die Identität sei ein Band, das die Individuen und die Gesellschaft zusammen-hält, so Hoovers poetische Schilderung;30 sie sei ein Phänomen, das durch die Dialektik von Individuum und Gesellschaft entsteht.31 Es ist nicht unser Ziel, uns mit den psychologischen Theorien der Identitätsbildung zu beschäftigen. Für das Thema Grenze ist es jedoch wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Iden-titätsbildung ein interaktiver Prozess zwischen dem Individuum und seiner (be-grenzten) kulturell geformten Umwelt ist. Dieser Prozess hat die Form eines Di-alogs.32 Die Kultur verhält sich gegenüber der Identität keineswegs neutral, son-dern ist eine aktive Komponente jeder Identität. Obwohl jeder von uns abhängig von seinen sozialen und biologischen Dispositionen (natürlich gibt es einen Dauerstreit über das Maß an Kulturdeterminismus dieser Dispositionen) in einen „Dialog“ mit seiner jeweiligen Kultur tritt, besteht kein Zweifel daran, dass die Kultur der Ausgangspunkt unserer Identität in dem Sinne ist, dass sie die zur Identitätsbildung notwendigen Sinngehalte und Inhalte schafft.33 28 Melucci, Alberto (1996): Challenging Codes. Collective Action in the Information Age, Cambridge, S. 77. 29 Appiah (2001): Identita, autenticita, p�ežití, S. 178. 30 Hoover (1997): The Power of Identity, S. 46. 31 Ebd., S. 67; Berger/Luckmann (1999): Sociální konstrukce reality, S. 171. 32 Vgl. Taylor (1989): Source of the Self. 33 So Hoover (1997): The Power of Identity, S. 62. Von einigen Autoren, die sich mit „Iden- tität“ beschäftigen, wird allerdings behauptet, der Prozess der Identitätsformung sei ein Pro- zess ihrer „Entdeckung“ oder „Findung“. Nach dieser Interpretation geht die Identität dem Sein voraus und wird als menschliche Eigenschaft verstanden. Dieser Ansatz wird als Essen- tialismus oder Primordialismus bezeichnet und beispielsweise von Ernest Gellner und Jana Nosková vertreten. Vgl. Gellner, Ernest (2003): Nacionalismus, Brno; Nosková, Jana (2005): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie, in: Slovenský národopis/ Slovak Ethnology, H. 3, S. 354-356. Persönlich neige ich eher zu der konstruktivistischen Sichtweise, die die Identität ausschließlich als einen Prozess und soziales Produkt versteht,
15
Für die Interpretation unseres Themas Grenze kann der Ansatz von Erik Erikson produktiv herangezogen werden, in dem zwischen einer positiven und einer ne-gativen Identität unterschieden wird. Die negative Identität kommt meistens in der Gestalt einer Herabsetzung oder Pseudo-Abgrenzung daher. Erikson spricht in diesem Zusammenhang von einer pathologischen Identitätsformung. Sie kommt fast regelmäßig in der Situation von Minderheiten vor, die sich gegen-über der dominanten Kultur abgrenzen, und führt meistens zur Stärkung von Gruppenantagonismen und Aggression. Langfristig führt sie zu einer Zunahme von Hass und Frustration sowie zu einem Mangel an (Selbst-)Achtung. Das Pa-thologische einer solchen Identität besteht in ihren zumeist zerstörerischen poli-tischen und sozialen Auswirkungen.
Die Identitätsformung vollzieht sich nie gradlinig. Es gibt immer ein Span-nungsfeld zwischen der positiven und der negativen Identitätsauffassung. Erikson stellt die Behauptung auf, dass die Gefahr von Zuschreibungen einer negativen Identität (entweder sich selbst oder den anderen), d. h. der Abgren-zung dem gegenüber, was wir bei sich selbst oder bei den anderen ablehnen, immer gegenwärtig sei. Es geht jedoch darum, über die Mittel zur Beherrschung dieser Gefahr zu verfügen. Verschiedene Identitäten können sich in einer sowohl komplementären als auch diskriminierenden gegenseitigen Beziehung befinden. Erikson behandelt die Diskriminierung (und den Chauvinismus) als eine Quelle der pathologischen Identitätsgestaltung.34 Die durch die Viktimisierung der „Anderen“ entwickelte Identität bezeichnet er als Pathologie. Er zeigt, dass die Dynamik der pathologischen Identität zwar unterschiedlich sein kann, jedoch meistens zum Hass, Gewalthandlungen und Dominanzbestrebungen führt. Die positive Identität, die keine neurotischen Züge aufweist, besteht in der Fähigkeit, die eigene Kompetenz unter Beweis zu stellen, ein integraler Bestandteil der Gemeinschaft zu sein und gegenseitige Bindungen aufzubauen, und führt wiede-rum zur Selbstzufriedenstellung.
die – mehr oder minder (selbst-)reflexiv – konstruiert sind. Die Identitätsformung wird sowohl durch psychologische als auch soziale Prozesse beeinflusst, und obwohl es sich um ein relativ stabiles Element der sozialen Wirklichkeit handelt, handelt es sich hierbei um kein „natürliches“ oder a priori gegebenes sozialpsychologisches Phänomen. Die Identität bleibt unverständlich, sofern sie nicht in einer bestimmten Kultur verortet ist. Theorien zur Identität sind in eine allgemeinere Interpretation der Wirklichkeit eingebettet und in die konkrete sym- bolische Sinnwelt mit deren theoretischen Legitimationen eingebaut; vgl. Berger/Luckmann (1999): Sociální konstrukce reality, S. 172. 34 Vgl. Hoover (1997): The Power of Identity, S. 76.
16
Erikson kommt bei seinen Forschungsanalysen der Identitätsformung zu der Schlussfolgerung, dass die menschliche Natürlichkeit im Streben nach einer Identität besteht, die auf zwei Grundprinzipien basiert.35 Einerseits ist es das Prinzip der Kompetenz in den Produktions-, sozialen und persönlichen Bezie-hungen. Diese drei Kompetenzschichten können schematisch folgenden Berei-chen zugeordnet werden: 1. Markt, 2. Zivilgesellschaft, 3. Familie. Reichtum, Macht, Einfluss, Ansehen oder Freundschaft können einzelne Formen der (in unterschiedlichem Maße) institutionalisierten Kompetenz darstellen. Das zweite Prinzip unserer Identität ist das Bewusstsein unserer sozialen Zugehörigkeit zu einer Welt der geteilten „vernünftigen“ Sinngehalte. Es geht hierbei um das Maß unserer Verankerung in einem spezifischen sozialen Umfeld. Sowohl die Kom-petenz als auch die Zugehörigkeit als Hauptprinzipien unserer Identität umfas-sen die wechselseitige Beziehung (Transaktion) zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Beides kann nur durch individuelle Anstrengung und mittels sozialer Anerkennung derer Bedeutung erreicht werden. Die Identität wächst und wird genährt oder frustriert nur in einer komplexen Verknüpfung des Indi-viduums und der Gesellschaft.36
Das Spannungsfeld zwischen dem Partikularismus und dem Universalismus ist der Schlüssel zum Verständnis der Beziehung zwischen Identität und Politik. Die Unterschiedlichkeit impliziert eine Diskriminierung und dieser Umstand begründet die Möglichkeit der politischen (Aus-)Nutzung (bzw. des Ge- oder Missbrauchs) der Identität; die Bestätigung der Unterschiedlichkeit ist daher auch ein kritischer politischer Aspekt im Prozess der Identitätsformung. Nach Hoover wird die Identität durch die Unterschiedlichkeit unterstützt und gleich-ermaßen bedroht.37 Die Identität beinhaltet jedoch immer Unterschiedlichkeit, durch die die Grenzen unserer Identität konstituiert werden.38 Die Frage der Identität umfasst zwei miteinander verbundene Momente: das Moment der Un-terschiedlichkeit der eigenen Person mit den besonderen Eigenschaften, die die-se Unterschiedlichkeit konstituieren, sowie das Moment des Fortbestehens der eigenen Persönlichkeit, das die Kontinuität dieser charakteristischen Merkmale
35 Eriksons Identitätskonzept wurde während des letzten Vierteljahrhunderts durch mehr als 300 Studien und Analysen erprobt; ebd., S. 19. 36 Vgl. ebd., S. 19-21. 37 Ebd., S. 66. 38 Vgl. Connolly, William E. (1991): Identity / Difference. Democratic Negotiations of Politi- cal Paradox, Ithaca, NY.
17
trotz der sich verändernden Lebensumstände gewährleistet.39 Das Fortbestehen der Unterschiedlichkeit führt zur „Schaffung einer Grenze“, welche zwangs-läufig einen Prozess der Einschließung (Inklusion) und der Ausgrenzung (Ex-klusion) nach sich zieht.40
Wie bereits oben erwähnt, können Identitäten sowohl komplementär oder unter-stützend als auch diskriminierend oder konkurrierend sein. Beides ist nach Hoo-ver gleichermaßen wahrscheinlich.41 Wie auch die Untersuchungen des moder-nen Nationalismus zeigen, werden nationale Identitäten zum Großteil als „nega-tive Identitäten“ definiert.42 Die Nation existiert in den Vorstellungen stets als nach außen hin gegenüber den „Anderen“ abgegrenzt. Laut Benedict Anderson „träumen nicht einmal die größten Messianisten von dem Tag, an dem sich die Angehörigen des Menschengeschlechts ihrer Nation anschließen, so wie es in bestimmten Epochen möglich war [...]“43. Auch Hoover argumentiert damit, dass das mögliche direkte Eingreifen des Staates und der Politik in den Prozess der Identitätsgestaltung in der Regel die Reaktion auf eine Identitätskrise dar-stelle.44 Ein solches Eingreifen hat den Charakter einer pathologischen stereoty-pischen Identitätsformung, stellt unter den gegebenen Bedingungen einen Ersatz für die mangelnde Sicherheit und persönliche Unreife des Handelnden dar und führt zur Gestaltung negativer Identitäten. Das Problem einer dergestalt legiti-mierten Identität liegt darin, dass die negative Identität eine flatterhafte und un-zuverlässige Quelle der politischen Loyalität und sozialen Solidarität darstellt. Wenn man etwas nur deshalb unterstützt, weil es sich von etwas anderem unter-scheidet, kann die Loyalität plötzlich bedroht werden, wenn jenes andere nicht mehr ausreichend präsent und bedrohlich erscheint. Dasselbe lässt sich auch über die soziale Solidarität sagen. Die Aufrechterhaltung der Loyalität und Soli-darität der Bürger erfordert somit, jenes andere (von Zeit zu Zeit) zur Schau zu stellen oder gegebenenfalls aktiv zu gestalten, d. h. Pseudo-Bedrohungen und falsche Feinde zu ersinnen.
39 Vgl. Bauman, Zygmunt (1995): Úvahy o postmoderní dob�, Praha, S. 27. 40 So Eisenstadt, Shmuel N./Giesen, Bernard (2003): Konstrukce kolektivní identity, in: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus, Praha, S. 361-374, hier: S. 364. 41 Hoover (1997): The Power of Identity, S. 65. 42 Vgl. Giddens (2007): Europe in the Global Age, S. 206; Luhmann, Niklas (1971): Sinn als Grundbegriff der Soziologie, in: ders./Habermas, Jürgen (Hrsg.): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt am Main, S. 25-100. 43 Anderson (2003): Pomyslná spole�enství, S. 245. 44 Hoover (1997): The Power of Identity, S. 40.
18
4. Kollektive Identitäten und ihre Grenzen
Das Konzept der Grenze spielt für das Verständnis der kollektiven Dimension der menschlichen Identität eine Schlüsselrolle. Wie bereits oben angedeutet wurde, bildet den Kern jeder kollektiven Identität die Unterscheidung von Wir und die Anderen, d. h. die Konstruktion der Vorstellung von Uns selbst und von den Anderen jenseits der Grenze. Edward Shils unterschiedet bei der Konstruk-tion der kollektiven Identität drei Codes: die primordialen (primordial; Primor- dialität), die kulturellen oder heiligen (sacred, auch universalistische Codes ge-nannt; Kultur oder Heiligkeit) und die traditionellen (civil; Zivilität).45 Es geht um die Weberschen Idealtypen, die in ihrer Reinform in der Praxis nicht vor-kommen. Der erste Typus korrespondiert mit dem, was weiter oben als Primor- dialismus oder Essentialismus bezeichnet wurde und was der rassischen Auffas-sung von einer Nation am meisten entspricht. Die Kollektivität wird in dieser Auffassung als eine gegebene und „natürliche“ Schicksalsgemeinschaft mit ei-nem vorpolitischen Statut verstanden. Die Grenzen einer solchen Gemeinschaft sind nach innen hin praktisch undurchlässig. Mitglied einer solchen Gemein-schaft kann man nur aufgrund der Blutsverwandtschaft werden. Die Mitglied-schaft kann man jedoch verlieren, wenn man ihre Attribute durch solche Attribu-te „entwertet“, die der Gesellschaft nicht eigen, d. h. fremd sind, beispielsweise durch eine Ehe.
Eisenstadt und Giesen weisen auf Folgendes hin: „Die primordialen Attribute der kollektiven Identität verurteilen allein schon durch die Art und Weise ihrer sozialen Konstruktion alle Nachahmungsbemühungen zum Scheitern; sie sind allem Anschein nach grundsätzlich unübertragbar und von der Reflexivität der Angehörigen eines primitiven Gemeinwesens losgelöst – kurzum, die Anderen sind einfach unabänderlich verschieden und dieser Unterschied äußert sich dadurch, dass sie minderwertig und gefährlich zugleich sind. Die Fremden gel-ten häufig als dämonisch und es scheint, dass sie eine ausgeprägte und feindli-che Identität besitzen, welche die Existenz des primitiven Gemeinwesens be-droht.“46 Es war bereits die Rede davon, dass in der heutigen Zeit, ähnlich wie die Autoren des vorangegangenen Zitats, kaum jemand annimmt, dass die Primordialität von etwas Naturgegebenem ausgeht. Vielmehr wird sie für eine
45 Vgl. Shils (1975): Center and Periphery, S. 111-126. 46 Eisenstadt/Giesen (2003): Konstrukce kolektivní identity, S. 368.
19
diffizile soziale Konstruktion gehalten, die wie jede andere Konstruktion zu ih-rer Entstehung und Erhaltung besondere Rituale sowie eine Kommunikations-praxis benötigt.
Bei den kulturellen Codes der kollektiven Identität geht es um die Beziehung des Kollektivs zum Übernatürlichen. Das Kollektiv wird in einen Zusammen-hang mit der unveränderlichen und ewigen Sphäre des Heiligen und Erhabenen gebracht, egal ob wir sie nun als den Gott, den Kult, die Vernunft oder den Fort-schritt definieren. Diese Codes haben eine universalistische Dynamik und unter-scheiden sich von den so genannten traditionellen Codes durch den Bezug auf die transzendentale Art und Weise der Legitimation. Ihre universalistische Aus-richtung führt häufig zu einer missionarischen Haltung gegenüber den ‘Ande-ren’, und die Grenze zwischen Innen und Außen kann durch Kommunikation – die Bildung, das Konvertieren oder die Assimilation – überschritten werden. Diejenigen, die sich der Mission widersetzen, werden als in die Irre geführt und fehlbar betrachtet, die sich ihrer wahren Identität nicht bewusst sind.47 Diese Codes können sich beispielsweise auch in Form einer universalistischen und kulturfundamentalistischen Menschenrechtsrhetorik manifestieren.
Den Kern der traditionellen (civic) Codes der kollektiven Identität bilden die üblichen Praktiken und Traditionen sowie institutionelle und konstitutive Me-chanismen. Diese Codes drücken die hierarchischen Unterschiede zwischen den Trägern der Tradition, neuen Mitgliedern und den Außenstehenden, denen je-doch weder positive, noch negative Eigenschaften zugeschrieben werden, aus. Die Aufnahme zum Mitglied des Kollektivs bedeutet die Beteiligung an den ortsüblichen Praktiken, was auch eine der Bedingungen für die Mitgliedschaft ist. Laut Eisenstadt und Giesen wird das Problem der „Grenze“ bei den traditio-nellen Codes dadurch gelöst, dass diese eher kaum erwähnt wird.48 Den Kern der Konstruktion der kollektiven Identität bildet keine Spiegelung von Etwas aus der Außenwelt, sondern die Konkretheit eines Individuums, (Stand-)Ortes oder eines historischen Ereignisses. Dieser Typus von Codes bietet günstige Voraus-setzungen für die Schaffung von Bedingungen, die sich für die Konstruktion von komplementären und positiven Identitäten eignen.
47 Vgl. Eisenstadt/Giesen (2003): Konstrukce kolektivní identity, S. 373. 48 Vgl. ebd., S. 371 f.
20
Historisch gesehen oszillierte der ethnische Nationalismus in Europa zwischen der primordialen und der kulturellen Auffassung von Nation. Die meisten modernen europäischen Nationen bekennen sich zu der bürgerlich-liberalen Auffassung von Nation, die sowohl Elemente der traditionellen Codes als auch jene der kulturellen Codes der kollektiven Identität beinhaltet. Deren klare Un-terscheidung wird jedoch mit der voranschreitenden Multikulturalität des jewei-ligen Umfelds zunehmend schwieriger. Der über die Grenze geführte Diskurs und die so stattfindende Kommunikation bedeuten häufig eine Verschiebung hin zu einer kulturellen Art und Weise der Konstruktion der kollektiven Identität, was bedeutet, dass die Unterschiede zwischen den kulturellen und den traditio-nellen Codes in der Praxis sehr subtil sind.49 Durch die Zunahme der Multikul- turalität können daher je nach Bedingungen sowohl die traditionellen als auch die kulturellen Codes der kollektiven Identität gestärkt werden. Der Unterschied zwischen ihnen ist selbstverständlich durch den Charakter ihrer Legitimation bedingt, wobei er in der Praxis nur sehr geringfügig und kaum erkennbar sein kann. Man kann jedoch annehmen, dass sich der traditionelle Code durch ein höheres Maß an Toleranz und Reflexivität und dadurch auch durch ein höheres Maß an Inklusivität von sozialen und politischen Institutionen auszeichnet.50
49 Vgl. Eisenstadt/Giesen (2003): Konstrukce kolektivní identity, S. 372. 50 Im Zuge der Diskussion über das Verhältnis von kollektiven Identitäten in Europa ist daran zu erinnern, dass der Begriff Nation in verschiedenen europäischen Sprachen unterschiedliche Bedeutungen hat und infolgedessen bei Begriffen wie nationale Interessen oder Nationalis-mus unterschiedliche Konnotationen aufweist (vgl. Hroch, Miroslav (2000): In the National Interest. Demands and Goals of European National Movements of the Nineteenth Century. A Comparative Perspective, Prague; ders. (1996): An Unwelcome National Identity, or What To Do About „Nationalism“ in the Post-Communist Countries, in: European Review, Jg. 4, H. 3, S. 265-276). Dieser Umstand müsste detaillierter untersucht werden, weil es bedeutet, dass es in Europa im Gestaltungsprozess der kollektiven Identität unterschiedliche Ausgangsbedin-gungen und Voraussetzungen gibt. In den Sozialwissenschaften spricht man üblicherweise von einem kulturellen und politischen Verständnis einer Nation, beziehungsweise von einem ethnischen (ethnic) und zivilen (civic) Nationalismus. Der erste Begriff bezieht sich auf die Kultur, der zweite auf den Staat. Diese Verschiedenheit rührt von den unterschiedlichen Be-dingungen in Bezug auf den Staat (politische Macht) und Kultur (Gesellschaft) im Ablauf der Gestaltungsprozesse von modernen europäischen Nationen und Nationalstaaten her. Gewis-sermaßen berechtigt, wenngleich einigermaßen vereinfacht, werden dem kulturellen (ethni-schen) Verständnis exklusivistische und dem politischen (zivilen) Verständnis wiederum in- klusivistische Züge zugeschrieben. Das „kulturelle“ Prinzip gilt demnach als „falsch“ bzw. „schlecht“ und das politische als „gut“. Beide Auffassungen stellen natürlich Idealtypen dar. In Wirklichkeit haben sich beide Prinzipien überlappt und gegenseitig sowohl unterstützend (kooperativ) als auch antagonistisch aufeinander gewirkt. Habermas weist darauf hin, dass die westliche Auffassung der Nation in Wirklichkeit meistens zwischen der Vorstellung eines
21
Es wird deutlich, dass jeder der genannten Codes der kollektiven Identität einen anderen Typus der Grenze impliziert. In diesem Zusammenhang wird das Kon-zept der aktiven / passiven Grenze vorgestellt. Die aktive Grenze zeichnet sich durch ihre Durchlässigkeit und eine Vielzahl von Durchlässen bzw. Kommuni-kationskanälen aus, die passive Grenze wiederum durch ihre kommunikative Undurchlässigkeit. Während für die primordiale Auffassung der kollektiven Identität die beidseitig passive Grenze kennzeichnend ist, impliziert die kulturel-le Auffassung der kollektiven Identität eine Grenze, die an ihrer Außenseite (von außen nach innen) aktiv und an ihrer Innenseite (nach außen hin) passiv ist. Und schließlich versucht die traditionelle Auffassung eine Grenze zu pflegen, die von beiden Seiten (sowohl von außen nach innen als auch von innen nach außen) aktiv ist. Eine in beiden Richtungen aktive Grenze ist der Ausdruck einer gegen-seitigen Kommunikation und zeugt von Bestrebungen, die Unterschiedlichkeit zu verstehen, während die passive Auffassung der Grenze zu stereotypischer Etikettierung, Abgrenzung und Bewahrung (Konservierung) der Verschieden-heit verleitet (siehe Tabelle A).
natürlich wachsenden Kollektivs und dem Rechtskonstrukt einer Nation von Bürgern schwankte (und schwankt) (vgl. Habermas (2001): The Postnational Constellation, S. 101), obwohl, wie von vielen behauptet wird, dieser Prozess in Westeuropa vom Staat hin zur Nation einsetzte, während es in Mittel- und Osteuropa eher andersherum der Fall war (vgl. Gellner, (2003): Nacionalismus; ders. (1993): Národy a nacionalismus, Praha; Hroch (2000): In the National Interest). Von vielen wird auf die Gefahr einer derart vereinfachten Aufteilung unter Hinweis darauf, dass auch das zivile Prinzip in der Vergangenheit starke exklusi- vistische Tendenzen aufwies, hingedeutet. Ein gutes Beispiel dafür bieten die zwei als exemp-larische Vorbilder für die zivile bzw. ethnische Auffassung geltenden Nationen: die Amerika-ner und die Tschechen. Auf der einen Seite wies die Politik der USA im Laufe der Geschichte gelegentlich zahlreiche ethnozentrische Züge (z. B. die Haltung gegenüber den Ureinwoh-nern, Afroamerikanern, Japanern oder den Linken) auf, auf der anderen Seite wurden auch von der Tschechoslowakei unter Masaryks Präsidentschaft zahlreiche Elemente eines fort-schrittlichen zivilen Universalismus proklamiert und umgesetzt. Trotzdem wird von vielen verständlicherweise daran festgehalten, dass durch das Übergewicht von entweder zivilen, oder ethnischen Elementen die jeweilige politische Kultur wesentlich geprägt wird (vgl. Bry-ant, Christopher G. A. (1995): Civic Nation, Civil Society, Civil Religion, in: Hall, John A. (ed.): Civil Society. Theory, History, Comparison, Cambridge, S. 136-157; Müller, Karel (2002): �eši a ob�anská spole�nost. Pojem, problémy, východiska, Praha).
22
Tabelle A: Beziehung zwischen der kollektiven Identität und der aktiven/passiven Grenze
Code der kollektiven Identität / Grenze Außen Innen Primordialität – rassische Inklusionsauffassung
passiv passiv
Kultur oder Heiligkeit – assimilierende Inklusionsauffassung
aktiv passiv
Zivilität – integrative Inklusionsauffassung
aktiv aktiv
Kurz und bündig: der Kern bzw. die Auswirkung des traditionellen Codes der kollektiven Identität, welcher die bidirektional aktive Grenze bevorzugt, ist die „Unterscheidung ohne Abgrenzung“. Wie bereits oben erwähnt, ist die Unter-scheidung zwar ein natürliches, jedoch zugleich kritisches Moment der Identi-tätsgestaltung. Die Unterscheidung kann eine Auswirkung des Handelns und der Kommunikation sein, allerdings auch ihre verborgene Voraussetzung. Ist die Unterscheidung eine verschwiegene Voraussetzung der Kommunikation, so führt sie zur Ausgrenzung. Der traditionelle Code der kollektiven Identität zeichnet sich durch eine Unterscheidung aus, die eine Folge der aktiven Kom-munikation darstellt, welche das Verstehen von Unterschieden ermöglicht und den gemeinsamen Diskursraum mitsamt der Kommunikationsformen begründet und bereitstellt. Die aktive Grenze ermöglicht das Kennenlernen und das Ver-stehen von Unterschieden auf eine Art und Weise, die nicht die Unterschiedlich-keit oder Negation impliziert, sondern die fortgesetzte Kommunikation und Ko-operation begründet und impliziert.51 Die aktive Grenze macht somit das
51 Im Kontext dieser Argumentation ist auch die von William Outhwaite erhobene Forderung zu verstehen, wenn er vorschlägt, man müsse auch die fehlgeschlagenen Konfliktlösungen wertschätzen (vgl. Outhwaite, William (2000): Towards a European Civil Society?, in: Soun dings, H. 16, S. 131-143). Diese sind nämlich vom Nichtlösen der Konflikte (i. S. v. Nicht-einmischung) zu unterscheiden. Misserfolge bei der Lösung von Konflikten sind in einer de-mokratischen Gesellschaft notwendig und sollten uns von Konflikten nicht abbringen, son-dern sie sollten als wertvoll verstanden werden. Die Bedingungen dafür sind der Respekt und die gegenseitige Anerkennung. Die Gewaltfreiheit der Konfliktlösungen bietet uns einerseits die Chance, unsere Interessen und Ansichten auch zukünftig mit den anderen zu konfrontie-ren, und andererseits ist sie eine wichtige Ressource unseres Selbstvertrauens, unsere Interes-sen und Überzeugungen frei und angstfrei zu formulieren, wann auch immer wir es für not-wendig erachten. Eine erfolglose (jedoch friedliche) Konfliktlösung erhöht die Wahrschein-lichkeit, dass die Konflikte in Zukunft gelöst werden. Der Wert einer derart prozessorientier-ten Kommunikation besteht darin, dass die grenzüberschreitende Kommunikation keine bloße Institutionalisierung der Konsensfindung darstellt, sondern auch eine Institutionalisierung der Nichterreichung des Konsensus (ebd.). Der Wert der Institutionalisierung eines Konflikts be-
23
Verstehen der Unterschiedlichkeit und gleichzeitig das Konstruieren der Einheit möglich. Wie von Eisenstadt und Giesen treffend beschrieben wurde, wird das Problem der Grenze bei den traditionellen Codes dadurch gelöst, dass diese kaum erwähnt wird.52 Giddens spricht in diesem Zusammenhang von der Durch-lässigkeit der Grenze, Klaus Eder vom Finden der Grenzen des narrativen Netzwerks auf der Suche nach der kollektiven Identität, wobei diese zwangs- läufig unscharf und für eine Neubewertung offen bleiben, weil ein narratives Netzwerk selbst durch eine rege Kommunikationspraxis gekennzeichnet wird.53
Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang verständlicherweise bietet, zielt darauf ab, ob überhaupt noch von einer Grenze die Rede sein kann, die, falls dies notwendig wird, als Quelle der kollektiven Identität und Motivation zur „freiwilligen Selbstbeschränkung“54 bzw. zum „freiwilligen Aufopfern“55 dienen kann. Ist es denn kein Versuch einer Quadratur des Kreises, wenn man die Vor-stellung von einer Gemeinschaft ohne eine Umgrenzung verteidigt? Die Frage nach der Beziehung zwischen der aktiven Grenze und der Identitätsgestaltung würde sicherlich eine tiefere theoretische Aufarbeitung und umfangreichere em-pirische Untersuchung verdienen. Eine aktive Grenze, die den traditionellen Code der kollektiven Identität voraussetzt, kommt der positiven Auffassung der Identität entgegen, welche auf der Kompetenz und Kommunikationspraxis ba-siert. An dieser Stelle soll an das allgemein akzeptierte Argument erinnert wer-den, dass die Konstruktion der sozialen Beziehungen heutzutage eher der Logik eines Netzwerks und nicht der Logik einer territorialen (d. h. klar abgesteckten) Grenze folgt.56 Ich bin der Ansicht, dass auch eine durchlässige aktive Grenze die integrative Funktion einer Grenze erfüllen kann; sie kann die Grenze einer netzwerkdefinierten kollektiven Identität sein. Es geht jedoch um keine Grenze in Form einer hochgezogenen Mauer, sondern um eine, die das Ergebnis einer Kommunikationspraxis darstellt und für eine Neubewertung weiterhin offen
steht folglich nicht nur in der Gewaltfreiheit, sondern auch in dem Ablauf (Prozeduralität) der Konfliktlösungen selbst. 52 Eisenstadt/Giesen (2003): Konstrukce kolektivní identity, S. 371 f. 53 Giddens (2007): Europe in the Global Age; Eder, Klaus (2007): Europa als besonderer Kommunikationsraum, in: Berliner Journal für Soziologie, Jg. 17, S. 33-50. 54 Aron (2003): Demokracie a totalitarismus. 55 Habermas (2001): The Postnational Constellation. 56 So Castells (2001): The Internet Galaxy; Eder (2007): Europa als besonderer Kommunika- tionsraum; Rifkin, Jeremy (2005): Evropský sen. Jak evropská vize budoucnosti potichu zasti- �uje Americký sen, Praha.
24
bleibt. Es ist eine elastische, durch viele Durchlässe gekennzeichnete Grenze, deren Durchlässigkeit durch die Bereitschaft zur eigenen Eingliederung in den offenen Kommunikationsraum sowie bestimmte kulturelle und institutionelle Voraussetzungen auf beiden Seiten der Grenze bestimmt wird. Die aktive Gren-ze schafft die Voraussetzungen für die Kommunikation mit denjenigen, die man nicht kennt, und ermöglicht das Schließen und Öffnen der in ihr vorhandenen Durchlässe. Das Schließen ist jedoch kein primärer Kennzeichnungsmerkmal der aktiven Grenze, sondern vielmehr eine Folge der mangelnden Bereitschaft der Akteure, den gemeinsamen Diskursraum und seine Formen zu akzeptieren.
Es wurde bereits angedeutet, dass zu den Voraussetzungen einer aktiven Grenze sowohl die spezifischen Akteure der Kommunikation als auch die Kompatibili-tät der äußeren Umstände auf beiden Seiten der Grenze gehören. Die äußeren Umstände, zu denen man die Kulturressourcen und die Infrastruktur zählen kann, müssen einen sinnvollen grenzüberschreitenden Informationsaustausch und Wissensverbreitung in beide Richtungen gewährleisten. Die Existenz einer aktiven Grenze hängt zudem von einem bestimmten institutionellen Unterbau (z. B. der Existenz von Nichtregierungsorganisationen, Kommunikationsforen, Förder-, Regierungs- und Austauschprogrammen usw.) ab, durch den die Mög-lichkeiten für eine Pflege der Grenze als einer offenen Struktur/Einrichtung, welche die Kommunikation und das Verstehen der Unterschiede zwischen den Akteuren von beiden Seiten der Grenze ermöglicht, bereitgestellt werden. Die aktive durchlässige Grenze kann demnach eine Art institutionalisierte Schnitt-stelle darstellen, die die Kommunikation und das Kennenlernen der Verschie-denheit möglich macht, und als Quelle für interaktive Pluralität und öffentlichen Kritizismus dienen.
5. Europäische Öffentlichkeit – Handhabung einer aktiven Grenze
Der europäische Integrationsprozess könnte als die Gewährleistung einer bidi-rektional aktiven Grenze interpretiert werden. Das allgemein akzeptierte Argu-ment, dass die Europäische Union insbesondere als ein Mechanismus zur Ein-dämmung (containment) des ethnischen Nationalismus angedacht war und ist, kann als eine Forderung nach einer kulturellen und institutionellen Handha-
25
bung (treat) einer bidirektional durchlässigen Grenze übersetzt werden. Diese Forderung ist sowohl in Bezug auf die EU-Außen- als auch auf die EU-Binnengrenzen von Bedeutung. In Bezug auf die Außengrenzen geht es um die Nachbarschaftspolitik, in erster Linie konkret um die Bereitstellung von kultu-rellen und institutionellen Voraussetzungen für die Handhabung der aktiven Grenzen zu der Türkei, Nordafrika und der Ukraine, aber auch in Bezug auf China, Russland oder die USA, obwohl dort der Einfluss der EU bislang eher vernachlässigbar gering war.
Bezüglich der Außengrenzen kann an drei spezifische Beispiele aus der letzten Zeit erinnert werden. Erstens war es der Druck der EU auf den Kosovo und auf Serbien, wo es zu einer Verfestigung der passiven Grenze kam. Dieser Druck zielte auf die Öffnung und Gewährleistung der Kommunikationskanäle ab. Zur-zeit ist es insbesondere der Druck der Europäischen Union, der vornehmlich auf Serbien im Zuge der Bemühungen des Landes um den EU-Beitritt ausgeübt wird und eine Vertiefung und weitere Zuspitzung in diesem schwelenden („eingefro-renen“) Konflikt verhindert. Als zweites Beispiel kann der Druck von EU-Institutionen auf die Slowakei und auf Ungarn dienen. Die Spitzenvertreter bei-der Länder haben 2006 nach der Übernahme des Premierminister-Postens in der Slowakei durch Robert Fico zwei Jahre lang keine offiziellen Kontakte unterhal-ten und erst auf Drängen der Europäischen Kommission hat sich der Trend hin zu einer gegenseitigen Kommunikation der obersten Vertreter beider Länder gewendet.
Das dritte Beispiel ist der Druck der EU auf die Lösung der Integration von Ro-ma-Gemeinschaften in Tschechien, wo nach 1989 eine Zunahme von ethnischen Spannungen und eine sich vertiefende Segregation zu beobachten sind. Eine langfristige Lösung des Problems gelingt insbesondere deshalb nicht, weil zwi-schen der Mehrheitsgesellschaft und den Roma-Gemeinschaften die passiven Grenzen überwiegen. Dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft und die Roma-Gemeinschaften lernen, miteinander zu kommunizieren und ihre Verschieden-heit zu verstehen, gibt es bisher keine ausreichenden kulturellen und institutio-nellen Voraussetzungen. Die Stärkung der passiven Grenze bestärkt die beste-henden stereotypischen Vorurteile und Etikettierungen und schafft zudem ein Gefühl der Unsicherheit und Diskriminierung, welches von der gegenseitigen Ignoranz und der wachsenden Spannung genährt wird. Alle drei genannten
26
Beispiele können als Anschauungsmaterial dafür dienen, welche Gefahren die Stärkung von passiven Grenzen mit sich bringt und welche Rolle in diesem Zu-sammenhang die EU zu spielen versucht. Der häufig von den Appellen an die primordialen und kulturellen / heiligen (sacred) Codes der kulturellen Identität begleitete politische Populismus und kulturelle Fundamentalismus stellt eine ernsthafte Bedrohung der Demokratie in Europa dar. Dieser Typus der Identi-tätspolitik nährt die Voraussetzungen für die Konstruktion von passiven Gren-zen samt ihrer Auswirkungen und beutet sie anschließend aus.
Die Europäisierung der Öffentlichkeiten (public spheres) sollte ein Teil und zu-gleich Ausdruck der Sicherstellung von aktiven Grenzen in Europa sein (und ist es auch). Auch wenn wir jetzt die politischen und sozialen Folgen der Entwick-lung bzw. der Europäisierung beiseitelassen, steht die Bedeutung der Öffent-lichkeit für die Sicherung der Demokratie außer Frage. Auch die Europäisierung der Öffentlichkeiten ist zweifelsohne eine Voraussetzung und zugleich Aus-druck einer Entwicklung von Demokratien über den Rahmen des Nationalstaats hinaus. Die Europäisierung der Öffentlichkeiten (auf allen Entscheidungsebe-nen) stellt eine Sicherstellung der aktiven Grenzen in Europa dar. Dieser Prozess basiert auf der Voraussetzung, dass die Akteure beiderseits der Grenze trotz un-terschiedlicher Interessenlagen und kollektiven Identitäten einander als legitime Gesprächspartner respektieren. Die Akteure der grenzüberschreitenden Kom-munikation halten einander nicht für Ausländer (foreigners), sondern gestalten zusammen einen kommunikativen Diskurs sowie einen gemeinsamen Kommu-nikationsraum.
Die aktive Grenze stellt eine notwendige und produktive Komponente von europäisierten Öffentlichkeiten dar,57 welche eine vorurteilsfreie Begegnung mit der Verschiedenheit sowie eine Neubewertung von eigenen Interessen und Identitäten ermöglichen. Wie im Zusammenhang mit der Kommunikation und dem Kennenlernen der Verschiedenheit (bzw. des mir Unbekannten) von Bridgette Wessels angeführt wird, ermöglichen die über durchlässige aktive Grenzen stattfindenden Kommunikationsprozesse den Ausgleich zwischen „too far“ und „too close“ als Kompromiss zwischen „being the same and the different
57 Vgl. Risse (2010): A Community of Europeans?
27
at the same time“.58 Der Ausgleich als das Gleichgewicht zwischen diesen zwei Lagen garantiert einerseits die auf der Gestaltung positiver Identitäten basie- rende soziale Inklusion und demokratische Integration, und andererseits das öffentliche Lernen und Kritizismus. Emmanuel Levinas, auf den sich Wessels beruft, verwendet in diesem Zusammenhang das Konzept des angemessenen Abstands („proper distance“). Diese Argumentationslinie entspricht auch Becks Definition der so genannten „reflexiven Modernisierung“, die sich durch die Überwindung des kognitiven Binarismus der „einfachen Modernisierung“ („entweder – oder“) sowie durch die Betonung der Komplementarität von kognitiven und Identifizierungscodes („sowohl als auch“) auszeichnet.59
6. Fazit
In meinem Beitrag argumentierte ich zugunsten der These, die Grenze könne eine eigenständige Kulturform darstellen, die einerseits das Gefühl der Einheit und Zugehörigkeit schafft und andererseits das Verständnis und die Kommuni-kation der Verschiedenheit ermöglicht. Unter Heranziehung von Edward Shils‘ Typologie der kollektiven Identität sowie des Identitätskonzepts von Erik Erikson und dessen Untersuchungen zu den Prozessen der Identitätsgestaltung interpretiere ich den europäischen Integrationsprozess als die Sicherung und Handhabung von aktiven Grenzen, die die Stärkung der traditionellen (civic) Codes der kollektiven Identität und die Konstruktion von positiven Identitäten ermöglichen. Die traditionellen Codes der kollektiven Identität schaffen die Vo-raussetzungen für soziale Kritik und öffentliches Lernen. Positive Identitäten erzeugen eine Komplementarität von kollektiven Identitäten, implizieren Kom-munikation und Kooperation und führen zur Selbst-/Zufriedenstellung. Die akti-ve Grenze ist demnach sowohl die Voraussetzung als auch der Ausgangspunkt für zivile Integration, öffentliches Lernen und Gestaltung positiver Identitäten. Negative Identitäten als Ausdruck von Unsicherheit und Bedrohungsgefühl er-zeugen eine stereotypische Abgrenzung und Diskriminierung und stärken die passive Grenze. Negative Identitäten erzeugen Abschottung, Ignoranz, Funda-
58 Vgl. Wessels, Bridgette (2008): Exploring the notion of Europeanization of Public Sphere and Civil Society in Fostering a Culture of Dialogue Through the Concept of „Proper Dis- tance“, in: Sociologija. Mintis ir veiksmas, Jg. 23, H. 3, S. 28-46. 59 Vgl. Beck (2007): Vynalézání politiky.
28
mentalismus, Neigungen zu Gruppenantagonismen und Gewalt. Zwischen der passiven Grenze, der negativen Identität und der sozialen Ausgrenzung auf der einen sowie der aktiven Grenze, der positiven Identität und der sozialen Inklusi-on auf der anderen Seite bestehen reflexive Beziehungen, wie es anhand der zwei Kreisläufe (A, B) im folgenden Schema angedeutet wird. Schema: Reflexive Dynamik der Beziehungen von „Grenze, kollektiver Identität, sozia-
ler Eingliederung und Wissen“
Die traditionellen Codes der kollektiven Identität können anscheinend zur Stär-kung der kosmopolitischen Identität als einer Gemeinschaft mit aktiven Gren-zen, welche die Unterschiede zwischen „wir/die Anderen“, „innen/außen“ rela-tivieren, führen. Die Unterscheidung ist das Ergebnis des aktiven Handelns und nicht einer stereotypen Etikettierung oder Abgrenzung. Die Unterscheidung ist stets ein offenes Ergebnis der Kommunikation, die Abgrenzung derer apriori-sche Voraussetzung. Die Abgrenzung und die passive Grenze führen zur Kon-struktion der Andersheit, während durch die aktive Grenze die Toleranz gestärkt wird. Mithilfe der Kommunikation und der Bemühungen um Verständigung er-möglich die aktive Grenze eine Stärkung der Toleranz gegenüber denjenigen, die wir nicht kennen. Es geht um das Kennenlernen der Unterschiedlichkeit, der
29
die „Larve des Fremden bzw. des Feindes vom Gesicht heruntergerissen“ und eine Andersheit zugeschrieben wird, die keine Bedrohung mit einschließt.
Natürlich bin ich nicht so töricht zu glauben, dass die Abgrenzung von Men-schen gegenüber „den Anderen“ und „dem Anderen“ irgendwann gänzlich un-terdrückt werden könnte. Dies ist nicht einmal wünschenswert. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Zeugen vom Ende der Geschichte werden, der paradiesi-schen Glückseligkeit ausgesetzt und von dem Rhythmus göttlicher Dithyramben in den Schlaf gewogen. Es wäre herrlich, doch statt eines Rückzugs von „Fein-den“ und „Risiken“ sehen sich die liberal orientierten Europäer eher ihrer wach-senden Zahl gegenüber. Auch in den Fragen der Gestaltung von kollektiven Identitäten in Europa wird das Integrationspotenzial der als gemeinsam wahrge-nommenen Feinde und Bedrohungen eine wichtige Rolle spielen. In dieser Heu-ristik geht es jedoch darum, den wirklichen Gefahren die Stirn zu bieten. Und darin besteht auch im 21. Jahrhundert die Herausforderung sowohl für Europa als auch für die deutsch-tschechischen Beziehungen. Können die bürgerlichen Gesellschaften und die Politiker Europas die wirklich realen Gefahren aufspüren und sie auf ein sozial verträgliches und menschlich erträgliches Maß reduzieren? Der moderne Nationalstaat hat sich diesbezüglich nicht besonders gut bewährt. Der Kampf gegen die Geister und Gespenster, die Europa in eine Katastrophe stürzten, hat schließlich im vergangenen Jahrhundert den Großteil seiner politi-schen Agenda beansprucht.
Giddens weist darauf hin, dass die mit der Moderne einhergehende weite Ver-breitung von abstrakten Systemen zur Überwindung der Abhängigkeit von per-sönlichen Bindungen beiträgt und dass der Gegensatz von „Freund“ nicht mehr „Feind“, sogar nicht einmal mehr „Fremder“ sei, sondern vielmehr „jemand, den ich nicht kenne“.60 Darin besteht eine der Herausforderungen der (europäischen) Bürgerschaft, wie man das Selbst-/Vertrauen mit der Unsicherheit miteinander verzahnt und wie man lernt, den „Anderen“ mit Vertrauen und Respekt zu be-gegnen. Es steht jedoch außer Frage, dass eine erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderung durch wirksame (europäisierte) politische Institutionen sowie eine europäisierte politische Kultur unterstützt werden sollte, die den Akteuren sowohl das sichere Erleben der Abgrenzung als auch die Interaktion mit der Verschiedenheit und nicht zuletzt die Handhabung von aktiven Grenzen ermög-
60 Giddens (1998): D�sledky modernity, S. 108.
30
lichen. Dann wird es möglich, dass die Gegenwart der „Anderen“ mit der For-mung von positiven Identitäten nicht im Widerspruch steht, sondern zu ihrem integralen Bestandteil wird. Denn wie bereits Bauman sagt: „[…] moralisch reife Menschen sind diejenigen, die die Andersheit gern neben sich haben, die das Bedürfnis nach dem Unbekannten verspüren und die sich ohne eine gewisse Anarchie und Unsicherheit in ihrem Leben unvollständig fühlen.“61 Bestandteil einer solchen Konfrontation mit der „Andersheit“, die schließlich Teil jeder kri-tischen Reflexion ist, ist auch der Kampf gegen die „Feinde“ in uns selbst, wel-cher jedoch nicht zum Verlust der Selbstachtung führen sollte. Denn, wie Arthur Rimbaud offenbart, auch „ich bin ein anderer“62 ...
Auswahlbibliografie
Anderson, Benedict (2003): Pomyslná spole�enství [Die Erfindung der Nation – Imagined Communities] in: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacio- nalismus [Blicke auf die Nation und den Nationalismus], Praha, S. 239-269.
Appiah, Kwame Anthony (2001): Identita, autenticita, p�ežití. Multikulturní spole�nosti a sociální reprodukce [Identität, Authentizität, Überleben. Multikul- turelle Gesellschaften und Soziale Reproduktion], in: Taylor, Charles/Gutmann, Amy (ed.): Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání [Multikulturalismus. Erforschung der Politik der Anerkennung], Praha, S. 163-178.
Aron, Raymond (2003): Demokracie a totalitarismus [Demokratie und Tota- litarismus], Brno.
Bauman, Zygmunt (1995): Úvahy o postmoderní dob� [Überlegungen zur postmodernen Ära], Praha.
Bauman, Zygmunt (2002): Tekutá modernita [Flüssige Modernität], Praha.
61 Bauman (1995): Úvahy o postmoderní dob�, S. 59. 62 Rimbaud, Arthur (1990): Seher-Briefe/Lettres du voyant, übers. und hrsg. von Werner von Koppenfels, Mainz.
31
Beck, Ulrich (2007): Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace [Die Erfindung der Politik. Zur Theorie der reflexiven Modernisierung], Praha.
B�lohradský, Václav (1992): Kapitalismus a ob�anské ctnosti [Kapitalismus und bürgerliche Tugenden], Praha.
Berger, Peter L./Luckmann, Thomas (1999): Sociální konstrukce reality. Pojed-nání o sociologii v�d�ní [Soziale Konstruktion der Realität. Eine Abhand- lung über die Soziologie des Wissens], Brno.
Bryant, Christopher G. A. (1995): Civic Nation, Civil Society, Civil Religion, in: Hall, John A. (ed.): Civil Society. Theory, History, Comparison, Cambridge, S. 136-157.
Campbell, David (1992): Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Manchester.
Castells, Manuel (2001): The Internet Galaxy. Reflection on the Internet, Busi-ness, and Society, Oxford.
Calhoun, Craig (1994): Social Theory and the Politics of Identity, in: ders. (ed.): Social Theory and the Politics of Identity, Cambridge, MA/Oxford, S. 9-36.
Cohen, Anthony P. (2000): Signifying Identities. Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values, London.
Connolly, William E. (1991): Identity/Difference. Democratic Negotiations of Political Paradox, Ithaca, NY.
Eder, Klaus (2007): Europa als besonderer Kommunikationsraum, in: Berliner Journal für Soziologie, Jg. 17, S. 33-50.
Eisenstadt, Shmuel N./Giesen, Bernard (2003): Konstrukce kolektivní identity [Konstruktionen nationaler Identität], in: Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus [Blicke auf die Nation und den Nationalismus], Praha, S. 361-374.
Gellner, Ernest (1993): Národy a nacionalismus [Nationen und Nationalismus], Praha.
32
Gellner, Ernest (2003): Nacionalismus [Nationalismus], Brno.
Giddens, Anthony (1998): D�sledky modernity [Konsequenzen der Moderne], Praha.
Giddens, Anthony (2007): Europe in the Global Age, Cambridge.
Habermas, Jürgen (2001): The Postnational Constellation. Political Essays, Cambridge.
Hoover, Kenneth R. (1997): The Power of Identity. Politics in a New Key, Chatham, N. J.
Hroch, Miroslav (1996): An Unwelcome National Identity, or What To Do About „Nationalism“ in the Post-Communist Countries, in: European Review, Jg. 4, H. 3, S. 265-276.
Hroch, Miroslav (2000): In the National Interest. Demands and Goals of Euro-pean National Movements of the Nineteenth Century. A Comparative Perspec- tive, Prague.
Luhmann, Niklas (1971): Sinn als Grundbegriff der Soziologie, in: ders./ Habermas, Jürgen (Hrsg.): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt am Main, S. 25-100.
Melucci, Alberto (1996): Challenging Codes. Collective Action in the Infor-mation Age, Cambridge.
Morley, David (2000): Home Territories. Media, Mobility and Identity, London/ New York, NY.
Müller, Karel (2002): �eši a ob�anská spole�nost. Pojem, problémy, východiska [Die Tschechen und die Bürgergesellschaft. Begriff, Probleme, Lösungsan- sätze], Praha.
Picht, Robert (1993): Disturbed Identities. Social and Cultural Mutations in Contemporary Europe, in: Garcia, Soledad (ed.): European Identity and the Search for Legitimacy, London, S. 81-94.