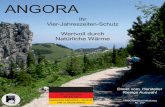Die Beinkleider vom Rieserferner und die keltischen „bracas“
Transcript of Die Beinkleider vom Rieserferner und die keltischen „bracas“
Vorgelegt von:
Florian MessnerSommersemester 2009
Einleitung
Der Rieserfernerfund bezeichnet den Fund von gut erhaltenen
hallstattzeitlichen Geweberesten in der Rieserfernergruppe in
Südtirol.
Zur genaueren Lokalisierung des Gebietes (siehe Abb. 1): Wir
befinden uns hier im Antholzertal, nahe der Rieserfernerhütte
am Gamsbichljoch. Dieses Joch stellt den Übergang zwischen dem
Antholzer- und dem Rein- bzw. Tauferer Ahrntal. Der
Textilkomplex befand sich etwa 200 Meter westlich der Hütte,
auf einer Meereshöhe von 2.841 m.
Fundgeschichte
In den Jahren 1992 und 1994 fand Gottfried Leitgeb, der Wirt
der Rieserfernerhütte, nahe der Schutzhütte in ausgeapertem
Gebiet mehrere Gewebe unbekannten Alters (Strumpf), die
anschließend vom Amt für Bodendenkmäler untersucht wurden. Bei
den Untersuchungen kamen noch weitere Objekte zum Vorschein
(Abb. 2 und 3). Insgesamt handelte es sich um ein Paar
2
„Socken“, zwei Paare Beinkleider, sowie verschiedene Schnüre
und Lederreste. Die Beinkleider waren teilweise in
hervorragendem Zustand und Proben dieser Bekleidungsreste
wurden von der ETH Zürich mittels der Radiokarbonmethode auf
ihr Alter bestimmt. Diese Untersuchungen brachten nun eine
Sensation zu Tage: Die Beinkleider stammen aus der älteren
Eisenzeit (Hallstattzeit) und sind etwa 2.500 – 2.800 Jahre
alt.
1994 wurde das Fundgebiet unterhalb des Gamsbichljoches
archäologisch mittels Georadar untersucht. Dabei konnten,
abgesehen von einigen Schnüren und Lederresten, keine weiteren
Kleiderreste entdeckt werden. Auffallend war auch, dass keine
menschlichen Knochen gefunden wurden.
Die Kleider wurden in Bozen restauriert und auch vom Labor für
Archäobiologie in Como genauer untersucht.
Die einzelnen Kleidungsstücke
Alle der aufgefundenen gewebten Textilien sind aus Wolle
gefertigt, allerdings nicht aus Schafwolle, sondern aus Wolle,
die von Ziegen stammt.
a) Das erste Paar Beinlinge (Abb. 4) besteht aus Leinenbindung
und ist 64 cm lang, mit einem Höchstdurchmesser von 34 cm. Die
Leggings weisen unten jeweils eine Lasche auf, um den Fußspann
zu schützen. Beide Stücke bestehen aus je einem Teil, das
umgebogen und zusammengenäht wurde. Teilweise sind noch zwei
braunrote Borten appliziert.
b) Das zweite Paar Beinlinge (Abb. 5) besteht aus einem
schwereren Stoff und ist mit einer anderen Technik
3
(Spitzköperbindung) gewebt. Im Detail sieht man eine
Flickstelle im Kniebereich (Abb. 6), wo zwei verschiedene
Gewebearten (erkennbar durch verschiedene Farben)
zusammengenäht wurden. Der Kniebereich ist mit einem Stoff aus
Leinenbindung verstärkt, wobei diese Bindung aber nicht mit
derjenigen des ersten Legging-Paares identisch ist. Die
Schnüre, die man am rechten Exemplar erkennen kann, dienten
wahrscheinlich zur Befestigung des Objektes am Fuß.
c) Beide Exemplare der Wollschuhe oder „Socken“ (Abb. 7)
bestehen aus Leinenbindung und sind aus verschiedenen Streifen
zusammengenäht. Das rechte Exemplar ist in einem sehr guten
Zustand, während man das linke nur aus dem Zusammenhang als
Schuh bezeichnen kann. Die Oberfläche der Socken ist leicht
verfilzt, was auf Wasserkontakt schließen lässt, wie etwa bei
Hochgebirgstouren über Gletscher. Die Verfilzung könnte aber
auch auf den Versuch zurückzuführen sein, Wasser abzuweisen um
trockenen Fußes Gletscher zu überqueren.
Auf diesen Bildern erkennt man leider nicht, dass der rechte
Schuh mit einem Faden genäht wurde, der noch heute deutliche
Spuren einer Blaufärbung trägt.
d) Des weiteren fanden sich mehrere Fragmente aus Leder (Abb.
8), die Dal Ri als Überschuhe für die „Socken“ interpretiert.
Diese Überschuhe dienten wohl dem Schutz der „Socken“ vor
Beschädigung und Nässe.
Interpretation
Das Bemerkenswerte am Rieserfernerfund ist die Auffindung eines
kompletten Satzes Unterbekleidung, welches seinesgleichen
4
sucht, denn z.B. aus Hallstatt wurden vor allem Gewebe in
Zweitverwendung geborgen. Leggings wurden auch schon 2.000
Jahre früher im Hochgebirge getragen, das zeigt die
Beinbekleidung von Ötzi, der Leggings aus Ziegenleder besaß.
Die Kleidungsstücke haben in etwa dieselbe Größe und bilden ein
Ensemble. Sie wurden wahrscheinlich alle übereinander getragen,
um eine möglichst gute Kälteisolation zu erreichen. Die Schnüre
könnten zur Befestigung der Stücke der Socken als auch der
Leggings am Gürtel gedient haben. Die Lederreste stammen
wahrscheinlich von Überschuhen.
Das Fehlen jeglicher menschlicher Knochen könnte bedeuten, dass
die Kleider gewechselt und zurückgelassen wurden.
Auszuschließen ist aber auch nicht, dass sich im Gletscher noch
ein Leichnam befindet, oder dass es sich um eine rituelle
Hinterlegung der Kleidung (z. B. aufgrund einer erfolgreichen
Jochüberquerung) handelt.
Auffallend sind die zahlreichen Flickstellen und die
Unterschiede in der Machart zwischen den einzelnen Stücken, was
auf eine Lebensweise des Trägers fern menschlicher Zentren
(z.B. Hirte) hinweisen könnte.
Die geographische (15 km) und zeitliche Nähe (ebenfalls
Hallstattzeit) zum Gräberfeld von Niederrasen (Windschnur)
lässt darauf schließen, dass der Besitzer der Kleidung
zumindest Kontakt mit der dortigen Bevölkerung gehabt hat. Im
dortigen Gräberfeld sind nämlich auch Steigeisen, die für
solche Hochgebirgstouren vonnöten waren, gefunden worden.
Heute wird der Rieserfernerfund im Südtiroler Archäologiemuseum
von Bozen ausgestellt.
5
Keltische bracas
Die Bezeichnung „Bracas“ geht auf den römischen Schriftsteller
Diodorus Siculus (kurz Diodor) zurück, der im Jahre 54 v. Chr.
eine Universalgeschichte schrieb, in der er auch die Kelten
erwähnt. Laut Diodor gehörten trugen Kelten bestickte Hemden in
unterschiedlichen Farben. Zu diesen Hemden trug man Hosen,
deren Muster und Farbe leider nicht erwähnt wird. Allerdings
waren die Mäntel der Kelten gestreift und mit einem dichten,
mehrfarbigen Karomuster verziert. Deshalb werden bei heutigen
Rekonstruktionen oft karierte Hosen verwendet.
Die Form der Hosen war unterschiedlich. Funde zeigen
verschiedene Varianten wie knöchellange, aber auch knielange
kurze Hosen.
Laut Polybius war besonders die Kniehose seit dem 2.
Jahrhundert v. Chr. in Gallien im alltäglich. Die römischen
Schriftsteller, denen Hosen fremd waren, sprachen deswegen
häufig von „Gallia braccata“, dem behosten Gallien.
Funde von kompletten Hosen aus dieser Zeit sind Mangelware,
weswegen hier auf einige Exemplare eingegangen wird, die von
Moorleichen aus Nordeuropa stammen. Die Hosen von Marx-Etzel
und Dätgen stammen zwar aus dem germanischen Kulturkreis und
wurden nach Christi Geburt gefertigt. Allerdings wird sich die
germanische nicht grundlegend von der keltischen Hose
unterschieden haben, da die Hose ja eine Allzweckform
darstellt.
Die Hose der Moorleiche von Marx-Etzel (Ostfriesland-
Niedersachsen), die ins erste bis dritte Jahrhundert nach
Christus datiert, besteht aus einem einzigen Tuchstück, das
6
umgelegt und vernäht wurde. Wegen dieser einfachen
Herstellungsart war diese Hose im Bund sehr weit. Sie musste
deshalb stark in Falten gelegt, oder mit einem Gürtel gehalten
werden (siehe Abb. 9)
Die Moorleiche von Dätgen (Schleswig-Holstein) stammt aus dem
zweiten bis dritten nachchristlichen Jahrhundert. Und wurde
1959 entdeckt. Bei den gut erhaltenen Textilien der Leiche
handelt es sich unter anderem um eine kurze Hose, die aus
mehreren Teilen besteht. Wegen dieses aufwändigeren Schnittes
kann die Dätgen-Hose der Körperform besser angepasst werden
(siehe Abb. 10).
Erwähnt werden soll noch eine exemplarische Abbildung, die auf
einer Schwertscheide aus Grab 994 in Hallstatt (frühe
Laténezeit) stammt (siehe Abb. 11).
Die Scheide ist mit einer figürlichen Ritzverzierung
geschmückt, die mehrere Personen und deren Hosen darstellt. Die
Beinkleider bestehen aus übereinander angeordneten
Stoffstreifen, die unterschiedlich gemustert sind und bis zur
Taille reichen. Diese hosenähnlichen Kleidungsstücke werden
unterschiedlich gedeutet. Die Meinungen reichen von einer
bloßen Ornamentierung, über Beinwickel bis zu eng anliegenden
gemusterten Hosen. Laut Kurzynski ist die Interpretation als
Beinwickel unwahrscheinlich, da keine Halterungen abgebildet
sind und für reine Ornamente sind die „Hosen“ zu detailliert.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine strumpfhosenartige
Bekleidung.
Abbildungen
7
Abbildung 3: Umzeichnung des Textilkomplexes Abbildung
4: „Leggings“ aus Leinenbindung
Abbildung 5: „Leggings“ aus
Spitzgratköper
9
Abbildung 8: Eines der Lederfragmente
Abbildung 9: Schnittzeichnung der
Hose von Marx Etzel
Abbildung 10:
Schnittzeichnung der Hose von
Dätgen
11
Abbildung 11: Detail der Schwerscheide aus Hallstatt
Bibliographie
Bazzanella, Marta, Lorenzo Dal Ri, Alfio Maspero und Irene
Tomedi 2005: Iron Age Textile artefacts from
Rieserferner/Vedretta di Ries (Bolzano/Bozen – Italy), in:
Hallstatt Textiles. Technical Analysis, Scientific
Investigation and Experiment on Iron Age Textiles, BAR
International Series 1351, S. 151-160.
Demetz, Stefan, Reimo Lunz, Luzia Brunner Renzler 1997: Urne,
Beil & Steigeisen. Archäologie in Rasen-Windschnur und der
rätselhafte Rieserfernerfund.
Dal Ri, Lorenzo 1996: I ritrovamenti presso il rifugio Vedretta
di Ries/Rieserferner nelle Alpi Aurine (2850 m s.l.m.), in:
Rivista di Scienze Preistoriche 47, 1995-96, S. 367-388.
Gleba, Margarita 2008: Textile Production in pre-roman Italy,
Ancient Textiles Series Vol. 4.
Kurzynski, Katharina von 1996: "... und ihre Hosen nennen sie
bracas". Textilfunde und Textiltechnologie der Hallstatt- und
Laténezeit und ihr Kontext. Internat. Arch. 22.
12
Lunz, Reimo 2005: Archäologische Streifzüge durch Südtirol.
Band 1, Pustertal und Eisacktal.
http://www.germanenleben.de/ausstattung/kleidung/kleidung.htm,
Zugriff: 5. Juli 2009.
13