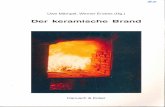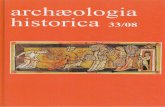Wo sind all die Schiffe hin? Mittelalterliche Wrackhölzer vom Frankenhof-Stralsund
Transcript of Wo sind all die Schiffe hin? Mittelalterliche Wrackhölzer vom Frankenhof-Stralsund
175Kapitel174 Philipp Grassel . Jasmin Loose
Philipp Grassel Jasmin Loose
HoLznutzunG im mitteLaLter und der FrüHen neuzeitDie Städte und Siedlungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit zeich-neten sich vor allem im nordalpinen Raum durch eine intensive Holz-nutzung aus. Dieser Rohstoff diente nicht nur als prägender Baustoff für Häuser, sondern auch als elementarer Werkstoff verschiedener städtischer Gewerke wie z. B. der Wagnerei, der Böttcherei und der Bootsbaukunst. Somit spielte er für die gesamte urbane, infrastrukturelle Entwicklung eine entscheidende Rolle. Auch als Handelsgut erlangte Holz eine große ökonomische Bedeutung innerhalb der städtischen Wirtschaft. Darü-ber hinaus waren die eisenverarbeitenden Berufsgruppen wie Schmiede und Gießer ebenfalls direkt von diesem Rohstoff abhängig, da ihre Essen mit Holzkohle betrieben wurden und somit Holz sowie Holzkohle nicht zuletzt auch als Brenn- und Heizmaterial Verwendung fanden. Das sehr weite Spektrum der Nutzung von Holz und dessen begrenzte Verfügbar-keit führten schon früh zu weitreichenden Reglementierungen bezüglich des Einschlages, der Verarbeitung, der Ein- und Ausfuhr sowie der Res-sourcenbildung dieses Naturproduktes. Eine Vielzahl mittelalterlicher und neuzeitlicher Schriftquellen erlaubt hier weitreichende Einblicke in die verschiedenen, zeitgenössischen Gesetzeslagen der städtischen Räte und der ländlichen Nobilitäten zur Wald- und Holznutzung1. Von einem forstwirtschaftlichen Bewusstsein, das dem heutigen Verständnis ähnlich ist, ist jedoch frühestens ab dem Spätmittelalter zu sprechen2. Aufgrund des offensichtlich hohen Bedarfs und der begrenzten Verfügbarkeit eta-blierte sich sehr schnell die Praxis des „Recyclings“ von Hölzern. So trifft man bei Ausgrabungen innerhalb mittelalterlicher Siedlungen häufig auf hölzerne Funde und Befunde, die sich aus wiederverwendeten Bestand-teilen anderer Holzkonstruktionen zusammensetzen. Hierbei ist jedoch eine differenzierte Verwendung dieses Materials zu beobachten. So sind wiederverwendete Hölzer überwiegend im Kontext von Stabilisierungen und Unterfütterungen von Kellern und/oder Hafenanlagen, innerhalb der städtischen Brauch- und Abwasserleitung sowie bei der Anlage einfacher Kloaken zu beobachten3. Eine Verwendung als Baustoff für aufgehende Bauten wie Wohnhäuser bzw. administrative und/oder repräsentative Gebäude ist dagegen selten. Erklären lässt sich diese Differenzierung mit der offensichtlichen Qualitätsminderung des wiederverwendeten Holzes durch dessen Primärnutzung. So wies das Material naturgemäß Gebrauchs-spuren wie Lochungen, Abarbeitungen, Zersplitterungen oder auch Teer- und Pechreste sowie andere Verschmutzungsspuren auf, wodurch nur bedingt eine handwerkliche Neuverarbeitung möglich war. Ferner ist anzunehmen, dass diese Hölzer durch ihre langen Nutzungsphasen weder optisch noch olfaktorisch als qualitativ wertvoll angesehen wurden. Die
Wo sind all die Schiffe hin?mittelalterliche Wrackhölzer vom Frankenhof-Stralsund
175Wo sind all die Schiffe hin?
beschriebene Wiederverwendung von Hölzern für infrastrukturell wichtige, jedoch im Stadtbild kaum sichtbare Konstruktionen lässt sich auch an einem Fundplatz des 14. Jahrhunderts in Stralsund erkennen. Dessen spätmittelalterliche Befunde bildeten die Grundlage zweier wissenschaftlicher Abschlussarbeiten des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und wer-den im Folgenden näher beschrieben4. Die Untersuchungsergebnisse sollen zudem als konkretes Beispiel dienen, um Problematiken bei der Interpretation von sekun-där verwendeten Holzfunden aufzuzeigen. Des Weiteren werden die Ergebnisse, die sich aus der wissenschaftlichen Analyse der Befunde ergaben, kurz dargestellt.
FundPLatz und BeFundeDas Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern führte im Jahr 2010 eine umfangreiche archäologische Untersuchung des Altstadtgebie-tes der südwestlich der Insel Rügen gelegenen Hansestadt Stralsund durch. Dabei wurde auch das am südöstlichen Rand der Altstadt befindliche Quartier Franken-hof erfasst und dokumentiert (Abb. 1). Die Untersuchung des etwa 5.000 m² gro-ßen Geländes erfolgte durch die Landesamtmitarbeiterinnen Marlies Konze M.A. und Dipl.-Geol. Renate Samariter. Eine abschließende Betrachtung des Gebietes „Frankenhof “ ergab das Bild eines mehrfach durch Ziegelbruch, Lehm und Ger-berlohe künstlich erhöhten Areals, welches im Hochmittelalter noch in unmittelba-rer Nähe des Strelasunds lag. Als Strelasund wird die Meerenge bezeichnet, welche die Insel Rügen vom Festland trennt (Abb. 2). Es handelte sich bei dem beschriebe-nen Vorgehen der Erhöhung offenbar um planmäßige Landgewinnungsmaßnah-
abb. 1 Karte mit Lage des Grabungsgeländes „Frankenhof“ im heutigen altstadtgebiet von Stralsund. abb. 2 Topografische Karte des Strelasunds.
177Wo sind all die Schiffe hin?176 Philipp Grassel . Jasmin Loose
men, in deren Folge die seeseitige Küstenlinie des Sunds ab dem Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit weiter nach Osten verschoben wurde. Die Stadt Stralsund wurde im 13. Jahrhundert unmittelbar an der festländischen Sundseite gegründet und entwickelte sich schnell zu einem dominierenden Machtzentrum der Region. Bis heute ist der Sund, vornehmlich durch seine geschützte Lage, ein wichtiger Zufahrtsweg zu den Seegebieten, Bodden- und Nehrungssystemen des Greifswal-der Boddens, der Insel Usedom und der Darßer Halbinsel. Seine wirtschaftliche Bedeutung erschöpft sich jedoch nicht in der günstigen Lage als Verbindungsweg. Ein weiterer, bedeutender Aspekt ist die Tatsache, dass der Ostseehering den Sund bis heute als eines seiner Hauptlaichgebiete nutzt. Diese beiden Punkte, welche im Mittelalter eine noch wesentlich erheblichere ökonomische Bedeutung hatten, als dies heute der Fall ist, förderten den Aufstieg Stralsunds zu einer der führenden Städte innerhalb des wendischen Hansequartieres und auch des ganzen Hanse-bundes5. Die deutliche Stratigrafie des Grabungsgeländes „Frankenhof “ erlaubte eine klare Differenzierung der einzelnen Befunde. Das vorhandene Feuchtboden-milieu führte insbesondere bei den Holzbefunden zu einer sehr guten Konservie-rung. Knochen, Stein sowie metallische Objekte konnten ebenfalls in einem guten Zustand geborgen werden. Insgesamt fiel die Datierung aller Befunde in eine Zeit-spanne, die vom 14. Jahrhundert bis in die Zeit des Großen Nordischen Krieges (1700–1721) reichte. Die Entdeckung der Fundamente eines auf 1600 datierten Wachhauses, von Teilen eines Hornwerkes des frühen 18. Jahrhunderts sowie von mehreren Massengräbern und Laufgrabenresten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) stellen vor allem die neuzeitlichen Befunde in fortifikato-rische bzw. militärische Kontexte. Dagegen zeigen die älteren, mittelalterlichen Befunde zivile, städtische und hafenspezifische Ausprägungen6. Hierzu zählen zwei zeitlich aufeinander folgende Straßenbefunde, die teilweise mit Hölzern unterfüt-tert waren, ein als Werftgebäude zu interpretierender Hausbefund sowie ein mehr-phasiges Wasserleitungssystem. Die letzten beiden Befunde sind als komplette Holzbefunde anzusehen, bei deren Freilegung bereits zu erkennen war, dass sie größtenteils aus wiederverwendeten Schiffshölzern erbaut wurden.
die WerFtBei dem Gebäudebefund handelte es sich um den geschlossenen Befund einer zweiteiligen, langrechteckigen Hausstruktur von insgesamt 15 m Länge, maximal 5 m Breite und einer Erhaltungshöhe von 1,5 m (Abb. 3). Eine den kompletten Befund überdeckende Aufschüttungsschicht enthielt metallische Kleinfunde wie Münzen und Pilgerzeichen, welche in das Ende des 14. Jahrhunderts datiert wur-den7. Damit ergab sich ein Terminus ante quem, nach dem das Gebäude nicht nach 1400 errichtet worden sein konnte. Keramikfunde, die aufgrund ihrer Fundlage in die Nutzungsphase des Gebäudes fielen, ließen sich dem Zeithorizont E1 zuord-nen und ermöglichten eine grobe Einordnung des Befundes in die Zeitspanne zwi-schen 1320 und 13908. Der nördliche Teil des Befundes bestand aus einem etwa 5 x 3,5 m großen, relativ fundleeren Raum. Die Südwand dieses Raumes bildete gleichzeitig die Nordwand des sich direkt anschließenden südlichen Gebäudeteils. Eine eindeutige Verbindung zwischen beiden Gebäudeteilen konnte nicht nach-gewiesen werden. Auch fehlte ein klar identifizierbarer Zugang oder Einstieg zu dem nördlichen Gebäudeteil. Der genannte südliche Raum wies eine rechteckige Form von 11 m Länge sowie eine Breite von 4–5 m auf. Das Laufniveau dieses Raumes bestand aus einer Schicht von Lehm und Gerberlohe, auf der Ziegel-bruch und lose Hölzer verschiedener Größen auflagen. Hier fand sich ebenfalls
eine Vielzahl schiffstechnischer Kleinfunde wie Eisennagelreste, Nieten, Kalfatklammern sowie teils großflächige Teer- und Pechakkumulatio-nen, die mit Moos, Stroh und Haar vermischt waren. Weiterhin konnte eine Vielzahl dicht beieinanderliegender, natürlich gewachsener und grob bearbeiteter Krummhölzer innerhalb der nordöstlichen Ecke des südlichen Raumes geborgen werden. Darüber hinaus ließen sich zwei unterschiedliche Bereiche innerhalb dieses Gebäudeteils durch erhal-tene Stützbalkenreste optisch voneinander trennen. So gab es einen wei-ten, östlichen Bereich, der eine Fläche von ca. 11 x 3–4 m aufwies, und einen westlichen, eher als schmaler Korridor zu bezeichnenden Bereich mit einer Fläche von ca. 8 x 1 m. Innerhalb des Korridors konnte am nördlichen Ende ein zusammenhängender Befund aus dicht gepackten, teils miteinander verbackenen, kleinen Feldsteinen, Holzkohlestückchen, Lehmbrocken und Ziegelbruch dokumentiert werden (Abb. 4). Dieser Befund wies deutliche Brandspuren auf und war offenbar unterschiedlich starker Hitze ausgesetzt gewesen. Da keine weiteren Brandspuren inner-halb des Gesamtbefundes nachgewiesen wurden und ein Gebäudebrand damit ausgeschlossen werden konnte, schien es sich hierbei um eine Art Feuerstelle gehandelt zu haben. Alle Seitenwände außer derjenigen auf der Südseite zeigten vertikale Pfostensetzungen verschiedener Größen mit unterschiedlichen Abständen zueinander. Schwellbalken oder deren Reste, die zur Auflage der Seitenwandhölzer dienten, konnten nicht nach-gewiesen werden. Es handelte sich bei dem Gebäudebefund demnach um einen einfachen Pfostenbau. Reste einer Dachkonstruktion konnten nicht identifiziert werden. Dies ist jedoch aufgrund der späteren Auffüllung und damit einhergehenden Erhöhung des Geländes nicht verwunderlich.
abb. 3 Südlicher raum des Werftgebäudes.
179Kapitel 179Wo sind all die Schiffe hin?178 Philipp Grassel . Jasmin Loose
Die fehlenden vertikalen Stützpfosten innerhalb der südlichen Außenwand las-sen vermuten, dass es sich hierbei um eine bewegliche Seitenwand handelte, die nach Westen hin geöffnet wurde. Drei einzelne Pfosten, die in Reihe und in einer Linie zur Südwand standen, schlossen sich dieser westlich an und untermauerten die genannte Theorie. So könnten sie als Führungs- und Auflagepfosten für die einzelnen Seitenwandhölzer gedient haben. Insgesamt sprechen die Indizien, wie die schiffstechnischen Kleinfunde, die als Kalfatreste anzusprechen sind, die mit Stroh und Moos vermischten Teerakkumulationen und die verschiebbare südliche Außenwand für eine plausible Interpretation des Befundes als Werftgebäude. Die bereits beschriebene unmittelbare Nähe des gesamten Geländes zum Strelasund sowie die Krummhölzer unterstützen diese Annahme. Auch spricht die Untertei-lung des Innenraumes in zwei Bereiche für eine werkstattähnliche Nutzung des Gebäudes. So diente der größere Bereich vermutlich zur Aufnahme der durch die südliche Öffnung hereingezogenen, reparaturbedürftigen Schiffe. Mithilfe der Feu-erstelle wurden dann im schmaleren Korridor einzelne benötigte Eisenwaren her-gestellt. Auch könnte dieser Bereich, wohl aus Platzmangel, als „Aufenthaltsraum“ der Arbeiter genutzt worden sein. Die Nähe der Feuerstelle wäre dabei vor allem im Winter von Vorteil gewesen. Ähnliche, eindeutig als Werftgebäude und Lagerplätze für Schiffsmaterial zu interpretierende Befunde sind in den skandinavischen Naust zu erkennen. Als Naust werden stabile und längerfristig genutzte Bootshäuser bezeichnet. Diese weisen darüber hinaus vergleichbare Raumaufteilungen sowie schiffstechnische Kleinfunde auf und datieren hauptsächlich von der Wikingerzeit an bis ins Hochmittelalter9. Von den 147 erhaltenen Wand- und Stützhölzern des beschriebenen Befundes konnten 89 Stücke eindeutig als ursprüngliche Schiffs-bauteile identifiziert werden. Weiterhin wurden die Hölzer größtenteils überein-ander gelegt und zwischen den Stützpfosten festgeklemmt, sodass die erhaltenen Bearbeitungsspuren, wie Durchlochungen und Nagelungen, fast ausschließlich auf deren Primärnutzungen zurückgeführt werden konnten.
daS LeitunGSSyStemSüdlich des Werftkomplexes konnten insgesamt zwei aufeinander folgende, holz-ausgesteifte Kanalstrukturen unterschiedlicher Länge voneinander differenziert und analysiert werden. In den komplexen Befundstrukturen des Leitungssys-tems fanden sich im Vergleich zum Werftkomplex jedoch nur wenige Schiffshöl-zer (Abb. 5). Der Bau des ersten Kanals umfasste drei Bauphasen. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde zunächst ein etwa 1 m breiter, durch eine innen liegende Balkenkonstruktion ausgesteifter Kanal errichtet, der unter dem schon genannten, gleichzeitig erbauten Straßenbefund hindurchführte. Dessen ehema-liger Laufhorizont war mit Brettern abgedeckt. Die genannte Straße befand sich vermutlich im Gischtbereich des angrenzenden Strelasunds, weshalb sie nach rela-tiv kurzer Nutzungsdauer etwa Mitte des 14. Jahrhunderts aufgegeben und durch eine höher gelegene und etwa doppelt so breite Fahrbahn ersetzt wurde. Der erste Kanalabschnitt blieb dabei erhalten, wurde jedoch mit einer leicht nach Norden verlagerten Flucht verlängert und der Kanalauslass durch das Einsetzen von Bret-tern verjüngt. Etwa zur gleichen Zeit entstand nördlich des Kanals das bereits
abb. 4 Schematischer Plan der Werft mit raumaufteilung (dunkelgrau: arbeitsraum, hellgrau: Korridor) und Feuerstelle (dunkelrot: starke Brandspuren, orange: schwächere Brandspuren).
abb. 5 teil des Leitungssystems
bei der Freilegung.
181Wo sind all die Schiffe hin?180 Philipp Grassel . Jasmin Loose
beschriebene Werftgebäude. In der dritten und letzten Bauphase wurde am zuvor verjüngten Ende eine rechtwinklige, kastenförmige Konstruk-tion angefügt, die aus drei ca. 4–4,5 m langen Bestandteilen eines bisher undatierten, flachbodigen Schiffes zusammengesetzt war (Abb. 6)10. Die Konstruktion mündete in einen nur mit Soden ausgekleideten Graben, der am Ufersaum des Strelasunds endete (Abb. 7a). Um 1380/90 wur-den die Straße und das erste Leitungssystem aufgegeben, das Areal auf-geschüttet und ein neuer, durch Bohlen und Pfähle ausgesteifter Kanal mit leicht verschobener Flucht errichtet, welcher ebenfalls unmittelbar in den Strelasund mündete (Abb. 7b). Der 0,8–1 m breite Kanal wurde bis zu seiner Aufgabe in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts konti-nuierlich in Richtung Strelasund verlängert und erreichte im Laufe sei-ner gesamten Nutzungsphase eine maximale Länge von 32 m. Das ganze Leitungssystem diente vermutlich der Ableitung von Unrat, Fäkalien und Oberflächen- bzw. Abwasser in den östlich an das Grabungsgelände angrenzenden Strelasund. Vergleichbare, gedeckelte Wasserrinnen, die in die Mitte des 10. Jahrhunderts datieren, sind bereits aus Haithabu
bekannt11. Jüngere Wasserleitungssysteme aus ausgehöhlten Stämmen und mehrteiligen Kastenkonstruktionen finden sich weiterhin in vielen mittelalterlichen Siedlungen12. Da die Versorgung der Städte mit Frisch-wasser und die Entsorgung des Siedlungsunrates in den Städten in der Regel individuell gelöst wurden13, war es nicht möglich, die genannten Leitungssysteme einer präziseren Funktion zuzuweisen. Insgesamt konn-ten aus dem Befund 29 wiederverwendete Schiffshölzer geborgen werden, deren Bearbeitungsspuren, wie auch beim Werftgebäude, überwiegend auf deren Primärnutzung zurückzuführen waren.
anaLySen der ScHiFFSHöLzerAus beiden Befunden ließen sich insgesamt 112 Hölzer eindeutig als Schiffshölzer identifizieren. Die guten Erhaltungsbedingungen erlaubten den Verfassern eine funktionale Einteilung derselben in vier Hauptgrup-pen. Hierzu gehörten Planken, Kniehölzer, Spanten und Kiel-/Masthölzer. Eine fünfte Hauptgruppe, die als Varia bezeichnet wurde, musste hinzuge-fügt werden. Diese Gruppe enthielt alle Hölzer, die aufgrund zu starker Fragmentierungen keinen eindeutigen Rückschluss auf die Verortung im Schiffskörper zuließen, jedoch größtenteils schiffbauliche Merkmale besa-ßen. Insgesamt konnten 87 Plankenreste, neun Kniehölzer, 14 Kiel-/Mast-hölzer und zwei Spanthölzer identifiziert werden, deren Größe zwischen einigen Dezimetern und mehreren Metern schwankte14. Alle Stücke ließen sich wiederum in einzelne Untergruppen aufteilen. So wurden innerhalb der Leitungssysteme drei schon genannte Plankenreste als L-förmige
abb. 6 Prahmstücke.
abb. 7a Phasenplan des
Leitungssystems bis 1380/90. das Kürzel
HB 24 bezeichnet lediglich die
Befundnummer des Holzbefundes. abb. 7b
Phasenplan des Leitungssystems ab 1380/90. die Kürzel HB 7 und HB 25 bezeichnen lediglich die Befundnummern der Holzbefunde.
183Kapitel 183Wo sind all die Schiffe hin?182 Philipp Grassel . Jasmin Loose
Übergangsplanken eines oder mehrerer flachbodiger Schiffe erkannt. Diese Plan-kenreste wiesen eine Länge von 4,05, 4,2 und 4,6 m sowie eine Breite von 10, 34 und 36 cm auf. Innerhalb der gesamten Hauptgruppe wurde darüber hinaus zwischen Einzelplanken und Plankenverbänden unterschieden. Es konnten 13 Plankenkom-binationen ermittelt werden, deren Länge zwischen 1 und 3,6 m lag (Abb. 8). Ihre Gesamthöhe bewegte sich zwischen 35 und 70 cm. Bei den Einzelplanken reichte die Spanne der erhaltenen Maße von unter 20 cm Länge und ca. 10 cm Höhe bis hin zu einer Länge von über 2,5 m mit einer Höhe von ca. 30 cm (Abb. 9). Alle Planken-kombinationen und der Großteil der Einzelplanken dienten als direkte Konstrukti-onselemente des Werftgebäudes und der Leitungssysteme. Zu beachten ist allgemein die Tatsache, dass es sich bei allen Funden um Holzreste mit teilweise starken Zer-störungsspuren handelte. Die dargestellten Maßangaben sollen lediglich die relativ große Spannweite der Abmessungen der erhaltenen Hölzer illustrieren. Maßanga-ben zu den originalen Abmessungen innerhalb der Primärkontexte sind durch die Zerstörungsspuren nicht mehr zu fassen. Die Gruppe der Kniehölzer wurde in Roh-stücke und Stücke mit Verbauungsspuren unterteilt (Abb. 10 a/b). Acht Exemplare fanden sich innerhalb des Werftbefundes im Bereich der nordöstlichen Ecke des südlichen Gebäudeteils. Sie waren demnach nicht als Konstruktionselemente des Gebäudes zu verstehen. Von diesen Kniehölzern wiesen wiederum zwei Stücke deut-liche Verbauungsspuren auf. Ein weiteres Rohstück konnte innerhalb des Leitungs-systems geborgen werden. Inwiefern es mit dessen Konstruktion zusammenhing, ließ sich allerdings nicht klären. Alle Rohstücke zeigten weder Nagelungen noch Durchlochungen, jedoch waren Rindenreste und grobe Beilspuren erhalten. Die Maße der Schenkel bewegten sich im Bereich zwischen 40 und 70 cm Länge sowie 25 bis 40 cm Höhe. Die bestimmbare Winkelspanne lag zwischen 95° und 146°. Bei den zwei Stücken, die Verbauungspuren aufwiesen, war nur jeweils ein Schenkel erhal-ten, sodass hier keine Angaben über Winkelmaße gemacht werden können. Die Länge der erhaltenen Schenkel lag bei 30 und 50 cm. Ein Stück wies eine nicht durchgehende Durchlochung auf, während das zweite Stück Holznagelungen, Durchlochungen und Eisennagelungen zeigte. Die Abarbeitungsspuren und Rissen-den auf beiden Stücken sowie die Reste der Nagelungen legten nahe, dass sie offen-bar während eines oder mehrerer Reparaturprozesse aus Schiffskörpern heraus gelöst und ersetzt worden waren. Wie schon oben erwähnt, fand sich in der nordöstlichen Ecke des südlichen Gebäudeteils eine größere Ansammlung von Kniehölzern und Rohstücken verschiedenster Art. Da diese Stücke nicht in direkter Verbindung mit der Konstruktion des Werftgebäudes standen, ist hier offensichtlich von einer Art Lagerstelle auszugehen, die sich durch die funktionelle Nutzung des Raumes zur Bootsreparatur ergab. Die bevorzugte Nutzung von natürlich gewachsenen Krumm-hölzern sowie ihre vorrätige Lagerung sind auch im heutigen Holzschiffbau noch häufig zu beobachten15. Anders als die Knierohlinge wiesen die erhaltenen Span-tarme eindeutige Verbauungsspuren auf (Abb. 11). Beide Teile fanden sich innerhalb der Werft und sind als Konstruktionsteile des Gebäudes zu bezeichnen. Sie zeigten eine leicht geschwungene Form sowie einen quadratischen Querschnitt von 10 x 10 bzw. 15 x 15 cm und eine erhaltene Länge von 105 bzw. 95 cm. Weiterhin waren die für die Klinkerbauweise üblichen gestuften Auflageflächen der Planken zu erkennen. Holznagelungen und Durchlochungen waren bei beiden Stücken vorhanden, jedoch konnten keine Eisennagelungen nachgewiesen werden. Ebenso ließen sich jeweils an einer Schmalseite deutliche Rissenden und Zerstörungsspuren erkennen. Ein Span-tarm zeigte darüber hinaus an einer Schmalseite eine Abarbeitung, die als mögliche Laschung angesehen wurde. Der zweite Spantarm wies dagegen an einer Schmalseite Wülste und Furchen auf, die eindeutig als Belege für natürliches Wachstum zu inter-
abb. 8 Plankenverbund.
abb. 9 Große einzelplanke.
abb. 10a Knieholz, rohstück.
abb. 10b Knieholz mit Verbauungs spuren.
185Kapitel 185Wo sind all die Schiffe hin?184 Philipp Grassel . Jasmin Loose
pretieren waren. Mögliche Spant rohstücke wurden auch hier angetroffen. Diese ebenfalls in der nordöstlichen Ecke des südlichen Raumes gefundenen Krummhöl-zer wiesen eine geschwungene Grundform auf und besaßen eine Länge zwischen 95 und 155 cm (Abb. 12 a/b). Grobe Beilspuren sowie Rindenreste auf den Stücken untermauerten deren Interpretation als Rohstücke. Im Zusammenhang mit den annähernd quadratischen Querschnitten dieser Hölzer von 8 x 8 bis 10 x 10 cm ist eine Ähnlichkeit mit den erhaltenen Spantarmen offensichtlich und eine Interpreta-tion der Funde als mögliche Spant rohlinge naheliegend. Die Tatsache, dass diese Funde zusammen mit den Knierohlingen innerhalb der Nordostecke des südlichen Gebäudeteils entdeckt wurden, untermauert darüber hinaus die Interpretation die-ses Bereichs als Lagerplatz von Rohlingen und Krummhölzern. Die Gruppe der Kiel-/Masthölzer erfasste alle klar definierbaren Schiffsbauteile, die keiner der ande-ren Hauptgruppen zugeordnet werden konnten. So wurden hier z. B. Kielstücke, Spillhölzer und Mastschuhe aufgenommen. Die zwei erhaltenen Kielfragmente fan-den sich innerhalb des Befundes des Wasserleitungssystems. Sie dienten hier zur Stabilisierung der Schalhölzer und waren auf einer Länge von 98 bzw. 133 cm erhal-ten. Die Höhe betrug 14 und 18 cm, die Breite dagegen 11 und 14 cm. Ihre Form konnte als im Querschnitt T-förmig beschrieben werden und an beiden fanden sich Eisennagelungen (Abb. 13). Als ehemalige Spillhölzer konnten zwei Funde aus dem Werftbefund nachgewiesen werden, die hier als Stützbalken dienten. Sie wiesen eine erhaltene Länge von 2,05 und 2,2 m auf. Der Querschnitt eines Holzes war leicht rechteckig mit einer Kantenlänge von 30 x 35 cm. Das zweite Spillholz zeigte einen oktogonalen Querschnitt mit einem Durchmesser von 30 cm (Abb. 14). Beide Höl-zer besaßen mehrere quadratische Durchlochungen, die jeweils um 90° versetzt zueinander angeordnet waren. Die Kantenlänge dieser Durchlochungen betrug bei dem rechteckigen Spillholz 15 x 15 cm. Das im Querschnitt oktogonale Holz wies dagegen eine Kantenlänge der Durchlochungen von 7 x 7 cm auf. Reste von Holzna-gelungen waren bei beiden vorhanden. Die Interpretation als Spillholz ergab sich aus dem Vorhandensein und der Anordnung der Durchlochungen. Solch große quadra-tische Durchlochungen dienten sehr wahrscheinlich zur Aufnahme der Handspa-ken, mit denen das Spillholz bewegt werden konnte. Auch wies die versetzte Anordnung darauf hin. So konnten zwei Seeleute mit jeweils einem Handspaken das Spillholz drehen, indem sie abwechselnd die Spaken in die Durchlochungen steck-ten. Als Mastschuhe wurden zwei weitere Holzfunde aus dem Werftbefund identifi-ziert. Beide wiesen starke Zerstörungsspuren und eine Länge von 1,4 m sowie einen relativ quadratischen Querschnitt von 25 x 25 cm auf. Auch war in beiden Fällen eine große, zentral gelegene und rechteckige Durchlochung von ca. 15 x 20 cm erhal-ten (Abb. 15). Bei einem der Funde lag die Durchlochung zentral in einer ca. 70 cm langen, 15 cm breiten und etwa 6 cm tiefen Rinne. Mehrere ca. 3 cm tief einschnei-dende, rechteckige Aussparungen waren an den Unterseiten beider Hölzer zu beob-achten. Diese Aussparungen konnten als Auflageflächen für Bodenwrangen identifiziert werden. Bei der beschriebenen Rinne handelte es sich um eine Masts-pur, die der Führung des Mastzapfens beim Einsetzen des Mastes in den Mastschuh diente. Zur Aufnahme eben dieser Mast zapfen dienten wiederum die großen zentra-len Durchlochungen. Es handelte sich also eindeutig um Mastschuhe. Eine detail-lierte Aufzählung sämtlicher weiterer Stücke würde an dieser Stelle zu weit führen. Es sei aber gesagt, dass sehr wahrscheinlich auch Teile eines Mastes, Reste eines Deckquerbalkens sowie einer Bite identifiziert werden konnten. Letztere ist ein typi-sches Konstruktionselement des nordisch/skandinavischen Schiffbaus. Als Biten werden Querbalken bezeichnet, die eine zusätzliche Verstärkung des Spantsystems und damit des Rumpfes darstellen.
abb. 11 Spantarm.
abb. 12a Krummholz.
abb. 12b Krummholz.
anaLySen der F ix ierunGen und der KaLFatreSte
Insgesamt wurden etwa 400 Holznagelreste innerhalb der Befunde dokumen-tiert. Der Hauptteil dieser Holznägel, welche überwiegend bei den Planken und Plankenkombinationen sowie den Kiel-/Masthölzern zu beobachten waren, wies einen Durchmesser von 2–3 cm auf16. Das legte nahe, hier ein normiertes Maß für Schiffsholznägel anzunehmen17. Ähnliches war auch bei den Eisennagelungen zu beobachten. Auch hier bildeten die Gruppen der Planken und Kiel-/Masthöl-zer die Hauptquelle der Nagelungen. Ca. 500 Eisennagelungen waren erhalten. Alle wiesen einen quadratischen bis leicht rechteckigen Schaftquerschnitt auf, der eine Kantenlänge von 0,5 bis maximal 1 cm besaß. Die erhaltenen Kopfdurchmes-ser bewegten sich hauptsächlich im Bereich zwischen 2–3 cm. Eine Normierung schien demnach auch hier sehr wahrscheinlich18. Unterstützt wurden diese Nor-mierungstendenzen durch eine Analyse der erhaltenen Durchlochungen. Hier bil-deten die Gruppen der Planken und der Kiel-/Masthölzer ebenfalls die ergiebigste Quelle. So zeigten die meisten Durchlochungen einen rundlichen Durchmesser von 2–3 cm bzw. einen rechteckigen bis quadratischen Durchmesser von maxi-mal 1 cm Kantenlänge. Der direkte Vergleich zu den Holz- und Eisennagelungen war somit offensichtlich. Weitere Durchlochungen wie die zentralen Lochungen der Mastschuhe bildeten natürlich Ausnahmen, sie erklärten sich jedoch bei der Analyse der entsprechenden einzelnen Holzfunde. Andere schiffstechnische Funde wie Kalfatklammern und Kalfatmaterial wurden ebenfalls analysiert. Allerdings bestätigte die Interpretation der erhaltenen Sinteln19 lediglich die Datierung des Befundes20. Detaillierte Aussagen über Herkunft und Bauweise der ursprünglichen Schiffskörper ließen sich anhand dieser Einzelheiten nicht verifizieren. Ähnlich verhielt es sich mit dem Kalfatmaterial. Hier konnten lediglich Aussagen zur biolo-gischen Herkunft des Materials getroffen werden. So wurden neben Tierhaar auch pflanzliche Materialien wie Moose und Gräser genutzt. Ein Verwendungsmuster war jedoch nicht zu erkennen. Teilweise ist das pflanzliche Material auch zusam-men mit dem Tierhaar eingesetzt worden. Auffällig war allein die häufige Zopfform des Tierhaarkalfats. Die Verarbeitung des pflanzlichen Kalfats schien dagegen eher in locker zusammenhängenden Akkumulationen durchgeführt worden zu sein. Erklärbar ist diese Diskrepanz mit der besseren Handhabung des Tierhaares, wel-ches durch Verspinnung sehr gut in die genannte Zopfform gebracht werden kann.
ProBLeme Bei der anaLySe und der inter Pretation Von WiederVerWendeten HocH- und
SPätmitteLaLterLicHen ScHiFFSHöLzernBei der Auswertung wiederverwendeter Hölzer ist mit einigen Problematiken zu rechnen, besonders wenn es sich um Wrackhölzer handelt. Diese ergeben sich aus der Befundsituation sowie dem Material selbst und erlauben auch bei einer objekti-ven Interpretation und einer schiffbaulichen Zuordnung nur tendenzielle Aussagen über Primärkontexte und Funktionen. So ist z. B. die kontextuelle Betrachtung von Lage und Funktion des wiederverwendeten Bauteils innerhalb des Befundes, in dem es eingesetzt wurde, nur bedingt sinnvoll, um die Frage einer Primärnutzung zu klären. Da die wiederverwendeten Hölzer nicht für einen Neubau konzipiert wurden, ist davon auszugehen, dass sie unter rein praktischen Aspekten als Baustoff verarbeitet wurden. Demnach geben z. B. Lage und Funktion eines Spillholzes, wel-ches innerhalb eines Hausbefundes allein aufgrund seiner balkenähnlichen Struk-tur als solcher verbaut wurde, keine Aufschlüsse über Lage und Funktion desselben
abb. 13 Kielstück.
abb. 14 Spillholz.
abb. 15 mastschuh.
187Wo sind all die Schiffe hin?186 Philipp Grassel . Jasmin Loose
Spillholzes innerhalb des ursprünglichen Schiffskörpers. Allein die Einzelbetrach-tung des Stückes erlaubt, basierend auf Indizien wie Form und Bearbeitungs spuren, Aussagen über dessen ursprüngliche Nutzung. Die simple, grundlegende Proble-matik bei der Interpretation wiederverwendeter Hölzer besteht also in dem Verlust eines eindeutigen Primärkontextes. Der Interpretationsspielraum für eine funktio-nelle Bestimmung des Einzelfundes oder gar eine „Rekonstruktion“ des Ursprungs-kontextes ist von daher sehr weit gefasst. Ein zweites grundlegendes Problem bei einer schiffsarchäologischen Interpretation sekundär verbauter Hölzer ergibt sich aus der Tatsache der Vermischung verschiedener Schiffsbautraditionen ab dem 13. Jahrhundert im nordwesteuropäischen Raum und Ostseeraum21. Diese Ver-mischung macht eine eindeutige Zuordnung einzelner Schiffshölzer zu bekannten Schiffsformen innerhalb der genannten Region annähernd unmöglich. Ohnehin basieren die verschiedenen Bautraditionen – die natürlich nur den Versuch einer wissenschaftlichen Einteilung darstellen – auf einzelnen Detailunterschieden ver-schiedener, archäologisch nachgewiesener Schiffskonstruktionen, welche teilweise selbst in deren Primärbefunden schwer zu fassen und zu definieren sind. Ein drit-tes Problem ist in der unzureichenden historischen Quellenlage in Bezug auf For-men und Funktionen von mittelalterlichen Wasserfahrzeugen zu sehen. So halten Typenbezeichnungen von Schiffsformen, welche auf zeitgenössischen schriftlichen Quellen basieren, einer wissenschaftlichen Betrachtung und überregionalen Ein-ordnung sehr häufig nicht stand und ermöglichen nur tendenzielle Rückschlüsse. Ein anderes Problem ergibt sich aus einer naturwissenschaftlichen Analyseme-thodik zur Altersbestimmung der Hölzer. Mithilfe der Dendrochronologie ist es möglich, Fälldatum, Herkunft und Art von hölzernen Funden zu bestimmen. Das grundlegende Problem bei dieser Datierungsmethode ist, dass lediglich das Fäll-datum des Baumes bestimmt wird. Die Nutzungsphase des Holzes innerhalb der Primärkonstruktion und die darauffolgende sekundäre Verwendung werden damit nicht datiert. Es ergibt sich also ein Terminus post quem, da sämtliche weiteren Datierungen jünger als das Fälldatum sein müssen. Die Dauer der Verwendung als Bauteil in einem sekundären Kontext lässt sich allerdings meist durch die Befund-stratigrafie ermitteln. Folglich bilden Fälldatum und Befunddatierung die Spanne, in der sich die tatsächliche Nutzungsphase der Hölzer bewegt. Diese Phase kann jedoch aufgrund der unklaren Nutzungslänge innerhalb der Primärkonstruktion sowie der nicht zu ermittelnden Lagerungsdauer der Hölzer vor und nach der Pri-mär- sowie vor der Sekundärnutzung sehr weit ausfallen. Zwar rechnet man häufig mit einer allgemeinen Nutzungsphase für Schiffshölzer von ca. einer Generation, dennoch finden sich hierfür auch viele Gegenbeispiele22. Weiterhin lassen Art und Herkunft der Holzfunde gerade bei Schiffshölzern wenige Rückschlüsse auf die primären Konstruktionen zu. So ergaben die Analysen der Autoren, dass ca. 60 % der Schiffshölzer der beschriebenen Stralsunder Befunde aus Eichenholz und ca. 10 % aus Kiefernholz gefertigt wurden23. Diese Erkenntnis war jedoch nicht über-raschend, da beide Holzarten ein in Nordeuropa bis in die heutige Zeit sehr häufig genutztes Bauholz für Schiffskonstruktionen unterschiedlicher Ausprägung dar-stellen. Auch ergab die Herkunft der Befundhölzer keinen verwertbaren Hinweis auf mögliche definierbare Schiffsformen. Der im Hoch- und Spätmittelalter einset-zende überregionale Handel, bei dem auch Holz als begehrtes Handelsgut verschifft wurde, bildet hier eine Zäsur24. Aufgrund der überregionalen Verschiffung ist es spätestens ab dem 13. Jahrhundert unmöglich zu bestimmen, ob ein Schiffsteil aus z. B. baltischer Eiche tatsächlich zu einem im Baltikum gefertigten Schiffskörper gehörte. Die Holzanalysen ergaben lediglich, dass ein Großteil der Fundhölzer aus baltischer, polnischer und schwedischer Eiche sowie zu einem geringeren Teil auch
aus Kiefer derselben Herkunftsgebiete gefertigt wurde. Die dargestell-ten Problematiken verdeutlichen die grundlegenden Schwierigkeiten, welche sich bei der Beschäftigung mit wiederverwendeten Konstruk-tionsmaterialien und hier im Besonderen mit Wrackhölzern ergeben. Natürlich bilden die Zerstörungs- und Abnutzungsspuren der Hölzer selbst einen weiteren Punkt, den es bei einer objektiven Analyse zu beachten gilt.
ScHLuSSFoLGerunGenEin Grundproblem bei der archäologischen Analyse wiederverwende-ter Objekte – unabhängig davon, ob es sich hierbei um Hölzer, Metalle o. Ä. handelt – ist deren häufig unklare Objektbiografie25. Dies bedeutet, dass Funktion und Verarbeitung von Objekten nicht als stringente Linie fassbar sind und sich aufgrund der Sekundär- und teilweise auch Tertiär nutzung von Materialien sehr viele Variablen bei deren Interpre-tation ergeben. Eine wissenschaftliche Analyse derselben ist somit nur für einzelne Aspekte möglich. Die Wiederverwendung von Materialien erschwert jedoch die wissenschaftliche Analyse dieser Einzelaspekte zusätzlich. Selbstverständlich ist eine archäologische Bearbeitung von Funden, Befunden und deren Kontexten immer tendenziös. Definitive, unzweifelhafte Aussagen sind kaum möglich. Somit ist eine objektive Interpretation eines Fundes bzw. Befundes nur durch die detaillierte Betrachtung aller ihn ausmachenden Einzelteile zu erlangen. Das Hauptziel der hier vorgestellten Arbeiten bestand in der Aufnahme und Analyse aller als Schiffshölzer zu interpretierenden Einzelteile der mit-telalterlichen Werft- und Leitungsbefunde des Fundplatzes Stral sund-Frankenhof. Die genaue Beschreibung der Befunde und die Verifizierung
abb. 16 ausschnitt aus einer Lübecker Hafenansicht von e. diebel aus dem Jahr 1552. Die Flach bodenschiffe wurden von J. Loose rot eingefärbt.
189Wo sind all die Schiffe hin?188 Philipp Grassel . Jasmin Loose
191Wo sind all die Schiffe hin?190 Philipp Grassel . Jasmin Loose
ihrer Funktion sowie ihres Aufbaus waren selbstverständlich darin inbe-griffen. Des Weiteren wurde versucht, die Einzelfunde ihrer Primärfunk-tion zuzuordnen und damit Rückschlüsse auf Funktion, Aufbau, Form und eventuelle Herkunft ihrer Primärkontexte zu erlangen. Aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Funde schon bei der Bergung als Schiffshölzer identifiziert werden konnte, waren die Interpretationsmög-lichkeiten zur Primärnutzung bereits eingeschränkt. Dennoch stellten sich einige grundlegende Probleme ein, die detailliert beschrieben wur-den (siehe S. •••). Ein Teil der Funde ließ sich aufgrund einzelner Ver-gleichsbeispiele drei relativ genau definierten „Schiffsbautraditionen“ zuweisen. Zum einen konnten Reste von Flachbodenschiffen identifi-ziert werden (Abb. 16). Die bereits beschriebenen, L-förmigen Über-gangsplanken waren hierfür ein klares Indiz. Zum anderen fanden sich auch Teile, deren Maße und Bearbeitungsspuren deutliche Übereinstim-mungen zu Bauteilen von knorrähnlichen Schiffen der sogenannten nor-dischen Bautradition aufwiesen (Abb. 17). Vor allem die Abmessungen einiger Plankenkombinationen sowie der erhaltenen Spantarme und Mastschuhe ließen dies vermuten. Weitere Schiffshölzer stammten aller Wahrscheinlichkeit nach von koggenähnlichen Schiffskonstruktionen der sogenannten kontinentalen Bautradition (Abb. 18). Auch bei diesen stützte sich die Interpretation auf die Abmessungen von Plankenkombi-nationen. Aber auch Spillhölzer und Deckbalkenreste zeigten Überein-stimmungen. Dezidierte Zuweisungen zu konkreten Schiffstypen konn ten
jedoch nicht getroffen werden. Zwar ließen sich einzelne vergleichende Abmessungen bei Wracks wie dem „Karschauwrack“, der „Skuldelev 1“, „Haithabu 1“, „Roskilde 2“, „Kalmar 1“, dem „Gedesbyschiff “, der „Hel-geandsholmen III und V“ oder auch der „Darßer Kogge“ finden, aller-dings lieferten diese nur einzelne mögliche Anhaltspunkte. Die diesbezüglich bestimmbaren Einzelfunde erlaubten somit lediglich einen tendenziellen Ausblick auf die zuvor genannten „Schiffsbautradi-tionen“. Somit war nur die Aussage zu verifizieren, dass offenbar Teile von Schiffen der nordischen Bautradition und hier eventuell knorrähnli-chen Schiffen bzw. koggenähnlichen Schiffen der sogenannten kontinen-talen Bautradition erst abgewrackt und dann innerhalb der beschriebenen Befunde wiederverwendet wurden26. Weiterhin geschah dies offenbar auch mit flachbodigen Schiffen, welche aufgrund ihrer Konstruktions-weise nur für die Binnen- oder Küstenschifffahrt geeignet waren. Die Grundprobleme des fehlenden Primärkontextes, der Vermischung diffe-renzierbarer Bautraditionen ab dem 13. Jahrhundert sowie die eher indifferent überlieferten Typenbezeichnungen erschwerten eine objek-tive Analyse oder machten diese gar unmöglich. Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass innerhalb des zeitgenössischen Stralsunder Hafenge-bietes eine unüberschaubare Zahl von Klein- und Kleinstbooten ver-kehrte, zu denen auch die schon genannten Flachbodenschiffe zu zählen sind. Die Reparatur, Wartung oder auch Abwrackung dieser kleineren Boote wurde wohl häufiger nötig, als dies bei größeren Schiffen der Fall
abb. 17 Schematische darstellung einer Knorr.
abb. 18 Schematische darstellung einer Kogge des 14. Jahr-hunderts.
193Wo sind all die Schiffe hin?
war. Aber selbst eine nur unter gewissen Vorbehalten vorgenommene Zuordnung einzelner Schiffshölzer der Befunde zu diesen kleineren „Bootsklassen“ ist nahezu unmöglich. Allein die Zuordnung einzelner Fundhölzer als Bestandteile von flach-bodigen Binnenschiffen ließ sich verifizieren. Allerdings war dies nur möglich, da typendefinierende Holzfunde, wie L-förmige Übergangsplanken, nachgewiesen werden konnten. Jedoch deuteten auch diese Funde nur eine mögliche Zuordnung zu Flachbodenschiffen an. Ein genauerer Verweis auf eine konkrete Ausprägung dieser „Bootsform“ war damit nicht gegeben27. Weiterhin weisen bis heute viele Kleinbootkonstruktionen starke regionale Unterschiede auf und besitzen gleich-zeitig sehr lange Laufzeiten28. Auch waren sie noch weniger als die größeren „Schiffstypen“ regional übergreifenden oder gar genormten Konstruk tionsweisen unterworfen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass trotz einer detaillierten Betrachtung der einzelnen Hölzer keine definitive Aussage über deren Primärkon-texte getroffen werden konnte. Weder ließen sich Anzahl und Art noch Herkunft der ehemaligen Schiffskörper definieren. Die dargestellten Problematiken verwei-sen auf die zu hohe Variablenanzahl der Interpreta tionsmöglichkeiten, die wiede-rum eine eindeutige, plausible und wissenschaftlich objektive Aussage verhindern. Die dargestellten, tendenziellen und auf Vergleichsfunden basierenden Aussagen zu den Schiffsformen erscheinen lediglich als Möglichkeit, sich dem Ziel einer pri-märkontextuellen Zuordnung der Einzelfunde zu nähern. Gerade aufgrund seiner breiten Fächerung gibt das Fundmaterial trotzdem einen guten Einblick in die Details der Schiffsbaukunst des späten Mittelalters. Die dargestellten Ergebnisse der Holz- und Eisennagelanalysen seien hier erwähnt (siehe S. •••). Dennoch erlauben die Einzelfunde keinen Rückschluss auf die mögliche Anzahl größerer, überregional verkehrender Schiffe auf den Handelswegen des Mittelalters. Der Fundplatz lässt jedoch einen guten Einblick in die infrastrukturelle Verwertung von Wrack- und Altholz innerhalb hoch- und spätmittelalterlicher Siedlungen zu. Auch unterstreicht die hauptsächliche Herkunft der Hölzer aus dem östlichen Ost-seeraum die Ansicht, dass jenes Gebiet als die zeitgenössische Hauptprovenienz für Bauhölzer zu bezeichnen ist29. Allgemein zeigen die erhaltenen schiffstechnischen Funde und Befunde innerhalb der alten Hafengebiete sowie die Wrackfunde nur einen kleinen Ausschnitt eines ehemals halb Europa umfassenden Handelsgeflech-tes. Die archäologischen Daten spiegeln somit in keiner Weise die tatsächliche Anzahl von Schiffen und Fracht und damit das eigentliche Handelsaufkommen dieser Zeitstellung wider. Wo sind nun all die Schiffe hin? Die dargelegten Befunde und Funde zeigen, dass offenbar neben dem Verlust auf See ein nicht geringer Teil als minderqualitatives Wrackholz sekundär bei städtischen Baumaßnahmen wie-derverwendet wurde. Natürlich sind konkrete Zahlen und Angaben über deren sekundär genutzte Menge an dieser Stelle rein spekulativ. Aufgrund der großen Fundmenge solcher Hölzer bei archäologischen Untersuchungen zeitgenössischer Siedlungen scheint es jedoch angemessen, hier von einer sehr großen Anzahl aus-zugehen. Fragen nach dem Verhältnis von Schiffsverlust und Abwrackung sowie den daraus resultierenden Rückschlüssen zu Neubau und Gesamtzahl von Schif-fen, zu Holzhandel, Holzverwertung und Siedlungsaus- bzw. -umbau bilden von daher noch ein reichhaltiges Forschungsfeld. Diese und weitere Fragen nach Kon-struktionen und Innovationen innerhalb der Seefahrt, der damit zusammenhän-genden Strukturierung und Expansion der europäischen Ökonomie und somit auch der Entwicklung der europäischen Geschichte gilt es mithilfe der Zusammen-arbeit von Archäologie, Geschichtswissenschaft und Wirtschafts- wie Sozialwis-senschaften zu beantworten, zu bewerten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
192 Philipp Grassel . Jasmin Loose
abb. 19 der „Staude Plan“ von 1647. er zeigt die Stadt Stralsund im selben Jahr und wurde von Johann Staude erstellt. der Plan ist nicht genordet weshalb das Hafengebiet hier in der oberen linken Bildhälfte zu finden ist.
420 421endnotenendnoten
16 Auer 2011. 17 Koivumäki 2003. 18 Auer/Schweitzer 2012.
Philipp Grassel und Jasmin LooseWo SinD all Die SchiFFe hin?
1 Siehe hierzu z. B. Schubert 1987, 263–266; Radkau 2007, 46 f. 2 Radkau 2007, 57 f. 3 Beispiele hierfür finden sich u. a. in Dublin (McGrail 1993), Bremen (Rech 2001, 380 f.), Lübeck
(Gläser 2004, 190 f.), Rostock (Mulsow 2004, 222 f.) und Novgorod (Dubrovin 2007, 244 f.). 4 Grassel in Vorbereitung; Loose in Vorbereitung. 5 Kulessa 2005, 12–16. 6 Siehe Konze/Samariter 2012, 55–58. 7 Konze/Samariter 2010, 456. 8 Freundliche Mitteilung von M. Konze M.A. und Dipl.-Geol. R. Samariter. 9 Siehe hierzu Grimm 2006. 10 Es handelte sich bei den Hölzern um L-förmige Übergangsplanken. Vergleichbare Konstruktions-
teile sind u. a. bei dem in das 14. Jahrhundert datierten Kippenhornwrack aus dem Bodensee zu finden. Siehe Hakelberg 2003, 112.
11 Siehe Kalmring 2010, 283 f. 12 Vergleiche finden sich hierzu u. a. bei Grabowski/Schmitt 1993, 217–223; Schäfer 2005, 247. 13 Siehe Sczech 1993, 10. 14 Eine komplette Beschreibung der jeweiligen Einzelfunde würde an dieser Stelle zu weit führen.
Detaillierte Auflistungen der Funde mit Maßen, Bearbeitungsspuren und Besonderheiten finden sich in den Katalogteilen der genannten Abschlussarbeiten. Siehe hierzu Grassel in Vorbereitung; Loose in Vorbereitung.
15 Siehe Eichler 2010, 8 f.; Seymour 2010, 110 f. 16 Die ursprüngliche Länge der Holznägel konnte nicht bestimmt werden, da keine komplett erhalte-
nen Stücke vorhanden waren. 17 Eine ähnliche Normierung bzw. Standardisierung von Holznägeln ist bereits für das Frühmittelalter
bei Haus-, Schiff- und Grabbauten beobachtet worden. Siehe hierzu Westphal 2006, 91. 18 J. Bill beschrieb 1994 eine Tendenz, nach der für die eisernen Schiffsnägel des 12.–15. Jahrhunderts
eine Bevorzugung von Nägeln mit quadratischem Schaft zu erkennen ist. Eine Normierung lässt sich daraus jedoch nicht zwangsläufig ableiten, da für diese Zeitspanne vor allem im südskandina-vischen sowie im irischen Raum viele Ausnahmefälle nachweisbar sind. Weitere Forschungen sind daher nötig. Siehe hierzu Bill 1994, 60 f.; McCarthy 2005, 55 f.
19 Kalfatklammern werden auch als Sinteln bezeichnet. Siehe McCarthy 2005, 58. 20 Die erhaltenen Sinteln entsprechen der Kategorie II-D nach K. Vlierman und datieren somit etwa in
das 14. Jahrhundert. Siehe hierzu Vlierman 1997. 21 Siehe Nakoinz 1998, 317; Meier 2009, 56; 136 f. 22 Die „Darßer Kogge“ ist solch ein Gegenbeispiel. Durch die Datierungsdifferenzen des Inventars,
welches das Schiff bei seinem Untergang mit sich führte, und der Konstruktionshölzer kann auf eine Nutzungsphase von 40 bis 50 Jahren geschlossen werden. Siehe Förster 2003, 88.
23 Weiterhin ließen sich, allerdings nur in sehr geringem Umfang, Buche, Hainbuche und Esche nach-weisen. Zwei Funde wurden aus Buche und jeweils ein Fund aus Hainbuche bzw. Esche gefertigt.
24 Siehe hierzu Küster 1999; Heußner 2005; Ellmers 2006. 25 Eine Definition des Begriffs findet sich bei Hahn 2005, 40 f. 26 Die Begriffe „koggenähnlich“ und „knorrähnlich“ basieren auf historisch überlieferten Typen-
bezeichnungen und sind daher sehr kritisch zu betrachten. Sie wurden an dieser Stelle von den Autoren lediglich zur Illustrierung bestimmter Interpretationstendenzen genutzt. Zum Problem der Typenbezeichnungen siehe auch Weski 1999; Langenbach 2005.
27 Einige Beispiele für unterschiedliche Formen von flachbodigen Binnenschiffen finden sich u. a. bei Ellmers 1972, 95 f.; 2004, 55–69. Allgemein siehe hierzu Brandt/Kühn 2004.
28 Siehe z. B. Rudolph 1967; 1968/69. 29 Siehe Heußner 2005, 127 f. Das polnische Danzig ist in der Hansezeit für Schiffbauholz als Haupt-
exporthafen des Ostseegebietes – und darüber hinaus – anzusprechen. Siehe hierzu Ellmers 2006, 75 f.
daniel zwickauF den SPuren deS äLteSten See-itinerarS der oStSee
1 Siehe Bately/Englert 2007; Englert/Trakadas 2009. 2 Zahlreiche wendische Überfälle werden vom dänischen Chronisten Saxo Grammaticus beschrie-
ben. Der Wahrheitsgehalt dieser Beschreibungen darf allerdings auf der Grundlage angezweifelt
werden, dass Saxo Grammaticus kein unparteiischer Beobachter war und z. B. seine Charakterisie-rung wendischer Seefahrer als Piraten als Vorwand für dänische (Vergeltungs-[?]) Angriffe gedient haben könnte (siehe Jensen 2000, 7).
3 Siehe Fonnesberg-Schmidt 2007, 37 und 46. Es bleibt allerdings fraglich, inwieweit der Kreuz-zugsbegriff überhaupt auf die sich anschließenden dänischen Feldzüge in heidnische Gebiete der südlichen und östlichen Ostseeküste angewendet werden kann. Unter dänischen Historikern ist dies gegenwärtig ein kontrovers diskutiertes Thema (freundlicher Hinweis von Carsten Jahnke).
4 Wenden = Westslawen, u. a. Abodriten, Lutizen, Ranen. 5 Ab 1202 als König Waldemar II. bekannt. 6 Siehe Helmoldi Chronicon Slavorum II. 12.10; Arnoldi Abbatis Lubeccensis III. 5.1., VI, 13. 7 Riis 2003, 64. 8 Heinrici chronicon Livoniae VII, 1.2 (Bauer 1975, 27 ff.). 9 Anders als Ottars und Wulfstans Reisebeschreibung handelt es sich nicht um die Aufzeichnung
einer tatsächlich erfolgten Reise, sondern spiegelt vielmehr den systematischen Versuch wider, eine Reiseroute zu konzeptionalisieren.
10 Breide 2006, 26. 11 Härlin 1942; Langebek 1783, 622. 12 Johansen 1933; Riis 2003, 67 ff. 13 Ribe, Sinkfal (Einfahrt Brügge), Prawle (zwischen Plymouth und Dartmouth), Saint-Matthieu
(westlich von Brest), Far (Kap Váres oder Ferrol), Lissabon, die Straße von Gibraltar, Tarragona, Barcelona, Marseille, Messina und Akkon – in 37 Tagen.
14 Siehe Morcken 1983, 127; Varenius 1995, 192; Ventegodt 1982, 71; Westerdahl 1995 a, 25. 15 Sauer 1996, 66; Schmeidler 1917, 228. 16 Ventegodt 1982, 58 f. 17 Etymologiae 14,2 (Englisch 2002, 41). 18 Edson 2007, 236. 19 Orbis-Terrarum-Karten werden auch als T-O-Karten abgekürzt. Dies beschreibt zugleich die sche-
matisierte Form, indem das „O“ für den Erdkreis und das „T“ für die Gewässer steht, welche die drei Erdteile voneinander trennten: Europa – Asien: Tanais (Don), Asien – Afrika: Nil, Afrika – Europa: Mittelmeer (Friedman 1994, 70).
20 Fraesdorff 2005, 88 ff. 21 Fraesdorff 2005, 99 ff. 22 Christiansen 1997, 57. 23 Meyer 1848, 5. 24 Meyer 1848, 7. 25 Siehe Blomkvist 2005, 524 ff. 26 Riis 2003, 67. 27 Die Ableitung von linn als Burg (Lepp 1995, 144) ist nahe liegend, da die Gründung der Stadt erst nach
der Burg erfolgte. Dies wird auch dadurch verstärkt, dass das estnische Wort linna bzw. linda oft auf Kalkfelsen zutraf und ambivalent für Burg oder Berg verwendet wurde; letztere bildeten ja häufig die Basis der ersten (siehe Rußwurm 1855, 73). Es gibt allerdings auch abweichende Herleitungen, nach dem linna von litna bzw. lidna abgeleitet wird und als Stadt zu übersetzen wäre (siehe Pullat 1999).
28 Olearius 1656. 29 Breide 2006, 74. 30 Modéer 1937, 90. 31 Gallén 1993, 28 ff. 32 Die Koordination der livländischen Kreuzfahrerbewegung war stark von der Gründung örtlicher
Zisterzienserklöster und deren Informationsnetzwerken abhängig (Tamm 2009, 341 ff.). Wie aus noch erhaltenen päpstlichen Briefen in Antwort auf nicht mehr erhaltene Korrespondenzen aus den neuen Bistümern im Baltikum hervorgeht, lief geo-politisches Wissen in höchster Instanz zusam-men, denn neben den weltlichen Fürstenhäusern wurde dieses Wissen auch in Rom als notwendig erachtet (Jensen u. a. 2001, 8 ff.).
33 Im Englischen werden z. B. Buchhalter noch heute als „clerical staff “ bezeichnet, was den klerikalen Ursprung dieses Berufsstandes erklärt.
34 Ventegod 1982, 60 f. 35 Härlin 1942. 36 Es war bei Itinerarkarten üblich, dass Benennungen nicht hierarchisiert, sondern topografische Ein-
heiten wie Flüsse ohne Unterschied in eine Liste von Ortsnamen aufgenommen wurden (Harwood 2006, 37).
37 Transkription durch Härlin 1942; auch die Identifikationen der Ortsnamen in der folgenden Über-setzung dieses Autoren stammen vom selbigen.
38 Lieb 1974, 31 ff. 39 Hänger 2001, 104. 40 Hänger 2001, 96. 41 Allmand 2011, 139.
440 441LiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnis
Jann m. WittSeeFaHrtSGeScHicHte ScHLeSWiG-HoLSteinS
Andresen 1971: G. Andresen (Hrsg.), Schiffahrt und Häfen im Bereich der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg. Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte 21 (Flensburg 1971).
Asmus 1996: W. Asmus, Die Entwicklung des Verkehrs in Schleswig-Holstein 1750–1918 (Neumünster 1996).Deggim 2005: Chr. Deggim, Hafenleben in Mittelalter und Früher Neuzeit. Seehandel und Arbeitsregelungen in
Hamburg und Kopenhagen vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. Schriftenreihe des Deutschen Schifffahrtsmuse-ums 62 (Hamburg 2005).
Hammel-Kiesow 2001: R. Hammel-Kiesow (Hrsg.), Seefahrt, Schiff und Schifferbrüder. 600 Jahre Schiffergesell-schaft zu Lübeck 1401–2001 (Lübeck 2001).
Henningsen 1985: L. N. Henningsen, Provinsmatadorer fra 1700-Årene, Reder-, købmands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700–1770 (Flensburg 1985).
Jenisch 2005: U. Jenisch, Kiel maritim. Mit Jules Verne und Albert Einstein in die Zukunft. Mit ergänzenden Beiträ-gen von Boris Culik (Heikendorf 2005).
Link 1959: Th. Link, Flensburgs Überseehandel von 1755 bis 1807, seine wirtschaftliche und politische Bedeutung im Rahmen des dänisch-norwegischen Seehandels. Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Hol-steins 38 (Neumünster 1959).
Lorenzen-Schmidt/Pelc 2006: K.-J. Lorenzen-Schmidt/O. Pelc (Hrsg.), Das neue Schleswig-Holstein Lexikon (Neumünster 2006).
Lüden 1989: W. Lüden, Föhrer Seefahrer und ihre Schiffe (Heide 1989²).Mehl 2002: H. Mehl (Hrsg.), Historische Schiffe. Vom Nydamboot zur Gorch Fock (Heide 2002).Meier 2009: D. Meier, Land in Sicht. Entwicklung der Seefahrt an Nord- und Ostsee (Heide 2009).Sauer 1995: A. Sauer (Hrsg.), Jens Jacob Eschels: Lebensbeschreibung eines alten Seemannes, von ihm selbst und
zunächst für seine Familie geschrieben (Hamburg 1995).Schmidt 1993: R. Schmidt, Die Professionalisierung der nautischen Fachbildung. Die Seefahrtschule in Bremen
1799–1869. In: J. Brockstedt (Hrsg.), Seefahrt an deutschen Küsten im Wandel 1815–1914. Studien zur Wirt-schafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins 22 (Neumünster 1993) 119–138.
Witt 2001: J. M. Witt, ’Master next God?’ Der nordeuropäische Handelsschiffskapitän vom 17. bis zum 19. Jahrhun-dert. Schriftenreihe des Deutschen Schifffahrtsmuseums 57 (Hamburg 2001).
Witt 2006: J. M. Witt (Hrsg.), Eckernförde – Geschichte einer Hafen- und Marinestadt (Hamburg 2006).Witt 2009: J. M. Witt, Die Ostsee – Schauplatz der Geschichte (Darmstadt 2009).Witt 2011: J. M. Witt, Von Schwarz-Rot-Gold zu Schwarz-Rot-Gold. Eine kurze Geschichte der deutschen Marinen
von 1848 bis heute. Hrsg. vom Deutschen Marinebund e.V. (Berlin 2011).Witt 2012: J. M. Witt, Schleswig-Holsteinische Seefahrtsgeschichte in der Neuzeit (Heide 2012).Witt/Vosgerau 2010: J. M. Witt/H. Vosgerau (Hrsg.), Geschichte Schleswig-Holsteins – anschaulich – spannend –
verständlich (Heide 2010).
Florian HubercatHarina maria
Auer 2010: J. Auer, Prinsessan Hedvig Sophia, Fieldwork Report 2010. Esbjerg Maritime Archaeology Reports 3, 2010. Dreyer 1895: F. Dreyer, Statistisk oversigt over de i aaret 1893 indtrufne søulykkerfor danske skibe i danske og
fremmede farvande og for fremmede skibe i danske farvande. Bianco Lunos KGL. Hof-Bogtrykkert, 1895.Floris 1980: S. Floris, The Coral Banks of the Danian of Denmark. Acta Palaeont. Polonica, 25, 3/4, 531–540.Förster 2002: Th. Förster, Das Wrack vom Harten Ort vor der Insel Hiddensee. Ein Plattbodenschiff des 18. Jahr-
hunderts. Nachrichtenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 9, 2002, 105–110.Förster 2009: Th. Förster, Große Handelsschiffe des Spätmittelalters. Untersuchungen an zwei Wrackfunden des
14. Jahrhunderts vor der Insel Hiddensee und der Insel Poel. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 67 (Kuden 2009).
Gravesen 2001: P. Gravesen, Den geologiske udforskning af Fakse Kalkbrud fra midten af 1700-tallet til nu. Geolo-gisk Tidsskrift København 2001/2, 2001, 1–40.
Hinz 2000: D. Hinz, Untersuchungen an einem Seitenschwert vor Timmendorf/Poel. Unveröffentlichte Facharbeit zum Archäologischen Forschungstaucher. Prüfungskommission Unterwas serarchäologie beim Verband der Landesarchäologen der Bundesrepublik Deutschland (Staufen 2002), 1–3.
Halbwidl u.a. 2006: E. Halbwidl, F. Huber u. W. Kramer, Die Untersuchung des Wracks BSH 762 im Fehmarnbelt – ein Segelschiff mit kupferreicher Ladung. Starigard. Jahresbericht des Fördervereins des Instituts für Ur- und Früh-geschichte der CAU Kiel 7, 2006, 127–131.
Halbwidl u. Hoppe 2009: E. Halbwidl u. K. Hoppe, Der Einfluss von Teredo navalis auf die submarinen Kultur-güter an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. In: U. Müller, S. Kleingärtner, F. Huber (Hrsg.), Zwischen Nord- und Ostsee 1997–2007. Zehn Jahre Arbeitsgruppe für Maritime und Limnische Archäologie (AMLA) in Schleswig-Holstein [Symposium Kiel 2007]. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 165 (Bonn 2009), 99–108.
Huber 2008: F. Huber, Tätigkeitsbericht der Jahre 2008/2009 der Arbeitsgruppe für Maritime und Limnische Archäologie (AMLA). Starigard. Jahresbericht des Fördervereins des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel 9, 2008/09, 115–124.
Jonas 1997: W. Jonas, Schiffbau in Nordfriesland. Schriftenreihe des Nordfriesischen Schiffahrtsmuseums Husum 1 (Husum 1997).
Kaiser 1974: J. Kaiser, Segler im Gezeitenstrom. Die Biografie der hölzernen Ewer (Norderstedt 1974).Pohl 2003: H. Pohl, Die „Gaarden“. Untergang und Wiederentdeckung eines Kruppschen Motorschoners. Nachrich-
tenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 10, 2003, 105–110.Segschneider 2012: M. Segschneider, Verbrannt und versunken – Unterwasserarchäologische Untersuchungen am
Wrack der „Lindormen“ im Zuge der Festen Fehmarnbeltquerung. www.alsh.de [7.3.2013].
Schlüter 1984: M. Schlüter, Danske flasker. Fra Renæssancen til vore dage (Kopenhagen 1984).Szymanski 1934: H. Szymanski, Deutsche Segelschiffe. Die Geschichte der hölzernen Frachtsegler an den deutschen
Ost- und Nordseeküsten vom Ende des 18. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde, Historisch-volkswirtsch. Reihe 10 (Berlin 1934).
Szymanski 2009: H. Szymanski, Die Frachtsegler der deutschen Kleinschiffahrt. Historische Schifffahrt 89 (Lübeck 2009).
Weski 2011: T. Weski, Bodendenkmäler in deutschen Gewässern und Feuchtbodengebieten. Archäologisches Nach-richtenblatt 16/2, 2011, 121–127.
Wolsgård 2012: E. Wolsgård, Den sidste storsmugler. Øboer. Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø 2012, 45–48.
Jens auer und Holger SchweitzerdaS WracK der „PrinSeSSan HedViG SoPHia“
Anderson 1910: R. C. Anderson, Naval wars in the Baltic (London 1910).Auer 2011: J. Auer (Hrsg.), Fieldwork report Prinsessan Hedvig Sophia 2010. Esbjerg, Maritime Archaeology Pro-
gramme, University of Southern Denmark (Esbjerg 2011).Auer/Schweitzer 2012: J. Auer/H. Schweitzer (Hrsg.), Fieldwork report Prinsessan Hedvig Sophia 2011. Esbjerg,
Maritime Archaeology Programme, University of Southern Denmark (Esbjerg 2012).Barfood 1997: J. H. Barfod, Niels Juels flaade. Den danske flaades historie 1660–1720 (København 1997).Börjeson u. a. 1936: H. J. Börjeson/P. Holck/H. Szymanski, Lists of men-of-war 1650–1700 (London 1936).Cederlund 2006: C. O. Cederlund, Vasa I: The Archaeology of a Swedish Royal Ship of 1628. Statens Maritima
Museer (Oxford 2006).Endsor 2009: R. Endsor, The Restoration Warship: The Design, Construction and Career of a Third Rate of Charles
II’s Navy (London 2009).Garde 1852: H. G. Garde, Den dansk-norske sømagts historie. 1700–1814 (København 1852).Glete o. J.: J. Glete, List of Swedish Warships 1521–1721 (unpubliziertes Manuskript o. J.).Goodwin 1987: P. Goodwin, The Construction and Fitting of the Sailing Man of War 1650–1850 (London 1987).Halldin 1963: G. Halldin, Svenskt skeppsbyggeri. En översikt av utvecklingen genom tiderna (Malmö 1963).Hoving 1994: A. J. Hoving, Nicolaes Witsens Scheeps-Bouw-Konst Open Gestelt (Franeker 1994).Koivumäki 2003: T. Koivumäki, Sailing Warships. In: koti.mbnet.fi/felipe/index.html [11.10.2013].Lavery 1981: B. Lavery, Deane’s Doctrine of Naval Architecture 1670 (London 1981).Lavery 1984: B. Lavery, The Ship of the Line 2: Design, construction and fittings (London 1984).Lavery 1987: B. Lavery, The Arming and Fitting of English Ships of War 1600–1815 (London 1987).Rålamb 1943: A. Rålamb, Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tiende Tom. Sjöhistoriska Museet Faksimilieditioner
Faksimiltryck (Malmö 1943).Steffy 1994: R. Steffy, Wooden Shipbuilding and the Interpretation of Shipwrecks (College Station 1994).Svensson 1943: A. Svensson (Hrsg.), Svenska flottans historia 2. 1680–1814 (Malmö 1943).Tuxen/With-Seidelin 1922: A. P. Tuxen/C. L. With-Seidelin, Erobringen af Sverigs tyske Provinser 1715–1716
(Copenhagen 1922).Winter 1985: H. Winter, Der holländische Zweidecker von 1660–1670. 4. Auflage (Rostock 1985).
Philipp Grassel und Jasmin LooseWo SinD all Die SchiFFe hin?
Baykowski 1991: U. Baykowski, Die Kieler Hansekogge. Der Nachbau eines historischen Segelschiffes von 1380 (Kiel 1991).
Bill 1994: J. Bill, Iron Nails in Iron Age and medieval Shipbuilding. In: Ch. Westerdahl (Hrsg.), Crossroads in Ancient Shipbuilding (Oxford 1994) 55–64.
Brandt/Kühn 2004: K. Brandt/H. J. Kühn (Hrsg.) Der Prahm aus dem Hafen von Haithabu. Beiträge zu antiken und mittelalterlichen Flachbodenschiffen (Neumünster 2004).
Dubrovin 2007: G. E. Dubrovin, The Use of Wood in Transport. In: M. Brisbane/J. Hather (Hrsg.), Wood Use in Medieval Novgorod (Oxford 2007) 209–262.
Eichler 2010: C. W. Eichler, Holzbootsbau - und der Bau von stählernen Booten und Jachten (Ulm 2010).Ellmers 1972: D. Ellmers, Frühmittelalterliche Handelsschifffahrt in Mittel- und Nordeuropa (Neumünster 1972).Ellmers 2004: D. Ellmers, Kahn, Prahm und andere flachbodige Schiffstypen. Ein Beitrag zur Wörter- und Sachen-
forschung. In: Brandt/Kühn 2004, 55–69.Ellmers 2006: D. Ellmers, Hansischer Handel mit Schiffsbauholz. Ein Beitrag zur Wörter- und Sachenforschung. In:
H.-P. Baum/R. Leng/J. Schneider (Hrsg.), Wirtschaft, Gesellschaft, Mentalitäten im Mittelalter. [Festschrift zum 75. Geburtstag von Rolf Sprandel] (Stuttgart 2006) 63–78.
Ewe 1984: H. Ewe (Hrsg.) Geschichte der Stadt Stralsund (Weimar 1984).Förster 2003: T. Förster, Die „Darßer Kogge“. Der aktuelle Stand der archäologischen Untersuchungen. Nachrich-
tenblatt Arbeitskreis Unterwasserarchäologie 10, 2003, 87–93.Gläser 2004: M. Gläser, Die Infrastrukturen der Stadt Lübeck im Mittelalter und der frühen Neuzeit. In: M. Glä-
ser (Hrsg.), Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IV. Die Infrastruktur (Lübeck 2004) 173–196.
Grabowski/Schmitt 1993: M. Grabowski/G. Schmitt, „Und das Wasser fließt in Röhren“. Wasserversorgung und Wasserkünste in Lübeck. In: M. Gläser (Hrsg.), Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum. [Festschrift für Günter P. Fehring] (Rostock 1993) 217–223.
Grassel in Vorbereitung: P. Grassel, Mittelalterliche Schiffsholzfunde aus einem Gebäudebefund des 14. Jhs. vom Fundplatz 333 – Stralsund-Frankenhof. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern Jahrbuch 60 (in Vorbereitung).
442 443LiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnis
Grimm 2006: O. Grimm, Großbootshaus – Zentrum und Herrschaft, Zentralplatzforschung in der nordeuropäi-schen Archäologie (1.–15. Jh.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsband 52 (Marburg 2006).
Hahn 2005: H. P. Hahn, Materielle Kultur. Eine Einführung (Berlin 2005).Hakelberg 2003: D. Hakelberg, Das Kippenhorn bei Immenstaad. Archäologische Untersuchungen zu Schifffahrt
und Holzschiffbau am Bodensee vor 1900 (Stuttgart 2003).Heussner 2005: K.-U. Heußner, Handel mit Holz. In: H. Jöns/F. Lüth/H. Schäfer (Hrsg.), Archäologie unter dem
Straßenpflaster. 15 Jahre Stadtkernarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin 2005) 125–128.Kalmring 2010: S. Kalmring, Der Hafen von Haithabu. Ausgrabungen in Haithabu 14 (Neumünster 2010).Konze/Samariter 2010: M. Konze/R. Samariter, Kurze Fundberichte 2010, Fundplatz 333. Bodendenkmalpflege in
Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 58, 2010, 454–475.Konze/Samariter 2012: M. Konze/R. Samariter, Mittelalterliche Spielpläne für Tric-Trac und Schach/Dame aus
Stralsund, Quartier Frankenhof. Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 19, 2012, 55–74.Kulessa 2005: B. Kulessa, Siedlungsgeschichte und Hafenentwicklung in der Hansestadt Stralsund vom Mittelalter
bis zur frühen Neuzeit (Leidorf 2005).Küster 1999: H.-J. Küster, Gedanken zur Holzversorgung von Werften an der Nord- und Ostsee im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit. Deutsches Schifffahrtsarchiv 22, 1999, 315–328.Langenbach 2005: K. Langenbach, Wikingerschiffe und Hansekoggen. Zur Bedeutung der Schifffahrt für die Euro-
päisierung Europas. In: H. Eilbracht (Hrsg.), Itinera Archaeologica. Vom Neolithikum bis in die Frühe Neuzeit. [Festschrift für Torsten Capelle zum 65. Geburtstag] (Leidorf 2005) 151–158.
Loose in Vorbereitung: J. Loose, Sekundär verwendete Schiffsholzfunde aus einem spätmittelalterlichen Leitungs-system des Quartier Frankenhof-Stralsund (in Vorbereitung).
McCarthy 2005: M. McCarthy, Ships’ Fastenings. From Sewn Boat to Steamship (Texas A&M 2005).McGrail 1993: S. McGrail, Medieval Boat and Ship Timbers from Dublin (Dublin 1993).Meier 2009: D. Meier, Land in Sicht. Entwicklung der Seefahrt an Nord- und Ostsee (Heide 2009).Mulsow 2004: R. Mulsow, Archäologische Quellen zur Infrastruktur der Hansestadt Rostock. In: Gläser 2004, 221–236.Nakoinz 1998: O. Nakoinz, Das mittelalterliche Wrack von Schuby-Strand und die Schiffsbautraditionen der südli-
chen Ostsee. Archäologisches Korrespondenzblatt 28, 1998, 311–322.Radkau 2007: J. Radkau, Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt (München 2007).Rech 2001: M. Rech, Zum Hausbau im mittelalterlichen Bremen. In: M. Gläser (Hrsg.), Lübecker Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum III. Der Hausbau (Lübeck 2001) 377–386.Rudolph 1967: W. Rudolph, Boote der pommerschen Bodden zwischen Recknitz und Nogat I. Greifswald-Stralsun-
der Jahrbuch 7, 231–242.Rudolph 1968/69: W. Rudolph, Boote der pommerschen Bodden zwischen Recknitz und Nogat II. Greifswald-Stral-
sunder Jahrbuch 8, 185–196.Schäfer 2005: H. Schäfer, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung. In: H. Jöns/F. Lüth/H. Schäfer (Hrsg.), Archäo-
logie unter dem Straßenpflaster. 15 Jahre Stadtkernarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin 2005) 247–248.
Schubert 1987: E. Schubert, Der Wald: wirtschaftliche Grundlage der spätmittelalterlichen Stadt. In: B. Herrmann (Hrsg.), Mensch und Umwelt im Mittelalter (Stuttgart 1987) 257–274.
Sczech 1993: K. J. Sczech, Archäologische Befunde zur Entsorgung im Mittelalter – Dargestellt am Beispiel Kon-stanz und Freiburg im Breisgau (Konstanz 1993).
Seymour 2010: J. Seymour, Vergessene Künste. Bilder vom alten Handwerk (Stuttgart 2010).Vlierman 1997: K. Vlierman, A chaulking method used as an aid to date shipwrecks from Hanseatic period. In:
G. De Boe/F. Verhaeghe (Hrsg.), Travel Technology and Organisation in Medieval Europe. Papers of the ,,Medie-val Europe Brugge 1997” Conference (Zellik 1997) 41–52.
Weski 1999: T. Weski, Fiktion oder Realität? Anmerkungen zum archäologischen Nachweis spätmittelalterlicher Schiffsbezeichnungen. Skyllis. Zeitschrift für Unterwasserarchäologie 1999/2, 96–106.
Westphal 2006: F. Westphal, Die Holzfunde von Haithabu. Ausgrabungen in Haithabu 11 (Neumünster 2006).
daniel zwickauF den SPuren deS äLteSten See-itinerarS der oStSee
Adams/Rönnby 2002: J. Adams/J. Rönnby, Kuggmaren 1. The first cog find in the Stockholm archipelago, Sweden. The International Journal of Nautical Archaeology 31/2, 2002, 172–181.
Ågren/Svensson 2007: J. Ågren/R. Svensson, Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000. LMV-rapport 2007/4 (Gävle 2007).
Åkerlund 1951: H. Åkerlund, Fartygsfynden i den Forna Hamnen i Kalmar (Uppsala 1951).Allmand 2011: C. Allmand, The ‚De Re Militari‘ of Vegetius. The Reception, Transmission and Legacy of a Roman
Text in the Middle Ages (Cambridge 2011).Ankarberg 1995: C.-H. Ankarberg, Älvsnabben – Kapartillhall och flottbas i Stockholms skärgard. In: G. Flink
(Hrsg.), Kung Valdemars segelled (Stockholm 1995) 103–110.von Arbin 2012: S. von Arbin, A 15th-Century Bulk Carrier, Wrecked off Skaftö – Western Sweden. In: N. Günsenin
(Hrsg.), Between Continents [Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology Istanbul 2009] (Istanbul 2012) 67–74.
Bately/Englert 2007: J. Bately/A. Englert, Ohthere’s Voyages. A Late 9th-century Account of Voyages Along the Coasts of Norway and Denmark and Its Cultural Context (Roskilde 2007).
Bauer 1975: A. Bauer, Heinrich von Lettland: Livländische Chronik (Darmstadt 1975).Bevan/Philot 1873/1969: W. L. Bevan/H. W. Philot, Medieval Geography. An Essay in Illustration of the Hereford
Mappa Mundi (London 1873/Amsterdam 1969).Blomkvist 2005: N. Blomkvist, The Discovery of the Baltic. The Reception of a Catholic World-System in the Euro-
pean North (AD 1075–1225) (Leiden/Boston 2005).Breide 2006: H. Breide, Sjövägen till Estland. En medeltida färdbeskrivning fran Utlängan till Reval (Stockholm 2006).
Byström 1996: G. Byström, Utö bergslagsområde: en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Dalarö, Djurö, Muskö, Nämndö, Ornö, Tyresö, Utö, Västerhaninge och Österhaninge socknar. Atlas över Sveri-ges bergslag. Jernkontorets bergshistoriska utskott 104 (Stockholm 1996).
Cederlund 1990: C.-O. Cederlund, The Oskarshamn cog, Part I. Development of investigations and current research. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 19, 1990, 193–206.
Christiansen 1997: E. Christiansen, The Northern Crusades (London 1997).Edson 2007: E. Edson, The World Map 1300–1492. The Persistence of Tradition and Transformation (Baltimore 2007).Ellmers 2010: D. Ellmers, Koggen kontrovers. Hansische Geschichtsblätter 128, 2010, 113–140.Englert/Trakadas 2009: A. Englert/A. Trakadas, Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea Region in the Early Viking Age
as Seen from Shipboard (Roskilde 2009).Englisch 2002: B. Englisch, Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den Mappae mundi des frühen und hohen Mittel-
alters (Berlin 2002).Fonnesberg-Schmidt 2007: I. Fonnesberg-Schmidt, The Popes and the Baltic Crusades 1147–1254 (Leiden/Boston
2007).Fraesdorff 2005: D. Fraesdorff, Der barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert,
Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau (Berlin 2005).Fredholm 2006: M. Fredholm, Medeltid längs Kung Valdemars segelled. Medeltida fornlämningar och skriftliga
källor från Svärdsund, Ekholmen, Yxlösund, Vitsgarnssund, Gålö, Dalarö, Baggensstäket och Sveriges holme (Magisterarbeit Södertörns Högskola 2006).
Friedman 1994: J. B. Friedman, Cultural conflicts in medieval world maps. In: S. B. Schwartz (Hrsg.), Implicit Understandings. Observing, Reporting, and Reflecting on the Encounters Between Europeans and Other Peo-ples in the Early Modern Era (Cambridge 1994) 64–95.
Friis-Jensen/Zeeberg 2005: K. Friis-Jensen/P. Zeeberg, Saxo Grammaticus: Gesta Danorum/Danmarkshistorien 2 (Kopenhagen 2005).
Gallén 1993: J. Gallén, Det „Danska itinerariet“. Franciskansk expansionsstrategi i Östersjön (Helsingfors 1993).Hammel-Kiesow 1999: R. Hammel-Kiesow, Grain, fish and salt. Written sources and architectural evidence for the
trade with bulk commodities in Lübeck harbour in medieval and early modern times. In: J. Bill/B. L. Clausen (Hrsg.), Maritime Topography and the Medieval Town (Kopenhagen 1999) 87–94.
Harwood 2006: J. Harwood, To the Ends of the Earth. 100 Maps That Changed the World (Hongkong 2006).Hänger 2001: C. Hänger, Die Welt im Kopf. Raumbilder und Strategie im römischen Kaiserreich (Göttingen 2001).Härlin 1942: A. Härlin, Vår äldsta seglingsbeskrivning. Till Rors 10 (Stockholm 1942).Heide 2008: E. Heide, Viking, week, and widsith. A reply to Harald Bjorvand. Arkiv för nordisk filologi 123, 2008, 23–28.Heinsius 1986: P. Heinsius, Das Schiff der hansischen Frühzeit (Weimar 1986).Hirsch u. a. 1863: M. Hirsch/E. Toeppen/E. Strehlke (Hrsg.), Die litauischen Wegeberichte. Scriptores Rerum
Prussicarum – Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft 2 (Leipzig 1863).
Hocker 2004: F. Hocker, Bottom-based Shipbuilding in Northwestern Europe. In: F. Hocker/C. Ward, The Philo-sophy of Shipbuilding. Conceptual Approaches to the Study of Wooden Ships (College Station 2004) 65–93.
Jahnke/Englert im Druck: C. Jahnke/A. Englert, The State of Historical Research on Merchant Seafaring in Danish Waters and in the Western Baltic Sea 1000–1250. In: A. Englert (Hrsg.), Large Cargo Ships in Danish Waters 1000–1250. Ships and Boats of the North (im Druck).
Jensen 2000: K. V. Jensen, Saxos grænser. Dehumaniseringen af Venderne. In: C. S. Jensen/K. V. Jensen/J. Lind (Hrsg.), Venderne og Danmark. Et tværfagligt seminar (= Mindre skrifter udgivet af Center for Middelalderstu-dier, Syddansk Universitet 20) (Odense 2000) 6–12.
Jensen u. a. 2001: C. S. Jensen/K. V. Jensen/J. Lind, Communicating Crusades and Crusading Communications in the Baltic Region. Scandinavian Economic History Review 49/2, 2001, 8–14.
Johansen 1933: P. Johansen, Die Estlandliste des Liber Census Daniae (Kopenhagen/Reval 1933).Lahn 1992: W. Lahn, Die Kogge von Bremen I. Bauteile und Bauablauf. Schriften des Deutschen Schifffahrtsmuse-
ums 30 (Hamburg 1992).Labyrinthos: www.labyrinthos.net/ [11.11.2013].Langebek 1783: J. Langebek, Scriptores Rerum Danicarum (Kopenhagen 1783).Lemdahl u. a. 1995: G. Lemdahl/M. Aronsson/L. Hedenäs, Insekter från ett medeltida handelsfartyg. Entomologisk
Tidskrift 116/4, 1995, 169–174.Lepp 1995: H. Lepp, Domberget i Tallinn. In: G. Flink (Hrsg.), Kung Valdemars segelled (Stockholm 1995) 143–148.Lieb 1974: H. Lieb, Zur Herkunft der Tabula Peutingeriana. Die Abtei Reichenau. Neue Beiträge zur Geschichte und
Kultur des Inselklosters 20, 1974, 31–34.Liljefors 1997: J. Liljefors, Aluett i kung Valdemars segelled: Marinmuseums expedition 1996 (Karlskrona 1997).Litwin 1980: J. Litwin, ‚The Copper Wreck‘. The wreck of a medieval ship raised by the Central Maritime Museum
in Gdańsk, Poland. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 9/3, 1980, 217–225.
Lund 1997: N. Lund, Is Leidang a Nordic or a European phenomenon? In: A. Norgard Jorgensen/B. L. Clausen, Military Aspects of Scandinavian Society in a European Perspective, AD 1–1300 (Kopenhagen 1997) 195–199.
Magnus 1555: O. Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus (Rom 1555).Mägi 2011: M. Mägi, Ösel and the Danish Kingdom: Revisiting Henry’s Chronicle and the Archaeological Evidence.
In: M. Tamm/L. Kaljundi/C. S. Jensen (Hrsg.), Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia (Farnham 2011) 317–341.
Mäss 1994: V. Mäss, Underwater Archaeology in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 43, 1994, 97–100.
Meyer 1848: E. Meyer, Die Livländische Reimchronik (Reval 1848).Modéer 1937: I. Modéer, Något om namnformerna i Kung Valdemars Jordebok. Namn og bygd – Tidskrift för
nordisk ortnamnsforskning 25 (Uppsala 1937).Morcken 1983: R. Morcken, Old Norse Distance Tables in the Mediterranean Sea. Sjöfartshistoriske artiklar 20
(Bergen 1983).Norman 1995: P. Norman, Sjöfart och fiske: De kustbundna näringarnas lämningar. Fornlämningar i Sverige 3
(Stockholm 1995).
456 457abbildungsverzeichnisabbildungsverzeichnis
Jens auer und Holger SchweitzerdaS WracK der „PrinSeSSan HedViG SoPHia“
Auer 2011, unter Verwendung von Open Sea Map Daten und einer Karte von NordNordWest, Wiki-media Commons: Abb. 1Frederik V Atlas, Volume 32, Königliche Bibliothek Kopenhagen: Abb. 2RA 141-1, 1714: Abb. 3RA A762, o. D.: Abb. 4G. Lorenz: Abb. 5, 10Maritime Archaeology Programme, University of Southern Denmark 2011: Abb. 6L. Hermannsen, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein: Abb. 7, 8H. Schweitzer: Abb. 9Maritime Archaeology Programme, University of Southern Denmark 2011: Abb. 11, 12J. Auer: Abb. 13
Philipp Grassel und Jasmin LooseWo SinD all Die SchiFFe hin?
nach Konze/Samariter 2012, 55 Abb. 1: Abb. 1nach Kulessa 2005, 29 Abb. 7: Abb. 2Foto: M. Konze/R. Samariter, LAKD Mecklenburg-Vorpommern: Abb. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15erstellt von P. Grassel nach Vorlage des LAKD Mecklenburg-Vorpommern: Abb. 4erstellt durch J. Loose nach Vorlage des LAKD Mecklenburg-Vorpommern: Abb. 7nach Ellmers 2004, 63 Abb. 6: Abb. 16nach Kalmring 2010, 125 Abb. 84: Abb. 17nach Baykowski 1991, 6: Abb. 18Ewe 1984, 175 Abb. 88: Abb. 19
daniel zwickauF den SPuren deS äLteSten See-itinerarS der oStSee
D. Zwick: Abb. 1, 5, 7I. Leidus: Abb. 2nach Bevan/Philot 1873/1969, vom Autoren modifiziert: Abb. 3ÖNB Bildarchiv Wien, Cod. 324: Abb. 4Riksantikvarieambetet, vom Autoren modifiziert: Abb. 5 (oben)Basiskartendaten von J. Fredriksson, vom Autoren modifiziert: Abb. 5 (mitte)T. Zwick: Abb. 6A. McEntyre: Abb. 8Chr. Westerdahl: Abb. 9Labyrinthos, vom Autoren modifiziert: Abb. 10K. Romdahl (www.romdahl.se), mit freundlicher Genehmigung: Abb. 11nach Lahn 1992, vom Autoren wurden noch das Stevenruder und der Mast, die nicht mehr im archäo-
logischen Originalbefund erhalten waren, zur Veranschaulichung einskizziert: Abb. 12nach Magnus 1555, 90: Abb. 13K. Enholm: Abb. 14
marijana Krahl„d/S HøVdinG”
Satellitenbild Google Maps, überarbeitet von M. Krahl: Abb. 1, 2F. Huber: Abb. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13nach Schiffsmappe, Zeichnung H.I.D 6106 T. 1907: Abb. 9J. Ulrich: Abb. 10Buskerud Fylkesfotoarkiv: Abb. 11Bygdeposten: Abb. 12
Philip Lüth, Florian Huber und andré dubischtonPFeiFen Für ameriKa
F. Huber: Abb. 1, 9Institut für Ur- und Frühgeschichte Kiel: Abb. 2, 3, 4, 5, 7, 8J. Ulrich: Abb. 6Reproduktion Stadtarchiv Kiel: Abb. 10
Felix röschdaS ScHLeSWiGer HaFenVierteL
M. Schimmer, verändert durch F. Rösch: Abb. 1Karte auf Basis von © OpenStreetMap contributors; historische Uferlinie nach Vogel 1999, Abb. 1:
Abb. 2Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landes-
museen: Abb. 3, 6nach Stoob 1973; Original im Stadtarchiv Schleswig: Abb. 4M. Schimmer: Abb. 5F. Rösch: Abb. 7, 10Wikinger Museum Haithabu in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen: Abb. 8, 11W. Karrasch, Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf in der Stiftung Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen: Abb. 9, 13nach Schultze 2012, Abb. 4: Abb. 12
andré dubischSuBmarine Funde in neuStadt/HoLStein
A. Dubisch: Abb. 1, 3, 4, 11, 12, 13Institut für Ur- und Frühgeschichte Kiel: Abb. 2, 6, 8, 9K. Winter: Abb. 5, 7nach Szabo u. a. 1985, 78 (Abb. 63).: Abb. 10nach Hafen 1999, 10: Abb. 14
Philip Lüthin iSoLierter LaGe
P. Lüth: Abb. 1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20K. Winter: Abb. 2, 7J. Loose: Abb. 3, 21U. Kunz: Abb. 5, 10, 13Institut für Ur- und Frühgeschichte Kiel: Abb. 12F. Huber: Abb. 14
F. Huber, a. Baier, H. Fricke, m. nadler und J. ulrichim „tieFen Brunnen“ der KaiSerBurG
U. Kunz: Abb. 1, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 29nach Baier u. a. 2012, 46 Abb. 3: Abb. 2nach Gleue 2008, 53 Abb. 25: Abb. 3nach Gleue 2008, 62 Abb. 30: Abb. 4nach Gleue 2008, 64 Abb. 32: Abb. 5nach Baier u. a. 2012, 55 Abb. 6: Abb. 6nach Baier u. a. 2012, 56 Abb. 7; Zeichnung: Stadtarchiv Nürnberg; Bild: W. Herppich: Abb. 7nach Ströer/Sangl 1988, 29: Abb. 9J. Ulrich: Abb. 11J. Ulrich/D. Friebe: Abb. 14F. Huber: Abb. 15, 16, 18, 19, 23, 27A. Baier: Abb. 20E. Heukeroth: Abb. 28