Hüttenmeister_Lehnardt_2013_Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz
Transcript of Hüttenmeister_Lehnardt_2013_Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz
Nathanja Hüttenmeister, Andreas Lehnardt
Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz
In Mainz, einer der drei berühmten SchUM-Städte1 und bei den Juden als Magenza bekannt, erregten im August 2007 Funde auf einer Baustelle internationales Aufsehen: In der ausgehobenen Baugrube waren die Bauarbeiter auf Jahrhunderte alte Gräber und Grabsteinfragmente gestoßen. Dies war zunächst nicht weiter verwunderlich, erhebt sich die Stadt Mainz doch über dem römischen Legionslager Mogontiacum und lag die Bau-stelle in der Nähe der damals außerhalb der Stadt angelegten Nekropole. Sie war daher bereits von der Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie als Ver-dachtsfläche für römische Gräber eingestuft worden,2 und so wurden die Arbeiten mit den ersten Funden eingestellt. Die hinzugezogenen Archäologen fanden neben einer Rei-he von Steinfragmenten auch zwei unangetastete Gräber, unklar blieb jedoch zunächst, aus welcher Zeit die Gräber stammen. Die Nähe des unmittelbar an die Baustelle angren-zenden alten jüdischen Friedhofs und hebräische Schriftzeichen auf einem Teil der ge-fundenen Fragmente erhärteten den Verdacht, dass es sich um Reste des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs handelte,3 und dies wurde schließlich auf eindrucksvolle Weise be-stätigt: Ein Steinfragment konnte sicher einem der beiden Gräber zugeordnet werden.4 Eines dieser Gräber ist mit einer Lage flacher Steine gedeckt, auf dem anderen wurde eine aufwändige Steinkonstruktion errichtet, um den Grabstein, dessen unterer Teil noch im-mer an Ort und Stelle stand, in diesem sandigen, abschüssigen Untergrund zu stützen und zu stabilisieren. Schon auf den ersten Blick schien der Grabstein von David ben Jizchak Hakohen auf dieses Unterteil zu passen, was bewiesen werden konnte, indem er (vorübergehend) wieder aufgesetzt wurde. Dieser Grabstein weist mit seiner Front direkt nach Südosten, in Richtung auf Jerusalem, dem Ort der erwarteten Auferstehung, wäh-rend das zweite Grab eine leichte Abweichung von dieser Richtung aufweist.
Leider lässt sich der Grabstein des David ben Jizchak Hakohen (Abb. 1) aufgrund einer Beschädigung nicht genau datieren. Die Reste der Jahresangabe lassen darauf
1 SchUM nach den hebräischen Anfangsbuchsta-ben von Spira (Speyer), Warmaisa (Worms) und Magenza (Mainz).
2 Pressemitteilung der Stadt Mainz, 19.10.2007.3 Erstmals vorgestellt wurden die Funde auf einer
internationalen Fachtagung in Tel Aviv. Der Beitrag dazu erscheint in: Stefan Reif, Andreas
Lehnardt, Avriel Bar-Levav (Hg.): Death in Je-wish Life. Burial and Mourning Customs Among the Jews of Europe and Nearby Communities, Turnhout 2013, S. 220–225.
4 Siehe dazu den Beitrag von Gerd Rupprecht in diesem Band.
SchUM-Gemeinden #10.indd 197 18.12.12 08:35
198 · Nathanja Hüttenmeister, Andreas Lehnardt
schließen, dass er aus dem 9. Jahrhundert der (kleinen) jüdischen Zählung, aus dem Zeit-raum zwischen den Jahren 1041 und 1139, stammt. Betonreste an der vergleichsweise frisch wirkenden Bruchkante des Steins deuten darauf hin, dass die Beschädigung des Grabsteins relativ neu ist und vermutlich aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammt.
Die Stadt Mainz war zunächst davon ausgegangen, dass ein Neubau an dieser Stelle unbedenklich sei, da an derselben Stelle schon zuvor Gebäude gestanden hatten, die nun abgerissen worden waren: 1952 war hier eine Landwirtschaftsschule errichtet worden. Eine genauere Recherche hätte allerdings schnell zutage gefördert, dass auch beim dama-ligen Bau bereits mittelalterliche jüdische Grabsteine gefunden worden waren. Allerdings hatte man kurz nach dem Krieg weder das nötige Bewusstsein für die Bedeutung der Funde noch Interesse an ihnen, geschweige denn an einem Baustopp, und so wurden damals nur wenige Grabsteine geborgen, die anderen, darunter offensichtlich auch der Grabstein des David Hakohen, unter das Fundament des Neubaus verbracht und dem Vergessen anheim gegeben, bis sie nun beim Abriss der Schule wieder zutage traten.
Abb. 1: David ben Jizchak Hakoh(en), gestorben zwischen 1041 und 1139
SchUM-Gemeinden #10.indd 198 18.12.12 08:35
Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz · 199
Diesmal jedoch wählte die Stadt einen sehr viel behutsameren Umgang mit ihrem historischen Erbe: Nach Hinzuziehung der jüdischen Gemeinde Mainz, von Rabbinern und Wissenschaftlern, wurde beschlossen, auf den geplanten Neubau zu verzichten, um die ewig währende Totenruhe zu respektieren, und das Gelände wieder dem angrenzen-den jüdischen Friedhof anzugliedern. Die gefundenen Grabsteine und Fragmente wurden geborgen, die Gräber jedoch blieben unangetastet und die Grube wurde wieder aufgefüllt.
Die 1952 und 2007 gefundenen Steine waren bei weitem nicht die ersten mittelalterlichen jüdischen Grabsteine, die in Mainz gefunden wurden: Bereits 1834 war der erste mittel-alterliche Grabstein entdeckt worden.5 1860/62 beschrieb der Mainzer Rabbiner Marcus Lehmann weitere Funde in der Monatsschrift „Jeschurun“6 und in seiner Wochenschrift „Der Israelit“.7 In den folgenden Jahren kamen weitere Steine hinzu,8 und 1898 veröffent-lichte Siegmund Salfeld in seinem berühmten Martyrologium erstmals eine Übersicht über alle bis dahin bekannten Grabsteine.9
1926 wurde auf Initiative von Siegmund Salfeld auf einem an den jüdischen Friedhof angrenzenden Gelände, das – wie durch Ausgrabungen belegt werden konnte – eben-falls zum mittelalterlichen jüdischen Friedhof gehört hatte, der sogenannte „Denkmal-friedhof “ eingerichtet, um der großen Vergangenheit der jüdischen Gemeinde im mittelalterlichen Mainz zu gedenken (Abb. 2). Hier wurden die bis dahin gefundenen mittelalterlichen Grabsteine wieder aufgestellt, in lockerer Folge über das Gelände ver-teilt, so dass auf den ersten Blick zu erkennen war, dass die Grabsteine nicht mehr auf ihren Gräbern standen. Der damalige Mainzer Rabbiner Sali Levi veröffentlichte auch einige Neufunde10 sowie eine Liste mit allen 188 bis dato bekannten mittelalterlichen Grabsteinen.11
5 Georg Christian Braun: Über einen auf dem jü-dischen Begräbnißplatz zu Mainz gefundenen Stein, in: Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung 2 (1834), Heft 2, S. 163–166. Einen weitgehend vollständigen Überblick über die Veröffent-lichungen zum Friedhof bis ins Jahr 2005 siehe bei Falk Wiesemann: Sepulcra judaica. Biblio-graphie zu jüdischen Friedhöfen und zu Sterben, Begräbnis und Trauer bei den Juden von der Zeit des Hellenismus bis zur Gegenwart, Essen 2005, S. 293–295.
6 Marcus Lehmann: Die in der Nähe des Ludwigs-bahnhofes in Mainz aufgefundenen jüdischen Grabsteine, in: Zeitschrift des Vereins zur Erfor-schung der Rheinischen Geschichte und Alter-tümer 2 (1859/1864), S. 226–232; ders.: Die in Mainz aufgefundenen jüdischen Grabsteine, in: Jeschurun. Monatsblatt zur Förderung des jüdi-
schen Geistes und jüdischen Lebens 4 (1860), S. 204–210.
7 Mitteilung aus Mainz von Marcus Lehmann, in: Der Israelit 3, Heft 19 (7.5.1862), S. 150f.
8 Eliakim Carmoly: Die Juden zu Mainz im Mittel-alter. V. Der uralte Friedhof, in: Der Israelit 6, Heft 39 (27.9.1865), S. 563–565; Der alte israeliti-sche Friedhof in Mainz, in: Der Israelit 17, Heft 9 (1.3.1876), S. 201f.
9 Siegmund Salfeld: Der alte israelitische Friedhof in Mainz und die hebräischen Inschriften des Mainzer Museums, in: ders.: Das Martyrologium des Nürnberger Memorbuchs, Berlin 1898, S. 426–439.
10 Sali Levi: Beiträge zur Geschichte der ältesten jü-dischen Grabsteine in Mainz, Mainz 1926.
11 ,Verzeichnis der alten jüdischen Grabsteine auf dem „Judensand“‘ zusammengestellt von Rabbi-ner Dr. S. Levi, Mainz 1926.
SchUM-Gemeinden #10.indd 199 18.12.12 08:35
200 · Nathanja Hüttenmeister, Andreas Lehnardt
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es den Bemühungen des protestantischen Theolo-gen Eugen Ludwig Rapp (1904–1977) zu verdanken, dass die mittelalterlichen Grab steine nicht in Vergessenheit gerieten. Er sammelte jeden neu aufgefundenen Grabstein und sorgte dafür, dass die Steine fotografiert und dokumentiert wurden.12
1970 wurden im Gedenkbuch für Zvi Avneri 104 Mainzer Grabinschriften veröffent-licht,13 und im Todesjahr 1977 von Eugen Rapp erschien schließlich seine „Chronik der Mainzer Juden“ mit einer ausführlichen Behandlung der Grabdenkmalstätte.14
Die große Mehrheit der mittelalterlichen Grabsteine aus Aschkenas, die wir heute ken-nen, hat sich nur deswegen erhalten, weil die Steine von ihren Friedhöfen geraubt und als Spolien in kirchlichen wie weltlichen Gebäuden verbaut wurden, als Trophäen nach der Vertreibung der Juden, als sichtbares Symbol für den Sieg der Kirche über die Synagoge und als billig verfügbares Baumaterial. Dieses Schicksal war auch den Mainzer Grabstei-nen beschieden.
Der jüdische Friedhof in Mainz ist einer der ältesten, wenn nicht sogar der älteste jü-dische Friedhof des mittelalterlichen Aschkenas. Beisetzungen an diesem Ort können bis etwa zum Jahr 1000 zurückverfolgt werden, möglicherweise ist der Friedhof jedoch noch älter. Der älteste erhaltene Grabstein stammt vermutlich aus dem Jahr 1049, weitere aus den Jahren 1064/65, den 1080er Jahren und 1094/95. Kurz darauf, während der Verfol-gungen des Ersten Kreuzzuges im Jahr 1096, wurde die jüdische Gemeinde Mainz fast vollständig ausgelöscht und ihr Friedhof stark zerstört. Als die Juden nach Mainz zurück-kehrten, ersetzten sie einige der verloren gegangenen Grabsteine ihrer berühmten Vor-fahren durch (undatierte) Gedenksteine, wie zum Beispiel den für die berühmte „Leuch-te des Exils“, R. Gershom ben Jehuda, der (spätestens) 1040 in Mainz gestorben war.
Nach der spätmittelalterlichen Vertreibung der Juden aus Mainz im Jahr 1438 wurde der Friedhof wieder zerstört, vermutlich wurden einige Grabsteine geraubt und als Bau-material verwendet. 1449 wurde ein Teil des Friedhofsareals an die Juden zurückgegeben,
12 Sein Karteikasten mit Fotografien und Tran-skriptionen der Grabsteine wird im Seminar für Judaistik der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz aufbewahrt. Die Karteikarten werden veröffentlicht unter www.blogs.uni-mainz.de/fb01judensand. Siehe auch Eugen Ludwig Rapp und Otto Böcher: Die ältesten hebräischen In-schriften Mitteleuropas in Mainz, Worms und Speyer, in: Jahrbuch der Vereinigung der „Freun-de der Universität Mainz“ 9 (1959), S. 1–48.
13 Zvi Avneri: Medieval Jewish Epitaphs from Ma-genza, in: Aqiva Gilboa u. a. (Hg.): Studies in the History of the Jewish People and the Land of Israel in Memory of Zvi Avneri, Haifa 1970, S. 141–161 (hebr.).
14 Eugen Ludwig Rapp: Chronik der Mainzer Ju-den. Die Mainzer Grabdenkmalstätte, Grünstadt 1977. Eine Zusammenstellung von sämtlichen bisher gefundenen und publizierten mittelalter-lichen Mainzer Grabsteinen und Inschriften wird zur Zeit mit Unterstützung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz vorbereitet und in epidat, der epigrafischen Datenbank des Salo-mon Ludwig Steinheim-Instituts für deutsch- jüdische Geschichte e.V. an der Universität Duisburg- Essen, veröffentlicht werden. Eine neue wissenschaftliche Bearbeitung aller bisher in Mainz gefundenen mittelalterlichen Grabstei-ne ist in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Judaistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz geplant.
SchUM-Gemeinden #10.indd 200 18.12.12 08:35
Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz · 201
die nach Mainz zurückgekehrt waren. Dieser diente der Gemeinde bis ins Jahr 1880, als ein neuer Friedhof eingerichtet wurde.
Über 240 mittelalterliche jüdische Grabsteine sind in den letzten 200 Jahren in Mainz gefunden worden. Sie stammen aus dem Zeitraum von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum Jahr 1421. Ein Großteil der wiederentdeckten jüdischen Grabsteine war in Gebäu-den aus dem 15. Jahrhundert verbaut. Einzelne Steine wurden jedoch auch immer wieder in den Gärten, die an den Friedhof angrenzten, gefunden, also vermutlich in einem Ge-biet, das – wie der Ort der Neufunde auch – bis zur Vertreibung der Juden im Jahr 1438 Teil des mittelalterlichen Friedhofs gewesen war.
Einige Grabsteine werden seit den 1970er Jahren im Landesmuseum Mainz ausgestellt. Weitere sind bis heute verbaut geblieben, andere sind nach ihrer Entdeckung erneut ver-loren gegangen, doch die meisten gefundenen Grabsteine stehen heute auf dem erwähn-ten „Denkmalfriedhof “. Während ein Großteil der im 19. und 20. Jahrhundert aufgefun-denen Grabsteine als Spolien verbaut die Zeit überdauerte, wurden die neuen Grabsteine jetzt auf dem Gelände des mittelalterlichen Friedhofs gefunden, verschüttet im weichen Untergrund des seit dem 13. Jahrhundert „Judensand“ genannten Friedhofs.15
Abb. 2: Die Einweihung der „Denkmalfriedhofs“, Oktober 1926
15 Zvi Avneri (Hg.): Germania Judaica II/2: Von 1238 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Tübin-gen 1968, S. 516; Arye Maimon, Mordechai Breu-
er, Yacov Guggenheim (Hg.): Germania Judaica III/2: 1350–1519, Tübingen 1995, S. 787.
SchUM-Gemeinden #10.indd 201 18.12.12 08:35
202 · Nathanja Hüttenmeister, Andreas Lehnardt
Insgesamt wurden 29 teils vollständig, teils nur fragmentarisch erhaltene Grabsteine sowie eine ganze Reihe kleinerer unbeschrifteter Bruchstücke aus rötlichem, gelblichem und grauem Sandstein entdeckt. Weitere ausgegrabene Fragmente, vor allem große, mit ornamentalen Mustern verzierte rote Sandsteinplatten, scheinen nicht vom mittelalter-lichen jüdischen Friedhof zu stammen, möglicherweise gehen sie auf die erwähnte römi-sche Nekropole zurück.
Die meisten Grabsteine sind schlicht, doch sorgfältig gearbeitet, einige jedoch nur grob behauen. Soweit heute noch zu erkennen, weisen die meisten Grabsteine oben einen horizontalen Abschluss auf, drei werden durch einen Rundbogen geschlossen, und einer hat einen asymmetrischen Dreiecksgiebel. Die meisten Schriftfelder sind vertieft, und auf zwei Grabsteinen kann man noch Begrenzungslinien zwischen den Zeilen erkennen.
Zwölf der neu gefundenen Grabsteine sind datiert, sie stammen aus einem Zeitraum vom Ende des 11. bis zum Ende des 12. oder der Mitte des 13. Jahrhunderts und zählen damit zu den ältesten erhaltenen mittelalterlichen Grabsteinen in Mainz. Nur einer der neu aufgefundenen Grabsteine trägt ein genaues Sterbedatum. Er ist damit gleichzeitig der älteste sicher datierbare der neugefundenen Grabsteine: der Stein des R. Amram ben Jona, der am 18. Elul 846, dem 31. August des Jahres 1086, starb (Abb. 3).16 Amram ben Jona, der aus der heiligen Stadt, also aus Jerusalem, nach Mainz gekommen war und wohl mit R. Amram Jeruschalmi, seinerzeit einem der bedeutensten Mainzer Gelehrten17, zu identifizieren ist, starb keines natürlichen Todes: Er wurde erschlagen am „Tage des Zorns“, wie die Inschrift schreibt. Dieser „Tag des Zorns“ war möglicherweise eine Phase kurzer, aber offensichtlich heftiger Ausschreitungen gegen die Mainzer Juden, die mit R. Amram mindestens ein Todesopfer forderten, in anderen Quellen jedoch nicht belegt sind. Vermutlich aufgrund dieser besonderen Umstände wurde hier ein genaues Sterbe-datum mit Monat und Monatstag angegeben, wie es sich auch auf drei älteren Steinen findet, nach 1086 jedoch erst wieder Mitte des 12. Jahrhunderts vorkommt, auch hier auf dem Grabstein einer Märtyrerin von 1147.
Amrams Grabstein ist unter den Neufunden nicht der einzige Stein für einen Märty-rer: Zu den ältesten erhaltenen Grabsteinen ist unter anderem aufgrund seiner Gestal-tung wohl der undatierte Stein für die „gepriesene“ Märtyrerin Riwka bat Kalonymos zu zählen.18 Auf ihr Schicksal deutet eine seltene Wendung in ihrer kurzen, nur zweieinhalb der acht mit Hilfslinien vorgezeichneten Zeilen füllenden Inschrift hin: nechlelet, die „Durchbohrte“, übertragen also Erschlagene, Getötete, ein talmudischer, auf biblische Wendungen zurückgehender Ausdruck19, der, als Substantiv challal, in ähnlicher Form
16 Siehe auch: Grabstein Amram ben Jona, in: His-torisches Museum der Pfalz, Speyer, und Institut für fränkisch-pfälzische Geschichte und Landes-kunde, Heidelberg (Hg.): Die Salier. Macht im Wandel, Katalog. Begleitband zur Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz, Speyer, Mün-chen 2011, S. 227.
17 Siehe Avraham Grossman: The Early Sages of Ashkenaz (hebr.), Jerusalem 1988, S. 187, 201, 206, 365, 393, 427.
18 Zu diesem Grabstein siehe auch Nathanja Hüt-tenmeister: Riwka Tochter des Kalonymos aus Mainz. Ein zweimal verschwundener Grabstein, in: Kalonymos 12 (2009), Heft 3, S. 13–16.
19 bNazir 54a u. a.
SchUM-Gemeinden #10.indd 202 18.12.12 08:35
Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz · 203
heute in Israel für die im Kampf umgekommenen Soldaten (challale zahal) bekannt ist. Aufgrund ihres Vatersnamens könnte es sich bei Riwka um ein Mitglied der berühmten Familie der Kalonymiden handeln, auf die die Gründung der jüdischen Gemeinde in Mainz zurückgehen soll – und auf ihre noble Abstammung deutet auch die Tatsache, dass die Inschrift trotz ihrer Kürze gereimt ist, wie nur ganz wenige der erhaltenen Mainzer Grabinschriften, was als eine besondere Ehrbezeugung zu sehen ist: „Dieser Stein zum
Abb. 3: R. Amram ben Jona aus der Heiligen Stadt, gestorben am 31. August 1086
SchUM-Gemeinden #10.indd 203 18.12.12 08:35
204 · Nathanja Hüttenmeister, Andreas Lehnardt
Zeichen einer Erschlagenen (nechlelet), / zu Häupten der Frau Riwka, der Gepriesenen (mehullelet), / Tochter des Herrn Kalonymos“.
Riwkas heute am rechten Rand beschädigter Grabstein zählt zwar zu den Neufunden, war jedoch schon 1952 beim Bau der Landwirtschaftsschule entdeckt worden, wie histo-rische Fotos beweisen. Damals noch unbeschädigt, wurde er fotografiert und sein Text abgeschrieben,20 jedoch in der Baugrube gelassen und später wieder vergraben. Beim Abriss der Landwirtschaftsschule 2007 tauchte er wieder auf, trug jedoch offensichtlich Beschädigungen davon. Und auch diesmal wurde er zwar vor Ort fotografiert, doch nicht gemeinsam mit den anderen Neufunden in das Depot des Landesdenkmalamtes trans-portiert. Er gilt als verschollen – vermutlich wurde er wieder von Sand verschüttet und liegt geborgen in der geschlossenen Grube.
Einige Steine zeigen deutliche Spuren von Beschädigungen, die teils beim Bau der Landwirtschaftsschule im Jahr 1952, teils bei ihrem Abriss 2007 entstanden sind. Doch einer der neugefundenen Grabsteine weist Beschädigungsspuren auf, die deutlich älter zu sein scheinen: Die Inschrift für Binjamin Hakohen (bzw. seinen Sohn) aus dem Jahr 1105 ist heute nur noch teilweise lesbar, der Stein um die Buchstaben herum ist abge-platzt (Abb. 4). Dies könnte eine Folge von Verwitterung sein. Vergleicht man den Grab-stein jedoch mit früher gefundenen Steinen mit ähnlichen Beschädigungen, wie dem Stein der 1141 gestorbenen Batschewa, der erstmals 1957 von Eugen Rapp beschrieben wurde,21 so drängt sich der Verdacht auf, dass auch diese Steine nach der Vertreibung der Juden aus Mainz im Jahr 1438 für eine Weiterverwendung bestimmt und vor Ort teil-weise bearbeitet worden waren, dann jedoch aus unbekannten Gründen wieder von Sand verschüttet und vergessen wurden.
Eine ausführliche Bearbeitung der in Mainz neu aufgefundenen mittelalterlichen Grab-steine ist in Vorbereitung.22 Darüber hinaus steht eine gründliche wissenschaftliche Bearbeitung aller mittelalterlichen Mainzer Grabsteine noch aus und ist angesichts der Bedeutung dieses für die mittelalterliche Epigraphik wie für die Geschichte der Mainzer Juden äußerst wichtigen Bestandes – auch in Hinblick auf die Bemühungen um den Status eines Weltkulturerbes – mehr als wünschenswert.
20 In Rapps Karteikasten (s.o. Anm. 12) befinden sich zwei Aufnahmen dieses Grabsteins.
21 Eugen Ludwig Rapp: Mainzer hebräische Grab-steine aus dem Mittelalter. Die neuen Funde im Altertumsmuseum, in: Mainzer Zeitschrift. Mit-telrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte 52 (1957), S. 42–45, hier S. 42 und S. 43, Nr. 2 (Abbildung, Transkription in la-teinischen Buchstaben, Übersetzung); ders.: Die Mainzer hebräischen Epitaphien aus dem Mittel-alter, in: Jahrbuch der Vereinigung „Freunde der
Universität Mainz“ 7 (1958), S. 73–90, hier S. 82–87: ,Übersicht über alle datierbaren Mainzer In-schriften von 1064 bis 1420‘, Nr. M 007; Rapp, Böcher, Inschriften (wie Anm. 12), S. 27 (Tran-skription in lateinischen Buchstaben, Überset-zung, Kommentar); Bernd Andreas Vest: Der alte jüdische Friedhof in Mainz, 2. erweiterte Auflage mit Beiträgen von Friedrich Schütz und Manuel Herz, Mainz 2000, S. 72 und S. 100.
22 Sie wird 2013 in der Mainzer Archäologischen Zeitschrift erscheinen.
SchUM-Gemeinden #10.indd 204 18.12.12 08:35
Neu aufgefundene mittelalterliche jüdische Grabsteine aus Mainz · 205
Übersicht über die neu aufgefundenen mittelalterlichen Mainzer Grabsteine in chronologischer Reihenfolge
– Eine Frau (gest. 1085/86) [Inventar-Nr. 0014, fragmentarisch] – R. Amram ben Jona aus der Heiligen Stadt (gest. 31.08.1086) [0011, intakt] – (Sohn des?) Binjamin Hakohen (gest. 11.10.1105) [0006, beschädigt] – Ein Mann (gest. 1105/06) [0015, fragmentarisch] – Ein Mann? (gest. 1105/06?) [0024, fragmentarisch] – Zippora bat Mosche (gest. 1117/18) [0002, intakt] – Menachem ben Josef (gest. 1121/22) [0005, intakt, aber verwittert] – Meir ben Elasar Hakohen (gest. 1132/33) [0021, leicht beschädigt]
Abb. 4: (Sohn des?) Binjamin Hakohen, gestorben 1105
SchUM-Gemeinden #10.indd 205 18.12.12 08:35
206 · Nathanja Hüttenmeister, Andreas Lehnardt
– Orgia bat Schneor (gest. 1137/38) [0017, intakt] – David Hakohen ben Jizchak (gest. zwischen 1041–1139) [0001, beschädigt] – Kalonymos ben Joel (gest. 1144/45) [0018, intakt] – Awraham ben Schmuel Kohen (unsicher datiert, Mitte 12. oder Mitte 13. Jh.) [0004,
leicht beschädigt] – Sara bat Schimon Hakohen (gest. Juni/Juli 1152) [0019, intakt, aber verwittert] – Orgia bat Elasar (gest. 1181/82) [0007, fragmentarisch] – Riwka bat Kalonymos (undatiert, vermutlich einer der ältesten Steine) [0003, be-
schädigt] – Gita bat Josef (undatiert) [0008, fragmentarisch] – Mosche ben Eljakim Kohen (undatiert) [0012, beschädigt] – Ein Mann (undatiert) [0022, fragmentarisch] – Eine Frau (undatiert) [0009, fragmentarisch] – Eine Frau (undatiert) [0010, fragmentarisch] – 10 undatierte, teilweise sehr kleine Fragmente (möglicherweise nicht alles Bruch-
stücke von jüdischen Grabsteinen) [0013, 0020, 0023, 0025, 0027–0030, 0032, 0033] – 13 Fragmente von rechteckigen Steinplatten aus rotem Sandstein mit eingravierten,
ornamentalen Mustern, vermutlich römischen Ursprungs [0026, 0031, 0034]
SchUM-Gemeinden #10.indd 206 18.12.12 08:35











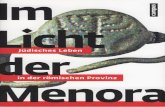








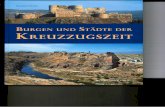
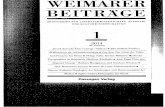





![["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63356a48a1ced1126c0ac8ca/jewish-regional-organization-in-the-rhineland-the-kehillot-shum-around-1300.jpg)



