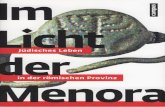PREFACE Of the 18000 species of plant found in India, 1300 ...
["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische...
Transcript of ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische...
Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein: Die Kehillot SchUM um 300
von Rainer Barzen (Trier)
Kehillot SchUM
»Wie sehr gehören unsere Lehrer in Mainz, in Worms und in Speyer zu den gelehrtesten der Gelehrten, zu den Heiligen des Höchsten, ... von dort geht die Lehre aus für ganz Israel, ... Seit dem Tag ihrer Gründung richteten sich alle Gemeinden nach ihnen, am Rhein und im ganzen Land Aschkenas«.1 Mit diesen Worten beschreibt in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts Isaak Or Sarua die besondere Stellung der drei großen jü-dischen Gemeinden am Mittelrhein und die Verehrung, die den Gelehrten dieser jüdi-schen Zentren über die Region hinaus zuteil wurde. Dass er die großen jüdischen Zen-tren des mittleren Rheingebietes als zusammengehörig betrachtete, besonders was die Gelehrten der drei Gemeinden betraf, verband ihn mit seinen Zeitgenossen. Man sprach von den Kehillot Magenza, Warmaissa, Spira, den Gemeinden von Mainz, Worms und Speyer, oder in späteren Generationen kürzer von den Kehillot SchUM, einem Akronym, das spätestens seit dem 4. Jahrhundert zum Synonym für die jüdischen Gemeinden des Mittelrheins werden sollte.
Schon im 2. Jahrhundert war die Zusammengehörigkeit der drei Gemeinden weder neu noch zufällig. Hatte sich am Ende des 0. Jahrhunderts in der Kathedralstadt Mainz die erste jüdische Gemeinde am Mittelrhein herausgebildet, so war kaum eine Gene-ration später in der benachbarten Kathedralstadt Worms eine weitere entstanden, die von Anfang an mit ihrer Schwester in Mainz in vielerlei Hinsicht verwoben blieb. Die Gelehrten beider Gemeinden traten bald gemeinsam in Erscheinung. So berichtet der berühmte französische Bibel- und Talmudkommentator Salomon b. Isaak (gen. Raschi, um 040–04), dass er in seiner Studienzeit am Rhein sowohl in Mainz als auch in Worms von namentlich genannten Lehrern Unterweisung erhielt.
Im Jahre 084 hatten verschiedene Ereignisse die Konstituierung einer Gemeinde in Speyer durch Juden aus Mainz begünstigt. Damit war in einer der zentralen Königs-
Mittelrhein: Die Kehillot SchUM um 1300
249
landschaften des Reiches, im räumlich einzigartigen Ensemble dreier dicht aufeinander folgender Kathedralstädte, eine Trias von jüdischen Zentren entstanden. Ebenso wie die sie umgebenden christlichen Stadtgemeinden, strahlten die Kehillot SchUM weit in ihr Umland aus; innerhalb der Judenschaft des regnum Teutonicum spielten sie eine zentrale Rolle.
Die von Anfang an bestehenden persönlichen und familiären Bindungen unter den Gelehrten und Führungsgruppen der drei Gemeinden führten nicht nur zur Verfesti-gung des Verhältnisses zwischen den jüdischen Zentren der mittelrheinischen Kathed-ralstädte. Das gemeinsame Ringen der vor Ort lebenden Gelehrten und ihrer Gerichte in speziellen Fragen des jüdischen Rechts führte letztendlich dazu, dass ihnen auch von außerhalb ihrer Gemeinden Konflikte und Probleme zur Lösung vorgelegt wurden. Eine Institutionalisierung dieses gemeinsamen Handelns führte schließlich auch zu festen Formen des verbindlichen Miteinanders dieser drei Gemeinden und ihrer Gelehrten. Was sich im frühen 2. Jahrhundert zunächst in Form von gemeinsamen Versammlun-gen der jüdischen Autoritäten der drei Gemeinden (wa‘ad ha-Kehillot) allmählich kon-stituierte, verdichtete sich an der Wende zum 3. Jahrhundert zu einem Gemeindebund mit gleich lautenden Rechtssatzungen für alle drei Gemeinden, die unter ihrer späteren Bezeichnung Takkanot SchUM den Ruhm des rheinischen Judentums im Schrifttum der jüdischen Rechtsgelehrsamkeit mitbegründet hat.
Gemeindebünde am Mittelrhein
Die organisatorische Vernetzung der drei SchUM-Gemeinden blieb der sie umgebenden nichtjüdischen Gesellschaft und deren Herrschaftsträgern nicht verborgen. Vielmehr ge-hört die Perzeption dieser besonderen Beziehung zu den wechselseitigen Wahrnehmun-gen von »christlichen« und »jüdischen« Organisationsformen. Dieses »Lernen« durch Wahrnehmung des jeweils Anderen führte zu ähnlichen Phänomenen und parallelen Entwicklungen innerhalb der jüdischen und der christlichen Gemeinschaft, zumal im städtischen Umfeld.
Interessante Belege für die Ausbildung vergleichbarer Organisationsformen unter Christen und Juden stellen für das Ende des 3. Jahrhundert eine Anzahl von Send-schreiben König Rudolfs dar. Die Umstände und Hintergründe dieser Schreiben vom 6. Dezember 286 werden in den genannten Schriftstücken dargelegt2 und sind im Zu-sammenhang mit der Flucht und Gefangennahme Meirs von Rothenburg des Öfteren diskutiert worden. So war eine beträchtliche Anzahl von Juden aus dem Umfeld der jüdischen Gemeinden des Mittelrheins aus ihren Siedlungsorten »übers Meer« geflohen. Die zurückgelassenen Güter dieser Juden forderte König Rudolf, seinem Verständnis von Herrschaft gegenüber den Juden als camere sue servis entsprechend, nun für sich. Wie wollte König Rudolf die Erfüllung seiner Forderungen umgesetzt wissen?
250
III Das Judentum des Nordens
Der Adressatenkreis seiner nahezu gleich lautenden Mandate verdient in seiner Zusam-menstellung und geografischen Begrenzung besondere Aufmerksamkeit. Am gleichem Tag wandte sich König Rudolf an die Räte und Gemeinden der Städte Mainz, Worms, Speyer, Oppenheim und an die Gemeinden der Städte in der Wetterau.3 Zusätzliche Schreiben wurden den jüdischen Gemeinden von Mainz, Speyer und Oppenheim, sowie an »die Gemeinde der Juden in der Wetterau« gerichtet.4 Weitere Adressaten waren nicht vorgesehen, wie König Rudolf im Schreiben an die Bürger von Mainz klar zu erkennen gab. Seine Forderungen sollten ausschließlich »alle Speyerer, Wormser, Oppenheimer, Mainzer Juden und alle Juden der Wetterau«5 erfüllen. Die christlichen Herrschaftsträ-ger vor Ort sollten dem König bei der Eintreibung helfen und sich nicht selbst an den zurückgelassenen Gütern bereichern.
Aus innerjüdischer Perspektive überrascht König Rudolfs Adressatenkreis keineswegs. Rudolf wandte sich offensichtlich an den Bund der Kehillot SchUM, so wie er in den Rechtssatzungen der jüdischen Gemeinden von 220 niedergelegt war. Dieser »Bund« unter den jüdischen Gemeinden der mittelrheinischen Kathedralstädte wurde, wie die verschiedenen Textzeugen der Rechtssatzungen (takkanot) zeigen, mehrmals erneuert. Er bestand während des 3. Jahrhunderts und darüber hinaus weiter fort. Auch die Nen-nung der Juden von Oppenheim im Zusammenhang mit den jüdischen Gemeinden der mittelrheinischen Kathedralstädte entsprach – zumindest seit dem letzten Drittel des 3. Jahrhunderts – innerjüdischen Verhältnissen. So richtete in einem Responsum Ascher b. Jechiel (um 250–327), der bedeutendste Schüler Meirs von Rothenburg (um 25–293), um 290 eine Anfrage an die Rechtsautoritäten aller vier Gemeinden, die er als »Gelehrte von Mainz und Oppenheim, Worms und Speyer« ansprach.6
Die christlichen Gemeinden der genannten Orte präsentieren uns in ihren Vernetzun-gen ein analoges Bild. Ebenfalls seit den zwanziger Jahren, genauer seit 226, sind Bünd-nisse zwischen den von König Rudolf kontaktierten christlichen Gemeinden der mittel-rheinischen Städte bekannt.7 Die Dokumente zum Bund von 254 erwähnten ebenfalls die Juden – neben Klerikern und anderen – als eine zu schützende Personengruppe.8 Es würde freilich zu weit führen, diese Erwähnung im Sinne einer Integration der jüdischen Gemeinden und ihres Bündnisses in den Bund der christlichen Gemeinden zu werten. Von den jüdischen Gemeinden ist in diesen Dokumenten nicht die Rede. Zumindest aber widerspricht die Integration der Juden in den Schutz des Bundes nicht den jüdischen Organisationsformen. Obwohl das Bündnis von 254, welches über die mittelrheinischen Kathedralstädte weit hinausreichte und viele Städte am Ober-, Mittel- und Niederrhein, Herren und Bischöfe zu seinen Mitgliedern zählte, wenige Jahre später scheiterte, blieben die engen Beziehungen zwischen den christlichen Gemeinden der drei Städte erhalten. Folgerichtig wurde im Jahre 293 das Bündnis zwischen den Städten Mainz, Worms und Speyer erneuert.9
Mit gutem Grund kann davon ausgegangen werden, dass König Rudolf die jeweiligen Verbindungen zwischen den jüdischen und zwischen den christlichen Gemeinden bekannt
Mittelrhein: Die Kehillot SchUM um 1300
251
waren. Die Bestimmungen der Sendschrei-ben zeigen, dass er sich offenkundig dieser funktionierenden Kommunikationsstränge innerhalb der jüdischen wie der christlichen Gesellschaft bedient hat. Wie klar dabei sei-ne Vorstellung von Form und Funktion der vorgefundenen Organisationen war, wird am Beispiel der Wetterau deutlich. Dabei macht Rudolfs Forderung an die Juden der Wetterau10 auf ein weiteres Phänomen aufmerksam, nämlich auf die Herausbil-dung von jüdischen »Bezirken«11, zumeist vor dem Hintergrund innerjüdischer und/oder allgemeiner Steuerorganisation. Eine gemeinsame Besteuerung der Juden aus den wetterauischen Ansiedlungen als iudei Wetterabie begegnet uns zum ersten Mal in der so genannten »Reichssteuerliste«12 von 24. Dort erscheint die Praxis, Juden aus verschiedenen Orten zu einem Steuerbezirk zusammenzufassen, noch auf die Region Wetterau beschränkt. König Rudolf hat diesen Steuerbezirk offenbar wiederbelebt. Innerhalb des jüdischen Kontextes blieb die Verbindung der Juden in der Wetterau nachweislich bis zu den Verwerfungen im Gefolge der Pestverfolgungen (349) als Be-zirk »Fulda« in einem geschlossenen Netz jüdischer Friedhofs- und Steuerbezirke wei-terhin intakt.
Jüdische »Bezirke« um 300
Die Wetterau war als »jüdischer Bezirk« um 300 keineswegs eine singuläre Erschei-nung. In den Quellen lassen sich für diese Zeit an Rhein, Main und Mosel mindestens vier weitere jüdische Bezirke nachweisen. Zwei von ihnen sind als »Gemeindebezirk«
Abb. 17: Kenotaph König Rudolfs von Habsburg im Dom zu Speyer.
252
III Das Judentum des Nordens
(Worms) bzw. »Friedhofsbezirk« (Köln) überliefert. Die beiden anderen Bezirke (»Fran-ken«, »Rhein«) sind durch die Überlieferung von hebräischen Verfolgungslisten des 3. und 4. Jahrhunderts fassbar. In ihrer liturgischen Überformung verbergen sie nur mit Mühe ihre Herkunft aus innerjüdischen Steuerlisten – wie Yacov Guggenheim betont hat – und sind darum als Belege einer innerjüdischen Regionalorganisation anzusehen.
Der älteste jüdische Bezirk unseres Raumes, dessen zugehörige Siedlungen größtenteils bekannt sind, ist uns anhand einer Auflistung von Blutorten des Nürnberger Memor-buches für die Opfer der Rintfleischverfolgung von 298 überliefert (Karte 613). Die unter der Überschrift Eretz Franken, »Land Franken« aufgeführten Blutorte nehmen einen Raum ein, der identisch ist mit dem nördlichen Teil des Bistums Würzburg. Eine Rechtssatzung für die Medinat Wormaissa, den »Bezirk Worms« aus dem Jahre 307 be-legt, dass es um 300 ebenso einen Bezirk der Gemeinde Worms gegeben haben muss. Schließlich kennt die Memorialliste zur Armlederverfolgung 336–38 einen Bezirk Renus (Rhein), der mit seinen jüdischen Siedlungen im Umfeld der jüdischen Gemeinde Kob-lenz das östlich des Vinxtbaches gelegene Gebiet des Trierer Erzbistums bzw. des Trierer Niedererzstiftes umfasste.
Wie verfestigt dieses Netz von jüdischen Bezirken vor 300 gewesen sein muss, zeigt ein Vergleich mit der wesentlich besser überlieferten jüdischen Regionalorganisation am Mittelrhein für die Zeit kurz vor den Verfolgungen zur Zeit der Pest (348–50), wie sie aus den Martyrologien des Nürnberger und des Deutzer Memorbuches rekonstruiert werden kann (Karte 714). Die geografische Gliederung dieser Ortslisten weist jeweils eine Anzahl von kleineren jüdischen Ansiedlungen einem jüdischen zentralen Ort zu, der in der Regel einer wichtigen Gemeinde mit Friedhof entsprach. Letztere war wie-derum in den meisten Fällen an einem städtischen Zentrum angesiedelt. Die Listen be-legen dabei ein nahezu geschlossenes Netz von jüdischer Regionalorganisation in allen jüdischen Siedlungsräumen des Reiches. Vergleicht man die auf dieser Basis gezeichnete Karte mit dem Befund der jüdischen Regionalorganisation um 300, so fällt auf, dass alle in der frühen Phase nachgewiesenen jüdischen Bezirke in der Mitte des 4. Jahrhun-derts nicht nur vorhanden, sondern in ihrer territorialen Ausdehnung nahezu identisch waren. Der Bezirk Franken entsprach hierbei dem Bezirk der Gemeinde Würzburg, der Bezirk Rhein dem Bezirk der Gemeinde Koblenz. Der jüdische Bezirk in der Wetterau existierte weiter und erscheint nun dem Vorort Fulda zugeordnet. Der jüdische Bezirk um die Gemeinde Worms ist für die spätere Phase kurz vor 350 gut überliefert. Seine territoriale Ausdehnung orientierte sich weitgehend am Einzugsgebiet des Wormser Bis-tums und wir dürfen annehmen, dass dies auch schon um 300 der Fall war. Denn auch im Falle der Gemeinden von Würzburg oder Koblenz sehen wir, dass die Bistumsgren-zen die territoriale Ausdehnung ihrer Bezirke entscheidend mitbestimmten. Auch für die beiden anderen jüdischen Gemeinden der SchUM-Städte Mainz und Speyer, deren Bezirke ebenfalls durch die Martyrologien der Pestverfolgung von 348–50 nachgewie-sen sind, ist weit vor 300 mit solchen Regionen aus angeschlossenen kleineren jüdi-
254
III Das Judentum des Nordens
schen Siedlungen zu rechnen. Für Speyer ist dies anlässlich einer Verpfändung der Ju-densteuer im Bistum 35 auch belegt. Im nördlich benachbartem Erzbistum Köln hat eine jüdische Regionalorganisation in den 90er Jahren ihre Spuren hinterlassen; sie darf spätestens mit dem Privileg Erzbischof Engelberts von Valkenburg aus dem Jahre 266 als gesichert gelten.
Die relative Quellenarmut bezüglich regionaler Organisationsformen der jüdischen Zentren am Mittelrhein mag zunächst überraschen, hat aber einen einfachen Grund: Wie schon erwähnt, basiert unsere Kenntnis von der Vernetzung jüdischer Niederlas-sungen zum größten Teil auf Ortslisten in Memorbüchern. Da aber die drei mittelrhei-nischen Gemeinden Mainz, Worms und Speyer und ihre Tochtersiedlungen bis zu den Pestpogromen von flächendeckenden Heimsuchungen, wie etwa der Rintfleischverfol-gung (298) oder der Armlederverfolgung (336–38) verschont blieben, fehlen vor 348 die Spuren regionaler Organisationsformen in den Martyrologien.
Bezirksorganisation und Steuerwesen
Doch kehren wir zu König Rudolf zurück. Was lässt sich aus den dargelegten Erkennt-nissen für seine Forderungen ableiten? Rudolf wandte sich mit seinen Schreiben offen-sichtlich nicht nur an die jüdischen Stadtgemeinden von Mainz, Worms und Speyer, sondern er schloss in seine Forderungen auch die von den jüdischen Gemeinden abhän-gigen Ansiedlungen ein. Die von König Rudolf beispielhaft vorgeführte Instrumenta-lisierung von jüdischen Organisationsformen hing dabei eng mit dem innerjüdischen Steuerwesen zusammen, dessen Steuerbezirke für die finanziellen Interessen des Königs nutzbar gemacht wurden. Allerdings waren diese Bezirke auch in späterer Zeit auf die einzelnen jüdischen Gemeinden (Kehillot) und deren Einzugsgebiete beschränkt. Rudolf ging offenkundig hier noch einen Schritt weiter und nutzte die überregionalen Struk-turen, zunächst den bekannten Bund der jüdischen Gemeinden Mainz, Worms, Speyer und Oppenheim, aber auch weitere Vernetzungen mit den umliegenden Gemeinden und Regionen, wie z. B. der Wetterau. Dies sollte kein Einzelfall bleiben.
Um das Jahr 290 richtete König Rudolf erneut eine Forderung an die Juden eines bestimmten Adressatenkreises. Chaim Or Sarua (geb. um 240), der Sohn des oben er-wähnten Isaak Or Sarua und Schüler Meirs von Rothenburg berichtet:
Denn als ich ins Rheinland kam, nachdem ich aus Frankreich fortgegangen war, versam-melten sich alle Gemeinden in Mainz. Und anwesend waren mein Lehrer, der Meister Menachem von Würzburg und unser Lehrer, Meister Heilmann und unser Lehrer, unser Meister Ascher und alle Großen, die sich im Rheinland befanden und die Anführer der Gemeinden, denn man musste eine große Steuer dem König Rudolf zahlen, eine Summe von 30.000.15
Mittelrhein: Die Kehillot SchUM um 1300
255
Karte
17: R
egion
alor
gani
satio
n jüd
ische
r Gem
einde
n in d
er er
sten H
älfte
des 1
4. Ja
hrhu
nder
ts.
256
III Das Judentum des Nordens
Zunächst versammelten sich »alle Gemeinden«, – ein nicht näher definierter Begriff – bei der Gemeinde Mainz, die vielleicht, wie in den christlichen Gemeindebünden, die Funktion eines Vorortes wahrnahm. Mit Ascher b, Jechiel aus Köln und Menachem von Würzburg war jeweils ein bedeutender Vertreter von zwei den mittelrheinischen Zentren benachbarten Gemeinden anwesend. Bei den Roschê ha-Kehillot (Anführern der Gemein-den) könnte es sich allgemein um die anwesenden Vertreter irgendwelcher Gemeinden handeln. Andererseits ist es nicht auszuschließen, dass es sich hier gerade um die Vorsteher der SchUM-Gemeinden Worms, Mainz und Speyer handelte. Auf jeden Fall ist von einer Teilnahme der Vertreter der jüdischen Gemeinde Mainz auszugehen, selbst wenn der Ein-ziehungsbereich der Versammlung weit über den rheinischen Raum hinausgereicht haben sollte. Auch spricht nichts gegen die Teilnahme der beiden mittelrheinischen Schwesterge-meinden. Die versammelten Gelehrten und Vorsteher werden den Modus der Verteilung der Steuerlast ausgehandelt haben. Wie kontrovers es dabei zugehen konnte, wird uns in Zusammenhang mit einer weiteren jüdischen Versammlung aus den Tagen Rudolfs deutlich. Chajim b, Jechiel Chefez Sahav (gest. nach 292), Rabbiner von Köln, berichtet um 287, wie es ihm gelang, die Kölner Gemeinde gegenüber »den Gemeinden« von der Zahlung einer Sondersteuer an König Rudolf auszunehmen.16 Bei der tatsächlichen Zah-lung wurde diese Sonderregelung jedoch nicht umgesetzt. Für beide Versammlungen gilt, dass die Gemeinden, die zu Zahlungen herangezogen wurden, eine Abgabengemeinschaft bildeten, in der die bereits vorhandenen Steuerbezirke miteinander verbunden wurden.
Wie wir gesehen haben, waren an der Wende zum 4. Jahrhundert die jüdischen Ge-meinden von Mainz, Worms und Speyer und die ihnen unterstehenden jüdischen Nie-derlassungen in einem jüdischen wie nichtjüdischen Kontext miteinander koordiniert. Kernstücke dieser kommunikativen Netzwerke blieben weiterhin die Bünde der jüdischen Gemeinden wie auch der christlichen Stadtgemeinden in den mittelrheinischen Kathe-dralstädten. Gegenseitige Wahrnehmung war, wie im Falle der Steuerforderungen von Rudolf von Habsburg, mit einer Instrumentalisierung von innerjüdischen Strukturen verbunden. Diese trug durchaus ambivalente Züge. Sie erleichterte zwar die fiskalische Ausbeutung des jüdischen Bevölkerungsanteils der Städte Mainz, Worms und Speyer und ihrer Nachbarn. Andererseits wurden auf diesem Wege die Formen jüdischer Regionalor-ganisation, ausgehend von den Gemeinden am Mittelrhein, Teil eines sich verdichtenden Netzes von Administration und Kommunikation. Auf diesem Wege wurden die regiona-len Organisationsformen der jeweils anderen Gemeinschaft nicht als fremd im Sinne von nicht zugehörig, sondern als Teile eines gemeinsamen Handlungsraumes betrachtet.
Anmerkungen
Isaak ben Moses, Sefer Or Sarua I (862), S. 27b. 2 MGH Const. III, Nr. 388, S. 368 f.
Mittelrhein: Die Kehillot SchUM um 1300
257
3 Mainz: consulibus et universis civibus Maguntinis (ebd., Zeile 28); Worms: consulibus et universis civibus Wormaciensibus (ebd., Anm. a.5); Speyer: Ein Schreiben an die christliche Gemeinde der Stadt Speyer ist nicht überliefert, wohl aber eines an die jüdische Gemeinde, siehe folgende Anm.; Oppenheim: universis civibus de Oppenheim (ebd., Anm. a.2); Wetterau: universis civibus ceterisque fidelibus imperi per Wedreviam (ebd., Anm. a.3).
4 Juden von Mainz: universis Iudeis Maguntinis (ebd., Anm. a.6); Juden von Speyer: Iudeis Spirensibus universis (MGH Const. III, Nr. 389, S. 369, Zeile 2), siehe auch HILGARD (Hg.), Urkunden (895), Nr. 58, S. 8; Juden von Oppenheim: universis Iudeis in Oppenheim (MGH Const. III, Nr. 389, S. 369, Anm. a.2,3); Juden der Wetterau: universis Iudeis per Wederaviam constitutis (ebd., Nr. 388, S. 368, Anm. a.4). Zweifelsfrei wird auch die jüdische Gemeinde von Worms ein gleichlautendes Schreiben erhalten haben, wenn auch nichts dergleichen überliefert ist.
5 omnes Iudeos Spirenses, Wormacienses, Oppenhemenses, Maguntinos ac ... omnes Iudeos Wetrevie (MGH Const. III, S. 369, Nr. 388, Z. 5–6 und HILGARD, S. 9, Nr. 58, Z. 0).
6 Rechtsgutachten des Ascher ben Jechiel (hebr.), Wilna 885, Kap. 42, Abschnitt , S. 40a. 7 MGH Const. II, Nr. 294, S. 409 f. 8 BOOS (Hg.), Quellen zur Geschichte der Stadt Worms I (886) Nr. 252, S. 69. 9 Ebd., Nr. 453, S. 299 ff. 0 universis Iudeis per Wedereviam constitutis (MGH Const. III, S. 368, Nr. 388, Anm. a.4); omnes Iudeos
Wetrevie (ebd., S. 369, Nr. 388, Z. 6). Im Hebräischen als Medinot bezeichnet, was auch mit »Länder« übersetzt werden kann. 2 MGH Const. III, S. 2, Z. 5. 3 Karte 6 basiert auf einem Ausschnitt der Siedlungskarte A 4.4 des im SFB 235 an der Universität Trier
entstandenen Kartenwerks, HAVERKAMP (Hg.), Geschichte der Juden (2002). Zu den »Memorbüchern« vgl. BARZEN, Regionalorganisation jüdischer Gemeinden (2002), S. 293–30; zu den »Rintfleisch«-Verfolgungen den Beitrag von Jörg MÜLLER in diesem Band.
4 Karte 7 stellt einen Auszug dar aus der Karte F 4 desselben Kartenwerks. 5 Rechtsgutachten des Chaim Or Sarua (hebr.), hg. von Jehuda ROSENBERG, Leipzig 865, Nr. 0, S. 34a.
Die der Übersetzung zugrundeliegende korrigierte Lesart des Textes geht auf eine Handschrift zurück. Siehe hierzu ZIMMER, Jewish Synods in Germany (978), S. 6, Anm. 3.
6 BLOCH (Hg.), Responsa of R. Meir of Rothenburg (895), Nr. 24, S. 35b f.
Weiterführende Literatur
APTOVITZER, Introductio ad Sefer Rabiah (938). – BARZEN, »Kehillot Schum« (2003). – BARZEN, Regionalorganisation jüdischer Gemeinden (2002). – BARZEN, BURGARD & KOSCHE, Hierachy (2000). – CARLEBACH, Die rechtlichen und sozialen Verhältnisse (90). – FINKELSTEIN, Jewish Self-Government (924, 972). – GROSSMAN, The Early Sages of Ashkenaz (988) [hebr.]. – GUGGENHEIM, A suis paribus (2003). – KREUTZ, Worms und Speyer (2000). – SCHMANDT, Judei, cives et incole (2002). – YUVAL, Heilige Städte, heilige Gemeinden (996). – ZIWES, Juden im mittleren Rheingebiet (995)
Resumé français
Le 6 décembre 286 le roi Rodolphe de Habsbourg transmit aux communautés juives rhénanes de Mayence, Worms et Spire un écrit conçu dans les mêmes termes par lequel il réclame la cession de tous les biens meubles et immeubles des Juifs ayant fui « en Outremer ». La mention conjointe des communautés juives des trois villes cathédrales du Rhin moyen en même temps que celle des « Juifs de Vetteravie » est remarquable : les hommes de pouvoir non juifs étaient manifestement au fait de formes juives d’organisation régionale
258
III Das Judentum des Nordens
telles qu’elles peuvent être mises en évidence au XIIIe siècle dans la région Rhin-Main-Franconie. Le roi s’adressait ainsi clairement à l’association de communautés du Rhin moyen connue par la suite sous la dénomination de qehillôt Shûm. Le lien particulier qui unissait ces trois centres du judaïsme est démontré dès les années 220 par leurs statuts juridiques communs. Cette « association des villes juives » correspond aux « Ligues Rhénanes » réunissant les cités chrétiennes en l’an 226, 254 et 293 au sein desquelles les cités s’employaient à intégrer les Juifs dans leur propre association.
Le parti que le roi Rodolphe tirait des formes d’organisation juives était intimement lié au système d’imposition interne aux communautés juives, dont les secteurs fiscaux sont ici utilisés au profit des intérêts financiers du roi. Ces secteurs restèrent pourtant restreints aux communautés juives individuelles (qehillôt) et à leur zone d’influence directe. Rodolphe alla apparemment plus loin en tenant compte des structures supra-communautaires, tout d’abord de l’association bien connue des trois communautés, des réseaux de communautés environnantes ensuite. Ce cas ne devait pas rester isolé. On connaît deux réunions des communautés rhénanes à la fin des années 280, au cours desquelles on procéda à la répartition du fardeau immense des impôts extraordinaires du roi entre les diverses communautés. Les liens privilégiés des Juifs de Mayence, Worms et Spire peuvent avoir joué un rôle particulier lors de ces répartitions par rapport à d’autres communautés, comme Cologne par exemple. Les communautés soumises à cette taxation représentent dans leur ensemble une communauté fiscale au sens d’un « réseau » de communautés régionales imposables.
![Page 1: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: ["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042619/63356a48a1ced1126c0ac8ca/html5/thumbnails/11.jpg)