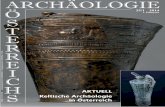“Widersprüchliche Zugehörigkeiten: Arnold Zweig in Ostdeutschland”, Raphael Gross and Monika...
Transcript of “Widersprüchliche Zugehörigkeiten: Arnold Zweig in Ostdeutschland”, Raphael Gross and Monika...
171
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine BuchreiheBegruidet von Walter H. Pehie
E i:1FSCCO19821
Originalausgabe
Zugleich Band 28 der Scbriftenreihe des Fritz Bauer Instituts,
Frankfurt am Main. Studien- und Dokumentationszentrum
zur Geschichte und Wirkung des Holocaust
Veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag,
einemUnternehmen der S. Fischer Verlag GmbH,
Frankfuit am Main, Februar 2013
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
Druck und Bindung: C. H. Beck, Nordlingen
Printed in GermanyISBN 978-3-596-18909-0
Adi GordonWidersprUchliche Zugehörigkeiten:Arnold Zweig in Ostdeutschland*
Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Maclitübernahmen, verlieI der Schriftsteller Arnold Zweig, em bekannter linker Intellektueller und Zionist, das Land. Nach kurzem Aufenthalt in Südfrankreich lie1 er sich im damals britischverwaketen Palästina nieder, im >Neuen Jischuw<<, der Gemeinschaft der Einwanderer, die sich für den Aufbau einer jüdischenNation und eines jüdischen Staates engagierten. Doch nur Wochen nach der Grundung Israels im Mai 1948 reiste Zweigins Nachkriegseuropa, auf Ferienreise, wie er verlauten lief. ImOktober 1948 kehrte er nach Ostberlin zurück, wo er — als der.bei weitem bekannteste jüdische Intellektuelle der sowjetiscienBesatzungszone und der frühen DDR — bis zu seinem Tod 1968blieb. Wenige Jahre nach seiner Rückkehr, 1952, shrieb ihmder deutsch-jüdische Schriftsteller Alfred Döblin, em Kollegemit sehr ähnlichem Hintergrund und Empfindungen:
>>Ich bin ja jetzt seit sieben Jahren in Deutschland und während ich die ersten Jahre die Ernigranten öfter ermutigte zurückzukehren, habe ich sie in den letzten Jahren davor gewarnt [...Jwegen der deutlich und deutlich werdenden Enthüllung desgeistigen Zustandes dieses Volkes nach den 12 Jahren Hitler.Die Wirkung war ungeheuer tief und ware nicht so tief gewesen,wenn sic nicht so gut vorbereitet gewesen ware und am geeigneten Objekt erfolgte. [...J [Die DeutschenJ reden nicht mehr vonder Schande der vergangenen Jahre, sic fühlen sic nicht mehr,sic reden und schreiben nur von der Einigung Deutschlands,und man mü&e em Narr scm, urn nicht zu wissen, was das bedeutet {...].<1
172 Adi Gordon Arnold Zweig 173
Döblin zweifelte nicht nur daran, dass so etwas wie eine
Reeducation und Demokratisierung Deutschlands moglich sei,
sondern sah nach dem Holocaust auf einer personlicheren
Ebene ellen unüberbrückbaren Graben zwischen Juden und
Deutschen. In dieser Hinsicht, betonte er, bestehe kein Unter
schied zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie jedenfalls, Do
bun und Zweig, hätten als jüdische Intellektuelle in Deutsch
land nichts mehr verloren:[DJaf Sie nach mehreren Jahren doch noch hierher zurück
kehrten, erstaunte mich, ich hätte Ihnen gewunscht, Sie hätten
es gelassen. Sie werden hier nichts ausrichten können. Ich sage
es Ihnen mit aller Sicherheit voraus. Lassen Sie sich nicht täu
schen. [...J Sie hätten besser drüben [in Israel, A. G.] bleiben sol
len, dort genau die Sache, die Sie jetzt vertreten, vertreten sollen.
Dort drüben wären Sie em lebendiges und aktives Element, in
Deutschland macht man Sie zu Schutt und Asche.<2In seiner Antwort weigerte sich Zweig, seine Rückkehr zu
rechtfertigen. Döblins scharfen Fragen wich er aus, wischtesie mit unpersonlichen, banalen Phrasen beiseite.3 Gleichwohlübersah er nicht, wie prekar seine Position als bewusster Jude inder DDR war; öffentlich jedoch bestritt er das. Von der offiziellen Parteilinie wich er ab, das betraf unter anderem sein Verständnis des Holocausts und seine Stellung zur Frage der deutschen >>Kollektivschuld<< an den NS-Verbrechen.4 Zweig trat,und das mag erstaunen, wenn man an seine bitteren Jahre in Palästina denkt, beharrlich für den Staat Israel em; dass er sich mitdiesem Staat identifizierte, verheimlichte er selbst dann nicht,als sich die DDR den Gegnern Israels anschloss. Er weigerte sichauch, eine staatlich organisierte Erklarung jüdischer DDR
Burger zu unterzeichnen, in der der Sechtagekrieg verurteiltwurde, worauf Politburomitglied Albert Norden bekanntlichmit der Bemerkung reagierte: >>Arnold Zweig hat rundherauserklärt, dass er mit dem Inhalt der Erklarung prinzipiell nicht
einverstanden sei. Das 1st angesichts seiner althergebrachtenprozionistischen Einstellung nicht erstaunlich. << Norden lagdamit nicht vollig falsch. Betrachtet man die rund zwanzig Jahregenauer, die Zweig in Ostdeutschland lebte, sieht man, dassneben Israelkritischem — wie dem 1962 erschienenen RomanTraum 1st teuer — stets sein unerschütterliches Verständnis fürdiesen Staat und auch die Hoffnung steht, dass beide Staatensich einander annähern.
Zweimal 1st Zweig umgesiedeh: zuerst in den zionistischenJischuw, dann ins sozialistische Ostdeutschland, und hier. wiedort blieben zwei Fragen unbeantwortet, die immer verwirrender werden, je genauer man sich mit seinem Leben beschaftigt:Warum ist er ausgerechnet dorthin gezogen? Und warum blieber jeweils so lange, obwohl er ideologisch in keines der beidenGemeinwesen so richtig passte?
Ich möchte in diesem Aufsatz Zweigs Remigration nach demHolocaust im gro&ren Zusammenhang seiner literarischenund intellektuellen Biographie betrachten, insbesondere vordem Hintergrund seines vierzehnjahrigen Exils in Zion. Dazuwerde ich auf wesentliche Unterschiede zwischen semen beidenOrtswechseln eingehen und nach ihrer jeweiligen Bedeutungfragen. Zweig lebte in einer Welt elnander bekämpfender Ideologien und fühlte sich stets zu ideologisch rigiden Formen derPolitik hingezogen; doch weder seine Emigration noch seine Re-migration lassen sich allein dadurch erklären, dass er einen klaren ideologischen Standpunkt hätte einnehmen wollen. SeineEntscheidungen entsprangen einerseits praktischen Erwägungen im Hinblick auf die jeweiligen Moglichkeiten, schreiben,seine Familie unterhalten und Einfluss gewinnen zu kOnnen, andererseits Fragen der Identität. Zweig war Jude und Deutscherund hat sein Leben lang versucht, die kulturell-geistigen Spannungen zwischen beiden Identitäten aufzulOsen. Dieser Versuchprägte seine schrifrstellerische Entwicklung im wilhelminischen
174 AdiGordon Arnold Zweig 175
Deutschland und in der Weimarer Republik; er stand im Zen
trum seiner Jahre als Exilant im zionistischen Jischuw, in dernnicht toleriert wurde, dass jemand an seiner deutschen Identität
festhielt; und er war nach dem Holocaust das zentrale Problem
in Ostdeutschland, wo Zweig sich eine eigene Sprache schaf
fen musste, urn seine jüdischen Perspektiven, Erinnerungen und
Empfindungen zum Ausdruck zu bringen.
Jüdischer Nationalist und deutscher Schriftsteller:Die Spaltung überwinden
Arnold Zweigs schriftstellerische Karriere begann in der Zeitvor dern Ersten Weltkrieg irn Umfeld des mitteleuropäischenZionismus. >>In den Jahren vor 1914<<, schreibt Wilhelm vonSternburg, >>ist Zweigs Auseinandersetzung mit seinem Juden
turn von seinem Bemühen, sich als Schriftsteller durchzusetzen,nicht zu trennen.<<6 Das aber scheint in sich widerspruchlich:Ging es dem Zionismus, und zwar in alien semen Auspragungen, nicht genau darum, mit der kulturellen >>Assimilation<< derJuden zu brechen? Versuchte er nicht gerade, die Abhangigkeitder modernen Juden von der jeweiligen >>Gast<-Kultur zu begrenzen und letztlich zu beenden? Strebte er nicht nach einerkuhurellen Renaissance des Judischen, ja nach einer hebräischen Renaissance, deren Kern darin bestand, zur elgenen Sprache, Literatur und Kuhur zurückzukehren? War es also für denjungen Zweig nicht em Widerspruch in sich, wenn er behauptete, er sei jüdischer Nationalist und deutscher Schriftstellerzugleich?
Zweig stand mit diesen anscheinend widersprüchlichen Bindungen nicht allein — auch Theodor Herzl, der grc& zionistische Führer, hätte sich gewiss nicht anders definiert. Am gründlichsten wurde die Stellung des jüdischen Autors innerhaib der
deutschen Literatur in der öffentlich gefuhrten >>Kunstwartde
batte<< erkundet. Losgetreten hatte sie Moritz Goldstein 1912
mit dem Aufsatz >>Deutsch-jüdischer Parnass<<, em Jahr später
legte er mit der nicht weniger folgenreichen Schrift >>Begriff und
Programm einer jüdischen Nationalliteratur<< nach. Provokativ
wies Goldstein auf die überproportional starke Präsenz der Ju
den im kulturellen Leben Deutschlands hin: >>Wir Juden verwal
ten den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die Berechtigung
und die Fahigkeit dazu abspricht.<<7 Doch obwohl er Zionist
war, trat Goldstein dem nicht mit dem Vorschlag entgegen, den
Sprung in die neuhebräische Literatur<< zu wagen. Das nämlich
erschien ihm unrealistisch, darum plädierte er für eine >>jüdi
sche Nationalliteratur<< in deutscher Sprache — und nicht in der
hebräischen Nationaisprache.Mit dem Aufsatz >>Zum Problem des jüdischen Dichters
in Deutschland<t vom August 1913 unterstützte Arnold Zweig
Goldsteins Vision einer jüdischen Nationailiteratur in deutscher
Sprache, wobei er dies mit der Perspektive einer neuen, post
liberalen Generation deutscher Juden verband. Postliberal, weil
Deutschsein und Judesein erst im Zeitalter des Liberalismus
als einander ausschliegend begriffen worden seien. Seit damals
habe man sich em imaginäres Spektrum vorgestellt, in dem sich
jeder, der sich dem jüdischen Pol näherte, zugleich vom deut
schen Pol entfernte, und umgekehrt. Dazu Zweig: > [Diesel Idee
des liberalen Menschen — sie ist nicht die unsere. Wir wissen,
da1 eine Birke urn so volliger Baum ist, je mehr sie Birke ist, eine
Eiche aber, je starker sie das Eichenhafte ausdrückt; und
da1, wenn man mittels Abstraktion zu dem Baum an sich zu
kommen gedachte, nicht Baum-, sondern Besenhaftigkeit das
Ergebnis ware.<<8Auch in den meisten seiner frühen literarischen Arbeiten ging
Zweig auf genau diese Fragen em. Viele seiner jüdischen Cha
raktere werden ausdrücklich als >>deutsche Kulturtrager< ge
176 AdiGordon Arnold Zweig 177
zeichnet.9 Protagonist der Erzahlung >> Quartettsatz von Schönberg<< (1913) etwa 1st Eli Saamen, em Musiker, der kurz vorseiner Alija nach Palästina steht, wo er sich em neues Lebenaufbauen will, doch nach einem Konzertauftritt weiI er, dass erEuropa niemals wird verlassen können.19 Zuvor, in den 1911veröffentlichten Aufzeichnungen über eine famitie Klopfer,hatte Zweig die Figur des Peter Klopfer eingefuhrt, einen bekannten deutschen Autor, der ins Land Israel ausgewandert ist.’In der Rahmenerzahlung wird Klopfer von seinem Sohn als emDeutscher vorgestelit, der an die europäische Kultur gebundenist, sich aber zugleich schmerzlich seiner jüdischen Eigenheitbewusst ist. Darum fühlt er sich gezwungen, aus Deutschlandins Land Israel zu ziehen und dort als >>vollstandiger<< Jude zuleben. Genau damit bricht seine doppelte Identität mit all ihrentragischen Unmoglichkeiten auf: Im Land seiner Väter em kultureller Fremdling, führt er em armseliges Leben und begehtschlie1lich Selbstmord, indem er sich in den See Genezarethstürzt. Doch schon der Abschied von Europa und seinem Geburtsland Deutschland, so legt die Erzahlung nahe, hatte einesuizidale Dimension. Auch Klopfers Kinder Heinrich und Miriam, die keine eigenen Familien gegrundet haben, werden aiskuhurelle Emigranten dargesteilt, als Fremde in einem fremdenLand. Zweig legt dem Sohn Heinrich die foigenden verzweifelten Worte in den Mund, als dieser an Jom Kippur in Tiberiasseine Seele sucht:
>>In diesem Volk beginnender Asiaten sind wir die letzten Europaer, losgelost von alien Wurzeln, alien Gesetzen, alien Sitten,unabhangig von allen Wertungen, von keiner Strafe geschreckt,gelockt von keinem Lohne, ohne Reue und Zukunft. Die Zukunft gehort den Asiaten. [...] Ich werde das nicht mehr erleben,aber ich glaube daran. [...j Ich aber bin froh gestimmt, da1 ichnoch von Europas Quellen getrunken habe und niemand michzwingen kann, dies zu vergessen.<<’1
Wie so viele deutsche Juden eriebte auch Zweig den Ausbruchdes Ersten Weltkriegs als letzte Probe auf sein Deutschsein.Auch er versuchte zunächst, seine Mobilisierung für Deutschlands Krieg mit semen Verpfiichtungen ais Jude in Einkiang zubringen und diesen Krieg zu verteidigen, der die jüdische Weltunausweichlich spalten und jüdische Soldaten aus verschiedenen Staaten gegeneinander in Steliung bringen musste. Auf seineWeise teilte er die unter den deutschen Juden verbreitete Oberzeugung, es werde die langersehnte vollstandige Integration befördern, wenn sie sich selbstlos und heroisch für Deutschlandopferten:
>>Ich habe viel, viel neue Gedanken über das Wesen der Nation gehabt, die ich noch nicht fixieren kann. So hat mich dieim tiefsten verbindende Kraft der Kulturgemeinschaft, die mirfrüher nicht so gegeben war, geradezu überfallen. Ich weiss ganzgenau — und Sie wissen, dass das zu meinem Glücke gehort —:
ich nehme meinen leidenschaftlichen Anteil an unseres Deutschlands Geschick als Jude, aufmeine mir eingeborene jüdische Artmache ich die deutsche Sache zu meiner Sache; ich höre nichtauf, Jude zu sein, sondern ich bin es immer mehr, le wilder ichmich freue, je tiefer ich empfinde, je heftiger ich nach Aktivitätdrange. <<12
Zweig verfasste sogar em Buch zur Verteidigung des Krieges,den Band Die Bestie mit sieben kurzen Kriegserzahlungen undzwei zuvor schon veröffentlichten Geschichten über Pogrome.’3Das war einer der Wege, die er wählte, um den deutschen Kriegais einen jüdischen darzustellen. Schiie11ich wurde dieser Krieggegen das antisemitische, >>pogromistische << Zarenreich geführt.Das Inferno von Verdun, der mit dm Krieg auficommende Antisemitismus und die antisemitische >>Judenzahlung<<’4 im deutschen Heer, die unbarmherzige, von Korruption bestimmteBesatzungspolitik der Deutschen im Osten, seine Begegnung mitden Ostjuden in den von Deutschiand besetzten Ländern —
178 AdiGordon Arnold Zweig 179
Zweigs Kriegserlebnisse machten bekanntlich die grof.en Erwartungen zunichte, die er in den Krieg gesetzt hatte: Deutschland war nicht die im Band Bestie beschriebene wohltatigeKriegsmacht, Deutschland dachte nicht daran, die russischenJuden zu befreien. Trotz ihrer Kriegsopfer wurden die deutschenJuden nicht starker integriert, im Gegenteil, mit dem Krieg erstarkte der Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierungnahmen zu, und wie die Judenzahlung vom Oktober 1916 emdeutig erkennen lie1, tat der deutsche Staat nichts, urn seinejüdischen Burger vor den Antisemiten zu schützen.
Noch während seines Dienstes vor Verdun veröffentlichteZweig den makabren Text >>Judenzahlung vor Verdun<, den erMartin Buber beschrieb als >> eine Reflexbewegung unerhörterTrauer über Deutschlands Schande iind unsere Qual, kein Essay, sondern em Bud [...] Wenn es keinen Antisemitismus imHeere gabe, die unertragliche )Dienstpflicht< ware fast leicht.Aber: verächtlichen und elenden Kreaturen untergeben zu sein!Ich bezeichne mich vor mir selbst als Zivilgefangenen und staatenlosen Ausländer. <<15
Einer Freundin schrieb er, das gesamte deutsche Heer sei>>von der hintersten Etappe bus zum vordersten Graben von dengiftigsten und niedrigsten moralischen Fäulnisstbffen durchseucht, und schwor, Rache zu nehrnen mit einem Buch, das dieganze Wahrheit ausbreiten werde16 Tatsächlich sag Zweig imHerbst 1917 über einem >>rachsuchtigen<< Antikriegsstuck, demSchauspiel Der Bjuschew, das 192$ zu seinem groften Erfoigwerden solite. Und er arbeitete bereits an seinem bedeutendstenWerk, dem Roman Der Streit urn den Sergeanten Grischa,der später zum Grundstein seines unvollendeten Romanzykius>>Dergro1e Krieg der weifen Männer<< wurde.
Eine schonungslose Kritik am deütschen Staat, genaüer: anden Deutschen, stand im Zentrurn von Zweigs Arbeiten während der Weimarer Republik. Dabei steilte er einem gnaden
losen und aggressiven Deutschland oft em >>anderes Deutschland<< gegenüber. So handelt der Grischa-Roman vom Zusammenstof zwischen dem aggressiv-autoritaren Generaimajor Albert Schieffenzahn (die Figur basiert unverkennbar auf ErichLudendorff) und dem freundlichen und gerechten General vonLychow, der das a1tpreufische Ideal des Rechtsstaats reprasentiert. Bezeichnenderweise jedoch lässt Zweig den rücksichtslosen Schieffenzahn die Oberhand gewinnen.
Die kritische Distanz zu Deutschland erreichte damit eineneue Stufe in Zweigs Schriften. Während der ersten Krisenjahreder Weimarer Republik schien er grundsatzlich an dieser Repubilk zu verzweifeln. Seine Analyse des wachsenden deutschenAntisemitismus führte ihn zu dem Schiuss, dass die besesseneBeschaftigung mit den Juden und anderen >>inneren Feinden<<in Deutschland em Epiphanomen sei, das in den unterdrücktenErinnerungen an Krieg und Niederlage wurzele.’7 Den Mord anRathenau sah er als typisches Beispie! dafür. In seinem harschen,nach der Tat in der Weltbühne veröffentlichten Artikel nannteer die Deutschen eine >Nation von Mitschu1digen<. >>Ein Judemittleren Formats. Und vie!, viel, vie! zu schade fur dieseNation<<, hei& es dort welter.18 An Martin Buber schrieb er empaar Tage später: >>Ich habe gar nicht gewusst, da1 ich eulerso grenzenlos emporten Scham fur die Deutschen fahig war.<’9Doch selbst in diesem Augenblick tiefer Voreingenommenheithielt Zweig an der Moglichkeit eines anderen, besseren, wahreren Deutschiand lest, lie1 auch nicht ab von seiner Uberzeugung, dass sich Deutschtum und Judentum — insbesondere seinelgenes — weder wechselseitig aussch1össen noch in Konkurrenzzueinander stünden, sich vielmehr gegenseitig bereicherten.
In semen Schriften zu jüdischen und zionistischen Themenlehit der kritische Ton der Artikel gegen Deutschland voliig.Das ostjüdische Antlitz (1920) und Das neue Kanaan (1925)hahen keinen Abstand, sie zeigen nicht dieselbe unparteiisch
180 AdiGordon Arnold Zweig 181
kritische Strenge, sondern sind eher geprägt von der Tendenz,ihren Gegenstand zu idealisieren und sich mit diesern zu identifizieren. Man könnte sich sogar fragen, ob die Idealisierungder jüdischen Gemeinschaft hier nicht nur dern Zweck dient, emunvorteilhaftes Bud der deutschen Gemeinschaft entstehen zulassen.
Aber all das änderte sich ab 1932, nach Arnold Zweigs ersterReise ins Land Israel, und zwar beinahe ubergangslos. SigmundFreud, sein bedeutendster Mentor und em Bewunderer seinesliterarischen Werks, zeigte sich im Hinblick auf Zweigs standhafte Au1erungen zum eigenen Judisch- und Deutschsein rechtskeptisch. >>Meister Arnold<< nannte er Zweig spottisch, unddieser Spitzname zielte ganz sicher auf dessen Bekenntnis zumDeutschsein.2° Doch gegen den jüdischen Nationalismus seinesFreundes hatte Freud nicht weniger Bedenken. Nach Zweigserstem Besuch in Palästina provozierte er ihn direkt: >>[W]iernerkwurdig muf dieses tragisch-tolle Land, das Sie besucht haben, Ihnen geworden sein. [...] Palästina hat nichts gebildet alsReligionen, heiligen Wahnwitz, vermessene Versuche, die äufere Scheinwelt durch die innere Wunschwelt zu bewaltigen,und wir stammen von dort (obwohl sich einer von uns aucheinen Deutschen glaubt, der andere nicht), unsere Vorfahren ha-ben dort [...J gelebt.<<21
Das Buch, das Zweig nun zu schreiben begann, kundigte vielmehr an als nur das Ende seiner Idealisierung des zionistischenUnternehmens. Dieses Buch, De Vriendt kehrt helm, teilte erFreud mit, sei em kleiner Roman, >>der die Ermordung des holländisch-jüdischen Schriftstellers J. J. de Haan in Jerusalem behandelt (1924) und im Anschluf daran den Araberaufstand desJahres [19J29. Das Thema ist alt für mich. [...] Die Reise machteden ahen Plan lebendig, ich skizzierte, einen Monat im Lande,einen ganz brauchbaren, ja faszinierenden Entwurf. Urn allerdings einige 10 Tage spater feststellen zu müssen, da1 er im Ent
scheidenden em Loch hatte: de Haan war gar nicht von Arabernermordet worden, wie ich 7 Jahre geglaubt, sondern von einem
Juden, einem politischen Gegner, einem radikalen Zionisten,den viele Leute im Lande kennen und der noch dort lebt. Ichweif heute, wie furchtbar mich das traf; erst merkte ich es nicht.Ich legte den Grundril meiner Arbeit neu an; das neue Faktumwar weit besser als das alte, es zwang mich, den Dingen ohneprojudisches Vorurteil auf die Haut zu sehen, den politischenMord des Juden am Juden genau so zu beleuchten, ats ware esem politischer Mord in Deutschtand, den Weg der Desillusionwelter zu gehen, so weit als nötig, als moglich — weiter als gut. <<22
De Vriendts dunkles Zentrurn ist nicht allein der politischeMord sellist, sondern es sind die Gesprache, die urn diesenMord und urn die arabischen Aufstände kreien. Zweig legte siezwei Protagonisten in den Mund, die bereits in früheren Textenaufgetaucht waren: Eli Saamen (der Uberlebende des Pogromsaus Zweigs Erzahlung >>Episode aus Zarenland< von 1912)und Heinrich Klopfer (der Sohn des deutsch-judischen AutorsPeter Klopfer aus Aufzeichnungen über elne Familie Klop[ervon 1911), der nun als Mitglied der pazifistischsten unter denzionistischen Organisationen eingefuhrt wird. Beide erkennen —
Klopfer erschrocken, Saarnen stoisch —, dass >am Anfangjeder Staatengrundung em Bruderrnord<< steht.23 Als enthülleer einem naiven Freund die bitteren, aber doch offenkundigenWahrheiten des Lebens, erklärt der Ostjude Saarnen seinem europaischen Frend den Brudermord: >>So einfach vollzieht sichdas [...] wie em Mondaufgang. Und wissen Sie, warum das auchheute wieder vorfällt? Wir werden em Volk, daran merkt manes. Mit semen einzelnen Kindern verfährt em Volk ja verdammtroh — es lagt sie in Massen totschlagen, verkommen, verhungem; vergleiche Weltgeschichte, neuerer Teil. <<24
Dieses Buch von 1932 — eines seiner schönsten — markiertedenn wohi auch das Ende der >>doppelten Buchfuhrung< in
182 AdiGordon Arnold Zweig 183
Zweigs politischen Analysen der jüdischen Welt elnerseits, derdeutschen andererseits. Festzuhahen 1st, dass das Ende seinerIdealisierung des Zionismus zugleich das Ende seines Zionismus uberhaupt anzuzeigen scheint. Wochen später allerdings,als Hitler zum Reichskanzler berufen wurde und Zweig denEntschluss fasste, Deutschland zu verlassen, wählte er, ohnewirkliche Alternative oder lange Uberlegung, Palästina zumZiel seiner Emigration. Erschrocken berichtete Brecht in einemBrief an Helene Weigel: >>Hier am Mittelmeer 1st es langweilig.Ich bin im Hotel La Plage (Sanary). Die Emigration bier ist nichtbesonders angenehm zu sehen. In Paris entsetzte mich Döblin,indem er einen Judenstaat proklamierte, mit eigner Scholle, vonWallstreet gekauft. In Sorge urn ihre Söhne kiammern sie sichjetzt alle (auch [Arnold] Zweig hier) an die TerrainspekulationZion. So hat Hitler nicht nur die Deutschen, sondern auch dieJuden faschisiert. <<25
Zweigs eigene Briefe aus dieser Zeit zeigen gelegentlich seineHoffnungen in Bezug auf die Emigration,26 doch war dieserOptimismus nur von kurzer Dauer. Schon fünf Tage nach derAnkunft in Haifa vertraute er seinem Tagebuch fünf Worte an,die die kommenden vierzehn Jabre zusammenfassen soliten:>>In Palästina. In der Fremde. <<27 Treffend kommentiert Wilhelmvon Sternburg: >>Es gehort jedoch zu den sebsamen Fugungendieses Schriftstellerlebens, da1 Zweig zu einem Zeitpunkt seinen Wohnsitz im neuen Kanaan aufschlagt, als er dem Zionismus bereits ablehnend gegenubersteht und mit zunehmenderSkepsis die jüdische Besiedlung Palästinas betrachtet. <<28
))Unheimlich, wie er hier als Emigrant ebtcc:Deutsches Exil im Gelobten Land
Judische Emigranten und Fluchtlinge aus Nazideutschland erhielten, wenn sie nach Palästina kamen, die einzigartige Möglichkeit, ihre erzwungene Auswanderung umzudeuten; eineMoglichkeit, die in anderen Zielländern kaum bestand. Selbstwenn die meisten von ihnen keine Zionisten waren und eineAuswanderung nach Palästina vor Hitler nicht in Betracht gezogen hätten, konnten sie ihre Emigration nun neu definieren(worm sie vom Jischuw auch bestärkt wurden): nämlich alsAlija, als bewusste jüdische Tat; als eine (womoglich heroische)Entscheidung, ihr Leben zu erneuern, indem sie am Aufbaueiner jüdischen Nation in Palästina mitarbeiteten. Warum aberschlug Zweig, der sch1ieIlich in Deutschland üb’er zwanzigJahre lang Zionist gewesen war, diesen Weg nicht em? Warumdefinierte er sich wedër als jüdischer Fluchtling noch als zionistischer Oleh,29 sondern als deutscher >>Antifascist in Palästina<c ?30
Nazideutschland hatte Zweig ins Exil getrieben, doch das erschütterte — wenn wir semen ersten Publikationen aus diesemExil trauen dürfen — weder seine deutsche Identität noch seineUberzeugung, ganz Jude und zugleich durch und durch Deutscher sein zu können. Das war das Hauptargument sowohl derStreitschrift Die Aufgabe des Judentums, die er zusammen mitLion Feuchtwanger verfasste, wie auch seines eigenen EssaysBilanz der deutschenJudenheit 1933.31 Zweig fasste seine Thesein eine hypothetische Frage: >>Und wie nun gar, wenn sich,wie bei der Tatsache >deutscher-Jude<, die formenden Schichtenso durchdringen und ubereinanderlagern, da die westeuropaische, römische Gesittungsschicht mit der deutschen Lebenskomponente und Geistigkeit em inniges Bündnis eingegangenist, in weichem jüdische Besonderheit [...J und deutsche Kul
184 AdiGordon Arnold Zweig 185
tur seit einem Jahrtausend oder noch langer miteinander verschmolzen sind?x32 Etwa die Hälfte des Essays befasste sich mitden verschiedensten deutsch-jüdischen kulturellen Leistungenund kulminierte in der Feststellung, die moderne deutsche Kultur könne ohne den jüdischen Beitrag nicht verstanden werden.
Kurt Tuchoisky, damals im schwedischen Exil, war besondersirritiert über die Bitanz. Em paar Tage, bevor er Selbstmord beging, schrieb er Zweig dazu einen sehr langen Brief: >>Was sindSie? — Angehoriger eines geschlagenen, aber nicht besiegtenHeeres? Nein, Arnold Zweig, das ist nicht wahr. Das Judentumist besiegt, so besiegt, wie es das verdient {...]. Die deutschenJuden sind verbocht.<<33 Nachetwa drei Jahren NS-Herrschaftverspottete Tuchoisky in diesem Brief nicht nur Zweigs Vorstellung einer würdevollen nationalen Reaktion der Juden, sondernauch sein schmerzlich naives Wunschdenken, das Dritte ReichHitlers lieIe sich irgendwie von einem noch immer existierenden >>besseren Deutschland im Exil<< abgrenzen: >>Aber zumDonner, die Deutschen wollen euch nicht! Sie merken es nicht.[...J Mein Leben ist mir zu kostbar, mich unter einen Apfelbaumzu stellen und ihn zu bitten, Birnen zu produzieren. Ich nichtmehr. Ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenigwie moglich spreche, nichts mehr zu schaffen. Möge es verrecken — möge es Ru1land erobern — ich bin damit fertig.<<34
Als Tuchoiskys Brief bei Zweig eintraf, war der Absender bereits tot, und der Empfanger hatte die Ansichten langst aufgegeben, für die er gescholten wurde. Tatsächlich war, was Zweigin Südfrankreich schrieb, geprägt von einer unbeugsamen Entschiossenheit, dem etwas entgegenzusetzen, was die Nationalsozialisten über die Juden und über Deutschland behaupteten.Doch kaum war er in Haifa, da änderte sich sein Ton. Der ersteBrief, den Zweig aus Palästina an Freud sandte — mit ausführlichen Klagen über die nicht funktionierende Zentraiheizungund die standig auffliegenden Fenster — wird haufig als Beleg
dafür angefuhrt, dass er sich diesem Land und dem Zionismusentfremdet hätte. Ich dagegen sehe in diesem Brief eine — allerdings vorubergehende — Desintegration seiner deutsch-jüdischen Identität, bewirkt durch die Schrecken von 1933 und die>>raue Landung<< in Palästina:
>>Mitten in Haifa, die letzte französische Zigarre rauchend,komme ich endlich dazu, an Sie zu schreiben. [...J Mir selbst,um auch davon noch schnell etwas zu erzählen, geht es imGrunde genommen ungewohnlich gut. Alle meine Depressionen sind verschwunden, die mich die letzten Jahre hindurch oftso entsetzlich qualten. Das Vaterland, der Vater Staat, die Wirtschaftslast, die Sorge um die Erhaltung des Besitzes — all das istvon mir abgefallen und mit ihm viele Verkrampfungen und forcierte Ideengebilde. Ich mache mir nichts mehr aus dem >Landeder Väterc Ich habe keinerlei zionistische Illusionen mehr. Ichbetrachte die Notwendigkeit, hier unter Juden zu leben, ohneEnthusiasmus, ohne Verschonerungen und selbst ohne SEpott.Ich bin dankbar für die List der Idee, die uns als junge Menschenmit diesem merkwurdigen Gebilde hier verband und uns zwang,im Interesse unserer Kinder und jungen Freunde hierherzugehen. Aber Dita und ich sind ebensosehr Emigranten oder ebensowenig wie in Südfrankreich. [...] Ich bin sicher, daf auch dassich wieder normalisieren wird [...j. Nur der Enthusiasmus, aufwohhatige Tauschung gebaut, der ist hin, und ich weine ihmkeine Träne nach.<<35 -
Das Drama, das dieser Brief offenbart, handelt nicht nur vonZweigs Enttauschung über Palästina und die primitiven Lebensbedingungen dort oder von seiner Entfremdung vom Zionismus. Vielmehr zeigt sich darin eine Krise seines Zugehorigkeitsgefuhls, wie er sie bis dahin nicht erlebt hatte. Langsamdämmerte ihm, dass er vielleicht doch nicht zu Deutschland gehörte und auch nicht mehr zu Zion, sondern verdammt war zueiner zutiefst modernen, heimatlosen Existenz, bar aller Trös
786 Adi Gordon Arnold Zweig 187
tungen durch die Zugehorigkeit zu einer Nation. Fast em Jahrwar vergangen, seit Hitler zum Reichskanzler berufen wordenwar, und Deutschland lehnte die Nationalsozialisten nicht ab,erlaubte ihnen vielmehr, ihre Herrschaft auszubauen. Freudhatte schon lange vorher versucht, Zweig >>von dem Wahn [zu]befreien, da1 man em Deutscher sein mui. Soilte man dies gottverlassene Volk nicht sich selbst überlassen? <<36 Bis dahin hatteZweig widerstanden, doch nun, im Exil, gab er offenbar auf.Er war em deutscher Schriftsteller, ausgewandert in eine Gesellschaft, die sich vorgenommen hatte, zur hebräischen Nationalsprache zurückzukehren, und die deshalbden fortgesetzten Gebrauch anderer Sprachen oft recht militant bekämpfte.37 >DieLeute<<, schrieb Zweig, >>verlangen ihr Hebräisch, und ich kannes ihnen nicht liefern, denn ich bin em deutscher Schriftstellerund em deutscher Europaer, und diese Erkenntnis verlangt Konsequenzen.
Diese Erkenntnis — dem bemerkenswert ähnlich, was er 1911in semen Aufzeichnungen über eine Familie Klopfer geschriebenhatte — hat Zweigs Jahre in Palästina unendlich viel mehrgeprägt als die kritischen Schlussfolgerungen, zu denen er 1932mit De Vriendt gelangt war. Zweig war uberzeugt, dass daskulturelle Establishment des Jischuw ihn wegen dieses Buchspolitisch isolierte und boykottierte. Das traf nicht wirklich zu.39Viele Forscher schreiben Zweig eine abweichende zionistischeAgenda zu und nehmen an, dass elne groere Offenheit gegenüber seinem eigensinnigen Zionismus seitens des Jischuw es ihmvielleicht ermoglicht hätte, in Palästina zu bleiben. Auch das 1stunbegrundet und nicht uberzeugend.40 So schrieb der PhilosophHugo Bergmann: >>Arnold Zweig war heute bei mir in der Bibliothek. Unheimlich, wie er hier als Emigrant lebt. Er lebt hiervom Tagebuch. <<41 Ziemlich rasch nach seiner Ankunft in Palästina wurde Zweig kiar, dass er em exilierter Europäer bleibenund niemals em zionistischer Oleh werden würde. Was er zum
Zeitpunkt seiner Ankunft allerdings nicht wissen konnte, war,wie lange es dauern sollte, bis er nach Europa würde zurückkehren können.
Seine Ansichten über Zion und dessen Zukunft haben sichwährend dieser vierzehn ereignisreichen Jahre nicht nennenswert geandert, seine Ansichten über Deutschland dagegenschon. Zweig hat, wie bereits zitiert, Freud gegenuber behauptet, das Exil habe ihn von semen Bindungen befreit (>>all das istvon mir abgefallen und mit ihm viele Verkrampfungen und forcierte Ideengebulde<<). Doch auch hier war er em unglaubwurdiger Erzähler: Die >>Verkrampfungen und forcierten Ideengebilde< blieben. Seit den Anfangsjahren der Weimarer Republikhatte er mit semen antideutschen Ressentiments gekampft unddas auch zum Ausdruck gebracht. Unausweichlich musstendiese Ressentiments (>>forcierte Ideengebilde<<) mit dem Aufstieg des Dritten Reichs und Zweigs erzwungener Auswanderung erneut ihr Haupt erheben. Davon 1st in unzahligen Eriefen an Freud die Rede. So schreibt Zweig etwa: >> [Ich] vermagmich nur schwer von den Haf- und Racheträumen zu befreien,mit denen ich mein seelisches Gleichgewicht wieder herzustellen suche. <<42 Schmerzlich steilt er fest: >>Ja, die Welt 1st, wie sie1st, die Deutschen, wie Deutsche nun mal sind<<, und eben nichtso, wie er stets hoffte, dass sie seien oder sein könnten.43 Dochverschafften bewusste Einsichten seiner Seele keine Erleichterung, und so sei er in psychoanalytische Behandlung zurückgekehrt: >>Ich erde die Hitlerei nicht los. Der Affekt hat sichgegen jemanden umgelagert, die unsere Sachen 1933 unterSchwierigkeiten betreut hatte. Aber mein Affekt ist Besessenheit. Und ich lebe nicht in ‘der Gegenwart, sondern bin>abwesend<. Und meine Arbeit wird breit und saftios und ohneGeheimnisse; und statt in die Personen läuft die Phantasiezwanghaft in sadistische Kriegswunschphantasien aus. Hiersitzt Dr. S., und morgen fange ich an [mit einer erneuten Ana
188 Adi Gordon
lyse; A. G.J. Vielleicht gelingt es ihm {...] an die Queue der Störungen zu gelangen.
Auch wenn er Freud in späteren Briefen berichtete, die >Analyse bei Dr. S., die ich meiner wilden Depressionen und Hafausbrüche wegen nötig fand<< scheme >>gut vorwärtszugehen<,so zeigt sich auch, dass noch em weiteres von Zweigs >>rachsuchtigen Projekten<< von Ressentiments motiviert war: einebiographische Darstellung des Ausbruchs der Geisteskrankheitbei Nietzsche, dem >>Gott meiner Jugend<<.45 Zweigs Absichtwar es, die Aneignung Nietzsches durch die Nationalsozialistenmit wissenschaftlicher Distanz darzustellen und zu zeigen, wieselbsterklärte Nietzscheaner dessen wahre Lehren verzerrtenuñd verkehrten. Nach dem Röhm-Putsch schrieb Zweig anFreud von seinem rachsuchtigen Vergnugen und stelite auch diegeplante Nietzsche-Biographie dar: >>Der Kern meines Plans 1stnatürlich die Moglichkeit, einen antideutschen Affekt so grimmig und total zu entladen, wie er auf keinem anderen Wegegestahbar ist. Auch seine Verachtung gegen den deutschen Antisemitismus, die weltbekannt 1st, macht ihn zum Helden diesesRomans vollig unentbehrlich. <.46 Freud lobte Zweigs Ernüchterung im Hinblick auf die Deutschen .und hielt dessen neuenRoman Erziehung vor Verdun darin für meisterhaft, wie er dienegative Besonderheit der Deutschen darstelle.47
Doch in den späteren dreiiiger Jahren versöhnte sich Zweigschrittweise mit Deutschland; und der einzige Weg, auf demihm das gelingen konnte, war die Idee eines >> anderen Deutschland<< — die Tucholsky im oben zitierten Brief so lächerlichland —, verkorpert in den Foren des deutschen Exils, der Exilliteratur und der Exilpresse, die von New York und Buenos Aires his London und Moskau reichten. 1936 taucht Zweig immerhäufiger im Kontext linker Organisationen exilierter deutschsprachiger Autoren auf. So wird er als Mitglied des Komiteesder Notgemeinschaft deutscher ernigrierter Schriftsteller und
Arnold Zweig 189
des Ausschusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfrontgenannt (neben Johannes R. Becher Lion Feuchtwanger, EgonErwin Kisch, Ernst Toiler und dem Vorsitzenden HeinrichMann) •48 Diese neue Volksfront-Linie ist dokumentiert in vielenseiner Artikel für die Neue Weltbühne (Prag) und das Neue
Tage-Buch (Paris). In diesen Kreisen begann man Zweig als elneArt >>Vorzeigejuden< zu sehen.49
Vorbehalte gegen den Kommunismus und die Sowjetunion,wie Zweig sie in den zwanziger Jahren zum Ausdruck gebrachthatte, waren von ihm nun nicht mehr zu hören. 1937 missbilligte er noch Moskau 1937, das berühmt-berüchtigte Propagandabuch seines engen Freundes Lion Feuchtwanger. Em Jahr
später jedoch, und vermutlich als Reaktion auf die sich verschlimmernde Krise der Appeasement-Politik, entfernte er sich
von den liberalen Vorbehalten, die er während der WeimarerJahre geäufert hatte, und begann den Begriff der Demokratie auf eine Weise neu zu definieren, die der Komintern-Linieimmer mehr entsprach.5° Diese kiare politische Annaherungermoglichte es ihm, seine Bindungen an Deutschland — em zukünfriges Deutschland — wiederherzusteilen. Im Jischuw, daswar ihm langst kiargeworden, gab es für ihn als deutschenSchriftsteller keine Aufgabe und keine Zukunft. Für Zion warer nutzlos, nicht aber, nach dem Ende der Katastrophe, für em
zukünftiges Europa und Deutschland. Die Remigration wurdezur denkbaren Option. -
Erstaun1ichrweise haben auch die ersten Nachrichten überWesen und Umfang des Holocausts Zweigs Vorstellungen überDeutschland nicht wesentlich erschüttert oder ihn dazu gebracht, eine Rückkehr in em von den Nationalsozialisten befreites Deutschland auszuschlie1en. Wahrscheinlich zeigen sichseine Ansichten zur >> deutschen Frage << nirgends deutlicher alsim Orient, der von ihm mitherausgegebenen Wochenzeitung(Haifa 1942—1943). Nicht nur dass sie in deutscher Sprache er
190 Adi Gordon
schien und damit den zionistischen Imperativ der Hebraisierungmissachtete, schlimmer noch: sie diskutierte weiterhin das literarische und kulturelle Leben in Deutschland (was etwa emDrittel des Umfangs ausmachte), während sie das hebräischzionistische Kulturgeschehen in ihrem Umfeld fast vollstandiguberging.
Als die hebräische Presse in Palästina vollig absorbiert warund entsetzt über die ersten Meldungen zum Holocaust,herrschte in Zweigs Orient dröhnendes Schweigen zu diesemThema. Der ausführlichste Artikel dort war Zweigs Aufsatzgegen den >>Antigermanismus<< (der in sieben Fortsetzungen er-.schien), in dem er damals bereits der These der deutschen Kollektivschuld entgegentrat oder diese zu mindern suchte.5’ Mankann sich leicht vorstellen, wie verletzend es für die Menschenim Jischuw in diesen leidvollen Jahren gewesen seIn muss, dasses in ihrer Mitte eine deutschsprachige Wochenzeitung gab,die em Drittel ihrer Beiträge der deutschen Literatur und Kulturwidmete, antideutschen Haltungen entgegentrat und damitzugleich die zionistische Neuorientierung des Jischuw auf provozierende Weise in Frage stelite. Nach elnem Jahr seines Erscheinens, im März 1943, wurde der Orient von semen erbitterten Kritikern im Jischuw endgültig zum Schweigen gebracht.52
Kurz nachdem die Sowjetunion in den Krieg gegen Nazideutschland eingetreten war, erklärte Zweig unmissverständlich, dass er >>am liebsten über Moskau nach Deutschlandzurückkehren<< würde.53 Seine Verhandlungen mit dem kulturellen Establishment des künftigen Ostdeutschfand begannenschon vor Kriegsende. Spatestens 1947 wurde er ausdrücklicheingeladen, nach Deutschland zurückzukehren. Doch wie Geoffrey V. Davis gezeigt hat, reagierte Zweig abwartend und unentschieden auf einen bemerkenswert schmeichelhaften Brief vonErich Wendt, dem Leiter des Aufbau-Verlages, der ihn im Mai1947 erreichte.54 In der ganzen Zeit, in der er insgeheim und
Arnold Zweig 797
vorsichtig über elne Rückkehr nach Deutschland verhandelte,dementierte er öffentlich jedes Gerücht über seine moglicheAuswanderung aus Palästina im Ailgemeinen und eine Rückkehr nach Deutschland im Besonderen. In einem Brief an Ludwig Marcuse erläutert er: >>Ich kann und mag natürlich hier[in Palastina; A. G.j nicht bleiben. Das dan nicht laut werden.Als soiche Vermutungen durch die Zeitungen gingen, 1ief ich sieauf lustige Weise zerstreuen. Es gilt als Landesverrat, wenn ichhier weggehe [...J. Aber weg geh ich, und wohin, das hangt nochin der Luft.
Dieser Brief bestatigt emndeutig, dass Zweig der palastinensisch-zionistischen Offentlichkeit gegenuber nicht die ganzeWahrheit sagte, gleichzeitig aber ist nicht ganz ausgeschlossen,dass sich in diesem Verhalten eine wirkliche Unentschiedenheit zeigte, eine Unsicherheit in der Frage seiner Abreise ausdem Land Israel, seiner Rückkehr nach Europa und gar nachDeutschland. Wie auch immer, dieses Verhaltensmuster behielt er bis zur Abreise und darüber hinaus bei. Als Zweigdann im Sommer 1948 tatsächlich nach Europa zurückkehrte —
nur wenige Wochen nach Grundung des Staates Israel —,
erklärte er, er begebe sich auf eine langere Ferienreise (erschrieb sogar einen offenen Brief an das Bulletin der Israelisaus Mitteleuropa, überschrieben mit >>Ein Schriftsteller nimmtUrlaub<<).
Zweig und seine Frau reisten zuerst nach Prag und bliebendie beiden folgenden Wochen im nahe gelegenen Schloss DobI(damals em Erholungsheim des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes). Ironischerweise skizzierte Zweig dort einesseiner zionistischsten Bücher, das erst posthum, unter demetwas irreführenden Titel Emigrationsbericht oder Warum wirnach Palästina gingen, erschienen ist.56 Im September schickteJohannes R. Becher Arnold Zweig eine offizielle Einladung imNamen des >Kuhurbundes zur demokratischen Erneuerung
192 Adi Gordon
Deutschlands<<. Becher schiug vor, Zweig solle Mitte Oktobernach (Ost-)Berlin zur >>grofen Kulturwoche des Kuhurbundes<<kommen, wo er dem deutschen Publikum durch einige öffentliche Vortrage wieder bekannt gemacht werden würde. Diesmal nahm Zweig an und fuhr — noch immer ohne seine Frauund mit nur wenigen Koffern — nach Berlin. Aus dem geplantenZehn-Tage-Besuch wurden die restlichen zwanzig Jahre seinesLebens.57
PrivHegierter AuBenseiter im Arbeiter- und Bauernstaat
>>Ich wei1 nicht, wann und ob Zweig aus Berlin zurückkommt.Er verhandeft dort in Verlagssachen und auch wegen der Rückgabe des Eichkamp-Hauses. Er sprach einige Male im Radio.In seinem ersten Vortrag wies er als bewusster Jude auf diegroIe Hilfe der SR für den neuen Staat Israel hin und dankte inbewegten Worten dafür, audi für die ihm erwiesene Gastfreundschaft. Am 9. November sprach er allerdings von >unsererHeimat und der Notwendigkeit der Mithilfe an ihrem geistigen Wiederaufbau, was den Eindruck hinterlief, er spreche alsDeutscher. Nun, die Konsequenzen wird er selbst zu tragen haben, das geht uns letzten Endes nichts an. <<58
Dieser Brief, den Ruth Klinger — Zweigs Freundin und ehemalige Sekretärin, die damals als Sekretärin der israelischen Gesandtschaft in Prag arbeitete — an Max Brod schickte, zeugt vonder Verwirrung unter Zweigs israelischèn Freunden, die seineDementis offenbar geglaubt hatten. Klinger dokurnentierteauch die Zwangslage von Zweigs Ehefrau Beatrice (>>Dita<<).Selbst sie, so scheint es, hat nicht wirklich gewusst, wie realdie Moglichkeit einer Rückkehr nach Deutschland war. BeatriceZweig war selbst noch nicht wirklich bereit, Israel zu verlassen.Sie verabscheute, so kurz nach dem Holocaust, die Deutschen;
Arnotd Zweig 193
schon die Yorstellung eines Besuchs in Deutschland schrecktesie, von einer Rückkehr ganz zu schweigen. So war sie volligüberrascht, als ihr Mann, statt nach zehn Tagen zu ihr aufSchloss DobI zurückzukehren, einfach in Berlin blieb und ihrschrieb, sic möge die Sachen packen und zu ihm kommen. Beatrice Zweig erlitt einen Nervenzusammenbfuch.
Es sd eine >>Flucht in die Krankheit<< gewesen, so Klinger, dieeinzige bekannte Person, die >>Dita< urn sich hatte, und Empfängerm taglicher verwirrter Briefe.59 Monate verginen, Arnoldkam nicht zurück, und Ditas Zustand besserte sich nicht. )>Anfang Januar 1949 <<, erinnert sich Klinger, >>stupse ich sic in denZug nach Berlin. Sic winkt mir aus dern Fenster, sic weint bitterlich, während sich der Zug langsam in Bewegung setzt.<<60 DochDitas Zustand besserte sich auch in Berlin nicht: >>Ich gehe hierzugrunde, soviel ist sicher. Das Yolk hat sich nicht geandert,bis auf unseren kleinen Kreis<c6’ Zweig pathologisierte den Zustand seiner Frau und schickte sic in intensive psychiatrischè Behandlung, die em Jahr später offenbar den gewunschten Effektzeigte. Während dieser ganzen Zeit hielt er, zurnindest in semenErklarungen, noch an der Idee fest, dass sic teils in Berlin, teils inHaifa leben würden.
Die von Anfang an unoffene Art, in der Zweig seine Rückkehrnach Berlin in Szene setzte — geradezu kiandestin irn israelischenKontext; gegen die ausdrücklichen Wünsche und Bedürfnisseseiner Frau; ohne die Kinder; stets und gegen besseres Wissenvon der Reversibilität dieser Rückkehr sprechend —, diese unoffene Art 1st bezeichnend. Denn dieses Verhalten errnoglichte esihm, jede Diskussion über seine Rückkehr nach Deutschland zuvermeiden und damit auch nicht erklären zu müssen, warurn erirn Land des Holocausts leben woilte. Könnte es nicht scm, dasser sich so verhielt, weil er schlicht keinen guten Grund hättenennen können, von Lebensunterhalt und Bequernlichkeitenabgesehen,62 warum er und seine Familie in die sowjetisch be-
794 Adi Gordon
setzte Zone Deutschiands zogen? Weder seine Frau noch seineKinder hatten den Wunsch, nach Ostdeutschland zu gehen, undso war seine Rückkehr eng verbunden mit dem Auseinanderbrechen der Familie Zweig.
Es gab einen offensichdichen Gegensatz zwischen Dita ZweigsRemigration und der ihres Mannes. Arnold Zweig war raschund effektiv für das sich herausbjidende kulturelle Establishment der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands gewonnenworden, zuerst und vor allem für den Kuhurbund, dessen Mitglied er schon war, bevor er noch Palästina verlassen hatte. Insehr kurzer Zeit, nahezu übergangslos, wurde der SchriftstellerZweig zum iinientreuen Sprecher des ostdeutschen Staates. Seininternatjonaies Debut in dieser Funktjon muss wohi der Panser Weltfriedenskongress im April 1949 gewesen sein.63 Zweigspielte welter seine Rolle, bezog äu1erst scharf Position gegendie Gegner Ostdeutschiands (vornehmlich gegen den >>BonnerPuppenstaat<<64). Und so wie er semen DDR-Patrjotismus vorsich hertrug, fand er es bekanntlich auch angemessen, zu erkiären: >>Wenn ich sagen soil, was ich bin, so sage ich, ich bin em JaSager. Ich bin em ausgesprochener Ja-Sager, der zurückgekommen ist aus der Emigration in Palästina im Jahre 1948, nachdemsich 1945 [sic!J der Hauptgrund unserer Niederlage [...] hatbeseitigen lassen: die Spaltung den Arbeiterschaft<< — nämlichdurch Grundung der Ostdeutschland regierenden Partei, derSED. Kein Wunder, dass er nach soichen Verlautbarungen alsSchriftsteller gesehen wurde, der sich zur >>politischen Galionsfigure (FnitzJ. Raddatz) hatte machen lassen.65
Die andere Seite von Zweigs Ergebenheit dem ostdeutschenStaat gegenuber war natürlich, dass dieser Staat ihn geradezuumanmte: Vom Tag seiner Ankunft an wunde er mit Ehrungen,Pnivilegien und Posten bedacht. Im Januar 1949 schrieb LouisFurnberg (auch er war zuvor nach Palästina emigriert): >Zweig1st in Berlin und überglücklich [...] Er wird gefeiert und auf
Arnold Zweig 195
Händen getragen. Er hat Gerhart Hauptmanns Nachfolge ange
treten, und man wickeit ihn in Gold und Ehren.<66 Es war eine
stattliche Liste: Vizeprasident des Kuhurbunds (1949), Mitglied
der Volkskammer (1949—1959), Präsident der Akademie der
Künste (1950—1953), Nationaipreis der DDR 1. Kiasse (1950),
Präsident des DeutschenP.E.N.-Zentrums Ost und West (1957),
Internationaler Lenin-Friedenspreis (1958). Doch zwei weitereMoglichkeiten, die ihm der ostdeutsche Staat bot, bedeutetenZweig unendlich viel mehr: eine grole Leserschaft für seine Bu
cher und von allem das Gefühl, in wichtiger Funktion an
der Entnazifizierung, Demokratisierung und Pazifizierung
Deutschlands mitzuwirken. So gesehen verdankte sich Zweigs
Entscheidung für Ostdeutschland — über die Rückkehr in die
deutschsprechende Welt hinaus — einer Mischung aus prakti
schen und ideologischen Erwägungen.Rätseihaft an seiner Rückkehr nach Ostdeutschland alien ist,
dass en ideologisch nicht wirklich dorthin passte: Zweig war Un
verkennbar em Repräsentant der burgenlichen Kultur, intellek
tuell im 19. Jahrhundert verwurzelt; audi sein Stil, seine Art zu
schreiben, war traditionell. Er war niemals Mitgiied den kom
munistischen Partei gewesen und hatte die Sowjetunion in der
Zwischenkriegszeit heftig kritisiert. Noch immer bewunderte er
Freuds Psychoanalyse, die von den Sowjetpsychologie abgelehntwurde; zionistische und liberale Kritik waren em unverzichtba
rer Teil seiner am meisten gefeierten Werke. Diese Besonderheitbnachte Zweighäufig in prekare Situationen, wie sich an den
Ablehnung einiger seiner Bücher zeigt (Freundschaft mit Freud
zum Beispiel), ebenso am Verbot des Films, den auf seinem Ro
man Das Beil von Wandsbek basierte, oder seiner Entfennung
aus dem Präsidentenamt in der Akademie den Künste.67 Einige
Literatunwissenschaftler haben darum begonnen, ihn weniger
als Mitglied des ostdeutschen Kulturestabuishments zu sehen,
sondern eher als dessen Opfer, ja als eine Art Dissident. Einen
796 AdiGotdon
dieser Wissenschaftler, Arie Wolf, spricht sogar von ZweigsMarranensituation in Ostdeutschjand <<•68
Urn Zweig als >>ideologischen Aufenseiter<< zu charakterisieren, wurde viel über seine Weigerung geschrieben, die antiisraelische Petition von 1967 zu unterzeichnen. Sehr viel wenigerdagegen war zu lesen über seine Hahung während der pansowjetischen Prozesse gegen die >>Kosrn6politen<< Anfang derfunfziger Jahre, die offen antizionistisch und verdeckt (aberunverkennbar) antisemitisch ausgerichtet waren: der SlánskProzess, die Moskauer >Arzteverschworung<< und der Prozessgegen Paul Merker. In mehrfacher Hinsicht waren. diese Prozesse wohi eine Herausforderung für Arnold Zweig als intellectuet engage: zurn einen wegen der vielen Jahre und Schriften,die er dem Kampf gegen den Antisernitisrnus in semen verschiedenen Erscheinungsformen gewidmet hatte; zurn anderen wellsich so viele seiner besten Werke
— Ritualrnord in Ungarn(1914), Der Streit urn den Sergeanten Grischa (1927), Das Beltvon Wandsbek (1943) etc.
— iiterarisch mit Justizkritik befassten. Zudem lag nicht viel Trennendes zwischen Zweig und denAngekiagten in den Affären urn Siánsk und Merker.
Viele der Angeklagten im Prager Slánsk-Prozess waren engeKollegen von Ruth Klinger, die so viel getan hatte für ZweigsRückkehr nach Europa. Im Oktober 1953 ermutigte sie ihn,öffentlich für die Angeklagten und gegen den Prozess einzutreten: >>Wer Ihren Catiban [Zweigs Buch über Antisemitismus alspolitische Leidenschaft, A. G.] gelesen hat, weifg wie ich urnIhre profunden Kenntnisse der jahrhunderteatn jüdischenProblerne mit alien ihren Auswirkungen. Sornit glaube ich, da1Sie geradezu berufen sind, gewisse Verwirrungen zu klären, diein letzter Zeit urn sich greifen. <<69 Es gibt jedoch keinen Hinweisdarauf, dass Zweig im Hinblick auf den Slánsk-Prozess irgendetwas getan oder geschrieben hat.
Zweigs Nähe zu den Angeklagten im Merker-Prozess war
Arnold Zweig 197
weniger personlich als sachlich begrundet. Wie Jeffrey Hen
meisterhaft gezeigt hat, ging es in diesem Verfahren nicht urn
>>Spionage für kapitalistische Israelis und amerikanische Impe
rialisten<<, es hatte semen Grund vielmehr in den ostdeutschen
Debatten urn die Erinnerung an den Holocaust, es ging urn von
der Staats- und Parteilinie abweichende Ansichten zur deut
schen Verantwortung und Kollektivschuld und die damit ver
bundene Frage der Entschadigung jüdischer Opfer.7°Weniger als em Jahr vor Paul Merkers erster Verhaftung im
August 1950 brachte Arnold Zweig noch riskantere Positionen
zu Papier als dieser, und zwar in elnem Dokument mit dem Titel
Memorandum, einen Versuch betreffend, die Beziehungen
zwischen dem israelischen und dem deutschen Volke zu verbes
sern<c 71 Darin forderte Zweig >>unsere deutsche demokratische
Republik<< auf, den ersten Schritt zu tun hin zur )>Wiederher
stellung ertraglicher Beziehungen zwischen der Vertretung
Deutschlands und des jüdischen Volkes <<. Er net der >>Regierung
der DDR<< nicht nur, Wiedergutmachung zu leisten an das jüdi
sche Volk >>als Beitrag zur Entschadigung der Opfer des Nazi-
regimes <<, sondern verwies auch ganz selbstverständlich auf den
Staat Israel als den Repräsentanten des jüdischen Volkes. Es gibt
zwar keinen Hinweis darauf, dass Zweig diesen Vorschlag der
politischen Führung in irgendeiner förmiichen Weise vorgelegt
hätte, doch bezeugt diese Denkschrift, die sich in seinem person-
lichen Archiv land, immerhin seine unorthodoxen Ansichten
zurn Staat Israel, zur Frage der Schuld und der moralischen Ver
antwortiig, die (Ost-)Deutschland wegen des Holocausts dem
jüdischen Volk gegenuber hat.Etwas Ahnliches dokumentiert em Brief an Lion Feuchtwan
ger von Anfang 1953. Zweig beginnt ihn mit dern Versuch, die
antisemitische Dimension der Prozesse in Prag und Moskau
herunterzuspielen, schlieft daran aber eine kiare und ausführliche Verteidigung des Zionismus (>>Stiefbrüderchen des Sozia
798 Adi Gordon
lismus<<) sowie em Lob der Israelis an.72 Bemerkenswert 1st, dassZweig Kopien dieses pro-israelischen Schreibens an verschiedene ostdeutsche Zeitungen geschickt hat — mit der Bitte urnVeroffentlichung. Wieder haben wir es mit einem Nicht-Ereignis zu tun, denn die Zeitungen entschieden sich, den Brief bessernicht zu veröffentlichen. Dennoch: Wenn Zweig derart unorthodoxe Standpunkte öffentlich gemacht hat, stelit dies seinBud als konformistischer Ja-Sager in Frage.
So möchte ich zum Schiuss festhalten, dass Zweigs Auflenseitertum nicht nur der Grund für seine prekare Position in Ostdeutschland war, sondern auch genau das, was seine Rernigration für die DDR bedeutsam machte. Eberhard Hilscher hat diessehr gut zusammengefasst: >>Sein Leben kann in vielem als emBeispiel dienen. Namentlich der burgerlichen Intelligenz hat ervorgelebt, wie sie aus ihren wehanschaulichen Krisen herausgelangen kann. Er ist den Weg gegangen vom Idealismus, Zionismus und utopischen Sozialismus zum Materialismus, proletarischen Internationalismus und Marxismus und hat sich bewährtals em Volkserzieher und Humanist. <<73
Als deutscher Schriftsteller hat Zweig vierzehn Jahre inPalästina gelebt und in aller Härte erfahren müssen, dass dieGesellschaft des Jischuw und später der Staat Israel keine Verwendung für ihn hatten. Ganz anders war dies im Deutschlandnach dem Holocaust, insbesondere in der sowjetischen Besatzungszone: Hier bekam sein Anderssein einen Wert, hier demonstrierte es gleichsam die Legitimitat des neuen Staates.Zweig wurde als Repräsentant der burgerlichen Kultur wahrgenommen, der sich die Sache des Proletariats zu eigen gemacht hatte. Als Schriftsteller war er noch immer der Welt vongestern verhaftet, doch lebte er in einem Staat, der sich durchseine Vision der Zukunft definierte. Er war em Intellektuellerin einem Arbeiter- und Bauernstaat, zugleich bewusster Jude ineinem deutschen Staat. Er hatte einen Platz und elne Aufgabe
Arnold Zweig 199
in der DDR — paradoxerweise gerade dadurch, dass er nicht dazugehorte.
Aus den-i Englischen vonKlaus Binder
AnmerkungenDiese Studie wurde ermoglicht durch die Grofzugigkeit des Charles Phelps
Taft Research Center an der University of Cincinnati (Summer Researchfellowship). Ich danke meinen freunden Udi E. Greenberg, Ofer Ashkenazi,Carolina Jessen und Kate Sorrels für ihre wertvollen Hinweise und Ratschlage.1 Döblin an Zweig, 6. 10. 1952, zit. nach Arnold Zweig, Alfred Döblin,>)Briefwechsel<<, in: Neue Deutsche Literatur, Jg. 26, H. 7 (1978), S. 134—143,her S. 139f.2 Ebd., S. 140.
Vgl. Zweig an Döblin, 29. 10. 1952, ebd., S. 140f.Vgl. Thomas Taterka, >>>Alles steht auf dem Spielec UnvorgreiflicheBemer
kungen zum Ort Arnold Zweigs im Holocaust-Diskurs der DDR, in: JuliaBernhard, Joachim Schlör (Hrsg.), Deutscher, Jude, Europaer im 20. Jahrhundert. Arnold Zweig und dasJudentum, Bern 2004, S. 235—252; Alfred Bodenheimer, >>>AufDruckpaPier erzeugte Juden<. Antisemitismus undJudentum imSpätwerk Arnold Zweigs<<,1: Moshe Zuckermann (Hrsg.), Zwischen Politikund Kuttur—Juden in der DDR, Gottingen 2002, S. 132—140.- Zit. nach Hermann Simon, >>Ihnen und der Gemeinde alles Gute<. DerDichter Arnold Zweig — em prominentes Mitglied der (Ost-)Berliner jüdischen Gemeinde<, in: Mark H. Gelbr, Jakob Hessing, Robert Jutte (Hrsg.),Integration und Ausgrenzung. Studien zur deutsch-Iüdischen Literatur- undKulturgeschichte von der fri-then Neuzeit bis zur Gegenwart Tübingen 2009,S.351—366, hier S. 358.6 Wilhelm von Sternburg, Urn Deutschtand geht es uns. Arnold Zweig. DieBiographie, Berlin 1998, 5. 65.7 Moritz Goldstein, >>Deutsch-jüdischer Parnass<c, in: Kunstwart, 1g. 25, H. 11
(1. März 1912), S.281—294, hier S.283. Vgl. Mark H. Gelber, MelancholyPride. Nation, Race, and Gender in the German Literature of Cultural Zionism, Tubingen 2000.
Arnold Zweig, Judischer AusdrucksWitte. Pubtizistik aus vier Jahrzehnten,hrsg. von Detlev Claussen, Berlin 1991, S.40.
200 AdiGordon Arnold Zweig 201
Antisemitismus und gesellschaftliche Ausgrenzung von Juden sind zentraleThemen für Zweig; über die sogenannte deutsch-jüdische Symbiose hat er sichnie Illusionen gemacht. Andererseits treten in seinem Werk als Protagonistendurcliweg Figuren auf, die als Juden zur deutschen Kultur beitragen, und daswiederum zeugt dann doch von der Vorstellung, das Reich der höheren Kulturkönne angesichts der Wirklichkeit sozialer Ausgrenzung so etwas wie eineZuflucht und Antwort bieten. Dieser elitäre Kontext gebildeter Kultur ist es,der die Möglichkeit dessen bot, was Jacob Katz die >neutrale Gesellschaft<<genannt hat. Vgl. Ders., Tradition und Krise. Der Weg der jüdischen Gesellschaft in die Moderne, München 2002.10 Arnold Zweig, >>Quartettsatz von Schonberg<<, in: Ders., Geschichtenbuch, München 1920, S. 203—212.11 Arnold Zweig, Mädchen und Frauen. 14 Erzahlungen, Berlin 1931, 5. 196,S. 197f., Hervorh. A. G.12 Arnold Zweig an Helene Weyl, 27. 8. 1914, in: Arnold Zweig, BeatriceZweig, Helene Weyl, Komm her, wirlieben dich. Briefe einer ungewohnlichenFreundschaft zu dritt, hrsg. von use Lange, Berlin 1996, S. 78, Hervorfi. imOrig.13 Arnold Zweig, Die Bestie. Erzahtungen, München 1914.14 Nach Erlass des Kriegsministeriums vom 11. Oktober 1916, der auf dieantisemitische Propaganda, Juden seien >>Druckeberger<, reagierte und einestatistische Erhebung zum Anteil der Juden im deutschen Heer anordnete.Die Ergebnisse wurden bis Kriegsende nicht veröffentlicht, was die antisemitischen Ressentiments in der Bevolkerung noch verstrkte. 1922 ergab eineUntersuchung, dass anteilig ebenso viele deutsche Juden wie Nichtjuden emgezogen worden waren.15 Zweig an Buber, 15.2.1917, in: Georg Wenzel (Hrsg.), Arnold Zweig1887—1968. Werk und Leben in Dokurnenten und Bildern. Mit unveroffentlichten Manuskripten und Briefen aus dem Nachlass, Berlin 1978, S. 74.
Zweig an Agnes Hesse, 23. 8. 1917, ebd., S. 78.17 Arnold Zweig, >>Rathenau<<, in: Die Welthühne, Jg. 18, Nr. 31(3. 8. 1922),S. 109 f.; wieder abgedruckt in: Zweig,Judischer Ausdruckswille, S. 269—271.
Ebd.,S.271.19 Zweig an Buber, Postkarte vom 8. 8. 1922, Martin Buber Archiv, TheJewish National and University Library, Jerusalem, Arc. Ms. Var. 35, chet930, 3.20 Freud an Zweig, 8. 5. und 18. 8. 1932, in: Sigmund Freud,Arnold Zweig,Briefwechsel, hrsg. von ErnstL. Freud, Frankfurt am Main 1968, S. 51,S.ss.
22 Zweig an Freud, 2.5. 1932, ebd., S. 52 f., Hervorh. A. G.; vgl. auch Zweig
an Freud, 16. 11. 1932, ebd., S.S6ff. Tatsächlich istZweigs Behauptung, er sei
uberzeugt gewesen, den Mord habe em Araber begangen, envas seltsam, well
er bereits 1925, in seiner Untersuchung Das Neue Kanaan, von der Moglich
keit spricht, dass der Mörder em Zionist gewesen sein könne. Vgl. Arnold
Zweig, De Vriendt kehrt heirn. Roman, Berlin 1996, S.278.23 Zweig, De Vriendt kehrt heirn, S. 147.24 Ebd.25 Brecht an Weigel [Sanary, September 1933], in: Bertolt Brecht, Briefe, hrsg.
und kommentiert von Günter Glaeser, Frankfurt am Main 1981, 5. 179.26 Vgl. Manuel Wiznitzer, Arnold Zweig. Das Leben eines deutsch-jüdischen
$chriftstelters, Konigstein/Ts. 1983, 5. 46.27 Zit. nach Jost Hermand, Arnold Zweig. Mit Selbstzeugnissen und Bild
dokumenten, Reinbek bei Hamburg 1990, 5. 74.28 Von Sternburg, Urn Deutschland geht es uns, 5. 180.29 Oleh (hebräisch: Aufsteiger) ist der zionistische Begriff für eine Person, die
>>Alija macht<<, also nach Erez Israel auswandert.30 Arnold Zweig, >>Als Antifascist in Palästina<<, Archiv der Akademie der
Künste, Berlin, Arnold Zweig Archly (AZA), 1195. In Palästina schrieb und
veröffentlichte Zweig ausführlich zum Thema >>Emigration und Neurose<<
und hielt Vortrage darüber. Siehe Arnold Zweig, >>Emigration und Neurose:
Entwurf eines Vortrags in der Psychoanalytischen Gesellschaft, Jerusalemf,
AZA, 1281; Ders., >>Emigration, AZA, 127; Ders., >>The Window Panes,
in: Palestine Post, 2. 2. 1941, 5. 4; Ders., Verwurzelung<, in: Orient, 14
(3.7. 1942), S.sff.31 Vgl. Arnold Zweig, Bilanz der deutschen Judenheit 1933. Em Versuch,
hrsg. von Thomas Taterka, Berlin 1998; Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig,
Die Aufgabe desJudenturns, Paris 1933. Die Aufgabe desJudentums war kein
einheitlicher Text, sondern bestand aus zwei Essays: Feuchtwangers >>Natio
nalismus und Judentum< und Zweigs ))Judischer Ausdruckswille.32 Zweig, Bilanz der deutschen Judenheit, S. $6.33 Tuchoisky an Zweig, 15. 12. 1935, in: Kurt Tucholsky, Ausgewahlte Briefe
1913—1935, hrsg. von Mary Gerold-Tuchoisky und FritzJ. Raddatz, Reinbek
bei Hamburg 1962, 5. 333—339, hier S. 334.
Ebd., S. 3361.Zweig an Freud, 21. 1. 1934, in: Freud, Zweig, Briefwechsel, S. 66ff.
36 Freud an Zweig, 18. 8. 1932, ebd., S.56.3’ Vgl. etwa Tom Segev, Es war emma! em Palästina. Juden und Araber vorder Staatsgrundung Israels, München 2006, S.289.38 Zweig an Freud, 1. 9. 1935, in: Freud, Zweig, Briefwechsel, S. 124.
21 Freud an Zweig, 2. 5. 1932, ebd., S.51.
202 AdiGordon
Zweigs Korrespondenz zeigt eine erstaunlich herzliche Beziehung zwischen ihm und verschiedenen führenden Zionisten und zionistischen Organisationen während der dreiiiger und vierzigerjahre. Er wurde von einer Reihezionistischer Stiftungen unterstiltzt und schrieb regelmajig für die zionistische Palestine Post. Scm Roman Das Beji von Wandsbek erschjen in hebräjscher Ubersetzung im linkszionistischen Verlag Hakibbutz Hameuchad, unddies noch vor der deutschen Veröffentlichung.40 So gut wie alle Wissenschaftler, die sich mit Zweig beschaftigten, habenseine Entfremdung und schlieflich semen Abschied von der Gesellschaft desJischuw als Folge seines eigenwihigen Zionismus verstanden. Doch währendder vierzehn Jahre, die er in Palästina lebte und die so entscheidend waren fürdie Entwicklung des Jischuw, hat Zweig stets nu auf Fehier hingewiesen undniemals eine kohärente Agenda für Palãstina entwickelt und formuliert.41 Hugo Bergman[n], Eintrag für den 6. 3. 1934, in: Schmuel Hugo Bergman,Tagebücher & Briefe 1901—1975, Bd. 1: 1901—1948, hrsg. von Miriam Sambursky, Königstein/Ts. 1985, S. 353.42 Zweig an Freud, 10.2. 1934, in: Freud, Zweig, Briefwechsel, S. 74f.
Zweig an Freud, 23.3. 1934, ebd., S. 79.Zweig an Freud, 23.4. 1934, ebd., S. 84.Zweig an Freud, 6. 6. 1934, ebd., S. 90—93, bier S. 92; vgl. ebd., S. 85.Zweig an Freud, 8. 7. 1934, ebd., S. 95Vgl. Freud an Zweig, 23. 9. 1935, ebd., S. 120f.
48 VgI. Ernst Bloch, Briefe 1903—1975, Bd. II, Frankfurt am Main 1985,S.496; David R.Midgley, Arnold Zweig. Zu Werk und Wandlung 1927—1948, Königstein/Ts. 1980, S. 138.‘ Beim Versuch, einem gemeinsamen Kollegen zu helfen, bat Brecht Zweig,)>sich bei den New Yorker Juden zu verwenden<< (Brecht an George Grosz,Februar 1937, in: Brecht, Briefe, Bd. 1, S. 304). Margarete Steffin wiederumschrieb am 15. Mai 1937 an Zweig über ihre eigenen Erfahrungen in den jüdischen kolkhozy (Koichosen); vgl. Dies., Briefe an berühmte Manner. WalterBenjamin, Bertolt Brecht, Arnold Zweig, Hamburg 1999, S. 241.
Em paar Tage vor Beginn des Unternehmens Barbarossa (des Uberfalls derWehrmacht auf die UdSSR) schrieb Zweig an feuclitwanger, dass die Lageseine Meinung über den Gang der Russischen Kriegspolitik< you bestatige:>>Zuinnerst 1st Ru1land schon jetzt cia demokratjscher Staat, und wer weiI,ob sich das nicht schon nach auIen bewiesen haben wird, wenn dieser Briefankommt.cc (Zweig an feuchtwange 19.6. 1941, in: Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Briefwechsel 1 933—1958, Berlin 1984, Bd. 1, S. 230.) Vgl. ArnoldZweig, >Der Sinn der Demokratje hei&, demokratisches Leben zu ermöglichen<<, AZA, 1188; Ders., >>FünfJahre Hitlerei (17.1.1938), AZA, 1295.
Arnold Zweig 203
Eine Darstellung seiner politischen Wandlung während des Exils findet sich in
Adi Gordon, >>Against Vox Populi: Arnold Zweig’s Struggle with Political
Passions<, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Bd. 38(2010),
S. 133—147.51 Arnold Zweig, >>Antigermanismus: 1933 erlebt<, in: Orient, 20. 11. 1942,
S. 5—8; Ders., >>Antigermanismus: Die Realität dieses Krieges<<, in: Orient,
25. 12. 1942, S. 6—8.52 Frontstellung und Kampf gegen den Orient haben im Jischuw sofort nach
dessen Erscheinen begonnen, innerhaib weniger Monate war audi das Estab
lishment der deutschen Alija beteiligt. Der Kampf wurde gewalttätig: Am
2. Februar 1943 zerstörte eine Bombe die Druckerei des Orients. Es war
dies bereits die vierte Druckerei während der kurzen Existenz der Zeitschrift,
die drei zuvor waren auf die eine oder andere Weise gezwungen worden, die
Arbeit für den Orient einzustellen. Nach dem Bombenattentat gelang es den
Herausgebern gerade noch, eine letzte Ausgabe zu veröffentiichen — es war
das Ende des Orients.5 Zweig an Feuchtwanger, 8. 8. 1941, in: Feuchtwanger Zweig, Briefwech
set, Bd. 1, S.237.Vgl. Geoffrey V. Davis, >>Arnold Zweigs RUckkehr nach Deutschland<<, in:
Ian Wallace (Hrsg.), Aliens — Uneingebürgerte. German and Austrian Writers
in Exile, Amsterdam 1994, S. 11—33, bier S.26.
Zweig an Marcuse, 27. 11. 1946, Ludwig Marcuse Papers, Feuchtwanger
Memorial Library, University of Southern California, Los Angeles.56 Arnold Zweig, Diatektik der Atpen. Fortschritt und Hemmnis. Emigra
tionsbericht oder Warum wir nach Palästina gingen, Berlin 1997.57 Interview mit Arnold Zweig, AZA, 2027.58 Klinger an Brod, 14. 11. 1948, zit. nach “Das nenne ich em hattbares Bünd
nisLx Arnold Zweig, Beatrice Zweig und Ruth Klinger: Briefwechset (1936—
1962), hrsg. von Ludger Reid, Bern u. a. 2005, S. 58.
VgI. ebd., S. 58—61.60 Ruth Klinger, Die Frau im Kaftan. Lebensbericht einer Schauspieterin,
hrsg. von Ludger Held, Gerlingen 1992, S. 367.61 Zweig u. a., x.Das nenne ich em hattbares Bündnis!.x, S. 62.62 Die Zweigs hatten in Palästina jahrelang finanziell zu kampfen, in der
sowjetischen Besatzungszone und auch in der spateren DDR war ihr Lebens
unterhalt gesichert: Die Familie bekam elne Villa, einen Wagen mit Chauffeur
etc. Diese Motive in Zweigs Entscheidung betont Arie Wolf in Gröfle und Tra
gik Arnold Zweigs. Fin jüdisch-deutsches Dichterschicksal in judischer Sicht,
London 1991.63 [Vortrag von] Arnold Zweig von der deutschen Delegation, AZA, 1660.
205
64 Zweig an Feuchtwanger, 20. 10. 1949, in: Feuchtwanger, Zweig, Briefwechsel, Bd. 2, S. 53.Fritz J. Raddatz, Traditionen und Tendenzen. Materialien zur Literatur derDDR, Frankfurt am Main 1972, S. 299.
66 Zit. nach von Sternbuxg, Urn Deutschtand geht es tins, S. 266.67 In den letzten Jahrzehnten haben einige interessante Studien neues Lichtauf vie!e der DDR-Organisationen geworfen, für die Zweig gearbeitet hat:Dieter Schiller, >>Arnold Zweig und die Akademie. Der Präsident 1950bis 1953<<, in: Arthur Tilo Alt u.a. (Hrsg.), Arnold Zweig. Berlin — Haifa —Berlin. Perspektiven des Gesarntwerks, Bern u. a. 1995, S. 120—133; CarstenGansel, Parlarnent des Geistes. Literatur zwischen Hoffnung und Repression1945—1961, Berlin 1996; Wolfgang Schivelbusch, Vor dern Vorhang. Das gelstige Berlin 1945—1948, München 1995; Matthias Braun, Kulturinsel undMachtinstrurnent. Die Akadernie der Künste, die Partei und die Staatssicherheit, Gottingen 2007; Carsten Gansel (Hrsg.), Erinnerung als Aufgabe? Dokurnentation des II. und III. Schriftstellerkongresses in der DDR 1950 und1952, Gottingen 2008.68 Wolf, Graf.?e und Tragik Arnold Zweigs, S. 15.69 Klinger an Zweig, 23. 10. 1953, zit. nach von Sternburg, Urn Deutschlandgehtesuns, 5.291.7° Vgl. Jeffrey Herf, Zweierlei Erinnerung. Die NS-Vergangenheit irn geteilten Deutschland, Berlin 1998.71 Arnold Zweig, >>Memorandum, einen Versuch betreffend, die Beziehungenzwischen dem israelischen und dem deutschen Volke zu verbessern<<, AZA,2116.72 Zweig an feuchtwanger, 24. 1. 1953, in: Feuchtwange; Zweig, Briefwechsel, Bd. 2, S. 200.
Eberhard Hilscher, Arnold Zweig. Leben und Werk, Berlin 1968, 5. 174.
Henning TegtmeYetExodus und HeimkehrErnst Bloch, PhiloSOph der Hofinung
Unter den erausragend Philosophen des 20. Jahrhunderts 1st
Ernst Bloch in leder Beziehung eine usnahmegeStalt, um nicht
zu sagen em krasser, dabei aber höchst prominenter Au{ensei
ter. Das gilt zum einen im Hinblick auf die äu{eren Lebensum
stände. Anders als die Mehrzahl der bedeutenden Philosophen
seiner Generation, anders auch als andere namhafte exilierte
jüdische Philosopherl war Bloch die langste Zeit seines Lebensprivatgelehrtef und Gelegenheitsio1 alist ohne Aussicht auf
elne akademische Karriere. Die erste Professur trat er mit dreiundsechzig Jahren an, in elnem Alter, in dem eine akademischeWurdigung seines Denkens ernunftigerweise nicht mehrzu er
warten war. Doch soliten noch emma1 fast dreifig Jahre akade
mischer Tatigkeit auf diese Berufung folgen.Zum anderen sind auch Blochs Stellung und Ruf innerhaib
der Philosophie die eines Au1ense1tef s — was nicht zuletzt damit
zu tun hat, dass er die Mehrzahl seiner Werke als freier Schrift
steller verfasste, darunter sowohi Geist der Utopie (191$) als
auch sein Hauptwerk Das Prinzip Hoffnung (1959). Auf dras
tische Weise spiegelt sich diese Stellung in den Umständen seiner
Berufung auf den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität
Leipzig im Jahr 194$, wo er die Nachfolge Hans-Georg Ga
damers (oder Theodor Litts)1 antrat, und seiner Einladung zu
einer unbefristeten Gastprofessur in Tubingen 1961 •2 In beiden
Fallen wurde die Ernennung gegen den Willen des Instituts
bzw. des FachbereiChs für Philosophie durchgesetzt, 194$ vom05fldungsminiStef1Um des Landes Sachsen in der sowje
tischen esatzungsZ0ne, 1961 auf Betreiben von Theodof
204 Adi Gordon