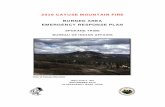Bauen nach der Krise. Die Spoliengalerie an der Apsis der Apostelkirche von Anazarbos
„Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht“. Interview mit Susanne Baer, in: Monika...
Transcript of „Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht“. Interview mit Susanne Baer, in: Monika...
Susanne Baer, Monika Dommann, Kijan Malte Espahangizi
Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht
Interview mit Susanne Baer, Bundesverfassungsrichterin
22 Seiten
DOI 10.4472/9783037346297.0011
ZusammenfassungObwohl Recht auf Wissen zurückgreift und neues Wissen produziert, ist der epistemische
Status von Gesetzen, Gerichtsentscheidungen, Rechtsansprüchen und
Gerechtigkeitsvorstellungen in der wissensgeschichtlichen Forschung bislang wenig
beleuchtet worden. Diese Ausgabe untersucht den breiten Fundus von Wissen, der bei der
Formulierung von Rechts- und Gerechtigkeitsansprüchen ebenso ins Spiel kommt wie bei
Praxen des Anklagens, Ermittelns oder Urteilens. Auf welche Weise und in welcher Form
finden dabei Wissensbestände aus anderen Disziplinen, Gesellschaftssphären und kulturellen
Bereichen Eingang in die Rechtspraxis? Wie wirkt das Recht auf die Fabrikation von Wissen
ein? Und welche Rolle spielen Kriterien und Praktiken der Rechtfertigung, der Zeugenschaft
und der Macht?
SchlagworteGerichtsprozess, Institution
Monika Dommann (Hg.),
Kijan Malte Espahangizi
(Hg.), Svenja Goltermann
(Hg.)
Nach Feierabend 2015
Wissen, was Recht ist
240 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-03734-568-9
ISSN 2235-4654
Zürich-Berlin 2015
Mit Beiträgen vonForensic Architecture,
Susanne Baer, Lauren A.
Benton, Monika Dommann,
Kijan Malte Espahangizi,
Andreas Fischer-Lescano,
Svenja Goltermann, Ruben M.
Hackler, Lucia Herrmann, Otto
Kirchheimer, u.a.
diaphanes eTexT
www.diaphanes.net
197
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht« Interview mit Susanne Baer*
Das Gespräch führten Monika Dommann und Kijan Espahangizi.
Ein regnerischer Montag im Februar 2015. Auf dem Weg zum Interviewtermin mit
Susanne Baer, Bundesverfassungsrichterin und Professorin für Öffentliches Recht und
Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin, überqueren wir meh-
rere Schwellen: zunächst die Schranke an der Pforte am Eingang der Parkanlage,
wo unsere Personalausweise kontrolliert werden. Dann die Sicherheitskontrolle am
Eingang des Pavillongebäudes mit der an Flughäfen üblichen Infrastruktur. Dass die
Verfassungsrichterin uns ein Interview gewährt, ist eine Seltenheit. Das Bundesver-
fassungsgericht wählt seine Kommunikationskanäle mit Bedacht. Der Pressesprecher,
welcher die Entscheidungen der Öffentlichkeit mitteilt, stimmt alle Pressemitteilungen
mit den Richterinnen und Richtern ab.
Dommann: Ich bin Ihnen 2002 erstmals begegnet an einem Kolloquium an der
Humboldt-Universität in Berlin, im Rahmen des Graduiertenkollegs »Codierung
von Gewalt im medialen Wandel«, an dem auch Cornelia Vismann beteiligt war.
Ihren Weg bis zur Verfassungsrichterin habe ich dann aus der Ferne beobachtet.
Ihre Biografie als eine Rechtswissenschaftlerin, die sich sehr stark auf die kultur-
wissenschaftlichen Diskussionszusammenhänge der Gender Studies, der Diskurs-
analyse und der Medienwissenschaft eingelassen hat, finden wir spannend. Inwie-
fern sind Sie von diesem spezifischen Kontext und Wissensmilieu in den 1990er
Jahren in Berlin geprägt oder inspiriert worden?
Baer: Die eigene Umgebung wird wohl meist – gerade als wissens- oder wahr-
nehmungsprägende Umgebung – eher als Normalität hingenommen und nicht
als Spezialität reflektiert. Und doch: Der Kontext Gender Studies an der Hum-
boldt-Universität war und ist zweifelsohne speziell. Zunächst prägt ihn das Neue,
Suchende, Zweifelnde: Die Gender Studies reden tatsächlich darüber, was sie tun
und ob das gut ist, was sie tun, dass sie es so tun, ob sie es weiter tun sollen. Das
* Bei dem folgenden Text handelt es sich um die vollständige und leicht überarbeitete Version
des im September 2015 als Teilabdruck im Merkur – Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken
erschienenen Interviews mit Susanne Baer.
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
198
ist typisch für ein junges Fach, doch dazu kommt bei den Geschlechterstudien der
Zustand als nach wie vor bedrohte Spezies, durch Vorurteile und – seltener – Kri-
tik. Nicht nur die internen Debatten, sondern auch die Dialoge mit anderen sind
dann und deshalb intensiv.
Zudem waren die Gender Studies an der HU sehr stark kulturwissenschaftlich
und nicht in erster Linie soziologisch geprägt wie anderswo in Deutschland. Die
Auseinandersetzung mit den Kulturwissenschaften steht dort in einer nach mei-
nem Eindruck wiederum speziellen, nämlich medienwissenschaftlich-historisie-
renden Tradition und in einer besonderen historischen Konstellation. Die Kul-
turwissenschaften der HU Ost und der politische Anspruch der Umbruchphase
kurz vor dem 21. Jahrhundert: Das waren Ausgangspunkte für eine bestimmte
politische Verortung, in der wiederum ein Interesse an Medialität und Materiali-
tät in der historischen Gewachsenheit und im Umbruch wichtig war. Geschlecht
wurde hier von Anfang an jedenfalls auch als Wissenskategorie verhandelt. Spä-
ter geschah das systematisch über Christina von Braun, Inge Stephan und andere.
Diese Entwicklungen waren, auch für mich, wichtig und anregend.
Biografisch kommen weitere Umbrüche dazu, die das eigene Denken durchaus
prägten: Ich habe Rechtswissenschaft in West-Berlin studiert, also an der FU als
einer Universität der Anti-Gründung zur DDR. Was gegen die Schere im Kopf
entstanden war, lief zugleich Gefahr, als Instrument des Kalten Krieges benutzt zu
werden. Ich erlebte dort in den 1980er Jahren viele Jura-Studierende als angepasst
und unpolitisch und das Studium als wenig intellektuell, manchmal sogar als auto-
ritär. Daher floh ich – aus meiner Sicht – in die Politikwissenschaft und politische
Theorie, damals am Otto-Suhr-Institut (OSI). Ein legendäres – linkes, interdis-
ziplinäres – Institut, für mich aber vor allen Dingen: ein Ort der Kritik, damals
auch der feministischen Politikwissenschaft. Das war sicher prägend. In der Poli-
tikwissenschaft wurden die Fragen gestellt, die das Recht aufwirft: Fragen nach
Macht und Herrschaft. Also musste ich da hin. Später folgte ein vor allem anderen
ermutigender Ausflug in die USA. Die Dinge haben sich also gefügt: Jura studie-
ren als Machttechnik, die Machtfrage thematisiert in der Politikwissenschaft, und
später dann – im medialen Wandel in den Kulturwissenschaften, immer zweifelnd
an den Verhältnissen, im wörtlichen Sinne: kritisch, schließlich mit den Gender
Studies an der HU.
Dommann: Sie haben einen Wandel beschrieben, der uns vertraut ist. Geschichte
ist wie Jura eine sehr traditionelle Disziplin. Ende der 1980er, Anfang der 1990er
Jahre wurde durch die Gender Studies, die Wissenschafts- und Technikforschung
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
199
und die postmodernen Theorieangebote ein wissenschaftlicher Selbstreflexions-
prozess in Gang gebracht, der nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Baer: Bestimmt lässt sich das zeitdiagnostisch beschreiben. Ich bin mir aller-
dings nie ganz sicher, wie viel auch von persönlichen Umständen geprägt wird,
von Zufällen, die natürlich nie welche sind, von Konstellationen. Einer meiner
Brüder arbeitet in der Literaturwissenschaft, zu Zeiten auch mit Derrida. Das war
zunächst der Anstoß für meine Auseinandersetzung mit der Postmoderne. Und
das war die Immunisierung gegen das deutsche Feuilleton, das der Dekonstruktion
bis heute ja oft kritisch gegenüber steht. Ich habe mich nicht von diesem Ressenti-
ment anstecken lassen, weil ich eine andere Prägung an der Seite hatte. Oder auch:
Meine Mutter ging im Alter von sechzig, siebzig Jahren nochmals zur Universi-
tät, hörte Vorlesungen zur Philosophie. Sie hat Texte zur Dekonstruktion gelesen.
Auch das war wichtig. Ein anderer Bruder macht Filme – und dann stellen sich
Fragen nach Medialität beim Abendessen. Eine Schwester ist Historikerin. Und
eine Schwester arbeitet mit obdachlosen Kindern. So findet sich ein Zugriff auf
Machtfragen, der nicht nur theoretisch genährt wird. Diese persönlichen Anek-
doten sind wichtig. Sie werden unterschätzt, aber das kennen wir ja: Das Private
ist eben auch hier (wissens-)politisch. Und diese Anekdoten sind eben in einer
historischen Phase situiert, die meine Erfahrung maßgeblich geprägt hat. Ohne
Brückenbauer, also ohne die Leute, die einem die andere Seite zeigen, hätte ich nie
so denken können.
Dommann: Sie haben Ihre Enttäuschung beim Jurastudium und die Fluchtwege in
die Politikwissenschaft beschrieben und sind dann aber doch wieder in der Rechts-
wissenschaft gelandet und schließlich gar zum Verfassungsgericht gegangen. Was
ist da passiert auf diesem langen Weg? Inwiefern spielt das auf den Fluchtwegen
erworbene Wissen heute bei Ihrer Tätigkeit eine Rolle?
Baer: Es war eine Enttäuschung vom Studierendenmilieu und vom Kanon. Der
Kanon ist überfüllt und dogmatisches Wissen wird als Gesetzeswissen trans-
portiert. Ganz viele Leute, die Jura studieren und irgendwie – Sie verzeihen das
Pathos! – die Welt verändern wollen, sind bitter enttäuscht, weil das Studium ihre
Fragen nach Gerechtigkeit nicht adressiert. Und da fliehen dann manche. Aber es
geht auch anders. Ich habe als Lehrende versucht, den Leuten etwas zu geben: Wo
seid ihr denn mit eurem Idealismus? Ihr kommt doch aus einem Grund hierher!
Und dann: Man geht nicht ans Gericht, sondern wird gewählt. Ich bin für das
Gericht vorgeschlagen und dann gewählt worden – was wahrscheinlich für mich
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
200
selbst die größte Überraschung war. Es passt allerdings zu meiner Entscheidung
für das Recht insgesamt. Das ging mit einer anderen Enttäuschung einher, im Stu-
dium in anderen Fächern: Ich wollte mich nicht in Thesen und Theorien verlieren.
Jura hat einen Korpus, das Material ist definiert. Das hat etwas Verlässliches, was
ich sehr attraktiv fand. Und das Recht, insbesondere gerichtliche Entscheidungen,
aber auch gesetzgeberische Prozesse, sind Brenngläser auf gesellschaftliche Wirk-
lichkeit. Das wollte ich verstehen. Die Art und Weise, wie demgegenüber die Phi-
losophie häufig juristische Entscheidungen nur als Beispiele diskutiert, wird der
politischen Realität nicht gerecht. Und die wollte ich schon als Wissenschaftlerin
kennenlernen.
Dommann: Ich finde es interessant, dass Sie von diesem Material und Korpus
sprechen. Ist die Heuristik der Rechtswissenschaft vielleicht vergleichbar mit der
Geschichtswissenschaft, die sich am Quellenkorpus abarbeitet?
Baer: Das mag sein, nur werde ich jetzt vorsichtig, weil die Gemeinsamkeit mit der
Theologie natürlich näher liegt. Wie dort haben wir in Europa über die kontinen-
tale europäische-römisch-rechtliche Tradition eine ganz stark verwissenschaft-
lichte Diskussion des Rechts, im Recht. Wir arbeiten nicht im Common Law, dem
Fallrecht der angloamerikanischen Tradition, einem im Kern dezisionistischen
Recht, das aber – etwas verschleiernd – »pragmatisch« genannt wird, sondern wir
systematisieren. Das ist Dogmatik und für alle, die sich für Logik, Sprachspiele
und Herleitungen begeistern können, traumhaft. Für mich kommt dazu diese
besondere Mischung aus Systematik und sozialer Realität, dieser Fokus auf den
Konflikt in der Welt, diese Fixierung auf den Unfall oder eben das Unrecht (was
zu unterscheiden wäre), und zugleich dieses ganz fein ziselierte begriffliche Instru-
mentarium, mit dem weiter gedacht werden kann und sollte, und in dem auch
nicht gleich gehandelt werden muss. Wichtig scheint mir auch, dass es da immer
zwei Dimensionen gleichzeitig gibt: das juristische Material im engeren Sinne, als
das Recht, und die Rechtswissenschaft. Und beides hat unterschiedliche Attraktivi-
tätsmomente. Dieses Wissen, was da vor einem liegt, ist sehr heterogen ausgestaltet
und erfordert auch sehr unterschiedliche Techniken in der Kritik. Mir war nur
klar: Es ging darum, das Ganze zu studieren, um es kritisieren zu können. Das hat
sich wohl jetzt ein bisschen geändert. (lacht)
Dommann: Sie haben den Anfang des Jurastudiums erwähnt und den Frust vieler
Studierender, die wieder aufhören. Und Sie haben an vielen Orten gefordert, dass
man eigentlich mehr Rechtssoziologie in das Curriculum einbauen müsste. Die
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
201
Frage ist: Warum Rechtssoziologie und nicht Rechtsgeschichte als eine Art von
Perspektivenerweiterung? Was zeichnet die Rechtssoziologie aus und was verspre-
chen Sie sich von mehr Rechtssoziologie für die Rechtspraxis, aber auch für die
Dogmatik?
Baer: Es könnte sein, dass ich der Rechtsgeschichte nicht gerecht werde, weil ich nie
das Glück hatte, mich mit ihr in einem Maße zu befreunden, wie das wahrschein-
lich erforderlich wäre. Ich bin wohl zudem nur ein begrenzt genuin historisch neu-
gieriger Mensch, weil ich eher aktuell und gern in die Zukunft denke. Das Zurück
ist mir eigentlich nur Quelle für neue Ideen. Wichtiger ist vielleicht: Wenn ich
Rechtssoziologie sage, benutze ich den etablierten Begriff, meine aber interdiszi-
plinäre Rechtsforschung, sonst würde ich ja auch die Kulturwissenschaft ausblen-
den. In der interdisziplinären Rechtsforschung haben die Wirtschaftswissenschaft,
die Kulturwissenschaft, die Politikwissenschaft, die Soziologie im engeren Sinne
ihren Platz – und natürlich auch die Geschichte. Und die Geschichte hat dann, wie
in vielen Fächern, eine historisierende Querschnittsfunktion, aber – so wie auch
die Soziologie – keinen eigenen Stand. Mich interessiert es, alle wichtigen, je nach
Gegenstand mehr oder minder bereichernden Perspektiven auf das Recht und die
Rechtsfragen zu bündeln. Daher würde ich die Frage »Was müsste in der juristi-
schen Ausbildung eine stärkere Rolle spielen?« auf interdisziplinäre Erkenntnisse
interdisziplinärer Rechtsforschung beziehen wollen und da eher nach Maßgabe
von Angemessenheiten votieren. Wenn ein Feld oder eine Problemlage nach His-
torisierung ruft, dann muss auch Historisierung sein!
Espahangizi: Sie haben mehrfach den Wissensbegriff erwähnt. Mich würde inter-
essieren, welche Rolle eine Wissensanalyse in so einer interdisziplinären Rechts-
forschungsausbildung spielen könnte?
Baer: Das ist für mich eine schwer zu beantwortende Frage, weil ich mit der Welt so
konstruktivistisch umgehe. Man müsste dann definieren können, was das Andere,
was Nicht-Wissen wäre. Ihre Frage, so verstehe ich sie jedenfalls, zielt auf eine Aus-
einandersetzung mit den Spezifika von Wissen, Nicht-Wissen, Risiko-Wissen usw.
Diese halte ich für sehr wichtig. Das ist auch der derzeitige Stand der Rechtswis-
senschaft: Es gibt Rechtsgebiete, in denen insbesondere Nicht-Wissen und Risiko
eine erhebliche Rolle spielen und mit behandelt werden müssen. Beispiele sind
das Umweltrecht, das Technikfolgenrecht, das Medizinrecht – also Rechtsgebiete,
wo wir schon wissen, dass wir nicht wissen. Die wissenstheoretische Basis dafür
müsste in den Grundlagenfächern angelegt sein.
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
202
Dommann: Lassen Sie uns nun über Ihre Arbeit am Verfassungsgericht reden. Um
die Anatomie dieser Institution zu verstehen, könnten wissenshistorische Fragen
hilfreich sein. Sie haben die Seiten gewechselt, sind von Berlin nach Karlsruhe
gegangen. Die Rolle einer Wissenschaftlerin an einer Universität ist immer auch
die einer Beobachterin. Was hat sich nun geändert mit dem Schritt ans Verfas-
sungsgericht? Sind Sie noch Beobachterin? Was umfasste eigentlich dieser Rollen-
wechsel? Was haben Sie gewonnen, was haben Sie verloren?
Baer: Als Wissenschaftlerin an der Universität habe ich mich nie nur als Beob-
achterin gefühlt und hielte das auch für einen gravierenden Fehler. Insofern ist
der Rollenwechsel erheblich, aber nicht derart gravierend. Zudem komme ich aus
einem anwendungsorientierten Fach und tue heute ganz praktisch tagsüber etwas
ganz Ähnliches wie zuvor: Ich lese oder schreibe lange Gutachten zu komplizierten
Fallkonstellationen, zu denen am Ende ein überzeugender Text entstehen muss.
Das habe ich an der Universität auch gemacht. Die Voten sind Gutachten zu span-
nenden Fallkonstellationen, die im Grunde sehr langen Aufsätzen oder kleinen
Monografien ähneln. Der Modus hat sich also nicht so stark verändert.
Dazu kommt: Als wissenschaftlich sozialisierte Person geht der Beobachtungs-
modus ja nie verloren. Insofern lebt man auch immer ein Stück weit in der Refle-
xivität des Sich-Selbst-Beobachtens, der Beobachtung des Phänomens, der Beob-
achtung anderer. Ein Verfassungsgericht ist ein besonderer Ort, auch anders als
andere Gerichte. Es liegt aus vielen Gründen nahe, intensiver über die Institution
und das eigene Tun nachzudenken – also auch stark in die Selbstbeobachtung zu
gehen. Dazu werden wir zudem gezwungen, weil wir so sehr unter Fremdbeobach-
tung stehen. Sie kommt jeden Morgen über den Pressespiegel ins Haus. Es wäre
erstaunlich und auch gefährlich, das zu ignorieren. Es ist ein Anreiz, Selbstbeob-
achtung zu betreiben.
Zudem ist sicherlich wichtig: Der Rollenwechsel ist als Berufswechsel in Deutsch-
land nicht komplett, denn der deutsche Gesetzgeber erlaubt neben dem Richteramt
weiterhin die Professur. Manchmal gehe ich an die Universität zurück, halte eine
Vorlesung oder gebe ein Seminar, und diese seltenen Momente genieße ich durch-
aus, denn das ist noch einmal ein ganz anderer Raum der Reflexion. Dann werden
auch die Unterschiede zum Verfassungsgericht ganz deutlich: Am Gericht fehlt die
Freiheit der Themenwahl und die Freiheit der beliebig kritischen Rede. Ich suche
mir nicht aus, wozu ich rede, und ich kann auch nicht so frei reden wie zuvor. Das
gilt sogar im Hörsaal. Ich kann auch nicht so tun, als wäre ich morgen Professorin
und heute wieder Richterin: Das ist, so meine ich, eine kokette Illusion.
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
203
Dommann: Was hindert Sie am vollen Ausschöpfen der Freiheit oder der Kritik?
Ist es das Amt?
Baer: Ich bin als Richterin an eine Regel gebunden, eine gesetzliche Vorgabe, denn
ich falle unter das Gebot richterlicher Zurückhaltung. Es ist eine echte Rechts-
pflicht, mich zurückzuhalten. Ich habe demnach das Beratungsgeheimnis zu befol-
gen, kann also über Interna des Gerichts nach außen nicht sprechen. Daneben gibt
es natürlich die wahrscheinlich sehr viel wirkmächtigere Kultur des Gerichts und
die Tradition, in der sich das bewegt. Zur Kultur des Bundesverfassungsgerichts
gehört, sehr vorsichtig mit der voice umzugehen, mit dem, was man an öffentli-
cher Stimme hat. Als Richterin bin ich Teil einer Institution, die sowieso schon
sehr wirkmächtig spricht – »Karlsruhe!« –, die also neben der Entscheidung von
Konflikten auch vielfache Vorwirkungen und Nachwirkungen entfaltet. Wenn ich
als Einzelperson im Schatten dieser institutionellen Reputation auch noch durch
die Welt laufe und mich äußere, muss ich mir schon darüber im Klaren sein, was
ich damit tue: Es ist die Nutzung einer institutionellen Macht, die mit Bedacht
ausgeübt werden will.
Zudem gibt es die Kultur der Organisation – und eine Kultur vermittelt sich
ja immer merkwürdig informell. Ich deute die Signale so, mich in dubio zurück-
zuhalten. Das ist ein tradiertes Wissen um die Grenzen des Amtes, und das ist
wichtig. Wenn hier also kontroverse politische Themen beraten werden, werde ich
darüber nach außen nicht sprechen. Und da in Deutschland heutzutage damit zu
rechnen ist, dass fast alles, was politisch kontrovers ist, irgendwann im Rahmen
eines Verfahrens nach Karlsruhe kommt, versuche ich, mich gerade zu innenpoli-
tischen Themen, die schon nach Verfassungsrecht rufen, auch nicht zu äußern.
Das reicht bis hin zum Bekanntenkreis. Führe niemanden in Versuchung. Es ist ja
etwas anderes, ob ich sage: »Ja, da habe ich so eine interessante Historikerin aus
Zürich getroffen, die hatte da auch eine Meinung zu«, oder ob Sie sagen »Da habe
ich mit einer Verfassungsrichterin geredet: Also die denkt …«. Das ist ja schon fast
ein Urteil, oder? Und natürlich ist es keins! Wir fällen ja schon keine Entscheidung
allein, wir sind an Regeln gebunden, da gibt es Präjudizien – aber gerüchtefähig
sind Meinungen allemal.
Dommann: Sie halten sich zurück, im Dienste des Rechts, aber Sie entscheiden …
Baer: Ich halte mich zurück im Dienste der Institution – an allererster Stelle. Ihr
»Im Dienste des Rechts« klingt sehr pathetisch … Das ist mir etwas zu groß, denn
für das Recht sind ganz viele zuständig, nicht nur wir. Ich halte mich also zurück,
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
204
um der Institution keinen Schaden zuzufügen. Und ich halte mich zurück, um
das eigene Entscheiden in diesem Haus zu schützen. Wir nehmen uns von innen
ja nicht einfach als starke Institution wahr, sondern auch immer als potenziell
gefährdete Institution. Das Gericht muss darauf achten, gehört zu werden, und es
muss zwar nicht strikt geschlossen, aber doch überzeugend auftreten. Das würde
fehlende Zurückhaltung gefährden.
Espahangizi: Sie sagen, dass die Entscheidungsfindung eben kein individueller
Prozess ist, sondern einer, der kollektiv stattfindet, unter anderem auf richterli-
cher Ebene, aber eben auch im Kontext von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und
anderen Personen, die daran arbeiten. Können Sie die Entscheidungsfindung im
kollektiven Prozess noch weiter erläutern?
Baer: Die Entscheidungsfindung am Bundesverfassungsgericht – und das ist auch
ein Unterschied zu vielen anderen Verfassungsgerichten – ist wohl das Kollektivste,
was ich mir vorstellen kann – und ich konnte es mir nicht vorstellen, bevor ich
hierher kam. Als kritische Rechtswissenschaftlerin hätte ich vieles nicht geglaubt,
was hier geschieht. Es kommt dem, was einige tatsächlich Diskurs nennen würden,
schon sehr nahe. So ist die Auseinandersetzung insbesondere unter den Richte-
rinnen und Richtern im Senat im Bundesverfassungsgericht sehr stark ritualisiert.
Das gilt insbesondere für die letzte Phase der Beratung der großen Entscheidun-
gen; zu acht, ohne Dritte, auch ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber
auch vor diesem Finale liegen ein bis zwei Jahre der ganz intensiven Debatte –
gerade auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – über das Votum, das man
selbst in den Senat bringt, um die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Das
ist die erste Stufe der Auseinandersetzung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind hier nicht clerks, sondern voll ausgebildete Richterinnen und Richter, die es
gewohnt sind, selbst Entscheidungen zu verantworten – also sind das intensive
Gespräche. Und wenn das Votum fertig ist, folgt die sehr ritualisiert-diskursive
Situation in den Senatsberatungen. Daneben gibt es eine dritte Form: die meist
rein schriftliche Aushandlung von Beschlüssen in der Kammer zu dritt. Das prägt
die Mehrzahl der Entscheidungen, aber nicht den Kern dessen, was wir unter »Wie
handelt dieses Gericht?« verstehen würden.
Im Gericht gibt es allerdings auch viele invisible thinkers, hinter denen noch ganz
viele invisible technicians stehen. Wir haben bei der Wiedereinzugsfeier in dieses
Gebäude Ende 2014 mit Hilfe der Kunst versucht, das aufzuzeigen (siehe den Bei-
trag »Maschinenraum des Rechts« im vorliegenden Jahrbuch). Es sollte sichtbar wer-
den, was man nicht zwingend sieht. Wenn ich hier in meinem Dienstzimmer sitze,
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
205
sehe ich die vielen technicians nicht, und ich muss sie über zwölf Jahre hinweg – so
lange dauert meine Amtszeit – nicht wirklich sehen. Aber es gibt ein Gefüge – meta-
phorisch gesprochen – hier unten, irgendwo in den Kellern, in den Seitentrakten,
das dafür sorgt, dass die Akten so sind, wie sie sein sollten, dass eine mündliche
Verhandlung stattfinden kann, dass tausend Dinge geschehen, die ein Gericht in
einem sehr hohen Maße ausmachen. Am Bundesverfassungsgericht nehme ich das
als ausgesprochen geräuschlos wahr – damit ich als Richterin denken kann. Das
ist, wenn Sie so wollen, der Luxus in so einem Amt. Das ganze Gebäude fühlt sich
oft so an, als sorge es im Kern dafür, dass hier sechzehn Richterinnen und Rich-
ter möglichst gute Entscheidungen fällen – und dann fühlt es sich übrigens auch
sehr gut an. Man stört uns möglichst wenig, gibt uns gute Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, schafft möglichst produktive Arbeitsbedingungen, damit wir mit dem
»Kram« nichts zu tun haben. Doch ohne diesen Kram geht gar nichts: Die penible
Aktenführung, die Formalisierung der Abläufe, die Verlässlichkeit der Routinen
produziert einen großen Teil der Rechtssicherheit. Die Rechtssicherheit wird also
sehr stark durch die invisible technicians hergestellt. Die Künstler und die Künst-
lerin haben herausgefunden, dass es allerdings nur einen Gegenstand in diesem
Gebäude gibt, den alle sehen, der alle insofern technisch verbindet. Und das ist ein
rollender Aktenwagen namens »Hund«.
Espahangizi: Wenn man das alles über das Verfassungsgericht hört, dann klingt das
beneidenswert. Vielleicht hätte ich doch Recht studieren sollen. Nun wirkt das aber
auch allzu rund. Ein diskursethisches Paradies, in dem der rationale, wohlgeführte
Diskurs zelebriert wird. Nun wissen wir gerade auch aus der praxeologischen Wis-
sensforschung, dass eben viele Dinge, nicht nur im Sinne der technischen Arbeit,
unterhalb einer gewissen Wahrnehmungsschwelle funktionieren. Man spricht von
Bauchentscheidungen in Entscheidungsprozessen, von richterlichen Körpern, die
im Spiel sind, technischen Figurationen, die eben Dinge vorgeben und damit Ent-
scheidungen präformieren. Sie haben auch das Wort »Gefüge« benutzt. Wo kom-
men dann hier vielleicht doch die weltlichen Machtstrukturen rein?
Baer: Ich kann verstehen, dass das auf Sie so rund wirkt – und es ist doch nicht
ganz so gemeint. Denn die Macht ist hier natürlich überall am Werke. Das Interes-
sante ist mit Blick auf das, was Sie »weltliche Machtstrukturen« nennen, dann eher:
Inwieweit gibt es hier Thematisierungen und De-Thematisierungen? Inwieweit gibt
es Tabus? Inwieweit gibt es Exklusionseffekte? Inwieweit führen bestimmte Tech-
nologien zu Entpersonalisierungen? Natürlich gibt es all das auch hier. Ich würde
wohl sagen – apropos Rollenwechsel –, dass mein Vorwissen in der Soziologie und
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
206
der Sozialpsychologie über Stereotypen, Attribution und »Muster im Kopf«, und
dass auch die medientheoretischen Arbeiten von Cornelia Vismann zum Recht,
also zur Architektur und dem Tisch im Gericht, mir helfen, die Prozesse am Ver-
fassungsgericht zu verstehen.
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben zu Ihrer Frage nach den Körpern: So wird hier
versucht, die physische Durchhaltefähigkeit als Faktor in Entscheidungsprozessen
zu minimieren. Das Gericht pflegt gewisse ganz höfliche, nicht-explizite Mittel
und Wege, um zum Beispiel körperliche Fitness der Beteiligten nicht durchschla-
gen zu lassen. Wir beraten sehr ordentlich, was Zeit und Raum betrifft, und gehen
eher behutsam und pfleglich mit uns um. Das fällt – zum Beispiel im Unterschied
zu Gepflogenheit in der Wissenschaft – hier durchaus auf. Demgegenüber trifft
vermutlich alles, was sich aus der Geschlechterperspektive über Gruppenzusam-
mensetzungen sagen lässt, auch auf ein Gericht zu – selbstverständlich gibt es auch
hier Geschlechterstereotype und geschlechtertypisches Verhalten. Gerichte waren
lange Institutionen ohne Frauen, oder treffender: männlich monokulturell. Das
hat sich geändert. Ich arbeite derzeit in einem Senat mit zwei Frauen, im zweiten
Senat arbeiten aktuell drei Richterinnen. Manche empfinden schon das als sehr
hohe Zahl – fünf von sechzehn! Interessanter ist es, nun genauer zu fragen: Was
trägt dazu bei, dass etwas durchschlägt oder nicht durchschlägt – ein Thema, eine
Sichtweise, eine Erfahrung?
Auch die berühmten roten Roben spielen eine Rolle. Es heißt, dies seien angeb-
lich Theaterkleider, nach einem Schnitt für die Bühne gefertigt, auch wenn sich das
so genau nicht nachweisen lässt. Jedoch: Es ist nicht einfach ein Kostüm. Die Robe
mit dem Hut hebt das Gesicht hervor und lässt den Rest verschwinden. Das heißt
beispielsweise: Ob der Anzug darunter teuer ist oder nicht, spielt keine große Rolle.
Das ist gewiss nicht klassenlos, aber es egalisiert bestimmte Faktoren, zumindest
in Richtung Außenwelt, denn wir tragen die Roben nicht, wenn wir miteinander
beraten. Dann wirkt nicht Kleidung, sondern es greift die egalisierende Arbeits-
kultur. Die Beratung ist der besondere Tag – so wache ich auf –, niemand kommt
auch nur eine Sekunde zu spät, notfalls auch krank, wenn man nicht gerade halb-
tot umfällt, man ist gut vorbereitet, aufmerksam, versucht, die Gegenpositionen
zu verstehen. Das gelingt nicht immer, aber der Anspruch prägt den Stil. Ein wei-
teres Detail: Technisch gibt es keine Laptops im Beratungszimmer. Wir arbeiten
viel mit Bleistift. Da hätte Cornelia Vismann ihre Freude gehabt: Der Bleistift hat
als Technologie natürlich tatsächlich Wirkung. Arbeiten Sie mit Bleistift? Es ist
eben speziell: das Radieren, das Ausstreichen, und dass letztlich sichtbar bleibt,
was radiert und ausgestrichen wurde.
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
207
Sie könnten das Gericht also so sehen: Hier entscheiden sechzehn Leute, je acht
Richterinnen und Richter in einem Senat. Das sind angesichts der Last der Verant-
wortung sehr wenige Menschen und wir verbringen sehr viel intensive Zeit mitei-
nander. Wir haben uns auch nie ausgesucht, miteinander zu arbeiten. Das ist nicht
der Kollege, den ich gewählt oder berufen habe, sondern sie oder ihn hat der Bun-
destag oder der Bundesrat geschickt. Wir kommen gezielt aus unterschiedlichen
politischen Kontexten, haben unterschiedliche biografische Hintergründe. Es sind
letztlich bürgerliche Höflichkeitsrituale, die hier dazu beitragen, Dinge sagbar und
einiges auch unsagbar zu machen.
Dommann: Darf ich bei den Ritualen nochmals nachhaken? Könnten Sie uns die
wichtigen Rituale erklären?
Baer: Die Rituale, die hier im Haus gepflegt werden, gehören nicht nach außen.
Es gibt bislang auch nur eine gute Studie über das Leben »hinter dem Schleier des
Beratungsgeheimnisses« – die Arbeit von Uwe Kranenpohl. Sonst finden Sie dazu
nichts und auch das hat seinen Sinn. Diese Rituale sind für unsere Arbeit mitein-
ander wichtig und sie machen viel davon aus, was sich als Qualität dieses Hauses
beschreiben lässt. Aber sie sind zutiefst vertraulich. Das ist auch so, um sanfte Ver-
schiebungen zu erlauben. Es sind eben Rituale, keine oktroi. Es gibt kein Hand-
buch des Handelns eines Verfassungsrichters, und ein Ritual ist über Persönlich-
keiten verschiebbar. So hatte ich nie das Gefühl, unterworfen zu sein. Es ist eher
das Gefühl, mich hineinzubegeben, und dann beginnt man meist ganz unbewusst
zu schieben und das ganze Gefüge verändert sich mit einem selbst. Da ähnelt wohl
manches eher einer Familienaufstellung.
Dommann: Einerseits beschreiben Sie das Gefüge des Verfassungsgerichtes als
Selbstverständlichkeit. Andererseits haben Sie von einer immer gefährdeten In-
stitution gesprochen. Wie kann eine Institution selbstverständlich und gefährdet
zugleich sein?
Baer: Ein Verfassungsgericht ist auf gewisse Weise eine unglaubliche Erfindung
einer Demokratie, weil so wenige Menschen Mehrheitsentscheidungen demokra-
tisch gewählter Parlamente und oft auch Referenden, also Volksabstimmungen,
kontrollieren. Insofern stellt ein Gericht mit solchen Befugnissen eine dauernde
politische Zumutung dar. Und mit dieser Zumutung muss die Institution entspre-
chend vorsichtig umgehen. Das gilt natürlich für alle Beteiligten. Eine kritiklose
Zeit für das Verfassungsgericht wäre eine schlechte Zeit für das Verfassungsgericht,
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
208
aber zu weit darf Kritik nicht gehen. Ein Verfassungsgericht ist also eine Institu-
tion, auf die geachtet werden will. Sie könnten auch sagen: Das sind im Kern sech-
zehn Leute, mehr nicht. Und hier bedeutet das: Wir alle müssen im Hinblick auf
die Wirkung jeder einzelnen Entscheidung und jedes Auftritts in der Öffentlich-
keit darauf achten, wie, wo, was nach außen wirkt. Auch deshalb sind die Interna,
die allerdings nicht zuletzt für abgewogene, wirklich durchdachte Entscheidungen
sorgen, nach außen nicht bekannt.
Die Schnittstellen zwischen innen und außen sind die mündlichen Verhand-
lungen und die Verkündung der Entscheidung, das wieder in den roten Roben.
Deshalb sind die Roben auch so ein focal point – sie markieren diesen Schnitt-
punkt. Die roten Roben verbergen die Rituale, aber sie schützen sie damit auch.
Das ist ein Teil ihrer Funktion. Nach innen schützen die Rituale auch vor Vor-
urteilen und vor dem politischen Machtargument. Wir müssen hier große Fragen
entscheiden, aber doch beschränkt auf Verfassungsrecht. Wie sichern Sie das ab?
Nehmen wir das Beispiel des Existenzminimums für Asylbewerber: Das ist eine
hochkontroverse Frage, zu der alle Richterinnen und Richter natürlich auch eine
Meinung haben, zu der einige von uns vermutlich auch schon gearbeitet haben,
was oft sogar dazu beitrug, dass sie für dieses Amt in Betracht kamen. Wie füh-
ren wir nun ein Gespräch darüber, das nicht nur subjektive Präferenzen abbildet,
sondern sich tatsächlich an die Verfassung bindet? Hier helfen eben Rituale. Sie
tragen dazu bei, dass alle in dem Moment wissen: »Du bist jetzt nicht als politisch
interessierte Bürgerin, Wissenschaftlerin, Denkerin oder was auch immer gefragt.
Du bist jetzt als Verfassungsrichterin gefragt und deshalb betrittst du diesen Raum
hier ganz pünktlich und ordentlich angezogen und begrüßt alle mit Handschlag
und gehst höflich, bei uns auch gar nicht selten herzlich, miteinander um«. Das ist
ein Rollenwechsel und es erleichtert eine Filterung der Argumente und auch des
Wissens, das jetzt eingespeist werden kann und soll. Darin liegt die Funktion der
Rituale.
Espahangizi: Kann ich noch einmal nachfragen, was die besondere Bindungskraft
dieser Rituale ausmacht? Wir haben jetzt auf der einen Seite die Rituale im Klei-
nen, die das Funktionieren ermöglichen. Und dann wölbt sich über dem Verfas-
sungsgericht aber auch »der weite blaue Himmel der Rechtskraft«. Die Frage ist:
Wie spielt die große Verantwortung der letzten Fragen, mit denen sich das Ver-
fassungsgericht befasst, in die Möglichkeit und Anschlussfähigkeit von diesen klei-
nen Ritualen hinein? Was hält diese verschworene Gemeinschaft im Rechtsalltag
zusammen?
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
209
Baer: Das ist eine schwierige Frage und meine Antwort fällt ja auch zurückhaltend
aus, weil die Rituale eben nicht nach außen gewandt sind. Zunächst aber zum
Himmel über dem Gericht: Ein Verfassungsgericht ist, wie jedes andere Gericht
auch, nie wirklich die letzte Instanz. Das ist eine allerdings nicht ganz unwichtige
Illusion. Die endgültige Klärung aber erfolgt hier nicht. Eine verfassungsgerichtli-
che Entscheidung ist eine, wenn auch wirkmächtige, Intervention in einem langen
Prozess, aber dann geht es wieder weiter und wieder los. Natürlich ist die Ent-
scheidung nicht zu unterschätzen und die Macht steckt ebenso wie die Verantwor-
tung – als ihr Korrelat, wenn nicht ihr Ausdruck – in jeder Pore des Geschehens
im Gerichtsalltag. Nicht alles diffundiert in das Rituelle. Wir sprechen intensiv
über Entscheidungsfolgen, also durchaus auch darüber, was wir tun und was wir
bewirken, oder aber lassen sollten. Zudem bereiten wir für eine Entscheidung ja
unglaublich viel Kontext auf, auch Geschichte als Regelungsgeschichte und Kon-
fliktgeschichte, weil wir wissen wollen, was wir tun. Wir sind, wenn Sie so wollen,
ein grübelnder Verein. Nur muss dieser grübelnde Verein irgendwann auch ein-
mal zum Punkt kommen, braucht also auch einen Modus, der dazu zwingt, das
Grübeln zu beenden. Das sind Formalitäten und eben auch Rituale.
Dommann: Wie schätzen Sie die Strahlkraft des Verfassungsgerichts ein? Dies
auch vor dem Hintergrund, dass gerade gegenwärtig in der Schweiz die Frage des
Zusammenspiels zwischen nationalem Recht und Völkerrecht kontrovers disku-
tiert wird?
Baer: Die Internationalisierung und Transnationalisierung von Verfassungsrecht
ist in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, ein immer wichtigerer Faktor
geworden. Das war früher nicht so. Heute wird auch im Hinblick auf die EU und
das Straßburger Rechtssystem votiert, wenn nicht sogar in Hinblick auf das interna-
tionale Recht der Vereinten Nationen. Es wäre ja auch erstaunlich, wenn das Recht
das einzige Feld wäre, das von der Globalisierung nicht erreicht worden wäre. Alles
ist globalisiert und transnationalisiert – warum dann nicht auch wir? Insofern ist
transnationaler Rechtspluralismus zunächst eine Zustandsbeschreibung: Das ist
die Zeit, in der wir leben, und damit muss sich auch ein Verfassungsgericht ausein-
andersetzen. Die Folge ist: Es entscheiden mehrere Gerichte. Renate Jaeger, die als
Richterin hier und am Straßburger Gerichtshof gearbeitet hat, sprach in Hinblick
auf das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Gerichte von einem Mobile. Das
ist ein interessantes Bild. Ich würde beim Mobile natürlich immer fragen: Woher
kommt denn der Wind, der das Ganze bewegt? Und das ist gar nicht leicht zu
beantworten. Zudem ist das Modell für Richterinnen und Richter auch schwie-
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
210
rig: Es ist keine Hierarchie, keine letzte Entscheidung, was die Rechtssicherheit
gefährdet. Praktisch taucht die Schwierigkeit der Fragmentierung allerdings nur
selten auf: Der allergrößte Teil der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
wird weiterhin besten Gewissens nach dem deutschen Grundgesetz und nur dem
deutschen Grundgesetz getroffen. Nur in wenigen Fällen kommt es zu ernsthaften
und schwierigen Fragen in der Auseinandersetzung mit internationalen und trans-
nationalen Rechtsordnungen. Es werden allerdings mehr.
Ich sehe Trans- und Internationalisierung weder als Bedrohung noch als nur
positive Chance, sondern als Herausforderung, mit der wir umgehen müssen.
Historisch gesehen ist es ein unglaublicher Erfolg, in einem Rechtsraum meh-
rere Gerichte zu haben, die sich um Grund- und Menschenrechte kümmern. Das
darf man nicht vergessen. Denn worum geht es denn hier? Es geht doch nicht um
institutionelle Eitelkeiten, die uns viele gern unterstellen, um ein »Jetzt habe ich
nicht mehr alleine das Sagen«. Sondern es geht darum, dass wir uns in Europa weit-
hin einig sind, dass es Rechtsschutz gegen dieselben Unrechtstatbestände geben
muss. Wunderbar! Und wo wir unterschiedlich denken, müssen wir kooperieren,
durch intensives Gespräch.
Espahangizi: Inwiefern kann man sagen, dass das Bundesverfassungsgericht dann
trotz dieses Mobile-Modells eine Art role model ist, ein Exportschlager vielleicht
sogar?
Baer: Das Bundesverfassungsgericht ist – aus der Perspektive vergleichenden Ver-
fassungsrechts – im Moment vermutlich sehr einflussreich und das hat Gründe.
Ein Grund liegt darin, dass der Supreme Court der USA, der lange the leading
court of the world war, sehr stark an Reputation verloren hat. Die Gründe dafür
sind ebenfalls komplex. Ein Teil der Reputation hängt an der Institution selbst, ein
Teil aber auch an der Nation. Gerichte verlieren auch immer mit den Ländern, in
denen sie zu Hause sind. Die Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts hat wohl
auch etwas mit der Stellung Deutschlands in der Welt zu tun. Das Schweizerische
Bundesgericht hat folglich auch einen guten Ruf. Nur ist es als internationales Ver-
fassungsgericht bislang nicht präsent.
Ein zweiter Faktor für das Interesse an Karlsruhe ist sicherlich, dass Deutsch-
land historische Erfahrungen gemacht hat, die viele Länder sehr interessieren. Das
betrifft Umbruchsituationen wie die Wiedervereinigung: Wie sind wir damit umge-
gangen? Es betrifft auch die Situation nach 1945: Wie hat es ein Land geschafft, von
einer Diktatur und einer totalitären Staatsform als Gesellschaftsform zu einer der
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
211
großen Grundrechtsdemokratien zu werden? Da scheint eine Lektion zu stecken,
für die sich Menschen interessieren.
Dazu kommt, dass wir, weil wir uns mit der kontinentalen Rechtstradition ver-
bunden fühlen, unsere Urteile sehr systematisch begründen. So ließen sich sehr
deutliche dogmatische Linien entwickeln. Manche kritisieren das, denn es sei
»gebetsmühlenartig« – aber das ist auch verlässlich und explizit. Wir sind insofern
ein sehr erklärendes, sehr akademisches Gericht. Das bietet weltweit schlicht viel
gut sortierten Stoff, der sich studieren lässt.
Espahangizi: Darf ich da direkt einhaken: Sie hatten gesagt, es gehe auch um
eine Art der Urteilsformulierung, die Verlässlichkeit erzeugt. Der Wissenschafts-
forscher Ludwik Fleck hat den Begriff des Denkstils geprägt, der immer aus dem
Kollektiv heraus gedacht wird. Kann man von einem Urteilsstil des Verfassungs-
gerichts sprechen? Wie würden Sie diesen beschreiben?
Baer: Jedenfalls gibt es so etwas: einen Urteilsstil, als Stil der Darstellung und
Begründung. Schon der Aufbau einer Entscheidung des deutschen Verfassungs-
gerichts unterscheidet sich von anderen Gerichten. Ich nenne das die Urteilsarchi-
tektur. Die Entscheidungen lassen sich damit schnell lesen, obwohl sie mittlerweile
sehr lang sind, denn es ist klar: Teil A ist der Sachbericht, Teil B die Stellung-
nahmen, Teil C die Begründung – und das ist sehr verlässlich. Zudem zwingt es
zur verdichteten Präsentation der Maßstäbe: Teil C beginnt immer mit den Ober-
sätzen als Maßstäben der folgenden Entscheidung und diese sind immer in hoher
Selbstreferenzialität gefasst – was wieder kritisiert wird, aber auch das ist verläss-
lich. Dazu kommt am Bundesverfassungsgericht – und das ist im internationalen
Vergleich auch nicht die Regel – die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur.
Manches wird zitiert, alles wurde gelesen. Das ist für das deutsche Gericht cha-
rakteristisch. Es ist für derart mächtige Gerichte auch ein wichtiger Punkt, denn
es zeigt: Wir haben ein kritisches Publikum – meine ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen in der Rechtswissenschaft –, die mit Argusaugen jedes Wort des Gerichts
kommentieren – und wir nehmen das ernst. Eine solch dichte Beobachtung gibt
es wohl eher selten. Sie gehört zu den Desideraten für den Europäischen Gerichts-
hof, denn dieser ist bislang nicht eingebunden in eine Community, die sofort sagt:
»Da hast du dir widersprochen, das hast du übersehen, das ist nicht logisch, das
ist nicht überzeugend«. Rund um Karlsruhe existiert demgegenüber eine unglaub-
liche Feedbackschleife, seit Jahrzehnten. So viel Aufmerksamkeit qualifiziert auch,
nicht nur durch Zustimmung, sondern mehr noch durch Kritik. So sind also diese
spezifischen Selbstbezüglichkeiten und Argumentationstypen stark in der Struktur
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
212
sortiert und auch die Referenztechnik ist ausgefeilt. Darauf wird sehr geachtet und
darüber wird auch diskutiert: Wen zitieren wir, warum, wann, wie, wo?
Das alles ist allerdings der Darstellungsstil, nicht zwingend auch der Denkstil –
denn rechtssoziologisch müssen wir ja unterscheiden zwischen der Verfertigung
der Entscheidung und der Darstellung, denn der Darstellungsprozess ist ein eige-
ner Prozess. Der Stil der Darstellung ist heute auf gewisse Weise technischer als vor
vierzig Jahren. Wir sind im Moment – zumindest nach meinem Eindruck – eher
nüchtern und weniger metaphorisch als zu anderen Zeiten. Alte Entscheidungen
zu Beginn der Arbeit des Gerichts erläuterten offensiv das Telos des Demokratisch-
Grundrechtlichen. Das tun wir heute so nicht mehr oft. Aber es gibt auch keine
Scheu vor dem großen Wort.
Dommann: Wann war es metaphorischer?
Baer: Die stärker metaphorische Rhetorik erinnere ich vor allen Dingen am Anfang,
also in den 1950er, 1960er Jahren. Damals musste sich das Gericht noch etablieren
und einer Bevölkerung zu erklären suchen, wie man Dinge neu und anders denken
könnte und sollte. Die ersten großen Entscheidungen waren insofern noch eine
Zumutung für diese junge Demokratie.
Dommann: Sie haben ja von den Argusaugen der epistemic community gesprochen,
die Ihnen auf die Finger schaut und die Sie immer mitdenken, wenn Sie beraten
und entscheiden. Jetzt gibt es ja noch andere Augen: Es gibt das Schielen, vielleicht
auch das Starren der Öffentlichkeit auf das Verfassungsgericht als letzte Instanz
der Gerechtigkeit. Das ist eine Unterscheidung, die in der Rechtstheorie auch recht
stark gemacht wird, zwischen Recht und Gerechtigkeit, die aber den Laien nicht so
richtig einleuchten will – warum Recht zuweilen nicht gerecht sein soll.
Baer: Es ist gut, dass diese Unterscheidung zwischen Recht und Gerechtigkeit dem
Laien nicht einleuchtet.
Dommann: Warum?
Baer: Ich würde das für eine zynische Welt halten, die Recht nicht mehr mit
Gerechtigkeit verbindet. Wenn Recht nicht mehr mit Gerechtigkeit verbunden ist,
dann hat das Recht – und dann hat die Welt – ein Problem. Es landen hier pro
Jahr etwa siebentausend Verfahren. Das sind alles Anfragen von Menschen, die die
Hoffnung haben, dass ihnen hier Recht gegeben wird. Und ihr Recht ist die subjek-
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
213
tiv als gerecht empfundene Antwort auf einen Konflikt. Insofern geht das immer
zusammen: Recht und Gerechtigkeit. Genau damit habe ich hier zu tun: Wenn
ich in Karlsruhe für das Gericht arbeite, dann ist es der Ruf dieser Leute: »Gib mir
mein Recht!« und damit auch: »Lass mir Gerechtigkeit widerfahren!«. Wir sind
ein Bürgergericht. Die Leute brauchen also keine Anwältinnen und Anwälte, um
hierher zu kommen. Es sind oft Menschen, die zwar nicht juristisch arbeiten, aber
doch sehr reflektiert auf Gerechtigkeit hoffen, nämlich auf Gerechtigkeit in dem,
was in einem spezifischen Verfahren möglich ist. Sie haben die gewissermaßen
realistische Erwartung eines fair share in der Gesellschaft, in der wir leben, mit den
Verteilungsmechanismen, die wir haben. Der Gedanke der Fairness ist insgesamt
sehr prägend. Bevor ich also einen Beschluss unterschreibe, gibt es genau diesen
Moment, in dem ich weiß: Da hat jemand Hoffnung hineingesetzt, hat sich diese
Mühe gemacht, hierher zu kommen. Und ich muss dem gerecht geworden sein, als
Richterin. Wenn ich da zweifele, unterschreibe ich nicht, dann muss da eben noch
weiter gearbeitet werden.
Die US-amerikanische Juristin Catharine MacKinnon hat einmal gesagt: »Equa-
lity is in the crack in the wall of dominance.« Hier ließe sich allgemeiner sagen:
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«. Das ist für mich sicher eine
Prägung. Wer hierher kommt, ruft oft wider besseren Wissens, also wider geringer
Erfolgschancen das Verfassungsgericht an. Das ist an der Tätigkeit hier auf eine
Art großartig, dann aber auch sehr belastend. Ich träume nicht selten von den
Fällen, für die ich hier zuständig bin. Dann ist da die Angst, dem irgendwie nie
ganz gerecht werden zu können, denn für viele ist das Verfahren hier die letzte
Hoffnung, against all odds. Die sagen sich: »Ich probier’s doch noch einmal beim
Gericht.« Dabei haben sie schon in zwei oder drei Instanzen verloren und das
Rechtssystem hat ihnen bereits gesagt: »Nein, so nicht.« Und dann kommen sie
noch einmal zu uns. Das Verfassungsgericht steht wohl für eine bestimmte Hoff-
nung, und für Vertrauen.
Ein Beispiel für diese Prozesse ist die Serie der Entscheidungen zu Transsexuel-
len. Menschen, die stark unter Tabus und Stigmata zu leiden hatten und haben,
beginnen irgendwann, eine Serie von Verfahren am Verfassungsgericht anzusto-
ßen, um zu ihrem Recht zu kommen. Sie wenden sich an eine Institution, die –
im Sinne tradierter Vorstellung – mehrheitlich aus älteren, weißen, christlichen,
heterosexuellen Herren besteht, weil sie auf Gerechtigkeit hoffen. Und sie haben
jedes Verfahren gewonnen. Es gibt also heute eine Serie von Entscheidungen, in
der zugunsten der Beschwerdeführenden entschieden wird. Darin wird Trans-
sexualität wirklich eindrücklich behandelt. Offensichtlich gelang es, das Verspre-
chen eines Grundrechtsgerichts nach außen zu halten: »Ihr bekommt euren day
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
214
in court, ihr bekommt euer fair hearing«. Auch dann gibt es Kritik, dass nicht alles
erreicht worden sei, dass das Verfassungsgericht sehr lange braucht – ja, stimmt!
Aber so signalisiert es auch: Wir sind nicht selbstherrlich und wir geben uns wirk-
lich Mühe! Wir versuchen nicht, das zack, zack irgendwie abzuhandeln, sondern
wir versuchen, dem vorgebrachten Anliegen gerecht zu werden. Darum geht es,
und das ist durchaus mühsam: Gerecht-Werden, Menschen eine Stimme geben,
die sie verloren haben, noch einmal hinsehen, noch einmal prüfen, ob ein Grund-
recht verletzt wurde. Das ist vielen Menschen offensichtlich sehr viel wert, sonst
würden sie nicht in solchen Mengen zu uns kommen.
Espahangizi: Nun gibt es ja eine Art Paradoxie: Wenn es ein Bedürfnis und eine
Nachfrage gibt und das Erfolgsmodell Verfassungsgericht noch erfolgreicher wird
und noch mehr Anträge eingehen, dann führt das doch zu einer systemischen
Überlastung. Sie hatten ja auch gesagt, es handelt sich de facto um eine kleine Ins-
titution. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass letztlich nur ein kleiner, ein sogar
minimaler Teil erfolgreich ist, könnte das nicht zur Korrosion dessen führen, was
die Leute überhaupt dazu bewegt, sich an das Verfassungsgericht zu wenden?
Baer: Das ist ein schöner Begriff: Korrosion. Wir sehen das mit großer Sorge. Es
gibt seit vielen Jahren eine Diskussion um die Entlastung des Bundesverfassungs-
gerichts, weil es an den Grenzen der Arbeitsfähigkeit agiert. Konkret heißt das:
Von meiner ganz schlichten Lesekapazität her kann ich kaum mehr tun, als ich
derzeit tue, und es liegen immer noch hunderte Verfahren auf meinem Tisch
und es gehen jeden Tag neue Verfahren ein. Wir sind an den Grenzen des Mach-
baren. Am Straßburger Gericht ist das ein bekanntes Problem und hat dramati-
sche Folgen: Die Verweigerung von Rechtsschutz ist auch eine Verweigerung von
Recht und Gerechtigkeit – das führt in der Tat zu schlimmer Korrosion. Aber die
Lösung ist nicht leicht zu haben: Wir wollen nicht davon weg, dass Menschen ohne
Rechtsbeistand zu uns kommen können. Das wäre ein denkbarer Filter, aber ein
Grundrechtsgericht darf nicht elitär sein. Dann ließe sich – das Übliche in der
kapitalistischen Welt – an Gebühren denken. Aber auch das ist keine gute Idee. Es
ist nur für den Ausnahmefall denkbar.
Espahangizi: Wäre es aber nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, es wäre viel
gerechter, nicht auf alle diese einzelnen Fälle einzugehen und dabei in diese Pro-
blematik hineinzugeraten, sondern sich paradigmatische Fälle zu nehmen und
durch Strahlkraft dieser Urteile Gerechtigkeit zu schaffen?
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
215
Baer: In Straßburg sind Pilotverfahren etabliert worden. Auch in unserem System
ist das ein Stück weit angelegt, denn nur der kleinste Teil der Entscheidungen muss
begründet werden. Das bedeutet auch: Die ganze Mühe, die ausgefeilten Sätze,
der akademische Darstellungsstil – das dringt da nicht nach außen, denn das wäre
nicht machbar. Es gibt also eine starke Priorisierung. Aber es bleibt die Masse und
die kleine Menge an paradigmatischen Großentscheidungen, die sehr viel Zeit
benötigen …
Espahangizi: Lassen Sie mich noch eine weitere Paradoxie ansprechen: Um Gerech-
tigkeitsansprüche zu formulieren und durchzusetzen, gibt es ja neben dem Rechts-
system auch zivilgesellschaftliches Engagement, politische Auseinandersetzungen
bis hin zu Formen von Gewaltanwendung. Bestärkt der Erfolg des Verfassungs-
gerichts nicht die Tendenz, Fragen der Gerechtigkeit auf das Recht zu reduzieren?
Baer: Manche vertreten die sehr populäre These der Juridifizierung der Welt, des
gouvernement des juges, der juristocracy. Ich halte dies im Hinblick auf die Macht-
fülle, die mit gerichtlichen Entscheidungen einhergeht, also mit Blick auf die
Gewalt des Rechts, für eine wichtige Kritik. Aber zugleich verkennt sie – und das
habe ich ein Stück weit in Ihrer Frage gehört –, was gerade ein solches Gericht
ermöglicht. Das Verfassungsgericht hat beispielsweise in der Rechtsprechung zur
Meinungsfreiheit und zur Versammlungsfreiheit immer wieder Räume eröffnet,
Möglichkeiten gerade für die Zivilgesellschaft geschaffen. Auch die Gleichberech-
tigungsrechtsprechung und die Rechtsprechung zur sexuellen Identität lassen sich
so werten: Das hat empowerment gefördert und Leuten agency gegeben, die sie nie
hatten. Insofern wendet es sich gegen die Schließung, die closure, die Sie anspre-
chen.
Eine solche Schließung entsteht allerdings, wenn es eine zu starke Fokussie-
rung auf die juristische Rationalität gibt, auf Entweder-oder-Entscheidungen, und
wenn das Drama dieses juristischen Entscheidens im Entweder-oder unterschätzt
wird. Das wird in der Tat noch wenig wahrgenommen. Eine gerichtliche Entschei-
dung wird häufig als Botschaft zum Thema rezipiert, dabei ist sie nur ein Ja-Nein
zu einer ganz reduzierten, sehr genau gestellten Frage. Der Zwang, der in diesem
binären Code rechtmäßig / rechtswidrig steckt, ist in der Tat auch eine Heraus-
forderung.
Daneben gibt es auch eine Paradoxie des Erfolgs, insofern der Fokus auf
Karlsruhe immer größer und wichtiger wird. Alles, so scheint es, geht heute an
Karlsruhe. Gleichzeitig gelingt es dem Gericht aber auch immer wieder, die Bälle
zurückzuspielen. Ein Beispiel ist die aktuelle Europarechtsprechung: Da hatten
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
»Grundrechte sind der Riss in der Mauer der Macht«
216
viele gehofft, das Gericht stoppt nun den Bundestag oder die Bundesregierung
in Sachen Europäischer Integration. Und was hat Karlsruhe gemacht? Es hat den
Bundestag aufgefordert und ermächtigt, seine Aufgabe wahrzunehmen. Der Clou
war gerade nicht zu sagen, wo es europapolitisch lang geht, sondern der Clou war,
auf Demokratie zu pochen. In leichter Abwandlung eines bekannten Zitats: »It’s
democracy, stupid!« Diese Linie verfolgt das Gericht auch auf Feldern, auf denen
es jedenfalls mir viel schwerer fällt, die Entscheidung abzugeben. Ein Beispiel dafür
ist die Existenzsicherung, also der Kampf gegen Armut in einer Wohlstandsgesell-
schaft. Als Bürgerin habe ich da eine ziemlich dezidierte Meinung. Aber ich bin
hier als Verfassungsrichterin. Und als Verfassungsrichterin gebe ich die Frage, die
Bürger an uns herangetragen hatten, um das Parlament zu verpflichten, an das
Parlament zurück und sage: »Lieber Bundestag, liebe Bundesregierung – könn-
tet ihr euch bitte nochmals Gedanken machen, was Armut in Deutschland heute
wirklich heißt?« Das mag enttäuschend sein. Aber es ist die einzige Chance, diese
Prozesse offen zu halten. Ich sehe mich hier also auch als jemand, die in Kategorien
prozeduraler Gerechtigkeit denkt. Da heißt es: »Weiter öffnen, öffnen, öffnen …«
Espahangizi: Ich darf noch einmal dran bleiben: Eine Möglichkeit in unserer
Gesellschaft, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, besteht darin, auf die Änderung
des kodifizierten Rechts etwa von Gesetzestexten hinzuarbeiten. Nun haben wir
zum Beispiel in der Schweiz mittlerweile eine Rassismus-Strafnorm und das ist
auch gut so. Aber wir merken auch, dass die rassistische Diskriminierung in der
Gesellschaft dadurch nicht einfach verschwindet, ja sich sogar dem Ton nach der
neuen Gesetzeslage anpasst. Stichwort: »Rassismus ohne Rasse«. Wenn Rassismus
auf das reduziert wird, was mit der Strafnorm juristisch erfassbar ist – etwa auf eine
öffentliche rassistische Aussage –, dann kann man sagen: »Wo ist denn eigentlich
das Problem? Wir haben ein Gesetz, ist doch alles gut!« Struktureller Rassismus
fällt damit aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung.
Baer: Die Ambivalenz des Rechts ist in der Geschichte der Emanzipationsbewe-
gungen immer ein strukturelles Problem gewesen. Es besteht auch darin, dass die
Politik das Recht zuweilen als Beschreibung gesellschaftlicher Zustände benutzt.
Man kann auf die kritische Frage »Gibt es Rassismus?« aber eben nicht hinrei-
chend antworten »Es gibt gute Gesetze gegen Rassismus«. Das genügt nicht, und
trotzdem scheint es wirkmächtig zu funktionieren. Hier wirkt der ontologische
Überschuss des Rechts, und das ist eine Herausforderung.
Ich würde dennoch nicht von dem Versuch abgehen wollen, Recht angemessen
auf Realität reagieren zu lassen. Aber »angemessene Reaktion« kann auch heißen,
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
Interview mit Susanne Baer
217
dass ich in der Rechtsnorm von dem differiere, was ich gesellschaftlich erzeugen
will. Eine Kontroverse im Anti-Rassismus-Recht ist daher: »Darf ich den Begriff
›Rasse‹ benutzen?« Ich halte eine Rechtsordnung für vorzugswürdig, die mit dem
Begriff »Rassismus« arbeiten würde. Aber machen wir uns nichts vor: Auch da
steckt »Rasse« drin. Beides ist allerdings besser, als auf »Ethnie« auszuweichen,
denn das fördert nach meinem Eindruck die Illusion, es gäbe kein Problem, son-
dern nur kulturalisierte Differenz. MacKinnon nennt diese Herrschaftstechnolo-
gie den »Samthandschuh auf der Faust der Dominanz«. Und dieser Samthand-
schuh ist verführerisch, der ist so weich, das ist alles viel netter … Insofern ist es
für rechtspolitische Aktivistinnen und Aktivisten eine große Herausforderung, zu
differenzieren: kein N-Wort im Alltag, auch keine Rede von »Rasse«, wenn es um
Menschen geht, aber doch Recht gegen Rassismus.
Da lässt sich auch ein feministisches Beispiel anfügen. Wenn ich sage »Es braucht
Quotenregelungen zur Frauenförderung«, ist damit nicht gemeint; »Frauen müs-
sen unbedingt gefördert werden, weil Frauen schwach und doof sind«. Vielmehr
braucht es Quotenregelungen zur Frauenförderung, weil die Welt so ungerecht ist,
dass sie ohne Quotenregelung auf den Ruf nach Fairness nicht reagiert, und die
Quotenregelung muss dann, um den Anforderungen der Grundrechte gerecht zu
werden, auch noch sehr sachgerecht ausfallen. Das sind eben verschiedene Ebenen.
Differenzierung und mehr Sinn für die Spezifika des Rechts täten gut. Das ist wohl
für mich ein Kerndesiderat.
Dommann & Espahangizi: Vielen Dank für das Gespräch!
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016
diaphanes eTexT lizenziert für [email protected] / 03.10.2016