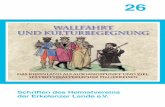Das Planetarische. Vom Denken und Abbilden des ganzen Globus
Spiegelungsprozesse und das ‚wahre‘ Selbst_Vortrag PsyPäd Mainz 2012
Transcript of Spiegelungsprozesse und das ‚wahre‘ Selbst_Vortrag PsyPäd Mainz 2012
Spiegelungsprozesse und das ‚wahre‘ Selbst? Von imaginären Ab-Bildern zu symbolischen Strukturen in der Anerkennung des Anderen
Valentin Rumpf
1. Einleitung
„Geht man davon aus, dass eine Spiegelung den Zustand, den sie aufgreift auch ir-
gendwie verändert, (...) so liegt eine Paradoxie in der Unterstellung, dass ein oft nur
unklar oder gar nicht bewusster ‚Originalzustand‘ trotz seiner Unbewusstheit nicht
spurlos transformiert wird, sondern über die Transformationen des Zustandes hinweg
eine Ahnung von seiner ursprünglichen Verfasstheit erhalten bleibt – und davon, dass
er von einem Anderen transformiert wurde“ (Dornes 2006b: 109).
Im vorliegenden Beitrag wird es um verschiedene disziplinäre Einsatzstellen
gehen, die sich aus differenten epistemologischen Perspektiven auf (vor al-
lem frühkindliche) Spiegelungs- und Anerkennungsprozesse speisen und die
im Durchgang der Argumentation in eine transdisziplinäre Diskussion zwi-
schen entwicklungspsychologischen und subjektphilosophischen Linien ein-
münden sollen.
Ausgangspunkt bilden vor allem Fragestellungen des Frankfurter Psy-
choanalytikers und Entwicklungspsychologen Martin Dornes, der in mehre-
ren Veröffentlichungen den Versuch unternimmt, diese transdisziplinäre
Perspektivierung über eine Integration einschlägiger entwicklungspsycholo-
gischer (etwa bei Stern 2003, 2005) und psychoanalytischer Befunde (etwa
bei Winnicott, 1971) zur Entwicklung des Selbst herzustellen und dabei auch
auf Lacans (1973) Theorie des Spiegelstadiums verweist. Meine Absicht ist
dabei, ihm in diesen Überlegungen einerseits zu folgen, um im Weiteren
gleichermaßen mit und gegen seine Überlegungen zu argumentieren. Dabei
soll ein fachübergreifendes Bild frühkindlicher Spiegelungsprozesse markiert
werden, das neben den bei Dornes primär entwicklungspsychologisch veran-
kerten (und damit primär den Begriff des Selbst fokussierenden) auch sub-
jektphilosophische Fragestellungen (und damit den philosophischen Begriff
des Subjekts) mit einschließt. Diese nehmen in meinem Beitrag ihren Aus-
gang bei Hegels Theorie zur Entstehung des Selbstbewusstseins im Prozess
der Anerkennung und schlagen sich in der Lacanschen Rezeption in der Figur
des Dritten bzw. ‚großen Anderen‘ (A) nieder.
2
Intention des Betrages wird damit auch sein, aufzuzeigen, inwiefern
Dornes und Lacans Einsatzstellen sich einerseits epistemologisch ergänzen,
andererseits jedoch unvereinbar erscheinen, insofern ihre disziplinären und
anthropologischen Ausgangspositionen divergieren. Damit mag mein Beitrag
zwar Gefahr laufen, bereits offene Türen einzurennen, da Dornes transdiszip-
linäre Perspektivierungen (vgl. etwa Dornes 2006b: 108; Dornes 2000: 223)
in überaus differenzierter Form erfolgen, andererseits soll es mir das Bemü-
hen wert sein, auf einige bislang wenig beachtete Anknüpfungspunkte hin-
zuweisen, welche jener Differenzierung zugute kommen sollten.
Lacans Konzept des Spiegelstadiums könnte m.E. beispielsweise trotz
des Umstandes, dass es, so Dornes, „von Philosophen geschätzt und von
Entwicklungspsychologen ignoriert wird“ (Dornes 2006a: 217) vor dem
Hintergrund der aktuell einschlägigen intersubjektiven Psychoanalyseströ-
mung (etwa bei Orange u.a. 2001; Mitchell 2003, Altmeyer/Thomä 2006)
transdisziplinäre Beachtung finden. Denn der französische Psychoanalytiker
legt speziell mit dem Konzept des ‚bestätigenden Blick des Dritten‘ (vgl.
Lacan 1973: 61ff) dar, welchen Stellenwert neben der (v)erkennenden, ab-
bildhaften Imagination des Selbst der hinzutretende, ‚signifizierende Dritte‘
als Voraussetzung für das Selbsterkennen des Kindes im Spiegel einnimmt.
Er wird damit zum Vorläufer der Auflösung der Mutter-Kind-Dyade im Sin-
ne der Separation und der Anerkennung der symbolischen Kastration durch
den väterlichen Dritten (vgl. Widmer 2009: 30f; Ruhs 2000: 41; Schon 2002;
Dammasch 2008).1
2. Von Dornes Fragestellungen zu Hegels Theorie der Entstehung des Selbstbewusstseins in der Anerkennung des Anderen
Ausgehend von der Tatsache, dass es beim Säugling ein grundlegendes Be-
gehren nach Anerkennung seiner Bedürfnisse gibt, stellt Dornes v.a. in sei-
nem Artikel „Spiegelung – Identität – Anerkennung“ (2006a) die Frage, ob
und inwiefern auch der Säugling in der Lage sei, die „Mutter als getrennte
Person in eigenen Rechten“ (ebd.: 59) anzuerkennen. Da jene Fragestellung
in philosophischer Sicht ganz wesentlich die Theorie zur Entstehung des
1 Damit unterstreicht er meines Erachtens übrigens an dieser Stelle mit und nicht gegen
Winnicott den Übergang zwischen der klassischen, intrapsychisch orientierten Triebtheorie und einem postklassischen, intersubjektiv ausgerichteten Denken (vgl. dazu Laplanche 1992).
3
Selbstbewusstseins und des damit einhergehenden dialektischen Anerken-
nungsprozesses bei Hegel tangiert, welche in Lacans Rezeption Fundament
für seine Theorie des Spiegelns sowie auch des Begehrens darstellt, sollen
Hegels Ausführungen an dieser Stelle kurz angerissen werden.
Hegel geht zunächst in den „Vorlesungen über die Geschichte der Philo-
sophie“ davon aus, dass die Seele des Menschen „das Sich-selbst-Erhalten im
Anderen“ sei (Hegel 1837: 48). In der Phänomenologie des Geistes (1807:
140f), führt er seine Theorie derart weiter, dass sich das Selbstbewusstsein
allererst als Ereignis der Anerkennung durch den Anderen konstituiert, d.h.
sich stets in Abhängigkeit eines Gegenüberstehenden bzw. Fremden figuriert,
verändert und sich somit „selbst im Anderen“ findet:
„Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, indem, und dadurch, dass es für ein ande-
res an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein Anerkanntes. (…) Es ist für das Selbstbe-
wusstsein ein anderes Selbstbewusstsein, es ist außer sich gekommen. Dies hat die
gedoppelte Bedeutung; erstlich es hat sich selbst verloren, denn es findet sich als ein
anderes Wesen; zweitens, es hat damit das Andere aufgehoben, denn es sieht auch
nicht das Andere als Wesen, sondern sich selbst im Anderen“ (Hegel 1807: 140f)
Er umschreibt das Selbstbewusstsein kurzum als Summe der Erkenntnis der
Dialektik von Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, in metaphorischer
Form eines dialektischen Konflikts um Anerkennung, Begierde und Abhän-
gigkeit zwischen Herr und Knecht.2
Hegel verweist damit auf die ‚Doppelsinnigkeit‘ des Bewusstseins, wel-
ches sich allererst im Anderen findet, sich damit jedoch auch letztlich selbst
aufheben muss: „es (das Bewusstsein, V.R.) muss darauf gehen, das andere
selbstständige Wesen aufzuheben, um dadurch seiner als des Wesens gewiss
zu werden; zweitens geht es hiermit darauf, sich selbst aufzuheben, denn dies
anderer ist es selbst“ (Hegel 1807: 148). Hegel begreift jenen unaufhebbaren
Dualismus bzw. Polarismus des Selbstbewusstseins in einer unendlichen
Spannung, die sich in der steten „Begierde“ nach Anerkennung (Hegel 1807:
149) ausdrückt - und später in Lacans Theorie des Begehrens (désir, u.a.
Lacan 1975) psychoanalytisch gewendet wird.3
2 Unter anderem jenes hegelsche metaphorisch-illusionäre Verhältnis wird später bei Lacan
zur Grundlegung seines Subjektverständnisses des „Begehrens“, das sich beim Menschen im „kleinen“ anderen ausdrückt und zuerst in seinem Essay über das Spiegelstadium Popularität erlangte (vgl. Lacan 1973).
3 Lacan beruft sich in seinen Werken wiederholend direkt oder indirekt auf Hegel v.a. über die Rezeption des französischen Hegelianer Alexandre Kojève, der Hegels Theorien in seinen populären Pariser Vorlesungen primär marxistisch bzw. sozialistisch auslegte (vgl. Kojève 1958).
4
Die zugrunde liegende Dynamik dieses Konflikts, die Ambivalenz zwi-
schen Ich oder Du, gut oder böse und Herr oder Knecht bei gleichzeitiger
Abhängigkeit führt schließlich bei Hegel wie Lacan in eine letztlich unaus-
weichliche Aporie, die nicht nur im Suizid des Jüngling Narziss beschrieben
wird, sondern auch in der (post-)klassischen Psychoanalyse (z.B. im Spal-
tungsbegriff Melanie Kleins 1962) wie im gegenwärtigen subjektphilosophi-
schen Diskurs eine konjunkturelle Thematik darstellt.
Doch damit wieder zurück zu Dornes: Für ihn ergibt sich als Antwort auf
die eingangs gestellte Frage, ob und inwiefern der Säugling nicht nur aner-
kannt werden will, sondern auch selbst emotionale Anerkennung vermitteln
kann, dass die Fähigkeit zur reziproken Anerkennung wahrscheinlich eine
Entwicklungserrungenschaft darstelle und nur über die Affirmation des An-
spruchs nach „Anerkannt-Werden-Wollen“ verlaufen könne (Dornes 2006a:
59). Obzwar diese Einschätzung entwicklungspsychologisch ausgerichtet ist,
betont er damit wie Hegel die Abhängigkeit der Fähigkeit zur Anerkennung
des Anderen vom Anerkanntwerden des Eigenen. Der erkenntnistheoretische
Unterschied liegt meines Erachtens jedoch darin, dass er den ambivalenten
Selbst-Anerkennungsprozess in der Abhängigkeit zu einem „ganz“ Anderen
(d.h. also im Sinne von Alterität als irreduzibler Fremdheit) weniger proble-
matisiert, als dies Hegel und in seiner Folge Lacan aus subjekttheoretischer
bzw. subjektkritischer Perspektive tun. Die Selbsterkenntnis wird bei Dornes
vielmehr in einem interaktionistisch-fruchtbaren Prozess eines souveränen,
„kompetenten Säuglings“ verstanden, der „in einem wahrnehmungspsycho-
logischen Sinne die Welt von sich selbst unabhängig zu differenzieren weiß“
(Dornes 2000: 19) – eine gerade vor dem Hintergrund (post-) moderner psy-
choanalytischer und philosophischer Ausgänge nicht unumstrittene These
(z.B. Ahrbecks Gegenüberstellung zur Angewiesenheit des Säuglings, vgl.
Ahrbeck 2007).
3. Dornes Theoriegrundlegung zu frühkindlichen Spiegelungsprozessen in Auseinandersetzung mit ein-schlägigen Affektspiegelungsmodellen
Dornes geht in seinen Überlegungen von der – in der Objektbeziehungstheo-
rie lange Zeit unreflektierten – Frage Winnicotts aus, was das Kind erblickt,
wenn es in das Gesicht der Mutter schaut. Winnicott beantwortet diese Frage
5
mit der populären Formel, dass „wie sie (die Mutter, V.R) schaut, davon
ab(hängt), was sie selbst erblickt“ (Winnicott 1971: 129), d.h. dass das Kind
sieht, „was es in sich selbst erblickt“ (ebd.). Jenen Prozess konzeptualisiert
Winnicott demzufolge als das, was „den Anfang für einen bedeutsamen Aus-
tausch mit der Welt bilden könnte: den zweigleisigen Prozess, in dem innere
Bereicherung und die Entdeckung des Ausdrucksgehaltes des Sichtbaren sich
ergänzen“ (ebd.).
Etwa durch Lächelspiele und gestikulären Austausch kommt es zur suk-
zessiven Feinabstimmung der sozioemotionalen ‚Rhythmen‘ zwischen Mut-
ter und Kind. In einer gelungenen Interaktion gelangt der Infant nach und
nach in die Lage, Erfahrungen mit der Regulierung seines Affektzustandes
und Erregungsniveaus zu machen und gleichsam zu entdecken, dass sich eine
andere Person seinen Bedürfnissen und seinem Erleben bedeutungsvoll zu-
wendet. Daraus folgt die „positive oder negative Tönung seines sich bilden-
den affektiven Kerns“ durch den sich der soziale ‚Stil‘ des Kindes herausbil-
det (Köhler 2004: 165; vgl. auch Stern 2003 u. 2005). Es ergibt sich, dass das
Kind die Ausdauer im Verfolgen einer Handlung und die Mittel, die zur Ver-
folgung eingesetzt wurden, im Gedächtnis als (frühe) Repräsentanzen spei-
chert und Befindlichkeiten und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit
Bindungs- und Trennungsverhalten mentalisiert werden (vgl. Fonagy u.a.
2004).
Mit zunehmender Entwicklung und ‚Übung‘ erkennt der Säugling die
Affektantworten der Mutter als Darstellung seiner eigenen Emotionen. Eine
„referenzielle Entkoppelung“ (vgl. Gergely/Watson 1996; zit. n. Dornes
2004: 178f) findet statt: Er entkoppelt den Ausdruck der Mutter von ihrer
Person, bezieht ihn in weiterer Folge auf sich und lernt dadurch ihre Ausdrü-
cke als seine eigenen Zustände zu verstehen.
Das Kind muss sich dennoch, und damit stimmt Dornes mit etwa Fonagy
et al (wie im philosophischen Diskurs eben auch Hegel) überein, paradoxer-
weise erst über seine Mutter als Anderem in sich selbst erfahren und sukzes-
sive vergewissern – eine Diagnose, die v.a. in der heutigen Strömung der
relationalen Psychoanalyse insofern als Grundformel gilt, als dass Intersub-
jektivität der Subjektivität vorausgeht – und nicht umgekehrt (vgl. Kahlen-
berg 2010: 59; Altmeyer/Thomä 2006: 8). Die ersten inneren Repräsentanzen
bzw. Symbolbildungen sind somit von der libidinös besetzten Mutter als
Primärobjekt geprägt und beeinflussen die Entwicklung der Selbst- und der
weiteren Objektrepräsentanzen. Dornes bezweifelt in seiner Frage nach ei-
nem „wahren“, sozusagen ‚unkontaminierten‘ Selbstempfinden insofern
zurecht, ob die gespiegelten und markierten Reaktionen der Mutter und die
damit entstehenden Repräsentationsbildungen beim Kind nicht immer schon
6
einer vermittelnden Ko-Konstruktion von Mutter und Kind gleichkommen
oder ‚spontane Gesten’ im Winnicott’schen Sinne sind. Doch wie, so wäre
dann zu fragen, sollten solch spontane Gesten im strengen Sinne ohne die
Hegelsche ‚Zwischensphäre‘ der Anerkennung beschaffen sein, wenn man
vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungserkenntnisse nicht mehr von
einem solipsistischen, oder‚ so müsste man sagen, vermittlungsfreien Erfah-
rungsraum ausgehen kann.4
Es stellt sich mit dieser Feststellung also auch die Frage, inwiefern „man
diesen Beeinflussungsprozess (immer auch, V.R.) als Entfremdungsprozess
betrachten soll“ (Dornes 2000: 212). Dornes selbst kommt zu der Conclusio,
dass man ihn im Lichte von Winnicotts Theorie (1971) als „An- oder Berei-
cherungsprozess betrachten sollte, der nur im misslingenden Fall“ d.h. bei
unzureichender oder inkongruenter „Markierung“ (vgl. Gergely/Watson
1996) zu „Entfremdungsgefühlen und/oder Symptombildungen führt“ (Dor-
nes 2000: 212). Winnicott beschreibe demzufolge eher den Fall gelungener
Spiegelung, „in dem die Zustände des Subjekts vom Objekt er-
kannt/gespiegelt werden und das Subjekt dadurch ein Bewusstsein seiner
selbst und seiner Bedürfnisse gewinnt“ (Dornes 2000: 225). Lacans Theorie
würde hingegen eher „auf den Fall misslingender Spiegelungen fokussieren,
in dem Zustände des Subjekts vom Objekt nicht – oder nur unzureichend
gespiegelt würden und das Kind sich deshalb entfremdet fühlt“ (ebd.). Diese
Annahmen bilden auch den Kern seiner Kritik an Lacan, welche im Folgen-
den präzisiert und schließlich unter einer abwägenden Perspektive diskutiert
werden soll.
4. Dornes Kritik an Lacans Theorie des Spiegelstadiums
Im Bewusstsein dessen, dass Lacans Theorie des Spiegelstadiums schon seit
Längerem ein On & Off-Thema in der Konjunktur um Subjektivierungs- und
Entwicklungsdiskurse darstellt und seine Positionen gerne als letzte Wahrhei-
ten oder ‚Hype‘ verabsolutiert werden, liegt mir ein solches Vorgehen fern.
Mir geht es, wie angerissen, um eine differenzierte Abwägung konstitutiver
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den systematischen bzw. epistemolo-
gischen Einsatzstellen von Dornes und Lacan.
4 Auch Dornes spinnt die Fragestellung dahingehend weiter, ob und inwiefern der Säugling
in den durch die Affektansteckung wahrgenommen Gefühle „mitschwingt“ und inwiefern ihm dabei das „mit“, also der eigene Anteil im Schwingen gewahr werden kann (vgl. Dornes 2006: 108).
7
Dornes geht im Ausgang von modernen Befunden der Säuglingsfor-
schung (etwa bei Stern 2003) davon aus, dass Säuglinge bereits unmittelbar
nach der Geburt keine passiven Wesen sind, sondern über differenzierte kog-
nitive und sozio-emotionale Kompetenzen verfügen: „Im Bereich der zwi-
schenmenschlichen Interaktion sind Säuglinge kompetente Teilnehmer. Sie
verfügen über ein subtiles Repertoire von mimischen, lautlichen und gesti-
schen Verhaltensweisen, mit denen sie den Eltern ihre Befindlichkeit signali-
sieren und deren Interaktionsangebote beeinflussen“ (Dornes 2000: 21). Sie
seien demnach Initiatoren, nicht bloß Teilnehmer am Beziehungs- und Inter-
aktionsgeschehen und damit auch der Selbst- und Fremddifferenzierung5.
Dornes nimmt unter dieser Prämisse auch an, dass „das Körper- und Selbst-
empfinden ursprünglich eher einheitlich sei“ und das Erleben im Sinne einer
von Lacan postulierten ursprünglichen Zerrissenheit als „Desintegrationspro-
dukt einer nichttragenden Beziehungsstruktur“ (Braun 2007: 48) verstanden
werden müsse.
Jene These eines ursprünglich einheitlichen Körperempfindens begründet
sich jedoch anhand der Kritik Mayers (2011) 6, strukturlogisch gesehen
„nicht minder problematisch wie ihr Gegenteil. Sie bleibt gebunden an den absenten
Nachweis, wie die empirische Beobachtung als ursprünglicher Eindruck beurteilt
werden kann. Denn dieses Urteil entzieht sich als Quelle aller folgenden Entwick-
lungsschritte weiterer Begründung und erhält damit eine quasi-metaphysische Quali-
tät. Außerdem herrscht Unklarheit, wie genau die Bruchstelle zwischen empirisch zu-
gänglichen Reiz-Reaktionsketten und den inneren Verarbeitungsprozessen des Säug-
lings, also z.B. die Frage nach möglichen psychischen Widerspiegelungen eines äuße-
ren Vorgangs, interpretatorisch zu schließen sei. Denn die unvermittelte Beobachtung
und Erforschung des Innerpsychischen erscheint kategorisch ausgeschlossen – For-
schung beinhaltet unhintergehbar Vermittlung“ (Mayer 2011: 218).
Es gilt aus entwicklungspsychologischer Perspektive dennoch an mehreren
Stellen eine Lanze für Dornes‘ Kritik zu brechen: Es mutet aus heutiger Sicht
5 Im Zuge dessen legt Dornes an anderer Stelle unter Einberufung der Theorie des „virtuellen
Anderen“ von Stein Brâten (1992) – und entgegen der Aussage von Vertretern intersubjektiver Ansätze wie Altmeyer (2005) oder Bohleber (2006) – die Annahme zugrunde, „dass manche Aspekte des Subjekts nicht sozial konstituiert werden, sondern dass das Subjekt in gewisser Hinsicht schon vor jedem sozialen Kontakt eine soziale Konstitution hat“ (Dornes 2006b: 78). Unter anderem an dieser Stelle scheint Dornes keine begriffliche Unterscheidung zwischen dem eher philosophisch konturierten Begriff des Subjekts und dem eher psychologisch verwendeten Begriff des Selbst vorzunehmen.
6 „Das Hören, Sehen und Fühlen des Babys folge nicht zunächst getrennten Bereichen der Apperzeption, die erst im fortlaufenden Entwicklungsprozess aufeinander bezogen und ko-ordiniert werden. Ausgangspunkt seien vielmehr unbewusst zusammenspielende Körper-funktionen, die sich erst später für das Kind unterscheidbar ausdifferenzieren“ (Mayer 2011: 218).
8
beispielsweise überaus fragwürdig an (vgl. Dornes 2000: 224), wie Lacan
den Zeitraum des „Spiegelstadiums“ (1973: 61-70) undifferenziert bis will-
kürlich zwischen den 6. und 18. Monat zu datieren sucht, jene Spanne, in der
gemäß der klassischen wie aktuellen entwicklungspsychologischen For-
schungsbefunde die vielleicht wegweisendsten Entwicklungsschritte vollzo-
gen werden (vgl. Göppel 2006). Insofern scheint auch Dornes Kritik plausi-
bel, dass Kinder gemäß der heutigen Annahmen ab dem ca. 15.-18. Monat
eher mit Rückzug und Verlegenheit auf das Spiegelbild reagieren als mit
„jubilatorischer Geschäftigkeit“, die eher ab dem 6. Monat beobachtbar sei
(vgl. Dornes 2000: 218). Des Weiteren trifft Dornes – interessanterweise
ohne jene Erkenntnis bei seinen eigenen Vergleichsbemühungen zu hinter-
fragen – einen Kernpunkt, wenn er davon spricht, dass Winnicott und Lacan
unterschiedliche anthropologische Grundvoraussetzungen besäßen, wenn
Lacan vom „untilgbaren Mangel“ bzw. „unstillbaren Begehren“ im Funda-
mentalphantasma (vgl. Lacan 1978) und Winnicott von einer „erreichbaren
Fülle“ (Dornes 2000: 225) im Zwischenraum spiegelnder Erfahrungen aus-
gehe.7
Was in der Analyse jener angerissenen Kritikpunkte und ihrer Abwägung
bislang eher beiläufig mitschwang, meint folgendes:
Lacan nimmt, so meine These, in seiner Rede über das „Ich als Funkti-
on“ bzw. „Instanz“, die „auf einer fiktiven Linie situiert (sei), die das Indivi-
duum allein nie mehr auslöschen kann“ (Lacan 1973: 64), eine aus Dornes
epistemologisch inkommensurabler Perspektive nur unzureichend identifi-
zierbare Position ein8, die kein entwicklungspsychologisches, sondern diffe-
renz- bzw. alteritätstheoretisches Erkenntnisinteresse ausdrückt, welches mit
den folgenden Ausführungen über das „Spiegelstadium“ nochmals spezifi-
ziert werden soll.
7 Ein weiterer am Rande geäußerter, aber meines Erachtens wesentlicher Punkt setzt dort an,
wo Lacans Spiegelmodell einer idealisierenden Identifikation mit dem Anderen deswegen unplausibel erscheine, da in diesem Alter (etwa nach Kohlberg und Piaget) noch keine Dispositionen von Moral bestünden, welche jedoch Voraussetzung für jedwede Form einer Unterscheidung von Ideal und „Normalität“ seien. Obzwar jene Kritik im Lichte der strukturlogischen Überlegung, welche Errungenschaft nun Vorbedingung für die andere sei, also selbst[v]erkennende Idealisierung für eine Disposition von Moral oder umgekehrt normative Standards für eine Instanz des Selbst(v)erkennung, vermutlich unentscheidbar bleibt, muss sich jene Kritik auch die Frage gefallen lassen, ob Lacan mit jenem Prozess nicht vielmehr die Funktion einer unbewussten Idealisierung im Sinne der Ausbildung eines ‚Fundamentalphantasmas‘, d.h. eines selbstgefälligen Ichs (moi) beschreibt (vgl. Lacan 1973: 66).
8 Man könnte somit an dieser Stelle unter Rekurs auf Lyotard, wie Koller (1993 u. 1999) es prominent in bildungstheoretischen Diskursen bemüht hat, vom Ausgang unterschiedlicher ‚Diskursarten‘ sprechen, die keiner Metadiskursart zuführbar sind und insofern im inkommensurablen Verhältnis eines Widerstreits stehen (bleiben) müssen.
9
Lacan fokussiert in seiner frühen Marienbader Rede (1936) vom „Spie-
gelstadium[s] als Bildner der Ich-Funktion“ (vgl. Lacan 1973: 61-70) meines
Erachtens nicht den Prozess eines als sich im Spiegel erkennenden Selbst im
apperzeptiven, d.h. identitätslogischen Sinne. Es geht ihm weniger um den
Begriff und Prozess der „wahren“ Selbstbewusstseinserfahrung (die etwa auf
experimentelle Weise mit dem so genannten „Rouge-Test“ überprüfbar wä-
re), die sich dann in der Logik Abbild = Abgebildeter erschöpft (bei Lacan
klein a‘ = a) – eine Erkenntnismethode, welche Lacan unter Einberufung
seiner alteritätstheoretischen Perspektive gerade ablehnt.
Vielmehr hält er nach der Funktion von irreversiblen Erkennungsprozes-
sen in der frühen Kindheit Ausschau, die sich in (nicht konkretistisch am
Objekt des Spiegels festzumachenden) Identifizierungsmomenten zeigen und
deren Ergebnis das Bewusstsein einer Täuschung ihrer selbst ist. Das, was
das Kind im Spiegel und im ‚menschlichen‘ Spiegelbild seiner primären
Bezugsobjekte, die laut Lacan als ‚signifizierende Dritte‘ hinzutreten, er-
blickt, ist gleichzeitig Ort und Anfang der Konstitution als dezentriertem
Subjekt – nicht als entwicklungspsychologischem Selbst im Sinne des carte-
sianischen Cogito. Spiegel, besser gesagt die fremdartige Erfahrung des Sich-
Spiegelns, stehen für Lacan anders als bei den Dornes‘schen Ausführungen
für die unauslöschbare Beziehung von Objekten zu dem (v)erkannten, da von
außen „angerufenen“ (vgl. Althusser, 1977), anerkannten (Hegel) und doch
heteronom erschaffenen Subjekt, eine paradoxe Beziehungsstruktur, die zur
Basis aller späteren Objektbeziehungen wird.9 Denn der Blick im Spiegel
zeigt (schon durch seine Verkehrung im Abbild, vgl. Widmer 2009: 26ff;
Koller 1994) „nicht (nur) das Bild, das die anderen von uns haben, sondern
(ist) der Blick, den wir auf uns selbst richten und der von Erwartungen be-
seelt ist, die wir narzisstisch erfüllen“ (Meyer-Drawe 1990: 113).10
Zusammengefasst konstituiert sich mit Lacan demnach Subjektivität in
der illusorischen und verhafteten Verkennung immer schon auf dem (Vor-)
Feld des Anderen, das in der frühen Kindheit durch das Spiegelbild inszeniert
9 Lacan führt dazu aus: „Das Subjekt ist niemand. Es ist zerlegt, zerstückelt. Und es blockiert
sich, es wird angezogen von dem zugleich täuschenden und realisierten Bild des anderen oder überhaupt von seinem eigenen Spiegelbild. Da findet es seine Einheit“ (Lacan 1954/1955: 73).
10 D.h., das Objekt, auch das Antlitz der Mutter, wird so mit Lacan zum Selbst „erhoben“, psychoanalytisch gesehen, „besetzt“ (Küchenhoff 1999), quasi ‚emporstilisiert‘, um die Funktion einer kompensatorischen Identifikation mit einem überdimensionierten, aber integrierten Ab-Bild seiner selbst zu gewährleisten: Das im Spiegelstadium als wohlgeformtes, zum ersten Mal einheitlich erfahrene Spiegelbild des eigenen Körpers wird zum Symbol für die lebenslange Illusion der Identifizierung mit anderen Objekten – allen voran der der primären Bezugs- und Bindungsobjekte, d.h. meist der Eltern und ihrer übertragenen Werte (“Ich-Ideal“ in Freuds Konzeption).
10
wird (vgl. Meyer-Drawe 1990: 125), wobei der Spiegel auch bei Lacan meta-
phorischen Charakter hinsichtlich der unerlässlichen Anerkennung durch den
Anderen als Bedingung zur Subjektwerdung besitzt (vgl. Lacan 1978).11
Demzufolge läuft auch Dornes‘ Kritik (2000: 219), dass kleine Kinder insge-
samt wenig Zeit vor dem Spiegel verbringen, jener insofern als bloßer Ge-
genstand nicht wesentlich für die Spiegelsituation sei, ins Leere, da Lacan
den Blick bzw. die Reaktion des Dritten als konstitutiv für ein anerkennendes
Moment der separierendes Funktion erachtet (vgl. Widmer 2009: 30f).
Auch der Anmerkung, Lacan würde im Gegensatz zu Winnicott’s Theo-
rie (1971) „eher auf den Fall misslingender Spiegelung fokussieren, in dem
die Zustände des Subjekts (…) nicht – oder nur unzureichend (…) gespie-
gelt“ (Dornes, 2000: 225) würden, müsste man mit Vorangestelltem entgeg-
nen, dass genau jener illusionäre Identifizierungsprozess des Spiegelns als
„Normalfall“ gilt, insofern die Identifikation mit dem Ab-Bild seiner selbst
den notwendigen Produktionsprozess für die Entstehung einer Ich-Funktion
darstellt. Denn die mit Lacan als Ich wahrgenommene Funktion eines „wah-
ren Selbst“, und damit stimmt Dornes ja überein, findet sich weniger über
„eine psychologische oder anthropologische Realität, als vielmehr über „eine
regulative Idee“: Der Infant siebt nicht nur sich selbst, also „kein Selbst in
Reinform (…) sondern immer auch sein selbst, wie es in den Augen des an-
deren existiert“ (Dornes 2000: 223). Insofern überschneiden sich, so könnte
man sagen, Dornes und Lacans Spiegelmodelle hier sogar an jener Stelle, wo
sich das Kind im Spiegel eines vermeintlichen Spielgefährten (Dornes) oder
einer Imago seiner selbst (Lacan) gerade nicht erkennt, sondern verkennt.
Pointiert gesagt bleibt es mit Mayer (2013), „wesentlich, (…) die alteri-
tätstheoretische Wendung zu bedenken“. Nur dann würde plausibel, dass die
freudige Anerkennung des eigenen Spiegelbildes des eigenen Körpers, „ja
noch die Identifizierung damit, im Sinne Lacans nicht gleichzusetzen mit
dem identitätslogischen Zielpunkt der bewussten Identifizierung des ‚Selbst‘
(ist). Sonst wären seine Spekulationen durch den gegenwärtigen Stand ent-
wicklungspsychologischer Forschung überholt“ (Mayer 2013: 3).
Die Funktion des Subjekts in der philosophisch dezentrierenden Sicht-
weise Lacans, (welche letztlich auf Freuds Heteronomieverdikt des Ichs als
Reiter des übermächtigen ES rekurriert) findet bzw. entsteht also allererst im
11 Insofern erscheint auch die des Öfteren bei Dornes (u.a. 2000) oder etwa Altmeyer (2005:
53) eingesetzte Dichotomisierung zwischen Winnicotts und Lacans Theorie des Spiegelns meines Erachtens problematisch, da bei Winnicott, wie Lacan ein ‚signifizierender Dritter‘, d.h. jenes spiegelnde sowie diese Spiegelung „brechende“ (Altmeyer/Thomä 2006: 21), affektregulierende Objekt existent sein muss, um eigene Anteile und damit das Selbstempfinden mittels eines markierenden Ausdrucks (vgl. Gergely/Watson 1996) bewusst werden zu lassen.
11
Auseinandersetzungsprozess mit einem ihm vorgängigen, es als solches an-
erkennenden „kleinen“ und „großen“ Anderen, der ihm im Medium des Spie-
gelns und später der Sprache die (zweifelsohne) bindende Voraussetzung
eines kohärentes Subjektstatus bereitstellt.12 Dieser Befund scheint, entwick-
lungspsychologisch gewendet, dann auch gar nicht so weit entfernt von den
Dornes’schen Rückbezügen auf die Mentalisierungstheorie der Londoner
Forschungsgruppe um Peter Fonagy, die unter Bezugnahme auf Ger-
gely/Watsons biofeedback model (1996) davon ausgeht, dass es in der frühen
Kindheit zu allererst kohärenten und kongruenten Spiegelungsprozessen am
Anderen bedarf, um ein qualitativ ebenbürtiges Selbstgefühl entwickeln zu
können (vgl. Fonagy u.a. 2004).
Insofern läge jener Bedingung mit Lacan keine pathologische Dimension
zugrunde, sondern das, was mit Hegel auf Seiten der intersubjektiven Psy-
choanalyse ihm folgende Autoren wie Green (2006), Laplanche (1992), Og-
den (2004 und 2006), Küchenhoff (1999) oder Warsitz (2004) als vorauszu-
setzende Anerkennung in der Funktion des „analytischen Dritten“ (Ogden
1994, 2004 und 2006) attestieren.
Mit diesen Ausführungen, so sollte deutlich geworden sein, werden Dor-
nes‘ und Lacans Standpunkte nicht einfach gegeneinander ausgehebelt.
Vielmehr ging es darum, systematische Differenzierungspunkte auszu-
machen, an denen die Fragestellung virulent wird, ob und inwiefern beide
von vereinbaren oder inkommensurablen Diskursarten ausgehen, die ver-
gleichbar oder quer zueinander liegen und mögliche Integrationsbemühungen
problematisch erscheinen lassen.
Literatur
Ahrbeck, Bernd (2007): Angewiesensein und innerer Konflikt – kritische Überlegun-
gen zur empirischen Säuglingsforschung. In: Eggert-Schmidt Noerr, Annelin-
de/Finger-Trescher, Urte/Pforr, Ursula. (Hrsg.): Frühe Beziehungserfahrungen.
Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 33-56.
Althusser, Louis (1977): Ideologie und ideologische Staatsapparate. In: ders.: Aufsät-
ze zur marxistischen Theorie. Hamburg: VSA, S. 108-153.
Altmeyer, Martin (2005): Innen, Außen, Zwischen. Paradoxien des Selbst bei Donald
Winnicott. In: Forum für Psychoanalyse 21, 1, S. 43-57.
Altmeyer, Martin/Thomä, Horst (Hrsg.) (2006): Die vernetzte Seele. Die intersubjek-
tive Wende in der Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 203-226.
12 Ein Befund, den auch Dornes in Lacans Theorie hervorhebt, ihn allerdings so akzentuiert,
dass das Kind die Bekundungs- und Anerkennungsgesten lediglich „zur Bewältigung seiner eigenen Hilflosigkeit braucht“ (Dornes 2000: 223).
12
Braun, Christoph (2007): Die Stellung des Subjekts. Lacans Psychoanalyse. Berlin:
Parodos-Verlag.
Bråten, Stein (1992): The virtual other in infants’ minds and social feelings. In: Wold,
H. (Hrsg.): The Dialogical Alternative. Toward a Theory of Language and Mind.
Oslo: Scandinavian Press, D. 77-97.
Bohleber (2006): Intersubjektivismus ohne Subjekt? Der Andere in der psychoanalyti-
schen Tradition. In Altmeyer, Martin/Thomä, Horst (Hrsg.), Die vernetzte Seele.
Die intersubjektive Wende in der Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Cotta,
Dammasch, Frank (2008): Triangulierung und Geschlecht. Das Vaterbild in der Psy-
choanalyse und die Entwicklung des Jungen. In: Dammasch, Frank./Katzenbach,
Dieter/Ruth, Jessica (Hrsg.): Lernen, Denken und Handeln aus psychoanalyti-
scher und pädagogischer Sicht. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel, S. 13-39.
Dornes, Martin (2000): Die emotionale Welt des Kindes. Frankfurt/M.: Fischer, 4.
Aufl.
Dornes, Martin (2004): Über Mentalisierung, Affektregulierung und die Entwicklung
des Selbst. In: Forum der Psychoanalyse 20, 2, S. 175-199.
Dornes, Martin (2006a): Spiegelung – Identität – Anerkennung. Überlegungen zu
kommunikativen und strukturbildenden Prozessen der frühkindlichen Entwick-
lung. In: Datler, Wilfried/Finger-Trescher, Urte/Büttner, Christian (Hrsg.): Die
frühe Kindheit. Psychoanalytisch-pädagogische Überlegungen zu den Entwick-
lungsprozessen der ersten Lebensjahre. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädago-
gik 10. Gießen: Psychosozial-Verlag. 2. Aufl., S. 48-62.
Dornes, Martin (2006b): Die Seele des Kindes. Frankfurt/M.: Fischer, 8. Aufl.
Fonagy, Peter/Gergely, György/Jurist, Elliot L./Target, Mary (2004): Affekt-
regulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-
Cotta.
Gergely, György/Watson, John (1996): The Social Biofeedback Theory Of Parental
Affect–Mirroring. In: International Journal of Psycho-Analysis 77, 6, S. 1181-
1212.
Göppel, Rolf (2006): Die Bedeutung der frühen Erfahrungen oder: Wie entscheidend
ist die frühe Kindheit für das spätere Leben? In: Datler, Wilfried/Finger-
Trescher, Urte/Büttner, Christian (Hrsg.): Die frühe Kindheit. Psychoanalytisch-
pädagogische Überlegungen zu den Entwicklungsprozessen der ersten Lebens-
jahre. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 10. Gießen: Psychosozial-
Verlag, 2. Aufl., S. 15-36.
Green, A. (2006): Das Intrapsychische und das Intersubjektive in der Psychoanalyse.
In Altmeyer, Martin/Thomä, Horst (Hrsg.), Die vernetzte Seele. Die intersubjek-
tive Wende in der Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 227-258.
Hegel, Georg F. W. (1807): Phänomenologie des Geistes. Kap. IV. Stuttgart: From-
manns-Verlag, 3. Aufl., S. 139-181, 1951.
13
Hegel, Georg. F. W. (1837): Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. In:
Moldenhauer, Eva/Michel, Karl Markus (Hrsg.): Werke in zwanzig Bänden –
Band 19. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1969.
Kahlenberg, Eva (2010): Aus den Augen, noch im Sinn? Vom Selbst in Anderen. In:
PSYCHE 64, 1, S. 59-85.
Klein, Melanie (1962): Das Seelenleben des Kleinkindes und andere Beiträge zur
Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Verlag.
Köhler, Lotte (2004): Frühe Störungen aus der Sicht zunehmender Mentalisierung. In:
Forum der Psychoanalyse 20, 2, S. 158-174.
Kojève, A.lexandre (1958): Hegel, eine Vergegenwärtigung: Kommentar zur Phäno-
menologie des Geistes. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Koller, Hans-Christoph (1993): Bildung im Widerstreit. Bildungstheoretische Überle-
gungen im Anschluss an Lyotards Konzeption pluraler Diskurse. In: Marotzki,
Winfried/Sünker, Heinz (Hrsg.): Kritische Erziehungswissenschaft – Moderne –
Postmoderne – Band 2. Weinheim: Juventa, S. 80-104.
Koller, Hans-Christoph (1994): Bildung als Ab-Bildung? Eine bildungstheoretische
Fallstudie im Anschluss an Jacques Lacan. In: Pädagogische Rundschau 48, 6, S.
687-706.
Koller, Hans-Christoph (1999): Bildung und Widerstreit. Zur Struktur biographischer
Bildungsprozesse in der (Post-)Moderne. München: Fink.
Küchenhoff, Joachim (1999): Verlorenes Objekt, Trennung und Anerkennung. Zur
Fundierung psychoanalytischer Therapie und psychoanalytischer Ethik in der
Trennungserfahrung. In: Forum der Psychoanalyse 15, 3, S. 189-203.
Lacan, Jacques (1954 u. 1955/1991): Seminar II. Das Ich in der Theorie Freuds und in
der Technik der Psychoanalyse. Weinheim: Quadriga-Verlag.
Lacan, Jacques (1973/1986): Schriften I. Olten: Walter-Verlag.
Lacan, Jacques (1975/1991): Schriften II. Olten: Walter-Verlag.
Lacan, Jacques (1978): Seminar XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Olten:
Walter-Verlag.
Laplanche, Jean (1992): Die unvollendete kopernikanische Revolution in der Psycho-
analyse. Frankfurt/M.: Fischer-Verlag.
Mayer, Ralf (2011): Erfahrung-Medium-Mysterium. Studien zur medialen Technik in
bildungstheoretischer Absicht. Paderborn: Schöningh.
Mayer, Ralf (2013): Vom Spiegel zur symbolischen Ordnung – Subjekt, Medialität
und Biographie. In: Heinze, Carsten/ Hornung, Alfred (Hrsg.): Medialisierungs-
formen des Autobiographischen. Konstanz: UVG-Verlag,
Meyer-Drawe, Käte (1990): Illusionen von Autonomie. Diesseits von Ohnmacht und
Allmacht des Ich. München: Kirchheim-Verlag.
Mitchell, Stephen (2003): Bindung und Beziehung. Auf dem Weg zu einer relationa-
len Psychoanalyse. Gießen: Psychosozial-Verlag.
14
Ogden, Thomas H. (1994): The Analytic Third: Working with intersubjective clinical
facts. In: International Journal of Psychoanalysis 75, 1, S. 3-19.
Ogden, Thomas H. (2004): The Analytic Third: Implications for Psychoanalytic The-
ory and Technique. In: Psychoanalytic Quarterly 73, 1, S. 167-195.
Ogden, Thomas H. (2006): Der Analytische Dritte, das intersubjektive Konzept der
Analyse und das Konzept der projektiven Identifizierung. In: Altmeyer, Mar-
tin/Thomä, Helmut (Hrsg.): Die vernetzte Seele. Die intersubjektive Wende in
der Psychoanalyse. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 35-64.
Orange, Donna, Atwood, George E. & Stolorow, Robert D. (2001): Intersubjektivität
in der Psychoanalyse. Kontextualismus in der psychoanalytischen Praxis. Frank-
furt/M.: Brandes & Apsel.
Ruhs, August (2010): Lacan. Eine Einführung in die strukturale Psychoanalyse. Wien:
Löcker-Verlag.
Schon, Lothar (2002): Sehnsucht nach dem Vater. In: Steinhardt, Kornelia/Datler,
Wilfried/Gstach, Johannes (Hrsg.): Die Bedeutung des Vaters in der frühen
Kindheit. Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 15-28.
Stern, Daniel (2003): Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta, 8.
Aufl., S. 198-230.
Stern, Daniel (2005): Der Gegenwartsmoment. Veränderungsprozesse in der Psycho-
analyse, Psychotherapie und Alltag. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel.
Warsitz, R.-P. (2004). Der Andere im Ich. Antlitz-Antwort-Verantwortung.. In
PSYCHE 58, 9-10, 783-810.
Widmer, Peter (2009): Subversion des Begehrens. Eine Einführung in Jacques Lacans
Werk. Wien: Turia + Kant, 3. Aufl.
Winnicott, Donald (1971): Vom Spiel zur Kreativität. Stuttgart: Klett-Cotta.
Abstract
In mehreren jüngeren Veröffentlichungen umreißt der Psychoanalytiker und
Entwicklungspsychologe Martin Dornes unter Rückgriff auf einschlägige
Forschungsergebnisse das Phänomen frühkindlicher Spiegelungs- und Affek-
tregulierungsprozesse und markiert unter anderem im Diskurs über das ‚wah-
re Selbst‘ konstitutive Unterschiede zwischen psychoanalytisch und philoso-
phisch motivierten Figuren von Spiegelung, Wahrnehmung und Anerken-
nung – etwa in der Auseinandersetzung mit Lacans und Winnicotts Entwick-
lungstheorien.
15
Der hieran anknüpfende Beitrag zielt zum einen darauf ab, Dornes‘ diffe-
renzierten Überlegungen im Lichte zeitgenössisch-integrativer Entwicklungs-
ansätze wie der ‚Mentalisierungstheorie‘ nachzugehen, und zum anderen
mittels Jacques Lacans an Hegel angelehnten Begriffen Anerkennung und
Begehren ein kritisch-würdigendes, alternatives Bild der frühen Identitäts-
entwicklung zu zeichnen, dass sich aus subjekttheoretischen Einsätzen speist.
Anhand dieser Beschäftigungslinie wird darüber hinaus diskutiert, inwiefern
eine realistische, repräsentationale Funktion von Selbst und Anderen, die die
bei Dornes angeschnittene Figur der ‚reziproken Anerkennung’ berührt, in
der frühen Entwicklung wesentlich über paradoxale Strukturmomente von
Verkennung und Anerkennung des so genannten „großen Anderen“ (Lacan)
als konstitutiv Fremdem verläuft.
Autorenangaben
Valentin Rumpf, Mag. phil., Doktorand und Lehrbeauftragter am Institut für
Bildungswissenschaften der Universität Wien. Forschungsschwerpunkte:
Transdisziplinäre Forschung im Schnittfeld von Systematischer Pädagogik,
Psychoanalytischer Pädagogik und Subjektphilosophie.
E-Mail: [email protected]