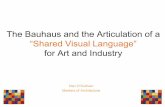Not the Bauhaus: The Breslau Academy of Art and Applied Arts
Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
Transcript of Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
Mythos Bauhaus setzt sich kritisch mit dem Bauhaus als Ikone der Moderne auseinander und stellt das Bild in Frage, das wir vom Bauhaus haben. Dabei wird die Vielfalt und Widersprüchlichkeit der schule offenbar, die in vielen aspekten die Geschichte der Weimarer Republik spiegelt. Die autoren behandeln die architekten und die architektur ebenso wie die Maler und die Rezeption der Bauhaus-Moderne in der Nachkriegszeit.
Die autoren: anja Baumhoff, Loughborough; Peter Bernhard, Erlangen; Irene Below, Bielefeld; Klaus von Beyme, heidelberg; Kathleen James-Chakraborty, Dublin; Magdalena Droste, Cottbus; Regina Göckede, Cottbus; Nicola hille, tübingen; helmuth Lethen, Wien; Dietrich Neumann, New haven; Paul Paret, salt Lake City; Wolfgang Ruppert, Berlin; sigrid schade, Zürich; Karl schawelka, Weimar; Robin schuldenfrei, Chicago; Frederic J. schwartz, London; Christoph Wagner, Regensburg.
hg. anja Baumhoff und Magdalena Droste
Mythos Bauhaus
ReimerMyt
ho
s Bau
hau
s
Zentrum für interdisziplinäre ForschungCenter for Interdisciplinary ResearchUniversität Bielefeld
Herausgegeben von Anja Baumhoff und Magdalena Drostein Kooperation mit Sigrid Schade, ICS ZürichRedaktion: Anja Baumhoff, Magdalena DrosteÜbersetzungen der Beiträge von Kathleen James-Chakraborty, Dietrich Neumann, Paul Paret, Robin Schuldenfrei und Frederic J. Schwartz: Anja Baumhoff
Gefördert durchHOCHTIEFBTU CottbusZIF BielefeldICS Zürich
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gestaltung: Studierende der Fakultät Architektur der BTU BrandenburgischenTechnischen Universität Cottbus, inbesondere Sophie Reinisch und Matthias AbendSchrift: Poynter OSTextTWOL (12pt), Dictrict (6 pt, 12pt, 72pt) Umschlagfoto: Walter Gropius, Meisterhaus Klee-Kandinsky, Dessau, 1926Restaurierung: HOCHTIEF, 1999Foto: Dominik Lengyel, 2009
© 2009 bei den einzelnen Autoren und Dietrich Reimer Verlag GmbH, Berlinwww.reimer-verlag.de
Alle Rechte vorbehaltenGedruckt auf alterungsbeständigem PapierDruck: Elbe Druckerei Wittenberg GmbHPrinted in Germany
ISBN 978-3-496-01399-0
© VG Bild-Kunst, Bonn 2009 (s. S. 363)
Zwischen Selbsterfindung und EnthistorisierungHg. Anja Baumhoff und Magdalena Droste
Reimer
MYTHOSBAUHAUS
53
In einer Meisterratssitzung am 22. Oktober 1923 erklärte Walter Gropius: »Ganz besonders schwierig ist die Frage bei den Bildhauereien. Was bisher dort geleistet wurde ist gering.«1 Enttäuscht über die schlechten Verkaufszahlen der gerade beendeten Bauhaus Ausstellung in Weimar und besorgt über die sich verschlechternde finanzielle Lage wollte Gropius die Struktur und Organisation der BauhausWerkstätten evaluieren. Indem er »die ›Bildhauerei‹ zur Diskussion« stellte, hinterfragte der Direktor den Sinn und Zweck der Stein und Holzbildhauerei, wie auch ihre handwerkliche Basis.2
Gropius hatte allen Anlass, sich Sorgen zu machen, denn von Anfang an war die Bildhauerwerkstatt durch Instabilität gekennzeichnet. 1919 wurden erstmals zwei getrennte Werkstätten für Stein und Holzbildhauerei eingerichtet, die anfangs unter der Leitung von Professor Richard Engelmann standen, der jedoch Ende des Jahres 1920 von Johannes Itten als Formmeister für die Steinbildhauerei und von Georg Muche für die Holzbildhauerei abgelöst wurde. 1921 bzw. 1922 übertrug man die Leitung der Werkstätten Oskar Schlemmer. 1924 wurden beide Werkstätten vereinigt. Mit dem Umzug nach Dessau wurde die Bildhauerei in Plastische Werkstatt umbenannt und von Joost Schmidt bis 1932 geleitet. Es ist erstaunlich, dass die Meister des Bauhauses zwar die Beziehung von freier Kunst und Architektur, von Industrie und Gegenwartskultur diskutierten, dass sie jedoch nicht in der Lage waren, eine überzeugende Auffassung von Skulptur und Plastik sowie von ihrer Stellung und Bedeutung in Lehre und Praxis des Bauhauses zu entwickeln.
Dieser Text greift die von Gropius aufgeworfene »Frage der Bildhauerei« wieder auf, indem er die sich wandelnde Praxis der Plastik am Bauhaus untersucht sowie deren Implikationen für eine Theorie der modernen Kunst. Statt einen vollständigen Überblick zu geben, wird sich dieser Text auf zwei Ereignisse aus den besonders wichtigen Jahren 1923 und 1928 konzentrieren, die das Problem der Plastik am Bauhaus beleuchten: 1923 markiert das Jahr der bedeutenden Bauhaus Ausstellung in Weimar und im Zuge dessen die entscheidende Diskussion über die Bildhauerei im Meisterrat. Das Jahr 1928 brachte die wieder auferstandene, reformierte Plastische Werkstatt und eine Publikation mit Signalwirkung von Joost Schmidt unter dem Titel »Plastik … und das am Bauhaus?!?«.3 Zwei Fotografien aus den beiden betreffenden Jahren werden uns dabei helfen, das sich verändernde Verständnis der Plastik am Bauhaus anschaulich zu machen.
Das erste Bild ist eine anonyme Fotografie der Steinbildhauerei (Abb. 03.01), die 1923 im Katalog der Bauhaus Ausstellung in Weimar abgedruckt wurde und die ein wichtiger Nachweis der Leistungen
Paul Paret Die Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
1 Protokoll des Bauhausrates vom 22. Oktober 1923, in: Volker Wahl (Hg.), Die Meisterratsproto-kolle des Staatlichen Bauhauses Weimar 1919 bis 1925. Weimar 2001, S. 318.
Abb. 03.01 Die Werkstatt für Steinbildhauerei am Bauhaus Weimar, 1923.
2 Wahl (wie Amm. 1), S. 318.
3 Joost Schmidt, Plastik… und das am Bauhaus?!?!, in: Bauhaus 2: 2/3, 1928, S. 21.
54 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
und Ambitionen des Bauhauses ist.4 Sie zeigt eine ganze Reihe teils vollendeter, teils unvollendeter Arbeiten aus Gips und Stein. Auch wenn nicht alle Werke eindeutig zugeordnet werden können, sind sie doch allein schon durch die Art und Weise ihrer Anordnung sowie durch Material und Format eindeutig als ziemlich konventionelle Skulpturen identifizierbar. Im rechten Vordergrund des Bildes sind Teile des Gipses »Abstrakte Figur« von Oskar Schlemmer erkennbar, dem Formmeister der Werkstatt. Hinter Schlemmers Figur sieht man, von rechts nach links, den Marmortorso von Kurt Schwerdtfeger und ein geradliniges Relief, ebenfalls von Schwerdtfeger, hinter welchem sich ein pyramidenartiges Grabsteinelement von Hans HoffmannLederer befindet. In der Mitte des Raumes sieht man Otto Werners »Bauplastik« und hinter ihr zur Linken Schlemmers Relief »Halbfigur mit betonten Formen«. Auf dem Tisch im hinteren Raum befinden sich weitere Arbeiten, die möglicherweise von Ilse Fehling und Joost Schmidt stammen. In der linken Ecke der Fotografie erkennt man Schwerdtfegers »Bauplastik«, außerdem Schlemmers Relief »Stehende Figur« und unter ihr zur Rechten ein kleines geometrisches Relief, das wahrscheinlich von Schmidt stammt.5 Diese Arbeiten bewegen sich alle in einem relativ engen Rahmen konventioneller Plastik–figurative Bildhauerkunst, Reliefs, Monumente und architektonische Skulpturen–, in dem sich die üblichen Kategorien und Grenzen des plastischen Programms am Bauhaus bis zur Ausstellung von 1923 widerspiegeln.
Die zweite Fotografie, die fünf Jahre später aufgenommen und in der Zeitschrift »bauhaus« im Herbst 1928 veröffentlicht wurde, zeigt völlig andere Arbeiten, die wir im ersten Moment vielleicht gar nicht als Plastiken erkennen würden (Abb. 03.02). Die Überschrift lautete »studien für lichtwerbung (der platz, die straße, das schaufenster als werbetheater)« und die Bildunterschrift nennt Heinz Loew und Franz Ehrlich aus der Plastischen Werkstatt als Hersteller. Das Bild zeigt ein fiktives großstädtisches Szenario, das von leuchtenden Symbolen, mechanischem Gerät, Reklame an Kiosken und mit dekorierten Schaufenstern bevölkert ist. Diese Fotografie repräsentiert ein völlig anderes Verständnis von Plastik, das wenig mit den konventionellen Materialien, Stilen und Erscheinungsformen gemein hat, die sich auf der Werkstattfotografie von 1923 finden. Anstelle von Gips und Stein haben wir es nun mit Fotografie und Fotomontage zu tun und der klassische Formenkanon der Statuen und Reliefs wurde durch Leuchtanzeigen und kinetische Objekte ersetzt. Statt des Werkstattinnenraums von 1923 haben wir nun das Spektakel der modernen Metropole vor uns, worauf die Bildunterschrift mit den Worten hindeutet: »der platz, die straße,
Abb. 03.02 Heinz Loew und Franz Ehrlich, Stu-dien für Lichtwerbung (der platz, die straße, das schaufenster als werbetheater), 1928, in: bau-haus 2:4 1928, S. 7.
5 Vgl. Michael Siebenbrodt (Hg.), Bauhaus Weimar. Designs for the Future. Ostfildern-Ruit 2000, S. 184. and Wulf Herzogenrath/Stefan Kraus (Hg.), Bauhaus Utopien. Arbeiten auf Papier. Stuttgart 1988, S. 124.
4 Staatliches Bauhauses Weimar 1919–1923. Weimar, München 1923 (Repr. München 1980), S. 199.
55
das schaufenster als werbetheater«. Im Laufe weniger Jahre hatte sich der Schwerpunkt der Bildhauerwerkstatt von einer frühen Beschäftigung mit architektonischen Plastiken, Monumenten und freien Bildhauerarbeiten verschoben zu einer Reflektion über die Beziehung von Plastik und funktionalem Design sowie seiner Produktion. Schließlich konzentrierte man sich bevorzugt auf Werbung und Ausstellungstände, bei denen die Fotografie eine entscheidende Rolle spielte. Die radikalen Veränderungen in der plastischen Konzeption und in den Ambitionen der Werkstatt, die in den Aufnahmen von 1923 und 1928 dokumentiert sind, werfen grundlegende Fragen über die Plastik, ihre Materialität und ihre Rolle als visuelle Praxis in der Moderne auf, wie auch über die Stellung der Plastik innerhalb des sich wandelnden Programms der BauhausModerne.
Werkstattfotografie 1923
Die Fotografie der Steinbildhauerei von 1923 ist nicht nur ein visuelles Zeugnis der darauf abgebildeten Objekte, sondern deutet auch auf die Ambitionen und Probleme der Plastik in dieser Zeit hin. Wie andere Werkstätten auch wurde die Stein und Holzbildhauerei aus der Idee heraus gegründet, dass sie zu größeren architektonischen Projekten beitragen könne, aber die erhofften Aufträge blieben aus und die Werkstatt entwickelte sich deshalb in Richtung freie Kunst weiter.6 Wie Schlemmer im Herbst 1922 bemerkte: »es wird für die Maler, als Wandmaler, nicht viel zu tun bleiben, noch weniger für die Bildhauer. Deshalb sind Wandmalerei und besonders Bildhauerei am Bauhaus auch die problematischen Werkstätten, solange sie die größere Auswirkung nicht haben.«7 Die fotografische Aufnahme der Werkstatt zeigt auch Reliefs, die in Zusammenhang mit architektonischen Projekten für die Ausstellung standen, auf die später noch ausführlicher eingegangen wird, sowie unabhängige, freie Arbeiten und Studien, die während der Ausstellung im Weimarer Landesmuseum zu sehen waren.
Das bekannteste Objekt der Aufnahme ist Schlemmers »Abstrakte Figur«, die, abgebildete in einer Teilansicht im rechten Vordergrund des Bildes, an drei Seiten angeschnitten ist.8 (Abb. 03.03) Für die BauhausAusstellung wurde der Gips »Abstrakte Figur« bei den »Freien Arbeiten der Meister« ausgestellt. Oftmals interpretiert im Sinne antiker Statuen und als Verkörperung von Schlemmers Ansichten über dreidimensionale Plastiken hat die präzise und rigide Geometrie die Figur fast zu einem Emblem der rationalistischen Moderne der zwanziger Jahre gemacht, zu einem klassizistisch anmutenden Ideal im Zeitalter maschineller Schönheit.9 Schlemmers
6 Unter den sehr frühen Aufträgen für die Bild-hauerwerkstatt war auch ein Modell für Gropius’ Märzgefallenendenkmal von 1921 und Joost Schmidts Holzreliefs für den Flur und die Tür des Hauses Sommerfeld in Berlin-Dahlem 1921.
Abb. 03.03 Oskar Schlemmer, Abstrakte Figur (Freiplastik G), 1923.
7 Andreas Hüneke (Hg.), Oskar Schlemmer: Idea-list der Form; Briefe Tagebücher Schriften. Leip-zig 1990, S. 100. Siehe auch Schlemmers Schrei-ben an den Meisterrat von 30. Oktober 1922. Vgl. Wahl (wie Anm. 1), S. 286, und Hans M. Wing-ler, Das Bauhaus 1919–1933, Weimar-Dessau-Berlin. Bramsche 1962, S. 72.
8 Anfänglich betitelt als Freiplastik G, ist diese Arbeit inzwischen als Abstrakte Figur bekannt. Vgl. Karin von Maur, Oskar Schlemmer. Bd. II Œu-vrekatalog der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken. München 1979, S. 384.
9 Vgl. Klaus Weber, Die Skulptur am Bauhaus: Holz- und Steinbildhauerei, Plastische Werkstatt, in: Experiment Bauhaus. Das Bauhaus-Archiv Berlin zu Gast im Bauhaus Dessau. Berlin 1988, S. 340. Karin von Maur, Oskar Schlemmer. Bd. I. Monographien., Passau 1979, S. 142ff.
56 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
Figur verkörpert jedoch auch die Probleme, die die Stein und Holzbildhauerei am frühen Bauhaus beschäftigten, ganz besonders die Beziehung zwischen Kunst und Handwerk sowie die von Technik und industrieller Produktion. In einem Tagbucheintrag vom Anfang November 1922 behauptet Schlemmer: »Ich glaube nicht an das Handwerk. …Es ist überholt durch die ganze moderne Entwicklung. Handwerkliches Kunstgewerbe im Zeitalter der Maschine und Technik wird Ware für die Reichen, ohne die breite Basis von ehedem und Wurzel im Volk. Das Handwerk von ehedem macht heute die Industrie, oder sie wird es machen nach ihrer ganzen Entwick lung.«10 Trotzdem stand Schlemmer dem gewandelten Engagement von Gropius für Technologie und Massenproduktion eher skeptisch gegenüber.
In einem Tagebucheintrag desselben Monats heißt es: »Ich kann kein Kunstgewerbe wollen, das nur Verdünnung der komprimierten Ideen ist. (…) Ich kann nicht wollen, was die Industrie besser schon tut, und nichts, was die Ingenieure besser tun. Es bleibt das Metaphysische: die Kunst.«11 Schlemmer wirkt jedoch gefangen zwischen den sich ändernden Auffassungen von Subjektivität am Bauhaus, zwischen einem expressionistisch gefärbten Ideal von Individualität und einer Entwicklung hin zur rationalisierten Maschinenästhetik und einer kollektiven Praxis, deren Vorbild die industrielle Produktion war. Die ganze Ambivalenz und Verwirrung von Schlemmers Position wird in der »Abstrakten Figur« deutlich, die in ihrer merk würdigen Verbindung von harten, maschinenartigen mit weichen, biomorphen Formen fast eine schizophrene Haltung einnimmt. Eine starke Schulter streckt sich in einer breit angelegten Kurve von der Figur weg, während die andere abrupt abgetrennt ist. Runde, voluminöse Formen kontrastieren mit scharfkantigen, planen Oberflächen und zwei Metallstangen dienen als prothesenartige Glied maßen, um den Korpus mit seinem verhältnismäßig großen Sockel zu verbinden, der selbst eine Mischung aus scharfen Eckkanten und geschwungenen Kurven ist. Diese Kombination zeigt ein Durcheinander in den Subjektpositionen, die nicht nur Zeichen des Menschlichen mit denen der Maschine vermischen, sondern auch Autorität mit Verletzlichkeit, Solidität und Ganzheitlichkeit mit einem verletzten Körper, in den operativ eingedrungen wurde. Selbst der Kopf erscheint nur halbseitig in einer helmartigen Einfassung.
Die »Abstrakte Figur« mag folglich weniger eine klassisch ausbalancierte Figur sein, als ein verwundeter Körper mit prothetischen Ersatzteilen und einer Rüstung zur Verteidigung, die ihn vor noch mehr Schaden bewahren soll. Sie ist, was Hal Foster unter der »dop
10 Tut Schlemmer (Hg.), Oskar Schlemmer: Briefe und Tagebücher. München 1958, S. 142.
11 Hüneke (wie Anm. 7), S. 103.
57
pelten Logik der technologischen Prothese im imaginären Raum des Hochmodernismus (versteht): die Maschine als Kastrationstrauma und als phallischen Schutz gegen eben dieses Trauma.«12 Wenn Schlemmers Figur ein Emblem der Schönheit im Maschinenzeitalter ist, dann ist es eines, das viel mit den grotesken Darstellungen der verstümmelten Veteranen des Ersten Weltkrieges von Georg Grosz oder Otto Dix gemeinsam hat, genauso wie mit den utopischen Geometrien des internationalen Konstruktivismus.13 Die »Abstrakte Figur« ist geschützt, aber auch verzehrt von der zunehmend rationalisierten Maschinenästhetik, welche das Bauhaus in den folgenden Jahren kennzeichnen sollte. Schlemmers Plastik ist emblematisch für die vielen Widersprüche der BauhausModerne.
Die Werkstattaufnahme von 1923 verstärkt durch die radikale Beschneidung und Zerstückelung der Figur an drei Seiten, die fast wie ein chirurgischer Akt wirkt, den Eindruck von Schlemmers Figur als eines beschädigten und rekonstruierten Körpers. Die Fotografie spaltet nicht nur Schlemmers Figur in der Mitte, sondern in der rechten oberen Ecke trennt sie ein Quadrat von der eingebetteten Geometrie des Kopfes der Figur und ihres Helmes ab. Außerdem grenzt Schlemmers Figur an die Rückseite von Kurt Schwerdtfegers unfertigen Marmortorso, dessen dunkle, rau gearbeitete Oberfläche nicht nur haptisch in der Textur und im Farbton einen Kontrast bildet, sondern auch in Anspruch und Eigenart ein physisches und körperliches Gegenbild zu Schlemmers sauber gearbeiteten Formen bildet.
Arbeiten von Joost Schmidt und Oskar Schlemmer zur Ausstellung 1923
Außer Schlemmers »Abstrakter Figur« ist das Bemerkenswerte an der Werkstattfotografie, wie stark sie die Objekte, die sie eigentlich darstellen will, verdeckt und abblendet, denn fast alle Gegenstände sind mindestens teilweise vom Bildrahmen angeschnitten. Skulpturale Facetten und Oberflächen lassen sich in der Fotografie nicht wirklich unterscheiden und verschmelzen stattdessen mit den Wänden und Fenstern des architektonischen Raumes, den sie ausfüllen. Diese enge Sequenz sich überschneidender Skulpturen und Reliefs, die von den linken und rechten Ecken der Fotografie hereinkommen, definieren den Raum der Werkstatt in einem Maße, dass die Skulpturen die Architektur scheinbar konstituieren, statt lediglich in ihr zu existieren. So verweist die fotografische Gestaltung auf die Bedeutung des architektonischen Gesamtkunstwerkes, statt auf die einzelner skulpturaler Objekte und betont damit eine Idee, die zentral für Gropius und das Bauhaus war.
12 Hal Foster, Prosthetic Gods. Cambridge, London 2004, S. 114.
13 Während des Ersten Weltkrieges diente Schlemmer 1914 zuerst an der französischen Front bevor er sich eine Fußverletzung zuzog, und 1915 kämpfte er an der russischen Front. Siehe Tage-bucheintrag vom 20.. März 1915, in dem er schreibt: »Was für ein Los mir in dem großen Chaos des Krieges bestimmt es? Ob ein Schuß in die Brust… Ob Krüppel, ob es gerade die rechte Hand, der rechte Arm oder das Augenlicht.» Hü-neke (wie Anm. 7), S. 15–16. Zu Schlemmers Dar-stellung des menschlichen Gesichts siehe Juliet Koss, Bauhaus Theater of Human Dolls, in: Kathleen James-Chakraborty (Hg.), Bauhaus Cul-ture: from Weimar to the Cold War. Minneapolis, 2006, S. 91ff.
58 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
Bei der Planung der Ausstellung von 1923 war die Beziehung zwischen Plastik und Architektur ein wichtiges Thema. Die prominenteste und programmatisch wichtigste Frage für die Bildhauerwerkstatt in Bezug auf die Ausstellung betraf eine Reihe von Reliefs von Joost Schmidt im Vestibül des Hauptgebäudes und von Oskar Schlemmer im Werkstattgebäude. (Diese Arbeiten tauchen auch in der Werkstattfotografie auf: Schlemmers Relief einer stehenden Figur im hinteren linken Bereich ist das Modell oder möglicherweise sogar die Gussform für eine diagonale Relieffigur, die die kleine Treppe im Eingangsbereich des Werkstattgebäudes flankiert. Das schmale Relief darunter, im rechten Teil der Aufnahme, könnte eine Studie für Schmidts Relief im Vestibül des Hauptgebäudes sein.)
Schlemmers ursprünglicher Vorschlag für die Neugestaltung des Vestibüls im Hauptgebäude bezog sich auf das BauhausManifest von 1919, als er dazu aufrief, der Malerei und Plastik ihre Funktion zurückzugeben, »die sie zu großen Zeiten hatten: Teil der Architektur als Raum und Wandgestaltung« zu sein.14 Auch Gropius erklärte in einem Brief an Henry van de Velde, dass im Vestibül »die Wandfüllungen (…) plastisch gestaltet (werden) und zwar so, dass sie nicht irgendwelche renaissanceartig aufgestellte Füllungen darstellen, sondern funtionelle Bedeutung für den ganzen Raum tragen.«15 Die Aufgabe, das Vestibül neu zu gestalten, fiel Joost Schmidt zu, der, zusätzlich zu anderen Veränderungen, drei große abstrakte Reliefs schuf, wofür er ein einfaches Vokabular elementarer Formen benutzte sowie konvexe und konkave Formen in Gips und farbigem Glas.16 (Abb. 03.04) Die angestrebte »functionelle Bedeutung« dieser Reliefs lag darin, den architektonischen Raum des Vestibüls zu akzentuieren, wie auch die räumlichen Bewegungsmöglichkeiten durch es hindurch. In Abbildung 03.04 zum Beispiel deutet die Verschränkung vertikaler und horizontaler Elemente eine menschliche Figur an, aber das Liniennetz der Bahnen und der damit verbundenen Kammern spielt auch auf die Funktion des Vestibüls und die Passage durch die Flure und Hallen des Gebäudes an. Im Werkstattgebäude gegenüber wurden Schlemmers Reliefs und Wandgemälde, zumindest teilweise, ebenfalls mit einer funktionalen Beziehung zur Architektur der Räume entworfen. (Abb. 03.05). In Schlemmers MörtelRelief an der Decke des Gebäudeeingangs zum Beispiel korrespondieren die drei sich überlappenden Figuren mit den richtungs weisenden Axen der Tür, rechts des Flures, und links der kleinen Treppe zum Hauptteil des Gebäudes. Deren Stufen sind von roten Nischenreliefs flankiert, auf denen dünne Relieffiguren in Gold und Silber zu erkennen sind, deren unterschiedliche Proportionen »entsprechend der Dynamik der Treppe« als Diagramm wie auch als
14 Zitat nach Wulf Herzogenrath, Oskar Schlemmer: Die Wandgestaltung der neuen Archi-tektur. München 1973, S. 35.
15 Walter Gropius, Brief an Henry van de Velde, den 21. Juni 1923. Thüringisches Hauptstaats- archiv Weimar, Bauhaus Sammlung, Mappe 38.
Abb. 03.04 Joost Schmidt, Relief in Vestibül des Hauptgebäude Bauhaus Weimar, 1923. zerstört, Foto: Bauhaus-Archiv Berlin.
16 Zusätzlich zu diesen Reliefs rahmte Schmidt das offene Treppengeländer in eine solide Ver-schalung ein und änderte auch einige Fensterrah-men und Beleuchtungskörper. Vgl. Herzogenrath (wie Anm. 14) S. 35–36. Im Zuge der Vorbereitun-gen der Ausstellung entfernte das Bauhaus die Bronzestatue von Rodin, Eva (ca. 1881), die seit 1911 im Vestibül stand. Daran entzündete sich eine bittere Kontroverse zwischen dem Bauhaus und der wieder erstandenen Kunstakademie, mit welcher das Bauhaus gezwungenermaßen das Gebäude teilte. Dieser Streit führte zu Vandalismus und schließlich zur Zerstörung von Schmidts Reliefs im Jahre 1924. Vgl. Paul Paret, Rodin at the Bauhaus, in: Journal of the Iris & B Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford Univer-sity 3, 2002–2003, S. 197–204.
60 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
Metapher für die physische und intellektuelle Bewegung durch den Raum des Werkstattgebäudes dienen.17 Trotz dieser Intentionen passten weder Schlemmers noch Schmidts Reliefs in das sich ent wickelnde Bauhausprogramm vom funktionalen Design und den Prinzipien des Neuen Bauens. Beide wurden von dem einflussreichen Kritiker und frühen BauhausMentor Adolf Behne harsch angegriffen, der, genau wie Gropius, inzwischen einen rigoroseren Funktional ismus befürwortete. In seiner Besprechung für die »Die Weltbühne« kritisierte Behne die Reliefs von Schlemmer und Schmidt als nutz lose Demonstration, die zeige, »dass man mit (den neuen Formen) die Wände ebenso schön dekorieren kann wie mit klassischen oder barocken Formen.«18 Behne sah darin ein fundamentales Missver stehen der Moderne, deren Produkte doch »jeden nachträglichen äußeren Schmuck abweisen« müssten. Auch Schlemmer sprach privat von einem »relativen Misserfolg« seiner Arbeit, trotz aller Energie, die er in seine Reliefs und Wandgemälde investiert hatte.19 Die Reliefs von Schlemmer und Schmidt stellen den letzten Versuch der Bildhauerwerkstatt dar, Reliefs zu schaffen, die sich auf die Architektur bezogen, denn im neuen Dessauer Schulgebäude sollte es dafür keinen Platz mehr geben.
Nach der Ausstellung 1923
In der Sitzung des Bauhausrates nach der Ausstellung am 22. Oktober 1923 machte Gropius die anfangs zitierten Bemerkungen über die ungenügenden Erfolge der Stein und Holzbildhauerei (»was bisher dort geleistet wurde, ist gering«).20 In Anbetracht der übergeordneten Ziele der BauhausWerkstätten und ihrer Beziehung zur Architektur stellte Gropius die Zukunft der Bildhauerwerkstatt damit in Frage.21 Obwohl dies nicht zum ersten Mal geschah, ist an der Zusammenkunft am 22. Oktober 1923 bemerkenswert, mit welcher Deutlichkeit diese Problematik nun angesprochen wird, und in den folgenden Abschnitten werde ich mich wiederholt auf das Protokoll dieser Sitzung beziehen.22 Ein Teil der Diskussion drehte sich um die praktische Frage, ob die Stein und Holzbildhauerei weiterhin eine Handwerksausbildung anbieten und Lehrbriefe ausstellen sollte. Dies hat seine Ursache zumindest teilweise in den drückenden finanziellen Problemen, die das Bauhaus im Herbst 1923 beschäftigten. Sehr schnell jedoch drehte sich das Gespräch um weitreichendere Fragen, die darauf hindeuten, dass es eine grund legende Unsicherheit im Hinblick auf moderne Plastik und ihre Position im Bauhaus gab.
Abb. 03.05 Oskar Schlemmer, Deckenrelief im Werkstattgebäude, Bauhaus Weimar, 1923. zerstört.
17 Oskar Schlemmer, Gestaltungsprinzipien bei der malerisch-plastischen Ausgestaltung des Werkstattgebäudes des Staatlichen Bauhauses, in: Das Kunstblatt 7, 1923, S. 340–343. Repr. in Wingler (wie Anm. 7), S. 78–79. Vgl. Wulf Herzo-genrath, Wandgestaltung, in Herzogenrath (wie Anm. 5) S. 169–188.
20 Wahl (wie Anm. 1), S. 318. Dies war die erste Sitzung des Bauhausrates, einer Art erweiterten Konzils, zu dem die Formmeister ebenso gehörten wie die Handwerksmeister und die Vertreter der Gesellen. Im Unterschied zum Meisterrat (dem nur die Formmeister angehörten) war der Bauhausrat nur ein beratendes Gremium. Gropius hatte in seiner Funktion als Direktor die Entscheidungs-macht. Vgl. Ute Ackerman, Einleitung, in: Wahl (wie Anm. 1), S. 39f. Und Anja Baumhoff, The Gen-dered World of the Bauhaus. The Politics of Po-wer in the Weimar Republic’s Premier Art Insti-tute, 1919–1932. Frankfurt a.M 2001, S. 30ff.
22 Der Mangel an produktiver Arbeit in der Plas- tischen Werkstatt wurde ebenfalls in der Meister-ratssitzung vom 11. Dezember 1922 besprochen. Vgl. Wahl (wie Anm. 1), S. 281ff.
19 Oskar Schlemmer, Brief an Otto Meyer-Amden, 21. Oktober, 1923, in: Hüneke (wie Anm. 7), S. 115.
18 Adolf Behne, Das Bauhaus in Weimar, in: Die Weltbühne 19, 1923, S. 289–292. Vgl. Wulf Herzo-genrath, Von Ornament zum Heizungskörper: Re-liefs, in: ders. Mehr als Malerei–Vom Bauhaus zur Video-Skulptur. Regensburg 1994, S. 112ff.
21 Und »stellt die ›Bildhauerei‹ zur Diskussion.«, Wahl (wie Anm. 1), S. 318.
61
24 Diese Aussage wird Gropius zugeschrieben, ist aber in dem Meisterrats–Protokoll durchge-strichen. Wahl (wie Anm. 1), S. 318.
23 »Gropius bejaht Muches Ansicht, ist für labo-ratorische Arbeit – kein Handwerk – keine syste-matische Ausbildung.« Protokoll des Bauhausra-tes vom 22. Oktober 1923, in: Wahl (wie Anm. 1), S. 319.
Wenn beispielsweise die Bildhauerwerkstatt eine systematische Ausbildung im Handwerk aufgeben würde, wie es Walter Gropius, Georg Muche, MoholyNagy und Joost Schmidt in dieser Sitzung befürworteten, sollten die beiden Werkstätten dann freie plastische Arbeiten zulassen?23 Oder sollte freies Arbeiten nicht unterstützt werden, indem man die beiden Werkstätten einfach zu machte, zumal Gropius erklärte »die Werkstatt ist kein Tummelplatz für akademische Drückerei.«24 Sollte man eine neue plastische Werkstatt aufmachen, die nicht auf spezifische Materialien ausgerichtet war, sondern einen »praktischen ArchitekturProbeplatz« (Georg Muche) bot, oder die sich »für laboratorische Arbeit« (Gropius) eignete oder in der man einfach nur mal etwas ausprobieren konnte (Joost Schmidt)?25 Diese Debatten über Handwerk, Produktivarbeit und freie Kunst entbrannten im Rahmen spezieller Auseinandersetz ungen und beleuchten die grundlegende Unsicherheit der Stellung der Plastik am Bauhaus. Josef Hartwig, der Handwerksmeister für beide Werkstätten, sprach sich natürlich gegen ein Ende der Handwerksausbildung aus. Er war für die Fortführung der beiden separaten Werkstätten auf der Grundlage der unterschiedlichen Formensprache in Holz und Stein, von denen MoholyNagy nur meinte, dass sie beide als Handwerk aus der Mode gekommen seien und dass sie deshalb »als aussterbende Angelegenheit betrachtet werden« könnten.26 Schlemmer dagegen sprach sich für freie plastische Arbeiten aus, einfach schon wegen der Nachfrage bei den Studierenden, denn »der Drang zur plastischen Betätigung (ist) groß… Man will wieder ›Akt‹ modellieren.«27
Schlemmers Argumentation wurde durch Marcel Breuer noch verstärkt, damals Geselle am Bauhaus, was wiederum Gropius verstimmte, der stöhnte: »Die Leute wollen nur Künstler sein« und er fügte hinzu, »das Bauhaus ist nicht nur Schule, sondern ProduktivApparat.«28 Wassily Kandinsky hatte auch Bedenken, die Werkstätten zu schließen, da niemand davon ausgehen konnte, dass die plastische Arbeit am Bauhaus mit einem Schlag aufhören würde. Für Kandinsky war es eher die Frage, ob man diese Entwicklung besser steuern könnte, wenn man zum Beispiel die Plastische Werkstatt anders organisierte.
Unfähig, einen Konsens zu finden, schlug Gropius schließlich vor, die Entscheidung zu vertagen, da die »verschiedenen Ansichten beweisen, daß der Fall nicht klar ist.«29 Obwohl Gropius die Diskussion an diesem Punkt beenden wollte, heißt es im Protokoll des Bauhausrates ohne weitere Erklärung »Ein allgemeiner Disput über die Materialien der Plastik und über Plastik schließt sich an.«30 Diese abschließende Erklärung fällt nicht nur wegen der Offenheit
25 a.a.O., S. 318–319.
26 a.a.O., S. 319.
27 a.a.O.
28 a.a.O.
29 a.a.O.
30 a.a.O.
62 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
ihrer Ausage auf und wegen der Andeutung einer breiten Diskussion über das Thema, sondern auch durch die Banalität und das sichtliche Desinteresse der Verwaltungssprache. Dieser nicht weiter erläuterte Satz besagt allerdings sehr wenig. Ging die darauf folgende Diskussion vielleicht in eine neue Richtung? Oder bezeugt diese allgemeine Aussage lediglich die Wiederholung all jener Argumente zur Plastik am Bauhaus, die wir bereits kennen?
Da sie ohne Ergebnis endete, deutet diese Diskussion des Lehrkörpers auf das gescheiterte Programm der Handwerksausbildung hin und verweist auf die spätere Zusammenlegung der beiden Werkstätten und ihre Umbenennung in eine einzige experimentelle Plastische Werkstatt. Zu diesem Zeitpunkt konnte jedoch noch keine Entscheidung getroffen werden und die bildhauerische Praxis am Bauhaus befand sich in einer Sackgasse. Schlemmer fasste die Lage Monate später zusammen: »Übereinstimmend ist die Meinung, daß das plastische Element als Schul und Lehrgegenstand nicht zu missen ist. …Weniger Übereinstimmung herrschte darüber, ob die Plastik als Kunstübung noch Berechtigung habe.«31
Die neugegründete plastische Werkstatt
Es dauerte noch bis Ende April, ehe die endgültige Entscheidung gefällt wurde, die Stein und Holzbildhauerei zusammen mit der Glaswerkstatt und der Bühne als »Versuchsplatz« einzustufen, womit sie zumindest nicht denselben Anforderungen zweckbestimmter und Einkommen generierender Arbeit unterlagen wie die anderen »reinen Produktivwerkstätten«.32 Nach dem Umzug nach Dessau im Jahre 1925 wurde die Bildhauerei in »Plastische Werkstatt« umbenannt und stand nun unter der Leitung von Joost Schmidt. Schon die Umbenennung an sich signalisierte das Ende der handwerklich ausgerichteten Werkstatt, da man die Hinweise auf die Materialien Stein und Holz gestrichen hatte. Auch der Terminus Bildhauerei, bei dem starke materialbezogene Konnotationen mitschwingen und der wortgeschichtlich im Verb »hauen« verwurzelt ist, entfiel. Viele Jahre lang war die neue Werkstatt nicht besonders aktiv und es dauerte bis 1928, ehe die Plastische Werkstatt wieder auftauchte, mit einem neuen und völlig veränderten Profil.33
Schmidt kündigte die Auferstehung des Plastischen in dem spöttischen, polemischen Essay an »Plastik… und das am Bauhaus?!?!«, der in der Sommerausgabe der Zeitschrift »bauhaus« 1928 erschien. Fast scheint es so, als würde Schmidts Text da fortfahren, wo die Debatte aufgehört hatte. Aber statt eine bestimmte Position zum Sinn und Zweck der Plastik am Bauhaus zu vertreten, macht sich Schmidt
32 Protokoll der Sitzung des Bauhausrates am 24. April 1924. a.a.O., S. 341. Die Wandmalerei war ursprünglich hier mit eingeschlossen, wurde aber dann herausgenommen. a.a.O., S. 332.
31 Oskar Schlemmer, Zur Krise der Stein- u(nd) Holzbildhauerei, 1. März 1924. Ausarbeitung als Anlage zum Protokoll der Sitzung des Bauhausra-tes am 4. April 1924. a.a.O., S. 337–338.
33 Zu den Verwirrungen und Problemen über die offizielle Gründung der Plastischen Werkstatt siehe Rainer K. Wick, Teaching at the Bauhaus. Ostfildern-Ruit 2000, S. 297–298. Heinz Loew erinnert sich: »Obwohl Joost Schmidt schon 1925 zum Leiter der Plastischen Werkstatt ernannt wurde, war zu dieser Zeit weder ein Etat noch ein geeigneter Raum vorhanden-um korrect zu sein, nur ein leerer Raum.« Heinz Loew, Joost Schmidt: Lehrer am Bauhaus, in: Joost Schmidt, Lehre und Arbeit am Bauhaus 1919–1932. Düs-seldorf 1984, S. 8.
Abb. 03.06. Joost Schmidt, Plastik… und das am Bauhaus?!?!, 1928, in: bauhaus 2:2–3, S. 20.
63
über die Beweggründe des Disputs lustig. Sogar der Titel seines Essays spielt auf die Absurdität der Plastik und auf ihre problema tische Vergangenheit am Bauhaus an.
Schmidt eröffnet seine Erklärung mit einem Potpourri aus Zitaten, die eine Ermüdung mit dem Problem der Plastik am Bauhaus vortäuschen: »endlich wieder…, also doch, immer noch, usw.«34 Jeder, erklärt er, werde diese Worte selbst vervollständigen können, nur um seinen eigenen Standpunkt bestätigt zu sehen. In der Plastischen Werkstatt jedoch sind wir »leichtsinnig genug, unsere‚ standpunkthaftigkeit ›aufzugeben. wir riskieren es, aus dem standpunkte die bewegpunkte‹ zu machen.« Schmidt weigert sich, zu erläutern, was er unter Plastik versteht, oder aber ein spezielles Ziel oder eine Funktion für die Werkstatt anzugeben. Den »zweck unseres tuns…,« anzugeben, höhnt er, »das führt doch jetzt zu weit.«
Schmidt fährt dann damit fort, den Idealismus des frühen Bauhaus’ zurückzuweisen und sich darüber lustig zu machen, dass die Schule die Künste in einer großen architektonischen Synthese wieder vereinigen wolle (ein Ideal, das die Reliefs im Weimarer Haupt gebäude des Bauhauses beeinflusst hatte). Er schreibt: »wir haben nicht die absicht: architektur, plastik, malerei zu einer neuen gemeinheit zu triolisieren. was sich einmal ›ent‹dreit hat, soll man nicht ›wieder‹ verkuppeln!« Indem er die Vorsilbe »ent« im Wort »›ent‹dreit« und das Wörtchen »wieder« in Anführungszeichen setzt, stellt Schmidt das Ideal in Frage, dass Malerei, Skulptur und Architektur jemals harmonisch vereinigt waren, wie es die mittelalter lichen Phantasien des frühen Bauhaus postulierten. Schmidts extravagante Ausdrucksweise tritt an die Stelle der Ernsthaftigkeit und grandiosen Moral der frühen BauhausRhetorik, gewürzt mit einer Prise groben Sarkasmus’. So spielt zum Beispiel Schmidts Wortschöpfung »triolisieren« auf eine musikalische Triole an und weckt dabei die Assoziation an eine ménage à trois. Auch das Verb »verkuppeln« enthält die sexuelle Anspielung auf eine arrangierte Ehe und ist verbunden mit dem Substantiv »Kupplerin«.
Wenn Schmidts Text sich über die Debatte zur Stellung der Plastik im BauhausProgramm lustig macht, so sprechen die Abbildungen des Textes eine eindeutigere und viel genauere Sprache (Abb. 03.06). Schmidt hat in seinen Text acht stark ausgeleuchtete fotografische Studien von geometrischen Formen, kinetischen Experimenten und Wahrnehmungstests eingebaut. Die Objekte und deren fotografische Aufnahmen wurden von Studierenden der Plastischen Werkstatt gemacht.35 Auf unterschiedliche Weise tragen alle diese Abbildungen dazu bei, die plastischen Objekte zu entmaterialisieren. Sie weisen auf das hin, was in Schmidts Essay nicht gesagt wurde: das Foto
34 Schmidt (wie Anm. 33), S. 21.
35 Loew (wie. Anm. 33), S. 8.
Abb. 03.06. Joost Schmidt, Plastik… und das am Bauhaus?!?!, 1928, in: bauhaus 2:2–3, S. 21.
64 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
grafie nun eine zentrale, sogar ausschlaggebende Rolle in der Arbeit der Plastischen Werkstatt spielt.
Viele der fotografischen Methoden und Kniffe der Angehörigen der Plastischen Werkstatt – starkes Seitenlicht, einfarbige Hintergründe, das Beschneiden und manchmal auch das Verzerren der Bilder–halfen, die Plastiken von der mondänen Welt der Objekte zu separieren und unterminierten ihre statische Materialität, die traditionellerweise das Wesen der Plastik bestimmte. Indem sie ein abstraktes, visuelles Feld kreierten, in dem Form, Volumen und deren Wahrnehmung erforscht werden konnten, halfen die Fotogra fien, die Plastik von den Einschränkungen durch Masse und Material, und implizit auch von Architektur und funktionalem Design, zu befreien.36 Das Bild in der mittleren Reihe links in Schmidts Text (Abbildung 3 im originalen Layout S. 20 von Schmidt Abb. 03.06) ist eine von zahlreichen stroboskopischen Aufnahmen und Zeitrafferstudien, in denen Bewegung dazu genutzt wurde, den Eindruck eines sogenannten »virtuellen Volumens« zu erzeugen, ein Ausdruck den MoholyNagy später in seinem Buch »von material zu architektur« 1929 entwickelte. In dem wichtigsten Kapitel des Buches, »das volumen (plastik)«, das gleich mehrere Aufnahmen der Plastischen Werkstatt enthält, beschreibt Moholy die plastische Entwicklung als den »weg vom materialvolumen zum virtuellen volumen; von der tasterfassung zur visuellen, beziehungsmäßigen erfassung.«37 Moholys Formulierung, wie auch die Bilder in Schmidts Text, fassen das Problem der modernen Plastik in quasi fotografische Begriffe optischer Wahrnehmung. Ähnliche Tendenzen, die körperliche Solidität zu überwinden und zu entmaterialisieren, die allzu konkrete und alles überragende Materialität zu transzendieren, ziehen sich wie ein roter Faden durch die moderne Plastik und durch die anspruchsvolle Fotografie, die sich mit ihr befasste.
Am Bauhaus beschäftigten sich die Fotografien von Schmidt und seinen Studenten der Plastischen Werkstatt nicht nur mit objektiven Studien zu den Themen Volumen, Form und Wahrnehmung, sondern auch mit den Untersuchung von Verzerrungen durch Schatten oder Reflektionen. Ein Beispiel für das Letztgenannte ist eine Reihe von Aufnahmen von Heinz Loew, benannt als »Fotoexperimentplastische Werkstatt« (Abb. 03.07). Hier ist die Kamera sprichwörtlich im Auge einer Maske situiert, deren Bild auf uns zurückreflektiert, während sich im Vordergrund andere Masken und Objekte mehrfach in einem reflektierenden Raum spiegeln, in dem ein Mann auf einem Tisch steht und sich nach vorn beugt, eine Drehung, die durch die Biegung der Spiegelfläche noch verstärkt wird.
Abb. 03.07 Heinz Loew, Plastische Werkstatt/Fotoexperiment, ca. 1927. Bauhaus-Archiv Berlin.
36 Vgl. Wulf Herzogenrath, (wie Anm. 18), S. 120.
37 László Moholy-Nagy, von material zu archi-tektur. Passau 1929 (Faksimile Ausgabe Mainz/Berlin 1968), S. 167.
65
1928 war die Fotografie bereits ein zentraler Bestandteil der Aktivitäten der Plastischen Werkstatt. Schmidt war allerdings nicht der erste Bauhausmeister, der mit Fotografie experimentierte. Die Ankunft von Lucia und László MoholyNagy im Jahre 1923 hatte bereits Jahre früher eine Welle individueller fotografischer Experimente an der Schule ausgelöst. Überraschenderweise lag es offenbar an der Plastischen Werkstatt, dass Fotografie erstmals Eingang in den Lehrplan des Bauhauses fand.38 Dabei fällt auf, dass ähnliche Aufnahmen wie jene, die Schmidt in seinem Text reproduzierte, nun dafür genutzt wurden, die Plastische Werkstatt auf Ausstellungen des Bauhauses der späten zwanziger Jahre zu präsentieren. Eine Fotografie der »Bauhaus Wanderschau« aus dem Jahre 1929/30 zeigt die Objekte anderer Werkstätten an Wänden und Vitrinen, während die Plastische Werkstatt durch eine Reihe fotografischer Studien an Wand tafeln vertreten ist. (Abb. 03.08) Hier sind sie keine Illustrationen und auch keine Modelle für abwesende Objekte, sondern die Fotografien sind die Produkte der Plastischen Werkstatt sie haben die plastischen Objekte erfolgreich ersetzt.
Entwicklung der plastischen Werkstatt
Es ist bemerkenswert, dass die Installation in der »Bauhaus Wanderschau« die Fotografien der Plastischen Werkstatt so ausstellt, dass sie leicht aus der Wand hervortreten, um so eine räumliche Dimension zu erzeugen, auch wenn die Bilder selbst diese gerade eliminiert haben. Die Fotografie diente nicht nur dazu, die skulpturalen Objekte zu entmaterialisieren und ihnen einen autonomen, dem Nützlichkeitsdiktat enthobenen Status zu verleihen, sondern paradoxerweise wurde sie auch zu einem Katalysator für die Plastische Werkstatt, die durch sie zu produktiver Arbeit zurückfand, indem sie Ausstellunggestaltungen und Werbungen für Designprodukte machte. Ein Beispiel, das den Bildern mit dem virtuellen Volumen, die sich in Schmidts Text finden, durchaus verwandt ist, ist Loews »Entwurf für eine rotierende Leuchtreklame« von 1928, die für den Glühbirnenfabrikanten Osram gedacht war. (Abb. 03.09) Auf einer vertikalen Stange war eine rotierende Scheibe befestigt, die die Buchstaben »OSRAM« trug, wobei eine Lichtprojektion die Buchstaben beleuchtete und ihren beweglichen Schatten auf die Straßen und Gebäude werfen sollte.39 Ein anderes Beispiel sind natürlich die Studien für Lichtwerbung von Heinz Loew und Franz Ehrlich von 1928, die bereits an Anfang dieses Textes erwähnt wurden. (Abb. 03.02) Wie Loew sich später erinnerte: »Die Anwendung der Fotografie begann in dieser Zeit eine bedeutende Rolle zu spielen (…)
38 Das »Lehrziel« der Plastischen Werkstatt beinhaltete jene Lehre, die 1928 im Katalog zum Internationalen Kunsterzieher-Kongress erläutert wurde und Gebiete enthielt wie »plastik und licht« und »optisch wahrnehmbares der materie« Wingler (wie Anm. 7), S. 152f. Vgl. Heinz Loew, (wie Anm. 33), S. 45–6. Erst im Jahre 1929 wur-de Walter Peterhans als Leiter der Fotografischen Abteilung eingestellt. Sie sollte eigentlich eine Unterabteilung Werbe-Werkstatt sein, aber es gab Spannungen und Konflikte zwischen Peterhans und Schmidt. Vgl. Lutz Schöbe (Hg.), Bauhaus Photographie aus der Sammlung der Stiftung Bauhaus Dessau. Firenze/Dessau 2004, S. 23.
39 Vgl. Ute Brüning (Hg.), Das A und O des Bau-hauses. Bauhauswerbung: Schriftbilder, Drucksa-chen, Ausstellungsdesign. Leipzig 1995, S. 241.
66 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
LichtreklameEinheiten wurden in Modellform in verschiedenen Anordnungen fotografiert, um den Eindruck von illuminierten Straßen, Plätzen, Kiosken oder individuellen Gebäuden zu vermitteln. Die Werkstatt bearbeitete eine ganze Reihe von Projekten, welche zum größten Teil auch ausgeführt wurden und den Studierenden viel seitige praktische Erfahrung gaben.«40 Hannes Meyer, der Gropius als Direktor des Bauhauses im April 1928 nachfolgte, unterstützte diese Entwicklung. Meyer betonte nicht nur die Notwendigkeit, dass die Werkstatt sich selbst finanzierte, sondern machte Schmidt zum Leiter der Druck und Reklamewerkstatt, wo er Herbert Bayer ersetzte, der das Bauhaus zusammen mit Gropius und MoholyNagy Anfang 1928 verließ. Unter ihrem Leiter Schmidt arbeiteten die Plast ische Werkstatt und die Reklame (und spätere Werbe) Werkstatt zunehmend zusammen und wurden letztendlich vereinigt. Schmidt beschrieb es für die Zeit nach dem Weggang von Gropius: »die plast ische Werkstatt blieb weiterhin Experimentierwerkstatt, in der u.a. meine Studierenden bewegliche Plastiken ausprobierten, deren praktische Folgerungen bei Ausstellungsbauten Verwendung fanden.«41
Die zunehmende Konzentration der Plastischen Werkstatt auf Werbung und Ausstellungsgestaltung kann man im Lehrplan des Bauhauses nachverfolgen. Im Frühjahr 1928, zu Beginn der MeyerÄra, wurde als »Lehrziel« der Plastischen Werkstatt angegeben: »Entwicklung und Steigerung des räumlichen Vorstellungsvermö gens.«42 Bereits Ende 1928 hatte sich die Plastische Werkstatt deut liche Ziele gesetzt, wie »die werbeplastik« und »produktivarbeit in gemeinschaft mit der werbewerkstatt«.43 Und im Herbst 1929 erschien die Broschüre »junge menschen kommt ans bauhaus!« in welcher Meyers Reorganisation der Werkstätten beschrieben wird. Hieraus geht hervor, dass die »sonderklasse plastik« den Bereich von »freier plastik«, »modellieren und gipsbearbeitung«, bis zu »räumlicheplastischekinetischen mitteln der werbung (…) sowie statische und bewegliche schaufenster lichtwerbung (umfasst).«44
Die Werbeentwürfe und Ausstellungsdisplays der Plastischen Werkstatt repräsentieren eine andere Art des Umgangs mit dem industriellen Kapitalismus. Im Unterschied zur Metallwerkstatt oder der Weberei hatte die Plastische Werkstatt nicht das Ziel, Prototypen verwertbarer Objekte für die Massenproduktion zu entwerfen. Stattdessen wandte sich die Plastische Werkstatt der Werbung und dem Ausstellungsdesign zu, um so zwischen der Objektwelt der Weimarer Republik und den visuellen Systemen von Austausch und Umverteilung zu vermitteln. Trotz ihrer Annäherung an das moderne, visuelle Spektakel, bezieht sich die Werbung der Plastischen Werkstatt auch auf das frühe Ziel des Bauhauses, die Plastik mit der
40 Loew (wie Anm. 33), S.8. Ausstellungsstände, zu denen die Plastische Werkstatt beitrug, bein-halteten auch den Junkers-Stand auf der Ausstel-lung »Gas und Wasser«, Berlin 1929 und den Stand für die »Wirtschaftlichen Vereinigung der Konserven-Industrie, Berlin« auf der Internatio-nalen Hygiene Ausstellung, Dresden, 1930. Vgl. Kai-Uwe Hemken, Guillotine der Dichter oder Aus-stellungsdesign am Bauhaus, in: Brüning (wie Anm. 39), S. 228–267.
Abb. 03.08 Bauhaus-Wanderschau 1929/30, Ausstellung im Kunstgewerbemuseum, Zurich, 1920. Foto: Zürcher Hochschule der Künste, MIZ-Archiv.
41 wie das Bauhaus erlebte. unpubliziertes Typo-skript, Bauhaus-Archiv Berlin, Joost Schmidt, S. 11.
43 Joost Schmidt, studien- u. arbeits-plan der plastischen werkstatt, Typoskript (c. 1928), Bau-haus-Archiv Berlin, Archiv Joost Schmidt, Inv.-Nr. 12012/15. Andere Arbeitsgebiete im Be-reich der Skulptur werden aufgelistet als: »räumli-che u. gestaltliche elemente der plastik; statische u. kinetische plastik; die plastische menschliche figur.«
44 junge menschen kommt ans bauhaus!, in: Gerd Fleischmann (Hg.), Bauhaus: Drucksachen, Typografie, Reklame. Düsseldorf, S. 132–133.
42 Katalog zum Internationaler Kunsterzieher-Kongreß, Prague 1928, in: Wingler (wie Anm. 7), S. 152f. Vgl. Heinz Loew, Plastische Werkstatt Dessau 1927–1932, in: Schmidt (wie Anm. 33), 44–48.
68 Paul ParetDie Bauhaus-Moderne und das Problem der Plastik
Abb. 03.09 Heinz Loew, Ohne Titel (Entwurf für eine rotierende Leuchtreklame), 1928. Foto: Bau-haus-Archiv Berlin (Reprophoto).
Architektur zu synthetisieren. (vgl. Abb. 03.02) In diesen Entwürfen ist die Plastik wiederum integriert in das übergeordnete Gebiet von totaler Gestaltung und Architektur, die nicht länger als überragender Bau, sondern als Teil des visuellen und kommerziellen Gewebes der Metropole verstanden wird. Ich möchte am Ende auf das Protokoll der Sitzung des Bauhausrates vom 22. Oktober 1923 zurückkommen und auf die Schlussbemerkung zum Thema Plastik: »Ein allgemeiner Disput über die Materialien der Plastik und über Plastik schließt sich an.« Bemerkenswert in ihrer Allgemeinheit und Offenheit, deutet diese Aussage eine intensive und weitschweifende Debatte über das Wesen der modernen Plastik an. Dies deutet auf die gelebte Erfahrung des Bauhauses zurück, die eine grundlegende Unfähigkeit anzeigt, eine gültige Position für die Plastik, ihre Theorie und Praxis zu etablieren. Im Laufe weniger Jahre reichten die Aktivitäten der Bildhauerei und Plastischen Werkstatt von freier Skulptur über archi tektonische Wandreliefs, Kinderspielzeuge und Schachspiele, Bühnenbilder und Theaterkostüme, kinetische und optische Experimente bis zur Werbung und Ausstellungsgestaltung, wobei die Fotografie eine wesentliche Rolle spielte. In der letzten Bemerkung des Protokolls mag man denn auch mehr als nur eine Beschreibung dieser speziellen Sitzung und ihrer ergebnislosen Diskussion sehen. Sie kann auch verstanden werden als eine treffende, wenn auch nicht intendierte, Charakterisierung der weitläufigen Geschichte der Plastik am Bauhaus und vielleicht sogar als eine ontologische Krise der modernen Plastik insgesamt.