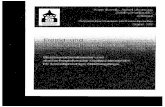Pilgerzeichen auf Glocken des 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Das Rheinland als Pilgerlandschaft...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Pilgerzeichen auf Glocken des 15. und frühen 16. Jahrhunderts. Das Rheinland als Pilgerlandschaft...
4
Schriften des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.Nr. 26
ISBN: 978-3-9815182-1-4
Herausgeber: Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V.Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2012Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalbder engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Druck: Verlagsdruckerei Schmidt · Neustadt a.d. AischLayout, Satz u. EBV: Grafikdesign-Studio Wortmann, Erkelenz
5
Schriften des Heimatvereins der Erkelenzer Lande e.V.Nr. 26
ISBN: 978-3-9815182-1-4
Herausgeber: Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V.Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2012Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalbder engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Druck: Verlagsdruckerei Schmidt · Neustadt a.d. AischLayout, Satz u. EBV: Grafikdesign-Studio Wortmann, Erkelenz
Helmut Brall-Tuchel (Hg.)
ERKELENZ 2012
Das Rheinland als Ausgangspunkt und Ziel
spätmittelalterlicher Pilgerreisen
Beiträge des interdisziplinären Symposiumsin Erkelenz am 14. Oktober 2011
49
Das Rheinland als Pilgerlandschaft im Spiegel von Pilgerzeichen auf Glocken des 14.-16. Jahrhunderts
von Hartmut KühneAuf der Grabplatte des Ritters Arnold von Harff, dessen ausgedehnte Pilgerreise ein Anlass für die in diesem Band dokumentierte Tagung war, finden sich neben dem Kopf links und rechts je vier Zeichen, gewissermaßen Piktogramme, die Hin-weise auf wichtige Stationen seiner großen Reise geben. (Abb. 1) Zur Linken ver-weist das Winkelmaß als Attribut des Apostels Thomas auf Indien, der Pilgerstab mit -flasche auf Santiago de Compostela, das Schwert mit dem zerbrochenen Rad auf das Katharinenkloster im Sinai und das Patriarchenkreuz könnte evtl. auf
1 Eine Deutung der Zeichen findet sich bei Helmut Brall-Tuchel – Folker Reichert, Rom-Jerusalem- Santiago. Die Pilgerreise des Ritters Arnold von Harff (1496-1498) (2. Auflage 2008), S. 14. Die Deu- tung des Patriarchenkreuzes, des Drachen mit der Lanze (?) und der Glocke mit Taukreuz wird hier erstmals vorgeschlagen. Dasselbe Zeichen (Taukreuz mit Glocke) findet sich auch auf der Gedächtnis- tafel für die Nürnberger Handelsfamilie Ketzel (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Inv.-Nr. Gm 581m) bei den Porträts von Georg und Ulrich Ketzel, sowie bei den älteren Vorlagen dieses Bildes; vgl. Kurt Löcher, Die Gemälde des 16. Jahrhunderts. Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Be- standskatalog (1997), S. 370-372.
Konstantinopel verweisen. Zur rechten Seite sind die gekreuzten Petersschlüssel als Hinweis auf Rom, ein Taukreuz mit Glocke als Verweis auf Saint-Antoine en Viennoise, das Stammkloster des Antoniterordens, und ein Drache mit Lanze (?) evtl. als Zeichen für den Mont Saint Michel zu lesen.1
Abb. 1: Grabplatte des Ritters Arnold von Harff in der kath. Pfarrkirche zu Lövenich
50
Diese Zur-Schau-Stellung der durch frommes Reisen erwor-benen Auszeichnungen könnte man als ein Spezifikum adliger und patrizischer Repräsentation im ausgehenden Mittelalter betrachten. In einem weiteren Horizont lässt sich diese Ver-wendung symbolischer Zeichen zur Kennzeichnung der eige-nen Person aber auch als Reflex auf einen wesentlichen Be-standteil der mittelalterlichen Pilgerkultur insgesamt begreifen. Denn als sich im Laufe des 11. Jahrhunderts der Pilgerstand als ein eigentümliches rechtliches und kulturelles Phänomen etablierte, begannen die ‚Pilger‘ auch ihren Status durch an der Kleidung getragene sichtbare Zeichen zu markieren. Zunächst waren es die Jakobsmuscheln, die man zum Aufnä-hen durchbohrte. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts kamen aus Blei-Zinn gegossene Metallplaketten, die eigentlichen Pil-gerzeichen, hinzu, die Ösen oder später auch Anstecknadeln zur Befestigung an Hut oder Mantel besaßen. (Abb. 2)
Diese millionfach hergestellten Pilgerzeichen bilden auch den Kontext für die Zei-chen auf der Grabplatte des Arnold von Harff. In einem Fall kopierte der Steinmetz hier sogar ein reales Pilgerzeichen aus Metall: Die Darstellung der gekreuzten Doppelschlüssel auf der Grabplatte entspricht recht genau den damals in Rom verkauften Pilgerzeichen.2 Zum Vergleich sei auf den Fund eines solchen Pilger-zeichens hingewiesen, das sich auf der Rückseite einer Siegelkapsel erhalten hat, mit der 1480 eine von acht Kardinälen ausgestellte Ablassurkunde beglaubigt wurde.3 (Abb. 3)
Wenn im Folgenden die Pilgerzeichen des Mittelalters behan-delt werden, so ist dies nur in einem begrenzten Ausschnitt möglich. Um dem daran Interessierten dennoch einige grund-legende Informationen zur Geschichte der Pilgerzeichenpro-duktion und ihrer Erforschung zu bieten, ist dem Beitrag ein erster allgemeiner Abschnitt vorgeschaltet.4 Im zweiten Abschnitt wird ein Überblick über die Pilgerzeichen von niederrheinischen Wallfahrtsorten geboten. Dieser Ab-schnitt ist insofern exemplarisch, als er auf den Ergebnisse einer regionalen Untersuchung aufbaut, bei der Pilgerzeichen-abgüsse auf Glocken in Nordthüringen erfasst wurden.
Abb. 2: Pilgerdarstellung vom Jakobusaltar der St. Bartholo-mäuskirche von Themar (Thüringen), spätes 15. Jh.
Abb. 3: Römisches Pilgerzeichen auf der Rückseite einer Siegelkapsel von 1480
51
Die Ergebnisse dieser Untersuchung scheinen mir aber auf allgemeine Tendenzen hinzudeuten, so dass sich durch diesen regionalen Befund aus Thüringen durch-aus Einblicke in die Wirklichkeit der niederrheinischen Wallfahrtslandschaft vom 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts ergeben. Ein dritter Abschnitt soll diese Perspektive im Hinblick auf die aus Aachen stammenden Pilgerzeichen vertiefen. Denn obwohl Aachen das mit Abstand bedeutendste spätmittelalterliche Pilgerziel im römisch-deutschen Reich war, was sich auch in der Aachener Pilgerzeichen-produktion niederschlägt, fehlt eine gründliche Aufarbeitung dieser zwischen der Ostsee, den Karpaten und dem Ärmelkanal weit verstreuten Pilgerzeichenüberlie-ferung. Dieser Beitrag wird diesem grundlegenden Mangel nicht abhelfen können. Aber einige Neufunde aus der vorgenommenen Untersuchung werfen ein neues Licht auf unsere bisherige Kenntnis der Aachener Pilgerzeichentypen und laden so dazu ein, einige grundlegende Beobachtungen zu formulieren, die als Hinweise für eine künftige Weiterarbeit dienen sollen. 1. Anmerkungen zu den Pilgerzeichen des Mittelalters und ihrer Erforschung Während die Besucher des Jakobusgrabes im spanischen Galizien schon im Ver-lauf des 11. Jahrhunderts gebohrte Jakobsmuscheln an ihrer Kleidung als Zeichen ihres Pilgerstandes zu befestigen begannen 5, setzte die Herstellung von metal-lenen Pilgerzeichen erst nach der Mitte des 12. Jahrhunderts ein. Die ältesten Pilgerzeichen wurden – soweit wir gegenwärtig wissen – in Rom6 und an Kirchen entlang der französischen Santiagowege hergestellt, nämlich zunächst in Roca-madour7, Saint Gilles8, Le Puy 9 und Saint Leonard10.
2 Zur Typologie der römischen Pilgerzeichen vgl. den Überblick von Carina Brumme, Mittelalterliche Zeugen der Wallfahrt in die Ewige Stadt - die römischen Pilgerzeichen, in: Rom sehen und sterben… Perspektiven auf die Ewige Stadt. Um 1500-2011, hg. von Kai-Uwe Schiertz u.a. (Bielefeld 2011) S. 49-55.3 Hartmut Kühne, Ein römisches Pilgerzeichen im Archiv der Stadt Mühlhausen, in: Mühlhäuser Beiträ- ge 34 (2011) S. 175-179.4 Eine vorzügliche Einführung in das Thema bietet Kurt Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen, in: Wall- fahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adalbert Stifter Vereins München, hg. von Lenz Kriss-Rettenbeck - Gerda Möhler (1983) S.203-223.5 Vgl. den Katalog der europäischen Jakobusmuschelfunde: Kurt Köster, Pilgerzeichen und Pilgermu- scheln von europäischen Santiagostraßen (1983) S. 119-155. Ergänzungen jüngerer Funde finden sich bei Robert Plötz, Signum peregrinationis. Heilige Erinnerung und spiritueller Schutz, in: Das Zei- chen am Hut im Mittelalter. Europäische Reisemarkierungen: Symposion in memoriam Kurt Köster (1912–1986) und Katalog der Pilgerzeichen im Kunstgewerbemuseum und im Museum für Byzantini- sche Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin, hg. von Hartmut Kühne - Lothar Lambacher - Konrad Vanja (2008) S. 47-70, hier bes. S. 65-68.6 Vgl. Andreas Haasis-Berner, Pilgerzeichen des Hochmittelalters (2003) S. 138-148.7 Vgl. Köster, Pilgerzeichen (wie Anm. 5) S. 43-88; Haasis-Berner, Pilgerzeichen (wie Anm. 6) S. 116-126.8 Vgl. Köster, Pilgerzeichen (wie Anm. 5) S. 89-11; Haasis-Berner, Pilgerzeichen (wie Anm. 6) S. 127-132.9 Vgl. Haasis-Berner, Pilgerzeichen (wie Anm. 6) S. 111-115.10 Vgl. Köster, Pilgerzeichen (wie Anm. 5) S. 21-42; Haasis-Berner, Pilgerzeichen (wie Anm. 6) S. 103-110.
52
Die Herstellung von Pilgerzeichen begann in deutschen Landen wohl in etwa gleichzeitig um 1200 oder im frühen 13. Jahrhundert am Kölner Dom11, am Aa-chener Marienstift12 und im Matthiaskloster bei Trier13. Diese frühen Pilgerzeichen sind massive Flachgüsse, die in der Regel eine durchgehende Fläche zeigen und deren Darstellungen ein leicht erhabenes Relief bilden. (Abb. 4a-b) In der ers-ten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden diese massiven Plaketten von durchbro-chenen, filigraneren Zeichen abgelöst, die man „Gittergüsse“ nennt. Hier werden die Darstellungen durch Linien gebildet, zwischen denen der Hintergrund durch-scheint. (Abb. 4c) Diese Herstellungstechnik ermöglichte es, mit derselben Mate-rialmenge wesentlich größere Zeichen herzustellen, die z.T. mehr als 10 cm Höhe erreichten, während die älteren Flachgüsse selten über 5 cm Höhe besaßen. Seit dem späten 15. Jahrhundert wurden Pilgerzeichen auch als Brakteaten herge-stellt, d. h. es handelte sich um einseitig geprägte Bleche, in die zur Befestigung Löcher eingestanzt wurden.
11 Zu den Kölner Drei-Königs-Pilgerzeichen vgl. den Gesamtkatalog von Andreas Haasis-Berner - Jörg Poettgen, Die mittelalterlichen Pilgerzeichen der Heiligen Drei Könige. Ein Beitrag von Archäo- logie und Campanologie zur Erforschung der Wallfahrt nach Köln, in: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 30 (2002) S. 173-202.12 Die Bearbeitung der Aachener Pilgerzeichen, der größten und differenziertesten Gruppe von mittel- alterlichen Pilgerzeichen überhaupt, ist ein Desiderat der Forschung. Die Zusammenstellung von Pe- ter Rong, Mittelalterliche Aachener Pilgerzeichen aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts (2000) ist unzuverlässig. Die Aachener Pilgerzeichen werden im dritten Teil dieses Beitrags gesondert thema- tisiert.13 Vgl. Hartmut Kühne - Jörg Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen aus der Diözese Trier: Kurzkata- log und Befunde, in: Wege zum Heil. Pilger und heilige Orte an Mosel und Rhein, hg. von Thomas Frank - Michael Matheus - Sabine Reichert (2009) S. 135-180, bes. S. 138-141 und S. 149-163.14 Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 4), dort in der Kartenlegende S. 214f.15 Einen vorzüglichen Überblick über die Herstellungstechnik mittelalterlicher Pilgerzeichen und anderer Weißmetallgüsse bietet Daniel Berger, Herstellungstechniken hoch- und spätmittelalterlicher Klein-
Abb. 4a und 4b: Aachener Pilgerzeichen, 1. Hälfte des 14. Jhs. (?)
53
Der Übergang von den Flachgüssen zu den Gittergüssen erfolgte etwa zeitgleich mit der ra-santen Ausbreitung der Pilgerzeichenherstellung auch an nur regional besuchten Wallfahrtsorten. Kurt Köster kannte im Jahre 1983 insgesamt 257 Wallfahrtskirchen in ganz Europa, an denen Pil-gerzeichen verkauft wurden.14 Inzwischen wird man besser von mindestens 500 Kirchen in Eu-ropa ausgehen dürfen, an denen Pilgerzeichen ausgegeben wurden.Hergestellt wurden die Pilgerzeichen aus ei-ner Blei-Zinn-Legierung mittels einer rationellen Gusstechnik in steinernen Modeln.15
An einigen Orten haben sich Rechnungen aus der Zeit um 1500 erhalten, aus de-nen hervorgeht, dass in Klosterneuburg bei Wien (hl. Leopold), in der Kreuzkapel-le des westfälischen Stromberg und der Georgskapelle von Gettorf in Schleswig jährlich zwischen 1000 und 2500 Zeichen verkauft wurden. In einzelnen Fällen wurden aber auch ganz andere Größenordnungen erreicht. In der Hochphase der Wallfahrt zur Schönen Maria von Regensburg von 1519 bis 1523 verkaufte man jährlich zwischen zehn- und zwanzigtausend Zeichen16 und auch eine kleine Wall-fahrtskapelle in Wersdorf bei Weimar kam auf fast 10 000 verkaufte Pilgerzeichen im Jahr.17 In diesem Zusammenhang wird in der Literatur gerne auf jene 130 000 Pilgerzeichen verwiesen, die während der zweiwöchigen Engelweihe im Kloster Einsiedeln im Jahre 1466 nach der Konstanzer Chronik des Gebhard Dacher verkauft wurden. Das Stück kostete nur zwei Pfennige, was dem Kloster durch die große Menge dennoch insgesamt 1300 Gulden eingebracht haben soll18. Die Preise für ein einzelnes Zeichen waren nicht nur in Einsiedeln moderat; um 1500
objekte aus Zinn, in: Hendrik J. E. van Beuningen - Adrianus Maria Koldeweij - Kicken u.a., Heilig en Profaan 3. 1300 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties (2012) S. 39-55.16 Vgl. die Zusammenstellungen der verschiedenen Daten bei Hartmut Kühne, Zwischen Bankrott und Zerstörung – vom Ende der Wallfahrten in protestantischen Territorien, in: Wallfahrt und Reformation – Pout’ a reformace. Zur Veränderung religiöser Praxis in Deutschland und Böhmen in den Umbrü- chen der Frühen Neuzeit, hg. von Jan Hrdina - Hartmut Kühne - Thomas T. Müller (2006) S. 201- 220, hier S. 210f.17 Hartmut Kühne, Rechnungsbücher als Quellen der Pilgerzeichenforschung. Zwei exemplarische Fun- de aus Thüringen: Die Reiserechnung des Grafen Johann III. von Henneberg zum Mont Saint Michel und das Rechnungsbuch der Kapelle von Wersdorf bei Apolda, in: Wallfahrer aus dem Osten. Mittel- alterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine, hg. von Hartmut Kühne - Lothar Lamba- cher - Jan Hrdina (2012) S. 383-412, hier bes. S. 405f. und S. 411f.18 „Und darnach als die engelwihin ußgieng, do hat man ußgerechnet an den zaichen, die die bilgrim kofen ain umb 2 Pf[ennige], das hundertusend und 30000 bilgrim da sind gesin, und hant doch nit alle zaichen genomen. [...] do hett man gerechnet uß, das man uß den zaichen hett gelöst 1300 guldin.“ Die Chroniken der Stadt Konstanz, hg. von Philipp Ruppert (1891) S. 260.
Abb. 4c: Aachener Pilgerzeichen, drittes Viertel des 14. Jhs. (?)
54
zahlte man in deutschen Landen zwischen einem bis drei Pfennigen für das Stück. Allerdings gab es seit dem 15. Jahrhundert auch teurere, aus Silber gegossene Zeichen, die gelegentlich vergoldet waren.19 Selten macht man sich klar, dass diese preiswerten Pilgerzeichen vor der Erfin-dung der neuen Drucktechniken des 15. Jahrhunderts die einzige Form von priva-tem Bildbesitz für breite Schichten der Bevölkerung darstellten.In den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts ging die Pilgerzei-chenproduktion in den meisten Regionen Europas zu Ende. Dies war vor allem durch jene Krise verursacht, welche die reformatorische Bewegung für alle For-men traditioneller Frömmigkeit mit sich brachte, so dass der ‚Absatzmarkt’ zeitwei-lig zusammenbrach. In einer längerfristigen Perspektive wurden die Pilgerzeichen aber durch die zweiseitig geprägten Wallfahrtsmedaillen abgelöst, die für die ka-tholische Barockfrömmigkeit kennzeichnend wurden und die sich bereits um 1500 ankündigten. Die Kenntnis der mittelalterlichen Pilgerzeichen ging jedenfalls in der frühen Neuzeit verloren. Erst als bei den Flussbegradigungen des 19. Jahrhunderts Pilgerzeichen in gro-ßer Zahl als archäologisches Fundgut aus dem Schlamm der Themse, der Seine, der Loire, der Saône und der Sambre auftauchten, kam es zu einer Wiederentde-ckung dieser mittelalterlichen Massenartikel, was ihnen auf dem Antiquitätenmarkt eine kurzzeitige Konjunktur bescherte.20 Dieses Interesse verlor sich in Sammler-kreisen aber spätestens nach dem Ersten Weltkrieg. Damals war bereits ein neuer Impuls zur Erforschung der Pilgerzeichen von dem Dänen Frederick Uldall ausge-gangen, der im Jahre 1905 seine erste Untersuchung über Pilgerzeichen als Ab-güsse auf spätmittelalterlichen Glocken in Dänemark und Mecklenburg publizier-te.21 Seit dem 14. Jahrhundert hatten Glockengießer nämlich Pilgerzeichen zum Glockenschmuck verwendet, indem sie diese in den Glockenmantel eindrückten. Die flüssige Glockenspeise verdrängte das leichter schmelzbare Weißmetall, so dass eine Kopie des Pilgerzeichens auf der Oberfläche in der härteren Bronze zurückblieb. Von Uldall angeregt suchte der Thüringer Pfarrer Paul Liebeskind auf mitteldeutschen Glocken ähnliche Abgüsse. Durch seine Beiträge wurden beson-
19 Vgl. die Zusammenstellung entsprechender Belege bei Andreas Haasis-Berner, Pilgerzeichenfor- schung. Forschungsstand und Perspektiven, in: Spätmittelalterliche Wallfahrt im mitteldeutschen Raum. Beiträge einer interdisziplinären Arbeitstagung Eisleben 7. / 8. Juni 2002, hg. von HartmutKüh- ne - Wolfgang Radtke - Strohmaier-Wiederanders (2002) S. 63-83, hier S. 67f.20 Zur Wiederentdeckung der Pilgerzeichen im 19. Jahrhundert vgl. die kurzen Notizen bei Haasis-Ber- ner, Pilgerzeichenforschung (wie Anm. 19) S. 63 und die Darstellung bei Helena Koenigsmarková - Hartmut Kühne, Die Prager Pilgerzeichensammlung. Eine sammlungs- und forschungsgeschichtliche Einleitung, in: Hartmut Kühne - Carina Brumme - Helena Koenigsmarková, Jungfrauen, Engel, Phal- lustiere. Die Sammlung mittelalterlicher französischer Pilgerzeichen des Kunstgewerbemuseums in Prag und des Nationalmuseums Prag (2012) S. 15-30, bes. S. 15-19.21 Frederick Uldall, Schwesterglocken aus dem Mittelalter im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin und dem Königreich Dänemark, Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Alter- tumskunde 70 (1905), S. 153-182. Grundlegend wurde aber der ein Jahr später publizierte Glocken- atlas Frederick Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker (1906). Die Sammlung mittelalterli-
55
ders Glockenkundler und die im Rahmen der Erstellung von Kunstdenkmalinven-taren der deutschen Länder auch mit der Inventarisation von Glocken befassten Denkmalkundler auf diesen Glockenschmuck aufmerksam.22 Als im Zweiten Welt-krieg Glocken als Rohstoffreservoir für die Rüstungsindustrie beschlagnahmt wur-den, brachte dieser Vorgang wenigstens für die abgelieferten, aber nicht mehr zur Vernichtung gelangten Glocken den positiven Effekt einer ansatzweisen Inven-tarisation, deren Ergebnisse durch das „Deutsche Glockenarchiv“ dokumentiert werden, das sich heute im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg befindet.23 Auch auf der Grundlage dieser Dokumentation baute der Frankfurter Bibliothekar Kurt Köster im ‚Nebenberuf’ eine Materialsammlung zu europäischen Pilgerzei-chen auf, die nach seinem Tod 1986 als „Zentrale Pilgerzeichenkartei Kurt Köster“ dem „Deutschen Glockenarchiv“ zugeordnet wurde und ca. 6500 Einzelnachwei-se enthält.24 Der promovierte und habilitierte Mediävist Köster hatte nämlich seit den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts die Pilgerzeichen als sein Lebensthema ent-deckt. Seit dieser Zeit sammelte und analysierte er im Nebenberuf mit großer Akribie Nachweise dieser mittelalterlichen Wallfahrtszeugnisse, die er seit 1956 immer wieder in kleineren und größeren Aufsätzen dem interessierten Fachpu-blikum vorstellte. Neben der immensen Sammelleistung hat Köster durch seine strenge ikonographische Typisierung der Zeichen ein methodisches Instrumenta-rium geschaffen, das die Forschung bis heute bestimmt. Freilich hat sein früher Tod 1986 vor der Fertigstellung des von ihm geplanten großen Buches über die mittelalterlichen Pilgerzeichen auch dazu geführt, dass entsprechende Forschun-gen vor allem in Deutschland für ein gutes Jahrzehnt stagnierten.In den letzten 25 Jahren haben die enormen archäologischen Neufunde in den Niederlanden, z.T. aber auch in England, in Frankreich und zuletzt an der polni-schen und deutschen Ostseeküste die europäische Pilgerzeichenforschung vor-angetrieben. In den Niederlanden hat sich die Forschung optimal vernetzt, weil hier seit gut zwei Jahrzehnten der Kunstgeschichtliche Lehrstuhl der Universität Nimwegen
cher französischer Pilgerzeichen des Kunstgewerbemuseums in Prag und des Nationalmuseums Prag (2012) S. 15-30, bes. S. 15-19.22 Paul Liebeskind, Pilger- und Wallfahrtszeichen auf Glocken, Teil 1–3, in: Die Denkmalpflege 6 (1904) Nr. 7, S. 53-55; 7 (1905), Nr. 15, S. 117-120; 7 (1905), Nr. 16, S. 125-128.23 Vgl. Ludwig Veit, Das Deutsche Glockenarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg 1965–1985, in: Lusus campanularum. Beiträge zur Glockenkunde, Festschrift zum 80. Geburtstag von Sigrid Thurm, hg. von Tilmann Breuer (1986), S. 91–98; Claus Pese, Das Deutsche Glocken- archiv, in: Mehr als nur Kunst. Das Archiv für Bildende Kunst im Germanischen Nationalmuseum, bearb. von Claus Pese (1998), S. 136-145.24 Jörg Poettgen, Europäische Pilgerzeichenforschung. Die Zentrale Pilgerzeichenkartei (PZK) Kurt Kösters († 1986) in Nürnberg und der Forschungsstand nach 1986, in: Jahrbuch für Glockenkunde 7/8 (1995/1996), S. 195-206; Ders., Der Beitrag der Glockenkunde zur Pilgerzeichenforschung von Kurt Köster bis heute, in: Das Zeichen am Hut (wie Anm. 5) S. 31-46.
56
unter der Leitung von Jos Koldeweij seine Forschungsarbeit mit der Arbeit der „Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes“ des ambitionierten Pri-vatsammlers Hendrik J. E. van Beuningen verknüpfen konnte, der gegenwärtig über die weltweit größte Sammlung von Pilgerzeichen mit etwa 5000 Einzelstü-cken verfügt. Aus dieser Zusammenarbeit heraus sind inzwischen drei bedeuten-de Korpuswerke („Heilig en profaan“) mit jeweils ca. 1000 Pilgerzeichen publiziert worden.25
Freilich stellt sich mit der europaweit wachsenden Zahl der Funde zunehmend das Problem, die national oder regional betriebenen Fundauswertungen miteinander zu verknüpfen. Es bedürfte einer Arbeitsstelle, die unter den heutigen komplexe-ren Bedingungen der wissenschaftlichen Kommunikation jene Rolle einnehmen könnte, die Kurt Köster als Nestor der Pilgerzeichenforschung am Ende seines Lebens ausfüllte. Als sein wissenschaftliches Vermächtnis 1986 dem Germani-schen Nationalmuseum übergeben wurde, war damit die Hoffnung verbunden ge-wesen, ein damals in Planung befindliches Institut für Realienforschung, ähnlich dem der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Krems, würde diese Aufgabe mit übernehmen26, was freilich nicht geschah. Seit ich im Sommer 1999 die „Zentrale Pilgerzeichenkartei Kurt Köster“ in Nürn-berg erstmals zu Gesicht bekam, überlegte ich, wie die dort zusammengetragenen Materialien aus dem Zustand sorgfältiger Archivierung wieder in die wissenschaft-liche Kommunikation einzuspeisen wären. Ein im Sommersemester 2001 veran-staltetes Seminar an der Humboldt-Universität zu Berlin mündete in die zur jener Zeit des ersten Internet-Booms naheliegende Idee, die in Nürnberg bewahrten Daten zusammen mit den Neufunden in Form einer online abrufbaren Datenbank zusammenzuführen. Diese Unternehmung wurde sowohl von engagierten und in-ternetaffinen Studenten als auch von an der Sache interessierten Wissenschaft-lern wie Wolfgang Brückner (Würzburg), Andreas Haasis-Berner (Waldkirch) und Jörg Poettgen (Overath) unterstützt, so dass die „Pilgerzeichendatenbank“ 2002 als Testprojekt „online“ ging und bis heute unter www.pilgerzeichen.de aufgerufen
25 Hendrik J. E. van Beuningen - Adrianus Maria Koldeweij, Heilig en profaan. 1000 laatmiddeleeuw- se insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen (1993); Dies. - Dory Kicken, Heilig en profaan 2. 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties (Cothen 2001); Dies. (wie Anm. 15). Die drei Standardwerke werden künftig wie auch sonst üblich als HP I, HP II und HP III ab- gekürzt. 26 Vgl. Wolfgang Brückner, Kurt Köster und das Pilgerzeichenarchiv. Zu Tode des Historikers und Bib- liothekars, in: Bayerische Blätter für Volkskunde 13 (1986) S. 100-102, wieder abgedruckt in: Ders., Volkskundler im 20. Jahrhundert (Würzburg 2000) S. 138-140. 27 Vgl. Lothar Lambacher, Museale Grundlagen, Stand und Perspektiven des ‚Berliner Pilgerzeiche- projekts‘, in: Wallfahrer aus dem Osten (wie Anm. 17) S. 13-30, bes. S. 21-23. 28 Neben der Berliner Tagung im November 2006 - vgl. den Tagungsband Das Zeichen am Hut (wie Anm. 5) - und der Prager Tagung im April 2010 – vgl. den Tagungsband Wallfahrer aus dem Osten (wie Anm. 17) – wurde im Oktober 2011 auch die Jahrestagung der Deutschen Sankt-Jakobus-Ge- sellschaft dem Thema gewidmet. Ein Tagungsband ist in Vorbereitung: Pilgerzeichen – Pilgerstraßen, hg. von Klaus Herbers – Hartmut Kühne (voraussichtlich 2012).
57
werden kann. Das Echo war überraschend positiv, es gab vielfältige Hinweise, freundliche Kritik und eindringliche Appelle zur Weiterarbeit in einem kaum erwar-teten Umfang. Freilich gelang es nicht, bei einer der großen wissenschaftlichen Förderinstanzen jene Mittel einzuwerben, von denen eine Professionalisierung und Verstetigung des Vorhabens abhing - drei bei unterschiedlichen Stiftungen in den Jahren 2002, 2005 und 2009 eingereichte Anträge scheiterten. Mit der drohenden und schließlich im Jahre 2007 vollzogenen Auflösung des Lehrstuhls für Christliche Archäologie, Denkmalkunde und Kulturgeschichte an der Hum-boldt-Universität, der dem Projekt eine institutionelle Anbindung geboten hatte, schien das Vorhaben einer Bündelung der Pilgerzeichenforschung zunächst an sein Ende gekommen zu sein.27 Inzwischen hat das Projekt aber mit dem Berli-ner Kunstgewerbemuseum ein neues Dach gefunden. Eine Reihe von Tagungen28 und einschlägigen Publikationen29 nähren die Hoffnung, dass es mittelfristig doch gelingen könnte, die Berliner „PilgerzeichenDatenbank“ zu einem Kompetenzzen-trum für die Bestimmung und Interpretation der europäischen Pilgerzeichen mit einem Schwerpunkt für Ostmitteleuropa auszubauen.
2. Pilgerzeichen vom Niederrhein auf Glocken in Nordthüringen – ein exemplarischer BefundAuf der großen Ausstellung „Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400“, die das Kölner Schnütgen-Museum 1972 veranstaltete, wurden erstmals mittelalterliche Pilgerzeichen als eigenes Thema im Rahmen einer großen Sonderausstellung museal präsentiert. Nicht zufällig hatte der damals im Hauptberuf als Generaldi-rektor die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main leitende Kurt Köster sämtliche einschlägigen Katalogtexte verfasst.30 Er hatte bei den Ausstellungsmachern wohl auch darum geworben, die eher un-scheinbaren Metallgüsse oder deren Glockenabgüsse zusammen mit den Meis-terwerken der mittelalterlichen Schatzkunst dem Ausstellungspublikum darzubie-ten. Mit dem Beitrag zum Kölner Katalog hatte es Köster vermocht, das Thema
29 Hier sei vor allem auf die Kataloge zu einzelnen größeren Pilgerzeichensammlungen verwiesen: Hartmut Kühne – Carina Brumme, Der Pilgerzeichenfund am Kloster Seehausen und sein historischer Kontext. Mit einem Katalog des Seehausener Fundes, in: Sachkultur und religiöse Praxis, hg. von Dirk Schumann (2007) S. 406–457; Hartmut Kühne unter Mitarbeit von Carina Brumme – Stefan Kra- bath – Lothar Lambacher, Europäische Pilgerzeichen und verwandte Weißmetallgüsse des hohen und späten Mittelalters im Kunstgewerbemuseum und im Museum für Byzantinische Kunst der Staat- lichen Museen zu Berlin [Katalog], in: Das Zeichen am Hut (wie Anm. 5) S. 249-384; Kühne - Brumme - Koenigsmarková, Jungfrauen (wie Anm. 21).30 Kurt Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen und Wallfahrtsdevotionalien, in: Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800-1400, hg. von Anton Legner (1972) S. 146-160.
58
Pilgerzeichen wenigstens kurzzeitig aus dem Bereich des wissenschaftlichen Spezialistentums auf die Bühne der kulturgeschichtlich interessierten Öffentlich-keit zu bringen31.Die Katalogbeiträge Kurt Kösters von 1972 und die ein Jahr später von Ursula Hagen vorgelegte Monografie32, die im Falle der mittelalterlichen Pilgerzeichen aber nicht über die Texte Kösters hinausgeht, sind freilich bisher die einzigen Ver-suche geblieben, einen Gesamtüberblick zu den mittelalterlichen Pilgerzeichen aus dem mittel- und niederrheinischen Raum zu gewinnen, der durch das Wall-fahrtsdreieck Köln – Aachen (Maastricht) – Trier seit dem 13. Jahrhundert das dominierende Wallfahrtszentrum im römisch-deutschen Reich darstellte.33 Diese singuläre Stellung in der mittelalterlichen Wallfahrtsgeographie führte auch dazu, dass aus keinem anderen deutschen Gebiet ähnlich verschiedenartige und zahl-reiche Pilgerzeichentypen bekannt sind. Für folgende Kirchen konnte bisher eine Produktion von Pilgerzeichen nachgewiesen oder zumindest wahrscheinlich ge-macht werden:
- Marienstift Aachen34
- Domkirche Köln (Heilige Drei Könige)35
- Stiftskirche Sankt Ursula in Köln36
- Servatiusstift in Maastricht37
- Stiftskirche Sankt Quirinius in Neuss38
- Abteikirche Kornelimünster39
- Matthiaskloster Trier40
- Domkirche Trier (Heiliger Rock)41
- Kloster St. Maria ad martyres Trier42
- Klosterkirche Eberhardsklausen43
- Wallfahrtskapelle Hausenborn44
- Chorherrenstift St. Goar45
- Pfarrkirche Hadamar46
- Lambertistift Düsseldorf47
- Saint-Hubert in den Ardennen48
- Pfarrkirche Düren (Annenhaupt)49 - Gustorf bei Neuss (St. Leonhard)50
- Wesel (St. Antonius)51
- Münstereifel (St. Chrysanthus)52
- Abteikirche Brauweiler53
31 Kurt Köster konnte das Thema auch in den folgenden Jahren bis zu seinem Tod in einer Reihe gro- ßer kulturgeschichtlicher Ausstellungen präsentieren, so der Aachener Zisterzienserausstellung 1980, in der Marburger Ausstellung zur heiligen Elisabeth 1981, in der großen Münchner Ausstellung „Wall- fahrt kennt keine Grenzen“ 1984, in der Braunschweiger Ausstellung zu Kunst und Kultur des Bürger- tums in Norddeutschland 1985 und im selben Jahr auch in der Genter Ausstellung zur Santiagofahrt.32 Ursula Hagen, Die Wallfahrtsmedaillen des Rheinlandes in Geschichte und Volksleben (1973).33 Dieser Sachverhalt wurde in der älteren Literatur zwar wahrgenommen – vgl. u.a. Erich Stephany, Der Zusammenhang der großen Wallfahrtsorte an Rhein – Maas – Mosel, Kölner Domblatt 23/24 (1964) S. 163 - 179 – ist aber erst in den letzten Jahren besonders von Wolfgang Schmid, Die Wall- fahrtslandschaft Rheinland am Vorabend der Reformation. Studien zu Trierer und Kölner Heiltums- drucken, in: Wallfahrt und Kommunikation. Kommunikation über Wallfahrt, hg. von Bernhard Schnei- der (2004) S. 17-195; Ders.- Paula Giersch, Rheinland – Heiliges Land. Pilgerreisen und Kultur- kontakte im Mittelalter (2004) intensiver in den Blick genommen worden, ohne dass dieses Thema damit schon ausgeschöpft wäre.34 Vgl. dazu den Abschnitt 3 dieses Beitrags.35 Für diese Zeichen liegt eine Gesamtdarstellung vor: Haasis-Berner – Poettgen, Die mittelalterli- chen Pilgerzeichen (wie Anm. 11).
59
36 Jörg Poettgen, Kölner Pilgerzeichen der Heiligen Ursula – Zeugnisse einer im 12. Jahrhundert be- ginnenden Wallfahrt, in: Pilgerzeichen – Pilgerwege (wie Anm. 28).37 Die Maastrichter Pilgerzeichen weisen einen reichen Typenkanon auf, dessen Untersuchung bisher noch nicht erfolgte. Einen Überblick über die jüngeren Formen ab dem 14. Jahrhundert vermitteltKös- ter, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 154f. Für die älteren Flachgüsse sind die nieder- ländischen Kataloge einschlägig: HP I (wie Anm. 25) S. 192-196; HP II (wie Anm. 25) S. 288-295; HP III (wie Anm. 25) S. 157-161. Zu den Zeichen mit der Darstellung des Büstenreliquiars des hl. Servatius vgl. Jos Koldeweij, Das Servatius-Büstenreliquiar in der Maastrichter Servatiuskirche und seine liturgische Nutzung, in: Kunst und Liturgie im Mittelalter, hg. von Nicolas Bock u.a. (2000) S. 217–233.38 Kurt Köster, Neusser Pilgerzeichen und Wallfahrtsmedaillen. Ein Beitrag zur Geschichte der Quiri- nus-Verehrung, Neusser Jahrbuch für Kunst, Kulturgeschichte und Heimatkunde 1 (1956) S. 15–28; Ders., St.-Quirinus-Wallfahrten und ihre Pilgerandenken. Neue Studien zur Kultgeschichte und Iko- nographie des Neusser Heiligen, ebd. 5 (1960) S. 8–26; Ders.,St. Quirinus-Pilgerandenken. Ein un- bekanntes Neusser Wallfahrtszeichen auf einer Altartafel Derick Baegerts, ebd. 7 (1962) S. 39–42; Ders., Die Pilgerzeichen der Neusser Quirinus-Wallfahrt im Spätmittelalter. Originale Fundstücke – Abgüsse auf Glocken – Bildzeugnisse, ebd. (1984) S. 11-29.39 Die Pilgerzeichen aus Kornelimünster sind in der Forschung umstritten. Hatte noch Köster, Mittelal- terliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 156 Plaketten mit der Darstellung des heiligen Papstes mit seinem Attribut, dem Horn, eindeutig Kornelimünster zugerechnet, so werden diese Zeichen von der niederländischen Forschung zumeist nach Ninove gewiesen, vgl. HP III (wie Anm. 25) S. 111-114 mit Verweisen auf die Funde in HP I und HP II. Nur für die Zeichen mit der Büste des Heiligen gilt dies nicht, vgl. HP II (wie Anm. 25) S. 254.40 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) bes. S. 138-141 und S. 149-163.41 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 141-143 und S. 164-170.42 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 171.43 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 174-176.44 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 177.45 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 177.46 Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 177f.47 noch Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S.157.48 Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 158.49 Kurt Köster, Wallfahrtszeichen und Pilgerdevotionalien aus der Frühzeit der Dürener Sankt-Anna- Wallfahrt, in: St. Anna in Düren, hg. von Erwin Gatz (1972) S. 191–209; Jörg Poettgen, Zwei unbe- kannte Medaillen der Dürener St.-Annen-Wallfahrt, in: Dürener Geschichtsblätter 77 (1988) S. 25 - 28; Ders., Die Anfänge der Dürener St.-Anna-Wallfahrt im Zeugnis der Anna-Glocke von Vianden (1503), ebd. 85 (2001) S. 31-59. 50 Köster, Pilgerzeichen und Pilgermuscheln (wie Anm. 5) S. 40f. 51 HP II (wie Anm. 25) S. 248.52 Das Zeichen ist bisher nur als einzelner Glockenabguss auf einer 1526 gegossenen Glocke in Kirspe- nich nachgewiesen und nicht publiziert. Der Nachweis findet sich im Deutschen Glockenarchiv, Ger- manisches Nationalmuseum Nürnberg, Karteikarte 15/13/124. 53 Diese Herkunft des Pilgerzeichen ist bisher noch in der Diskussion: Jörg Poettgen, Die Leidenswerk- zeuge Jesu auf einer Glocke – Ein spätgotisches Pilgerzeichen aus Brauweiler?, in: Pulheimer Beiträ- ge zur Geschichte und Heimatkunde 27 (2003) S. 36–40.
Bei dieser stattlichen Liste wird man sich aber klar machen müssen, dass die gro-ße Mehrzahl der Kirchen nur regionale Attraktion erlangte und sich deren Pilger-zeichen daher nur in kleiner Zahl im Rheinland selbst und den unmittelbar benach-barten Regionen finden. Als überregionale Wallfahrtszentren, deren Pilgerzeichen sich mit ihren Besuchern im ganzen römisch-deutschen Reich und auch darüber
60
hinaus verbreiteten, sind lediglich das Aachener Marienstift, das Servatiusstift in Maastricht, die Kölner Domkirche und Sankt Ursula anzusprechen.54 Durch ihre Einbindung in das Besuchsprogramm der alle sieben Jahre stattfindenden Aache-ner Heiltumsfahrt haben am Ende des 15. Jahrhunderts auch die Pilgerzeichen von Sankt Quirinius in Neuss und nach 1502 die des Dürener Annenhauptes eine ähnlich weite Verbreitung gefunden. Diese Beobachtung wird durch den Befund gestützt, der sich aus der exemplarischen Untersuchung von Glocken in Nordthü-ringen ergibt. In den Jahren 2010-2012 habe ich mit Unterstützung des Nordhäu-ser Heimatforschers Hans Losche im Rahmen eines Projektes zur vorreformato-rischen Frömmigkeit in Mitteldeutschland versucht, Kirchenglocken systematisch auf Hinweise zu Pilgerzeichen zu überprüfen. Das Untersuchungsgebiet, das in etwa die Landkreise Nordhausen, Eichsfeld, den Unstrut-Hainich-Kreis und den Kyffhäuserkreis umfasst, bot sich an, weil Ost-thüringen bereits von Paul Liebeskind55 und gegenwärtig nochmals von Günter Hummel56 intensiv beforscht wurde und für das an einschlägigen Glockenabgüs-sen arme Südwestthüringen einschlägige Informationen durch die Arbeit von Hans Scholz vorliegen.57 Damit war Nordthüringen das in Thüringen bisher am schlech-testen untersuchte Gebiet. Zur Vorbereitung der Vor-Ort-Recherchen wurden zu-nächst die einschlägigen Bände des Kunstinventars nach Hinweisen auf entspre-chende Glockenabgüsse durchsucht.58 Da die Bände fast alle vor der Entdeckung der Pilgerzeichenabgüsse auf Glocken durch Uldall 1905 verfasst wurden, finden sich in ihnen freilich allenfalls Bemerkungen zu markantem Glockenschmuck. Fer-ner wurde auf das von Ernst Schuster bis 1964 zusammengetragene glocken-kundliche Material im Landesdenkmalsamt Halle59, die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts im Auftrag der Evangelischen Kirche Deutschlands von Richard
54 Eine Analyse der geografischen Verbreitung der Aachener und Kölner Pilgerzeichen, auf die ich hier schon zurückgreife, ist gegenwärtig im Druck: Carina Brumme, Aus nah und fern – Interpretation von Fundverbreitungsräumen am Beispiel der Pilgerzeichen aus Aachen und Köln, in: Pilgerzeichen – Pil- gerstraßen (wie Anm. 28).55 Liebeskind, Pilger- und Wallfahrtszeichen (wie Anm. 23).56 Günter Hummel - Barbara Löwe - Frank Reinhold, Pilgerzeichen auf Glocken in Ostthüringen unter besonderer Berücksichtigung von Altenburg, erscheint voraussichtlich 2013 im Band 6 der Beiträge zur Frühgeschichte und zum Mittelalter Ostthüringens.57 Freundliche Mitteilung von Werner Scholz, Wasungen.58 Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angren- zender Gebiete: Bd. 2: Der Kreis Langensalza, unter Mitwirkung von Heinrich Otte bearbeitet von Gustav Sommer (1879); Bd. 4: Kreis Mühlhausen, bearbeitet von Gustav Sommer - Heinrich Otte (1881); Bd. 11: Stadt Nordhausen, bearbeitet von Julius Otte Schmidt (1888); Bd. 12: Kreis Graf- schaft Hohenstein, bearbeitet von Julius Otte Schmidt (1889); Bd. 28: Kreis Heiligenstadt, bearbei- tet von Walter Rassow (1909); Walter Rassow, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunst denkmäler des Kreises Worbis (1994).59 Heinrich Schuster, Erbe von Erz. Typoskript und Materialsammlung im Archiv des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Abteilung Bau- und Kunstdenkmäler.60 Evangelisches Zentralarchiv Berlin, Bestand 525, „Glockenerfassung Richard Heinzel“.61 Vgl. die tabellarische Übersicht im Anhang zu diesem Beitrag.
61
Heinzel durchgeführte Glockenerfassung60 sowie die Zentrale Pilgerzeichenkartei Kurt Köster im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg zurückgegriffen. Sofern sich hier Indizien zu einschlägigen Glockenabgüssen fanden, wurden diese nach Möglichkeit vor Ort besichtigt und fotografiert. Das Ergebnis dieser Unternehmung sind insgesamt 65 Pilgerzeichenabgüsse, die sich auf 28 Glocken fanden.61 Sechs Zeichen sind so stark vergossen, frag-mentiert oder in der Bildaussage unklar, dass sie sich einer örtlichen Zuweisung entziehen. Von den verbleibenden 59 Zeichen stammen 28 aus Wallfahrtskirchen am Niederrhein, nämlich 18 aus Aachen, fünf aus Köln, drei aus Maastricht, und je eines aus Neuss und der Marienkirche von Halle bei Brüssel. 20 weitere Zeichen lassen sich regionalen Wallfahrten zuweisen: vier stammen aus der Marienkirche in Elende bei Bleicherode, vier wahrscheinlich aus Grimmenthal, drei aus der Ni-kolauskirche von Nikolausberg / Ulrichshausen bei Göttingen, vier aus der Mari-enkapelle bei Querfurt, zwei aus der Marienkirche von Ziegenhain bei Jena, eines aus der thüringischen Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen bei Apolda und zwei wohl aus einer noch nicht identifizierten Annenwallfahrt im nordwesthüringischen oder evtl. auch im nordosthessischen Raum. Die übrigen Zeichen stammen aus Gotts-büren in Hessen oder Jakobsberg in Westfalen und von anderen noch nicht ein-deutig identifizierten Herkunftsorten, die aber weder mit einer regionalen Wallfahrt noch mit den niederrheinischen Pilgerzentren im Zusammenhang stehen. Damit kommen ca. 48 % aller in Nordthüringen dokumentierten Zeichen vom Nie-derrhein und nur 34 % hängen mit regionalen Wallfahrtsorten zusammen. Dies zeigt die eindeutige Dominanz der niederrheinischen Wallfahrtszentren auch für den mitteldeutschen Raum im späten Mittelalter, wobei die Aachener Marienkirche mit der siebenjährlichen Reliquienweisung mit allein über 30 % aller Belege im Zentrum stand. Die Anziehungskraft der niederrheinischen Pilgerzentren erklärt auch die Präsens von Pilgerzeichen in Nordthüringen, welche aus dem westfä-lischen Raum stammen. Ein instruktives Beispiel hierfür ist die 1496 gegossene Uhrschlagglocke der Sankt-Blasii-Kirche in Nordhausen. (Abb. 5) Auf ihr finden
Abb. 5: Pilgerzeichen-Abgüsse auf der Uhrschlagglocke von Sankt Blasii in Nordhausen
62
sich neben einem Zeichen aus Maastricht mit der Zeigung der Servatiusbüste und einem fragmentarischen Kölner Drei-Königs-Zeichen zwei runde Gittergüsse mit der Darstellung des Apostels Jakobus d. Ä.62 Diese Pilgerzeichen stammen aus Haddenberg / Jakobsberg, heute ein Ortsteil von Beverungen, wenig nördlich von Höxter gelegen. Dort entstand um 1480 eine bedeutende Jakobus-Wallfahrt, die vom Kloster Corvey betreut wurde.63 Die weit-räumige Attraktion dieser Wallfahrt, die sich auch in der geografischen Streuung ihrer Pilgerzeichen niederschlägt, verdankt sie vor allem der Funktion als Transit-heiligtum auf dem Weg aus dem Osten an den Niederrhein, denn in Höxter gab es einen der wenigen Weserübergänge, so dass eine wichtige Zubringerstraße zum Hellweg in der Nähe von Jakobsberg vorbeiführte.64
Wer dafür verantwortlich war, dass bestimmte Pilgerzeichen auf Glocken ange-bracht wurden, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Einige Indizien legen es nahe, dass dieser Glockenschmuck sich weniger der Initiative einer Glockengie-ßerwerkstatt als vielmehr den jeweiligen Auftraggebern verdankt.65 Daher spricht einiges dafür, dass sich in mehreren Pilgerzeichen, die auf derselben Glocke er-scheinen, auch eine Pilgerfahrt abbilden kann, auf der mehrere Kirchen nachei-nander besucht wurden. Man könnte in diesen Fällen von Itinerarglocken spre-chen.66
Abb. 6: Abguss eines Aachener Spiegelzei-chens auf der Glocke von Osterrode
Abb. 7: Quiriniuszeichen aus Neuss auf der Glocke von Osterrode
63
62 Eine ausführliche Darstellung zu dieser Glocke und ihren Pilgerzeichen bei Hartmut Kühne, „Wir sind noch da“ – spätmittelalterliche Pilgerzeichen auf einer Glocke der St. Blasii-Kirche in Nordhausen, in: Beiträge zur Geschichte aus Stadt und Kreis Nordhausen 34 (2009) S. 139–151. 63 Zur Wallfahrt vgl. von Karl-Ferdinand Besselmann, Stätten des Heils. Westfälische Wallfahrtsorte des Mittelalters (1998) S. 107–109. Zur Identifikation des Pilgerzeichentypus vgl. Kühne - Poettgen, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 13) S. 145-149 und S. 171-173.64 Zur Funktion von Jakobsberg und anderer westfälischer Wallfahrtskulte als Transitstationen der Aa- chenfahrt vgl. Hartmut Kühne, Pilgerzeichen westfälischer Transitwallfahrten im Mittelalter, in: Pilger- zeichen – Pilgerstraßen (wie Anm. 28).65 Vgl. Poettgen, Der Beitrag der Glockenkunde (wie Anm. 25) S. 40 f.66 Einige besonders markante Beispiele solcher Itinierarglocken sind beschrieben in: Hartmut Kühne - Carina Brumme, Ablässe und Wallfahrten in Braunschweig und Königslutter. Zu einem Detail des Brie- fes Heinrich Hanners an Thomas Müntzer, in: Thomas Müntzer – Zeitgenossen – Nachwelt. Siegfried Bräuer zum 80. Geburtstag, hg. von Hartmut Kühne - Hans-Jürgen Goertz - Thomas T. Müller - Günter Vogler (2010) S. 39-78, hier S. 192.
Abb. 8: Abguss eines Kölner Drei-Königs-Zeichens auf der Glocke von Mehrstedt
Um eine solche Glocke könnte es sich bei der 1513 für die Kirche von Osterrode (OT von Neustadt/Harz, Lk. Nordhausen) gegossenen handeln, auf der ein Aache-ner Zeichen (Abb. 6), ein Quiriniuszeichen aus Neuss (Abb. 7) und wohl eines aus Jakobsberg abgegossen wurden. Auch die ein Jahr jüngere Glocke von Mehrstedt (OT von Schlotheim, Unstrut-Hainich-Kreis) könnte mit ihren Abgüssen eines Kölner Drei-Königs-Zeichens (Abb. 8), eines Zeichens aus Aachen (Abb. 9) und
Abb. 9: Abguss eines Aache-ner Spiegelzeichens auf der Glocke von Mehrstedt
64
eines Servatiuszeichens aus Maastricht (Abb. 10) das Besuchsprogramm eines Thüringer Pilgers im niederrheinischen Wallfahrtsverbund abbilden. In ähnlicher Weise legt es der Glockenschmuck der 1476 gegossenen Glocke von Gudersleben (OT von Ellrich, Lk. Nordhausen) nahe, dass die drei hier abgegossenen Zeichen aus Köln und Aachen auf einer Pilgerfahrt erworben wurden. (Abb. 11) Bisher singulär ist unter diesen Zeichen der Ab-guss aus Aachen, der im großen Bildfeld ein Drei-gesicht als Sinnbild der göttlichen Trinität zeigt. Ebenso ungewöhnlich ist das Zeichen mit der Dar-stellung der Heiligen Drei Könige im Rundrahmen mit einer dreigiebligen Bekrönung.
In der Mitte erscheint eine Gestalt, deren Kopfbedeckung als Mitra oder evtl. auch als Tiara zu interpretieren ist. Möglicherweise ist Petrus als Patron der Kölner Domkirche gemeint? Die Darstellung der Anbetung im Rundrahmen erinnert an jenen Kölner Pilgerzeichentypus, der von Andreas Haasis-Berner und Jörg Po-ettgen als „Typ C III d“ beschrieben wurde, während die Bekrönung mit den drei Giebeln dem „Typ C III c“ entspricht.67 Inzwischen ist ein ähnlicher Abguss auch auf der undatierten Glocke von Bornim bei Potsdam bekannt geworden.68
Betrachtet man den in Nordthüringen festgestellten Befund im Hinblick auf die zeitliche Schichtung der Pilgerzeichenabgüsse, so fällt auf, dass im 14. Jahrhun-dert lediglich fünf Zeichen auf insgesamt drei Glocken abgegossen wurden und von diesen fünf Pilgerzeichen vier aus Aachen stammen. Auch diese Feststellung scheint für das Wallfahrtswesen insgesamt symptomatisch zu sein: Bis zum Aus-
67 Haasis-Berner - Poettgen, Die mittelalterlichen Pilgerzeichen (wie Anm. 11) S. 195f.68 Cornelia und Rainer Oefelein, Pilgerspuren auf mittelalterlichen Glocken in Brandenburg (2012) 47f. mit Abb. 59. Die Figur im Giebelwerk wird hier irrtümlich als „Madonna mit Kind“ angesprochen. Die Lesung der Inschrift in der Randleiste erscheint nicht als plausibel.69 Vgl. Kurt Köster, Gottsbüren, das „hessische Wilsnack“. Geschichte und Kulturgeschichte einer mit- telalterlichen Heiligblut-Wallfahrt im Spiegel ihrer Pilgerzeichen, in: Festgabe für Paul Kirn, hg. von Ekkehard Kaufmann (1961) S. 198–222. Zum raschen Ende der Wallfahrt vgl. auch Wilhelm A. Eck- hardt, Gottsbüren – ein hessisches Wilsnack?, in: Die Wilsnackfahrt. Ein Wallfahrts- und Kommuni- kationszentrum Nord- und Mitteleuropas im Spätmittelalter, hg. von Felix Escher – Hartmut Kühne (2006), S. 259–267. Zu den Pilgerzeichen aus Gottsbüren vgl. Hartmut Kühne - Carina Brumme, Jen- seits von Wilsnack und Sternberg: Pilgerzeichen spätmittelalterlicher Heilig – Blut – Wallfahrten, in: Varia campanologiae studia cyclica. 25 Jahre Deutsches Glockenmuseum auf Burg Greifenstein. Zu- gleich eine Festschrift für Jörg Poettgen zur Vollendung des 70. Lebensjahres (2009) S. 129–142.
Abb. 10: Abguss eines Maastrichter Servatius-zeichens auf der Glocke von Mehrstedt
65
gang des 14. Jahrhunderts konnten sich im Reichsgebiet kleinere Wallfahrtskir-chen kaum gegen die großen Pilgerzentren am Niederrhein durchsetzen. Dass die einzige Ausnahme in unserem Befund ausgerechnet ein Pilgerzeichen aus dem hessischen Gottsbüren bildet, ist sicher kein Zufall, denn die nach 1331 rasch aufblühende und nach kaum 20 Jahren schon wieder zusammenbrechende eu-charistische Wallfahrt war gewissermaßen der Prototyp der seit dem 15. Jahrhun-dert immer stärker florierenden, spontan entstehenden Wunderkulte.69
Abb. 12: Chronologische Darstellung aller bekannten datierten Glockenabgüsse von Aachener Zeichen (hellgrau) und Kölner Zeichen (dunkelgrau) im Zyklus der Aachenfahrten
Abb. 11: Abgüsse von zwei unterschiedlichen Kölner Drei-Königs-Zeichen und eines Aachener Spiegelzeichens auf der Glocke von Gudersleben
66
Bei den Pilgerzeichenabgüssen des 15. Jahrhunderts ist auffällig, dass sich diese auf sieben Glocken finden, die zwischen 1461 und 1496 gegossen wurden – für mehr als die erste Hälfte des Jahrhunderts also kein Beleg vorliegt. Diese Konzen-tration auf das gute letzte Drittel des 15. Jahrhunderts setzt sich in den 18 Glocken mit Pilgerzeichen, die von 1500 bis 1520 gegossen wurden, fort. Die große Zahl von Glocken mit Pilgerzeichenabgüssen aus dem knappen halben Jahrhundert vor Beginn der deutschen Reformation ist nicht zufällig, sondern entspricht einem Trend, den Carina Brumme kürzlich für alle datierten Pilgerzeichenabgüsse aus Aachen und der Kölner Domkirche dokumentiert hat. Die von ihr entworfene Gra-phik (Abb. 12) zeigt die jeweilige Anzahl der Glockenabgüsse Aachener Zeichen (hellgrau) und Kölner Zeichen (dunkelgrau), in Siebenjahreszyklen subsummiert und auf das vorangegangene Jahr der Aachenfahrt bezogen. Der Befund aus Nordthüringen weicht zwar im Fehlen einschlägiger Daten für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts von dem allgemeinen Trend ab, entspricht aber den Spitzenwerten aus der Zeit um 1500. Wie ist dieser Beobachtung zu interpre-tieren? Pilgerte die Bevölkerung in Nordthüringen – und überhaupt im Reich – um 1500 stärker als zuvor? War sie frömmer als zuvor? Man wird dies nicht vorschnell von der Hand weisen dürfen, wenn man etwa an die inzwischen schon klassische Formulierung Bernd Moellers von der gewaltigen Steigerung der Frömmigkeit um 1500 denkt.70 Allerdings wird man auch andere Faktoren berücksichtigen müssen.
70 Bernd Moeller, Frömmigkeit in Deutschland um 1500, in: Archiv für Reformationsgeschichte 56 (1965) S. 5-31. Neudruck in: Ders., Die Reformation und das Mittelalter. Kirchenhistorische Aufsätze, hg. von Johannes Schilling (1991) S. 73-85.71 HP II (wie Anm. 25) S. 295, Nr. 1267.72 Zum Ablauf der Maastrichter Heiltumsweisung vgl. Hartmut Kühne, OSTENSIO RELIQUIARUM. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, Gestalt und Funktion der Heiltumsweisungen im rö- misch-deutschen Regnum (2000) S. 220-227.
Dass sich gerade in den 50 Jahren vor dem Beginn der Reformation so viele Pilgerzeichen auf Glocken finden, dürfte auch damit zusam-menhängen, dass in dieser Zeit außerordent-lich viele Glocken gegossen bzw. umgegossen wurden, wie überhaupt aus der Zeit um 1500 eine reiche Ausstattung der Kirchen erhalten blieb. Dies ist aber nicht allein der Frömmigkeit der Zeit geschuldet, sondern auch der außer-ordentlichen wirtschaftlichen Prosperität, die sich zumindest in Mitteldeutschland seit den 1470er Jahren feststellen lässt.
Abb. 13: Abguss eines Maastrichter Servatius-zeichens auf der Glocke von Kreuzebra
67
Zuletzt sei in diesem Abschnitt noch auf zwei seltene Pilgerzeichenabgüsse hingewiesen, die bei unserer Untersuchung erstmals entdeckt und identifiziert wurden. Auf der 1520 gegossenen Glocke von Kreuzebra (Verwaltungsgemein-schaft Dingelstädt, Lk. Eichsfeld) findet sich neben zwei Abgüssen der regionalen Wallfahrten von Elende und Nikolausberg auch ein Pilgerzeichen, das in einem Rundrahmen die Reliquienbüste des hl. Servatius darstellt, der links und rechts von zwei Engeln flankiert wird, die den charakteristischen Servatiusschlüssel und seinen Bischofsstab halten. (Abb. 13) Die Details sind freilich auf dem Glo-ckenabguss nicht so gut zu erkennen wie auf einem Pilgerzeichenoriginal, das in Middelburg gefunden wurde.71 Dessen bisherige Datierung auf die Zeit zwischen 1350 und 1450 ist durch den Glockenabguss nun auf die Zeit nach 1500 zu korri-gieren. Die Darstellung des Pilgerzeichens fängt gewissermaßen einen Moment der Maastrichter Reliquienzeigung ein, wie sich z.B. aus dem Vergleich mit einem Einblattdruck aus der Zeit um 1475 ergibt, der die miteinander verbundenen Re-liquienzeigungen von Maastricht, Aachen und Kornelimünster bewirbt. (Abb. 14) In der linken Spalte sind die Maastrichter Reliquien versammelt: Im zweiten Gang der Pilger- und der Bischofsstab des hl. Servatius, im dritten die Reliquienbüste.72
Abb. 14: Einblattdruck für die Reliquien-Zeigungen in Aachen, Maastricht und Kornelimünster, um 1475
68
Rätselhaft war zunächst ein ungewöhnlicher Abguss auf der 1476 gegossenen Glocke von Neunheilingen (Unstrut-Hainich-Kreis). (Abb. 15a-b) Eng übereinan-der waren hier zwei unterschiedliche Pilgerzeichen in den Lehmmantel der ver-lorenen Form eingedrückt worden. Das obere Zeichen ist leicht zu identifizieren: Die in einer Ädikula halbfrontal thronende Marienfigur mit dem Jesuskind auf dem Schoß, unter deren Füßen ein schrägstehendes Wappen erscheint, dessen Wap-penbild – einen steigenden Löwen – man eben noch erahnen kann. Es handelt sich um ein Zeichen aus der Marienkirche von Ziegenhain bei Jena, einer im frü-hen 15. Jahrhundert entstandenen Wallfahrt, deren Kirche durch den Einbruch der Reformation nie fertiggebaut wurde.73
73 Die Geschichte der Wallfahrt ist ein Desiderat der Forschung. Bisher liegt ein nur unbefriedigender Überblick vor von Ottogerd Mühlmann, Die Wallfahrtskirche zu Ziegenhain bei Jena (Thüringer Kirch- liche Studien 4, 1981) S. 181-194. Zu den Pilgerzeichen aus Ziegenhain vgl. Jörg Poettgen, Krypto- gramme und Pilgerzeichen auf spätmittelalterlichen Glocken im östlichen Thüringen, in: Jahrbuch für Glockenkunde 9/10 (1997/98) S. 81-98. 74 Vgl. HP I (wie Anm. 25), S. 220;HP II (wie Anm. 25) S. 335.
Durch die Kombination mit dem Zeichen aus Ziegenhain lag die Vermutung nahe, dass es sich auch bei dem zweiten um das Zeichen einer bisher unbekannten Wallfahrt aus dem thüringisch-hessischen Raum handeln könnte – eine Hypothe-se, die aber nicht weiterführte. Die zufällige Lösung des Rätsels ergab sich bei der
Abb. 15a und 15b: Pilgerzeichenabguss aus der Marienkirche von Halle auf der Glocke von Neunheiligen
69
Arbeit an der Zentralen Pilgerzeichenkartei Kurt Köster, die eine Karteikarte ent-hält, auf der ein inzwischen verschollenes Pilgerzeichen aus der Sammlung Franz Claes abgebildet und beschrieben wird, das große Ähnlichkeit mit dem Abguss in Neunheiligen zeigt. (Abb. 16) Es wiederholt sich die eigentümliche Architektur mit den beiden seitlichen Türmen, die Einteilung des Bildfeldes in ein hochrecht-eckiges Mittelfeld, in dem die Gottesmutter auf einem spätgotischen Thron sitzt, die beiden seitlichen hochrechteckigen Felder, in der jeweils ein Engel und ein Adorant der Gottesmutter zugekehrt knien, die markante Öse mittig unterhalb der Fußleiste und das Schriftband in der Fußleiste, in dem „ons vrouwe …“ stand, was sich mit einiger Mühe auch auf dem Glockenabguss lesen lässt. Das verschol-lene Pilgerzeichen soll nach der Angabe von Kurt Köster aus der Marienkapelle von Halle bei Brüssel stammen, was durch einige ähnliche fragmentarische Fun-de aus den Niederlanden auch bestätigt wurde.74 Da der Vergleichsfund aus der Sammlung Franz Claes verschollen ist, stellt der Glockenabguss in Neunheilingen gegenwärtig das einzige vollständig erhaltene Zeichen dieses Pilgerzeichentypus aus Halle dar.
Allerdings wurde in Halle eine brei-te Palette von Pilgerzeichen ange-boten, was auch durch eine merk-würdige Steinskulptur im Chorum-gang der Martinskirche von Halle illustriert wird (Abb. 17): In einem Architekturzwickel ist ein Pilgerzei-chenverkäufer („miraclier“) an sei-nem Verkaufstisch dargestellt, des-sen Angebot von zwei Engeln auf Tüchern präsentiert wird – es ist au-genfällig, dass hier eine breite Pro-duktpalette verkauft wurde. Der Glockenabguss aus Neunheilin-gen wirft freilich die Frage auf, ob es sich bei diesem Einzelfund um ein singuläres Zeugnis handelt oder ob er darauf verweist, dass die Marien-kirche von Halle auch weitere Pilger aus Mitteldeutschland anlockte. Un-sere Kenntnisse von mitteldeutschen Besuchern in Halle hängen bislang stets mit dem Hof König Maximilians als ‚Transmissionsriemen‘ solcher Reisen zusammen.
Abb. 16: Pilgerzeichen aus der Marien-kirche von Halle
70
Der sächsische Herzog Albrecht der Beherzte (1443-1500) stiftete der Marienka-pelle eine lebensgroße Wachstatue, die nach dem Kupferstich der Gnadenkapelle in der Diva Virgo Hallensis von Justus Lipsius um 1600 noch neben der Kaiser Maximilians stand.75 Auch Albrechts Neffe, Kurfürst Friedrich der Weise, besuchte 1494 die Marienkapelle.76 Jenseits der Sphäre mit dem Königshof verbundener Fürsten haben sich bisher keine Zeugnisse mitteldeutscher Pilgerreisen nach Halle ausfindig machen las-sen. Damit stellt der Pilgerzeichenabguss in Neunheiligen die Frage danach, wie-viel er – und auch die anderen Pilgerzeichenabgüsse – uns von der mobilen Fröm-migkeit jener breiten Schichten verrät, deren Reisen sich nicht im Medium der Schrift niedergeschlagen haben, wie es bei den Pilgerberichten und Rechnungs-büchern der Fürsten, Adligen und Patrizier der Fall gewesen ist.
75 Justus Lipsius, Diva Virgo Hallensis (1604), Kupferstich zwischen S. 14 und 15: „Sacellum D. virgi- nis et praecipui ornatus“.76 Karl von von Reizenstein, Unvollständiges Tagebuch auf der Reise Kurfürst Friedrich des Weisen von Sachsen in die Niederlande zum Römischen König Maximilian I. (1494), in: Zeitschrift des Ver- eins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde 4 (1860) 127–137.77 Kurt Köster, Meister Tilman von Hachenburg. Studien zum Werk eines mittelrheinischen Glocken- gießers des fünfzehnten Jahrhunderts. Mit besonderer Berücksichtigung der als Glockenzier verwen- deten mittelalterlichen Pilger- und Wallfahrtszeichen, in: Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtli- chen Vereinigung 8 (1957) S. 1–206, hier S. 57-70.
Abb. 17: Pilgerzeichen-verkäufer an seinem Ver-kaufstisch, Skulptur in der Martinskirche von Halle
71
3. Marienschrein – Gnadenbilder – Spiegelzeichen: Die Krux der Aachener PilgerzeichentypologieWie für die Pilgerzeichenforschung überhaupt hat Kurt Köster auch für die Ty-pologie der Aachener Pilgerzeichen den entscheidenden Anstoß gegeben. Seine schon 1957 anhand des Œuvres des rheinischen Glockengießers Tilman von Ha-chenburg entwickelte Systematik der Aachener Zeichen77 fasste er 1972 nochmals knapp zusammen.78 Danach hatten schon „die ältesten [Aachener Pilgerzeichen] als zentrales Bildfeld einen Rundrahmen. Darin zeigen zwei auf seitlichen bogen-förmigen Podesten stehende Kleriker zwischen sich das über eine Stange ge-hängte ausgebreitete Mariengewand […] Darunter thront stets die Maria Aquensis mit Kind und Lilienszepter […] Bekrönt wird der Kreis durch eine einfache Turm-architektur oder durch einen nischenförmigen Aufbau.“79 Diesem Typus entspricht ein Pilgerzeichenabguss auf der 1370 gegossenen Glocke von Sankt Ägidien in Heiligenstadt (Lk. Eichsfeld). (Abb. 18)
Von diesem „einkreisigen Zeichen“ führt die Entwicklung der Aachener Pilgerzei-chen durch die Einfügung eines kleinen leeren Rundrahmens, in den ein Spie-gelchen eingepasst werden kann, zu den markanten „dreikreisigen Spiegel-zeichen“, die im 15. Jahrhundert domi-nieren. Diese Spiegelchen dienten dazu, das ‚Bild‘ der Vier Großen Reliquien wäh-rend der Heiltumsweisung einzufangen, indem sie bei der Präsentation der Reli-quien auf diese gerichtet wurden. Kös-ter beschreibt den Grundtypus der drei-kreisigen Spiegelzeichen wie folgt: „Der große untere Kreis und ein mittelgroßer oberer Kreis, beide mit wechselnden bildlichen Darstellungen, werden über-schnitten und zusammengehalten von einem dazwischengesetzten kleinen ‚leeren‘ Kreisrahmen mit radial angeord-neten Zungen, der zur Aufnahme eines Spiegelchens bestimmt ist. Flankiert und bekrönt wird der aus Mittel- und Oberkreis bestehende Aufbau durch eine geometrische Turm- und Giebelar-chitektur.“ 80
Abb. 18: Abguss eines einkreisigen Aachener Pilgerzeichens auf der Glocke von Sankt Ägidien in Heiligenstadt
72
Bei den Zeichen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist der obere Kreis meist mit dem Antlitz Christi – der Vera Ikon – ausgefüllt; im unteren Kreis , befin-det sich fast immer eine Darstellung der thronenden Maria mit dem Jesuskind und darüber das ausgebreitete Marienkleid auf einer Stange, das von zwei Figuren ge-halten und ausgebreitet wird. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wandert die Zeigung des Marienkleides aus dem unteren in den oberen Kreis. „Dagegen erscheinen im unteren Kreis eine Fülle wechselnder Darstellungen, die sich frei-lich fast alle auf das Marienleben beziehen. […] Weitaus am häufigsten begegnet hier eine vierfigurige Beweinung: Maria hält den toten Sohn auf ihrem Schoß, mit ihr trauern Johannes und Maria Magdalena.“81 Zu diesem Typus gehören auch die meisten der in Nordthüringen erfassten Aache-ner Pilgerzeichen (Abb. 6): In neun Fällen handelt es sich um dreikreisige Spiegel-zeichen, die im unteren Feld die Beweinung Christi darstellen – zwei Mal wurden auch nur dieses Bildfeld abgegossen, während der übrige Teil des Pilgerzeichens vor der Einbringung in die Lehmform abgeschnitten wurde. Weitere vier Zeichen aus Nordthüringen stellen im unteren Bildfeld Maria mit Kind als Halbfigur auf der Mondsichel im Strahlenkranz dar. (Abb. 9). Nur das Zeichen mit dem Dreigesicht auf der Glocke von Gudersleben (Vgl. Abb.11)erweist sich als singulär, auch wenn der typische Aufbau der dreikreisigen Zeichen seine Lokalisierung nach Aachen als sehr wahrscheinlich erscheinen lässt. Die von Kurt Köster entwickelte Typologie der Aachener Pilgerzeichen, die hier nur in den Grundlinien skizziert wurde, wurde im Wesentlichen auf der Grundlage der Glockenabgüsse entwickelt. 1972 waren neben den Glockenabgüssen nur sechs mehr oder weniger fragmentierte Pilgerzeichenoriginale aus Aachen be-kannt. Als besonders durch die massenhaften Pilgerzeichenfunde in den nieder-ländischen Feuchtböden seit den 1980er Jahren zahlreiche ähnliche Flachgüsse mit der Darstellung einer thronenden Maria mit dem Jesuskind auftauchten, zog als erster Andreas Haasis-Berner in seiner 1995 verfassten Magisterarbeit den Schluss, dass es sich bei diesen Plaketten um Aachener Pilgerzeichen handeln
78 Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 149-151.79 Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 149.80 Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 149.81 Köster, Mittelalterliche Pilgerzeichen (wie Anm. 30) S. 149.82 Andreas Haasis-Berner, Pilgerzeichen des Hochmittelalters. Untersuchung zu ihrer Entstehung und Bedeutung. Magisterarbeit an der Adalbert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. (1995) S. 51-53.83 Haasis-Berner, Pilgerzeichen (wie Anm. 6) S. 157-166.84 Vgl. HP II (wie Anm. 25) S. 310-314, Nr. 1315-1317 und 1319-1339.85 Haasis-Berner, Pilgerzeichen (wie Anm. 6) S. 158.86 Die Beschreibung folgt im Wesentlichen den Ausführungen von Carina Brumme, Das spätmittelalter- liche Wallfahrtswesen im Erzstift Magdeburg, im Fürstentum Anhalt und im sächsischen Kurkreis (2010) S. 79f.87 Wallfahrt kennt keine Grenzen [Ausstellungskatalog München 1984], hg. vom Bayerischen National- museum München und dem Adalbert Stifter Verein (1984) S. 43, Nr. 42.
73
müsse82 und wiederholte diese Hypothese in der überarbeiteten Druckfassung dieser Arbeit 2003,83 nachdem diese These bereits im zweiten niederländischen Pilgerzeichenkatalog „Heilig en profaan“ 200184 übernommen worden war. (Abb. 4a-b) Das entscheidende Argument für die Lokalisierung nach Aachen war, dass Aachen als der bedeutendste Marienwallfahrtsort des Reiches im 13. Jahrhundert ebenfalls Pilgerzeichen vertrieben haben muss, wenn dies für Köln, Maastricht, Trier und andere Pilgerkirchen dieser Region seit der Zeit um 1200 belegt ist. Diese Argumentation von Andreas Haasis-Berner hat sich inzwischen stillschwei-gend durchgesetzt – eine Diskussion darüber hat in Fachkreisen nicht stattge-funden. Allenfalls ist noch offen, ob die von Andreas Haasis-Berner entworfene Typologie von drei Varianten der Aachener Flachguss-Plaketten zutrifft: die erste, stärker im südlichen und alpenländischen Raum belegte, mit einem Rundgiebel, eine zweite, bisher nur in einem Exemplar bekannte, querrechteckige mit einem Architekturaufbau und die dritte, quantitativ dominierende Form mit einem spitz-giebligen Dach. Zumindest für die dritte Variante ist die Herkunft aus Aachen der-zeit aber unbestritten. Allerdings stellt sich die Frage: Was stellen diese Flachgüs-se eigentlich dar? Andreas Haasis-Berner hatte angedeutet, dass die Herstellung der spitzgiebligen Zeichen ein Reflex auf die Fertigstellung des Aachener Marien-schreins gewesen sein könnte – allerdings ohne dies weiter auszuführen.85 Im Frühjahr 2011 entstand eine rege Diskussion über die Bildinhalte der frühen Aachener Pilgerzeichen, die der Verfasser durch ein per Email versandtes The-senpapier anregte und an der sich vor allem Jörg Ansorge (Horst), Carina Brum-me (Berlin), Wilhelm Alfred Eckhardt (Marburg), Jörg Poettgen (Overath) und Willy Piron (Nimwegen) beteiligten. Anlass für diesen Meinungsaustausch waren immer neue Funde eines weiteren marianischen Pilgerzeichentyps, der hier durch einen Glockenabguss aus dem Dorf Piscaborn (OT Mansfeld, Sachsen-Anhalt) vorge-stellt sei.86 (Abb. 19) Das Zeichen zeigt Maria im langen Gewand auf einer reich-geschmückten Thronbank mit Kissen. Ihr nimbiertes Haupt trägt einen Kronreif mit Lilien, darunter eine Art Schleier, dessen rhombenförmige Enden beidseitig auf ihrer Brust aufliegen. Dazwischen verschließt eine blütenförmige Spange ihr Gewand. Dieses fällt mit einem auffälligen Schwung seitlich über das linke Knie Marias. Die Unterschenkel werden von wellenförmigen Ornamenten überdeckt. Zu Linken Marias steht in einem mit kleinen Kugelstrukturen verzierten langen Gewand das Jesuskind. Das Haupt des Knaben ist von einem Kreuznimbus um-geben. Marias rechter Arm ist scharf abgewinkelt und hält dabei in der Hand einen kugelförmigen Gegenstand. Auf der linken Seite des Zeichens erscheint ein ker-zentragender Engel, der sich Maria zuwendet. Unter dem Thron befindet sich eine ornamentierte Leiste. Der so beschriebene Pilgerzeichentypus ist schon länger bekannt. Ein 1965 in Bayern gefundenes Exemplar wurde 1984 in der großen Münchner Wallfahrtsaus-stellung als Marienzeichen „wohl aus Frankreich“ ausgestellt.87 Andreas Haasis-
74
Berner hatte im Jahre 2000 erstmals versucht, alle bekannten Exemplare zu erfassen.88 Auf-grund der Fundverteilung und der Stilistik des Zeichens hatte er einen Herkunftsort am Nie-derrhein oder in Nordfrankreich vermutet und Boulogne-sur-mer als möglichen Herkunftsort ins Spiel gebracht. Carina Brumme kartierte 2010 die geografische Verteilung der Funde neu89 und votierte für die Herkunft aus einem „westeuropäischen Marienkultort“ mit einem „romanischen Gnadenbild“. Die Konfrontation mit einigen Neufunden die-ses Pilgerzeichentypus zu Jahresbeginn 2011 hatte mich motiviert, Kollegen und Kolleginnen zu der oben bereits erwähnten Diskussion über die Herkunft der Zeichen einzuladen.
88 Andreas Haasis-Berner, Archäologische Funde von mittelalterlichen Pilgerzeichen und Wallfahrts- andenken in Westfalen, in: Westfalen 78 (2000) S. 345-363, hier S. 358-360.89 Brumme, Das spätmittelalterliche Wallfahrtswesen (wie Anm. 86) S. 383.90 Roar Hauglid, Pilgrimsferd og pilgrimsmerke, Föreningen til norske for- tidsminnesmerkers bevä- ring, Arsberetning for 1936-37 (1938) S. 117-126, hier S. 125. 91 Jörg Ansorge, Pilgerzeichen sowie religiöse und profane Zeichen aus der Grabung für das Ozeane- um in Stralsund, in: Das Zeichen am Hut (wie Anm. 5) S. 83–114, hier S. 100 mit Abb. 5. S6; Ders., Mittelalterliche Pilgerzeichen aus der Hansestadt Wismar, Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vor- pommern Jahrbuch 56 (2009) S. 213–257, hier S. 222, mit Abb. 5.6 und S. 225 mit Abb. 7.1; Ders., Kurze Fundberichte Mittelalter/Neuzeit, Rostock, Hansestadt, Fpl. 473, in: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern Jahrbuch (58, 2011) S. 424–428, dort Abb. 211.1.92 Es handelt sich um einen von mehreren Archäologen, Historikern und Kunsthistorikern gemeinsam verfassten Text, der bei drei Pilgerzeichenfunden ansetzt, im Hinblick auf die Aachener Pilgerzeichen aber weit über die konkreten Funde hinausgeht: Jan Ansorge–Hrdina – František Kolár – Barbora Marethová – Aleš Mudra – Pavla Skalická – Hana F. Teringerová, Neue Pilgerzeichenfunde aus Opava (Troppau) und die Typologie der älteren Aachener Pilgerzeichen im Kontext der Zeugnisse zur Aachenfahrt aus den böhmischen Ländern im 14. Jahrhundert, in: Wallfahrer aus dem Osten (wie Anm. 18) S. 321-359. 93 Hrdina – Kolár – Marethová – Mudra – Skalická – Teringerová, Neue Pilgerzeichenfunde aus Opava (wie Anm. 92) S. 340f.
Dabei wurde schnell deutlich, dass noch ein weiterer Typus in die Betrachtung mit einbezogen werden musste, dessen erstes Exemplar bereits 1938 von dem Norweger Hauglid publiziert worden war90 (Abb. 20) und von dem der Archäologe Jörg Ansorge zwischen 2008 und 2011 insgesamt vier Exemplare bergen konnte, darunter auch ein vollständig erhaltenes Stück aus Rostock.91 (Abb. 21) Für die-sen Pilgerzeichentyp ist charakteristisch, dass Maria ein Lilienszepter in der Hand hält und auf einem Ringpfostenstuhl thront. Zu beiden Seiten kniet je ein Engel während die kleine Gestalt eines Pilgers zum Jesuskind hinaufsteigt.
Abb. 19: Abguss eines Marienzeichens (aus Aachen?) auf der Glocke von Piscaborn
75
Im Austausch der Meinungen führten immer neue Beobachtungen und Argumente rasch dazu, nicht nur die marianischen Pilgerzeichenplaketten mit dem Spitzgie-bel, sondern auch die beiden hier vorgestellten Typen der thronenden Maria mit Aachen in Beziehung zu setzen. Auf dem Hintergrund dieser Diskussion hat der Prager Kunsthistoriker Aleš Mudra 2012 den Versuch einer Typisierung der frühen Aachener Pilgerzeichen unternommen, der so überzeugend ist, dass er hier vor-gestellt werden soll.92
Mudra macht zunächst darauf aufmerksam, dass die frühen Aachener Pilgerzei-chen – sowohl die Flachgussplaketten als auch die jenem Typus zugehörigen, der hier durch den Abguss von Piscaborn vorgestellt wurde – trotz allgemeiner Darstellungskonventionen eine Spezifik aufweisen: „Die Beine [Marias] sind sche-matisch als zwei parallel verlaufende senkrechte Rollen angedeutet, die oben in kreisrunden Knien enden. Quer über die Beine verlaufen die in dichtem Rhythmus gelegten Falten eines Mantels. Die Stilisierung der Draperie zu einem einfachen Bogen wird lediglich im oberen Teil unterbrochen, wo sich eine Falte gabelt und das Knie umkreist. Wie bei den meisten Pilgerzeichen, bei denen man Aache-ner Provenienz annimmt, erscheinen die dichten und parallel verlaufenden Falten auch auf dem Rumpf Mariens und Christi, in diesen Teilen allerdings linear und senkrecht.“93
Abb. 20: Marienpilgerzeichen (aus Aachen), gefunden im Kloster Selje (Norwegen)
Abb. 21: Marienpilgerzeichen (aus Aachen), gefunden in Rostock
76
Diese eigentümliche Darstellung der Beine und des Faltenwurfs finden nach Mudra ihre Erklärung darin, dass die Madonna des Aachener Marienschreins die Vorlage bildete: „Die aus vergoldetem Silber getriebene Figur wird in einem nahezu in eine freie Statue übergehenden Hochrelief dargestellt und findet sich an prominenter Stelle in der Mitte einer der Längsseiten des Reliquiars. […] Der Marienschrein wurde irgendwann in den zwanziger bis dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts angefertigt und ist ein hervorragendes Werk des sogenannten Mul-denfaltenstils, der für Nikolaus von Verdun und seine Nachfolger charakteristisch ist, die im Rheinland und im Maasland wirkten. Die Goldschmiede, die im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts an der Wiege dieses Stils standen, ließen sich durch die antike Plastik, namentlich durch die ‚feuchten‘ Draperien der spätrömischen Zeit inspirieren. Gerade der Draperienreichtum des Madonnenmantels an dem Aachener Reliquiar mit den sehr geschmeidigen, lebendigen und detailliert for-mulierten Parallelfalten, die stimmig die Körperformen umkreisen, entzogen sich einer Reproduktion in kleinem Maßstab. Die Handwerker, die die Gussformen der Pilgerzeichen anfertigten, hatten offen-bar große Probleme mit der Stilisierung der Falten, um im Rahmen der begrenz-ten Möglichkeiten des entsprechenden Mediums eine klar erkennbare Beziehung zur Vorlage zu bewahren. Im Rahmen der antikisierenden Draperie schenkten sie den Wellen der Hauptfalten, die quer über die untere Hälfte der Statuette verlie-fen und mit denen die glatt umfassten und aus dem benachbarten Faltengewirr deutlich hervortretenden Knie kontrastierten, ihre Aufmerksamkeit. In drastisch vereinfachter Form finden wir diese beiden Elemente (die Wellenlinie, die an das Piktogramm für Wasser erinnert, und die hervortretenden glatten Knie) auf zahl-reichen, Aachen zugeschriebenen marianischen Pilgerzeichen des 13. und 14. Jahrhunderts […]. Auf die Madonna aus dem Marienschrein weisen auch andere Motive hin […]. Es handelt sich insbesondere um den rechten Arm Mariens, der vor den Körper gebeugt ist und dessen Hand einen Apfel umschließt, und um den breiten verzierten Saum am Hals, von dessen Mitte eine Rosette ausgeht. Die gewöhnlich weit aufgerissenen Augen Mariens, die zu einem großen Teil den Ge-sichtsausdruck beherrschen, gehen wohl auch von der genannten Goldschmiede-arbeit aus.“ 94 (Abb. 22)
94 Hrdina – Kolár – Marethová – Mudra – Skalická – Teringerová, Neue Pilgerzeichenfunde aus Opava (wie Anm. 92) S. 341f. 95 Hrdina – Kolár – Marethová – Mudra – Skalická – Teringerová, Neue Pilgerzeichenfunde aus Opava (wie Anm. 92) S. 350f. 96 Hrdina – Kolár – Marethová – Mudra – Skalická – Teringerová, Neue Pilgerzeichenfunde aus Opava (wie Anm. 92) S. 342-344; zum Marienbild und dessen Wiederentdeckung vgl. J. Hubert Kes- sel, Das Gnadenbild Unserer Lieben Frau in der Stiftskirche zu Aachen (1878) S. 44-49; August Brecher, Ave Maria, Kaiserin. Das Aachener Gnadenbild im Wandel der Jahrhunderte (1994) S. 52-55.97 Vgl. oben Anm. 79.98 Kessel, Das Gnadenbild (wie Anm. 96) S. 30f. und S. 42f.
77
Insbesondere stellt sich die Frage, wie die markanten rhombischen Schleierenden zu erklären sind, die bei den Pilgerzeichen der Typen B und C von der Schulter auf die Brust der Madonna fallen. Hier verweist Aleš Mudra auf jene Madonnen-plastik aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die sich heute in der Aache-ner Domschatzkammer befindet und die von Hubert Kessel im 19. Jahrhundert entdeckt und als älteres Gnadenbild aus dem Marienmünster identifiziert worden war.96 Auch wenn die ikonografische Ähnlichkeit zwischen dem Schleier dieses Marienbildes und den markanten Schleierenden auf den Pilgerzeichen nicht von der Hand zu weisen ist, so wirft diese Hypothese eine Reihe von Fragen auf. Denn Hubert Kessel hat mit seinem engagierten Einsatz für die Anerkennung des vom ihm im Mutterhaus der Schwestern vom armen Kinde Jesu ‚wiederentdeck-ten‘ Gnadenbild ein historisches Theoriegebäude über die Abfolge bestimmter in Aachen verehrter Gnadenbilder errichtet, das bis heute wirksam ist und das etwa auch Kurt Köster mit seiner Annahme ungeprüft übernahm, dass die ältesten Aa-chener Pilgerzeichen-Gittergüsse die „Maria Aquensis“, d.h. eben jenes Gnaden-bild, darstellten.97 Kessel nahm an, dass sich seit dem Ausgang der karolingischen Zeit, spätestens aber ab dem 10. Jahrhundert, ein byzantinisch-romanisches Gnadenbild im Marienmünster befunden habe, dessen Abbild er in dem Siegelbild des Marienstiftes von 1226 glaubte erkennen zu dürfen.98
Abb. 22: Maria mit Kind am Aachener Marienschrein
Mit diesen Beobachtungen dürfte gesichert sein, dass sich die älte-ren Flachgüsse (von Mudra als Typ A bezeichnet) ebenso auf das Vor-bild des Aachener Marienschreins beziehen wie der jüngere Typus, der hier durch den Glockenabguss von Piscaborn (Abb. 19) vorgestellt wurde (Mudra: Typ B, zeitlicher Ansatz ca. 1300-1350). Dem folgt wiederum der noch jüngere Typ C, der hier durch den Rostocker Fund vorgestellt wurde, welcher zeitlich zwischen 1350-1375 anzusetzen ist.95 Die Frage ist freilich, was den Wandel der Darstellung von Typ A über Typ B zu Typ C außer der all-gemeinen Stilentwicklung und den technologischen Veränderungen beim Guss der Pilgerzeichen ver-anlasst hat.
78
99 Kessel, Das Gnadenbild (wie Anm. 96) S. 44f.
100 Kessel, Das Gnadenbild (wie Anm. 96) S. 63-66.
101 Vgl. Brecher, Ave Maria (wie Anm. 96) S. 34-37.
102 Vgl. Brecher, Ave Maria (wie Anm. 96) S. 20-24.
103 Vgl. etwa die Darstellung des Kircheninneren mit Blick in den Marienchor von Hendrik van Steen- wijk aus dem Jahre 1573, abgebildet bei Brecher, Ave Maria (wie Anm. 96) S. 31.
Dieses Gnadenbild, für dessen Existenz es freilich keinen gesicherten Beleg gibt, ist nach Kessels Annahme im Aachener Stadtbrand des Jahres 1237 unterge-gangen und durch das von ihm im 19. Jahrhundert wiederentdeckte thronen-de Gnadenbild ersetzt worden.99 Einen Beweis für seine These sah er in dem Aachener jüngeren Karlssiegel von 1227/28, das Karl den Großen kniend vor der thronenden Maria darstellt. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts sei das ältere Gnadenbild nach Kessel durch das vermeintlich jüngere, stehende Gnadenbild abgelöst worden.100 Letz-teres war im Stadtbrand von 1656, der auch den Marienchor in Mitleidenschaft zog, beschädigt worden, so dass sein heutiger Zustand nicht mehr das spät-mittelalterliche Original wiedergibt, son-dern sich zumindest teilweise auch der nach 1656 erfolgten Wiederherstellung verdankt.101
Abb. 23: Abguss eines Marienzei-chens (aus Aachen?) auf der Glocke von Himmelsberg
Inzwischen ist unstrittig, dass sich Kessel bei der Datierung beider Plastiken – des thronenden und des stehenden ‚Gnadenbildes‘ – geirrt hatte und beide der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehören.102 Ob das Bild der thronenden Madonna im Aachener Domschatz im 14. Jahrhundert als Gnadenbild verehrt wurde, ist zumindest unsicher. Es ist sogar eine offene Fra-ge, ob es überhaupt ein Gnadenbild der thronenden Madonna im Marienmünster gegeben hat. Die Verehrung der stehenden und bekleideten Madonna ist in Aa-chen aber nicht nur durch frühneuzeitliche Zeugnisse gesichert,103 sondern auch durch einen Einblattdruck des 15. Jahrhunderts, der in Aachen etwas in Verges-senheit geraten zu sein scheint, nachdem er 1909 erstmals publiziert wurde.104
Es handelt sich um einen etwa 25 cm hohen und 18 cm breiten kolorierten Druck,
79
ein sogenanntes Schrotblatt, das im vorderen Buchdeckel der Handschrift eines Mainzer Breviers die Zeiten überdauert hatte. (Abb. 24) Die Handschrift stammt aus dem Raum Nordwestthüringen-Südniedersachsen und kam 1907 mit anderen Erwerbungen aus der Heiligenstädter Gymnasialbi-bliothek in die Königliche Bibliothek, die heutige Staatsbibliothek Berlin, wo sie unter der Signatur Theol. Lat. Fol. 695 verwahrt wird.105 Der Druck ist 1908 aus dem Einband herausgelöst und in der Schausammlung der Bibliothek ausgestellt worden. Am Ende des Zweiten Weltkriegs ging das Blatt verloren. Aber durch die Faksimileausgabe von Wilhelm L. Schreiber kann man sich eine recht gute Vor-stellung von dem Originaldruck machen.106 (Abb. 24) Er zeigt eine stehende Marienfigur mit dem Kind auf dem linken Arm und der Bildunterschrift: „virginis et matris in aquis est forma marie Istius hic plene pictu-ram cernimus esse“, wodurch er die Darstellung als Wiedergabe des in Aachen verehrten Gnadenbildes ausweist. Im oberen Bilddrittel sieht man rechts und links in der Architekturfassade die Aachener Reliquien über Stangen zur Weisung auf-gehängt. Man darf davon ausgehen, dass ein Aachenpilger dieses Blatt um 1460 erworben und in seine Heimat im thüringisch-niedersächsischen Grenzraum ge-bracht hat. Das stehende Gnadenbild wurde also mit Sicherheit in der Mitte des 15. Jahrhunderts in Aachen verehrt. Hat dieses Bild auch Spuren in der Aachener Pilgerzeichenherstellung hinterlas-sen? Einer der in Nordthüringen gefundenen Pilgerzeichenabgüsse bietet ein gu-tes Argument dafür, dass dieses Gnadenbild tatsächlich bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Aachen verehrt wurde. Es handelt sich um einen Pilgerzeichen-abguss auf der Glocke von Himmelsberg (OT Sondershausen, Kyffhäuserkreis). Die Glocke ist nicht datiert, trägt aber auch den Abguss eines Pilgerzeichens aus Gottsbüren. Dadurch wird die Zeit ihrer Herstellung auf den Zeitraum zwischen 1331 und 1350, höchstens 1360 eingeengt, da nach dem raschen Bedeutungs-verlust der Gottsbürener Wallfahrt Pilgerzeichenabgüsse nach der Mitte des 14. Jahrhunderts bisher nicht belegt werden konnten, hingegen in den 1330er Jahren zahlreich waren. Bei einem zweiten unsauberen Abguss eines Pilgerzeichens auf derselben Glo-cke scheint es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Aachener Flachguss mit Spitzgiebel und bekrönenden Kreuzchen zu handeln. Der dritte Pilgerzeichenab-guss stellt in einem hochrechteckigen Architekturrahmen, der von zwei kleineren
104 Martin Scheins, Maria als Hüterin der Aachener Reliquien auf einem Schrotbild des 15. Jahrhun- derts, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 31 (1909) S. 180-189.
105 Vgl. die Handschriftenbeschreibung von Peter Jörg Becker -Tilo Brandis, Die theologischen latei- nischen Handschriften in Folio der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin: Teil 2. Ms. theol. lat. fol. 598-737 (1985) S. 224-226.
106 W[ilhelm] L[udwig] Schreiber, Formschnitte und Einblattdrucke in der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts Bd. 31) (1913), S. 18f., Nr. 25.
80
Abb. 24: Kolorierter Einblattdruck, Schrotblatt mit dem Aachener Gnadenbild und den Großen Heiltümern
seitlichen und einem höheren Mittelturm bekrönt wird, eine stehende Marienfigur mit Krone dar, die das Kind auf dem linken Arm trägt und in der rechten Hand einen kugelförmigen Gegenstand hält.
81
Rechts neben ihr steht ihr halbfrontal zugewandt ein Engel, der einen großen Kerzenleuchter hält. Das in Himmelsberg wohl im zweiten Viertel des 14. Jahrhun-derts abgegossene Zeichen ist nicht singulär. In „Heilig en profaan 2“ sind fünf sehr ähnliche Pilgerzeichen dokumentiert, die in Dordrecht gefunden wurden,107 und im Museum Het Valkhof in Nimwegen befindet sich ebenfalls ein solcher Fund, der aus Tiel stammt.108 Im Jahre 2011 fand Krzysztof Wachowski zusammen mit einer Reihe weiterer Pilgerzeichenfunde nochmals ein Exemplar im schlesischen Środa Śląska (Neumarkt). (Abb. 25)Die weite Verbreitung dieses Pilgerzeichentypus verweist auf einen marianischen Kultort mit einer so starken Ausstrahlung, dass für die erste Hälfte des 14. Jahr-hunderts im Reichsgebiet nur Aachen in Frage kommt. Ein weiteres Argument für die Zuweisung nach Aachen liefert ein bisher singuläres Pilgerzeichen, das in Amsterdam gefunden wurde: Es zeigt unter dem ausgebreiteten Marienkleid und
107 HP II (wie Anm. 25) S. 347, Nr. 1446-1450. 108 Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahr- hundert [Ausstellungskatalog Kevelar - Nijmegen - Zutphen – Roermond], hg. von Peter van der Coelen - Robert Plötz - H.J. Steeger (2001) S. 183, Nr. 117.
Abb. 25: Marienzeichen (aus Aachen?), gefunden in Środa Śląska (Schlesien)
Abb. 26: Marienzeichen aus Aachen, Mitte des 14. Jhs., Bodenfund aus Amsterdam
82
109 HP II (wie Anm. 25), S. 314, Nr. 1341. Ich habe Aleš Mudra (Prag) für den Hinweis auf diese Ähnlich- keit zu danken.110 Jörg Poettgen, Karl der Große auf Aachener Pilgerzeichen des Mittelalters. Mit einem Katalog der bisher bekannten Exemplare, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 110 (2008), S. 65-100, hier S. 95f. Nr. 33. 111 Ebd., S. 96.112 HP II (wie Anm. 25) S. 314, Nr. 1340113 Vgl. Kühne, OSTENSIO (wie Anm. 72) S. 157-160.114 Stephan Beissel, Die Aachenfahrt. Verehrung der Aachener Heiligthümer seit den Tagen Karls des Großen bis in unsere Zeit (1902).
Zuletzt ist ein bisher völlig singulärer Pil-gerzeichenabguss vorzustellen, der sich auf der undatierten Glocke von Oppers-hausen (Unstrut-Hainich-Kreis) findet und der zeitlich ebenfalls in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts gehören dürfte. Auch in diesem Fall handelt es sich um einen hochrechteckigen Rahmen, der ähnlich wie das vorherige Zeichen von zwei kleinen seitlichen Türmen und ei-nem kegelförmigen Mittelturm mit einem Kreuzchen bekrönt wird. Das Bildfeld wird von einer Art Vierpass gerahmt, in des-sen Ecken die vier Evangelistensymbole zu erahnen sind. In der Mitte thront Ma-ria mit einem Lilienszepter in der rechten Hand, während das Kind zu ihrer Linken steht. Ganz zu ihrer Rechten kniet eine Gestalt, die man durch den Kronreif als König ausmachen kann, und reicht ihr ei-nen Gegenstand.
Abb. 27: Abguss eines Marien-zeichens (aus Aachen?) auf der Glocke von Oppershausen
Zur Linken naht sich ihr ebenfalls eine kleine Gestalt, die einen Stab in Händen trägt. Es scheint sich hier um dieselbe Gestalt zu handeln, die in dem von Aleš Mudra als Typ C bezeichneten Typus als Pilger kenntlich ist. Man möchte gar zwischen dem in Oppershausen dargestellten Gesicht und dem von Hauglid pub-lizierten Pilgerzeichen (Abb. 20) eine Ähnlichkeit der Physiognomie erkennen. Die Szene des vor Maria knienden Königs muss auf den „heiligen Kaiser Karl“ bezo-gen werden und verbindet den Abguss in Oppershausen mit einem in Middelburg gefundenen Miniatur-Hausaltärchen aus Metall, das den heiligen Kaiser vor Maria im Wochenbett kniend zeigt.110 Jörg Poettgen verweist bei seiner Besprechung
der Vera Ikon eine stehende Marienfigur, die der des bisher besprochenen Pilger-zeichentypus ähnelt.109 (Abb. 26)
83
des Altärchens darauf, dass hier die Darstellung des sog. Aachener Mariensiegels (1327/28) und diejenige auf zwei Emailplatten des vor 1350 entstandenen Sime-onsreliquiars aufgenommen werden.111 Auch zu dem Abguss in Oppershausen gibt es eine interessante Parallele aus Amsterdam (Abb. 28):
Abb. 28: Marienzeichen aus Aachen, Mitte des 14. Jhs., Bodenfund aus Amsterdam
Ein Zeichen, das unter der Weisung des Marienkleides die thronende Marienfigur mit dem Kind in der charakteristischen Darstel-lungsweise der älteren Aachener Typen A und B zeigt. Auch hier nahen sich ihr auf der einen Seite eine Figur mit Reichsapfel – der Kopf mit Krone ist abgebrochen – und auf der anderen Seite eine Figur mit (Pilger)stab.112
Was lässt sich als Ergebnis dieses Parforce-ritts durch die Pilgerzeichenüberlieferung des Aachener Marienmünsters und deren konkre-tem Niederschlag in der Glockenlandschaft Nordthüringens festhalten? Angesichts der undurchsichtigen Zusammenhänge und Dif-ferenzen ikonografischer Typen könnte sich Verwirrung einstellen. Dennoch bestätigt sich die Meinung Kurt Kösters von der relativen Stabilität der Aachener Pilgerzeichentypen seit dem späten 14. Jahrhundert.
Ebenso haben wir vor allem durch die ikonografisch-kunsthistorische Analyse von Aleš Mudra die Zusammengehörigkeit der frühen Aachener Flachgüsse mit den Übergangstypen B und C und deren zeitliche Einordnung besser verstehen ge-lernt. Die Krux der Interpretation der typen- und formenreichen Aachener Pilger-zeichen dürfte besonders den Zeitraum von ca. 1325 bis 1375 betreffen. Durch die hier vorgestellten Varianten wird deutlich, dass man am Aachener Marienstift in dieser Zeit um die angemessene Form des (Wallfahrts-)Kultes und dessen Um-setzung in ein bildliches Programm gerungen hat. Man wird diesen Prozess nicht auf die Etablierung der regelmäßigen Reliquienweisung reduzieren können, die spätestens 1312 erstmals gefeiert wurde und seit 1349 im Siebenjahresrhythmus stattfand.113 Freilich wissen wir über diese historischen Vorgänge gegenwärtig sehr wenig und es ist überhaupt verwunderlich, dass es nach Stephan Beissels Monografie von 1902114 noch niemand unternommen hat, eine Geschichte der Aachenfahrt – immerhin der bedeutendsten mittelalterlichen Wallfahrtsbewegung im Reich überhaupt – zu schreiben. Wer auch immer diese Aufgabe eines Tages anpacken wird, er kommt dabei an den Aachener Pilgerzeichen als sprechenden Zeugen ihrer Geschichte nicht vorbei.
84
Ort Datum Pilgerzeichen
Bleicherode, Lk Nordhausen 1472 dreikreisiges Aachener Spiegelzeichen mit vierfiguriger Beweinung
Bodenrode-Westhausen, 1508 dreikreisiges Aachener SpiegelzeichenLk Eichsfeld mit Maria halbfigurig in der Mondsichel mit Strahlenkranz
Dachrieden 1489 1. dreikreisiges Aachener Spiegel- (Gemeinde Unstruttal), zeichen mit vierfiguriger BeweinungUnstrut-Hainich-Kreis
4. SchlussPilgerzeichen waren nach ihrer Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert zunächst eine kuriose Liebhaberei kulturhistorisch interessierter Sammler und durch die Abgüsse auf Glocken ein entlegenes Spezialthema der ohnehin kaum im Wissen-schaftsdiskurs wahrgenommenen Campanologie. Der Kunstgeschichte erschie-nen sie wohl zu sehr als Massenware und waren meist auch noch zu ‚hässlich‘, um ein Gegenstand ernsthafter Forschung sein zu können. Auch die Geschichte, Kir-chengeschichte oder Volkskunde hat sich dem Gegenstand bisher nie intensiv zu-gewendet und innerhalb der Mittelalterarchäologie bilden Pilgerzeichen eine unter vielen Fundgruppen, so dass diese Objekte zwischen den Disziplinen durch alle Raster fielen. Dass es dennoch lohnend sein kann, sich auf dieses mittelalterliche Massenprodukt einzulassen, sollte dieser Aufsatz zeigen. Denn Pilgerzeichen bil-den durch ihre massenhafte Verbreitung Wallfahrtsbewegungen oft geographisch und chronologisch klarer ab, als es schriftliche Quellen vermögen, in denen die ‚normale‘ religiöse Mobilität breiter Schichten selten Niederschlag gefunden hat. Dass Pilgerzeichen über die Funktion als Indikator für bestimmte Wallfahrtsbewe-gungen hinaus auch als Bildmedien interessant sind, sollte besonders der letzte Abschnitt zur Problematik der Aachener Pilgerzeichen deutlich gemacht haben. Die Zeichen spiegeln als ältestes Massenbildmedium des mittelalterlichen Europa nämlich auch Entwicklungen der Wallfahrtskulte und der Verehrungspraxis wieder, auf deren Reflexion in der Bildersprache der Zeichen in Zukunft stärker geachtet werden sollte.
Anhang: Übersicht zu den untersuchten Glocken
2. Fragment, dreikreisiges Aachener Spiegelzeichen mit vierfiguriger Beweinung 3. dreikreisiges Aachener Spiegel- zeichen mit vierfiguriger (?) Beweinung“
85
Ort Datum Pilgerzeichen
Diedorf 1517 1. runde Plakette mit Anna selbdritt (Gemeinde Katharinenberg), und Inschrift „1494“ Unstrut-Hainich-Kreis
Ellrich (St. Nikolai-Kirche), Ende 1. Elende Lk Nordhausen 15. Jh. 2. Nikolaus (Nikolausberg) 3. auf Drachen stehender hl. Georg
Großgrabe (Weinbergen-Groß- 1517 dreikreisiges Aachener Spiegelzei-grabe) Unstrut-Hainich-Kreis chen mit Maria halbfigurig in der Mondsichel mit Strahlenkranz, mittlere und unterer Teil des oberen Kreises vergossen
Großurleben, Verwaltungs- 1516 1. PZ Ziegenhaingemeinschaft Bad Tennstedt, 2. Kreuz mit lilienförmigen Unstrut-Hainich-Kreis Verzierungen 3. Vera-Ikon-Plakette
Gudersleben (OTEllrich), 1476 1. Köln, Hl. Drei Könige (Typ B III b) Lk Nordhausen 2. Köln, Hl. Drei Könige (Typ C III, aber kein bekannter Untertypus) 3. dreikreisiges Aachener Spiegel- zeichen, im unteren Kreis Drei- gesicht, im oberen Wappen von Engeln gehalten 4. Fragment: stehender Pilger mit Stab (unklar, Fragment von Jakobsberg?)
Hain (OT von Kleinfurra), um 1500 Vier identische, etwas vergossene Lk Nordhausen) Plaketten, Pieta, Grimmenthal (?)
Harzungen 1499 Köln, Hl. Drei Könige (Typ B III b) nur (Landkreis Nordhausen) untere Hälfte abgegossen
Hauröden (OT von Bischoffe- 1504 1. Marienzeichen Querfurtrode), Lk Eichsfeld 2. ädikulaförmiges Zeichen, stark ver- gossen
Heiligenstadt (Kirche 1370 einkreisiges Aachener Zeichen, auf derSt. Ägidien), Lk Eichsfeld Bank thronende Maria mit Kind, dar- über Weisung des Marienkleides und Pantokrator
Heiligenstadt (Martinikirche), 1518 1. Wolfgangszeichen (evtl. Sankt Lk Eichsfeld Wolfgang am Aberse?) 2. Unbekanntes Antoniuszeichen
86
Ort Datum Pilgerzeichen
Helmsdorf, (Verwaltungs- 1496 1. dreikreisiges Aachener Spiegelzei-gemeinschaft Dingelstädt), chen mit vierfiguriger Beweinung Lk Eichsfeld, kath. Pfarrkirche1 2. Vierzehnheiligen bei Jena 3. nicht zu identifizierendes Zeichen
Heroldishausen, 1518 dreikreisiges Aachener Spiegelzeichen Unstrut-Hainich-Kreis2 mit Maria halbfigurig in der Mondsichel mit Strahlenkranz
Heuthen, (Landkreis Eichsfeld) 1519 runde Plakette mit Anna selbdritt und Inschrift „1494“
Himmelsberg (OT von Sonders- Um 1350 1. Gottsbürenhausen), Kyffhäuserkreis 2. Aachen, Maria mit Engel und Kerze 3. Aachen, stark vergossener Flach- guss: Ädikula mit Spitzgiebel, zwei Türmchen und 4 Ösen
Holbach (OT von Gemeinde 1461 1. Elende Hohenstein), Lk Nordhausen 2. Nikolauszeichen mit Schriftband (Nikolausberg)
Kreuzebra (Verwaltungs- 1516 Marienzeichen Querfurtgemeinschaft Dingelstädt), Lk Eichsfeld, Uhrschlagglocke
Kreuzebra, 2. Glocke 1520 1. Elende 2. Nikolauszeichen mit Schriftband (Nikolausberg) 3. Maastricht, kreisrundes Zeichen mit Servatiushaupt
Mehrstedt (OT Schlotheim), 1512 1. Köln, Hl. Drei Könige (Typ B IIIb)Unstrut-Hainich-Kreis 2. Maastricht, Zeichen mit Servatius- büste 3. dreikreisiges Aachener Spiegel- zeichen mit Maria halbfigurig in der Mondsichel mit Strahlenkranz
1 Die Angaben erfolgen nach der Glockenerfassung Richard Heinzel (wie Anm. 60). Nach Aussage des zuständigen Pfarrers Markus Hampel von Januar 2012 gibt es in der Pfarrkirche keine mittelalterlichen Glocken mehr; diese wurden durch Stahlglocken ersetzt.2 Die Angabe erfolgt nach Beschreibende Darstellung (wie Anm. 58), Bd. 2: Kr. Langensalza, S. 15. Die Glocke war bereits zuvor umgegossen worden.
87
Ort Datum Pilgerzeichen
Nordhausen, Kirche Sankt 1496 1. Köln, Hl. Drei Könige (Typ B III b)Blasii, Uhrschlagglocke 2. Maastricht, Servatiusbüste mit zwei Engeln, 3. Vera Ikon (Rom?), 4. Jakobsberg bei Höxter 5. Jakobsberg bei Höxter 6. Marienzeichen aus Querfurt 7. Marienzeichen aus Querfurt 8. dreikreisiges Aachener Spiegelzei- chen mit vierfiguriger Beweinung (auf der Flanke, nur unterer Kreis mit Beweinung)
Neunheilingen, 1476 1. Ziegenhain Unstrut-Hainich-Kreis 2. Hall (Belgien)
Oppershausen, 14. Jh. Aachen: quadratisches PZ mit vier Unstrut-Hainich-Kreis Ösen, thronende Maria, links daneben Karl der Große kniend, rechts Pilger
Osterode (OT von Neustadt/ 1513 1. dreikreisiges Aachener Spiegelzei-Harz), Lk Nordhausen chen mit vierfiguriger Beweinung 2. Neuss, Quirinuszeichen 3. Jakobsberg (?) rundes Zeichen mit vier Ösen und stehendem Heiligen, vergossen
Pustleben (OT von Wipper- 1467 dreikreisiges Aachener Spiegelzel-dorf), Lk Nordhausen chen mit vierfiguriger Beweinung
Seebach, Kr. Mühlhausen 15. Jh. Elende
Wiegersdorf (OT von Ilfeld), 1513 1. dreikreisiges Aachener Spiegelzei- Lk Nordhausen chen mit vierfiguriger Beweinung 2. Jakobsberg (?) rundes Zeichen mit vier Ösen und stehendem Heiligen, Rankenwerk, vergossen 3. Marienzeichen, Maria thronend mit dem Kind unter Ädikula und zwei Fialen, vergossen 4. Kreuzigung unter gestufter Ädikula mit Maria und Johannes, vier Ösen, nicht identifiziert
190
Abbildungsnachweis
49 H. Brall-Tuchel, 50 (Abb. 2) H. Kühne, 50 (Abb. 3) H. Kühne, 52 J. Ansorge, 53 J. Ansorge, 61 H. Losche, 62 (Abb. 6 und 7) H. Losche, 63 (Abb. 8 und 9) H. Kühne, 64 H. Kühne, 65 (Abb. 11) H. Losche, 65 (Abb. 12) C. Brumme, 66 H. Losche, 67 Kölner Domblatt 23/24, 68 H. Losche, 69 K. Köster, Germanisches Nationalmuseum, 70 Reproduktion nach C. Enlart, Manuel d‘archéologie fran-çaise, 71 H. Kühne, 74 Materialsammlung H. Schuster, Landesamt für Denkmal-pflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle, 75 (Abb. 20) Reproduktion nach R. Hauglid (1938), 75 (Abb. 21) J. Ansorge, 77 Bildstelle Marburg (Aufnahme-Nr. 64.432), 78 Materialsammlung H. Schuster, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle, 80 Reproduktion nach W. L. Schreiber (1913), 81 (Abb. 25) K. Wachowski, 81 (Abb. 26) Reproduktion nach HP II (wie Anm. 25 auf S. 56) Nr. 1341, 82 Materialsammlung H. Schuster, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle, 83 Reproduktion nach HP II (wie Anm. 25 auf S. 56) Nr. 1340.