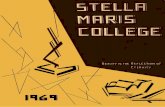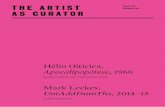1968 autofiktional: Der Pariser Mai als narratives Konstrukt in Wort und Bild
-
Upload
uni-rostock -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 1968 autofiktional: Der Pariser Mai als narratives Konstrukt in Wort und Bild
Albrecht Buschmann
1968 autofiktional: der Pariser Mai als narratives Konstrukt in Wort und Bild
1. Stadtraum und Kunstraum, neu codiert
Ab Mitte Mai 1968 arbeiten die Druckwerkstätten der Pariser École des Beaux-Arts auf Hochtouren. Hier entstehen als Lithographien oder im seinerzeit hochmodernen Siebdruckverfahren Tag für Tag in hohen Auflagen politische Plakate, die anschließend von Helfern auf Mauern und Gebäude geklebt werden.
In konsequenter Verweigerung der gängigen Regeln der Kunstwelt ent-stehen diese Plakate streng anonym, auch wenn namhafte Künstler wie Alexander Calder, Jacques Carelman, Jean-Jacques Sempé oder Daniel Milhaud an den Entwürfen mitwirken. Welche der Entwürfe gedruckt werden, entscheidet ein Kollektiv. Das Ich der oft namhaften Künstler geht auf im Wir der Werkstatt. Aufgehängt werden die Plakate nicht in Galerien oder Museen, sondern auf der Straße. Diese Kunstwerke kann man nicht kaufen, sondern gratis sehen, und sie sind keine Unikate, sondern Massenware. Kunst ohne erkennbares Künstlersubjekt, ohne Preis, ohne Signatur, ohne separierten Raum – beinahe scheinen sie eine Utopie zu verwirklichen, verheißen sie doch ganz konkret die Inversion zentraler Codes im Symbolsystem ‚Bildende Kunst’. Wohl deshalb sinniert die Hauptfigur eines Romans über den Pariser Mai, die der fruchtlosen Diskussionen müde ist:
En revanche, nous collâmes des centaines d’affiches des Beaux-Arts et des Arts-Déco. Eux furent à la hauteur, produisant sans cesse, se renouvelant chaque jour, liant harmonieusement théorie et pratique sans jamais racoler pour un groupuscule. (Fajardie 1988: 47)
Auf manchen der Plakate sind jene teilweise bis heute gebräuchlichen Slogans in situationistischer Manier zu lesen, mit denen die Wirklichkeit in witzige Paradoxe überführt wird: „Il est interdit d’interdire.“ Andere zeigen komplexe Bild-Text-Kombinationen, die die zeitgenössischen politischen Ereignisse kommentieren, persiflieren, zuspitzen – etwa in dem am 21. Mai erstmals geklebten Plakat zu Charles de Gaulles Diktum vom 19. Mai: „La réforme oui! La chienlit non!“ Der deftige Slogan wird aufgenommen und gegen seinen Urheber gewendet: Wer so etwas sagt, ist selbst „chienlit“. Doch bleibt es nicht bei dieser starren Rhetorik, in der einer Behauptung eine Gegenbehauptung entgegengestellt wird. Denn im Ikonotext wird de
Albrecht Buschmann 2
Gaulle nicht einfach abgebildet, sondern maximal vereinfacht dargestellt, erkennbar nur an der langen Nase plus Offiziersmütze, und solcherart als Kinderpuppe präsentiert. Die Respektsperson als Handpuppe, die Autorität im Kontext des Infantilen, de Gaulle als lächerlich zappelndes Spielzeug. Text und Ikonotext des Plakats stellen frech die politische Hierarchie der fünften Republik auf den Kopf, ohne sich aber selbst zu wichtig zu nehmen. Denn dafür fehlt dem Text jener vollmundige Duktus protestierender Selbstgewissheit („Non à…!“ – „… jamais!“), zudem sieht die Handpuppe einfach nur niedlich aus (vgl. Abbildung 1).1
Inversion eines kulturellen Codes, Inversion der politischen Hierarchie, und wenn wir uns nun die Plakate im Raum der Stadt vorstellen, zunächst an den Mauern der Renault-Fabrik in Boulogne-Billancourt, dann im Quartier Latin, an Mauern und Wohnhäusern, unter Straßenschildern oder an öffentlichen Gebäuden klebend, gerät auch die gewohnte Relation zwischen öffentlichem Stadtraum und dem üblicherweise privaten Kunstraum in Schwingung. Die Kunst verlässt ihre heiligen Orte, ist plötzlich dans la rue, was die Wahrnehmung des Stadtraums verändert, vor allem aber auch das Verständnis davon, was als Kunst zu gelten hat. Der schwarze Rahmen des Plakats trennt von der Fläche des Stadtraums einen Bereich ab, der Alterität beansprucht, einmal aus sich selbst heraus, aber auch in Relation zu dem ihn umgebenden Stadtraum und dem von ihm verlassenen Kunstraum. Die Vielzahl der Plakate bilden Fremdkörper am Leib der Stadt, die das gewohnte Stadtbild aufrauhen. Ohne zwischen politischer Aussage und kulturellem Statement zu unterscheiden, sind ihre Inversionen präsent für jeden, der auf die Straße geht, und so wird la rue, dieser emblematische Ort des Pariser Mai, in einem Atemzug politisch und kulturell neu codiert.2
*
Das Ich, das aufgeht im Wir, und die Dynamisierung der Räume im Kontext des Pariser Mai 1968, sind die Eckpunkte der folgenden Untersuchung. Was aber war der Pariser Mai 1968? Ein événement oder ein mouvement, eine révolte oder eine révolution? Für General Charles de Gaulle bestanden seinerzeit keine Zweifel, in seinen Augen handelte es sich um eine Verschwörung mit dem Ziel, in Frankreich eine totalitäre kommunistische Diktatur zu errichten: „La France en effet est menacée de dictature [...] [, de] la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main.“ (de Gaulle 1968) So seine Äußerung bei der ereignisgeschichtlich entscheidenden Radioansprache am Nachmittag des 30. Mai 1968. Nicht weniger drastische Worte hatte bereits zwei Wochen zuvor sein Premierminister Georges 1 Dieser Effekt sticht besonders deutlich ins Auge, wenn man die auf de Gaulle gemünzte
Graphik mit der auf Nicolas Sarkozy übertragene Fotomontage (vgl. http:// imaginaction.over-blog.org/article-19991872-6.html, 15.10.2008) vergleicht.
2 Zur Geschichte der Druckgraphik aus der École des Beaux-Arts im Kontext des Pariser Mai vgl. Fraenkel (2008).
1968 autofiktional 3
Pompidou gewählt, als er am 14. Mai vor der Nationalversammlung erklärt hatte: „A ce stade, ce n’est plus, croyez-moi, le gouvernement qui est en cause, ni les institutions, ni même la France. C’est notre civilisation elle-même.“ (Pompidou 1968) Das war am Tag nach dem Beginn des größten französischen Generalstreiks seit 1934, am Tag drei nach der so genannten nuit des barricades vom 10. auf den 11. Mai, die für die Geschichtsschreibung zum Pariser Mai 1968 den Übergang vom studentischen Protest im Quartier Latin zum sozialen Protest im ganzen Land markiert.3
Das Ende der Zivilisation. Große Worte, die Georges Pompidou in die Diskussion wirft, und an großen Worten mangelt es generell nicht, wenn über 1968 und speziell über den Pariser Mai gesprochen wird, weder seinerzeit noch in den späteren Beschreibungen und Bewertungen der Zeitzeugen. Wie kaum ein zweites Ereignis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die studentischen Proteste dieser Wochen, haben die Besetzung der Sorbonne, haben die Straßenkämpfe um die Universität, der Generalstreik, das Taktieren der alten Linksparteien, das Zaudern der Regierung, gipfelnd in Großdemonstrationen auf den Grands Boulevards und in erneuten Straßenschlachten im Quartier Latin, zu persönlichen Wortmeldungen animiert. Viele Zeitgenossen, vor allem diejenigen, die dem mouvement Sympathie entgegenbrachten, fühlen sich offensichtlich aufgerufen zum (meist auf das eigene Erleben fokussierenden) Erzählen. Die Folge davon ist, dass hinter einer Flut von Geschichten das „Ereignis zum Mythos“ wird – so der treffende Untertitel des Sammelbandes 1968 von Ingrid Gilcher-Holtey (2008).
3 Vgl. Gilcher-Holtey (1995: 32): „Die Ereignisse in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai
veränderten die Bewegung. Sie dehnte sich räumlich und sozial aus. Sie übersprang das Quartier Latin und das Studentenmilieu sowie die Kreise der sympathisierenden Schüler und Jugendlichen. Sie löste eine nationale Welle der Solidarisierung mit den Studenten in der breiten Öffentlichkeit aus und verknüpfte die organisierte Arbeiterbewegung mit der Studentenbewegung zu einer gemeinsamen Demonstration gegen die Regierung.“
Albrecht Buschmann 4
2. Kritische Momente unter autofiktionaler Perspektive. Das Korpus
Im Folgenden sollen, um die Entstehung dieses mythischen Bildes von 1968 besser verstehen zu können, einige Wortmeldungen aus der Zeit und über die Zeit analysiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden: Erinnerungen und Memoiren der politischen Akteure beider Seiten, der Vertreter des Staates wie der Demonstranten, daneben Romane, Dokumentationen, Filme und, wie eben gesehen, Plakate, die seit 40 Jahren – und, wie gerade jetzt wieder, meist zu den jeweiligen runden Gedenktagen erscheinend – rezipiert werden und ihren Teil zur Mythisierung beitragen.4 Um diese „histoire collective“ (so der Untertitel von Artières/Zancharini-Fournel 2008) wenigstens exemplarisch als narratives Konstrukt beschreiben zu können, werde ich mein Augenmerk auf die Darstellung zweier Einzelereignisse richten: auf die nuit des barricades sowie auf das rätselhafte Verschwinden Charles de Gaulles am 29. Mai, beides „kritische Momente“ im Sinne Pierre Bourdieus (1988: 254ff.). Dass es sich um ereignisgeschichtliche Schlüsselmomente handelt, betont die Historio-graphie (vgl. Gilcher-Holtey 2008: 15ff.); hinzu kommt, dass die beiden Momente unter kommunikationsgeschichtlicher Perspektive besonders relevant und gewissermaßen komplementär sind: In der Nacht der Barrikaden wird, dank der Live-Übertragung des Radiosenders RTL, schon landesweit über das Ereignis kommuniziert, noch während es sich ereignet,5 wohingegen der 29. Mai der Tag des abwesenden, des schweigenden, des seine Mitarbeiter und Vertrauten nicht informierenden Präsidenten ist, dessen Radioansprache am folgenden Tag auch deshalb so große Wirkung
4 Einen analytischen Vergleich der sich wandelnden Schwerpunkte der Erinnerung an
das Ereignis ‚1968’ bietet Rioux (2008). 5 In der Nacht der Barrikaden stellten zahlreiche Anwohner der Straßen des Quartier
Latin ihre Radios auf die Fensterbänke, was bei den Protestierenden auf der Straße schon im Augenblick der Aktion deren Rezeption ermöglichte: „De toutes parts, dans la rue, on était baigné dans les sons de l’événement: il y avait instantanéité totale entre l’événement et l’information, l’information et sa réception.“ (Bernard 1990: 258) Ein anderer Zeitzeuge beschreibt die euphorisierende Wirkung dieser Simultaneitätserfahrung: „Dès que j’ai entendu un transistor, cela m’a énormément réconforté. Ils ont parlé d’une trentaine de barricades. J’ai sauté de joie et on a tous crié: On n’est pas seuls!“ (zit.n. Gilcher-Holtey 2005: 244) Die Schlüsselerfahrung des Einzelnen, Teil eines größeren ‚Wir’ zu sein, das via Radio-Live-Schaltung in ganz Frankreich wahrgenommen wird, generiert einerseits ein gestärktes Selbstbild, andererseits trägt es zu einem „enthousiasme communicatif“ bei (wie Le Monde es am Tag danach nannte, vgl. Gilcher-Holtey 1995: 245), der im Erzählen von den Ereignissen all die vielen Ichs auf den Barrikaden und in ihrer Nähe auf eine nationale Ebene transzendiert, sie zu Akteuren von (in diesem Augenblick) nationaler Tragweite macht. Und man darf annehmen: Auch viele andere, die in dieser Nacht nicht selbst auf den Barrikaden waren, sondern mitfiebernd vor ihrem Radio saßen, fühlten sich im Nachhinein als Teil der Ereignisse.
1968 autofiktional 5
entfaltet, weil zuvor bei seinen Anhängern die Sorge bestand, er könnte sie womöglich für immer verlassen haben.6
Die Erzählungen über diese Momente möchte ich als autofiktionale Konstruktionen begreifen, als petits récits, die das eigene Leben und Erleben einpassen und anpassen an die grands récits vom Mai 1968. Es geht dabei nicht darum, ausgehend von einem bipolaren Modell zu prüfen, wer im Vergleich zu ereignisgeschichtlichen Darstellungen oder soziologischen Analysen vermeintlich korrekt erzählt und wer nicht, sondern vielmehr herauszuarbeiten, wie das, was sich seit nunmehr vierzig Jahren als Bild vom Pariser Mai verdichtet, als diskursives Konstrukt entsteht. Schließlich räumen auch Historiker wie Norbert Frei ein, dass man ‚1968’ kaum ereignisgeschichtlich und nur diskursanalytisch auf die Schliche kommen könne. Er schreibt:
‚68’ ist mehr als der Inbegriff des einen realen Geschehens. ‚68’ ist der Assoziationsraum gesellschaftlicher Zuschreibungen und auktorialer Selbstdeutungen, eine beispiellos florierende Begegnungsstätte, in der die Aussagen der Akteure und die Entgegnungen ihrer Kritiker, die Wahrnehmungen der Zeitgenossen und die Beobachtungen der Nachgeborenen aufeinandertreffen. ‚68’ ist das Ergebnis von Interpretation und Imagination im ‚weltweiten Schein der Gleichzeitigkeit’. Genau darin liegt die historiographische Tücke des Objekts. (Frei 2008: 211)
Aus diesen Überlegungen leitet der Historiker seine (diskurszentrierte) Definition dessen ab, was einen Achtundsechziger auszeichnet: „,68er’ zu sein, hieß schon damals und heißt bis heute, über ‚68’ zu reden.“ (Frei 2008: 210)
Mit autofiktionalen Konstrukten ist also das gemeint, was Norbert Frei die „auktorialen Selbstdeutungen“ (Frei 2008: 211) nennt, und ihre Analyse soll ohne die sich anbietenden präskriptiven Festschreibungen des fiktionalen Status der jeweils ins Blickfeld rückenden Genres vonstatten gehen: Die sogenannten Tagebücher, Erinnerungen, Protokolle wie auch die eingangs zitierten Reden sollen zunächst äquivalent zu Romanen oder Filmen betrachtet werden. Der hier verwendete Begriff der ‚autofiktionalen Konstruktion’ meint damit etwas anderes als jener der autofiction, wie ihn Serge Doubrovsky 1977 eingeführt hat und der sich exklusiv auf Romane bezieht, die im Englischen als autobiographical novel bezeichnet werden würden. Auch die von Gérard Genette (1991: 86f.) in die Diskussion um den französischen Begriff der autofiction eingebrachte Differenzierung in „vraie
6 Wegen der durchschlagenden Wirkung der Rede – und um die prekäre Lage in den
Stunden zuvor zu überspielen – wurde aus dem Umfeld de Gaulles die Erklärung lanciert und vertreten, dieses Verschwinden sei ein genialer Schachzug des Präsidenten gewesen, mit dem es ihm gelungen sei, sich wieder in eine offensiv gestaltende Position gegenüber seinen Widersachern zu bringen (vgl. auch die Analyse der Darstellung von Jacques Foccart im Abschnitt 3). Diese These diskutiert Gilcher-Holtey und gelangt zu dem Fazit: „Die historische Forschung indes […] kann die These, daß der Flug nach Baden-Baden ein intendierter, taktischer Schachzug de Gaulles war, nicht stützen […].“ (1995: 404)
Albrecht Buschmann 6
autofiction“ (wenn sich die dreifache Identität von Autor, Erzähler und Protagonist im rein fiktionalen Kontext situiert) und „fausse autofiction“ (wenn sie im Kontext realer Ereignisse dargestellt ist) möchte ich nicht a priori übernehmen, weil durch die Begriffe ‚wahr’ und ‚falsch’ an der Trennlinie zwischen fiktionalen und diktionalen Texten eine Konnotation eingeführt wäre, deren wertender Charakter offensichtlich ist.7
Folgende Erzählungen der Ereignisse sollen untersucht und miteinander verglichen werden: Aus der Perspektive derjenigen, die den Demonstranten gegenüber standen, kommen Maurice Grimaud, seinerzeit Polizeipräfekt von Paris, und Jacques Foccart zu Wort, einer von Charles de Gaulles poli-tischen Freunden aus der Zeit der Résistance und 1968 offiziell sein General-sekretär für Afrikapolitik. Beide veröffentlichen ihre Erinnerungen mit mehr als dreißig Jahren Abstand. Für die Perspektive der Protestierenden möchte ich Louis Malles Film Milou en Mai (1988) und Frédéric Fajardies Roman Jeunes femmes rouges toujours plus belles (1988) heranziehen sowie die dokumentarische Montage Génération von Hervé Hamon und Patrick Rotman (1987). Allen Texten ist gemeinsam, dass sie nach den Ereignissen veröffentlicht wurden, folglich in Kenntnis der ereignisgeschichtlichen Abläufe sowie mindestens der ersten Phase der Rezeption um den ersten Jahrestag 1978. Es soll nun nicht darum gehen, Entwicklungslinien der Rezeption aufzuzeigen, etwa mit Blick auf die bisher vier runden Jahrestage,8 sondern vielmehr zu skizzieren, wie die konkrete Zeitangabe ‚1968’, deren Semantik als Epochenbegriff ja immer diffuser wird, sich in Erzählmuster übersetzt, vor allem, wie sie sich in Raumwahrnehmungen konkretisiert. Karl Schlögel schreibt Im Raume lesen wir die Zeit (2003) und darum werden die genannten Artefakte insbesondere daraufhin untersucht, wie sie das Geschehen des Pariser Mai 1968, insbesondere die kritischen Momente und die sich an sie anlagernden Interpretationen, im Raum darstellen, in Raumsymbolik überführen oder, im Fall des eingangs erwähnten Plakats „La chienlit c’est lui!“, sich selbst im euklidischen Raum konstituieren.
Beginnen wir von innen, vom Blick aus dem Zentrum der Macht auf das Zentrum der Machtausübung, mit Jacques Foccarts 1997 veröffentlichtem zweiten Teil seiner Erinnerungen Le Général en Mai. Journal de l’Élysée II. 1968-1969.
7 Zur Diskussion um die problematischen Begriffe ‚Autobiographie’, ‚autofiction’ und
‚Neue Autobiographie’ vgl. de Toro (2004). 8 Den Versuch einer solchen Gedächtnisgeschichte der Ereignisse bieten Rioux (2008)
sowie der Beitrag von Silja Behre in diesem Band. Eine chronologische Diskursgeschichte der autofiktionalen Erzählungen vom Pariser Mai kann, da hierfür ein Korpus von einigen hundert Texten herangezogen werden müsste, nicht Gegenstand dieses Aufsatzes sein.
1968 autofiktional 7
3. Jacques Foccarts Le Général en Mai. Journal de l’Élysée II. 1968-1969 (1997): Rückbesinnung auf die ‚großen Tage’
In den Erinnerungen dieses engen Vertrauten de Gaulles im Kabinett werden die Maitage als dramatisches Ringen um die Kontrolle der Exekutive über die Ereignisse beschrieben. Der Text ist streng chronologisch nach Eintragungen Tag für Tag gegliedert, wobei innerhalb dieser ein authentisches Tagebuch emulierenden Form erkennbar narrativ verdichtet wird, etwa mit pointierten Dialogen, ausführlichen Charakterskizzen und offensichtlich nachgetragenen resümierenden Beurteilungen, die nicht frei von Pathos sind. So heißt es am Ende des Eintrags zum 29. Mai:
Telle a été cette journée effroyable, angoissante, déchirante de drame personnel, le drame du vieux gaulliste que je suis, éprouvé dans toute l’affection que j’ai pour le Général, brisé de voir cet homme en arriver au point de se poser de telles questions. Enfin, c’était épouvantable. (Foccart 1997: 149)
Im Präsens der Erzählung wird der Leser dank dieser Erzählweise zum Augen- und Ohrenzeugen von Kabinettssitzungen und Telefonaten, Krisengipfeln und Hinterzimmerbesprechungen. In direkter Rede ist beispielsweise Premierminister Georges Pompidou zu hören, der am 30. Mai zum Erzähler sagt: „Je pense que je suis démissionaire, je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions.“ (Foccart 1997: 149) Doch Foccart kann gerade noch steuernd eingreifen und entgegnet: „Georges, ce n’est pas le moment de faire cela.“ Woher die Sicherheit des Ich-Erzählers? Er ahnt, dass de Gaulle keineswegs unüberlegt vorgeht, weshalb er Pompidou erklärt: „Si, d’ailleurs de toute façon, je pense que le Général doit avoir des intentions.“ (152) Foccart selbst wie das von ihm beschriebene Personal bewegen sich allein in geschlossenen Räumen, die Orte der Ereignisse (die Pariser Innenstadt, die Boulevards, das Quartier Latin) werden kaum einmal benannt, vom Erzähler weder selbst gesehen noch medial vermittelt beschrieben.
Dieser räumlichen Leerstelle in Jacques Foccarts Bild von den Ereignissen entspricht die als beängstigend wahrgenommene Leere im Élysée-Palast, als am 29. und 30. Mai der General verschwunden ist. Gefüllt wird sie mit einer deutlich als solchen erkennbaren Re-Konstruktion der Vorgänge, mit der der autofiktionale Erzähler seine sich bewahrheitenden Vorahnungen und vor allem seine Rolle bei der Rettung Frankreichs betont. Schon für den 29. Mai heißt es bei Foccart „J’ai senti qu’un drame se jouait à l’Élysée“ (145), und am Nachmittag des 30. ist es allein Foccarts beherzte Ansprache an den soeben nach Paris zurückgekehrten General, die das Blatt der Geschichte wendet. Folgendermaßen habe er zu de Gaulle gesprochen:
„Mon Général, le pays a soif d’ordre et d’autorité […]. Il veut être commandé, c’est tout simplement cela. Si vous le lui dites, c’est gagné. C’est gagné ! On n’a pas le droit de continuer comme cela, ce n’est pas possible…” – Eh bien, oui ! Foccart, on le fera. On va le faire, j’y suis décidé. (Foccart 1997: 150; Hervorhebg. im Orig.)
Albrecht Buschmann 8
Dank der Ansprache des Erzählers habe der General wieder seine Zuversicht „des grands jours” (150), gemeint ist der Kampf in der Résistance, zurückgewonnen: „Je retrouve un homme tout à fait différent, un homme transformé, décidé, qui est en train de griffonner sur un papier ce que je lui dis.“ (150) Daraufhin will er ihm die Eckpunkte seiner bevorstehenden Rede diktiert haben. Auch die von allen Kommentatoren post quem hervorgehobene Bedeutung der festen Stimme des Generals für den Erfolg der nachmittäglichen Radioansprache des 30. Mai ist aus Foccarts Sicht ihm zu verdanken,9 war er es doch, der de Gaulle folgenden Ratschlag gegeben haben will: „Mon Général, si vous parlez haut et ferme, c’est possible.“ (150)
Höhepunkt dieses erinnerten Dialogs ist die ans Ende der Erzählsequenz gestellte Szene der körperlichen Nähe des Erzählers zum General nach dem hier zusammengefassten Gespräch, die deutlich als Kompensation zu der zuvor schmerzlich erlebten Trennung arrangiert ist. Noch einmal Foccart: „Alors, le Général se lève, et la poignée de main est extrêmement émouvante. Je suis porté par un élan à l’embrasser, et lui aussi je crois. Enfin, nous en restons à la poignée de main.“ (151) Die Präsenz des Körpers de Gaulles in seinem Amtssitz, seine unmittelbar erlebte körperliche Nähe, sowie die Körperlichkeit seiner Stimme am Radio, beides vom Erzähler-Ich mit seinem eigenen Wirken eng verknüpft, werden so erinnert, dass sie das Subjekt der Erzählung an einer Schlüsselstelle für die Sicherung der politischen Macht positioniert. Ein in seiner räumlichen Wahrnehmung eingeschränktes und, wie der folgende Vergleich mit den Erinnerungen Maurice Grimauds zeigen wird, auffallend stark auf das Erzähler-Ich fokussiertes autofiktionales Konstrukt.
4. Maurice Grimauds Je ne suis pas né en mai 68. Souvenirs et carnets 1934-1992 (2007): Friedfertigkeit als Werteklammer
Maurice Grimaud, seinerzeit Polizeipräfekt von Paris, legt in seinem Buch Je ne suis pas né en mai 68. Souvenirs et carnets 1934-1992 den Akzent der Erzählung auf die Betonung seiner Rolle bei der Deeskalation des Geschehens auf den Straßen der Hauptstadt.10 Auch seine Erinnerungen präsentieren sich als authentisches Tagebuch, allerdings mit einem höheren Grad an Glaubwürdigkeit als im Falle Foccarts, etwa weil in den chronologischen Aufzeichnungen mehrfach metasprachlich kommentierend festgehalten wird, dass wegen der sich überstürzenden Ereignisse an diesem oder jenem Tag keine Eintragungen möglich gewesen seien: Die explizit benannte Ellipse als Teil einer erzählerischen Beglaubigungsstrategie. Sich
9 In der der historischen Datenbank für Tondokumente des Anbieters www.ena.lu kann
man sich die Rede Charles de Gaulles in der Originalaufnahme anhören (vgl. de Gaulle 1968).
10 Bereits mit En Mai fais ce qu’il te plaît (1977) hatte er im Vorfeld des ersten runden Jubiläums ein Buch über die Ereignisse von 1968 vorgelegt.
1968 autofiktional 9
selbst zeigt Grimaud mehrfach in Szenen fürsorglicher Paternalität für die ihm unterstellten Polizisten, die er beispielweise ohne schützende Eskorte und quasi inkognito in seiner privaten Dauphine auf ihren Posten aufsucht, um ihnen Mut zuzusprechen (Grimaud 2007: 325). Nicht nur der Text, auch der Ikonotext hebt die dialogische Kompetenz des Ich-Erzählers hervor und dokumentiert seine Präsenz dans la rue: Fotos im Buch zeigen Grimaud bei Diskussionen mit Anwohnern und Journalisten auf den Straßen des Quartier Latin.11
Maurice Grimauds Blick auf die zentralen Akteure der Regierung ist deutlich kontrastiv angelegt. Dem Präsidenten de Gaulle, der den Ereignissen lieber mit offensiven Polizeiaktionen, etwa der sofortigen Räumung des besetzten Théâtre de l’Odéon, begegnen möchte, steht Premierminister Pompidou gegenüber, bei dessen Beschreibung Grimaud mehrfach Ruhe und Besonnenheit betont.12 Zu der ersten gemeinsamen Besprechung nach de Gaulles Rückkehr nach Frankreich am 18. Mai heißt es zusammenfassend:
Le Général a constamment parlé d’un ton vif et colérique, le visage un peu rouge, le pied impatient sous la table. Son autorité est certaine et Pompidou et les autres marquent bien leur attitude respectueuse. Cependant, ils disent ce qu’ils ont à dire avec un certain courage, surtout Pompidou qui est intervenu très calmement pendant toute cette scène, évitant manifestement de dramatiser. (Grimaud 2007: 329; vgl. auch 325)
Selbst die aus polizeilicher Sicht unproblematische Gewerkschaftsdemonstration im Stadion von Charléty (27. Mai) hätte de Gaulle am liebsten verbieten lassen. Grimaud hingegen, unterstützt von Pompidou, habe auf die Kanalisierung des Protests in solchen Großveranstaltungen gesetzt, weil sie von den Gewerkschaften und den klassischen Linksparteien organisiert wurden und leichter zu kontrollieren waren. Dank mehrfacher Intervention Grimauds widersetzt sich de Gaulle schließlich nicht mehr der Genehmigung der Veranstaltung. „[I]l se résigne“ (332), übermittelt man dem Polizeipräfekten aus dem Élysée.
Wieder erkennen wir einen Erzähler, der den General erfolgreich lenkt und, diesmal deeskalierend, Schlimmeres verhindert. Auch bei Grimaud schreibt sich der Ich-Erzähler gezielt als Teil des gaullistischen Erfolgs in die Geschichte der Nation ein, wenn er am 31. Mai über das Verhalten de Gaulles resümierend urteilt: „Une fois de plus le Général a su intervenir de façon décisive au moment crucial.“ (337)
Für die Stunden des Verschwindens des Generals am 29. Mai gesteht Grimaud seine völlige Unkenntnis ein, er kann auf den diesbezüglichen Seiten nur referieren, was ihm an sich widersprechenden Informationen zugetragen wird. Da er sich aber nicht nur im Polizeipräsidium oder durch
11 In historischen Filmaufnahmen ist er auch im Hintergrund der Kämpfe am Boulevard
Saint-Michel zu sehen, also tatsächlich an einem der Orte der Ereignisse. 12 Im Gegenzug lobte Pompidou vor der Nationalversammlung die humanité im Vorgehen
Grimauds (vgl. Pompidou 1968).
Albrecht Buschmann 10
Ministerien bewegt, sondern auch an den Orten des Protests zugegen ist, gelangt er kurz vor der Apotheose der politischen Krise der letzten Maitage zu der die Raum-Verhältnisse sehr hellsichtig erkennenden und luzide formulierten Aussage, wonach der schnelle Wechsel zwischen innehaltender Positionsbestimmung und Vorwärtsbewegung das Kennzeichen der Zeit sei. Er schreibt: „Chacun cherche à se placer et, en même temps, à courir pour ne pas être dépassé et, pendant ce temps, on a l’impression que la rue reste le grand recours et la grande menace.“ (333) Dass er die Straße nicht nur als Raum der Bedrohung, sondern auch als Ort der Rettung begreift, dürfte dem in der erzählten Zeit noch nicht gewussten Effekt der gaullistischen Großdemonstration vom 30. Mai auf den Champs-Élysées geschuldet sein.
Die aus eigenem Antrieb wechselnde Präsenz des Erzählers im Innenraum der Macht – wie bei Foccart spielen zahlreiche Szenen in Ministerien, Besprechungsräumen, der Préfecture de Police – und im Raum der Protestierenden im Quartier Latin erlaubt dem Erzähler die persönlicher Anschauung geschuldete Einschätzung, tatsächlich Zeuge einer ‚Revolution’ zu sein. Überraschend für einen (ehemaligen) Polizeichef und vermutlich ebenfalls der distanzierten Rückschau zuzuschreiben ist die positiv wertende Aussage, dieses ‚Abenteuer’ aus nächster Nähe erlebt haben zu dürfen: „Incroyable aventure de la contestation de toute notre société par sa jeunesse. Et pour moi, quel singulier destin que de vivre cette révolution dans le poste de préfet de police!“ (325) Grimauds Rückblick ist demnach gekennzeichnet durch die Erzählung aus und über Innen- und Außenräume, woraus sich bei ihm eine Sicht der Ereignisse ergibt, die nicht starr bipolar konstruiert ist.
Ungeachtet dieser Differenzierung bleibt auch bei seiner Darstellung kein Zweifel daran, dass er sich als Teil der siegreichen Seite positioniert und dass ein Teil des Erfolgs der Gaullisten – gemeint ist die Tatsache, dass im Mai 1968 keine Todesopfer zu beklagen waren – vor allem ihm zu verdanken ist. Gedächtnisgeschichtlich auffällig ist, dass Grimaud einen prospektiv anschlussfähigen Wert hervorhebt – die Suche nach gewaltfreier Konfliktbewältigung –, während Foccart retrospektiv argumentiert und den Erfolg de Gaulles mit der (von ihm eingeleiteten) Rückbesinnung auf die alten Tage des Kampfes gegen die deutsche Besatzung erklärt. Wo Foccart mit Reflexen aus dem Krieg arbeitet, schreibt sich Grimaud nicht nur als erfolgreicher Verfechter der Deeskalation in die Ereignisgeschichte ein, sondern lehnt sich zugleich an den in der Rezeption von ‚1968’ immer stärker hervortretenden Aspekt der Friedlichkeit im ‚„Mai ‚cool’ et ludique“ (Rioux 2008: 7) an. Damit gelingt ihm das doppelte autofiktionale Kunststück, sich als aktiv gestaltende Figur in die Geschichte des Gaullismus und als Wegbereiter des Wertewandels durch ‚1968’ darzustellen.
1968 autofiktional 11
5. Frédéric Fajardies Jeunes femmes rouges toujours plus belles (1988): Desillusionierung des revolutionären Underdogs
Frédéric Fajardies Roman Jeunes femmes rouges toujours plus belles erzählt den Sommer 1968 aus zwei sich abwechselnden Perspektiven. Einmal sehen wir den Protagonisten und Ich-Erzähler Freddy, einen jungen Mann mit abgebrochener Schulkarriere, wie er sich 1968 durch die Mai-Unruhen kämpft, bei denen er die proletarische Radikalität gegenüber der politischen Naivität der Studenten verkörpert. Auf der zweiten Erzählebene sehen wir einen gealterten Freddy, der, auch hier als Ich-Erzähler, im Mai 1988 nach zwanzig Jahren im afrikanischen Exil, wo er u.a. in Mosambik militärisch für seine revolutionären Ideale kämpfte, nach Paris zurückkehrt und seine Stadt, vor allem das Quartier Latin, nicht wiedererkennt. Frankreich hatte er seinerzeit inkognito verlassen müssen, weil er – wenn auch in Notwehr – einen Polizisten erschossen hatte.
Jeunes femmes rouges toujours plus belles ist ein Desillusionsroman, der das Scheitern der Revolution in eine sehr klare symbolische Raumordnung übersetzt. Dem Quartier Latin in der Erzählebene von 1968 entspricht das Afrika der rückblickenden Perspektive von 1988; in beiden Räumen sind es politische Winkelzüge (die der Studentenführer von 1968, die der afrikanischen Politiker in den achtziger Jahren),13 die den ehrlich kämpfenden Underdog um die Erfüllung seiner politischen Hoffnungen bringen. In beiden Kämpfen wird Freddy zurückgeworfen auf Innenräume ohne Handlungsoptionen: Im Sommer 1968 muss er in der Dachkammer seiner Geliebten Francine untertauchen, in Afrika wird er mehrfach als Soldat gefangen genommen und im Gefängnis inhaftiert. In den abbildrealistisch beschriebenen Straßenkämpfen im Quartier Latin sind es von der Polizei blockierte Straßen,14 in Afrika Stacheldrahtverhaue, die die freie Bewegung des Ich und die Realisation seiner politischen Ideale verhindern. Und auch die Bewegung zwischen den beiden Räumen der Revolution ist symbolisch aufgeladen: Schließlich erfolgt die Reise von dem nicht mehr revolutionären Paris in das noch revolutionäre Afrika auf einem Frachter, während die Rückreise prosaisch im Flugzeug stattfindet. Man könnte beinahe annehmen, Fajardie habe Michel Foucaults Aufsatz Des espaces autres aus dem Jahr 1967 gelesen,15 wo es heißt: „Le bateau a été pour notre civilisation […] la plus grande réserve d’imagination. Le navire, c’est l’hétérotopie par excellence.“ (Foucault 1994: 762) Es ist genau ein solches
13 Allein schon die Tatsache, dass die Führer der Studenten mit dem Staat verhandeln, ist
den jungen Arbeitern suspekt: „Teddy et moi ne nous sentions pas représentés par les ambassadeurs étudiants, mais nous n’avions guère d’alternative: le pouvoir nous dégoûtait […].“ (Fajardie 1988: 32)
14 So ist es bei der Lektüre dank präziser Angaben der Straßennamen möglich, den Weg der Demonstranten durch das Paris der nuit des barricades auf dem Stadtplan zu verfolgen. (vgl. Fajardie 1988: 29ff.)
15 Zur Bedeutung dieses Aufsatzes für das Verständnis sozialer Räume als relationale Konstruktionen durch Ausschluss eines ‚Anderen’ vgl. Dünne (2006).
Albrecht Buschmann 12
heterotopes Schiff, auf dem der Protagonist zu seinem zweiten Revolutionsversuch aufbricht.
Aber bleiben wir noch in Paris und betrachten die Darstellung des zweiten kritischen Moments. Den 30. Mai nimmt Freddy vor allem als Bestätigung seiner schon in den Tagen zuvor resigniert gespürten Schwächung der Bewegung wahr. In einer Szene, die am 23. Mai spielt, hatte er bereits voller Prophetie gedacht: „Mais paradoxalement, plus le nombre de grévistes augmentait, plus la dynamique du mouvement s’émoussait.“ (Fajardie 1988: 47) Wieder erkennen wir eine autofiktionale Konstruktion, in der der Ich-Erzähler vorher schon gewusst haben will, wohin die Ereignisse führen werden. Am 30. Mai selbst wird er nicht Augenzeuge dessen, was sich um den Arc de Triomphe abspielt, sondern sieht es nur angewidert im Fernsehen und vergleicht die Menschenmenge der Unterstützer de Gaulles und der etablierten Ordnung mit „les foules acclamant Pétain“ (49). Auf diese Einschätzung folgt – diegetisch vorangetrieben durch den Mord an dem Polizisten – das physische Verschwinden des Erzählers, zunächst in den privaten Gegen-Raum (Francines Dachkammer als locus amoenus der perfekten Liebe), dann hinaus aus Frankreich nach Afrika, mit der Waffe in der Hand in den seinerzeit als ideal empfundenen Raum der Revolution. Das Ende des Buchs setzt einen doppelten Schlussstrich unter die politische Handlung, denn die Erkenntnis des eigenen Scheiterns beider revolutionärer Projekte wird einerseits befördert durch die Tatsache, dass die Polizei, wie Freddy erfährt, das Verfahren gegen ihn eingestellt hat, und andererseits dadurch, dass er nunmehr aufbricht zum lang ersehnten Wiedersehen mit Francine, die ihn bezeichnenderweise nicht in Paris, sondern in Südfrankreich erwartet.16
6. Louis Malles Milou en Mai (1988): Mediale Brechung und politische Ironisierung
Wo Frédéric Fajardie in seinem Rückblick Ende der achtziger Jahre ganz auf die Archivierung der wütenden Perspektive des jungen Proletariers setzt, ungebrochen durch eine relativierende Gegenperspektive, sei es aus der Sicht eines Studenten oder eines Repräsentanten der gaullistischen Staatsmacht, optiert Louis Malle in seinem dezent ironischen Film Milou en Mai aus der gleichen Zeit für eine Kopräsenz der anderen Seite, die vor allem intermedial durch das ständige Hören von Radioübertragungen eingeholt wird. Während seine Figuren im Mai 1968 in einem südfranzösischen Landgut isoliert sind und es nicht schaffen, die in der zu Beginn der Handlung an einem Schlaganfall verstorbene Mutter der Hauptfigur Milou (gespielt von Michel Piccoli) zu beerdigen, kommen via Radio die Nachrichten aus Paris, so dass mal die Live-Reportage aus dem Quartier Latin in die Totenwache funkt, mal eine Ansprache de Gaulles in 16 Eine Lektüre des Romans als politisch-historischen Krimi bieten Müller/Ruoff (2007:
309ff.).
1968 autofiktional 13
das familiäre Mittagessen gesendet wird. So feiert der Film die Kraft des alten Mediums Radio, in vielfältiger Weise präsent zu sein und simultan Kopräsenz herstellen zu können, und nicht zufällig wird der Radioapparat auf dem Höhepunkt des Generalstreiks aus dem Haus getragen, um auch unter freiem Himmel über den (revolutionären) Lauf der Geschichte informieren zu können.
Auf den ersten Blick scheint die Konstruktion der symbolischen Räume klar gezeichnet: Hier die fast unsichtbare Metropole, von der nur die Tonspur der événements zu hören ist, da das einsam stehende Landhaus in der Provinz, wo gerade ein sehr privates, familiäres Ereignis zu bewältigen ist. Doch diese Gegenüberstellung von Zentrum und Peripherie wird vielfach unterlaufen und dynamisiert, allein schon durch die intermediale Präsenz der Stimmen der Hauptstadt im peripheren Landhaus. Weitere Verfahren der räumlichen Überblendung lassen sich finden: Manche Szenen spielen die Ereignisse des Nordens in Form einer Farce im Süden nach, wenn etwa der Pfarrer, die rote Fahne schwenkend, einen Protestmarsch der Dorfbewohner gegen den Großgrundbesitzer anführt – der ironische Widerhaken besteht darin, dass das der weitgehend mittellose Milou ist. Oder sie werden in den Augenzeugenberichten derer ins Landhaus hereingeholt, die in Paris dabei gewesen sind. Diese Augenzeugen treten als autofiktionale Erzähler in Erscheinung, und zwar in all den zahlreichen Sequenzen von Milou en Mai, in denen sie von ihren Erlebnissen aus Paris erzählen und auf diese Weise ihr persönliches Erleben in einen historischen Rahmen einbauen: Sei es der Lastwagenfahrer Grimaldi, der von den sexuellen Vergnügungen mit sich befreienden Bürgersfrauen schwadroniert, oder Milous Neffe Pierre-Alain, der tatsächlich auf den Barrikaden dabei gewesen ist, der aus erster Hand von den Kämpfen und der Brutalität der Polizei berichtet und selbstbewusst die studentischen Forderungen nach Amnestie und Enteignung, neuer Sozialordnung und Befreiung vertritt.17 Im Verlauf der Diegese werden zahlreiche politische Schlüsselthemen, die die Wahrnehmung des Pariser Mai und des Mythos 1968 prägen, in die familiäre Handlung eingeblendet, oft in ironischer Brechung. Dazu nur drei Beispiele: In den familiären Kontext übersetzt werden die Kritik an Privatbesitz und am Materialismus (bei jedem Streit um die Aufteilung des Erbes), die Forderung nach einer neuen Geschlechterordnung und einer freieren Sexualität (wir werden, auch dank der neuen Pille, Zeuge von Partnertauschspielen, Fesselpraktiken, lesbischer Liebe und Betrug am bürgerlich angetrauten Partner) oder die Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte für die Protestbewegung (der Großvater der Familie ging regelmäßig nach Afrika zur Großwildjagd, und dessen Jagdtrophäen werden nun zu Requisiten eines bizarren Maskenballs – in den jäh die Nachricht vom Verschwinden de Gaulles platzt). So bekommt der Zuschauer eine Welt vor Augen geführt, in der beinahe jede private 17 Der überforderte Vater des Studenten Pierre-Alain, Milous Bruder Georges, ist
bezeichnenderweise ein Journalist, der gerade an einer De-Gaulle-Biographie schreibt und seine Felle davonschwimmen sieht, sollte sein Idol zurücktreten.
Albrecht Buschmann 14
Handlung im Haus von den Codes beeinflusst ist, um deren Gültigkeit in Paris gerade vehement gekämpft wird. Von einer Trennung der symbolischen Räume kann also nicht mehr die Rede sein, und da deren Verbindungen zudem durchgehend kommentiert werden, wird auch die Semantik der Codes selbst in Frage gestellt.18
Eine Schlüsselszene zur Analyse der Raumwahrnehmung und Raum-symbolik zeigt Milous Neffen Pierre-Alain bei einem Picknick im Garten. Mit entblößtem Oberkörper sitzt er mit seiner Cousine Claire und deren Freundin Marie-Aude zusammen, die beide um die Aufmerksamkeit des jungen Helden von den Barrikaden buhlen. Erschreckt sehen sie die vielen Blutergüsse auf seinem Rücken, woraufhin er jeden der Striemen nonchalant mit einer Ortsangabe kommentiert: „Ici, c’était la rue Gay-Lussac, et ça, c’était à la Bourse.“ Die Topographie des studentischen Widerstands erscheint wie eingeschrieben in den Körper des Kämpfers, der damit gleichermaßen die repressive Gewalt des Staates archiviert und als der eines gebrandmarkten Opfers stilisiert wird. So wie Pierre-Alain stellvertretend für die Protestierenden des Quartier Latin in Südfrankreich präsent ist, ist auf seinem Körper exemplarisch die Gewalt des Staates zu erkennen.19
7. Das Quartier Latin als doppelte Heterotopie des Pariser Mai
All die bis hierher knapp vorgestellten Artefakte zeigen autofiktionale Erzähler, die sich in Bezug zu den Ereignissen von 1968 stellen und dieses Geschehen in eine räumliche Ordnung übersetzen.20 Die einen dergestalt, dass nur ihre eigene Sphäre beschrieben und berücksichtigt ist (Foccart, Fajardie), die anderen, indem sie eine modellhafte Gesamtschau versuchen, die beide Sphären, die der Macht und die des Protests, in bestimmten 18 So sind, um nur zwei Beispiele zu nennen, beinahe alle Paare im Verlauf der Handlung
in neuen Konstellationen sexuell aktiv, aber am Ende stehen wieder feste Paarungen und sogar eine (symbolträchtige) Hochzeit zwischen Dienstmädchen und Soldat. An anderer Stelle wird der revolutionäre Elan der Dorfbewohner musikalisch ironisiert, indem die Internationale, die ihrem Auftritt unterlegt ist, allmählich den Rhythmus wechselt und in beschwingten Zigeuner-Jazz übergeht. Eine Analyse von Milou en Mai als Komödie bietet Lommel (2001: 70ff.).
19 Womit zwar eine der Grundideen des mouvement – die Aufhebung der Grenze von privater und öffentlicher Sphäre – erfüllt ist, aber in ganz anderer Art als intendiert. Auch dies wieder einer der ironischen Kommentare des Regisseurs.
20 Wobei letztlich nicht zwischen dem Rückbezug auf die Ereignisse und der seinerzeit medial vermittelten Wahrnehmung der Ereignisse zu trennen ist (vgl. Fußnote 5). Schon die Benennung nuit des barricades verwischt, durch den evidenten Rückbezug auf die Kämpfe der Pariser Commune (besser: auf die Ikonographie der Kämpfe der Pariser Commune), die Grenze zwischen dem ‚Ereignis’ (dem für Durchgangsverkehr hinderlichen Anhäufen von ausgebrannten Pkw und anderem Sperrmüll mitten auf der Straße) und dem ‚wahrgenommenen Ereignis’, dem Bau einer ‚Barrikade’. Erst diese Benennung – und die nachfolgend beinahe exklusive Kommunikation mittels dieser Benennung – macht aus einer Behinderung des Straßenverkehrs einen revolutionären Akt, schließt das eigene Handeln mit historischen Großereignissen kurz und transzendiert das eigene Tun in einen übergeordneten diskursiven Zusammenhang.
1968 autofiktional 15
Räumen aufgehen lässt: Die der Regierung in ihren bekannten Palästen und repräsentativen Gebäuden (der Élysée-Palast, das Polizeipräsidium etc.), die der Protestierenden in den Straßen vor allem des Quartier Latin. In Louis Malles Film werden die beiden Räume intermedial überblendet (die Stimme des Radios) oder stellvertretend inkorporiert (Pierre-Alains Blutergüsse), und in Maurice Grimauds Erinnerungen erfolgt die Verbindung der Räume, indem der für Dialog und Deeskalation plädierende Ich-Erzähler sich selbst in beiden Sphären bewegt und in beiden kommuniziert. Bezeichnenderweise wird in Frédéric Fajardies Roman der ereignisgeschichtliche Schlüsselmoment, die Wende des 30. Mai, als der Augenblick hervorgehoben, in dem die Repräsentanten der Gegenseite ihre Paläste der Macht verlassen und selbst auf die Straße gehen, um dort für die Regierung zu demonstrieren; damit okkupieren sie gewissermaßen den Raum, der bis dahin der des antistaatlichen Protests war. 21
Gemeinsam ist allen vier Beispielen, dass ihre Ich-Erzähler sich im Nachhinein zu den Ereignissen dergestalt in Beziehung setzen, dass sie antizipierend als Gestalter des Erfolgs (Foccart, Grimaud) oder als hellsichtige Opfer der Niederlage (Freddy, Pierre-Alain) erscheinen. Der Wissensstand der Erzählzeit wird zur Aufwertung der Sprecher in der erzählten Zeit verwendet, mit triumphalischer Rhetorik bei Foccart, als Bescheidenheitsgeste bei Grimaud, als Pose melancholischer Abgebrühtheit bei Fajardie, und im Gestus ironisierter Naivität bei Malle.
Eine weitere signifikante Besonderheit für die Raumsymbolik ist in ihrem Verhältnis zur Körperlichkeit festzumachen. Wie sich Geschichte in den Körper schreibt, wurde am Beispiel von Milou en Mai bereits gezeigt, und eine ganz ähnliche Szene, diesmal vor einem Spiegel, findet sich auch in Jeunes femmes rouges toujours plus belles. Unmittelbar vor seinem ersten Spaziergang ins Quartier Latin, das er zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wiedersehen wird, betrachtet Freddy seinen nackten Körper mit den Narben, die er sich im afrikanischen Buschkrieg eingehandelt hat:
Là, cette longue cicatrice de vingt-cinq centimètres, c’était une balle P.M. … Là, les sept ou huit lignes semblables à des frises, c’était l’indélébile empreinte des barbelés dans lesquels j’étais resté attaché pendant huit heures … Là, cette grosse cicatrice boursoufflée, c’était un piège de brousse …“ (Fajardie 1988: 20)
Die Beschreibung und Kommentierung seiner sichtbaren körperlichen Verletzungen aus dem postkolonialen Stellvertreterkrieg leiten bezeichnenderweise die Rückkehrszene ein, bei der er an den Ort des Geschehens kommt, das seinem Leben die entscheidende Wende gegeben hatte: „Mai 68, source de ma vie gâché“, heißt es unmissverständlich im Text (Fajardie 1988: 19). Im Quartier Latin, so suggeriert dieser sich schließende Kreis, begann das, was nun seinen Körper zeichnet, nämlich eine Serie revolutionärer Niederlagen. Bei Frédéric Fajardie wie bei Louis Malle
21 Die Namen der namhaften Demonstranten in vorderster Reihe – André Malraux, Alain
Peyrefitte, Michel Debré, Christian Fouchet – werden einen Absatz lang voller Verachtung aufgezählt (vgl. Fajardie 1988: 49f.).
Albrecht Buschmann 16
werden die Körper zu Trägern der Zeichen der Niederlage, der gescheiterten Hoffnungen auf ein anderes Leben, und die Körper-Zeichen erinnern an die Orte dieser Niederlagen: die Straßen des Quartier Latin bei Malle, an das mit dem Pariser Kampf durchgehend parallelisierte Afrika bei Fajardie.
Eine äquivalente Semantisierung der Körper findet sich in den Erzählungen aus der Sicht des herausgeforderten Staates nicht, dennoch ist die Evokation des Körpers auch dort von besonderer Bedeutung. Gemeint ist die Bedeutungszuschreibung auf den Körper des abwesenden Charles de Gaulle. Dieser Körper wird im Rückblick, aus der Kenntnis der ungeheuren Wirkung seiner physischen Rückkehr nach Paris, allein schon dadurch überhöht, dass er so ausführlich thematisiert wird. Dieser kurzfristig abwesende Körper wird zur Projektionsfläche, vor allem für die ungeheuren Ängste seiner Anhänger, aber auch für die kurz vor dem Scheitern stehenden Hoffnungen seiner Gegner.
Das Motiv des abwesenden Körpers taucht in der Ereignisgeschichte des Mai 1968 ja noch ein zweites Mal auf, schließlich wurde Daniel Cohn-Bendit nach seinem Besuch in Deutschland die Wiedereinreise verweigert. In Hervé Hamons und Patrick Rotmans Montage-Dokumentation Génération wird nun versucht, den Effekt der Rückkehr so auf Cohn-Bendit zu übertragen, dass er – in expliziter Anlehnung an den Fall des Generals – eine ähnlich mythische Wirkung bekommen soll. Zunächst wird Cohn-Bendits Rückkehr über die grüne Grenze Ende Mai als Bestätigung der subversiven Energie der Protestierenden und der Schwäche des Staates benannt: „Son retour signifie que les sorbonnards restent capables de bafouer l’État.“ (Hamon/Rotman 1987: 557) So weit, so dokumentarisch, schließlich wird diese Wahrnehmung seines unerwarteten Auftauchens in einer Vollversammlung an der Sorbonne auch in der historischen Literatur beschrieben (vgl. Frei 2008: 21ff.; Artières/Zancarini-Fournel 2008: 233ff.). In einem zweiten Schritt nutzen die Autoren nun aber die Gelegenheit, den (zurückgekehrten) Körper des Studenten zu dem des Präsidenten in Beziehung zu setzen, wenn sie schreiben: „On a retrouvé Dany, on a perdu de Gaulle,“ und zwar ausgerechnet zu Beginn des Abschnitts über die 24 Stunden des 29./30. Mai. Eine Erzählstrategie, die den Studentenführer und den Präsidenten der Republik auf eine Ebene stellt, womit eine semantische Übertragung ermöglicht wird, die Cohn-Bendit das gleiche politische Gewicht zuschreibt wie de Gaulle.
In den entscheidenden Tagen des Mai 1968, so der symbolische Code aller hier miteinander verglichenen Texte, erscheint das Quartier Latin und vor allem der Boulevard Saint Michel als doppelte Heterotopie. Einerseits bedeutet dieser Raum um die Universität für die Staatsmacht den Gegenort schlechthin, es ist der Raum derjenigen, die das eigene Wertesystem in Frage stellen und zugleich das eigene Machtmonopol. Andererseits verheißt es einen Freiraum, in dem eine andere, eine bessere Gesellschaft möglich zu sein scheint. Oder, um es noch einmal mit den Worten Michel Foucaults aus dem bereits zitierten Aufsatz zu sagen: Das Quartier Latin, verstanden als
1968 autofiktional 17
Heterotopie, ist für die einen „l’envers de la société“, für die anderen „la société elle-même perfectionnée“ (Foucault 2006: 755).
8. Beschreiben, einschreiben, umschreiben
Um auf die Leitfrage nach den autofiktionalen Einschreibungen in den Diskurs über 1968 zurückzukommen, so bestätigen die hier untersuchten Artefakte die Ausgangsvermutung, dass das Ereignis ‚1968’, in unserem Beispiel der Pariser Mai 1968, ungeachtet des fiktionalen Status der jeweiligen Textsorte (Roman, Tagebuch, Kinofilm) zu autofiktionalen Konstrukten animiert.22 Über die symbolische Codierung des Raums sowie des Körpers im Raum gelingt es dem jeweils erzählenden Ich, sein Erleben in einem grand récit aufgehen zu lassen und es so zu transzendieren. Für die gaullistischen Erzähler besteht dieser grand récit im Sieg der eigenen Sache angesichts des herausgeforderten Staates (wenn nicht der bedrohten Zivilisation), für die Protestierenden ist es das Empfinden, Teil eines einzigartigen kritischen Moments gewesen zu sein. Wohlgemerkt – diese Selbsteinschreibungen erfolgen und funktionieren, ohne dass die autofiktionalen Erzähler tatsächlich relevanter Bestandteil dieser Rahmenhandlung und ihrer Erzählung gewesen sein müssen. Diese beiden Rahmenerzählungen – die von der Rettung der Fünften Republik durch de Gaulle und die von der beinahe gelungenen Revolution – kristallisieren sich um die doppelte Heterotopie ‚Quartier Latin’ und funktionieren demnach komplementär zueinander.23 Die Anziehungskraft der gaullistischen Rahmenerzählung ist evident, schließlich ist sie – ereignisgeschichtlich gesprochen und auf dem Sommer 1968 blickend – die Siegergeschichte. Die Rahmenerzählung der Protestierenden hingegen regt aus mehreren Gründen zum Erzählen an: Weil sie für ihre Epoche Einmaligkeit beanspruchen kann (der größte Generalstreik, das Wanken der Republik), weil die Simultaneitätserfahrung im Generationenprotest euphorisiert (vgl. Anmerkung 5), aber auch aufgrund der Tatsache, dass Verlierer einer historischen Auseinandersetzung immer einen höheren diskursiven Aufwand betreiben müssen als die Sieger, um sich als
22 Im Fall von Louis Malles Film müsste man genauer formulieren und sagen, dass ‚1968’
dazu animiert, solche autofiktionalen Erzähler zu zeigen. 23 Die damit verbundene doppelte Bedeutungszuschreibung mag ein Grund dafür sein,
dass sich so viele Zeitzeugen (und inzwischen nicht mehr nur die) in solcher Menge zu Wortmeldungen aufgerufen fühlen. Dutzende Autobiographien und Erinnerungen von Politikern hätten für diese Untersuchung als Beispiele herangezogen werden können sowie ein Vielfaches an Romanen und Filmen. Schon 1984 mochte Patrick Combes, als er in seiner Studie La littérature et le mouvement de Mai 68 eine Auswahl von über vierzig Romanen zu untersuchen hatte, sich allenfalls „juste une introduction, une contribution“ zutrauen (Combes 1984: 13). Alle diese Stimmen tragen, in gleicher Weise wie die hier exemplarisch vorgestellten, dazu bei, ‚1968’ vom „Ereignis zum Mythos“ (Gilcher-Holtey 2008) zu machen.
Albrecht Buschmann 18
„Erinnerungsgemeinschaft“ (Burke 1991: 298) zu konstituieren.24 Wie wirkmächtig diese durch unzählige autofiktionale Konstrukte generierte und vermittelte Gegenerinnerung der Protestierenden ist, erkennt man daran, dass es ihr über lange Zeit gelang, zum dominierenden Diskurs über ‚1968’ zu werden.25 So hat das selbstbewusste Reden über und Erzählen vom jeweils eigenen ‚1968’ in der Summe aus der gefühlten Niederlage einen diskursiven Sieg gemacht.
9. Literaturverzeichnis
Philippe Artières/Michelle Zancarini-Fournel (Hrsg.), 68. Une histoire collective (1962-1981), Paris 2008.
Anja Bandau/Albrecht Buschmann/Isabella von Treskow, Literaturen des Bürgerkriegs – Überlegungen zu ihren soziohistorischen und ästhetischen Konfigurationen, in: dies. (Hrsg.): Bürgerkriege der Romania, Berlin 2008, 7-18.
Luc Bernard, Europe 1. La grande histoire dans une grande radio, Paris 1990. Pierre Bourdieu, Homo academicus, Frankfurt a.M. 1988. Peter Burke, Geschichte als soziales Gedächtnis, in: Aleida Assmann/Dietrich Harth
(Hrsg.), Mnemosyne. Formen und Funktionen kultureller Erinnerung, Frankfurt a.M. 1991, 289-304.
Patrick Combes, La littérature et le mouvement de Mai 1968. Écritures, mythes, critique, écrivains 1968-1981, Paris 1984.
Jörg Dünne, Soziale Räume, in: ders./Stefan Günzel (Hrsg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaft, Frankfurt a.M. 2006, 289-303.
Frédéric Fajardie, Jeunes femmes rouges toujours plus belles, Paris 1988. Jaques Foccart, Le Général en Mai. Journal de l’Élysée, 1968-1969, 2, Paris 1997. Michel Foucault, Des espaces autres, in: ders., Dits et Ecrits, 1980-1988, 4, Paris 1994,
752-762. Béatrice Fraenkel, Les affiches de Mai: l’atelier populaire des Beaux-Arts, in: Philippe
Artières/Michelle Zancarini-Fournel (Hrsg.), 68. Une histoire collective (1962-1981), Paris 2008, 276-281.
Norbert Frei, 1968. Jugendrevolte und globaler Protest, München 2008. Charles de Gaulle, [Radioansprache vom 30.5.1968]. URL: http://www.ena.lu/-
discours_charles_gaulle_evenements_mai_68_paris_mai_1968-012600052.html. (17.10.2008).
Gérard Genette, Fiction et diction, Paris 1991. Ingrid Gilcher-Holtey, „Die Phantasie an die Macht”. Mai 68 in Frankreich, Frankfurt
a.M. 1995. Ingrid Gilcher-Holtey (Hrsg.), 1968. Vom Ereignis zum Mythos, Frankfurt a.M. 2008. Maurice Grimaud, Je ne suis pas né en mai 68. Souvenirs et carnets 1934-1992, Paris
2007.
24 Den methodischen Horizont eines literatur- und kulturwissenschaftlichen
Forschungsfeldes, das die Frage untersucht, wie und in welchen Phasen als traumatisch erlebte innergesellschaftliche Gewaltkonflikte künstlerisch aufgearbeitet werden, diskutieren Bandau/Buschmann/von Treskow (2008).
25 Wie peinigend diese Diskursmacht für die Anhänger der gaullistischen Sicht der Dinge ist, wird etwa in der aggressiven Wucht von Nicolas Sarkozys Rede im Palais Omnisports de Bercy deutlich, den Sybille Große in diesem Band eingehend analysiert.
1968 autofiktional 19
Hervé Hamon/Patrick Rotman, Génération I. Les années de rêve, Paris 1987. Hervé Hamon/Patrick Rotman, Génération II. Les années de poudre, Paris 1988. Jerôme Leroy, Frédéric H. Fajardie, Monaco 1994. Michael Lommel, Der Pariser Mai im französischen Kino. 68-er Reflexionen und
Heterotopien, Tübingen 2001. Elfriede Müller/Alexander Ruoff, Histoire noire. Geschichtsschreibung im
französischen Kriminalroman nach 1968, Bielefeld 2007. Georges Pompidou, [Rede vor der Assemblée Nationale vom 14.5.1968]. URL:
http://www.georges-pompidou.org/epoque/documentation_diverse/pol_int/-14mai68.htm. (17.10.2008) Als Filmdokument: http://mai68.ina.fr/-index.php?vue=notice&from=fulltext&mc=discours%20politique&num_notice-=2&total_notices=11.
Jean Pierre Rioux, L’événement-mémoire. Quarante ans de commémorations, in: Le Débat 149/2008, 4-19.
Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit, München 2003. Alfonso de Toro, Die postmoderne „neue Autobiographie“ oder die Unmöglichkeit
einer Ich-Geschichte am Beispiel von Robbe-Grillets Le miroir qui revient und Doubrovskys Livre brisé, in: ders./Claudia Gronemann (Hrsg.), Autobiographie revisited: Theorie und Praxis neuer autobiographischer Diskurse in der französischen, spanischen und lateinamerikanischen Literatur, Hildesheim, Zürich, New York 2004, 79-115.