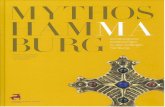Altägyptische Schöpfungsvorstellungen im Kult: Mythos, Text und Bild
Transcript of Altägyptische Schöpfungsvorstellungen im Kult: Mythos, Text und Bild
Sonderdruck aus:
DISKURS RELIGION
BEITRÄGE ZUR RELIGIONSGESCHICHTE UND RELIGIÖSEN ZEITGESCHICHTE
Herausgegeben von
Ulrike Brunotte und Jürgen Mohn
BAND 1
Kult und Bild
Die bildliche Dimension des Kultes im Alten Orient, in der Antike
und in der Neuzeit
Herausgegeben von
Maria Michela Luiselli Jürgen Mohn
Stephanie Gripentrog
ERGON VERLAG
Umschlagabbildung: Nicolas Poussin: Die Anbetung des Goldenen Kalbes (1633-1637)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2013 Ergon-Verlag GmbH · 97074 Würzburg Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und für Einspeicherungen in elektronische Systeme. Umschlaggestaltung: Jan von Hugo
Satz: Thomas Breier, Ergon-Verlag GmbH
www.ergon-verlag.de
ISBN 978-3-89913-957-0
Inhalt
Maria Michela Luiselli / Jürgen Mohn / Stephanie Gripentrog Einleitung................................................................................................................. 7
Maria Michela Luiselli Images of Personal Religion in Ancient Egypt: An Outline ............................................................................................................. 13
Susanne Bickel Altägyptische Schöpfungsvorstellungen im Kult: Mythos, Text und Bild ........................................................................................... 41
Martin Guggisberg Lebendige Götter? Zum Verhältnis von Gottheit und Götterbild im antiken Griechenland ........................................................................................67
Martin Bommas Pyramids in Ancient Rome: Images without Cult?............................................................................................. 91
Hans-Peter Mathys Bilder und Bilderverbot in Israel – Der Mensch als Bild Gottes................................................................................. 111
Bernd U. Schipper Kultbilder im antiken Israel. Das Verhältnis von Kult und Bild am Beispiel der anikonischen Kultobjekte.......................................................... 163
Ulrike Brunotte Bilderkult und Ikonoklasmus. Die Lehre von der Inkarnation und das reformatorische Problem der Verkörperung........................................................ 181
Jürgen Mohn Von den Kult-Bildern zum Bilder-Kult ‚romantischer’ Kunstreligion: Religionsgeschichtliche Interpretationen zu Philipp Otto Runges Zeiten-Zyklus in religionsaisthetischer Perspektive ............................................ 203
Autorenverzeichnis .............................................................................................. 243
Altägyptische Schöpfungsvorstellungen im Kult: Mythos, Text und Bild
Susanne Bickel
Schöpfungsvorstellungen sind spekulative Antworten auf die Frage nach dem Ur-sprung des Lebens, nach der Herkunft des Universums und seiner einzelnen Be-standteile. Es handelt sich um Fragen, die sich die meisten Kulturen stellen, um ihre Weltanschauung zu beschreiben, zu erklären und zu untermauern. Diese Antworten sind zwangsläufig – zum Teil noch heute – spekulativ, doch sie sind in Einklang mit der Weltanschauung, sie benutzen dieselben Bilder und dasselbe Vokabular. Schöpfungsvorstellungen sind also der Versuch, die Komplexität der menschlichen Erfahrungswelt zu reduzieren und sich das letztlich Unerklärbare dennoch zu verbildlichen. Die gemeinsame Weltanschauung und Welterklärung schafft eine wichtige Grundlage kultureller Zugehörigkeit. Heute verwenden wir zur Beantwortung von Fragen der Weltbeschaffenheit mehrheitlich die Sprache der Wissenschaft, welche der Komplexität Rechnung tragend, dennoch oft mit Modellen zur vereinfachten Fassbarkeit arbeitet. In antiken Kulturen wurden die-selben Fragen in der Sprache des Mythos abgehandelt, der zahlreiche natürliche, menschliche und soziale Gegebenheiten über Aktionen und Interaktionen von Gottheiten des polytheistischen Weltsystems zu beschreiben und zu erklären vermochte. In dieser Funktion bildete der Mythos eine Ausdrucksform, die die Gegebenheiten der Welt in eine begreifbare und beschreibbare Form bringen konnte. Das Wissen um die vom Mythos angebotenen Erklärungsmuster war kulturell fundierend und verbindend. Dies entspricht einer Definition des My-thos als ‘kulturellem Leistungswert’ wie ihn Aleida und Jan Assmann in ihren sieben Mythos-Begriffen als ‘M3: funktionalistischer Begriff ’ festhalten. 1
Der Umgang mit dem jeweiligen mythischen Wissen konnte jedoch je nach Kultur anders gehandhabt werden. Gewisse Kulturen, insbesondere die jüdisch-christliche, aber auch teilweise die mesopotamischen Kulturen, verfestigten die grundlegenden mythischen Vorstellungen in Texten, die zur Referenz jeden wei-teren Umgangs wurden. Andere Kulturen, zu denen die altägyptische zu zählen ist, bevorzugten einen polyvalenten und polysemischen Umgang mit dem myt-hischen Wissen.
1 Assmann, Aleida; Assmann, Jan: Mythos, in: Handbuch religionswissenschaftlicher
Grundbegriffe, hg. von Hubert Cancik, et al., Band 4, 1998, S. 179-200. Die Diskussion zum Thema Mythos innerhalb der Ägyptologie des 20. Jahrhunderts wird zusammenge-fasst bei Köthen-Welpen, Sabine: Theogonie und Genealogie im Pantheon der Pyramiden-texte, Bonn 2003, S. 8-38 und Goebs, Katja: A Functional Approach to Egyptian Myth and Mythemes, in: Journal of Ancient Near Eastern Religion 2 (2002), S. 27-59.
SUSANNE BICKEL 42
So gab es im antiken Ägypten niemals kodifizierte Mythen, also auch keinen normierten, allgemeingültigen Schöpfungsbericht. Genauso wie das Wissen um das Wesen und Wirken der Götter nie in einem verbindlichen, exklusiven Text festgelegt wurde, so bildeten auch die Erklärungen zu Weltschöpfung und Welt-entstehung einen kulturellen Wissensfundus, einen Tiefentext,2 der als solcher keiner Verschriftlichung bedurfte, ja vermutlich von seiner Form her gar nicht hät-te verschriftlicht werden können. Als kulturexterne Beobachter können wir diesen Wissensfundus aus einer Vielzahl meist einzeln evozierter Mytheme rekonstruie-ren, die in unterschiedlichen Kontexten situationsspezifisch nutzbar gemacht wurden. Man spricht in der Ägyptologie also nie von einer Schöpfungsgeschichte, sondern vielmehr von Schöpfungsvorstellungen, die punktuell und kontextbezo-gen einen Aspekt, einen Moment oder Vorgang des Schöpfungsprozesses veran-schaulichten.
Schöpfungsvorstellungen sind in recht grosser Anzahl aus der gesamten pha-raonischen Zeit belegt, von den ältesten religiösen Texten, die in den Pyramiden des Alten Reichs (2400 v. Chr.) niedergeschrieben wurden, bis in die Tempel der Römerzeit. Stellt man diese Textzeugen zusammen, so erweist sich die auf Anhieb erstaunliche Tatsache, dass es kaum einen Text gibt, der den Vorgang der Welt-schöpfung oder Weltentstehung als Gesamtes wiedergibt, von einer Ausgangssitu-ation bis zum erfahrbaren Resultat der geschaffenen Welt. Nicht nur gibt es also in Ägypten keinen normativen und verbindlichen Schöpfungsbericht, sondern auch keinen kohärenten Bericht des kompletten Schöpfungsvorgangs überhaupt. Dies dürfte bei der sehr breiten Quellenlage deren sich dieses Thema erfreut, kaum Zufall sein. Vielmehr ist es der Ausdruck von zwei Faktoren: Zum einen der Tatsache, dass das Wissen über den Ursprung nicht Gegenstand einer Lehre oder eines Dogmas war und keiner Tradierung per se bedurfte, und zum anderen, dass in jeder der Anwendungssituationen, auf die wir weiter unten eingehen werden, andere Aspekte des Schöpfungsvorgangs von Relevanz und Interesse waren.
Die Grundgedanken der Schöpfungsvorstellungen waren im Bewusstsein der ägyptischen Kultur verankert und blieben über mehr als 2500 Jahre sehr kon-stant. Die Tradierung erfolgte jedoch nicht über einen normierten und auch nicht zwangsläufig über einen narrativen Text, sondern über Kontext bezogene Anwendungen in Form von partiellen Evokationen. Diese Evokationen einzelner Vorstellungen, Aspekte eines Vorgangs oder Mytheme, waren dabei an kein festes Vokabular gebunden, sie konnten bei jeder Anwendung neu formuliert werden.
Diese Feststellungen gelten nicht nur für die Thematik der Schöpfung und Weltentstehung, sondern auch für alle mythischen Vorstellungen Ägyptens und ihre mythologischen Umsetzungen.3 So ist z.B. auch der Horus-Seth-Osiris Kom-
2 Assmann, Jan: Rezeption und Auslegung in Ägypten, in: Rezeption und Auslegung im Al-
ten Testament und in seinem Umfeld, hg. von Reinhard G. Kratz, Thomas Krüger, Orbis Biblicus et Orientalis, Band 153, Göttingen 1997, S. 127.
3 Vgl. Goebs, Katja: A Functional Approach.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 43
plex in keiner ägyptischen Quelle, – auch nicht in seiner längsten Ausformulie-rung bei Plutarch – in seiner Gesamtkohärenz dargelegt.4 Auch dieser vielschichti-ge Vorstellungskomplex ist uns ausschliesslich über kontextbezogene Aktualisie-rungen zugänglich, von denen keine die ‘gesamte Geschichte’ und schon gar nicht die Gesamtheit der semantischen Möglichkeiten umfasst. Für alle ägyptischen Mythen und ihre vielfältigen Umsetzungen gilt: ‘A myth is not the same as any single realization in which it may have been embodied and is now accessible’.5
So lässt sich festhalten, dass die Grundgedanken des Mythos, anhand derer der Ursprung und die Entstehung der Welt evoziert wurden, während der gesamten pharaonischen Geschichte sehr konstant blieben. Die Aktualisierungen dieses Gedankenguts waren in ihrer Formulierung frei; in der Auswahl der Mytheme und in der semantischen Ausrichtung waren sie vom jeweiligen Kontext abhän-gig. Die Kontexte hingegen, in denen die Schöpfungsvorstellungen mobilisiert wurden, änderten sich in entscheidender Weise von einer Epoche zur anderen.
1. Die Grundvorstellungen des Mythos
Die Rekonstruktion der Grundvorstellungen zur Weltentstehung ergibt, dass sich die Ägypter die Herausbildung der bestehenden, komplex differenzierten Welt als einen Prozess, eine Abfolge von vier Etappen erklärten:
1. Das Urgewässer Nun, mit dem sich die Vorstellung einer Phase der Präexistenz verband
2. Die Entstehung des Schöpfers als das eigentliche kosmogonische Momentum 3. Die Schöpfung oder die Phase der Differenzierung 4. Die ‘Jetztzeit’, die Phase der Erhaltung und Fortpflanzung des Geschaffenen.
1.1. Der Nun
Die Vorstellung von einem präexistenten Grundelement gehört zu den kenn-zeichnenden Gedanken der ägyptischen Kultur, der über die Jahrtausende kaum Veränderung erfuhr. Der Nun war eine vielschichtige gedankliche Einheit. Er war ebenso ein fruchtbares, wässriges Element, das die Potentialität sämtlicher Exis-tenz einschloss, als ein in Schweigen und Finsternis gehüllter Raum, in dem sich
4 Junge, Friedrich: Mythos und Literarizität: Die Geschichte vom Streit der Götter Horus
und Seth, in: Quaerentes scientiam, Festgabe für Wolfhart Westendorf, hg. von Heike Behlmer, Göttingen 1994, S. 87.
5 Baines, John: Myth and Literature, in: Ancient Egyptian Literature, hg. von Antonio Loprieno, Probleme der Ägyptologie, Band 10, Leiden 1996, S. 362. Baines, John: Prehisto-ries of Literature: Performance, Fiction, Myth, in: Definitely: Egyptian Literature, hg. von Gerald Moers, Lingua Aegyptia Studia Monographica, Band 2, Göttingen 1999, S. 32-37.
SUSANNE BICKEL 44
Tore und Höfe befanden. Der Nun konnte auch personifiziert und als handelnde Gottheit dargestellt und gelegentlich als ‘Vater der Götter’ bezeichnet werden.
Zeitlos, ebenso präexistent, gegenwärtig und über das Ende der Schöpfung hinweg dauernd, stellte der Nun im Weltbild der Ägypter sowohl die Hülle des geschaffenen Universums als auch das Grundwasser und die Nilflut dar, ja selbst das rituell verwendete Reinigungswasser repräsentierte den Nun. Als sämtliche Existenzmöglichkeiten umfassendes Urelement, aus dem letztlich alles Seiende hervorgegangen war, verkörperte der Nun auch das Element der Regeneration schlechthin. Schläfer, Tote und vor allem der Sonnengott tauchten in ihn herab, um mit neuer Lebenskraft aus ihm hervorzutreten.
1.2. Die Entstehung des Schöpfers
Der Schöpfergott wurde als von jeher in einem virtuellen Existenzzustand im Urgewässer Nun präsent erachtet. Das Mysterium der Schöpfung lag im Über-gang aus dieser virtuellen Existenz in den konkreten Zustand des Existierens, im Übergang also von Unbewusstsein und Passivität zu Bewusstsein und zu gewoll-tem, geplanten Handeln.
Dieser Übergang wird meist als autogen beschrieben, der Schöpfer ist von selbst entstanden (xpr Ds=f), oder er hat sich selbst geschaffen (jr sw), sich selbst geformt (od sw) und sich so in den kennzeichnenden ersten Zustand des Allein-seins (waj), der völligen Einsamkeit in mitten des Urgewässers gebracht.
Die Selbstentstehung wird in den meisten Texten lediglich postuliert, in gewis-sen Fällen wurde jedoch versucht, dahinter eine treibende Kraft zu erkennen.
So ist es in Sargtext Spruch 80 (ca. 20. Jh.) der Urozean Nun selber, der den dahin treibenden Gott anspricht und ihn aufrüttelt, zu Bewusstsein und Leben zu kommen. Der Nun wird hier als die Kraft beschrieben, die den Schöpfungs-prozess dank der Effizienz des gesprochenen Wortes ausgelöst hat.
Ab der Ramessidenzeit (ca. 13./12. Jh) treten vermehrt Vorstellungen auf, wo-nach andere Götter, Mittlerwesen oder auch Gegenstände als Zwischenglied zwi-schen dem Urzustand und dem aktiven Schöpfergott gewirkt haben. Zu den ver-breitetsten Vorstellungen gehören die Göttin Neith als Mutter des Re, Mehetwe-ret die Kuh, die den Schöpfergott aus dem Nun hob oder Göttergremien wie die Achtheit, die Djaisu in Edfu und die Hemusut in Karnak. Ferner treten auch Vor-stellungen auf, wonach ein Ei oder eine Lotusblume als eine Art gestative Zwi-schenetappe auf dem Weg zur Entstehung des Schöpfers fungiert haben.
1.3. Der Schöpfungsvorgang
Die Ägypter bedienten sich sowohl der Vorstellung einer aktiven, transitiven Er-schaffung der Welt, als auch der einer intransitiven Entstehung. Letztere baute auf dem Verbum kheper ‘werden, entstehen’ auf. In allen Epochen wurden mit
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 45
diesem Verbum Formulierungen gebildet wie: ‘Ich bin es, der entstanden ist als der Entstandene, als ich entstanden war entstand das Entstandene, alles Entstan-dene entstand nachdem ich entstanden war’.6
Wesentlich häufiger jedoch versuchte man die Realität als etwas Erschaffenes, bewusst Kreiertes zu erklären. Dabei stiess man auf das Problem der Einsamkeit des Schöpfergottes, dem ein gänzlich anthropomorphes Bild zugrunde lag. Das zu Erschaffende musste direkt aus dem einen Wesen heraus geschöpft werden. Als Mittel (Medium, vermittelndes Element) etwas zu kreieren, kamen also nur Sub-stanzen in Frage, die dem anthropomorphen Gott zur Verfügung standen. Dies waren:
– konkrete Sekretionen: Samen, Speichel, Expiration, Schweiss und Tränen – abstrakte Emanationen: verschiedene Formen der Sprache (Schöpferwort Hu,
Befehl, Benennung), Gedanke (Wunsch, Wille etc., der ägyptische Begriff jb), Blick-Kraft (Imaginatio, Einbildungskraft) oder eine nicht leicht zu definieren-de akhu-Kraft.
In den ägyptischen Schöpfungsvorstellungen kommen keine äusseren Mittel zum Einsatz, wie etwa die Erde in der Genesis oder im mesopotamischen Atrachasis Gedicht zur Erschaffung der Menschen.
Schöpfungsmittel und erschaffenes Resultat konnten weitgehend beliebig kombiniert werden. Ebenso konnte jede als Schöpfergott qualifizierte Gottheit sämtliche Mittel verwenden; Die Annahme, die Schöpfung durch das Wort wäre etwa speziell mit Ptah verbunden, hat sich längst als unkorrekt erwiesen. Die ein-zige feste Verbindung, bedingt durch die Paronomase, die ja immer auf etwas Es-sentielles hindeutete, ist das Entstehen der Menschen remetsch, aus den Tränen remut des Schöpfers. An dieses besonders prägnante Bild, liessen sich tiefgreifen-de Auslegungen über das Wesen der Menschen anknüpfen (s. unten).
1.4. Die Phase der Erhaltung
Dass das Weiterführen und Aufrechterhalten des Schöpferwerkes ebenfalls in der Verantwortung des höchsten Gottes stand, gehörte zu den Grundvorstellungen der altägyptischen Weltanschauung. Ursprung und Jetztzeit waren verbunden. Die mythologische Ausgestaltung dieser Vorstellung variierte jedoch stark von einer Epoche zur andern. Nur stichwortartig sollen die weitreichenden Ausgestaltungen dieser Thematik hier vorweggenommen werden. Für das Mittlere Reich ist die Vorstellung belegt, dass der Schöpfergott die Verantwortung für die Aufrechterhal-tung des von ihm kreierten Prinzips Leben und für das Funktionieren des Kos-mos, insbesondere der Fruchtbarkeit der Erde anderen Göttern übertrug, die als
6 Faulkner, Raymond O.: The Papyrus Bremner-Rhind, Bibliotheca Aegyptiaca III, Bruxelles
1933, S. 69-71, Übersetzung id. in: Journal of Egyptian Archaeology 24 (1938), S. 41.
SUSANNE BICKEL 46
sein Sohn bezeichnet wurden. In den Quellen des Neuen Reichs tritt der Aspekt der Erhaltung in den Vordergrund, diese wird fortan vom solaren Schöpfergott selber garantiert. Der tägliche Sonnenlauf wurde zum Zeichen der permanenten Wiederholung der Schöpfung. In griechisch-römischer Zeit schliesslich wurde der Gedanke der Erhaltung mit der jährlich inszenierten Geburt des Kindgottes, re-spektive des Königs verbunden, in dessen Obhut das Gedeihen der Welt lag.
Fassen wir noch einmal zusammen: die aus den Quellen zu rekonstruierenden Grundkonzeptionen, die während der ganzen Dauer der pharaonischen Kultur konstant blieben, waren zum einen die Vorstellungen vom Nun als präexistie-rendem Ursprungsprinzip, zum anderen das Bild des Schöpfergottes mit primär solarem Charakter, der sich in Einsamkeit vor der Aufgabe der Entfaltung und Schöpfung sah. Auch die für die Schöpfung der Weltkonstituenten zur Verfü-gung stehenden Mittel blieben weitgehend dieselben. Es kamen im Verlauf des langen Gebrauches nur wenig neue Vorstellungen hinzu und es wurden keine als veraltert erklärt. Die mit diesen Etappen des Prozesses zusammenhängenden Vorstellungen wurden in den Texten, die auf sie verwiesen, in vielseitigster Weise ausgestaltet und verdichtet.
2. Vom Tiefentext zum Kulttext
Die eben skizzierten Vorstellungen stellen die Hauptgedanken des altägyptischen Tiefentexts zum Thema Weltentstehung und Schöpfung dar, den Kern des My-thos. Sie bildeten die Grundlage der Welterklärung und davon abgeleitet auch der Kosmographie und Weltanschauung. Sie blieben konstant und allgemeingül-tig. In dieser theologisch kulturell fundierenden Funktion hätte es, zumindest in Ägypten und wohl in vielen anderen Kulturen, keinen Grund gegeben, den My-thos in Form eines Textes niederzulegen. Dass wir als kulturexterne Beobachter die mythischen Vorstellungen überhaupt kennen – oder vielmehr rekonstruieren können –, verdanken wir der Tatsache, dass sie von der Ebene des Tiefentextes oder kulturellen Wissensfundus in die Ebene des sehr Schrifttext basierten Kultes transferiert wurden. In ganz unterschiedlichen Kontexten und Kultpraktiken wurden mythische Vorstellungen in vielfacher Weise mobilisiert, angewandt und auf einer neuen Ebene sinnstiftend gemacht.
In dieser Funktion stand ein Mythos nicht mehr in Beziehung zu den existen-ziellen, kosmischen und staatspolitischen Grundstrukturen, sondern zu einer Vielzahl von punktuellen Einzelphänomenen und -ereignissen. Er diente nicht mehr den grossen Fragen der Welt sondern zahllosen spezifischen, konkreten Gegebenheiten und Bedürfnissen.
In ihrer kultischen Funktion wurden Elemente des Mythos entweder als Prä-zedenzfall, als Referenzpunkt oder als Mittel der Valorisierung und Überhöhung eingesetzt. Der Mythos war also nicht mehr Erklärung eines Phänomens, son-
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 47
dern ein Phänomen wurde als mit einer mythischen Begebenheit vergleichbar er-klärt und in der Form eines Rückverweises in Analogie gestellt.
Die vorwiegend im Bereich der Kulttexte angesiedelten Anwendungen sind für uns die einzigen textlichen Quellen altägyptischer Schöpfungsvorstellungen und auch die wesentlich selteneren Bildquellen stammen aus eben diesem Bereich. Diese Anwendungsbereiche interessierten sich aber nicht für den Mythos als sol-chen, sondern machten sich jeweils nur einzelne relevante Mytheme oder Kurz-sequenzen nutzbar. Aus diesem Grund präsentiert sich das mythische Material in den Textquellen überaus fragmenthaft und können wir die Grundgedanken myt-hischer Handlungszusammenhänge – den Tiefentext – lediglich rekonstruieren.
In ihrer kultischen Verwendung bedürfen Mythen keiner Ausformulierung. Eine schlichte Evokation, ein kurzer Verweis auf eine einzige Begebenheit ge-nügt, den gesamten Zusammenhang konzeptuell zu mobilisieren und dessen Ausgang auf die vorliegende Situation zu übertragen. Es kommt daher nur selten zu längeren Sequenzen und nur in Ausnahmefällen zu eigentlichen mythologi-schen Narrationen, wie z.B. die Horus- und Sethgeschichte im Papyrus Chester Beatty I7 oder die Geschichte von Astarte und dem Meer.8 Doch sind auch diese bis zur Narration entfalteten Ausgestaltungen kontextgebundene, in diesen Bei-spielen im Königskult nutzbar gemachte Aktivierungen mythischer Vorstellun-gen, die weder die Gesamtkohärenz noch den semantischen Kern des Tiefentex-tes wiedergeben, wohl aber aus diesem schöpfend neue Bedeutung und Wirk-samkeit kreierten.
In den von Aleida Assmann und Jan Assmann definierten sieben Mythos Beg-riffen würden diese Aktualisierungen ‘M6’, literarischen Mythen,9 entsprechen. Anders als im europäischen Kulturraum konnte in Ägypten die Literatur zwar durchaus Ort der produktiven Umdeutung von Mythen sein,10 doch befand sich der bedeutendste und vielseitigste Anwendungsbereich in den verschiedenen Formen des Kultes.
Die gedankliche Kohärenz, die Sinnhaftigkeit und Modellhaftigkeit der mythi-schen Grundvorstellungen waren im Bewusstsein präsent. Durch einen punktuel-len Verweis, durch ein kleines Fragment aus dem Gesamtfundus, konnte die Be-
7 Vgl. Broze, Michèle: Mythe et roman dans l’Égypte ancienne. Les aventures d’Horus et
Seth dans le Papyrus Chester Beatty I, Orientalia Lovaniensia Analecta, Band 76, Leuven 1996. Verhoeven, Ursula: Ein historischer ‘Sitz im Leben’ für die Erzählung von Horus und Seth des Papyrus Chester Beatty I, in: Wege öffnen. Festschrift für Rolf Gundlach zum 65. Geburtstag, hg. von Mechthild Schade-Busch, Ägypten und Altes Testament, Band 35, Wiesbaden 1996,, S. 347-363.
8 Collombert, Philippe; Coulon, Laurent: Les dieux contre la mer. Le début du ‘papyrus d’Astarté’ (pBN 202), in: Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 100 (2000), S. 193-242.
9 Vgl. Assmann, Aleida; Assmann, Jan: Mythos, in: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, hg. von Hubert Cancik, u.a., Band 4, Stuttgart 1998, S. 179-200.
10 Vgl. Baines, John: Myth and Literature. Junge, Friedrich: Mythos und Literarizität.
SUSANNE BICKEL 48
deutung auf unterschiedliche Kontexte angewandt und umgeleitet werden. Die Mythen lebten so im Textgut (und falls sie auch im Alltag Verwendung fanden?) vorwiegend in Fragmenten, die situationsbezogen ständig neu formuliert werden konnten. Diese Fragmente waren fest mit dem Gesamtzusammenhang verbun-den und bezogen ihren Sinn erst aus der Kenntnis des Ganzen. Die fragmentier-te Evokation des Mythos transportierte einen Sinn, der in unterschiedliche Kon-texte transferiert werden und darin in neuer Form sinnstiftend gemacht werden konnte. (Abb.1)
Abb. 1
3. Schöpfungsvorstellungen in kultischen Kontexten
Der wichtigste Ort mythologischer Entfaltung waren die verschiedenen Sphären des Kultes. Hier konnten mythische Vorstellungen, insbesondere Schöpfungsvor-stellungen, eingesetzt und in jeweils anderer Form signifikant gemacht werden. Stellt man die Quellen zusammen, so zeigt sich, dass Schöpfungsvorstellungen je nach Epoche aus sehr unterschiedlichen Bereichen und Textsorten stammen.
Drei Hauptanwendungsbereiche können identifiziert werden.
– Gegen Ende des 3. und in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends wurden mythi-sche Vorstellungen in funerären Texten als Präzedenzfälle evoziert. Die vom Verstorbenen zu durchlaufende Transformation zur jenseitigen Existenzform wurde mit Aspekten des Schöpfungsprozesses (und des Horus-Seth-Osiris Komplexes) in Analogie gesetzt und dadurch die Zusicherung gewonnen, dass der vom Individuum zu durchlaufende Transformationsprozess dem mythi-schen Vorgang entsprechen würde.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 49
– Im 2. Jahrtausend treten Schöpfungsmytheme in grosser Zahl im Kontext von Kulthymnen an Gottheiten auf. Ihr Zweck liegt dabei in der Vergegenwärti-gung und Lobpreisung göttlicher Macht und Wirksamkeit.
– Ab der Mitte des 1. Jahrtausends wurden mythische Vorstellungen in Ritual-texte und andere Tempeltexte integriert und dienten der Begründung zahlrei-cher kultischer Praktiken und lokaler Gegebenheiten.
Diese Hauptanwendungsbereiche in unterschiedlichen Epochen schliessen natür-lich ein sporadisches Vorkommen von Schöpfungsmythemen in den andern Kultkontexten nicht aus. In all diesen Zusammenhängen wurden die Schöp-fungsvorstellungen produktiv und im jeweiligen Kontext unmittelbar sinnstif-tend eingesetzt.
Vermutlich in allen Zeiten wurden Schöpfungsmytheme gelegentlich in magi-schen Texten und im Zusammenhang mit Heilspraktiken eingesetzt, doch wurde in diesen Bereichen primär auf den Horus-Seth-Osiris-Komplex referiert.
Ein weiterer möglicher Anwendungsbereich befand sich im theologisch-politischen Diskurs, wo die Evokation der Schöpfung und des Urzustandes auch als kontrapräsentischer11 Massstab, als Idealbild einer Zeit und eines Zustands der Welt dienen konnte, den Könige durch ihre Taten entweder nachahmen oder gar wiederherstellen mussten. Der Sinn entfaltete sich hier nicht durch Verbin-dung und Analogie mit den mythischen Vorstellungen, sondern gerade durch die Distanz und Andersartigkeit.12 Ein berühmtes Beispiel ist die Restaurationsstele, in der von Tutanchamun gesagt wird, er habe die Maat wieder hergestellt und so gehandelt, ‘dass die Welt (wieder) wurde wie beim Ersten Mal’. Auch in diesem Kontext gibt es keine explizite Darlegung der Vorgänge und Zustände, auf die verwiesen wird.
3.1. Altes und Mittleres Reich
Für das Alte und Mittlere Reich (2400-1600 v. Chr.) sind es fast ausschliesslich die funerären Texte, die Schöpfungsvorstellungen überliefern, die Pyramidentexte und vor allem die Sargtexte. Funeräre Texte waren dazu bestimmt, dem Verstor-benen das Weiterleben im Jenseits zu sichern. Sie wurden zum Teil rituell umge-setzt in Rezitationen und Handlungen, entfalteten dann aber im Grab oder Sarg angebracht ihre performative Wirksamkeit. Um ein Weiterleben zu erlangen, musste der Verstorbene zu einer neuen Existenzform finden, er musste eine Transformation durchgehen, wie Atum sie bei seinem Entstehen aus dem Nun durchgegangen war. Grundproblem in der Situation des Schöpfers wie auch des
11 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis, München 1997, S. 78-83. 12 Bickel, Susanne: Temps liminaires, temps meilleurs? Qualifications de l’origine et de la fin
du temps en Égypte ancienne, in: Représentations du temps dans les religions, hg. von Vincianne Pirenne-Delforge, Öhnan Tunca, Liège 2003, S. 46-50.
SUSANNE BICKEL 50
Verstorbenen war der Wechsel von einer Existenzform in eine andere. In dieser Situation hatte der Schöpfergott Atum das Prinzip des Lebens ‘erfunden’ und ihm in seinem Sohn Schu Gestalt gegeben. Dieser Vorgang der Entstehung von Leben aus einem Zustand des Nicht-Lebens übertrugen die Texte des Totenkultes auf die Situation des Verstorbenen. Die Schöpfungsvorstellungen wurden als Modell für den Vorgang der Regeneration genutzt.
Eine Vorgehensweise konnte dabei, wie im folgenden Beispiel aus den Pyra-midentexten, die Identifikation des Verstorbenen mit dem ersten Produkt des Schöpfergottes, seinem Sohn Schu, sein.
Schu, Sohn des Atum, ist dieser Verstorbene Pepi. Du bist der älteste Sohn des Atum, sein Ebenbild, Atum spuckte dich aus aus seinem Mund in deinem Namen Schu. (PT 660, §1870a-1871a)
Eine andere Nutzbarmachung bestand in der Einbindung des Verstorbenen in den Schöpfungsprozess, wodurch die Quelle kreativer, regenerativer Kraft auf ihn übertragen wurde. Gleichzeitig verlieh die Verbindung mit dem Schöpfungsvor-gang grosses Prestige.
Dieser Pepi wurde von seinem Vater Atum geboren, bevor der Himmel entstanden war, bevor die Erde entstanden war, bevor die Leute entstanden waren, bevor die Götter geboren wurden, bevor der Tod ent-standen war. Dieser Pepi wird dem Tag des Todes entkommen, … (PT 571, §1466b-1467a)
Im funerären Kontext liegt das Hauptinteresse an Schöpfungsvorstellungen auf drei Aspekten:
1. Aus der Analogie zwischen dem unbewussten und latenten Zustand des Schöpfers und dem des Toten wurde die Erwartung entwickelt, dass dieser wie der Schöpfer zu einer andern Existenzform finden und durch die Entfaltung der schöpferischen Kraft die Transformation in den jenseitigen Seinszustand erreichen konnte.
2. Die Texte des Mittleren Reiches fokussieren auf das Phänomen der Erschaf-fung oder Erfindung des Prinzips des Lebens und dessen Weitergabe. Auch die vom Verstorbenen angestrebte jenseitige Existenzform wurde als neu zu schaf-fendes Leben definiert.
3. Über Aretalogien wurde der Verstorbene mit dem Schöpfergott oder einer der Gottheiten der ersten Generation identifiziert. Aus dieser Verbindung mit dem Ursprung bezog er nicht nur Schöpferkräfte die seiner eigenen Transformation dienlich waren, sondern auch grosses Prestige und Autorität als zur Behaup-tung eines Status im Jenseits durchaus wichtige Faktoren.
Vor dem Hintergrund ihrer Funktion erklärt sich auch die Tatsache, dass die Tex-te dieser Zeit sich vorwiegend auf die Schöpfung der Kinder des Atum, Schu und
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 51
Tefnut, sowie auf die damit verknüpfte Entstehung des Lebens konzentrieren. Zu neuem Leben zu gelangen und in seinen eigenen Kindern weiterzuexistieren wa-ren auch die Hauptanliegen des Verstorbenen, für den die Texte verfasst waren. Um diese Vorgänge auszuformulieren, wurden, besonders in den Sargtexten, sehr tiefsinnige, geballte Bilder entworfen. Der aus dem Lebenshauch des Atum ent-standene Sohn Schu wird als Leben bezeichnet, er verkörpert das neu geschaffe-ne Prinzip; seine Schwester Tefnut wird mit dem alles überspannenden Prinzip der Maat, der kosmischen und sozialen Harmonie, gleichgesetzt. Die aus dem Vater entstandenen Kinder sind es, die ihn stützen, die ihm helfen sich aufzu-richten und ihn zur wirklich dauernden Existenz bringen. Wir treffen hier in my-thologischer Sprache auf die gesellschaftlich so zentrale Vorstellung der Wechsel-wirkung der Kräfte und der Solidarität zwischen den Generationen.
Da sprach Atum: dies ist meine lebendige Tochter Tefnut, sie wird mit ihrem Bruder Schu zusammen sein. Leben ist sein Name, Maat ist ihr Name. Ich werde mit meinen zwei Kindern leben, ich werde mit meinen zwei Kücken leben, und ich werde zwischen ihnen sein; das eine von ihnen wird hinter mir sein, das andere auf meinem Bauch. Leben ruht mit meiner Tochter Maat, das eine in mir drin, das andere um mich herum. Ich habe mich auf ihnen aufgerichtet, indem ihre Arme um mich waren. Dies ist mein Sohn, er lebt, derjenige den ich gezeugt habe in meinem Namen. Er versteht es, denjenigen der im Ei ist zu beleben im zugehörigen Körper, nämlich die Menschen, die aus meinem Auge hervorgegangen sind, das ich ausgesandt habe, als ich allein war mit Nun in Mattigkeit… (CT 80, II 32b-33f)
Die Erschaffung des Lebens aus dem Zustand des Nun war der Kerngedanke, der bewirkte, dass Schöpfungsmytheme in Totentexten verarbeitet wurden. Dort dienten sie als Präzedenzfall, als für jeden Verstorbenen relevantes Vorbild. Die erschaffenen Bestandteile des Universums waren hingegen von geringerem Inte-resse und die Aussagen beschränken sich auf das Wesentliche: Götter, Menschen, Himmel und Erde.
3.2. Neues Reich
Im Neuen Reich (2. Hälfte 2. Jahrtausend v. Chr.) finden wir Schöpfungsvorstel-lungen in überwältigender Fülle in den Hymnen des Götterkultes. Wie schon erwähnt, war die Weltanschauung dieser Zeit sehr auf den Sonnenlauf gerichtet, und dies im Grunde aus einer grossen Sorge um die Stabilität des Weltgefüges, aus dem Bewusstsein der Fragilität und ständigen Gefährdung der Schöpfung. Das Interesse richtete sich demnach weniger auf die erstmalige Schöpfung, als vielmehr auf deren Instandhaltung. Um den Schöpfer- und Sonnengott darin zu
SUSANNE BICKEL 52
unterstützen, sein Werk zu erhalten oder beständig neu zu initiieren, huldigten ihm die Menschen mit täglichen Opfern und mit verbalen, hymnischen Preisun-gen, in denen der Gott und sein Werk im Detail charakterisiert wurden. Dies führte zur Aufzählung der Schöpferkräfte und -Taten und gelegentlich zu ausge-dehnten, dem hymnischen Stil angepassten Listen der geschaffenen Elemente und Wesen, die Sterne, Berge, Wasser, Tiere aller Arten bis zum Floh, aber auch Institutionelles wie Städte, Tempel, die Gesetze und das Königtum aufzählten.
Du bist der Eine, der alles Seiende geschaffen hat, der Eine Einsame, der schuf, was ist. Die Menschen gingen aus seinen Augen hervor, und die Götter entstanden aus seinem Mund. Der die Kräuter erschafft, die das Vieh am Leben erhalten, und den ‘Lebensbaum’ für die Menschheit, der hervorbringt, wovon die Fische im Fluss leben und die Vögel, die den Himmel bevölkern. Der dem, der im Ei ist, Luft gibt; der das Junge der Schlange am Leben erhält, der erschafft, wovon die Mücke lebt, Würmer und Flöhe gleichermassen; der für die Mäuse in ihren Löchern sorgt und die Käfer am Leben erhält in jeglichem Holz.
Sei gegrüsst, der dies alles erschaffen hat, der Eine Einzige mit seinen vielen Armen; der die Nacht wachend verbringt, wenn alle Welt schläft, und sucht, was seiner Herde wohltut; Amun, bleibend an allen Dingen, Atum Harachte…13
Kennzeichnend für die Charakterisierung des Schöpfergottes des Neuen Reiches ist auch die betonte Fürsorge für die erschaffenen Wesen.
Diese primär für den Götterkult im Tempel konzipierten Hymnen mit stets ähn-lichen Beschreibungen des Schöpfergottes und seiner Taten wurden gelegentlich auch an den Fassaden oder in offenen Höfen der Gräber niedergeschrieben. Et-was später wurden Hymnen auch ins Totenbuch integriert (Kapitel 15). So kamen Schöpfungsvorstellungen doch wieder in den funerären Bereich, jedoch immer als preisende Hymnen in der Funktion einer captatio benevolentiae gegenüber der Gottheit, mit der sich der Verstorbene im Jenseits zu vereinen suchte. Die Schöp-fungsthematik diente nicht mehr, wie in vorhergehenden Zeiten, als Modell der eigenen Transformation. Es ist kennzeichnend, dass im Totenbuch und auch in den Jenseitsführern der Königsgräber nur sehr selten Schöpfungsvorstellungen
13 Papyrus Berlin 58038 (pap. Boulaq 17), Assmann, Jan: Ägyptische Hymnen und Gebete,
Orbis Biblicus et Orientalis, Fribourg/Göttingen 1999, S. 199-200; Luiselli, Maria Michela: Der Amun-Re Hymnus des P. Boulaq 17, Kleine ägyptische Texte, Band 14, Wiesbaden 2004, S. 23-24, 72-79.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 53
zur Sprache kommen. Auch im funerären Kontext wurden die Bewegung des Sonnengottes und die von ihm ausgehende belebende Kraft und Wirkung wich-tiger als die eigentlich schöpferische Handlung und damit verbundene ontologi-sche Transformation.
Sowohl im Götterkult als auch in der weit weniger häufigen funerären Ver-wendung war die Funktion der Erwähnung von Schöpfungsvorstellungen die des Lobpreises, der Erhöhung des Prestiges einer Gottheit und der ihr zugeschriebe-nen Fähigkeiten. Diese Darstellungen trugen zugleich die Zusicherung der per-manenten Entfaltung der Schöpferkraft und der Fürsorge des Gottes für die Schöpfung in sich.
3.3. Exkurs zu den Schöpfergottheiten
Ab dem Neuen Reich wurden verschiedene Gottheiten als Schöpfer bezeichnet. Grundsätzlich galt der Sonnengott als Urheber der Existenz, des Prinzips Leben und des Universums. Alle schöpferische Energie ging von der Sonne aus. Re ist die sichtbare Sonne und die solare Kraft, Atum ist spezifisch Schöpfer, das Grundmodell des Schöpfergottes: Er ist eine Erscheinungsform des Sonnengot-tes, dessen Name auf einem Wortstamm aufgebaut ist, der sowohl ‘Nichtsein’ als auch ‘Vollständig sein’ bedeutet. Es war ja gerade die Funktion dieses Gottes, die Transition vom Nichtsein zur Vollständigkeit der Schöpfung vollbracht zu ha-ben. Sämtliche bekannten Vorstellungen, die sich auf die materiellen und imma-teriellen Mittel beziehen, die der Gott aus sich selber hervorbringen konnte um weitere Wesen zu kreieren, sind schon im Mittleren Reich belegt und stets auf den Sonnengott Re oder Atum bezogen. 14
Seit dem Beginn des Neuen Reichs konzentrierte sich die Weltanschauung immer stärker auf das tägliche Erscheinen des Sonnengottes und dessen perma-nente Leben spendende und Leben erhaltende Wirkung; jeder Sonnenaufgang wurde nun als eine Art Wiederholung der Schöpfung angesehen. Zu Beginn der 18. Dynastie wurde diese Funktion auch auf den Gott Amun übertragen, der schon im Mittleren Reich mit dem Sonnengott gleichgesetzt und oft als Amun-Re angesprochen wurde.
Die Qualifikation als Schöpfergott ging in jedem Falle einher mit einer aus-drücklichen Solarisierung des betreffenden Gottes. Dies ist nicht nur für Amun-Re, sondern zum Beispiel auch für Ptah zu beobachten, der spätestens ab der 19. Dynastie auch als Schöpfergott verehrt wurde. So wird er in einem Hymnus vom Beginn des 1. Jahrtausends ausführlich als Schöpfer gepriesen zuvor jedoch als ‘Strahlender, Herr des Lichtes, der die beiden Länder erhellt mit seinem
14 Bickel, Susanne: La cosmogonie égyptienne avant le Nouvel Empire, Orbis Biblicus et
Orientalis, Band 134, Fribourg/Göttingen 1994, S. 72-111.
SUSANNE BICKEL 54
Glanz…” beschrieben und explizit solarisiert.15 Sein erster Schöpfungsakt besteht dann auch darin, seinen Sohn Re ‘mit seinem Ausspruch zu erzeugen, mit seinen Händen zu schaffen und ihn aus dem Nun herauszuheben”. Ptah wird demnach zu einer Vorstufe der eigentlichen Erscheinung des Sonnengottes erklärt. Wurde Ptah in älteren Quellen (z.B. Sargtext Spruch 647) als Sohn des Re bezeichnet, so konnten sich die Verhältnisse nun umdrehen und Re, der Erstentstandene par excellence zum Sohn einer andern Gottheit werden. Auch im sogenannten Denkmal memphitischer Theologie treffen wir auf dieses Vorgehen: Ptah wird mit Nun assoziiert und folgendermassen angesprochen: ‘Ptah-Nun: Vater, der Atum zeugte, Ptah-Naunet: Mutter, die Atum gebar”. Ptah ist die Ursubstanz, aus der der Schöpfer entstand.
In ähnlicher Weise wird die Göttin Neith seit dem Neuen Reich als Mutter des Re bezeichnet und als eine Art Vorstufe des eigentlichen Schöpfungsprozesses er-achtet.
Diese Transzendierung einer Gottheit durch eine andere drückt natürlich in keiner Weise Polemik oder Rivalität aus, sondern vielmehr die Suche nach dem Ursprung des Ursprungs, ein Dahinter-Kommen-Wollen, noch einen Schritt tie-fer eindringen wollen ins Mysterium des Ursprungs des Lichtes und Lebens. Man könnte sich fragen, ob in diesen Vorstellungen nicht sogar die ersten Ansätze des Bestrebens immer weiterer Transzendierung zu erkennen ist, das dann in den ers-ten nachchristlichen Jahrhunderten in der Gnosis seine Blüte erfuhr.
Die Solarisierung und die Bezeichnung als Vorstufe oder Schöpfer des Schöpfers waren Strategien, andere Gottheiten so enge wie möglich an Atum/Re zu binden und ihnen das Prestige des Schöpfers zu verleihen.
Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche weitere Götter solarisiert, so z.B. Khnum. Ursprünglich war Khnum nicht ein Schöpfergott, sondern spezifisch dafür zu-ständig, das entstehende menschliche Lebewesen zu formen und das Kind im Mutterleib zu beleben. Er war nicht wie der Schöpfergott für die Menschheit ins-gesamt zuständig, sondern für den Einzelmenschen. Sein Handeln war nicht im Bereich des Schöpfungsprozesses situiert, sondern innerhalb der existierenden Welt. Wenn nun Khnum gelegentlich in der Spätzeit dennoch als Weltschöpfer gepriesen wurde, so hiess er dabei Khnum-Re.
3.4. Spätzeit und griechisch-römische Zeit
Ab der Mitte des 1. Jahrtausends treffen wir noch einmal in grösserem Ausmass auf Schöpfungsvorstellungen. Diesmal stehen sie auf Papyri oder auf Tempelwän-den, vorwiegend im Zusammenhang mit Ritualen oder kulttopographischen Be-
15 PBerlin 3048, Knigge, Carsten: Das Lob der Schöpfung. Die Entwicklung ägyptischer Son-
nen- und Schöpfungshymnen nach dem Neuen Reich, Orbis Biblicus et Orientalis, Band 219, Fribourg/Göttingen 2006, S. 163-173.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 55
langen. In der 26. Dynastie begann eine umfassende Aktivität der Kompilation und Systematisierung religiöser Texte und religiösen Wissens. Wie der Deltapapy-rus16 als ältestes Beispiel einer langen Serie zeigt, wurden auch mythologische Tex-te gesammelt und z.T. gewiss auch gängige Vorstellungen erstmals verschriftlicht. Die Zweckangabe dieser Kompilationen ist nicht immer erhalten, doch dürfte ihr Gebrauch in allen Fällen mit rituellen Praktiken oder diesen zugrunde liegendem Wissen zutun gehabt haben.
Auch die griechisch-römische Zeit war von ausgesprochener kultureller Kreativi-tät gekennzeichnet. Wie nie zuvor sah sich die ägyptische Kultur veranlasst, sich selbst zu definieren und abzugrenzen, dies nicht zuletzt aufgrund der Präsenz des politisch ausschlaggebenden Hellenismus. Es entstand das Bedürfnis, die Existenz längst bestehender Gegebenheiten, Bräuche, Feste, Rituale, aber auch Tempel, Städte und landschaftlicher Besonderheiten zu begründen und zu erklären. My-thologische Texte erhielten die Bedeutung kultureller Identitätsbekräftigung und Legitimation. Trotz der Bezugnahme auf ungezählte Partikular- und Lokalsituati-onen schöpften diese neuen Aktualisierungen weiterhin grossteils aus dem traditi-onellen Vorstellungsfundus, obwohl sie durchaus auch mit marginaleren und z.T. nur lokal relevanten Mythemen verflochten werden konnten.17 In vielen Fällen geschah dies, indem man eine spezifische Gegebenheit direkt an die Weltentste-hung und den Schöpfungsprozess knüpfte, doch auch zahlreiche andere mythi-sche Vorstellungskomplexe wurden als Fundierungen aufgearbeitet, neu reflektiert und neu bedeutsam gemacht. Wenn eine beliebige Tatsache, ein Fest zum Bei-spiel, als am Tag der Schöpfung aus dem Schöpfergott selber entstanden, definiert wurde, so erklärte dies nicht nur die Tatsache selber, sondern verankerte sie gleichzeitig in der Urtiefe des kulturellen Bewusstseins. Die Verbindung mit dem Ursprung lieferte nicht nur die Ätiologie sondern verlieh der betreffenden Tatsa-che besonderen Wert und Bedeutung.
Die ätiologische, kulturell fundierende Anwendung von Schöpfungsvorstellun-gen lenkte das Interesse auf das vom Schöpfergott Geschaffene: Nicht mehr nur die wichtigsten Elemente des Universums werden erwähnt, sondern zusätzlich auch zahlreiche lokale kultische Fakten. Nur wenige Beispiele seien hier erwähnt.
Eine lange, sehr traditionelle Evokation von Schöpfungsvorstellungen im Pa-pyrus Bremner-Rhind steht in Funktion zur rituellen Abwehr des Apophis.18
16 Meeks, Dimitri: Mythes et légendes du Delta d’après le papyrus Brooklyn 47.218.84, Mé-
moires publiés par les Membres de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Band 125, Kairo 2006.
17 Quack, Joachim Friedrich: Lokalressourcen oder Zentraltheologie? Zur Relevanz und Situ-ierung geographisch strukturierter Mythologie im Alten Ägypten, in: Archiv für Religions-geschichte 10 (2008), S. 5-29.
18 Faulkner, Raymond O.: The Papyrus Bremner-Rhind; id. in: Journal of Egyptian Archae-ology 24 (1938), S. 41.
SUSANNE BICKEL 56
Die beiden kosmogonischen Inschriften im Chonsutempel von Karnak stehen im Rahmen des Maat-Opfers und setzten so die Kulthandlung des Königs zum Wohle der Welt mit deren Schöpfung und Instandhaltung in Parallele.19
Auch die schöne Beschreibung der Schöpfertaten auf dem II. Pylon von Kar-nak bezieht sich auf eine königliche Kulthandlung, nämlich auf die Neukonsek-ration des Tores durch Ptolemäus (VII.) Evergetes II., für den das Land Ägypten und insbesondere Theben von Amun-Re geschaffen worden waren.20
So wurde in jener Zeit wohl jeder Tempel als Ort des ersten Erscheinens des Schöpfers angesehen. Das sehr betonte Hervorheben einzelner Städte und Ge-genden erscheint erst in dieser Zeit und drückt meines Erachtens viel weniger lo-kale Theologie aus, die sich von den Nachbarn absetzen wollte, als das Bestreben nach tiefer kultureller Verankerung. Dieses wiederum wird vor dem Hintergrund jener Zeit verständlich, in der sich nicht nur die ägyptische Kultur als solche, sondern auch der Einzelne, jedenfalls die Mitglieder der Kultur tragenden Pries-terschaft, veranlasst sahen, sich und ihr Wirken zu definieren.
Ein besonders markantes Beispiel für die Verwendung von Schöpfungsvorstel-lungen im rituellen Kontext ist der Papyrus Salt 825 (Anfang der Ptolemäerzeit). Erstmals werden hier die vom Schöpfer in Kraft gesetzten schöpferischen Mittel von den bedeutenden Konstituenten der Welt losgelöst evoziert, um auf Anhieb marginale Einzelheiten zu kreieren. Es handelt sich jedoch um die Ingredienzien für die rituelle Herstellung einer Osirisfigur, deren richtige Ausführung grundle-gend war.
Ein Ausschnitt: ‘… Re weinte wieder. Das Wasser seines Auges fiel zur Erde und es wurde zu einer Biene’ …und diese Biene produziert dann das Wachs für die Osirisfigur. ‘Re war müde, der Schweiss seines Körpers fiel zur Erde, er keim-te und wurde zu Leinen, und so wurde der Stoff hergestellt… Re spuckte und warf Speichel aus und so wurde der Teer geschaffen…’.21
Wir sind hier weit entfernt von der philosophischen Sprache der Sargtexte, wo Re aus denselben schöpferischen Mitteln die Menschheit, die Götter und seinen das Leben verkörpernden Sohn Schu entstehen liess. Dennoch darf die Bedeu-tung dieser Verwendung der Schöpfungsvorstellungen im historischen und kultu-rellen Kontext nicht unterschätzt werden, denn das beschriebene Ritual der Her-stellung der Osirisfigur diente letztendlich der Erhaltung des Lebens und bezog
19 Mendel, Daniela: Die kosmogonischen Inschriften in der Barkenkapelle des Chonstempels
von Karnak, Monographies Reine Élisabeth, Band 9, Turnhout 2003. 20 Drioton, Étienne: Dédicaces de Ptolémée Évergète II sur le Deuxième pylône de Karnak,
in: Annales du Service des Antiquités 44 (1944), S. 111-162. Zu diesem Text und gewissen Charakteristika der thebanischen Theologie der Spätzeit und griechisch-römischen Zeit, Zivie-Coche, Christiane: Fragments pour une théologie, in: Hommages à Jean Leclant IV, Bibliothèque d’Études 106/4 (1994), S. 417-427.
21 Derchain, Philippe: Le Papyrus Salt 825, rituel pour la conservation de la vie en Égypte, Brüssel 1965, S. 137.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 57
seinen Einfluss und seine Wirkung nicht zuletzt aus der Verbindung mit der Schöpfergottheit und dem Ursprung des Lebens. Die Evokation von Schöp-fungsvorstellungen war also auch hier durchaus bedeutungsvoll. Dennoch kann festgestellt werden, dass in dieser sehr utilitaristischen Verwendung auf eine se-mantische Dimension verzichtet wurde, die sonst in kaum einer uns bekannten Anwendung fehlt.
3.5. Exkurs zur Entstehung der Menschheit
Schweiss und Tränen als Substanzen aus denen die Götter und die Menschheit entstanden waren, wurden seit dem Mittleren Reich regelmässig nebeneinander erwähnt. Dabei war die Substanz Tränen nicht nur über einen ungefähren jedoch als essentiell empfundenen Gleichklang mit den Menschen verbunden, sondern über eine wesentlich weitreichendere semantische Verknüpfung.22 Die Tränen wurden als ein unedles Produkt des Schöpfers gewertet, im Gegensatz zum Sa-men und vor allem zum wohl duftenden Schweiss des Schöpfers aus dem die Götter entstanden waren: ‘Aus meinem Schweiss habe ich die Götter entstehen lassen, aber die Menschen sind die Tränen meines Auges.’ (CT 1130 VII 464g-465a). Die erste Satzhälfte gibt die aktive Handlung des Gottes wieder, wogegen die zweite lediglich einen Zustand festhält.
Wie etliche längere Ausführungen klar machen, waren die Tränen nicht vom Willen des Schöpfers gelenkt, sie traten in einem Zustand der Trauer oder der Wut hervor. Die Menschen sind also zwar aus der Substanz des Schöpfers ent-standen, aber aus einem emotionell unkontrollierten und mit Bekümmernis be-hafteten Zustand heraus. Diese Entstehungssituation konnte die Begründung ih-res instabilen und unvollkommenen Wesens liefern.
Das Bild von der Entstehung der Menschen aus den Tränen und die damit verbundene Erklärung der Unzulänglichkeit ihres Wesens blieb über die ganze pharaonische Zeitspanne aktuell.
Ich bin (hervorgekommen aus dem) Nun, der Einzige, der nicht Seinesgleichen hat, ich bin entstanden, bei dem grossen Ereignis meines Auftauchens bin ich entstanden. Ich bin derjenige der auffliegt, dessen Form umkreist, der in seinem Ei ist. Ich bin derjenige der im Nun begann, siehe Hehu, ich bin hervorgekommen, siehe ich bin wohlbehalten. Ich bin derjenige, der sich gemacht hat, ich habe mich gebildet, wie ich es wünschte, gemäss meinem Willen.
22 Mathieu, Bernard: Les hommes de larmes: à propos d’un jeu de mots mythique dans les
textes de l’ancienne Égypte, in: Hommages à François Daumas, hg. von Antoine Guillau-mont, Montpellier 1986, S. 499-509. Zu den semantischen Möglichkeiten des Wortspiels, s. Loprieno, Antonio: La pensée et l’écriture. Pour une analyse sémiotique de la culture égyptienne, Paris 2001, S. 129-158.
SUSANNE BICKEL 58
Das was aus mir hervorgekommen ist, befindet sich in meiner Obhut. Tränen sind das, was ich gemacht habe wegen der Wut gegen mich, die Menschen gehören zur Blindheit die hinter mir ist. (CT 714, VI 343j-344g)
Mit knapper Sprache vermittelt dieser Totentext des Mittleren Reiches eine Gleichsetzung des Verstorbenen mit dem Schöpfergott und zugleich eine der konzisesten Darstellungen des Schöpfungsprozesses. Der Text illustriert deutlich, wie viel Vorkenntnisse der zugrunde liegenden Vorstellungen und der mit ihnen verbundenen Sinndimensionen vom Leser und Nutzer erwartet wurden. Nach einer ausführlichen Beschreibung der Selbstentstehung und Bewusstwerdung des Gottes beziehen sich die letzten Verse auf die Entstehung der Menschen aus ei-nem Zustand momentaner Blindheit des Schöpfers. Implizit wird hier auf den Mythos vom Sonnenauge referiert, in dessen Zentrum der Weggang der Tochter des Re steht, die mythologisch auch als ‘Auges des Re’ bezeichnet werden konn-te. Dieser Weggang der Tochter versetzte den Gott in Wut und Trauer. Seither ist die mythische Notlage längst überwunden, doch das damals daraus entstandene Produkt bleibt belastet. Diese Vorstellung diente weiter als Grundlage von Erör-terungen der Theodizee-Frage, in denen das Problem der Verantwortung für die menschliche Unzulänglichkeit reflektiert wurde.
Eine der spätesten Aktualisierungen von Schöpfungsvorstellungen, der Text im Tempel von Esna (2. Jh. n. Chr., gut 2000 Jahre nach CT 714), lieferte die Fundie-rung und Erklärung eines wichtigen Tempelfestes. Eine grosse Auswahl an traditio-nellen Mythemen wurde darin zu einer ausführlichen, sehr bildhaften Schilderung des von der Göttin Neith beherrschten Schöpfungsprozesses verarbeitet.23
Eine Passage des Textes beschreibt, wie der eben geborene Re seiner Mutter Neith wie ein Kind um den Hals fiel, als er sie sah. ‘Und dann weinte er in den Nun hinunter, weil er seine Mutter Neith nicht mehr sah, – und es entstanden die Menschen aus den Tränen seines Auges. Doch als er sie wieder sah, da speichelte er (vor Freude), und es entstanden die Götter aus dem Speichel seiner Lippen. Diese Götter, die damals entstanden, die stehen nun in ihren Schreinen…’
Es ist hier die Absenz der Mutter und nicht wie im vorherigen Beispiel der Tochter, die den noch im Kleinkindstadium befindlichen Schöpfergott Re zum Weinen bringt, doch findet sich auch hier die Gegenüberstellung der negativen Erfahrung als Ursprung der Menschen mit der positiven Entstehungssituation der Götter. Der Sinntransfer und die implizite Erklärung des menschlichen We-sens sind noch immer gewährleistet.
Hier liegt der Unterschied zur oben zitierten Passage des Papyrus Salt, die gewiss keinen essentiellen Qualitätsunterschied zwischen dem aus Tränen entstandenen
23 Sternberg-el Hotabi, Heike: Die Weltschöpfung in der Esna-Tradition, in: Texte aus der
Umwelt des Alten Testaments III/5, Gütersloh 1995, S. 1078-1087.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 59
Wachs und dem aus Schweiss hervorgegangenen Leinen vornimmt. Insofern wurde an jener Stelle, zugunsten einer vielseitigen Implikation des Schöpfers in der rituellen Produktion, auf die von den Schöpfungssubstanzen getragene Sinn-produktion verzichtet.
4. Schöpfungsvorstellungen im Bild
Die Entwicklung der ägyptischen Kultur ist durch eine Inflation der Bilder ge-kennzeichnet. Das Bildrepertoire vervielfachte sich im Laufe der Jahrtausende. Das Alte Reich bildete noch praktisch ausschliesslich Begebenheiten der konkre-ten Welt ab, wenn auch durchaus bisweilen darin Verweise auf Abstraktes und Konzeptuelles impliziert sein konnten. Seit dem 2. Jahrtausend wurde dann ver-schiedentlich der Versuch gewagt, auch nicht konkret Sichtbares und Erfahrbares darzustellen. Erste Beispiele finden sich in den Sargtexten (Zweiwegebuch, Sarg-text Spruch 466); am ausgeprägtesten geschah dies jedoch in den grossen Kos-mographien der Königsgräber des Neuen Reiches, die die Strukturen der diessei-tigen und der jenseitigen Welt und den Prozess ihrer Erhaltung nachbilden. Im Zentrum all dieser Darstellungen steht allerdings nicht die Schöpfung sondern der daraus entstandene Kosmos und sein Funktionieren. Ikonographische Aus-gestaltungen der eigentlichen Schöpfungsvorstellungen sind hingegen sehr selten. Bei den wenigen Bildern zum Schöpfungsprozess ist eine eindeutige Präzedenz des Textes vor dem Bild zu beobachten. Diese Feststellung kann jedoch keines-falls verallgemeinert werden. So gibt es einerseits zum Beispiel kosmographische Darstellungen bereits in der 1. Dynastie (der Kamm des Djet), also lange vor den ersten textlichen Aktualisierungen,24 und anderseits mythische Vorstellungen, die im Bild wesentlich grössere Verbreitung kannten als im Text, wie z.B. die Vereini-gung der beiden Länder (sema-taui). Andererseits sind in den Sargtexten etliche Mytheme dargelegt, die erst im Neuen Reich in den Königsgräbern oder den Vignetten des Totenbuches bildlich wieder gegeben wurden, erwähnt seien hier nur die Zerlegung des Apophis oder die Vereinigung von Re und Osiris.25
Das 1. Jahrtausend scheint einen kontinuierlichen Zuwachs an bildlichen Dar-stellungen gekannt zu haben.26 Ein erster Schub erfolgte in der Libyerzeit und betraf vorwiegend den funerären Bereich, Särge und Papyri. Zahlreiche längst be-
24 Roeder, Hubert: Auf den Flügeln des Thot: Der Kamm des Königs Wadj und seine Moti-
ve, Themen und Interpretationen in den Pyramidentexten, in: Wege öffnen. Festschrift für Rolf Gundlach zum 65. Geburtstag, hg. von Mechthild Schade-Busch, Ägypten und Altes Testament, Band 35, Wiesbaden 1996, S. 232-252
25 Bickel, Susanne: Die Jenseitsfahrt des Re nach Zeugen der Sargtexte, in: Ein ägyptisches Glasperlenspiel, ägyptologische Beiträge für Erik Hornung aus seinem Schülerkreis, hg. von Andreas Brodbeck, Berlin 1998, S. 41-56.
26 Hornung, Erik: Ancient Egyptian Religious Iconography, in: Civilizations of the Ancient Near East III, hg. von Jack M. Sasson, New York 1995, S.1711-1729.
SUSANNE BICKEL 60
Abb. 2: Schu trennt Nut und Geb, Papyrus des Khonsu-Renep, Piankoff, 1957, Taf. 11.
kannte Themen mythologischer oder mytho-kosmographischer Natur wurden in Bildern verdichtet, die oft den ausführlichen Text ersetzten. Diese Entwicklung könnte mit der Herkunft der hauptsächlichen Nutzer dieser Särge und Papyri zu-sammenhängen, den Mitgliedern der ursprünglich libyschen Elite, die zwar die ägyptischen Jenseitsvorstellungen für sich beanspruchten, jedoch keiner Texttradi-tion verbunden waren. Prominent unter den neuen Darstellungen tritt das Bild von der Trennung von Himmel und Erde durch Schu hervor (Abb. 2).
Dieses Mythem ist zwar nicht im engsten Sinn kosmogonisch, da es sich eher auf die Beständigkeit einer geschaffenen Struktur bezieht als auf den Vorgang deren Schöpfung, doch tritt es sprachlich geschildert auch im Verbund mit Schöp-fungsvorstellungen auf, wie zum Beispiel in Sargtext Spruch 78, wo der Verstor-bene mit Schu identifiziert wird:
‘NN ist der Ba des Schu, für den Nut oben drüber gelegt wurde und Geb un-ter seine Füsse; NN ist zwischen ihnen beiden.’ (CT 78 II 19a-b)
Das sprachliche Bild geht hier dem ikonischen um etwa eintausend Jahre vor-aus und auch der bedeutsamere obere Teil der Vorstellung, die ‘Hochhebungen des Schu’, ist bereits textlich in den Sargtexten präsent, lange bevor er in den Un-terweltsbüchern dann als Darstellung erscheint.
Ein weiterer Schub ikonographischer Kreativität erfolgte in der 25. und 26. Dy-nastie und ist für uns vorwiegend in Tempeln und auf Steinnaoi fassbar. Auch hier sind bildliche Aktualisierungen von Schöpfungsvorstellungen recht selten, doch kann zumindest auf die gelegentliche Darstellung der Achtheit hingewiesen werden, die das Erscheinen des Re aus der Lotusblüte förderte, wie im Beispiel
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 61
Abb. 3: Die Achtheit bringt den solaren Schöpfer als Kind hervor, Hibis Tempel, Davies 1953, Taf. 4.
aus dem Hibis Tempel (Abb. 3)27. In solchen Kontexten finden sich auch zahlrei-che Verweise auf Schöpferfähigkeiten von Gottheiten, kaum aber Evokationen anderweitig bekannter Schöpfungsmytheme.
Ein weiteres Beispiel eines ikonographischen Verweises auf die Schöpfungs-thematik ist das ‘Urgott-Kryptogramm’ (Abb. 4)28, das sich in ähnlicher Form auf mehreren magischen Stelen und in den Tempeln von Hibis und Philae findet, und das ganz offensichtlich die Vorstellung widerspiegelt, wonach ‘Ptah, der Selbstentstandene’ das Ei schuf, aus dem die Welt hervorging. Dieses Mythem findet sich sehr explizit im kosmogonischen Text des thebanischen Chonstem-pels (s. oben, Anm. 19). In der für die Spätzeit typischen freien Gestaltungsweise transportiert dieses Bild Gedanken, die zwar bereits in einer langen Tradition
27 Davies, Norman de Garis: The Temple of Hibis in El Khargeh Oasis, Part III The Decora-
tion, New York 1953, Taf. 4, Register 5. 28 Graefe, Erhart: Phallus und Ei: Ptah als Urgott. Das Fragment einer magischen Stele der
Bibliothèque Humaniste et Municipale de Sélestat, in: Egyptian Religion: The Last Thou-sand Years. Studies Dedicated to The Memory of Jan Quaegebeur, hg. von Willy Clarysse, Orientalia Lovaniensia Analecta, Band 84, Leuven 1998, S. 117-124.
SUSANNE BICKEL 62
Abb. 4: Ptah als Selbstentstandener befruchtet das Ei der Schöpfung, nach Graefe 1998, (Zeichnung F. Adrom).
standen, die aber immer wieder neu kombiniert und verdichtet werden und in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden konnten.
Dieser knappe Überblick über die Anwendungsbereiche altägyptischer Schöp-fungsvorstellungen zeigt, wie ein recht beschränkter Grundstock an spekulativen Bildern über gut zweieinhalb Jahrtausende in unterschiedlicher Funktion einge-setzt werden konnte. Der wechselnde Kontext beeinflusste dabei nicht die Vor-stellungen selber, sondern lediglich den Blickwinkel, den Schwerpunkt und die aus dem mythischen Gedankengut geschöpfte Sinndimension.
Im funerären Gebrauch des Alten und Mittleren Reiches lag das Hauptinteresse auf dem Phänomen der Transformation. Im Zentrum stand daher das Handeln des Schöpfergottes und insbesondere die Erschaffung des Prinzips Leben. Die Schöp-fungsvorstellungen dienten in diesem Kontext als Präzedenzfall und bildeten den
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 63
eigentlichen Inhalt oder das Ziel des Kultes, insofern die Regeneration des Verstor-benen als Nachahmung des Schöpfungsprozesses dargestellt wurde.
Im hymnischen Gebrauch des Neuen Reiches lag der Schwerpunkt auf der Be-schreibung der Person des Schöpfers, dessen erster und fortan permanenter Be-wegung und erhaltenden Wirkung. Durch die Evokation seiner Taten wurden die allumfänglichen Fähigkeiten des Gottes gepriesen und seine Macht überhöht, was gelegentlich zu langen Aufzählungen von geschaffenen Tieren und Instituti-onen führte und die Betonung der Fürsorge des Schöpfers für die Welt mit sich brachte. Die Schöpfungsvorstellungen bildeten in diesem Kontext das Mittel des Kultes.
In der Spätzeit und griechisch-römischen Zeit schliesslich wurde von spezifi-schen kultischen und topographischen Gegebenheiten ausgegangen, um diese in noch immer bedeutungsvoller Weise an den Ursprung der ägyptischen Kultur und Identität zu knüpfen. Hier dienten die Schöpfungsvorstellungen der Schil-derung der Ausgangslage und der Begründung von Kulthandlungen und geogra-phischen Phänomenen.
Der Mythos und seine Grundstrukturen und -vorstellungen lagen im Bewusst-sein der Kultur. Seine Aktualisierungen erfolgten vorwiegend im Medium des Textes und in verschiedenen Bereichen des Kultes. Erst in der Spätzeit und in für Ägypten erstaunlich spärlichem Masse, wurden Schöpfungsvorstellungen auch im Bilde ausgedrückt.
Bibliographie
Assmann, Aleida; Assmann, Jan: Mythos, in: Handbuch religionswissenschaftli-cher Grundbegriffe, hg. von Hubert Cancik u.a., Band 4, Stuttgart 1998, S. 179-200.
Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis, München 1997. Assmann, Jan: Rezeption und Auslegung in Ägypten, in: Rezeption und Ausle-
gung im Alten Testament und in seinem Umfeld, hg. von Reinhard G. Kratz, Thomas Krüger, Orbis Biblicus et Orientalis, Band 153, Fribourg/Göttingen 1997, S. 125-138.
Assmann, Jan: Ägyptische Hymnen und Gebete, Orbis Biblicus et Orientalis, Fri-bourg/Göttingen 1999.
Baines, John: Myth and Literature, in: Ancient Egyptian Literature, hg. von An-tonio Loprieno, Probleme der Ägyptologie, Band 10, Leiden 1996, S. 361-377.
Baines, John: Prehistories of Literature: Performance, Fiction, Myth, in: Definite-ly: Egyptian Literature, hg. von Gerald Moers, Lingua Aegyptia. Studia Mo-nographica, Band 2, Göttingen 1999, S. 17-41.
Bickel, Susanne: La cosmogonie égyptienne avant le Nouvel Empire, Orbis Bibli-cus et Orientalis, Band 134, Fribourg/Göttingen 1994.
SUSANNE BICKEL 64
Bickel, Susanne: Die Jenseitsfahrt des Re nach Zeugen der Sargtexte, in: Ein ägyp-tisches Glasperlenspiel, ägyptologische Beiträge für Erik Hornung aus seinem Schülerkreis, hg. von Andreas Brodbeck, Berlin 1998, S. 41-56.
Bickel, Susanne: Temps liminaires, temps meilleurs? Qualifications de l’origine et de la fin du temps en Égypte ancienne, in: Représentations du temps dans les reli-gions, hg. von Vincianne Pirenne-Delforge, Öhnan Tunca, Liège 2003, S. 43-53.
Broze, Michèle: Mythe et roman dans l’Égypte ancienne. Les aventures d’Horus et Seth dans le Papyrus Chester Beatty I., Orientalia Lovaniensia Analecta, Band 76, Leuven 1996.
Collombert, Philippe ; Coulon, Laurent: Les dieux contre la mer. Le début du ‘papy-rus d’Astarté’ (pBN 202), in: Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 100 (2000), S. 193-242.
Davies, Norman de Garis: The Temple of Hibis in El Khargeh Oasis, Part III The Decoration, New York 1953.
Derchain, Philippe: Le Papyrus Salt 825, rituel pour la conservation de la vie en Égypte, Bruxelles 1965.
Drioton, Étienne: Dédicaces de Ptolémée Évergète II sur le Deuxième pylône de Karnak, in: Annales du Service des Antiquités 44 (1944), S. 111-162.
Faulkner, Raymond O.: The Papyrus Bremner-Rhind, Bibliotheca Aegyptiaca III, Bruxelles 1933.
Goebs, Katja: A Functional Approach to Egyptian Myth and Mythemes, in: Jour-nal of Ancient Near Eastern Religion 2 (2002), S. 27-59.
Graefe, Erhart: Phallus und Ei: Ptah als Urgott. Das Fragment einer magischen Stele der Bibliothèque Humaniste et Municipale de Sélestat, in: Egyptian reli-gion: the last thousand years, studies dedicated to the memory of Jan Quae-gebeur, hg. von Willy Clarysse, Orientalia Lovaniensia Analecta, Band 84, Leuven 1998, S. 117-124.
Hornung, Erik: Ancient Egyptian Religious Iconography, in: Civilizations of the Ancient Near East III, hg. von Jack M. Sasson, New York 1995, S.1711-1729.
Junge, Friedrich: Mythos und Literarizität: Die Geschichte vom Streit der Götter Horus und Seth, in: Quaerentes scientiam, Festgabe für Wolfhart Westendorf, hg. von Heike Behlmer, Göttingen 1994, S. 83-101.
Knigge, Carsten, Das Lob der Schöpfung. Die Entwicklung ägyptischer Sonnen- und Schöpfungshymnen nach dem Neuen Reich, Orbis Biblicus et Orientalis, Band 219, Fribourg/Göttingen, 2006.
Köthen-Welpen, Sabine: Theogonie und Genealogie im Pantheon der Pyramiden-texte, Bonn 2003.
Loprieno, Antonio: La pensée et l’écriture. Pour une analyse sémiotique de la culture égyptienne, Paris 2001.
Luiselli, Maria Michela: Der Amun-Re Hymnus des P. Boulaq 17, Kleine ägyptis-che Texte, Band 14, Wiesbaden 2004.
ALTÄGYPTISCHE SCHÖPFUNGSVORSTELLUNGEN IM KULT 65
Mathieu, Bernard: Les hommes de larmes: à propos d’un jeu de mots mythique dans les textes de l’ancienne Égypte, in: Hommages à François Daumas, hg. von Antoine Guillaumont, Montpellier 1986, S. 499-509.
Meeks, Dimitri: Mythes et Légendes du Delta d’après le papyrus Brooklyn 47.218.84, Mémoires publiés par les Membres de l’Institut Francais d’ Archéo-logie Orientale 125, Kairo 2006.
Mendel, Daniela: Die kosmogonischen Inschriften in der Barkenkapelle des Chonstempels von Karnak, Monographies Reine Élisabeth; Band 9, Turnhout 2003.
Piankoff, Alexander: Mythological Papyri, Egyptian Religious Texts and Represen-tations 3, New York 1957.
Quack, Joachim Friedrich: Lokalressourcen oder Zentraltheologie? Zur Relevanz und Situierung geographisch strukturierter Mythologie im Alten Ägypten, in: Archiv für Religionsgeschichte 10 (2008), S. 5-29.
Roeder, Hubert: Auf den Flügeln des Thot: Der Kamm des Königs Wadj und seine Motive, Themen und Interpretationen in den Pyramidentexten, in: Wege öff-nen. Festschrift für Rolf Gundlach zum 65. Geburtstag, hg. von Mechthild Schade-Busch, Ägypten und Altes Testament, Band 35, Wiesbaden 1996, S. 232-252.
Sternberg-el Hotabi, Heike: Die Weltschöpfung in der Esna-Tradition, in: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments III/5, Gütersloh 1995, S. 1078-1087.
Verhoeven, Ursula: Ein historischer ‘Sitz im Leben’ für die Erzählung von Horus und Seth des Papyrus Chester Beatty I, in: Wege öffnen. Festschrift für Rolf Gundlach zum 65. Geburtstag, hg. von Mechthild Schade-Busch, Ägypten und Altes Testament, Band 35, Wiesbaden 1996, S. 347-363.
Zivie-Coche, Christiane: Fragments pour une théologie, in: Hommages à Jean Le-clant IV, Bibliothèque d’Études, Band 106/4, Kairo 1994, S. 417-427.