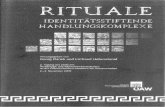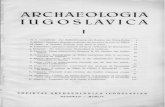„Das schöne Fest vom Wüstentale : Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen...
Transcript of „Das schöne Fest vom Wüstentale : Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen...
RITUALE –IDENTITÄTSSTIFTENDE HANDLUNGSKOMPLEXE
HERAUSGEGEBEN VON
GEORG DANEK UND IRMTRAUD HELLERSCHMID
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTENPHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
DENKSCHRIFTEN, 437. BAND
ORIGINES
SCHRIFTEN DES ZENTRUMS ARCHÄOLOGIE UND ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN
BAND 2
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTENPHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
DENKSCHRIFTEN, 437. BAND
RITUALE –IDENTITÄTSSTIFTENDE
HANDLUNGSKOMPLEXE2. TAGUNG DES ZENTRUMS ARCHÄOLOGIE UND ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN
AN DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 2./3. NOVEMBER 2009
HERAUSGEGEBEN VON
GEORG DANEK IRMTRAUD HELLERSCHMID
Vorgelegt von w. M. GEORG DANEK in der Sitzung am 21. Oktober 2011
Umschlaggestaltung: Maria Scherrer
Die verwendeten Papiersorten sind aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt, frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig.
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-7001-7127-0
Copyright © 2012 by Österreichische Akademie der Wissenschaften
WienRedaktion: Georg Danek
Tafellayout: Marion Frauenglas Satz und Textlayout: Maria Scherrer
Druck und Bindung: Prime Rate kft., Budapesthttp://hw.oeaw.ac.at/7127-0
http://verlag.oeaw.ac.at
5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Eva ALRAM-STERN
(Mykenische Kommission, ÖAW)Im Spannungsfeld der Ägäis: Grab, Ritual und Identität im frühminoischen Kreta . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Manfred BIETAK
(Kommission für Ägypten und Levante, ÖAW) Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole 23
Michaela LOCHNER
(Prähistorische Kommission, ÖAW)Bestattungsrituale auf Gräberfeldern der älteren Phase der mitteldonauländischen Urnenfelderkultur . 37
Alexandrine EIBNER
(Prähistorische Kommission, ÖAW)Die Situla von Kuffern. Zu Ritualen und identitätsstiftenden Handlungskomplexen in der Situlenkunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tina MITTERLECHNER – Agnes NORDMEYER
(Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik, Universität Wien) – (Institut für Kulturgeschichte der Antike, ÖAW)Das Bankett – ein zentrales Bildthema der antiken Sepulkralkunst dargestellt an den Fallbeispielen Etrurien und Lykien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Philipp SCHEIBELREITER
(Kommission für Antike Rechtsgeschichte, ÖAW)„Und zur Bekräftigung der Eide versenkten sie Metallklumpen im Meer“. Überlegungen zu einem Ritual der Vertragsbesicherung zwischen ewiger Bindung und Sympathiezauber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Petra AIGNER
(Kommission für Antike Literatur und Lateinische Tradition, ÖAW)Zum Maschalismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Eftychia STAVRIANOPOULOU
(Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik, Universität Heidelberg)Zwischen „Tradition“ und „Innovation“: Die Verschriftlichung von rituellen Praktiken … . . . . . . . . . . 123
Josef FISCHER
(Kleinasiatische Kommission, ÖAW)Herrscherverehrung im antiken Ephesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6
Ursula SCHACHINGER
(Numismatische Kommission, ÖAW)Die Sitte der Münzbeigabe in römerzeitlichen Gräbern am Beispiel der Gräberfelder von Lauriacum . 157
Norbert ZIMMERMANN
(Institut für Kulturgeschichte der Antike, ÖAW)Zur Deutung spätantiker Mahlszenen: Totenmahl im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Victoria ZIMMERL-PANAGL
(Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter, [CSEL], ÖAW)Die Totenreden und Epistula 25 des Ambrosius: Fragen zu Ritualen und Begräbnisumständen . . . . . . 187
Tafeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Inhaltsverzeichnis
23
M A N F R E D B I E T A K
(Kommission für Ägypten und Levante, ÖAW)
Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole1
Im Laufe der Grabungen der Universität Wien, später des Österreichischen Archäologischen Instituts Kairo im Zusammenwirken mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in der thebanischen Nekropole bei Luqsor (1969–1978)2, stießen wir immer wieder auf archäologische Relikte, die im Zusammenhang mit einem der bedeutendsten Nekropolenfeste des Alten Ägypten zu sehen sind, dem sogenannten „schönen Fest vom Wüstentale“3. Ich werde im Folgenden dieses Fest im Rahmen dieser Ausgrabungen zu kommentieren suchen, welche im Zentrum der Totenstadt der Reichshauptstadt Theben, im Vorgelände des Talkessels von Deir el-Bahari von 1969 bis 1978 vor sich gingen.
Das Fest dürfte zumindest auf König Nebhepetrec Mentuhotep II. (knapp vor 2000 v.Chr.) zurückgehen4, der in diesem einsamen Talkessel gegenüber von Theben seinen prächtigen Totentempel5 errichtet hatte (Fig. 1). Vermutlich besaß zu dieser Zeit bereits die kuhgestaltige Göttin Hathor eine Kultgrotte6, die man auf Grund von Artefaktfunden und der Platzkontinuität unter dem späteren Hathorheiligtum der Hatschepsut vermuten darf7. Es ist anzunehmen, dass diese Kultgrotte eine neue Ausgestaltung unter Mentuhotep II. erhalten hatte8.
Hathor tritt uns neben ihrer Rolle als Himmelsgöttin und mütterliche Schutzgöttin des Königs, als Göttin der Randberge9, als Patronin von entfernten Wüstenregionen wie Minen abseits vom Kulturland oder auf dem Sinai entgegen. In Theben hat diese Göttin jedoch die Rolle der Schutzherrin der Nekropole übernommen, die als solche im Randbereich des Lebens liegt. Ihre Ansiedlung in Theben dürfte von ihrem Hauptkultort in Dendera erfolgt sein10. Titel von Priesterinnen der Hathor von Dendera sind seit dem späten Alten Reich und vor allem aus der frühen 11. Dynastie im thebanischen Bereich bekannt11. Einen deutlicheren Hinweis
1 Diesen Aufsatz widme ich meinen ehemaligen Mitarbeitern in Theben West Josef Dorner, Elfriede Reiser-Haslauer, Heinz Satzin-ger und Helga Singer †. Für das Lesen des Manuskriptes und wichtige Hinweise bin ich Julia Budka und Claus Jurmann sehr zu ��������� ������������������������������������ ������������������������� ��������������������
2 Publiziert durch die Österreichische Akademie der Wissenschaften: Bietak 1972; Bietak/Reisner-Haslauer 1978; 1982; Budka 2010; Eigner 1984.
3 Foucard 1924; Schott 1953; Bietak/Reisner-Haslauer 1978, 19–29; Graefe 1986; Wiebach 1986. 4 Der Name in.t Nb-Hp.t-Ra „Tal des Nebhepetrec“ zur Zeit Hatschepsuts zeigt die enge Assoziation mit dem König in der Rück-
erinnerung. Vgl. Ullmann 2007, 8. Siehe auch die Zusammenfassung in Budka 2010, 29 Anm. 58. 5 Porter/Moss 1972, 381–400; Arnold 1974a; Arnold 1974b; Arnold 1979. 6 Der Umstand, dass der Tempel des Nebhepetrec nicht im Zentrum des Talkessels, sondern südlich verschoben errichtet wurde, ist
ein Hinweis, dass die Kultgrotte im ehemaligen Zentrum zu vermuten ist, bevor sie durch spätere Bauarbeiten unter Hatschepsut und Tuthmosis III. durch neue Kultbauten ersetzt wurde. Der wahrscheinlichste Platz dafür war die Region unter dem Hathor-heiligtum der Hatschepsut (vgl. Anm. 8).
7 Varille berichtete, dass ihm ein Antikenhändler Täfelchen einer Gründungsbeigabe gezeigt hätte, auf denen die Namen von Ha-thor und Mentuhotep aufschienen. Als Herkunft vermutete Varille Aufräumungsarbeiten im Bereich des Hathorheiligtums der Hatschepsut (s. Schott 1953, 5 Anm. 3).
8 S. vorige Anm. 9 Schott 1953, 5. 10 Sadek 1987, 49; Fischer 1968, 52–53. 11 Allam 1963, 58–62; Sadek 1987, 48f.; Galvin 1981, 12; Rzepka 2003; Budka 2010, 480 Anm. 2813; dazu jetzt auch Morenz 2009.
24 Manfred Bietak
auf einen lokalen Hathorkult erhält man aus der Tatsache, dass alle fünf im Tempelbezirk des Mentuhotep II. bestatteten Königsfrauen Hathorpriesterinnen waren12. Ein Relieffragment, heute im Museum Hannover (Han-nover 1935.200.82)13, zeigt den König in der Pose des aus dem Euter der Hathor-Kuh trinkenden göttlichen Sprosses – eine Szene, die aus dem Hathorheiligtum der Hatschepsut und von der Skulptur im Sanktuar des Hathor-Schreines Tuthmosis’ III. wohlbekannt ist (Fig. 2)14. Hathordarstellungen im Sanktuar des Tempels des Mentuhotep sind in wichtigen Kultszenen belegt15; so steht sie bei der Szene, in der Mentuhotep II. dem Schöpfergott Min-Amun gegenüber tritt, hinter dem König (Fig. 3)16. Hathor wird, soweit erhalten, als Herrin von Dendera bezeichnet17. Noch in der Zeit des Neuen Reiches wird Hathor mit dem Heiligtum des Nebhete-prec Mentuhotep II. assoziiert18.
Hathor spielte eine wichtige Rolle im sogenannten „schönen Feste vom Wüstentale“, in dessen Verlauf der Gott Amun von Theben von seinem Tempel in Karnak aus den Nil zum Westufer überquerte, um in feierlicher Prozession das Heiligtum der Hathor zu besuchen (Fig. 4–6). In der dem Fest vorangehenden Nacht verweilten Amunpriester der Totentempel des Königs Nebhepetrec Mentuhotep II. und des Secanchkarec Mentuhotep III. auf dem prominenten Berg El-Qurn („das Horn“), der ein pyramidenförmiges Aussehen hat und sich über dem Talkessel von Deir el-Bahari – dem Zielpunkt des Festzuges – erhebt. Die Priester hatten die Aufgabe, den Aufbruch der feierlichen Prozession im frühen Morgengrauen zu beobachten und hinterließen dabei ihre ����������!��������"����� ����#��$�����������%����&����19.
����%������ �������'����������������*+++<=&������#�� �� ����>������������ ���?���������$"������Geschehen wie die Ruderfahrt nach Westen und den Besuch der königlichen Totentempel sind wir vor allem aus Tempelinschriften und Tempelreliefs unterrichtet; über das private Geschehen, das sich vor allem in den Gräbern der Nekropole abspielt, geben die Wandbilder der Gräber Auskunft, wenngleich nur in einigen Fällen das Talfest in den Inschriften genannt wird20. In den meisten Fällen ist also der Bezug auf dieses Fest eine An-nahme von einiger Wahrscheinlichkeit. In manchen Fällen können andere Feste als Bezug nicht ausgeschlos-����������������������&�$�����������������������������������������@�������Y\���^���������&�����������Ramessidenzeit das weltliche z.T. ausgelassene Festgeschehen nicht mehr aufscheint und sich Bezüge auf das Talfest auf Rituale beschränken. Vieles am Festverlauf ist Deutung, und manches ist uns auch unverständlich geblieben wie das Verlöschen der Fackeln in Milch, nachdem Amun die zum Fest dazugehörende Nacht in seinem Sanktuar des Tempels der Hatschepsut verbracht hat21.
Ursprüngliches Ziel des Festzuges des Amun dürfte die Kultgrotte der Hathor am Ende des Wüstentales (heute Deir el-Bahari) gewesen sein. Einer späten Erwähnung in Diodor (1, 97, 9) im 1. Jh. v.Chr. dürfen wir entnehmen, dass jedes Jahr die Ägypter den Schrein des Zeus (Amun) über den Fluss nach Libyen (West-ufer) trugen. Die festliche Vereinigung der beiden Gottheiten wurde im Kult so gestaltet, dass die Priester die Schreine von Zeus und Hera (Amun und Hathor) auf eine mit Blumen bestreute Erhebung (wohl ein Podium) trugen22. Einige Tage später wurde die Gottheit (Zeus) wieder zurückgebracht. Wenngleich Theben nicht ge-nannt wird, bezieht sich diese Passage mit einer alljährlichen Schiffsfahrt in den Westen wohl auf das Talfest. Man könnte vermuten, dass es sich bei der geschilderten Kulthandlung um ein Fest handelte, das eine Hie-rogamie zum Gegenstand hatte. Es ist bei dem Bedeutungswandel, den das Fest in der Folgezeit mitmachte, bemerkenswert, dass man sich im 1. Jh. v.Chr. noch auf den ursprünglichen Zweck des jährlichen Ereignisses erinnert hatte. Ebenso ist bemerkenswert, dass das Prozessionsbild des Amun, soweit es gezeigt wird, den ithyphallischen Schöpfergott Min-Amun darstellte (Figs. 5–6). Besuche von Göttern sind im Alten Ägypten
12 Allam 1963, 62–64; Arnold 1974a, 83f. 13 Woldering 1958, 66, Taf. 27. 14 Porter/Moss 1972, 543 (u). 15 Arnold 1974b, Taf. 25, 26, 28, 44. 16 Arnold 1974b, Taf. 25, 26. 17 Arnold 1974b, Taf. 28. 18 Winlock 1947, 84; Allam 1963, 61. 19 Porter/Moss 1964, 668f. 20 Schott 1937, 7. 21 Schott 1937. 22 Der Umstand, dass das Zurückbringen der Hera (Hathor) nicht erwähnt wird, zeigt, dass diese am Zielort der Prozession zu Hause
war.
25 Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole
als Hintergrund von Tempelfesten insbesondere in der Spätzeit bekannt, so dass die Erwähnung bei Diodor durchaus glaubwürdig ist.
Dieter Arnold, der den Totentempel des Nebhepetrec Mentuhotep II. eingehend untersuchte, hat von der südlichen Außenwand des Sanktuars Relieffragmente zusammengefügt23, die zeigen, dass der König die Kult-barke des Gottes Amun von Theben über den Nil rudert24. Auch wenn nicht angegeben wird, aus welchem An-�����������%���������$������������ ������>��� ������ ������������_�"����"���!���������`�{%����|}��~����������die besondere Hinwendung des Königs zum Hathorkult bekannt25. Die Flussüberfahrt und die Kulthandlungen für Hathor sind zwei wesentliche Elemente des Talfestes.
Ab wann dieses Fest zu einem Nekropolenfest wurde, in dem Amun die Verstorbenen und die toten Könige in der Totenstadt besucht, kann man einigermaßen erklären. Wahrscheinlich vollzog sich dieser Wandel bereits unter der langen Regierungszeit des Nebhepetrec Mentuhotep II. Wenn man den Plan des „Wüstentales“, die Lage seines Totentempels mit integriertem tiefem Felsengrab und den Aufweg gemeinsam mit der Gruppie-rung der Gräber seiner Beamten betrachtet (Fig. 1), muss man zum Schluss kommen, dass die ganze Nekropole der 11. Dynastie in dieser Landschaft ein sinnvolles Ganzes darstellt. Die Gräber gruppieren sich einerseits in hoch gelegenen Galerien nördlich des Talkessels und in tiefen Lagen entlang des gesamten Aufwegs vom Fruchtland bis zum Bezirk des Totentempels. Die Gräber sind jedoch nicht auf den Totentempel des Herrschers ausgerichtet, sondern orientieren sich entweder nach Osten, dem Amuntempel zu, oder auf den Aufweg. Wenn ������ ������������&�����������������|+����������������������������������������������~����������-mauer im Norden und im Süden abgesichert war, so sieht man den Unterschied zu den engen und überdachten geschlossenen Aufwegen zu den Pyramiden des Alten Reiches. Dieser offene und breite Aufweg des Mentuho-tep hat ganz den Charakter einer Prozessionsstraße, die sich als Bühne eines Festzugs für das Talfest anbietet. Die Ausrichtung der Gräber auf die Prozessionsstraße und den Amuntempel am anderen Nilufer macht klar, dass die Inhaber der Gräber den Wunsch hatten, in aller Ewigkeit an diesem schönen Fest vom Wüstentale teilnehmen zu können. Unter diesem Gesichtspunkt werden das Fest und die Nekropole zu einem sinnvollen Organismus, der mit dem Jenseitsglauben der Ägypter erklärbar wird.
���������������������������� �����������������������������������������������������������'���-ziegeln als auch seinen gefestigten Kalkestrich und die beiden Einfassungsmauern anbelangt (Fig. 7). Ent-lang des Randes fanden sich in regelmäßigen Abständen Vermessungsmarken aus Kalkstein, mit deren Hilfe man Fluchten festhielt, andererseits die Steigung des Aufwegs unter Kontrolle hielt. Unmittelbar nördlich des Aufwegs wurden Gräber der 11. Dynastie freigelegt. Diese Gräber setzen sich in der deutschen Konzession westlich und der italienischen Konzession östlich unseres Untersuchungsbereichs fort (Fig. 1). Es gibt auch den Nachweis von Gräbern der 11. Dynastie südlich des Aufwegs, doch ist dieses Terrain nur wenig erforscht.
Einen weiteren Bezugspunkt zum Talfest könnte auch ein Totentempel im nächsten Tal weiter südlich von jenem des Mentuhotep II. gebildet haben, der von Herbert E. Winlock dem Secanchkarec Mentuhotep III.26, von Dorothea Arnold jedoch mit guter Argumentation dem Begründer der 12. Dynastie Amenemhet I. zugeschrie-ben wird27���� ��������!�������$������� �����~����������!������������������������������������������der vielleicht nie fertig gestellt wurde, zugänglich. Die Ebene dieses Aufwegs wird heute in Analogie zu dem nördlichen Aufwegsbereich nach Deir el-Bahari als das südliche Asasif bezeichnet. Die Bedeutung dieser südlichen Anlage für das Talfest wird einem erst aus der Situation von Totentempeln/„Häusern der Millionen Jahre“ der Hatschepsut28, Amenophis’ II.29 und vor allem Ramses’ II.30 nahe der Einmündung des südlichen
23 Arnold 1974b, Taf. 22, 23. 24 Die Annahme des Ruderns ist bei einer Nilüberquerung realistischer als Stagen. Leider ist das Relief im Bereich des mutmaßlichen
Ruderblattes nicht erhalten, doch gibt es eine Parallele aus der Zeit Sesostris’ I., die ein Ruderblatt statt einer Stagstange zeigt: Gabolde 1998, Taf. IX. Ebenso ist Tuthmosis III. beim Übersetzen der Kultbarke des Amun rudernd dargestellt (Bourgos/Larché sous Grimal 2006, 113)
25 Allam 1943, 1, 15, 39, 47f., 59–75, 97; Gestermann 1984; neuerdings Morenz 2009. 26 Porter/Moss 1972, 340; 27 Do. Arnold 1991. 28 Ullmann 2002, 53–59. 29 Porter/Moss 1972, 429–431; Der Manuelian 1987, 268. 30 Porter/Moss 1972, 431–443; Ullmann 2002, 339f.
26 Manfred Bietak
Aufwegs offensichtlich. Ebenso ist auf die Häufung der Spätzeitgräber sowohl nahe des nördlichen als auch des südlichen Aufwegs hinzuweisen31.
Für die Folgezeit nimmt man an, dass das Talfest in seiner Bedeutung abgenommen hatte, da die 12. Dy-nastie in den memphitischen Bereich nach Norden übersiedelte und mit Itji-tauwi, nahe dem Fayumeingang, eine neue Residenz begründete. Es ist jedoch in diesem Zusammenhang auf Statuen von Sesostris III., die den König betend zeigen und im Bezirk des Mentuhoteptempels aufgestellt waren, hinzuweisen32. Diese Statuen sollten wohl nicht nur eine Verbundenheit mit dem Reichseiniger Mentuhotep II. bekunden, sondern die ewige Präsenz des Königs Sesostris III. beim Talfest sicherstellen.
Die 18. Dynastie, die das Neue Reich von Theben aus begründete und sich hier auch samt ihrer Beamten-schaft bestatten ließ, verursachte ein Aufblühen des Talfestes. Amenophis I. errichtete einen Schlammziegel-tempel nördlich des Mentuhotep-Bezirkes der 11. Dynastie, der durch die Arbeiten für den Hatschepsuttempel überbaut wurde33. Ob es sich dabei um einen Totentempel oder um eine Barkenstation für das Talfest handelte, ������ ������� �����%���������������������� ���������������������������������������$�����������-nigs aus Sandstein und die Nähe zum Grab seiner Gemahlin Merit-Amun nördlich des Hatschepsut-Tempels34. Es wurden auch noch Gräber der Schwestern des Königs in dieser Umgebung vermutet35. Die Lage des Grabes des Königs selbst ist noch ungeklärt.
Es waren aber vor allem Hatschepsut (c. 1479–1457 v.Chr.) und Tuthmosis III. (c. 1479–1425 v.Chr.), die dem Nekropolenfest einen neuen glanzvollen Rahmen bereiteten (Fig. 8). Dazu gehörte der berühmt gewor-dene terrassenförmig angelegte Totentempel der Königin nördlich des Mentuhoteptempels36. Er erhielt den eindrucksvollen programmatischen Namen „Der große Tempel von Millionen Jahren, der Tempel des Amun Djeser-djeseru (= der Allerheiligste)���������������� �������������������������. Sinngemäß bedeutet das, dass es sich um einen Totentempel und zur gleichen Zeit um einen Amuntempel an einer Urstätte handelt. Die Grabanlage der Königin befand sich nicht mehr im hinteren Bereich des Totentempels wie bei Mentuhotep II., sondern hinter dem Talkessel von Deir el-Bahari auf der anderen Seite des Gebirgsmassivs im Tal der Könige. Der Bezug bzw. die Zusammengehörigkeit zwischen Tempel und Grab waren aber bei Hatschepsut wohl noch angedacht. Später errichtete man die Totentempel in der unteren Wüstenebene am Rande des Fruchtlandes, womit sie von den Bestattungsanlagen der Könige weit entfernt lagen.
Zu den weiteren Anlagen der Hatschepsut, die in Beziehung zum Talfest standen, zählte vor allem der 2000 Ellen (1050 m) lange Aufweg, der von einem Taltempel zum Totentempel hinaufführte und in seiner Mitte mit einem Stationsheiligtum ausgestattet war. Der bereits genannte Totentempel war ein sogenanntes „Haus der Millionen Jahre“37. Diese Art von Heiligtümern, die im Anfangsstadium bereits durch Mentuhotep II. ge-schaffen wurden, waren eigentlich Amun gewidmet, der die Nekropole besuchte und hier daher einen Schrein benötigte. Tatsächlich war das wuchtige Hauptsanktuar westlich des Hofes der obersten Terrasse der Schrein, der Amun während seines Besuches anlässlich des Talfestes beherbergte. Das ursprüngliche Ziel des Festzu-ges, die Göttin Hathor als Schutzherrin der Nekropole, wurde jedoch nicht vergessen. Sie erhielt südlich des Terrassentempels der Königin einen neuen Tempel, der mit einer eigenen Aufgangsrampe ausgestattet war.
Um ihren Tempelkomplex samt Aufweg umsetzen zu können, musste die Königin halbe Berge entfernen, den Talkessel von Deir el-Bahari nach Norden erweitern. Für die Terrassierung des Aufwegs in Richtung Tal-tempel und letztlich in Richtung Amuntempel am anderen Ufer musste eine über 40 m breite Schneise durch das Wüstengebirge geschlagen werden38. Dadurch zerstörte man viele Gräber der Nekropole der 11. Dynastie, welche sich nördlich des Aufwegs des Nebheteprec Mentuhotep II. befanden.
Diese Arbeiten wurden neben einem gewaltigen Bauprogramm der Königin, das sich nicht nur auf The-ben konzentrierte, sondern mehrere Bereiche des Landes und auch Nubien erfasste, geleistet. Dass es die
31 S.u. 32 Porter/Moss 1972, 384f. 33 Porter/Moss 1972, 343; Arnold 1979, Taf. 42; Dodson 1989/90, 43. 34 Porter/Moss 1960, Teil 1, 421 (TT 358). 35 Dodson 1989/90. 36 Porter/Moss 1972, 340–377; zum Sonnenkult dieses Tempels s. Karkowski 2003. 37 Zur Funktion Arnold 1962; 1978; Haeny 1994; Ullmann 2002, 661–670, 674–676 und zuletzt Schröder 2010. 38 Bietak 1972, 11; Bietak/Reisner-Haslauer 1998, 26.
27 Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole
Königin war, die hinter der Restauration des Talfestes stand, wird man gewahr, wenn man ihre Bauarbeiten im Amuntempel von Karnak betrachtet. Hier setzte sie vor den Tempel des Mittleren Reiches, der bis dahin die Kultstatue des Amun beherbergte und als Hauptheiligtum diente, einen neuen modernen Tempeltyp, der fortan Modellwirkung haben sollte, indem sie das für die Festprozessionen so wichtige Barkensanktuar (die „Cha-pelle rouge“)39, das bisher als erstes Stationsheiligtum vor dem Tempel stand, zentral in das Heiligtum einbe-zog. Damit war der Ausgangspunkt des Talfestes und das Gegenstück zum Barkensanktuar in Deir el-Bahari geschaffen worden, wobei die beiden Gegenpole architektonisch verschieden gestaltet worden waren. Ebenso �������������������������������������������������������������������������������"�����$������� ������der südlichen Außenwand der Chapelle rouge40, während sich die Darstellungen des Talfestes topographisch ��������������������� ������`����������������������$����41.
Aus der Herrschaft der Hatschepsut hat man den frühesten Nachweis eines anderen großen Festes in The-ben, des bereits genannten Opet-Festes42. Dieses war ebenfalls ein kalendarisch festgelegtes Prozessionsfest, in dem Amun aus seinem Tempel von Karnak auszog und auf einer Nilbarke zum Luqsortempel – dem Opettem-pel (Ip.t-rsi.t) – getreidelt wurde, um dort die Erneuerung des für die Erhaltung des Königtums so wichtigen königlichen Ka (Lebenskraft) zu zelebrieren43. Sehr wahrscheinlich war trotz der Bedenken von Siegfried Schott und Hellmut Brunner44 auch bei diesem Fest Hierogamie im Spiel, um die göttliche Herkunft des Kö-nigs als virtuelles Geschehen in Form der berühmten Geburtsszenen festzuhalten45. Die besterhaltene Version ��$������� �����'���������������������������46, doch haben wir ein Gegenstück in dem Wandprogramm des Tempels der Hatschepsut in Deir el-Bahari47.
Zu der Zeit von Hatschepsut erfolgte die Prozession nach Luqsor zu Lande und der Rückweg zu Wasser. Der Opettempel der Hatschepsut ist nicht mehr erhalten. Er ist dem Luqsortempel von Amenophis III. zum Op-fer gefallen48. Es existiert jedoch noch vor dem Luqsortempel ein in der Zeit Ramses II. versetztes Stationshei-ligtum aus der Zeit Hatschepsuts und Tuthmosis’ III.49. Außerdem besitzen wir den schriftlichen und bildlichen Nachweis und Abbildungen in versenktem Relief von sechs Wegstationen zwischen Karnak und Luqsor, die für die sichere Beherbergung des Kultbildes des Amun während des Umzugs sorgten50. Vom Luqsor-Tempel aus wurde auch eine zweite Achse zum südlichen Asasif und zum ehemaligen Totentempel Amenemhets I. {�������������������������������$"���}51 angedacht, an dessen östlicher Aufwegsmündung die Königin ein weiteres Millionenjahrhaus als Stationsheiligtum für diesen südlichen Prozessionsweg für das Talfest errichten ließ52.
Diese Feste boten der jungen Königin die Gelegenheit, ihren nicht ganz gefestigten Herrschaftsanspruch entlang der ausgebauten Prozessionsstraßen durch kultische Selbstinszenierung populär zu machen53. Sie ent-stammte als einzige der Hauptlinie der Dynastie, direkt von der Hauptgemahlin Tuthmosis’ I., der Gottesge-mahlin Ahmose, die allein Trägerin des reinen königlichen Blutes war. Hatschepsuts Halbbruder und Gemahl Tuthmosis II. ebenso wie dessen Sohn Tuthmosis III. entsprossen hingegen nichtköniglichen Nebengemah-
39 Porter/Moss 1972, 98–102; Bourgos/Larché sous Grimal 2006. 40 Bourgos/Larché sous Grimal 2006, 43–53, 59–65. 41 Bourgos/Larché sous Grimal 2006, 95–99, 108–114. 42 Wolf 1931; Murnane 1982; OIC Epigraphic Survey 1994. 43 Bell 1985; Waitkus 2008, 223–267. 44 Brunner 1977, 10–12. 45 So auch Bleeker 1967, 137–139. Siehe auch Waitkus 2008, 223–267. 46 Brunner 1964, 6–7, Taf. I–XVI; Porter/Moss 1972, 326–328; Murnane 1982, 576. 47 Porter/Moss 1972, 384 (17); Brunner 1964, 3–5. 48 Porter/Moss 1972, 301–339; Waitkus 2008. 49 Porter/Moss 1972, 309f, Plan XXVIII. 50 Bourgos/Larché, sous Grimal 2006, 43–53, 59–65. 51 S.o. Anm. 27. 52 S.o. Anm. 28–30. ����� ����'����������������� ���������������� ���������� �������������������$�������������������������
ersten Hof des Luqsortempels einen Nebenausgang zu einem Nilkai gestaltete und gegenüber am Westufer seinen Totentempel, das Ramsesseum errichten ließ. Dass diese Tempel zusammen gehören wird durch die Parallelität der Namen Hnm.t nhh (Luqsor) und Hnm.t WAs.t (Ramsesseum) zum Ausdruck gebracht (Stadelmann 1978, 178f.).
53 Zu den Prozessionsstraßen als Bühne für kultische Selbstinszenierung von Hatschepsut siehe F. Arnold 2004; Baines 2006, 286f. Allgemein zu Prozessionsstraßen: Cabrol 2001.
28 Manfred Bietak
linnen.54 Es ist zu vermuten, dass dieser Umstand das weitere Vorgehen der Hatschepsut prägte. Als Regentin für ihren noch minderjährigen Neffen Tuthmosis III. beanspruchte sie schließlich in einer außergewöhnlichen Initiative die Pharaonenwürde für sich, ohne ihren Neffen abzusetzen. Sie regierte weitgehend unumschränkt, bezog jedoch nach Reliefs zu schließen Tuthmosis III. in die kultischen Handlungen mit ein55.
Abgesehen von ihrer umfangreichen Bautätigkeit im Tale von Deir el-Bahari, in Karnak und in Luqsor erneuerte sie auf dem Westufer bei Medinet Habu einen Tempel der späten 11. Dynastie, der an einem Ur-hügelheiligtum für die acht Urgötter von Theben gelegen war56. Dieses Heiligtum wurde von Tuthmosis III. vollendet und stellt gleichzeitig den Endpunkt des Dekadenfestes dar, zu dem man vom Luqsortempel mit dem Kultbild des Amun in seiner Eigenschaft als Schöpfergott alle 10 Tage über den Nil setzte. Dieses Ritual diente der Erneuerung des Gottes durch seine Vereinigung mit den acht Urgöttern und seiner eigenen Urform57.
Es war vor allem Hatschepsut, die die neuen Bühnen für die thebanischen Tempelfeste schuf, wobei auf die Ost-West Achsen Karnak – nördliches Asasif – Deir el Bahari und Luqsor Tempel – südliches Asasif sowie Luqsor Tempel – Medinet Habu hinzuweisen ist. Diese Ost-West-Achsen prägten neben der Nord-Süd Achse Karnak – Luqsor die Topographie der Stadt Theben nachhaltig (Fig. 9)58 und banden das kultische Geschehen in den Sonnenlauf ein. Damit stellen sie die involvierten Tempel und Prozessionswege ins Zentrum des solaren religiösen Geschehens, das mit der täglichen Wiederauferstehung und Erneuerung des Sonnengottes symbol-haft verbunden ist.
Abgesehen vom Sinn der religiösen Feste war die Prozession der Götterbarke des Amun-Rec und später in seinem Gefolge die der Götterbarken der anderen Mitglieder der Triade von Theben Mut und Chons sowie Amaunet die Gelegenheit fürs Volk, den in den Tempel verborgenen Götterbildern näher zu kommen, wenn sie vorbei getragen wurden. Bitten an Amun konnten z.B. auf Ostraka59 niedergeschrieben und auf dem Pro-zessionsweg vergraben werden, damit die Gottheit diese zur Kenntnis nehmen konnte. Ab Hatschepsut wurde bewusst die Volksfrömmigkeit gefördert, möglicherweise um die Königin populär zu machen. Aus diesem Grunde müssen wir sie in erster Linie als Initiatorin für die gesteigerte Bedeutung des „schönen Festes vom >�����������������$"���������������������!������������������ ��������������������������%�� ��������������������������&��"��$��������������������������%����"�������"�������������������!��������#����-������������ ��������$��������!�������������"��������������&������������{%����Y+}������������������Festdarstellung auf dem Barkennaos der Königin in Karnak wurde bereits hingewiesen.
Tuthmosis III., der Koregent und Nachfolger von Hatschepsut, setzte mit gleicher Hingabe wie seine Tante bedeutende architektonische Akzente für das „schöne Fest vom Wüstentale“. Sein Haus der Millionen Jahre/seinen Totentempel ließ er zwischen den Einmündungen des nördlichen und des südlichen Asasif erbauen60. Dieser Tempel bildete den Schrein für Amun während des Talfestes und hatte auch einen Hathorschrein an ��������������������������~����������������������������������!���������"������������������������������-zessionsstraße nach Deir el-Bahari als auch dem zweiten Prozessionsweg durch das südliche Asasif dienen. In seiner späten Regierungszeit errichtete Tuthmosis III. jedoch in Deir el-Bahri zwischen dem Mentuhoteptem-pel und dem Hatschepsuttempel – höher als die Tempel seiner beiden Vorgänger im Tal – ein weiteres Haus der Millionen Jahre mit dem Namen ��������� �, das Amun-Rec zur Beherbergung während des Talfestes gewid-met war61. Ebenso erbaute er ein eigenes Hathorheiligtum, das unter seinem Sohn Amenophis II. als Zielpunkt des Festes fertiggestellt worden war62.
Dieser neue Tempel ��������� � war über einen eigenen breiten offenen Aufweg, der vom Fruchtland hinauf führte, zugänglich63. Wie bei Hatschepsut waren die Vormauern dieses Aufwegs aus glattgeschliffenem
54 Wente 1980, 129–131; Roehrig (Hg.) 2005, 7, 87–90. 55 Bourgos/Larché sous Grimal 2006, z.B. 47,51, 52, 57, 58, 60–62, 69, 71, 98, 99, 103, 105, 111,113, 114, 117, 118, 120, 140–143, 150,
152, 155, 167, 170–172, etc. 56 Porter/Moss 1972, 466–474; OIC Epigraphic Survey 2009. 57 Sethe 1929; Cooney 2000, 34–37; Ullmann 2007, 9f. 58 Zu innovativen kultischen und politischen Aktivitäten der Königin Hatschepsut s. Callender 2002. 59 Posener 1975. Auf diese Interpretation machte mich Orly Goldwasser (Hebräische Universität Jerusalem) aufmerksam. 60 Porter/Moss 1972, 426–429; Ullmann 2002, 84–87. 61 Porter/Moss 1972, 377–381; Lipinska 1977; 1984; 2005. Zu den hieratischen Besucherinschriften im Tempel s. Marciniak 1974. 62 Porter/Moss 1972, 380f.; Der Manuelian 1987, 264. 63 Zu den Phasen des Aufwegs s. Budka 2009, 179–203.
29 Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole
weißen Kalkstein gesetzt (Fig. 11)64. Im unteren Bereich des Aufweges fanden sich die Relikte von bis zu 10 m tiefen Baumgruben, die von der Expedition des Metropolitan Museum und der österreichischen Grabung erfasst wurden (Fig. 12)65. Da die westlichsten Gruben erst im Stadium des Ausmeißelns, die anderen jedoch bereits mit Nilerde gefüllt und mit Setzlingen versehen waren, wie zarte Wurzelreste zeigen, scheint es, als ob diese Allee erst in den letzten Regierungsjahren dieses großen Königs angelegt worden war. Nach seinem Tode ließ man das Projekt sofort fallen, ja man bewässerte selbst die Alleebäume nicht mehr66.
Der Aufweg Tuthmosis’ III. war parallel zu jenem des Nebhepetrc Mentuhotep II. angelegt worden, wobei ��������� ���~�������������������"����"��#������������������������"�������$�������������������������der ebenfalls als Prozessionsstraße für das Talfest anzusehen ist, einen gleichmäßigen Gradienten zu erhal-ten, mussten in seiner östlichen Hälfte Teile des anstehenden Wüstengebirges abgemeißelt werden. Diesen ��`�������$����������������������������������������������� ��������������#&������YY���^������<Nekropole zum Opfer (Fig. 12).
����������������YY���^�������$�������������������������#&������@��������!���������������������&���der Aufwege der Hatschepsut und Tuthmosis’ III. Diese liegen vor allem am Nordhang von El-Chocha den Aufwegen zugewandt (Fig. 13)67. Es scheint, als ob eine mit der Nekropole der 11. Dynastie vergleichbare Entwicklung eingesetzt hatte, die jedoch aus einem unbekannten Grund zum Stillstand kam. In der Folgezeit liegen die meisten Gräber auf den östlichen Abhängen der Anhöhe von Scheich cAbd el-Qurna südlich des heiligen Tales und zwischen dem nördlichen und dem südlichen Asasif68. Die meisten Grabanlagen waren mit Blickrichtung auf den Amuntempel in Karnak angelegt worden. Das Bildprogramm dieser Gräber mit weltlichen Motiven wie festlichen Banketten und Tanz sowie mit Opferdarstellungen wie Blumenspenden und Brandopferdarstellungen kann in Bezug auf den Verlauf des Talfestes als sehr aufschlussreich angesehen wer-den, wenngleich der Anlass dieser Festlichkeit meist nicht direkt erwähnt ist69. Sollten diese Szenen sich auf das Talfest beziehen, dann könnte man vermuten, dass die Familien von Theben möglicherweise bereits vor Beginn, vielleicht schon am Vortag der Festprozession des Amun-Rec über den Nil setzten und den Festtag und die darauf folgende Nacht in den Familiengräbern verbrachten. Vermutlich hatte man vor den Gräbern bunte Festzelte aufgestellt, die sich im Deckendekor der Grabkapelle widerspiegeln.
Der Festtag wurde mit einem Brandopfer für Amun-Rec begonnen, es folgten Speiseopfer70. Ob dieses Op-fer vor der Beteiligung am Festzug erfolgt ist, muss dahingestellt bleiben. Sehr wahrscheinlich brachte man jedoch das Brandopfer vor dem Grabeingang dar, da diese Darstellung meist in der Nähe des Einganges in die #���������"��$��������������������������������������������� ���� ������%���"�������������������lange Stabsträuße gereicht, die man bei der Prozession mitgeführt hatte. Inwieweit die Priester und Sistren-rasselnde Hathor-Priesterinnen71�����#&������� ������������������������������������$������� ������_����zur virtuellen Wirklichkeit wurden, lässt sich nicht sagen. Es ist zu vermuten, dass das Reichen der Blumen praktischerweise von den Familien vorgenommen wurde. Die Zeit danach wurde mit Festmählern, Musik, Gesang und Tanzvorführungen verbracht (Fig. 14).
Diese Bankette standen im Zeichen der Hathor, „der Herrin der Trunkenheit“. Tatsächlich scheint man sich berauschenden Getränken im Übermaß hingegeben zu haben. Wanddarstellungen der 18. Dynastie, die ein sehr weltlich orientiertes Festgeschehen zeichneten, zeigen bisweilen Betrunkene, die stocksteif weggetragen wurden, während manche vornehme Dame und manch vornehmer Herr der Gesellschaft sich während des Festmahls unter Mithilfe dienstbarer Geister übergeben musste (Fig. 15)72. Der Sinn dieser Bankette war wohl, dass die bestatteten Familienmitglieder im Geiste mit ihrer lebenden Familie vereint waren und an diesen Fest-lichkeiten teilnehmen konnten. Die Darstellungen des Bankettes machen es zu einer virtuellen Wirklichkeit,
64 Bietak 1972, 16f., Abb. 1. 65 Winlock 1942, 9–13; Bietak 1972, 17, Abb. 1; Budka 2010, 45, Abb. 3. 66 Bietak 1972, 16f.. 67 Bietak/Reisner-Haslauer 1982, 234, Abb. 112 A. 68 Bietak/Reisner-Haslauer 1982, 234, Abb. 112 A. 69 Schott 1953, 7. 70 Schott 1953, 5–9. 71 Schott 1953, 44f. 72 Schott 1953, 76–78, Taf. XI.
30 Manfred Bietak
auch für den Fall, dass die Familie nicht mehr zu den Gräbern kommt und diese verlassen sind. Die Festpro-zession des Amun-Rec hingegen ist in den Wanddarstellungen der Tempel festgehalten.
Die Wandbilder über das Talfest in den Gräbern der 19. und 20. Dynastie werden zunehmend nüchterner und beschränken sich mehr auf kultische Handlungen und religiöse Inhalte. Es war üblich geworden, bei religiösen Festen Bilder verstorbener Könige, insbesondere der Schutzpatrone der Nekropole Amenophis I. und dessen Mutter Ahmose Nofretari, bei Prozessionen mitzutragen. Ebenso gab es Prozessionsstatuetten von Privatleuten.
Ramses IV. errichtete am östlichen Ende der Aufwege des Mentuhotep II. und des Tuthmosis III. einen gewaltigen Tempel, der etwa die Ausmaße von Medinet Habu einnehmen sollte. Dazu wurde eine Fundament-wanne von c. 240 × 60 m aus dem anstehenden Wüstengebirge herausgemeißelt und mit reinem Sand gefüllt. Unter den Sanktuaren war die Tiefe des Fundamentbettes doppelt so tief. Am Westende musste infolge des abfallenden Untergrundes aufgeschüttet werden. Die Relikte des Tempels wurden von Grabungen des Metro-politan Museum unter Ambrose Lansing und Herbert E. Winlock und der Universität Wien erfasst73. Der Tem-pel dürfte Blöcken mit den Namen Ramses’ V. und des VI. zufolge erst in deren Regierungszeit fertig gestellt worden sein, sofern das Bauwerk je vollendet wurde. Die Mauerrelikte, die man als „ghost walls“ bezeichnen kann, zeigen Spolienblöcke aus Kalkstein, die noch Reliefs aus der Zeit von Hatschepsut und Tuthmosis III. sowie Ramses’ II. trugen. Sie stammen ursprünglich wohl vom Taltempel der Hatschepsut oder den Millio-nenjahrhäusern Hatschepsuts und Tuth mo sis’ III. südlich des Asasif sowie möglicherweise vom nördlichen Nebenbau des Ramesseums.
Die Lage des Tempels lässt darauf schließen, dass in der 20. Dynastie der Aufweg der Hatschepsut die Pro-zessionsstraße für das Talfest geblieben ist. Wie aus Tintenaufschriften auf Amphoren der Gründungsdepots dieses Tempels74 hervorgeht, stammt der Wein aus einem Weingut des „Hauses der Millionen Jahre“ Ram-ses’ IV.75. Es ist daher aus diesem Grunde und letztlich infolge der Nähe zur Prozessionsstraße der Hatschep-sut zu vermuten, dass es sich bei diesem Tempel um ein „Haus der Millionen Jahre“ Ramses’ IV. handelte76. Letztlich waren alle Totentempel in Theben-West die Schreine für den besuchenden Gott Amun-Rec während des Talfestes.
In der späten 20. Dynastie scheinen die Tempel des Nebhepetrec Mentuhotep II. und des Tuthmosis III. in Deir el-Bahari weitgehend durch Steinfall vom Bergmassiv her und durch Abbruch für Baumaterial zerstört worden zu sein. Dennoch wurde dieses Ruinengelände, vor allem die Schutthalden unterhalb dieser Tempel, als heiliger Grund in Ehren gehalten und von Month-Priestern als Begräbnisstätte benutzt77. Offensichtlich wollte man dem Zentrum des heiligen Tales möglichst nahe sein. Das Kultgeschehen dürfte vor allem über den ehemaligen Hatschepsuttempel mit angeschlossenem Hathorheiligtum gelaufen sein, da der Aufweg der Königin und offensichtlich auch ihr Tempel unversehrt geblieben sind.
Es waren schließlich die Kuschiten aus dem Sudan (25. Dynastie), die Ägypten um c. 733 v.Chr. eroberten78 und von einer Subkultur aus eine Besinnung auf alte Werte mit sich brachten. In einer Art “Renaissance“, die allumfassend und sehr innovativ war, suchte man an die Wurzeln des Uranfanges des Alten Ägyptens zurück-zukehren, um dort Kraft zu schöpfen79. So suchte man auch in Theben an den ursprünglichen Zielpunkt des heiligen Tales von Deir el-Bahari, aber auch zum weiter südlich gelegenen Tal, das als Aufweg zum Totentem-pel des Königs Secanchkarec Mentuhotep III. oder nach neuer Forschung des Amenemhet I. diente80, zurück-
73 Lansing 1935; Winlock 1942, 9–13; Bietak 1972, 17–26, pls. IXc–XIII; Budka 2001; Budka 2010, 48–60; Ullmann 2002, 524–542. 74 Bietak 1972, 19, Taf. IXc; Satzinger 1979, 95–114; Budka 2001, 54–57. 75 Bietak 1972, 19, Taf. IXc; Satzinger 1979, 95–114; Budka 2001; Ullmann 2002, 524–542. 76 S. dagegen Ullmann 2002, 530–536, die auf Grund der Belegschronologie des Tempels meint, dass diese Funktion der südliche
und kleinere Tempel Ramses’ IV. beim Tempel des Aya und Haremhab im Bereich von Medinet Habu innehatte. S. die ausführliche ������������������������������������_�����*+Y+������+������������� ���=��� ���� �������������������$"�������������������-pels Ramses’ IV. als Millionenjahrhaus. Wie wir sahen, besaßen mehrere Könige zumindestens zwei Häuser der Millionen Jahre auf dem Westufer, so vor allem Hatschepsut und Tuthmosis III.
77 Porter/Moss 1964, Teil II, 628–630. 78 Jansen-Winkeln 2006, 262f. 79 Zum Archaismus der Spätzeit s. Brunner 1970, 151–160; Eigner 1984, 17f.; Der Manuelian 1994; zu einem anderen Interpretations-
versuch s. Neureiter 1994. Allgemein über Archaismus: Kahl 2010. 80 S.o. Anm. 27.
31 Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole
zukehren81. Ohne Zweifel ist damals das Talfest wieder eingeführt worden. Als Prozessionsstraße diente der weitgehend intakt gebliebene Aufweg der Hatschepsut. Die Nekropole der Noblen dieser Dynastie gruppierte sich südlich der Prozessionsstraße und wurde in der folgenden 26. Dynastie, die Sais entstammte und den Gottesststaat Theben in ihre Abhängigkeit bringen konnte, fortgesetzt. Der Bezug der Gräber zur Prozessions-straße wird vor allem bei den Gräbern des Stadtgouverneurs und 4. Propheten des Amun Monthemhet (Grab Nr. TT 34) und des obersten Vorlesepriesters Petamenophis (TT 33), der Obersthofmeister der Gottesgemahlin-nen des Amun Pabasa (TT 279), Padihorresnet (TT 296) und Padineith (TT 197) aus der 26. Dynastie offenbar (Fig. 16). Die Achsen zwischen den Schlammziegelpylonen der Oberbauten der Gräber schneiden sich ca. 75 m vor dem Stationsheiligtum in der Mitte des Aufwegs an einem Punkt82, wo die Prozessionsbarken von Karnak kommend das erste Mal von den genannten Gräbern aus sichtbar wurden83. Die ebenfalls mit Pylonen versehenen Abgänge in die unterirdischen Anlagen der Gräber des Monthemhet und des Padineith beginnen am Südrand der Prozessionsstrasse der Hatschepsut. Abgesehen von diesen topographisch sehr deutlichen Hin-weisen eines Zusammenhanges der Spätzeitgräber und der Prozessionstrasse gibt es auch Darstellungen von �"�������������!��������������������#&����������������� �������&�$����������������_������84, das der #���������� �����������������������`�����$���������������#&��������cAnch-Hor, des Monthemhet und des Pabasa wieder das Reichen von Stabsträußen85. Alle diese Themen sind aus Gräbern der 18. Dynastie kopiert worden. Da die Totentempel des Neuen Reiches wohl nicht mehr in Betrieb waren, kann der Zielpunkt ���������������������!����������������������"����������`��������� ������������������������������in Deir el-Bahari gewesen sein.
Im Sinne einer Rückkehr an den Uranfang hat es auch weitere Grabagglomerationen der Spätzeit im südli-chen Asasif mit monumentalen Gräbern der 25. und 26. Dynastie86 und bei Medinet Habu, dem südlichen reli-giösen Zentrum von Theben-West gegeben (Fig. 17). Entlang der Prozessionsstraße zum Tempel Ramses’ III. liegen die Kapellen und Bestattungsanlagen der Gottesgemahlinnen des Amun der 25. und der 26. Dynastie87. Auch wenn diese nicht entlang des Zuwegs zum Tempel der 18. Dynastie nahe des Urhügelheiligtums lagen, so zeigen doch die Grabbauten der 25. und 26. Dynastie durch ihre Nähe zu diesem Heiligtum, dass man sich der einstigen Bedeutung dieses Platzes bewusst war. Man bevorzugte die Lage entlang der Prozessionsstraße zum Millionenjahrhaus Ramses’ III. weil es noch als großes Verwaltungszentrum und großes Millionenjahrhaus der 20. Dynastie in deutlicher Erinnerung geblieben war.
Das Talfest lebte bis zum Ende der Ptolemäerzeit und bis in die Römerzeit weiter, wie aus der bereits zitier-ten Passage des Diodor (1, 97, 9) und einer Reihe weiterer griechischer Textstellen88 und dem Leidener Toten-papyrus T 32.289 hervorgeht. Neben anderen Festen in Theben war es ein Fest, das vor allem den Verstorbenen gewidmet war und durch seinen fröhlichen Charakter zu einer Einrichtung wurde, die die Trauer überwinden half und eine feste Verbindung zwischen Lebenden und Toten herstellte. Es war ein Fest, das die Könige mit dem Volke vereinte.
LITERATUR
Allam, S.1963 Beiträge zum Hathorkult, Münchner Ägyptologische Studien 4, BerlinArnold, D.1962 Wandrelief und Raumfunktion in ägyptischen Tempeln des Neuen Reiches, Münchner Ägyptologische Studien 2, Berlin
81 Eigner 1984, 28–34, Abb. 2. 82 Bietak/Reisner-Haslauer 1978, Abb. 1. 83 Graefe 1986, 188. 84 Bietak/Reisner-Haslauer 1978, 138, Plan 32; Bietak/Reisner-Haslauer 1982, Taf. 77f.; Kuhlmann/Schenkel 1983, Taf. 19; Eigner
1984, Taf. 2, 18D; vgl. Schott 1953, 12–23. 85 Bietak/Reisner-Haslauer 1978, 101, Abb. 24, Plan 15; Bietak/Reisner-Haslauer 1982, Taf. 38–40, 79/C; Kuhlmann/Schenkel 1983,
Taf. 16a, 44, 47, 61; Eigner 1984; vgl. Schott 1953, 48–63. 86 Pischikova 2009. 87 Porter/Moss 1964, Teil 2, 772–774. 88 Foucart 1924, 9–43. 89 Schott 1953, 96.
32 Manfred Bietak
Arnold, D.1971 Grabung im Asasif 1963–1970, Bd. I. Das Grab des Jnj-jtj.f. Die Architektur, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung
Kairo, Archäologische Veröffentlichungen 4, Mainz1974a Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir el-Bahari. Band 1, Architektur und Deutung, Deutsches Archäologisches
Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröffentlichungen 8, Mainz1974b Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir el-Bahari, Band 11, Die Wandreliefs des Sanktuares, Deutsches Archäologi-
sches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröffentlichungen 11, Mainz1975 „Deir el-Bahari II“, in: W. Helck & E. Otto (Hrsg.), Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden, 1011–10171978 Vom Pyramidenbezirk zum „Haus der Millionen Jahre“, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Institutes, Abtei-
lung Kairo 34, 1–81979 The Temple of Mentuhotep at Deir el-Bahari, from notes of Herbert Winlock, The Metropolitan Museum of Art, New York1992 Die Tempel Ägyptens, Götterwohnungen-Baudenkmäler-Kultstätten, ZürichArnold, Do.1991 Amenemhat I and the Early Twelfth Dynasty at Thebes, in: Metropolitan Museum Journal 26, 5–48Arnold, F.2004 Pharaonische Prozessionsstrassen. Mittel der Machtdarstellung unter Königin Hatschepsut, in: E.-L. Schwandner/K.
Rheidt (Hg.), Macht der Architektur – Architektur der Macht. Bauforschungskolloquium in Berlin vom 30. Oktober bis 2. November 2002, veranstaltet vom Architektur-Referat des DAI, Mainz, 13–23
Baines, J.2006 Public Ceremonial Performance in Ancient Egypt: Exclusion and Integration, in: T. Inomata/L.S. Coben, Archaeology of
Performance. Theaters of Power, Community, and Politic. Lanham, MD/New York/Toronto/ OxfordBell, L.1985 Luxor Temple and the Cult of the Royal Ka, in: Journal of Near Eastern Studies 44, 251–294Bietak, M.1972 Theben-West (Luqsor). Vorbericht über die ersten vier Grabungskampagnen (1969–1971), Sitzungsberichte der Philoso-
phisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 278. Band, 4. Abhandlung, WienBietak, M./Reiser-Haslauer, E.1978 Das Grab des Anch-Hor Obersthofmeister der Gottesgemahlin des Amun, Nitokris. Bd. I, Untersuchungen der Zweigstelle
Kairo des Österreichischen Archäologischen Institutes, Bd. V, Wien1982 Das Grab des Anch-Hor, Obersthofmeister der Gottesgemahlin des Amun, Nitokris. Bd. II. Untersuchungen der Zweigstel-
le Kairo des Österreichischen Archäologischen Institutes, Bd. VI, WienBleeker, C.J.1967 Egyptian Festivals, Enactments of Religious Renewal, Suppl. to Numen 13, LeidenBourgos, F./Larché, F. sous la direction de N. Grimal2006 La chapelle Rouge. Vol. I. Fac-similéset photographies des scenes, Centre franco-égyptien d’étude des temples du Karnak,
ParisBrunner, H.1964 Die Geburt des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines altägyptischen Mythos, Ägyptologische Abhandlungen 10,
Wiesbaden1970 Zum Verständnis der archaisierenden Tendenzen in der ägyptischen Spätzeit, in: Saeculum 21, 151–1611977 Die südlichen Räume des Tempels von Luxor, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröf-, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröf- Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröf-, Archäologische Veröf- Archäologische Veröf-
fentlichungen 18, MainzBudka, J.2001 Die Tempelanlagen Ramses’ IV. in Theben-West, in: Die 20. Dynastie, Kemet 2/2001, 28–322009 Non-textual Marks from the Asasif (Western-Thebes): Remarks on Function and Practical Use Based on Exter nal Textual
Evidence, in: P. Andrássy/J. Budka/F. Kammerzell (Hg.), Non-textual Marking Systems, Writing and Pseudo Script from Prehistory to Present Times, Lingua Aegyptia – Studia monographica 8, Göttingen, 179–203
2010 Bestattungsbrauchtum und Friedhofsstruktur im Asasif. Eine Untersuchung der spätzeitlichen Befunde anhand der Ergeb-Eine Untersuchung der spätzeitlichen Befunde anhand der Ergeb-nisse der österreichischen Ausgrabungen in den Jahren 1969–1977, Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichi-, Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichi-Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichi-schen Archäologischen Institutes 34, Denkschriften der Gesamtakademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaf-ten Bd. 54, Wien
Cabrol, A.2001 Les voies processionnelles de Thèbes, Orientalia Lovaniensia Analecta 97, LeuvenCallender, V.G.2002 The Innovations of Hatshepsut’s Reign, in: The Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 13, 29–46Cooney, K.M.2000 !���~��$ �����!�������^������� ���'������������%�� ����������������������������������������������������� �������� ��
Center in Egypt 37, 15–47
33 Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole
Davies, N. de G.1933 The Tomb of Nofer-Hotep at Thebes, Publications of the Metropolitan Museum of Art, New YorkDer Manuelian, P.1987 Studies in the Reign of Amenophis II, Hildesheimer Ägyptologische Studien 26, Hildesheim1994 Living in the Past: Studies in Archaism of the Egyptian Twenty-sixth Dynasty, Studies in Egyptology, LondonDodson, A.1989/90 Amenhotep I and Deir el-Bahri, in: Journal of the Ancient Chronology Forum 3, 42–44Drenkhahn, R.1989 Ägyptische Reliefs im Kestner-Museum Hannover, HannoverEigner, D.1984 Die monumentalen Gräber der Spätzeit in Theben-West: Eine baugeschichtliche Analyse, Untersuchungen der Zweigstelle
Kairo des Österreichischen Archäologischen Institutes 7, Denkschriften der Gesamtakademie der Österreichischen Akade-mie der Wissenschaften Bd. 8, Wien
Fischer, H.G.1968 Denderah in the Third Millennium B.C., New YorkFoucard, G.1924 La belle fête de la valée, in: Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 24, 1–209Haeny, G.1994 Zur Funktion der „Häuser für Millionen Jahre“, in: R. Gundlach/M. Rochholz (Hg.), Ägyptische Tempel – Struktur, Funk-
tion und Programm (Akten der Ägyptologischen Tempeltagungen in Gosen 1990 und in Mainz 1992), Hildesheimer Ägyp-tologische Beiträge 37, Hildesheim, 101–106
Gabolde, L.1998 Le „grand château d’Amon” de Sésostris Ier à Karnak: La décoration du temple d’Amon-Rê au moyen empire, Mémoires
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, n.s., 17, ParisGalvin, M.1981 The Priestesses of Hathor in the Old Kingdom and the Ist Intermediate Period, Dissertation, Brandeis University, UMI Ann
Arbor, MichiganGestermann, L.1984 Hathor, Harsomtus und MnTw-Htp.w II, in: Studien zur Sprache und Religion Ägyptens, Bd. 2, Zu Ehren von Wolfhart
Westendorf überreicht von seinen Freunden und Schülern, Band 2: Religion, Göttingen, 763–776Graefe, E.1986 „Talfest“, in: Lexikon der Ägyptologie VI, Wiesbaden, 187–189Hirmer, M./Lange, K.1967 Ägypten. Architektur, Plastik, Malerei in drei Jahrtausenden, MünchenJansen-Winkeln, K.2006 The Chronology of the Third Intermediate Period: Dyns. 22–24, in: E. Hornung/R. Krauss/D. Warburton (Hg.), Ancient
Egyptian Chronology, Handbook of Oriental Studies 1, 83, Leiden/Boston, 234–264Kahl, J.2010 Archaism, in: W. Wendrich (Hg.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles (http://digital2.library.ucla.edu/viewI-
tem.do?ark=21198/zz0025qh2v)Karkowski, J.2003 Deir el-Bahari VI. The Temple of Hatshepsut: The Solar Complex, WarschauKuhlmann, K./Schenkel, W.1983 Das Grab des Ibi. Theben Nr. 36, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Kairo, Archäologische Veröffentlichungen
15, MainzLansing, A.1935 The Egyptian Expedition 1934–1935. The Museum’s Excavations at Thebes, in: Bulletin of the Metropolitan Museum of
Art, Sect. II, New York Nov. 1935, 4–12Lipinska, J.1977 Deir el-Bahari II. The Temple of Tuthmosis III. Architecture, Warschau1984 Deir el-Bahari IV. The Temple of Tuthmosis III. Statuary and Votive Monuments, Warschau2005 The Temple of Thutmose III at Deir el-Bahri, in: C.H. Roehrig (Hg.), Hatshepsut. From Queen to Pharaoh, The Metropoli-
tan Museum of Art, New York, New Haven/London, 285–288Marciniak, M.,1974 Deir el-Bahari I. Les inscriptions hiératiques du Tempel de Thoutmosis III, Warschau
34 Manfred Bietak
Morenz, L.2009 Hathor in Gebelein. Vom archaischen Höhenheiligtum zur Konzeption des Sakralbezirkes; als zweites Dendera unter
Menthu-hotep (II.), in: R. Preys (Hg.), 7. Ägyptologische Tempeltagung; Structuring Religion, Leuven, 28. September – 1. Oktober 2005, Akten der ägyptologischen Tempeltagungen 2/Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3, Wiesbaden, 191–210
Murnane W.J.1982 Opetfest, in: Lexikon der Ägyptologie IV, Wiesbaden, 574–579Neureiter, S.1994 Eine neue Interpretation des Archaismus, Studien altägyptischer Kultur 21, 219–254Nagy, I.1973 Remarques sur les souci d’archaisme en Egypte à l’époque Saite, in: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 21,
53–64OIC Epigraphic Survey1994 Reliefs and Inscriptions at Luxor Temple. Volume 1: The Festival Procession of Opet in the Colonnade Hall. The Epigra-
phic Survey, OIP 112, Chicago2009 Medinet Habu IX. The Eighteenth Dynasty Temple. Part I: The Inner Sanctuaries. With Translations of Texts, Commentary,
and Glossary, OIP 136, ChicagoPischikova, E.2009 Early Kushite Tombs in South Asasif, British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 12, 11–30Porter, B./Moss, R.L.B.1960 Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. Vol. I. Theban Necropolis.
Pt. 1. Private Tombs, Oxford1964 Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. Vol. I. Theban Necropolis.
Pt. 2. Royal Tombs and Smaller Cemeteries, Oxford1972 Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings. Vol. II. Theban Temples, 2nd
ed., OxfordPosener, G.1975 La piété personelle avant l’âge amarnien, in: Revue d’Égyptologie 27, 195–210Roehrig, C.H. (Hg.)2006 Hatshepsut. From Queen to Pharaoh (Ausstellungskatalog Metropolitan Museum of Art, New York), New Haven/LondonRzepka, S.*++�� ������������#��$������������<_����������������������������~������^�{���}��~������������������������ ������� ���
Festschrift für Hartwig Altenmüller zum 65. Geburtstag, Beihefte zu den Studien zur altägyptischen Kultur 9, Hamburg, 379–385
Sadek, A.I.1987 Popular Religion in Egypt during the New Kingdom, Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 27, HildesheimSatzinger, H.1979 Theben, in: Funde aus Ägypten. Österreichische Ausgrabungen seit 1961. Katalog Kunsthistorisches Museum Wien, WienSchott, S.1937 Das Löschen von der Fackeln in Milch, in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 73, 1–251953 Das schöne Fest vom Wüstentale. Festbräuche einer Totenstadt, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der
Literatur in Mainz 11, WiesbadenSchröder, S.2010 Millionenjahrhaus. Zur Konzeption des Raumes der Ewigkeit im konstellativen Königtum in Sprache, Architektur und
Theologie, WiesbadenSethe, K.1929 Amun und die acht Urgötter von Hermopolis: Eine Untersuchung über Ursprung und Wesen des ägyptischen Götterkönigs,
Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften 4, BerlinStadelmann, R.1978 Tempel und Tempelnamen in Theben-Ost und -West, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung
Kairo 34, 171–180Ullmann, M.2002 König für die Ewigkeit. Die Häuser der Millionen von Jahren. Eine Untersuchung zu Königskult und Tempeltypologie in
Ägypten, Ägypten und Altes Testament 51, Wiesbaden2007 Origins of Thebes as a Ritual Landscape, in: P.F. Dorman (Hg.), Sacred Space and Sacred Function in Ancient Thebes:
Occasional Proceedings of the Theban Workshop, Studies in Ancient Oriental Civilization 61, Oriental Institute of the Uni-versity of Chicago, Chicago
35 Das schöne Fest vom Wüstentale: Kult zur Vereinigung mit den Toten in der thebanischen Nekropole
Waitkus, W.2008 Untersuchungen zu Kult und Funktion des Luxortempels, Teil 1: Untersuchung, Aegyptiaca Hamburgensia 2, GladbeckWente, E.F.1980 Genealogy of the Royal Family, in: J. E. Harris/E.F. Wente (Hg.), An X-Ray Atlas of the Royal Mummies, ChicagoWiebach, S.1986 Die Begegnung von Lebenden und Toten im Rahmen des thebanischen Talfestes, Studien zur altägyptischen Kultur 13,
263–291Winlock, H.E.1942 Excavations at Deir el Bahari 1911–1931, New York1947 The Rise and the Fall of the Middle Kingdom in Thebes, New YorkWoldering, I.Y �\� ������&�����>�������&�^��� ��������������_����������������������<���������������������������*�����������-
noverWolf, W.1931 Das schöne Fest von Opet, Ernst von Sieglin Expedition 5, LeipzigWreszinski, W.1923 Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte, Leipzig
207 Manfred Bietak TAFEL 5
Abb
. 1: D
er T
empe
l des
Neb
hepe
trec M
entu
hote
p un
d di
e N
ekro
pole
der
11.
Dyn
astie
als
Büh
ne fü
r das
Tal
fest
(nac
h D
iete
r Arn
old
1971
, Pla
n 1)
208 TAFEL 6 Manfred Bietak
Abb. 2: Hathor in Kuhgestalt als Mutter des Königs, links Nebhepetrec Mentuhotep II (nach Drenkhan 1989, 63, Abb. 18),rechts Amenophis II. Aus dem Hathorheiligtum Tuthmosis III. in Deir el-Bahari (nach Hirmer/Lange 1967, Nr. 146).
Abb. 3: Hathor hinter dem König Nebhepetrec Mentuhotep II, der dem Schöpfergott Min-Amun opfert.Relief aus dem Sanktuar des Tempels des Mentuhotep II. in Deir el-Bahari (Arnold 1974b, Taf. 25, 26)
209 Manfred Bietak TAFEL 7
Abb. 4: König Nebhepetrec Mentuhotep rudert die Barke des Amun über den Nil(Arnold 1974, Taf. 22, 23.)
Abb. 5: König Sesostris I rudert die Barke des Amun über den Nil (Gabolde 1998, Pl. IX)
210 TAFEL 8 Manfred Bietak
Abb. 6: König Tuthmosis III rudert die Barke des Amun über den Nil (Bourgos/Larché, sous Grimal 2006, 113).
Abb. 7: Foto des Aufwegs des Nebhepetrec Mentuhotep II. mit einer Vermessungstafel aus Kalkstein(a. nach Budka 2010, Taf. 2a; b. nach Bietak 1972, Taf. 4b).
a. b.
211 Manfred Bietak TAFEL 9
Abb. 8: Plan von Deir el-Bahri mit den Tempeln des Mentuhotep II., Hatschepsut und Tuthmosis III samt ihren Aufwegen und Gräbern der Zeit von Tuthmosis III. und Amenophis II
(nach Arnold 1975, 1013–1014, Abb. 1).
212 TAFEL 10 Manfred Bietak
Abb. 9: Die Kultachsen in Theben: Karnak – Deir el-Bahari (Talfest), Karnak – Luqsor Tempel, Luxor (Opetfest) – Medinet Habu (Dekadenfest) (nach Arnold, 1992, 110)
213 Manfred Bietak TAFEL 11
Abb. 10: Prozession während des Talfestes, Reliefdarstellung aus dem Hathor Tempel in Deir el-Bahari (Foto Claus Jurmann)
Abb. 11: Plan des Asasif im österreichischen Konzessionsbereich mit den Aufwegen des Mentuhotep, des Tuthmosis III. und der Hatschepsut, Grabbauten der 11. Dynastie und spätzeitliche Graboberbauten (nach Bietak/Reisner-Haslauer 1978, Plan 1)
214 TAFEL 12 Manfred Bietak
Abb. 12: Durch die Aufwegsarbeiten Tuthmosis’ III. abgemeißelte Überreste eines Pfeilergrabes der 11. Dynastie mit Korridor zur Kultkammer. Man erkennt auch die Überreste der Baumgruben des Aufwegs Tuthmosis’ III. (Foto Julia Budka).
215 Manfred Bietak TAFEL 13
Abb. 14: Gastmahl während des Talfestes aus dem Grab des Nacht (nach Shedid 1991, 46).
Abb. 13: Nekropole der Tuthmosidenzeit am Südrand des Asasif (nach Bietak/Reisner-Haslauer 1982, Abb. 112).
216 TAFEL 14 Manfred Bietak
Abb. 15: Die Folgen des Rauschtrunkes während eines Festbanketts (a. nach Davies 1933, pl. XVIII; b. und c. nach Wreszinski 1923, Taf. 179 [Grab des Amenemhat] u. Taf. 392).
Abb. 15a Abb. 15c
Abb. 15b
217 Manfred Bietak TAFEL 15
Abb
. 16:
Die
Gra
bobe
rbau
ten
der S
pätz
eit i
m W
estb
erei
ch d
es A
sasi
f und
die
Bün
delu
ng d
er A
chse
n de
r Gra
bobe
rbau
ten
vor d
er H
albw
egst
atio
n de
s A
ufw
egs d
er H
atsc
heps
ut a
ls H
inw
eis a
uf d
ie G
ültig
keit
des T
alfe
stes
wäh
rend
der
Spä
tzei
t (a.
nac
h Ei
gner
198
4, 1
01, A
bb. 7
3; b
. nac
h B
ieta
k/R
eise
r-Has
laue
r 197
8, A
bb.1
).
a. b.