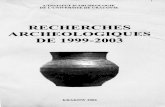Die Nekropole von Iffelsdorf an der Naab. Ein frühmittelalterliches Gräberfeld mit einigen...
Transcript of Die Nekropole von Iffelsdorf an der Naab. Ein frühmittelalterliches Gräberfeld mit einigen...
Archäologie Österreichs 25/1, 2014 1
Ö S T E R R E I C H S
ARCHÄOLOGIE25/1 2014
1. Halbjahr
€ 8,
20 –
CH
F 13
,50
Zula
ssun
gsnu
mm
er: 0
2Z03
2910
M –
Ver
lags
post
amt A
-119
0 W
ien
– P.
b.b.
AKTUELLKeltische Archäologie
in Österreich
Archäologie Österreichs
Redaktionsteam: Mag. Sandra Sabeditsch & Mag. Ulrike Schuh Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte Franz-Klein-Gasse 1, A–1190 Wien E-Mail: [email protected]
Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller und Verleger:Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, (c/o) Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Franz-Klein-Gasse 1, A–1190 Wien, Tel: (+43) 01/4277–40477, Fax: (+43) 01/4277–9409 E-Mail: [email protected], [email protected], Homepage: www.oeguf.ac.atSchriftleitung: Mag. Ulrike Schuh, Mag. Sandra Sabeditsch, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-LeebLektorat: Mag. Ulrike Schuh, Mag. Sandra SabeditschGraphische Bearbeitung, Satz & Layout: Mag. Sandra Sabeditsch, Mag. Ulrike SchuhFinanzielles Management: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Dr. Martin KrennEditorial Board: Dir. Dr. Wolfgang David, Mag. Dr. Karina Grömer, HR Dir. Dr. Anton Kern, Mag. Dr. Martin Krenn, Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Mag. Ing. Mathias Mehofer, Prof. Dr. Annaluisa Pedrotti, OR Dr. Marianne Pollak, Dir. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., ao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. Urban Wissenschaftliche Beratung: Ausschuss der ÖGUFDruck: Druckwerk Krems GmbH, Karl-Eybl-Gasse 1, A–3504 Krems/SteinTitelbild: Die Schnabelkanne vom Dürrnberg (Quelle: Salzburg Museum) wie die Situla von Kuffern (Quelle: A. Maillier, CAE Bibracte) stammen beide aus der Früh-La-Téne-Zeit, um ca. 400 v. Chr. Beide dienen als Weinbehälter und sind handwerkliche Meisterstücke. Sie spiegeln aber auch zwei unterschiedliche Einstellungen wider: Die Situla von Kuffern war bereits aus der Mode, Situlen hatten ihre Hochblüte im 6. Jahrhundert v. Chr.; die Schnabelkanne vom Dürrnberg in der typischen schlanken und eleganten Form ist dagegen innovativ und im Stil der Zeit modern. Würde man die beiden annähernd gleich alten Stücke bewerten, so könnte die Situla als typisch für ein Rückzugsgebiet verstanden werden, wogegen die Schnabelkanne kennzeich-nend für die Lage an einer Haupthandelsroute wäre. Es kann aber natürlich auch ein bewusstes Mittel der Selbstdarstellung der Besitzer bzw. Bestatteten sein: In Kuffern besinnt man sich der älteren hallstattzeitlichen Wurzeln (Boxkampf mit Hanteln, Trinkszene), obwohl man natürlich im Verkehr bzw. Kampfesweise zeigt, dass man auf dem Laufenden ist (Streitwagen, Helm). Auf dem Dürrnberg gibt man sich dagegen modern und den neuen Vorstellungen aufgeschlossen, insbesondere die Gestaltung des Kannengriffes und der Randfiguren zeigt mit seinen katzenartigen Mischwesen typische Merkmale des für uns heute schwer verständlichen, aber doch eindrucksvollen Früh-La-Tène-Stils.
EDIT
OR
IAL
IMP
RES
SUM
ISSN-Nr. 1018-1857Gedruckt mit der Unterstützung der Kulturabteilung des Amtes der Burgenländischen und Niederösterreichischen
Landesregierung sowie des Magistrats der Stadt Wien, MA 7–Kultur
Die Autoren sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich!
Geschätzte Leserinnen und Leser!
Bereits seit dem 19. Jahrhundert stehen „die Kelten“ im Fokus der archäologischen Fachwelt. Das aktuelle Thema dieser Ausgabe ist daher der Keltischen Archäologie in Österreich gewidmet und gibt einen Überblick über ihre Entwicklung und ihre wichtigsten Vertreter und Vertreterinnen in Österreich. Mit den übrigen Beiträgen dürfen wir Sie wieder zu einem „Streifzug“ durch Österreichs aktuelle archäolo-gische Forschungen vom Neolithikum bis zur frühen Neuzeit einladen. Gefäßdeponierungen sind ein häu-fig beobachteter Befund in der Urgeschichte. Überlegungen zu rituellen Praktiken, die zu diesen Befunden führen können, stehen im Mittelpunkt eines Beitrages, der diesen Aspekt am Beispiel bronzezeitlicher Gefäßensembles beleuchtet. Dass das Sternbräu – vielen Salzburg-Besuchern wahrscheinlich bekannt – nicht nur gastronomisch sondern auch archäologisch Interessantes bietet, zeigt ein Beitrag zu der bei Bauarbei-ten in diesem Areal dokumentierten Salzburger Stadtmauer. In der Rubrik „Museum intern“ wird die Neu-gestaltung der Schausammlung zur Bronzezeit im Krahuletz-Museum Eggenburg vorgestellt.Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf österreichischen Forschungen im Ausland und zeigt die Vielfalt dieser Projekte. So umspannen die Beiträge einen weiten zeitlichen Rahmen und führen vom be-nachbarten Bayern über die kroatische Mittelmeerküste bis nach Ägypten oder in den hohen Norden nach Norwegen, wo jeweils den örtlichen Gegebenheiten angepasst mit modernsten archäologischen und tech-nischen Methoden gearbeitet wird.
Wir wünschen allen LeserInnen einen schönen und erholsamen Sommer und allen AusgräberInnen inter-essante Ergebnisse bei ihren Projekten.
Wien, im Mai 2014 Sandra Sabeditsch und Ulrike Schuh
Archäologie Österreichs 25/1, 2014 1
Archäologie Österreichs 25/1 1. Halbjahr 2014
INH
ALT
DAS AKTUELLE THEMA
Geschichte der Keltischen Archäologie in Österreich Zur Frage der Keltizität der Hallstatt- und La-Tène-KulturOtto H. Urban 2–12
NEWS
Neugestaltung der ÖGUF-HomepageNicolas Schimerl 13–14
7.000 Jahre Siedlungsgeschichte – Erste Ergebnisse der Grabung in Antau 2012Ruth Steinhübl und Patrick Hillebrand 14–15
Ein neues frühneolithisches Gesichtsgefäß aus PoigenFranz Pieler 16–17
Die vierte Grabungskampagne in der urnenfelderzeitlichen Bergbausiedlung von Prigglitz-GasteilPeter Trebsche 17–20
Ausgrabung des dritten kleinen Heiligtums Objekt 41 am Sandberg 2013Veronika Holzer 20–22
Bemerkenswerte Einzelfunde aus bauarchäologischen Untersuchungen in der Salzburger AltstadtUlli Hampel 22–24
Archäologischer Studierendenverband Österreichs – Jahresrückblick 2013Astrid Schmölzer, Cornelia Lozic und Martin Gamon 24–25
FORUM
Tabuisierung – Inszenierung – Transformierung Bemerkungen zum Phänomen deponierter Gefäßensembles im RitualkontextAlexandra Krenn-Leeb 26-31
Die Stadtmauer im Sternbräu (Salzburg)Peter Höglinger 32–36
MUSEUM INTERN
Die Geschichte geht weiter… Schätze der Bronzezeit im Krahuletz-MuseumFranz Pieler 37–38
FORSCHUNG IM AUSLAND
Antike Wohnkultur in Syene (Assuan) am Beispiel der Areale 1 und 2Thomas Koch und Wolfgang Müller 39–44
Die Nekropole von Iffelsdorf an der Naab Ein frühmittelalterliches Gräberfeld mit einigen BesonderheitenRaphael Lampl, Hans Losert, Cornelia Lozic und Erik Szameit 45–50
Hafenprospektion im Nordatlantik. Die Insel Veøy aus der Luft und in 3DRonny Weßling, Joris Coolen und Natascha Mehler 51–55
Eine Mole des 17.–18. Jahrhunderts in Veštar/IstrienDie Ergebnisse der unterwasserarchäologischen Forschungen von 2012–2013Daniel Neubauer 56–60
NACHRUF
In memoriam Gabriela KrämerVon Freundinnnen und Kolleginnen 61–62
Prof. Dr. Heinrich Reinhart (12. August 1927 – 9. Mai 2013)Burghard Gaspar und Johannes M. Tuzar 62–63
Archäologie Österreichs 25/1, 2014 45
Forschung Im AuslAnd
Die Nekropole von Iffelsdorf an der Naab
Ein frühmittelalterliches Gräberfeld mit einigen Besonderheiten
Raphael Lampl, Hans Losert, Cornelia Lozic und Erik Szameit
Die Ausgrabung in Iffelsdorf, Stadt Pfreimd, Lkr. Schwandorf (Deutschland), ist Teil des For-schungsprojektes „Die Oberpfalz und ihre Nach-barregionen im frühen und hohen Mittelalter“, welches unter der Patronanz der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters, und der Universität Wien, Ins-titut für Urgeschichte und Historische Archäolo-gie, durchgeführt wird. Unter der Leitung von Hans Losert und Erik Szameit und werden seit 2002 Untersuchungen durchgeführt, um früh-mittelalterliche Lebensweise, Handel und Inter-aktion der lokal ansässigen Bevölkerung mit benachbarten Gruppen in einem kleinräumigen Gebiet zu erforschen und mit den archäologi-schen Befunden des Donau- und Ostalpenrau-mes zu vergleichen.1 Bislang wurden unter an-derem Teile der frühmittelalterlichen Siedlungs-wüstung bei dem Weiler Dietstätt2 mit einem hervorragend erhaltenen Brunnenbefund aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts3, das karolingerzeitliche Gräberfeld von Mockersdorf4 und Teile der Befestigung im Bereich des soge-nannten „Rauhen Kulm“5 bei Neustadt am Kulm, Kr. Tirschenreuth, erforscht.
Bisherige Ausgrabungen
Die untersuchte Fläche liegt, unmittelbar süd-westlich von Iffelsdorf bei Pfreimd, am rechten Ufer der Naab, welche nach 54 km bei Regens-burg in die Donau mündet. Nördlich erhebt sich der 514 m hohe Eixelberg, ein überregional bekanntes Wallfahrtszentrum. An die Grabungs-fläche angrenzend befindet sich eine erst in jüngerer Zeit gefasste Quelle mit starker Schüt-tung, welche Iffelsdorf bis in das späte 20. Jahr-hundert mit Trinkwasser versorgte. Neben dieser liegt eine erstmals in der Barockzeit genannte kleine Kapelle unbekannter Entstehungszeit. Von der nordöstlich unmittelbar an das Grabungs-
areal angrenzenden Flur sind zahlreiche latène-zeitliche Lesefunde bekannt. Im knapp einen Kilometer entfernten Pfreimd wurden bei Gra-bungen unter der ehemaligen Stadtburg im Jahr 2001 Hinweise auf frühmittelalterliche Sied-lungsaktivitäten in Form frühmittelalterlicher Keramik gefunden.6 In einem Kilometer Entfer-nung konnte im Jahr 2012 ein frühmittelalterli-cher Bestattungsplatz mit 87 Gräbern freigelegt werden.7 Die Bedeutung des betrachteten Rau-mes für Handel und Kontakte im Frühmittelalter wird durch die Nähe zu dem im Diedenhofener Kapitular genannten „Zollort Premberg“, etwa 30 km naababwärts gelegen, betont.Im Zuge des Neubaus der Straße von Iffelsdorf nach Untersteinbach wurden 1954 vier frühmit-telalterliche Gefäße geborgen. Da keine Skelett-reste festgestellt werden konnten, lag die Deu-tung als Brandgräberfeld nahe, wobei ein solches in der näheren Umgebung bislang nur aus Re-gensburg-Großprüfening bekannt ist.8 Die bei späteren Begehungen in Iffelsdorf aufgelesenen Gefäßfragmente ähnelten den 1954 geborgenen Gefäßen stark, weswegen eine einsetzende Zerstörung des Fundplatzes durch landwirt-schaftliche Tätigkeiten zu vermuten war. Um diese Situation beurteilen zu können, wie auch den Kontext der Gefäße zu klären, wurde im September 2011 eine dreiwöchige Grabungs-kampagne durchgeführt. Dabei konnten keine Brand-, jedoch vier extrem schlecht erhaltene Körperbestattungen freigelegt werden. Auf-grund der somit nachgewiesenen Gefährdung – die Gräber liegen zum Teil an der Unterkante des Pflughorizontes, manche im Bereich der Gräber deponierte Gefäße in nur 20 cm Tiefe unter rezenter Humusoberkante – wurde die Grabung im September 2012 und 2013 fortge-führt. Dabei konnten auf knapp 560 m² geöff-neter Fläche 34 Bestattungen, 74 Pfostengruben sowie zahlreiche weitere flache, amorphe Gru-ben dokumentiert werden (Abb. 1).Die Grabschächte weisen annähernd rechteckige Grundrisse auf. Die erhaltene Tiefe liegt bei maximal 80 cm unter der derzeitigen Humus-oberkante, wobei der Pflughorizont im Osten bereits zum Teil an die Sohle der Grabgruben reicht. An den Rändern der Grabschachtsohlen finden sich häufig lockere Steinsetzungen. Im Wesentlichen sind die Gräber Südost – Nordwest orientiert, wobei sich zwei leicht abweichende Gruppen zeigen. Aufgrund der schlechten Erhal-tungsbedingungen des Knochenmateriales ist
1 Die Finanzierung erfolgte über die Universitäten Bamberg und Wien sowie über eingeworbene Drittmittel, wobei für die Kampa-gne 2013 dem örtlichen Lions Club, der Stadtgemeinde Pfreimd sowie zahlreichen Privatpersonen zu danken ist.2 Gem. Richt, Stadt Schwarzenfeld, Lkr. Schwandorf. – Losert & Szameit 2003.
3 Herzig, Losert & Szameit 2008.4 Ausführlich bei Brundke 2013.5 Losert & Szameit 2005.6 Lohwasser & Losert 2002. – Ausführlich: Lohwasser 2008.7 Steinmann 2012.8 Eichinger & Losert 2004.
46 Archäologie Österreichs 25/1, 2014
Abb. 1: Iffelsdorf: gesamtplan der grabungskampagnen 2011–2013 (Quelle: r. lampl).
Archäologie Österreichs 25/1, 2014 47
Abb. 2: Iffelsdorf: glasperlenketten aus den gräbern 26 (1) und 27 (2) (Quel-le: h. losert).
eine anthropologische Auswertung nur in sehr wenigen Fällen möglich. Funde wie beispielswei-se Perlenketten und Pfeilspitzen ermöglichen auf archäologischem Weg einen Rückschluss auf das Geschlecht der Bestatteten.9 Rund 40 % sind als weiblich und 20 % als männlich anzusprechen, zu den übrigen ist keine Aussage möglich. Drei längliche Gruben, die in Form, Größe wie auch Orientierung ident mit den bisher nachgewiese-nen Grabgruben sind, waren fundleer. Drei Gräber werden von jüngeren, annähernd trich-terförmigen Gruben gestört, von denen zwei direkt auf den Kopfbereich sowie eine auf den Beckenbereich zielen. Weitere Hinweise auf Beraubung wurden jedoch nicht vorgefunden.
Fundmaterial
Bei 70 % der Bestattungen finden sich meist im Beckenbereich situierte Messer unterschiedlicher Größe. Knapp die Hälfte der Gräber ist mit Glas-perlenketten ausgestattet, welche sich aus ma-ximal 16 Perlen zusammensetzen. Die häufigsten Typen sind monochrome Oliven-, Mehrfach- so-wie Hohlperlen. Aus zwei nebeneinander liegen-den Gräbern sind Mosaikaugenperlen (Abb. 2) bekannt. Aus Grab 26 stammen neben einer Würfelperle und einer Mehrfachüberfangperle drei Mosaikaugenperlen des Typs 0120 nach R. Andrae10. Dieser datiert, der Chronologie von Jörg Kleemann folgend, in das 8. Jahrhundert.11 In Grab 27 sind neben fünf Mosaikaugenperlen12 auch drei Kreisaugenperlen13 vorhanden. Die nächste Analogie zu den vorhandenen Typen findet sich im rund 41 km entfernten karolinger-zeitlichen Gräberfeld von Kallmünz Kinderheim, Lkr. Regensburg, Grab 3, mit einem Kettchen aus
acht Perlen, davon zwei Mosaikaugenperlen sowie eine Kreisaugenperle.14 Das gemeinsame Auftreten dieser Formen ist typisch, wofür sich auch im ober- und niederösterreichischen Don-auraum Beispiele finden. So stellt die Perlenket-te aus dem Gräberfeld Steyr-Gleink in Oberös-terreich, Grab 11/1992, eine gute Analogie dar.15 Diese Kette setzt sich aus fünf Mosaikaugenper-len16 sowie zwei Kreisaugenperlen zusammen und datiert in den Zeitraum von der Mitte bis zur zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts.17 Stefan Ei-chert datiert Mosaikaugenperlen im karantani-schen Raum in die Zeit von 740 bis 830.18 J. Klee-mann ordnet in seiner Bearbeitung der Gräber aus Niedersachsen den selten auftretenden Typ 0473 nach R. Andrae seiner Gruppe IV zu, die in das letzte Drittel des 8. Jahrhunderts datiert.19 Die übrigen Typen der vorliegenden Kette sind in das 8. Jahrhundert zu verorten.20 Die Zeitstel-lung dieser sonst beigabenlosen Gräber21 aus Iffelsdorf kann somit in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts gelegt werden.Die Perlenkette aus Grab 1 stellt aufgrund ihrer Zusammensetzung eine singuläre Erscheinung im Gräberfeld dar. Sie besteht aus einer ge-drückt kugelförmigen braunroten Perle mit achterförmiger Fadenauflage. Dazu kommen zwei schwarzbraune mit gelbem Rand und mit-tiger Wellenlinie22, weiters ein ähnliches Stück aus grünem Glas. Eine entsprechende, aber umfangreichere Kette mit Perlen der erwähnten Typen findet sich in Grab 19 aus Krachenhausen, Lkr. Regensburg.23 Sie enthält mit Ausnahme der grün transluziden Perle die gleichen Typen. Diese Formen treten bereits im 7. Jahrhundert auf und laufen im 8. Jahrhundert weiter.
die gürtelgarnitur der stufe spA IIIa
Am letzten Grabungstag des Jahres 2013 konn-te ein Grab freigelegt werden, in welchem sich ein in einem Köcher gelagertes Pfeilbündel mit fünf Widerhakenspitzen, ein großes Messer sowie ein Buntmetallring im Hüftbereich, ein Feuerschläger sowie zwei eiserne Schnallen mit Buntmetalldorn befanden. Herausragend ist eine komplette, aus Buntmetall gefertigte 32-teilige awarische Gürtelgarnitur in Trachtlage – der bisher erste und einzige derartige Nachweis in Deutschland!
9 Pöllath 2002.10 Andrae 1973, 116.11 Kleemann 2002, 292.12 Drei Stück Typ 1272 sowie je ein Stück Typ 1273 sowie Typ 0473 nach Andrae 1973.13 Zwei Stück Typ 17 nach Andrae 1973 sowie eine Variante ähnlich Andraes Typ 19 mit gelbem Körper.14 Stroh 1954, Tafel 11.15 Russ 2013, 116–117.
16 Typ 02, 10, 1272 sowie 1273 nach Andrae 1973.17 Russ 2013, 79.18 Eichert 2013, 423–425.19 Kleemann 2002.20 Kleemann 2002, 92–94 sowie 293.21 Über den Gräbern 21 und 27 fand sich ein wohl frühmittel-alterliches Messer im Pflughorizont, das jedoch keinem Grab zugeordnet werden kann.22 Entspricht Nr. 91 aus Stroh 1954, Farbtafel.23 Stroh 1954, 22.
48 Archäologie Österreichs 25/1, 2014
Diese besteht neben einer zweiteiligen Haupt-riemenzunge aus vier ebenso zweiteiligen Ne-benriemenzungen mit Kreislappenzier. Weiters liegen 15 Nebenriemenbeschlägen sowie drei Lochschützer, fünf zweiteilige Scharnierbeschlä-ge, eine unverzierte Schnalle, ein Riemenend-stück sowie ein Nebenriemenbeschlag mit an-thropomorpher oder zoomorpher Darstellung vor. Die zweiteilige, gegossene Hauptriemen-zunge (Abb. 3) mit vier flachen Kreislappen, kurzem, glatten Feld und tierkopfförmigen Zwingen datiert in die Stufe SpA IIIa24. In Buda-pest-Vöröskereszt in Ungarn, Grab 15, findet sich ein sehr ähnliches Stück25. Aus Tiszaderzs, Ko-mitat Jász-Nagykun-Szolnok, ebenso Ungarn, liegt eine in der Gestalt der Tierköpfe abwei-chende Hauptriemenzunge mit ähnlichen Ne-benriemenbeschlägen und Schnalle vor.26 Eine feuervergoldete, einteilige Nebenriemenzunge zeigt eine außergewöhnliche Darstellung: eine anthropomorphe Gestalt, welche von einer Schlange verschlungen und wieder ausgespuckt wird.27 Da die hier vorgestellte Garnitur derzeit noch restauriert wird, ist eine nähere Betrach-tung noch nicht möglich. Die sehr schlecht er-haltenen Knochen konnten dank intensiver Be-mühung der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien in Grundzü-gen bestimmt werden. Das Sterbealter wird auf 17–25 Jahre festgelegt, das Geschlecht ist mit großer Wahrscheinlichkeit männlich. Zur Todes-ursache sind keine Angaben möglich.28
Der Gürtel aus Iffelsdorf steht weit außerhalb des Verbreitungsgebietes vollständiger awari-scher Garnituren. Eine schlüssige Interpretation ist nur anhand naturwissenschaftlicher Analysen möglich, welche bereits in Planung sind. Im angrenzenden, von zwei großen Pfostenlöchern gestörten Grab 36 fanden sich ein doppelkoni-scher Spinnwirtel, ähnlich dem in awarischen Gräberfeldern häufig auftretenden Typ, sowie ein silberner Kopfschmuckring.
Weitere metallfunde
Bislang sind aus Grab 22 und 29 einzelne Pfeil-spitzen bekannt. Grab 7 enthielt neben einer Perlenkette sowie einem Gefäß eine etwa im Beckenbereich situierte, gegossene Schelle mit anhaftenden Textilresten (Abb. 4). Die Form ist oval, mit kreuzförmigem Klangschlitz und einem Klangloch knapp oberhalb der Schellenmitte, und
Abb. 3: Iffelsdorf: Teile der awarischen gürtelgarnitur aus grab 37 (Quelle: h. losert, h. Voß).
somit dem Typ B4 nach K. Spindler zuzuordnen.29 Die Lage in Kombination mit den anhaftenden Textilresten könnte auf eine Anbringung an ei-nem Kleidungsstück hindeuten. Die Datierung anhand typologischer Aspekte ist schwierig, die längsovale Form wie auch das Fehlen einer Rip-pe in Schellenmitte weisen nur generell in das Frühmittelalter. Schellen dieser Zeitstellung wa-ren in der Oberpfalz bislang nur als Streufunde bekannt.30 Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt innerhalb der Grenzen des awarischen Khaga-nats, die Häufigkeit nimmt von mittelawarisch zu spätawarisch hin zu. Der Großteil der Schellen stammt aus Kindergräbern.31
Keramik
Aus dem Bereich des Gräberfelds konnten bisher neun Gefäße geborgen werden, von denen vier aus Grabgruben stammen. Am Fußende des Doppelgrabes 5/6 befanden sich ein im Rand-bereich zerstörter Topf mit dreifachem Wellen-band sowie eine gedrungene Schüssel mit einer auf der Schulter umlaufenden Wellenlinie. Diese wurde in situ mit der Unterseite nach oben auf-gefunden. Eine Interpretation als Abdeckung für
24 Daim 2000, 88–92.25 Nagy 1998, 202.26 Kovrig 1975, Tafel XX, 7–12.27 Siehe dazu ausführlich Losert & Szameit 2014.28 Für die anthropologische Bestimmung sei Karin Wiltschke-Schrotta sowie Miriam Weberstorfer vom Naturhistorischen Museum Wien herzlich gedankt.
29 Spindler 1998, 37.30 Pöllath 2002, 152. Bei der Schelle aus Thurnau-Alladorf ist ein Grabzusammenhang möglich, aber nicht nachweisbar.31 Kiss & Martin 1996, 269.
Archäologie Österreichs 25/1, 2014 49
Abb. 4: Iffelsdorf: gegossene Buntmetallschelle aus grab 7 (Quelle: h. losert).
ein Holzgefäß mit eventuellen Speisebeigaben wäre denkbar. Ein weiteres, jedoch fragmentier-tes Gefäß fand sich in der unteren Hälfte von Grab 9 auf der rechten Seite der Grabgrube. Etwa im rechten Beckenbereich befand sich in Grab 7 ein Topf mit einfacher Wellenlinie. Ein großes Wandfragment eines Vorratsgefäßes lag in situ etwa 20 cm über der Sohle von Grab 31. Dieses könnte ebenfalls als Abdeckung für ein Holzge-fäß gedient haben. Rechts neben Grab 34, au-ßerhalb der Grabgrube, wurde etwa 30 cm über Grabsohlenniveau der Boden sowie Wandansatz eines Gefäßes dokumentiert.Zwei Töpfe stammen aus flachen Gruben zwi-schen den Gräbern 1, 2 und 3, ein weiterer aus einem nur undeutlich erkennbaren Befund an der Grenze zur vom Straßenbau verursachten Störung. Ein Topf steht am Boden einer Grube ohne Grabzusammenhang. Im Bereich des Kopf-endes von Grab 10 und 11, bereits außerhalb der Grabgruben, befanden sich Fragmente einer Tüllenpfanne aus Keramik. Diese entspricht ei-nem in bajuwarischen Siedlungen des 8. Jahr-hunderts geläufigen Typ, wie vor allem Funde in Ergolding bestätigen.32 Die in Iffelsdorf außer-halb der Gräber deponierten Gefäße gleichen jenen aus den Grabgruben, weswegen mit einer Niederlegung während der Nutzung der Nek-ropole zu rechnen ist. Das gemeinsame Auftre-ten von mehreren Töpfen und einer Pfanne, wie auch der Nachweis mehrerer kleiner Feuerstel-len, kann als Hinweis auf Speisezubereitung und -verzehr am Gräberfeld gedeutet werden.33
Weitere Befunde
In der untersuchten Fläche liegen 74 Pfostenlö-cher mit einer maximal erhaltenen Tiefe von rund 50 cm vor, welche kaum datierendes Material
enthielten (Abb. 1). Jünger als die Gräber ist eine Reihe von bisher vier, im Abstand von exakt 6 m gesetzten Doppelpfosten unbekannter Funktion, welche Grab 36 stören. Ebenso jünger als die Nekropole sind zwei das Grab 34 störende Pfos-ten, welche mit einem der zuvor beschriebenen Doppelpfostenpaare in einer Flucht liegen. Eine Zusammengehörigkeit dieser Strukturen ist möglich, aber nicht nachweisbar. Zu den übrigen 64 Pfostensetzungen liegt kein erkennbarer Begehhorizont vor, auch sind aus keiner Zeitstel-lung entsprechend umfangreiche Keramikfunde vorhanden, die eine Interpretation als Siedlung stützen würden. Eine Interpretation ist somit erst nach der Aufdeckung weiterer Flächen möglich.
Resümee
In der vorgestellten Nekropole von Iffelsdorf konnten bislang 34 Gräber dokumentiert wer-den. Im Südosten sind aufgrund des Straßenbaus keine weiteren Gräber zu erwarten, im Südwes-ten scheint die Grenze der Ausdehnung erreicht. Im Nordwesten sind bei ansteigender Überla-gerung und damit einhergehend besseren Er-haltungsbedingungen weitere Gräber zu erwar-ten, im Nordosten hingegen ist eine starke und fortschreitende Gefährdung durch die moderne Landwirtschaft gegeben. Aus dem Gräberfeld liegen Trachtbestandteile vor, die Zeugnisse für weitreichenden Kontakt wie auch Austausch darstellen. Auffällig ist die Ähnlichkeit des Ma-terials zu jenem aus dem Donauraum, wie bei-spielsweise Steyr Gleink34. Das Material der nur 45 km entfernten frühmittelalterlichen Nekro-pole von Mockersdorf35 weicht typologisch und quantitativ stärker ab.Die Gräber 27 und 37 datieren mit ihren Funden (Mosaikaugenperlen und Gürtelgarnitur) in die zweite Hälfte, wahrscheinlich in das letzte Drittel des 8. Jahrhunderts. Genauere Angaben zur Belegungsdauer sind auf Basis des derzeitigen Forschungsstandes nicht möglich. Im Zuge der bisherigen Kampagnen ergab sich aufgrund der für die Region atypischen Funde, insbesondere der awarischen Gürtelgarnitur, die Frage nach der Herkunft und sozialen Gliederung der hier bestatteten Bevölkerung und deren Beziehung zu Awaren, Bajuwaren und Slawen. Der Bezug der Nekropole zur Quelle, wie auch zum Eixel-berg, ist noch unklar. Um diese und weitere Fragen zu klären, wird die Grabung im Septem-ber 2014 fortgeführt.
32 Engelhardt 1987.33 Losert & Szameit 2012, 111.
34 Szameit 2000, 523–526.35 Ausführlich bei Brundke 2013.
50 Archäologie Österreichs 25/1, 2014
literatur
R. Andrae 1973: Mosaikaugenperlen. Untersuchungen zur Verbreitung und Datierung karolingerzeitlicher Millefio-riglasperlen in Europa. Acta Praehistorica et Archaeologi-ca 4, 1973, 101–198.N. Brundke 2013: Das mittelalterliche Gräberfeld Mockers-dorf. Archäologie im Schatten des Rauhen Kulm. Pressath 2013.F. daim 2000: „Byzantinische“ Gürtelgarnituren des 8. Jahrhunderts. In: F. Daim (Hrsg.), Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 7, Innsbruck 2000, 77–204.S. Eichert 2013: Zur Absolutchronologie des Ostalpen-raums im Frühmittelalter unter besonderer Berücksichti-gung 14C-datierter Grabinventare. Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 54, 2013, 419–427.W. Eichinger & H. losert 2004: Ein merowingisches Brand-gräberfeld östlich-donauländischer Prägung bei Großprüfen-ing. Das archäologische Jahr in Bayern 2003, 2004, 98–101.B. Engelhardt 1987: Ergolding im Mittelalter. Landkreis Landshut, Niederbayern. Das archäologische Jahr in Bay-ern 1986, 1987, 147–151.E. herzig, H. losert & E. szameit 2008: Ein dendrodatier-ter Brunnen des 8. Jahrhunderts in Dietstätt. Das archäo-logische Jahr in Bayern 2007, 2008, 106–108.A. Kiss & M. martin 1996: Das awarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. Studien zur Archäo-logie der Awaren 5, Innsbruck 1996.J. Kleemann 2002: Sachsen und Friesen im 8. und 9. Jahr-hundert. Eine archäologisch-historische Analyse der Grab-funde. Veröffentlichungen der Urgeschichtlichen Sammlun-gen des Landesmuseums zu Hannover 50, Ol-denburg 2002.I. Kovrig 1975: The Tiszaderzs Cemetery. In: I. Kovrig (Hrsg.), Avar finds in the Hungarian National Museum I, Budapest 1975, 209–233.C. lohwasser 2008: 1200 Jahre auf 120 Quadratmetern. Frühmittelalterliche bis neuzeitliche archäologische Zeug-nisse unter dem ehemaligen Pfreimder Wasserschloss. Archäologische Zeugnisse zur Siedlungsgeschichte 2, Pressath 2008.
N. lohwasser & H. losert 2002: Frühmittelalterliche Siedlungsspuren unter dem ehemaligen Wasserschloss zu Pfreimd. Das archäologische Jahr in Bayern 2001, 2002, 125–128.H. losert & E. szameit 2003: Österreichisch-deutsche Ausgrabungen in einer Wüstung des frühen Mittelalters bei Dietstätt. Das archäologische Jahr in Bayern 2002, 2003, 102–104.H. losert & E. szameit 2005: Archäologische Untersu-chungen am Rauhen Kulm in der nördlichen Oberpfalz. Das archäologische Jahr in Bayern 2004, 2005, 126–128.H. losert & E. szameit 2012: Eine slawische Nekropole mit Gefäßdeponierung bei Iffelsdorf an der Naab. Das archäologische Jahr in Bayern 2011, 2012, 109–111.H. losert & E. szameit 2014: Eine awarische Gürtelgarni-tur aus der slawischen Nekropole bei Iffelsdorf. Das archäologische Jahr in Bayern 2013, 2014 (in Druck).M. nagy 1998: Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadt-gebiet von Budapest. Monumenta Avarorum Archaeo-logica 2, Budapest 1998.R. Pöllath 2002: Karolingerzeitliche Gräberfelder in Nord-ostbayern. Eine archäologisch-historische Interpretation mit der Vorlage der Ausgrabungen von K. Schwarz in Weismain und Thurnau-Alladorf. München 2002.D. russ 2013: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Steyr - Gleink, Hausleitnerstrasse. Unpubl. Diplomarbeit Univer-sität Wien 2013.K. spindler 1998: Falknerei in Archäologie und Geschich-te. Unter besonderer Berücksichtigung der Beizjagd in Tirol. Nearchos Sonderheft 3, Innsbruck 1998.C. steinmann 2012: Reihengräber in der Baulücke. Ar-chäologie in Deutschland 5/2012, 47.A. stroh 1954: Die Reihengräber der karolingisch-ottoni-schen Zeit in der Oberpfalz. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte 4, Kallmünz 1954.E. szameit 2000: Zum archäologischen Bild der frühen Slawen in Österreich. Mit Fragen zur ethnischen Bestim-mung karolingerzeitlicher Gräberfelder im Ostalpenraum. In: R. Bratož (Hrsg.), Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze – Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche. Anfänge der slowenischen Ethno-genese. Situla 39, Ljubljana 2000, 504–544.
64 Archäologie Österreichs 24/2, 2013
AutorInnen dieser Ausgabe AU
TO
REN
VER
ZEIC
HN
ISJoris Coolen, M.A., Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Martin Gamon, B.A., Gymnasiumstraße 56/4, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Prof. Burghard Gaspar, Grafenberg 63, A-3730 Grafenberg, E-Mail: [email protected]
Mag. Ulli Hampel, ARDIG – Archäologischer Dienst GesmbH, Porschestraße 39, A-3100 St. Pölten, E-Mail: [email protected]
Patrick Hillebrand, Verein PannArch, Josef-Haydn Gasse 4-8/Top 8/2, A-7000 Eisenstadt, E-Mail: [email protected]
Dr. Peter Höglinger, Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie, Landeskonservatorat für Salzburg, Sigmund-Haffner-Gasse 8, A-5020 Salzburg, E-Mail: [email protected]
Dr. Veronika Holzer, Prähistorische Abteilung, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]
Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Thomas Koch, Österreichisches Archäologisches Institut, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Raphael Lampl, BSc, Radlerstraße 2, A-4232 Hagenberg, E-Mail: [email protected]
PD Dr. Hans Losert, Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Am Kranen 14, D-96047 Bamberg, E-Mail: [email protected]
Cornelia Lozic, Floridsdorfer Hauptstraße 22/2/12, A-1210 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Ana Zora Maspoli, Löblichgasse 1/11, A-1090 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Wolfgang Müller, Schweizerisches Institut für Ägyptische Bauforschung und Altertumskunde in Kairo, 11/13 Sharia el-Shaer Aziz Abaza, ET-11211 Kairo-Zamalek, E-Mail: [email protected]
Univ.-Ass. Dr. Natascha Mehler, M.A., Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Daniel Neubauer, Kompetenzzentrum für Kulturelles Erbe und Kulturgüterschutz, Universität Wien, c/o Blue Shield Office Vienna, Schottengasse 3a, II. Hof, V. Stiege, 1. Stock, Tür 19, A-1010 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Dr. Franz Pieler, Krahuletz-Museum, Krahuletzplatz 1, A-3730 Eggenburg, E-Mail: [email protected]
Nicolas Schimerl, Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Astrid Schmölzer, Max-Mell-Allee 4/11, A-8010 Graz, E-Mail: [email protected]
MMag. Ruth Steinhübl, Verein PannArch, Josef-Haydn Gasse 4-8/Top 8/2, A-7000 Eisenstadt, E-Mail: [email protected]
ao. Univ.-Prof. Dr. Erik Szameit, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Mag. Dr. Peter Trebsche, Niederösterreichische Landessammlung Ur- und Frühgeschichte, MAMUZ Schloss Asparn, Schlossgasse 1, A-2151 Asparn an der Zaya, E-Mail: [email protected]
Dr. Johannes M. Tuzar, Krahuletz-Museum, Krahuletzplatz 1, A-3730 Eggenburg, E-Mail: [email protected]
ao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. Urban, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
Ronny Weßling, B.A., Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Universität Wien, Franz-Klein-Gasse 1, A-1190 Wien, E-Mail: [email protected]
VORSTAND 2013–2015
Vorsitz: Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-LeebStv. Vorsitz: HR Dir. Dr. Anton Kern
Schriftführung: Mag. Dr. Karina GrömerStv. Schriftführung: Mag. Dr. Peter Trebsche
Kassier: Mag. Ing. Mathias MehoferStv. Kassier: Mag. Dr. Martin Krenn
Geschäftsführung: Mag. Ulrike Schuh, BAStv. Geschäftsführung: Mag. Jakob Maurer
AUSSCHUSSMag. Gottfried Artner
HR i. R. Dr. Fritz Eckart BarthMag. Christoph Blesl
Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael DoneusProf. Dr. Alexandrine Eibner
HR i. R. Dr. Christa Farkaem. Univ.-Prof. Dr. Herwig Friesinger
Dr. Irene Heiling-SchmollMag. Hannes HerditsDr. Peter Höglinger
HR Mag. Franz Humerem. Univ.-Prof. Dr. Sigrid Jalkotzy
HR i. R. Dr. Manfred KandlerORegR i. R. Dr. Karl Kaus
Dr. Daniela KernHR Dr. Ernst Lauermann
em. Univ.-Prof. Dr. Andreas LippertKlaus Löcker
Dir. Dr. Renate MiglbauerSR i. R. Dr. Fritz Moosleitner
Univ.-Doz. Dr. Christine Neugebauer-MareschMag. Viktoria PacherMag. Dr. Franz Pieler
OR Dr. Marianne PollakMag. Sandra Sabeditsch
em. Univ.-Prof. Dr. Fritz SauterUniv.-Doz. Dr. Ulla Steinklauber
Mag. Sigrid Strohschneider-LaueAss.-Prof. Mag. Dr. Alois Stuppner
Univ.-Prof. Dr. Timothy TaylorUniv.-Prof. Dr. Claudia Theune-Vogt
Dir. Dr. Johannes Tuzarao. Univ.-Prof. Dr. Otto H. Urban
Dr. Barbara Wewerka
EhrenmitgliederHR i. R. Dr. Fritz Eckart Barth
HR i. R. Dr. Friedrich BergSR i. R. Dr. Fritz Moosleitner
Ingrid Maria NovakDir. i. R. Prof. Dr. Sigmar von Schnurbein
RechnungsprüfungDr. Reinhard E. Eisner
Dipl.-Ing. Manfred KrejsMag. Silvia Müller
Die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF)
Im Jahre 1950 wurde die Urgeschichtliche Arbeitsgemeinschaft inner-halb der Anthropologischen Gesellschaft in Wien unter dem Ehren-schutz von Prof. Dr. Gero von Merhart gegründet.1958 wurde diese in die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien umgewandelt (UAG). 1988 entstand die Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühge-schichte (ÖGUF).1997 sowie zuletzt 2010 wurden die Vereinsstrukturen der ÖGUF durch Statutenänderungen aktualisiert.
WERDEN SIE MITGLIED!Mitglieds-/Jahresbeitrag
Studierendenmitglied € 17,50 jährlichOrdentliches Mitglied € 35,00 jährlichUnterstützendes Mitglied € 70,00 jährlichFörderndes Mitglied € 700,00 einmalig
Füllen Sie eine Beitrittserklärung auf unserer Homepage aus:
www.oeguf.ac.at