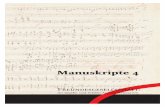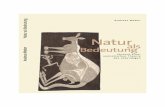Bildwerdung und Bild(z)erstörung. Ein kunstwissenschaftlicher Versuch.
-
Upload
uni-marburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bildwerdung und Bild(z)erstörung. Ein kunstwissenschaftlicher Versuch.
Dr. phil. Sacha Szabo, Unterhaltungswissenschaftler am Institut fur Theoriekultur, Freiburg, legt mit diesem Sammelband eine Theorieinstallation vor, die beides sein will: einerseits eine Wissen
schaft von der Unterhaltung und andererseits unterhaltende Wissenschaft. So lassen sich die einzelnen Beitrage einerseits als kultursoziologische Analysen eines Film lesen, andererseits zeichnen sie
eine lebendige 6lmsoziologische Diskussion nach, wie namlich - durch die unterschiedlichen Zugangsweisen - ein Objekt in viele verschiedene Objekte zerfallt. Mit diesem Vorgehen reagiert die Unterhaltungswissenschaft seismographisch auf die Erschutterung der Erkenntnis durch eine hete
rogene und kontingente WirkJichkeitserfahrung.
INSTITUT FOR THEORIEKULTUR STUDIEN ZUR UNTERHALTUNGSWISSENSCHAFT
Band 3
Artefakt: "K6rper"
Skizzen zu einer Soziologie des Schmerzes. 10 Zugange zu David Finchers Film "Fight Club"
von
Sacha Szabo (Hg.)
Tectum Verlag
SACHA SZABO
Einleitung
LISA LORENZ
INHALTSVERZEICHNIS
Die Akte Tyler Durden
FLORENTINE SCHOOG
What would Judith say
Eurn REGINA MAURER
"Ich will nicht ohne Narben sterben."
HANNAH KREINER
Fight Club im eigenen Korper
SACHA SZABO
Artefakt: "Korper"
ISABELL KOHLER
9
11
37
53
67
75
Fight Club - eine "Geschichte des Schmerzes"? 85
LUKAS POETSCHKE
Techno-Logik bei Fight Club 99
MADLEN GOTZ
Der Unternehmer Tyler Durden 109
7
NIHAT OZKAYA
S .£ " " el e
DENNIS JANZEN
Bildwerdung und Bild(z)erstorung. Ein kunstwissenschaftlicher Versuch
INSTITUT FUR THEORIEKULTUR
Das politische Testament der Unterhaltungswissenschaft
SACHA SZABO
Nachtrag
119
127
137
140
SACHA SZABO
Einleitung
"Willkommen beim Fight Club.
Regel Nr. 1 des Fight Club ist: Man redet nicht liber den Fight Club."1
Wie solI man iiber etwas schreiben, woriiber zu sprechen verboten ist. Ganz einfach indem nicht daritber sondern mitgesprochen wird. Immer wieder wird kolportiert, dass sich jemand "wirklich" urn die Aufnahme in Tyler Durdens Fight Club bemiiht hat. la, auch wir haben Antrage an Tyler Durdens Adresse geschickt.
Was ist aber der Fight Club? Die vorliegende Textsammlung basiert auf einem Hol
lywoodfilm von David Fincher aus dem Jahre 1998 eben dieses Namens. Urn kurz
Fight Club (USA/Deutschland 1999, R: Fincher, David), min. 00:40
9
N IHAT OZKAYA
BBQ_Art 6
126
DENNIS JANZEN
Bildwerdung und Bild(z)erstorung. Ein kunstwissenschaftlicher Versuch.
"Ich mache und verkaufe Seife! Das Eichmag der Zivilisation!" 1
Es ist eine trosdose Szenerie in flkhigem Grau-Schwarz, nur durchbrochen von ver
einzelten Streifen blauen Neonlichts, in der der namenlose Erzahler und sein Alter
Ego Tyler Durden ihren zukiinftigen Status verhandeln. Wie in einem Gemalde Ed
ward Hoppers mag die kalte, klare Linienfiihrung des Hintergrunds metonymisch
das von Einsamkeit gepragte Seelenleben des Erzahlers darstellen, in das nun iiber
raschend - quasi auf einen Schlag - eine neue Konstante eingebrochen ist.2 Dass
Bilder in der filmischen Narration mitunter hochste Bedeutsamkeit beim Transport
geahnter Seelenstimmung haben, muss hier als Gemeinplatz nicht erortert werden
man denke nur kurz an die entsattigten Darstellungen der trosdosen Diensdeistungs
gesellschaft im Gegensatz zur warmen, orange-roten Farbgebung der Fight Clubs in
David Finchers gleichnarnigem Film. Es ist ein anderer Bildbegriff, der in Fight Club unterschwellig verhandelt wird und der mir hier den Anlass zu einem kurzen, kunst
wissenschafdichen Versuch gibt. Die Grundthese ist einfach: Der namenlose Erzahler
schafft aus einern gewissen Minderwertigkeitsgefiihl heraus ein besseres Bild seiner
selbst, namendich Tyler Durden. Dieses Bildwerk gefallt sich selbst allerdings nicht
in rein projektierter Passivitat, sondern beginnt aggressiv, a) selbst weitere Bilder zu
erschaffen und b) andere Bilder - zumal solche mit hegemonialem Charakter - zu
storen oder zu zerstoren.
Fight Club (USA/Deutschland 1999, R: Fincher, David), min. 32:57. Kappen, Ines: Der Mann in der Krise oder: Kapitalismuskritik in der Mainstreamkultur. Bielefeld 2008, S. 106.
127
DENNIS JANZEN
I - Bildwerdung
Das Auftauchen Tyler Durdens hatte Hir den Erzahler nicht zwingend eine Dberra
schung sein miissen. Nicht nur, dass Tyler sich durch mehrfaches AUfblitzen (siehe
"Bildstorung") als Einzelbild auf dem Zelluloid und so vermutlich auch im Wahr
nehmungsraum des Erzahlers ankiindigt; er ist auch das Endprodukt einer Evolution
des mentalen Bildes, die in schnellen Schritten vom Geist des Erzahlers in die auBe
re Welt drangt. Ausgehend von einem der Dienstleistungsgesellschaft entwachsenen,
negativen Selbstbild als "Kopie einer Kopie einer Kopie, "3 das selbst keine definie
renden Eigenschaften mehr hat und deshalb auf (mangelhafte) Substitute angewiesen
zu sein scheint - "lch blatterte Kataloge durch und fragte mich, we1che Esszimmer
Garnitur wohl meine Personlichkeit definiert"4 - sucht der Erzahler nach anderen Moglichkeiten, sich nach innen und auBen zu reprasentieren. Die Problematik der
inadaquaten Reprasentation, des fehlenden Selbst- und AuBenbildes in einer Gesell
schaft der Vereinzelung machen ihn zu einer defizitaren Sozialfigur5 und letztlich
auch schlaBos und krank. In Selbsthilfegruppen findet der Erzahler vorerst Erlosung
- und ein Offenbarungsereignis zwischen den "riesigen schwitzenden Titten" des
ehemaligen Bodybuilders Bob, "so gewaltig, wie man sich die von Gott vorstellen
wiirde. "6 Auf dessen T-Shirt hinterlassen die Tranen des namenlosen Erzahlers erst
mals wieder etwas, das ihm langst verloren geglaubt schien: Das origin are, indexika
lische Abbild seines Innenlebens. Der tranengetrankte Abdruck erinnert wohl nicht
zufallig an die Klecksbilder des Rorschachtests, jenem projektiven Test, mit dem Psy
choanalytiker versuchen, die Personlichkeit des Probanden zu erfassen.7 Der Erzah
ler schafft es, ein eigenes Seelenbild zu erschaffen und nach auBen zu transportieren; ein Befreiungsschlag, der ihm sofort den lang ersehnten Schlaf zuriickgibt.
Fortan wird er "siichtig"B nach Selbsthilfegruppen. Es wird gezeigt, wie die Sit
zungen mentale Bilder evozieren ("Stellt euch euren Schmerz vor als wei Ben Ball aus
heilendem Licht [ ... J behaltet das Bild, denkt daran zu atmen ... '(9) und den Erzah-
128
Fight Club, min. 03:56. Ebd.: min. 05:08.
Die weitere Betrachtung dieses Aspekts solI fachlich den soziologischen Beitragen in diesem Band uberlassen werden. Fight Club, min. 03:35.
Eine andere, auf - gewiss vorhandene - christologische Implikationen des Films zielende Deutung konnte an die Vera Ikon oder das Abbild Christi auf dem Turiner Grabtuch den ken lassen. Passend dazu erklingen geistliche Gesange. Fight Club, min. 09:08. Ebd.: min. 09:57.
BILDWERDUNG UNO BILO(Z)ERSTORUNG. EIN KUNSTWISSENSCHAFTLICHER VERSUCH.
ler sein Inneres erkunden lassen, wo er in "seiner Hohle", einer frostigen Eiskaverne,
auf "sein Krafttier" trifft, deutbar als ein wei teres mentales Selbstbildnis. Man mag
bereits ahnen, dass ein Pinguin nicht den finalen Erfolg bei der Suche des Erzahlers
nach einer geeigneten Reprasentation seiner selbst darstellt: Im Schwarz-WeiB des
Pinguins und seiner indifferenten Anweisung "Gleite!"lo spiegelt sich letztlich doch
nur die Ununterscheidbarkeit von Dichotomien wie gut/bose, richtig/falsch, die kon
sumistischen Sinnsuche des Erzahlers am Beispiel des Yin-Yang-Wohnzimmertischs
und seine widerstandslose Integration in eine kalte Arbeitswelt wider. Entsprechend
schnell wird seine Bild- und Sinnsuche gestort von "einem Madchen namens Marla
Singer"l!, das fortan den Platz seines Seelentiers einnimmt. Die mannliche (Selbst-)
Vorstellungskraft wird von machtigen Bildern des Weiblichen gestort, von denen Marla Singer mindestens drei reprasentiert, "Kindfrau, Schlampe, Vamp"12. Marlas
Auftauchen markiert aber auch den Zeitpunkt, an dem Tyler Durden zum ersten Mal
aufblitzt.
Tyler ist das starkste mentale Bild des Films; so stark, dass es selbst EinBuss auf die
auBere Welt nehmen kann und in der Quasi-Abwesenheit des namenlosen Erzah
lers beeindruckende Handlungen vollfiihrt. Es muss angemerkt werden, dass die Be
deutungen und Eigenschaften mentaler Bilder in Psychologie, Philosophie und der
Kunst- bzw. Bildwissenschaft kontrovers diskutiert werden. 13 Der Begriff "meint im
Wesentlichen anschauliche Vorstellungen und spielt eine zentrale Rolle in mentali
stischen Reprasentationstheorien"14; zahlreiche Theorien wurden entwickelt, urn die
Formen und Eigenschaften mentaler Reprasentationen aufzuzeigen. EinBussreich hat
sich dabei die Familie der Imagery-Theorien gezeigt,15 die "von der Existenz spezi
fischer bildhafter Vorstellungen" ausgeht und somit "einen Typus von mental en Re
prasentationen [ ... ] in expliziter Analogie zu Bildem" modelliert. 16 Die Verbindung
von mentalen zu auBeren Bildern, abseits von sensorischen Netzhautbildern, wird im
10 Ebd.: min 10:33. 11
12
13
14
15
16
Fight Club, min. 03:00. Kappert: Der Mann, S. 12l. Fur die Diskussion und Kompilation der verschiedenen Standpunkte hat sich vor aHem Klaus Sachs-Hombach verdient gemacht. (Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bilder im Geiste. Zur kognitiven und erkenntnistheoretischen Funktion piktorialer Reprasentationen. Amsterdam 1995.) Sachs-Hom bach, Klaus/Schurmann, Eva: Philosophie. In: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt am Main 2005, S. 110. Grundlegend: Kosslyn, Stephen: Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate. Cambridge, MA, 1994. Schwan, Stephan: Psychologie. In: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt am Main 2005, S. 125.
129
DENNIS JANZEN
Aligemeinen kritisch gesehen, haben sie doch hauptsachlich Abbildcharakter, ohne;
spezifisch mediale Aspekte zu transportieren. 17 Jenseits der wissenschaftlichen Diskussion nimmt sich Fight Club die Freiheit, Tyler Durden als mental-bildliches, aber handlungsfihiges Produkt einer schizophrenen Personlichkeitsstorungl8 vorzustellen.
Er steht somit einer rein reprasentationalistischen Bildauffassung entgegen und ist ei
ner magischen Auslegung entsprechend Referent und Bild zugleichl9, allerdings nicht
in einer Urbild-Abbild-Relation2o, sondern im Sinne einer spontanen, konstruktiven
Tatigkeit des Geistes, also als Subjekt-Objekt-Verbindung.21 Nur ganz selten lasstTy
ler sich mit einem Vorbild in Verbindung bringen - etwa, wenn er in der Wanne sitzt
wie ein doch noch lebendiger Marat.
Seine eigene Genese, die Bildwerdung eines Gedanken, ubertragt Tyler Durden nun
mit groEtem Eifer und unbandiger Energie auf seine Umwelt: Die Manner in den Fight Clubs mussen geformt, skulptiert werden, von keksteigweicher Masse in eisenharte Korper verwandelt werden ("wie gemeiEelt'(22). Wie schon Arnold Schwarzenegger werden auch die Kampfer zu "lebenden Skulpturen"23, treten start als Sklaven
der Dienstleistungsgesellschaft als vitalisierte Bilder des starken, schonen Mannes24: "Fight Club spielt mit dieser Ikonographie des extrem durchtrainierten mannlichen Korpers. Auf der ikonographischen Ebene bedient er die Fetischisierung des
mannlichen Korpers und seine Kodierung als fit fur den gegenwartigen Kampf der Gesellschaft "25.
Es ist aber nicht nur die Stahlung des Korpers, die yom Fight Club bestimmt wird,
sondern auch die Zerstorung oder zumindest Markierung desselben. Die "Sichtbar-
17 Ebd.: S. 125, vgl. auch die umfassende Diskussion bei Gottschling. (Gottschling, Verena: Mental Pictures: Pictorial? Perceptual? In: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung. Koln 2005 .)
18 Vgl. den Beitrag von Lisa Lorenz in diesem Band. 19 Es konnte auch daruber spekuliert werden, ob die Evolution der mentalen Bilder des Erzahlers
dem Peirce'schen Zeichenbegriff folgt. Dann ware der "Rorschachtest" ein Index, der Pinguin ein Symbol und Tyler ein Ikon.
20 AuBer, man geht davon aus, dass der "Tyler", der auf der Rolltreppe am Emhler vorbeifahrt und in ihm den Wunsch aufkeimen lasst, als ein anderer aufzuwachen, nichts auBer seiner visuellen Erscheinung mit dem mentalen Konstrukt "Tyler" gemein hat - dann hatte das TylerBild ein Vor- bzw. Urbild.
21 22 23
24
Sachs-Hombach/Schiirmann: Philosophie, S. 112. Fight Club, min. 42:46. Schwarzenegger, Arnold: Bodybuilding fur Manner. Munchen 1982, S. 258; Honer, Anne: Kleine Leiblichkeiten. Erkundungen in Lebenswelten. Wiesbaden 2011, S. 109. Kappert: Der Mann, S. 107.
25 Ebd.: S. 110.
130
BILDWERDUNG UND BILD(Z)ERSTORUNG. EIN KUNSTWISSENSCHAFTLICHER VERSUCH.
machung von Schmerz"26 ist das zentrale Element der von Tyler Durden organisierten Happenings. 1m Kampf platzt die skulpturale Oberfiache auf, wird zerschlagen und muss wieder genaht werden, es bleiben sichtbare Narben, die in ihrer Einzig
artigkeit einen fur Eingeweihte dechiffrierbaren visuellen Code ergeben.27
Aus der
Kunstgeschichte ist uns die Gleichzeitigkeit eines schonen, aber zerschlagenen Kor
pers aus Darstellungen Christi als "Schmerzensmann" bekannt und so verwundert es
auch nicht, dass die hochste Auszeichnung Tylers fUr seine verdienten Schmerzens
manner - die chemische Verbrennung auf dem Handrucken - letztlich der Man
dorlaform der christlichen Seitenwunde gleicht28. Tyler Durden, dessen Handeln als Erfahrungs- und Bildgestalter ihn als Kunstler ausweist,29 notigt den Mannern das
Opfer ihrer entindividualisierten Oberfiache ab und ermoglicht ihnen eine resozialisierte Auferstehung als Bildwerk mit eingeschriebener Bedeutung: ,,1 don't want to
die without any scars."30
II - Bild(z)erstorung
Dies ist allerdings nur der erste Schritt. Die neu geformten Mannerkorper werden im folgenden "Project Mayhem" in schwarze Uniformen gesteckt, ihnen wird der Schadel rasiert und ein neofaschistisches, erneut subjekt-, da namenloses System gegrundet. Man mag mutmaEen, dass Tyler Durdens Bildschaffungsakte stets doppel
bodig sind: Sein eigenes Erscheinen wird mit einer Bildstorung markiert, zunachst ist er nicht mehr als ein auffiackerndes Einzelbild im Filmstreifen. Einmal korperlich
manifestiert, beginnt er sich gegen andere Bilder zu wehren, sie subversiv oder ag
gressiv zu storen oder zu zerstoren. Sein Vorgehen ist dabei kein blinder oder ignoranter Bildersturm, sondern eine in Tylers nihilistischer Weltanschauung fundierte
Guerillaaktivitat: In Trickfilme - und es darf hier durchaus der Disneykonzern als Stellvertreter einer zu attackierenden Kulturindustrie assoziiert werden - schneidet er Einzelbilder aus Pornofilmen und gibt Anweisung zur Zerstorung von "Firmenkunstwerken". Einem Verwaltungshochhaus setzt er mit einem Brandanschlag ein Uicheln
26 Ebd.: S. 107. 27 V gl. auch die Beitrage von Sacha Szabo, Elke Regina Maurer und Iris Kohler in diesem Band.
28 V gl. auch Anm. 7. 29 Batschmann, Oskar: Der Kiinstler als Erfahrungsgestalter. In: Stohr, Jiirgen: Asthetische Erfah-
rung heute. Koln 1996. 30 Fight Club, min. 32:56.
131
Fassade. Sein Ikonoklasmus31 richtet sich aber nicht nur gegen l\.onzerndenk$ maler, auch den klassischen Kanon der Hochkunst erkennt er als hinfillig an:
die Mona Lisa verfillt. "32 Nur kurz zu sehen ist der Hinweis darauf, dass sich
Durden auch in den Iaufenden Kunstbetrieb einmischt. Unter den Zeitungsartik~i~: die seine (Un)Taten dokumentieren, findet sich die Schlagzeile "Performance ArtiSt molested"33. Letztlich zahlt nur der Tod als "hochmoderne Kunst"34 und auch den
Erzahler befillt in Folge der Drang, "etwas Schones kaputt(zu)machen"35.
Kurz springt Tylers Eigenart der Bildstorung auch in die Sphare des Betrachters iiber:
In einer Szene wendet er sich direkt, in einem leinwandfiillenden, radikalen close-up an den Zuschauer und halt ihm eine Standpauke. Diese ist so heftig, dass der Film
streifen im Raderwerk des Projektors scheinbar erschiittert wird und hin- und her
zuspringen beginnt. Bevor es durch die physikalische Belastung zu einem Filmriss
kommen kann, wendet Tyler sich ab "und sonnt sich in der eigenen Obermacht: Die Imago hat Laufen gelernt und verspottet seine Erzeuger"36. Fight Club wird an meh
reren Stellen von derart selbstreflexiven Momenten durchbrochen ("Mir fillt noch immer nichts ein!" - ,,Aha! Riickblendenhumor ... '(37). Auch das ist ein Ikonoklas
mus, erinnert er doch den Kinobesucher daran, sich nicht der Illusion des vorgespie
lten Bildes hinzugeben, sondern sich seiner Funktion als Rezipient eines technisch
apparativen Schauspiels zu besinnen.
Mit dem Verschwinden Tylers im Ietzten Drittel des Films wird die Bildfrage wie
der an die Identitatsfrage als Anfang des Dilemmas riickgebunden. Der namen
lose Erzahler verliert sein auBeres Bild, seine Mentalprojektion, und macht sich auf
die Suche nach Tyler. Was er erlebt ist ein "permanentes DeFl-vu"38, die Jagd nach
einem Unsichtbaren, quasi die Negation eines validen, verwert- und verhandelbaren
Welt-Bildes. Was er verloren hat, ist allerdings im Erfahrungsschatz seiner Umwelt angekommen. Fiir den Erzahler zunachst vollkommen unverstandlich, wird er als
Tyler wahrgenommen, die Metamorphose von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde (bzw. "Mr. Arsch '(39) hat sich vollzogen, sein AuBenbild wurde vollstandig iiberblendet. Deshalb
31
32 33 34 35
Grundlegend: Gamboni, Dario: Zerst6rte Kunst. Bildersturm und Vandalismus im 20. Jahrhundert. K6ln 1998. Fight Club, min. 45:18. Ebd.: min. 77:53. Ebd.: min. 20:05. Ebd.: min. 93:04.
36 Kappert: Der Mann, S. 117 37 Fight Club, min. 124:37. 38 Ebd.: min. 105:28. 39 Ebd.: min. 113:13.
132
BrLDWERDUNG UND BrLD(Z)ERSTORUNG. ErN KUNSTWlSSENSCHAFTLICHER VERSUCH.
ist Losung des Konflikts auch mit der Zerstorung seines Gesichts verbunden: Durch
einen Schuss ins Gesicht macht der Erzahler sich unkenntlich ("Sie sehen furchtbar
aus, Sir, was ist passiert?'(40) und ersetzt das Bild des starken, iiberragenden Tyler Dur
den mit dem eines zerschundenen Mannes, der nicht einmal mehr Hosen tragt.
Der Film Fight Club stellt ebenso wie seine Figur Tyler Durden ein ambivalentes Bild
verstandnis aus: Sie sind sich ihrer Bildhaftigkeit bewusst und produzieren manisch
und lustvoll Bilder, die durchaus als schon oder asthetisch angesehen werden konnen _ der Film mit seinen technisch iiberragenden Kamerafahrten, den rhythmischen
Schnitten, der Licht- und Farbinszenierung, die Figur als Erfahrungsgestalter und
Trainer der kunstvoll modellierten Mannerkorper. Gleichzeitig ist ihnen ein tiefes
Misstrauen vor Bildern eingeschrieben, so dass diese - kaum erschaffen - sofort wieder dekonstruiert werden miissen. Aus den Helden der Fight Clubs wird eine Armee kahler, namenloser "Weltraumaffen"41, aus dem stylischen Actionkino ein selbst
reflexives "theatre of mass destruction"42. Auf der narrativen Ebene endet der Film
dann auch mit einer letzten Bildzerstorung: In gewaltigen Explosionen vergeht die
bestimmende Architektur einer Metropole. Auf der filmischen Ebene wird dieses nun eben doch wieder schone Bild aus der kulturindustriellen Traumfabrik aber ebenfalls
gestort: Mit dem erneuten Aufblitzen eines Porno-Bildes wirdder Zuschauer in den
Abspann entlassen.
40 Ebd.: min. 128:53. 41 Ebd.: min. 86:26. 42 Ebd.: min. 02:31.
133
Batschmann, Oskar: Der Kiinstler als Erfahrungsgestalter. In: Stohr, Jiirgen: Asthetische Erfahrung heute. Koln 1996.
Fight Club (USN Deutschland 1999, R: Fincher, David).
Gamboni, Dario: Zerstorte Kunst. Bildersturm und Vandalismus im 20. Jahrhundert. Koln 1998.
Gorrschling, Ven~n:l! Ment!ll Pictures: Pictorial? Perceptual? In: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung. Koln 2005.
Honer, Anne: Kleine Leiblichkeiten. Erkundungen in Lebenswelten. Wiesbaden 2011 .
Kappert, Ines: Der Mann in der Krise oder: Kapitalismuskritik in der Mainstreamkultur. Bielefeld 2008.
Kosslyn, Stephen: Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate. Cambridge, MA, 1994.
Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bilder im Geiste. Zur kognitiven und erkenntnistheoretischen Funktion piktorialer Reprasentationen. Amsterdam 1995.
Sachs-Hombach, Klaus/Schiirmann, Eva: Philosophie. In: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt am Main 2005.
Schwan, Stephan: Psychologie. In: Sachs-Hombach, Klaus (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden. Frankfurt am Main 2005.
Schwarzenegger, Arnold: Bodybuilding fur Manner. Miinchen 1982.
134
BILDWERDUNG UND BILD(Z)ERSTORUNG. EIN KUNSTWISSENSCHAFTLICHER VERSUCH.
BBQ_ART7
135