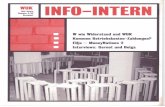Bildungsstandards M8 - Wie kommen die offiziellen Zahlen zustande und was sagen sie (nicht) aus
„Sah Adam Smith ein europäisches Wirtschaftssystem kommen? Versuch einer historischen...
Transcript of „Sah Adam Smith ein europäisches Wirtschaftssystem kommen? Versuch einer historischen...
Geschichtswissenschaftliches Bachelorseminar
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schmale
Institut für Geschichte Universität Wien
070002 SE Seminar Sommersemester 2014
Thema der Lehrveranstaltung: „Europa im 18. Jahrhundert“
Thema der Arbeit: „Sah Adam Smith ein europäisches Wirtschaftssystem kommen? Versuch einer historischen
Wahrnehmungsanalyse von Konzeptionen und Realitäten des Kapitalismus“
Name:………………………………….…………Maximilian Gruber Adresse:……………..……….Zehnergasse 12, 2700 Wiener Neustadt Telefonnummer:……………………..………………..0699/17178611 Email-Anschrift:……………………[email protected] Studienrichtung:……………………….BA Geschichte (Version 2012) Matrikelnummer:……………………………………………..1000331
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung……………………………………………………….…………………………………3
2. Theoretische Grundlagen……………………………………………….………………………….4 2.1 Grundbegriffe von Adams Smith’ Wohlstand der Nationen……………………………………..4 2.1.1 Die Arbeitsteilung als Grundüberlegung……………………………………………………….5 2.1.2 Eigennutz - habgierige Selbstsucht oder geläutertes Selbstinteresse?……………………………………………………………….6 2.1.3 Monopolisten am Markt, das „einfache System der natürlichen Freiheit“ und die „unsichtbare Hand“…………………………………………6 2.2 Immanuel Wallersteins World-System-Theorie als Deduktion historiographischer Beobachtungen…………………………………………….……8 2.2.1 Der Kapitalismus als dominierendes Niveau der Weltwirtschaft………………………………9 2.2.2 Zentrum und Peripherie………………………………………………………………….……..9 2.2.3 Faktoren für die Inkorporierung in das Welt-System…………………………………………11 2.3 Resümee………………………………………………………………………….……..………12
3. Sah Adam Smith das Weltsystem kommen? Textanalyse des Wohlstands der Nationen……………………………………………………..………………12 3.1 Ein gemeinsamer Markt……..……………………………………………………….…………13 3.2 Fehlende Freiheiten in den untersuchten Regionen - Europa und der Rest der Welt im Vergleich……………………………………………………………..15 3.3 Die Schattenseiten europäischer Wirtschaftspolitik in den Kolonien…………………………..17 3.4 Faktoren für wirtschaftliche Prosperität und solche, die sie verhindern………………………..20 3.5 Europas Vorteile und Zukunft in den Kolonien…………………………………………………23
4. Conclusio…………………………………………………………………………………………24
5. Anhang……………………………………………………………………………………………28 a) Zitate……………………………………………………………………………………………28 b) Bibliographie…………………………………………………………………………..…….…29
!2
1. Einleitung Der umfassenden Theorie wirtschaftlichen Handelns, die Adam Smith mit seinem Wohlstand der
Nationen am Ende des 18. Jahrhunderts, wird seit geraumer Zeit und bis in die Gegenwart als eine
der Grundlagen des liberal-kapitalistischen Wirtschaftssystems in Wissenschaft und Politik zuteil. 1
Wenngleich auch mittlerweile eine Vielzahl an Definitionen von Kapitalismus koexistieren, sind die
Wurzeln dieser Wirtschaftsform ungeachtet der Möglichkeit ihrer Ausdifferenzierung beispielsweise
in ländertypischen Formen von Kapitalismus in Europa zu verorten; durch dessen Expansion
bedingt lässt sich jedoch von einem globalen Phänomen sprechen, das auch Räume erreicht hat, in
denen niemals ein europäischer Staat direkte politische Kontrolle ausgeübt hat. Trotzdem einige 2
Forderungen Adam Smith’ vor allem im 19. Jahrhundert in seiner Heimat Großbritannien umgesetzt
wurden , scheint die aktuelle wirtschaftliche Verfassung vieler Regionen der Welt, obwohl in den 3
Weltmarkt eingebunden, weit von Smith’ Konzeptionen entfernt zu sein.
Die vorliegende Arbeit möchte sich jedoch nicht damit beschäftigen zu klären, in wie weit Adam
Smith’ Konzeptionen Realität geworden sind - zu groß erscheinen die noch immer bestehenden
Ungleichheiten zwischen ‚reichen‘ und ‚armen‘ Regionen, als dass man von einem für alle Parteien
wohlstandsförderlichen System ausgehen könnte. Sie möchte vielmehr klären, ob und zu welchem
Grade auch Adam Smith bereits in seiner Lebenszeit vergleichbare Ungleichheiten konstatierte und
was seine Einstellungen dazu waren. Sie will weiters feststellen, von welchem Blickwinkel aus er
auf die Wirtschaft seiner Zeit blickt und welche Erfolge und Mängel er dabei entdeckt.
Diese Fragestellungen setzen voraus, dass Adam Smith bereits so etwas wie ein Weltsystem des
Handels sah und seine Theorie auch anhand dessen und für dieses entwickelte. Um diese
Arbeitshypothese auf ein theoretisches Fundament zu betten, sollen zunächst einige der zentralen
Forderungen Adam Smith’ für ein idealtypisches Wirtschaftssystem skizziert werden, um sie
anschließen mit Immanuel Wallersteins Welt-System-Theorie zu kontrastieren. Dies soll zeigen, wie
die von Smith verwendeten Begrifflichkeiten in retrospektiven theoretischen Ansichten neue
Konnotationen und Wertigkeiten bekommen. Des Weiteren soll dadurch überhaupt erst die
Vorstellung eines Weltwirtschaftssystems, wie es auch bereits für die Zeit Adam Smith’
angenommen wird, konkretisiert werden.
vgl. Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit I. München: 19824, S.715, sowie Recktenwald, Horst Claus: „Adam 1
Smith“, Einführung der 2009 bei Zweitausendeins erschienenen Lizenzausgabe der Franz Stöpel-Übersetzung von Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Frankfurt am Main: 2009, S.15.
vgl. Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: 2011, S.954. 2
vgl. Winkler, Heinrich August: Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert. 3
München: 2009, S.257. !3
In einem weiteren Schritt sollen diese theoretische Grundlagen bei einer eingehenden Textanalyse
herangezogen werden, um die hier formulierten Forschungsfragen einer Antwortmöglichkeit
zuzuführen. Die abschließende Conclusio dient der Zusammenführung der Ergebnisse jener
Analyse und der Synthese der daraus gewonnenen Erkenntnisse.
2. Theoretische Grundlagen Um die Frage zu klären, in wie weit Adams Smith’ „Wohlstand der Nationen“ ein europäisches
Wirtschaftssystem vorwegnimmt, das schließlich alle Teile der Erde umspannt, ist es notwendig, ein
theoretisches Fundament für die Annahme eines derartigen Systems zu schaffen. Mit seiner seit
1974 erscheinenden und mittlerweile vier Bände umfassenden Reihe „The Modern World-System“ 4
hat Immanuel Wallerstein ein bis heute viel diskutiertes und auch kritisiertes Beispiel für einen
derartigen Forschungsansatz geliefert. In einem ersten Schritt ist es jedoch notwendig, relevante 5
Kernpunkte des Wohlstandes zu skizzieren, welche eine Vorstellung der von Smith konzipierten
Wirtschaftsform geben und darüber hinaus zum terminologischen Verständnis der Skizzierung der
Welt-System-Theorie, sowie zur Erleichterung der darauffolgenden Textanalyse entscheidend
beitragen.
2.1 Grundbegriffe von Adams Smith’ Wohlstand der Nationen Smith’ umfangreiches Werk beinhaltet nicht nur eine detaillierte Vorstellung von erfolgreichem und
vor allem für Individuum und Gesellschaft profitablem wirtschaftlichen Handeln, sondern vermittelt
auch eine Vielzahl an moralischen und sozialen Implikationen. Aufgrund der wirtschafts-
geschichtlichen Ausrichtung dieser Arbeit werden die ethisch-moralphilosophischen Denkanstöße,
zu denen der Wohlstand anregt, zugunsten der für den Entwurf seines liberal-kapitalistischen
Wirtschaftssystems zentralen Aspekte vernachlässigt. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf
denjenigen Bereichen, die auch in die Wallersteinsche Welt-System-Theorie Eingang gefunden
haben.
vgl. Wallerstein, Immanuel: The Modern World-System I-IV. New York/San Diego/London: 1974, 1980, 1989, 2011. 4
Zur Kritik an Wallerstein siehe u.a. Frank, André Gunder / Gills, Barry K. (Hg.): The World-System: Five Hundred 5
Years or Five Thousand? London / New York: 1993. In dieser Publikation, zu der auch Immanuel Wallerstein selbst beigetragen hat, wird Wallensteins ursprüngliches Konzept des Welt-Systems, das er um 1600 in seiner Entstehung ansetzt, aufgrund seiner zeitlichen Eingrenzung modifiziert und erweitert, wie bereits der Titel belegt. Weil jedoch die generelle Existenz eines derartigen Welt-Systems eine Konstante auch in Revisionen des Wallerstein-Konzeptes darstellt, erscheint letzteres von ungebrochener Aktualität und Relevanz für die Forschungsfragen dieser Arbeit.
!4
2.1.1 Die Arbeitsteilung als Grundüberlegung
Basis für die Theorie Adam Smith’ ist die Annahme von Arbeit „als [...] Quelle des jährlichen
Einkommens der Bewohner eines Landes“ . Daraus wird ersichtlich, welch essentielle Bedeutung 6
Smith der „jährliche[n] Arbeit eines jeden Volkes“ beimisst. Wie ertragreich die Arbeit ist, hängt 7
vor allem von der „Geschicklichkeit, Fertigkeit und Einsicht“ ab, mit der diese durchgeführt wird. 8
Diese drei Faktoren werden durch die Arbeitsteilung gewährleistet , welche es dem Arbeiter 9
erlaubt, sein gesamtes Augenmerk auf eine einzelne, spezialisierte Tätigkeit zu richten und ihn
ermuntert, sich der „Erfindung zahlreicher Maschinen, welche die Arbeit erleichtern und abkürzen
und einen Mann instand setzen, die Arbeit vieler zu verrichten“ . Die Ursache für diese 10
Innovationskraft sieht Smith zudem in dem Streben des Menschen nach mehr Freizeit. Wesentlich 11
an seiner Konzeption der Arbeitsteilung ist auch die Koppelung derselben an die Entstehung und die
Extension des Marktes. Ausgehend von dieser Überlegung lässt sich ein Kreislauf feststellen, bei 12
dem jede Vertiefung der Arbeitsteilung die Produktivität und damit schließlich auch die
Realeinkommen steigert, was wiederum, aufgrund der gesteigerten Kaufkraft, zu einer Ausdehnung
des Marktes führt. Dank dieses Prinzips wird laut Smith nicht nur die allgemeine Wohlfahrt der 13
Bevölkerung, sondern vielmehr deren Wohlstand sichergestellt. Nichtsdestotrotz ist sich Smith der 14
möglichen negativen Auswirkungen der Arbeitsteilung bewusst; im Besonderen geht er auf die
Auswirkungen auf das Bildungsniveau der Bevölkerung ein. Als Ausgleich gegen dieses 15
Phänomen rät Smith zur Förderung der Bildung auch in den ärmeren Schichten der Bevölkerung
und fordert sogar die Einführung einer Art allgemeiner Schulpflicht. 16
Kromphardt, Jürgen: Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus. Göttingen: 2004, S.72.6
WN, 43 = Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 7
London, 1776. Übers. v. Franz Stöpel. Frankfurt am Main: 2009, S.43.
WN, 43.8
WN, 49.9
WN, 53.10
vgl. WN, 55.11
vgl. WN, 64.12
vgl. Kromphardt 2004, S.74.13
vgl. WN, 56. Siehe Anhang a), Zitat 1.14
vgl. WN, 871.15
vgl. WN, 874-875.16
!5
2.1.2 Eigennutz - habgierige Selbstsucht oder geläutertes Selbstinteresse?
Als Grund für die Arbeitsteilung nimmt Smith einen Trieb des Menschen zu tauschen an, der den
Handel und damit schließlich eine Ausweitung von Arbeitsteilung und Markt antreibt. Jedoch ist 17
es nicht Selbstlosigkeit, die diese Neigung erweckt, ebenso wenig, wie sich die „wenigsten
spezialisieren [...] um das Los der Menschheit zu verbessern“ . Es handelt sich dabei um das 18
Selbstinteresse des Menschen sich die Güter, derer er zum (Über-)Leben bedarf bzw. die ihm das
Leben angenehmer machen, im Austausch gegen andere Güter (in primitiven Gesellschaften) oder
Geld (welches wiederum ein Tauschmittel für andere Güter ist), anzueignen. Obwohl dies zwar in 19
gewisser Weise eine egozentrische Haltung repräsentiert, zieht sie laut Smith keine negative
Konsequenzen für Gesellschaft und/oder Umwelt nach sich, sondern befördert im Gegenteil durch
die Investition erhaltener Gewinne die weitere Mobilisierung der Arbeitskraft und das „Gedeihen
der Gesellschaft.“ Der Unternehmer muss schließlich auch Gewinn machen, um die für die 20
Produktion notwendige Arbeit bezahlen zu können. 21
2.1.3 Monopolisten am Markt, das „einfache System der natürlichen Freiheit“ und die „unsichtbare Hand“ Für Smith ist es natürlich, dass sich dank der Arbeitsteilung das Kapital in den Händen einiger
Personen akkumuliert und diese jenes zur Anstellung von Arbeitskräften verwenden werden, um
schließlich Produktion und Profit zu steigern und damit eine weitere Ausdehnung des Marktes zu
erwirken. Während er daran noch nichts Verwerfliches findet, geht er streng mit Monopolisierung 22
und damit einhegenden Preisdiktaten ins Gericht: Seiner Meinung nach trachten Monopolisten
durch eine ständige Unterversorgung des Marktes sowie durch eine Nicht-Erfüllung der Nachfrage
danach, ihre Produkte deutlich über ihrem natürlichen Preis abzusetzen und ihren persönlichen
Profit zu Lasten der Konsumenten zu steigern. Für Adam Smith sind Monopole, wie auch jegliche 23
andere Handelsbeschränkungen und staatliche Eingriffe in die Wirtschaft ein Gräuel, denn für ihn
WN, 59. 17
Winter, Helen/ Rommel, Thomas: Adam Smith für Anfänger. Der Wohlstand der Nationen. 18
München: 20104 , S. 67.
vgl. WN, 60-61.19
WN, 321.20
vgl. WN, 97.21
vgl. WN, 97.22
vgl. WN, 111.Siehe Anhang a), Zitat 2.23
!6
ist „Zweck und Ziel aller Produktion […] der Verbrauch“ und nicht die Befriedigung der 24
persönlichen Interessen der produzierenden Kapitalisten. Diese seien nur insofern zu berücksichten,
als sie der Förderung der Konsumenteninteressen dienlich sind. 25
Er zeichnet den Kapitalismus als den Interessen des Konsumenten zuarbeitendes System, in dem
starke Konkurrenz am Markt die Preise stets auf einem für den Käufer akzeptablen Niveau halten.
Bei Aufhebung eben jener Beschränkungen bzw. Begünstigungen „stellt sich das einleuchtende und
einfache System der natürlichen Freiheit von selbst her“ . In diesem System habe jede(r) das 26
Recht, solange er/sie sich im legalen Rahmen bewegt, die Möglichkeit, sich in Konkurrenz mit den
anderen Marktpartien in Bezug auf seine/ihre Arbeit und Kapital zu begeben. Diese natürliche 27
Freiheit ermöglicht dem einzelnen Individuum Profiterwerb auf dem Markt, wobei dieser jedoch
nicht das Leitmotiv der Gesellschaft darstellen soll. Als vorrangigstes Ziel der Wirtschaft sieht
Smith viel mehr „das Interesse der großen Masse des Volkes“ , das heißt das Bedürfnis und Recht 28
der Konsumenten, ihre auf dem Markt erstandenen Produkte zum bestmöglichen Preis zu
erwerben. Die Interessen von Konsumenten und Kapitalisten sieht Smith dementsprechend 29
einander diametral entgegengesetzt. Seine Wirtschaftsform steht jedoch eindeutig vor allem im
Dienste der Konsumenten. Die von ihm geforderte unternehmerische Freiheit wird dabei nicht zum
befördernden Faktor chaotischer Gesetzlosigkeit, sondern viel als Garant des Wohlstand der
Gesellschaft. Obwohl also diese Freiheit also gewissermaßen durch die konsumentenorientierte 30
Preisregulation des Marktes limitiert wird, werden die Kapitalisten durch „eine unsichtbare Hand“ 31
dazu veranlasst, einen ursprünglich nicht dezidiert von ihnen intendierten Zweck erreichen zu
wollen. Dieser bestünde laut Smith darin, dass jedwede Person, ihr Kapital zur Unterstützung des
innländischen Gewerbefleißes und zur Wertsteigerung ihres Produkts zu verwenden sucht und damit
das die jährlichen Einnahmen des Volkes zu vergrößern sucht. Mit anderen Worten ist es die 32
unsichtbare Hand, die der Gesellschaft aus dem eigennützigen Handeln des Einzelnen Nutzen
WN, 747. 24
vgl. WN, 747. 25
vgl. WN, 775. 26
vgl. WN, 775. 27
WN, 568. 28
vgl. WN, 568. 29
vgl. Kromphardt 2004, S.84.30
WN, 524.31
vgl. WN, 524. 32
!7
bringt. Obwohl dies die einzige wörtliche Nennung dieses Begriffs im gesamten Wohlstand ist,
wurde der Begriff aus gutem Grund zu einem der bekanntesten Schlagwörter Adam Smiths: Er ist
der hypothetische Faktor, der eine die individuelle Freiheit betonende und befürwortende
Wirtschaftstheorie gleichsam zu einer auf das Gemeinwohl orientierten Gesellschaftstheorie macht.
Nicht nur Immanuel Wallersteins Welt-System-Theorie, derer für den Analyseteil dieser Arbeit
relevante Aspekte im Anschluss skizziert werden sollen, sondern eine ganze Reihe von Historikern
und Wirtschaftstheoretikern konstatierten jedoch die Schwäche dieser unsichtbaren Hand als
leitendem Aspekt einer selbstregulativen Marktwirtschaft, die Kapitalisten (und bisweilen auch den
kapitalistisch agierenden Staat) weg von ihrem auf ihre eigene Profitsteigerung orientierten
Eigennutz hin zu einem Handeln im Interesse der Anhebung des allgemeinen Wohlstandes in einer
Gesellschaft zu leiten. 33
2.2 Immanuel Wallersteins World-System-Theorie als Deduktion historiographischer Beobachtungen Die Theorie von einem von Europa ausgehenden weltumspannenden Wirtschaftssystem entwickelt
Immanuel Wallerstein anhand detailreicher wirtschafts- und sozialhistorischer Analysen, welche
vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des Ersten Weltkrieges reichen. Die darin von ihm erstellten
Konzepte können als Anlehnung und Ergänzung zur kurz zuvor erstmals und 1979 in ihrer
kompletten Fassung publizierten Studie „Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe -
XVIIIe siècle“ von Fernand Braudel gelesen werden, wenngleich sich der Untersuchungszeitraum 34
und die Begrifflichkeit in gewissen Punkten bei beiden Historikern unterscheiden. Nichtsdestotrotz
stimmen sie in zentralen Punkten weitgehend überein, welche grundlegend für die Annahme eines
europäischen Welt-Systems sind. Darüber hinaus konstatiert die Theorie Wallersteins auf Grundlage
der Geschichtsanalyse, aus der sie deduziert wird, dass viele der von Smith erdachten Konzeptionen
entweder nicht oder in abgewandelter Form realisiert worden sind, wobei gerade einige der Punkte,
die bereits Smith kritisierte, unter dem Deckmantel des Liberalismus umgesetzt oder fortgeführt
worden sind.
vgl. Berend, Ivan T.: Markt und Wirtschaft. Ökonomische Ordnungen und wirtschaftliche Entwicklung in Europa seit 33
dem 18. Jahrhundert. Göttingen: 2007, S.16 u. 19. Als Beispiele für interventionistische Ansätze werden unter anderem die Theorien von John Maynard Keynes und Karl Polanyi genannt, welche jeweils ein Eingreifen des Staates als Regulativ unter bestimmten Voraussetzungen befürworten. Siehe auch Keynes, John Maynard: The End of Laissez Faire. London: 1927, S. 5, 35, 39, 49, 52 & Polanyi, Karl: The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Hill: 1964, S.135, 214, 216f.
vgl. Braudel, Fernand: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe - XVIIIe siècle, tome I-III. Paris: 1979. 34
!8
2.2.1 Der Kapitalismus als dominierendes Niveau der Weltwirtschaft
Anders als etwa in marxistischen Ansätzen, die den Kapitalismus gewissermaßen als zu
überwindendes Evolutionsstadium der Gesellschaft sehen , stellt er in der Konzeption Wallersteins 35
eher eine Ebene oder ein Niveau der Wirtschaft dar, innerhalb dessen eine auf Arbeitsteilung
basierende geographisch-hierarchische Ordnung der verschiedenen Regionen besteht. 36
Kapitalistisches Wirtschaften ist dabei jedoch auch die dynamische Komponente, welche zur
Entstehung eines weltumspannenden Wirtschaftssystems führt. Akteure dieser Wirtschaftsform 37
sind zunächst vor allem auf den Fernhandel und den Handel mit Luxusgütern spezialisierte
Kapitalisten, welche monopolisierend auf die von ihnen bedienten Märkte einwirken und dabei vom
zweiten wichtigen Akteur, dem sich konsolidierenden modernen Staat, gefördert und geschützt
werden. Als eindrucksvolles Beispiel ist unter anderem die Niederländische Ostindische 38
Kompanie zu nennen, welche Wallenstein als „Prototyp einer kapitalistischen
Handelsgesellschaft“ gilt. Beförderer der Ausweitung des kapitalistischen Systems ist somit nicht 39
ein auf Nachfrage hin orientierter Markt, sondern die Profitinteressen von monopolisierend auf den
Markt (beziehungsweise die Märkte) einwirkenden Akteure. Um nachvollziehen zu können, was
genau Wallerstein mit kapitalistischem Wirtschaften meint und wie die Akteuere dieses
Wirtschaftens in den verschiedenen Regionen wirtschaftliche Freiheit oder Abhängigkeiten vom
Zentrum befördern, ist die für das System konstitutive Arbeitsteilung zwischen verschiedenen
Regionen zu beachten.
2.2.2 Zentrum und Peripherie
Essentiell für kapitalistisches Wirtschaften ist, wie bereits bei Smith zu sehen (siehe 2.1.1), das
Vorhandensein von Märkten, auf denen Akteure Handel treiben und interagieren können. Diese 40
sind jedoch in der Theorie von Immanuel Wallerstein nur der Aktionsraum, der, wie bereits zuvor
angedeutet, die Interaktion der verschiedenen Akteure zwischen den verschiedenen regionalen
Bereichen des Systems ermöglicht. Diese Bereiche sind schließlich in Zentrum, Peripherie,
vgl. Kromphardt 2004, S.155-158. 35
vgl. Vries, Peer: „Global Economic History: A Survey“, in: Schneider, Axel / Woolf, Daniel (Hg.): The Oxford 36
History of Historical Writing. Oxford: 2011, S.125.
vgl. Vries 2011, S.125.37
vgl. Vries 2011, S.124.38
Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem II - Der Merkantilismus. Europa zwischen 1600 und 1750. Wien: 39
1998, S.49.
vgl. Vries 2011, S.124.40
!9
Semiperipherie, sowie externe Bereiche zu differenzieren, welche sich durch ihre jeweilige 41
arbeitsteilige Funktion und ihre hierarchische Stellung innerhalb ihrer Wechselwirkungen
konstituieren. Im Zentrum sind dabei nach Wallerstein freie und (im Verhältnis zur Peripherie) gut
bezahlte und spezialisierte Arbeit zu finden, während die Peripherie sich durch unfreie und schlecht
bezahlte Arbeit und die Produktion von im Vergleich zu den im Zentrum hergestellten Waren
weniger wertvollen Gütern auszeichnet. Der Markt führt dabei entgegen der Konzeption Adams 42
Smiths nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung des Wohlstandes aller Marktparteien, sondern zu
einer hierarchischen Unterordnung der Peripherie unter das Zentrum, wobei erstere entsprechend
ihrem Platz in der Kette der Arbeitsteilung vor allem Rohstoffe für den kapitalistischen Weltmarkt
liefern muss, während in zweiterem das Mehrprodukt des erweiterten Marktes abgeschöpft werden
kann. Des Weiteren kennzeichnet das kapitalistische Weltsystem, dass vom Zentrum ausgehend 43
ein beständiges Drängen nach Kapitalakkumulation besteht, was es von vorangegangenen Welt-
Systemen unterscheidet. Gerade das 18. Jahrhundert sieht Wallerstein als entscheidende 44
Expansionsperiode dieses kapitalistischen und auf Europa zentrierten Welt-Systems, in der das auf
Nordwesteuropa zentrierte europäische Weltsystem immer größere Regionen inkorporierte, indem
es sie im Zuge der Ausweitung des europäischen Marktes als Folge der gesteigerten Produktion in
seine Peripherie aufnahm. Dabei ist für das 18. Jahrhundert vor allem der indische Subkontinent 45
zu nennen, welcher durch die zahlreichen britischen Interventionen (direkt und indirekt durch die
Britische Ostindische Kompanie) in die Peripherie des europäischen Welt-Systems rückte und damit
das mehr und mehr isolationistische China von seinem Platz in den externen Bereich verdrängte,
mit teils gravierenden Folgen für die bisher dort bestehenden sozioökonomischen Strukturen. 46
Auch der Status als externer Bereich ist dabei nicht zwingend mit einer vollkommenen
Abkapselung der betreffenden Region vom Welt-System zu verstehen, sondern verweist nur darauf,
dass diese Bereiche nicht in die vom Zentrum motivierte Arbeitsteilung eingebunden sind. Die
Amerikas waren dieser Theorie folgen bereits im 16. und 17. Jahrhundert Peripherien Europas,
vgl. Wallerstein 41
vgl. Vries 2011, S.124. 42
vgl. Wallerstein, Immanuel: The Modern World-System III. The second era of great expansion of the capitalist world-43
economy 1730 - 1840s. San Diego: 1989, S.138.
vgl. Wallerstein, Immanuel: „L’Occident, le capitalisme et le système-monde moderne“, in: Sociologies et sociétés 44
22/1: 1990, S.19. Siehe Anhang a), Zitat 3.
vgl. Wallerstein 1989, S.67, 124-125, 129.45
vgl. Wallerstein 1989, S. 137, 138-140 u. S.167. 46
!10
nahmen im 19. Jahrhundert jedoch verschiedene Entwicklungspfade. Während Lateinamerika 47
trotz erlangter politischer Unabhängigkeit peripher blieb, konnte Nordamerika ins Zentrum des
kapitalistischen Weltsystems aufrücken. 48
2.2.3 Faktoren für die Inkorporierung in das Welt-System
Die Entwicklung zu einem weltumspannenden System des Kapitalismus erfolgt über die
Inkorporierung neuer Regionen, welche gleichsam in die dem System inhärente Arbeitsteilung
eingebunden werden. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass diese Eingliederung jedoch nicht von
Akteuren der inkorporierten Regionen initiiert wird, sondern vielmehr als Konsequenz des
Expansionsbedürfnisse der Weltwirtschaft gesehen werden muss. In einem ersten Schritt treten 49
Regionen Wallerstein zufolge jedoch in die Peripherie und nicht ins Zentrum des Welt-Systems ein,
verbunden mit den zuvor geschilderten Konsequenzen der Arbeitsteilung, welche grundsätzlich an
ein Sinken des Lebensstandards in den betroffenen Räumen verknüpft ist. Darüber hinaus werden 50
durch die Eingliederung zwangsläufig die politischen Strukturen der jeweiligen Region mit dem im
Zentrum bestehenden Staatssystem verbunden, was für die betroffenen Strukturen entweder die
Entwicklung zu einem Staat innerhalb dieses Systems oder zur Absorbierung durch einen bereits
bestehenden Staat führt. Es ist letztlich dieses kompetitive Staatensystem, welches einen 51
entscheidenden Antrieb der Dynamik des Kapitalismus darstellt. Entgegen Smithschen 52
Erwartungen müssen die durch die Inkorporierung entstehenden Handelsströme keineswegs frei
sein, sondern werden im Gegenteil im Regelfall von den starken Akteuren des Zentrums
eingeschränkt beziehungsweise kontrolliert. Ebenso benötigt das hier entworfene kapitalistische 53
Wirtschaftssystem nicht zwingend geordnete Verhältnisse, um in bisher nicht externe Regionen zu
expandieren, sondern vielmehr für die Durchsetzung seiner arbeitsteiligen Bedürfnisse günstige
Bedingungen, zu deren Behauptung auch die Zerstörung bestehender Strukturen beitragen kann. 54
vgl. Vries 2011, S.124.47
vgl. Vries 2011, 125. 48
vgl. Wallerstein 1989, S.129. 49
vgl. Wallerstein 1989, S.125.50
vgl. Wallerstein 1989, S.170. 51
vgl. Vries 2011, S.125.52
vgl. Wallerstein 1989, S.170.53
vgl. Wallerstein 1989, S.188: „The promotion of ‚anarchy‘ often serves to bring down ‚unfavorable order‘, that is, 54
order that ist capable of resisting incorporation.“!11
Zusammengefasst blieb die Realisierung einer wirklichen wirtschaftlichen Freiheit im Sinne von
Abschaffung aller Handelshemmnisse durch den Staat und die Zurücknahme monopolisierender
Tendenzen durch Kapitalisten auch in der Hochzeit des Liberalismus im 19. Jahrhundert aus. 55
2.3 Resümee
Zusammenfassend sind Märkte ein entscheidendes Charakteristikum für kapitalistisches
Wirtschaften. Während Smith darin jedoch die Möglichkeit sieht, den allgemeinen Wohlstand durch
Arbeitsteilung und gesteigerte Produktivität zu steigern, hebt Wallerstein die durch die
Marktprozesse hervorgerufene geographische Hierarchie hervor, bei der bestimmte Randregionen
des Systems arbeitsteilig Waren herstellen, deren Mehrwert zu einem Großteil im Zentrum landet.
Für Smith stellt Eigennutz die Triebfeder für marktwirtschaftliches Engagement von Individuen dar,
wobei deren Monopolisierungstendenzen durch den Staat in seinem eigenen Interesse verhindert
werden sollten. Wallerstein konstatiert jedoch, dass unabhängig vom staatlichen Eingreifen in einem
derartigen System zwangsläufig Peripherie und Zentrum in dem skizzierten
Abhängigkeitsverhältnis bestehen müssen und der Zentrum-Staat dabei auch gar kein Interesse
daran hat, solche Tendenzen zu verhindern, solange die Freiheiten im Zentrum dadurch
aufrechterhalten werden können. Die Prozesse, die Wallerstein bei der Inkorporierung neuer
Regionen und das Weltsystem schildert und die immer mit einer Extension des Marktes des
Zentrums und ein hierarchischen Unterordnung der Peripherie verbunden sind, sieht Smith im
Entwurf seines Wirtschaftssystems aufgrund der ausgleichenden Wirkung des Marktes zunächst
nicht. Es bleibt jedoch Aufgabe des Analysenteils dieser Arbeit, zu untersuchen, ob und bis zum
welchen Grad nicht auch Adam Smith derartige Ungleichheitsproblematiken erkannte und
thematisierte.
3. Sah Adam Smith das Weltsystem kommen? Textanalyse des Wohlstands der Nationen. Im Folgenden soll anhand ausgewählter Bereiche, die auf die im Theorieteil skizzierten Konzepte
im Besonderen Bezug nehmen, analysiert werden, ob und inwiefern Adam Smith das von ihm
entworfene Wirtschaftsmodell im Spektrum eines globalen, auf Europa zentrierten Welt-Systems
verstand und welche Position er auf die herrschenden wirtschaftlichen Verhältnisse vertrat. Dabei
sollen speziell die Sichtweisen Adam Smith’ auf Europa und seine bereits zu seiner Lebenszeit
bestehenden Kolonien, sowie auf die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Europa und dem
vgl. Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem IV: Der Siegeszug des Liberalismus (1789-1914). Wien: 2012, 55
S.122. !12
Rest der Welt untersucht werden. Auf Grund der Dichte an Bezügen werden im Folgenden fünf
Bereiche ausgewählt, die durch ihre Konkretheit und Eindringlichkeit, mit der Smith sie
ausformuliert, besonders hervorstechen.
3.1 Ein gemeinsamer Markt
Ein besonderer Umstand, den Smith bereits für seine Lebenszeit konstatiert, ist die Verflechtung der
Märkte Europas und des Restes der Welt. S.66: Laut Smith seien bereits die positiven
Auswirkungen der Handelsbeziehungen zwischen Mutterland und Kolonie sichtbar und würden
auch auf beiden Seiten positive Effekte nach sich ziehen. Als Beispiel nennt er die maritimen 56
Handelsverbindungen zwischen London und dem (ost-)indischen Kalkutta, welche dank der
Schifffahrt einen gemeinsamen Markt entwickelt haben und damit beiderseitig die jeweiligen
Industrien anspornen. Die Schifffahrt hat dabei für ihn einen besonders dynamischen
Wirtschaftsvorteil, den er beispielsweise auch als Ursache für den Aufstieg der Altägyptischen
Hochkultur mit seiner Lage am langen und schiffbaren Nil, oder für die lange Tradition von
fortschrittlichem Ackerbau und Gewerbe in Bengalen und China. All diesen Kulturen spricht er 57
jedoch ab, sich im Außenhandel entschieden engagiert zu haben, sodass er ihren Reichtum ihren
Einkünften aus dem auf Schifffahrt basierenden Binnenhandel zurückführt. Regionen, die auf 58
derartige Handelswege nicht zurückgreifen konnten wie etwa das Landesinnere Afrikas oder
Sibirien, stünden deshalb bis in Smith’ Gegenwart so weit zurück, dass er gar von ihrem
„barbarischen und unzivilisierten Zustande“ weiß. 59
Weiters beschreibt Smith die gegenseitigen Abhängigkeiten der verschiednen Märkte weltweit, vor
allem in Bezug auf die Verwendung von Edelmetallen. So werde japanisches Kupfer beispielweise 60
aufgrund seiner Ergiebigkeit in Europa, peruanisches Silber in Europa und China gehandelt. Der
Markt für diese Metalle erstreckt sich laut Smith „über die ganze Welt“ , die Preise in der einen 61
Regionen wirken sich demgemäß auch auf alle anderen Regionen aus. Er konstatiert auch die
marktbefördernde Wirkung des amerikanischen Silbers, das zur Vergrößerung des europäischen
vgl. WN, 66.56
vgl. WN, 67.57
vgl. WN, 68.58
WN, 68.59
vgl. WN, 232.60
WN, 233.61
!13
Marktes und zu einer Steigerung von Kultur und Gewerbefleiß in ganz Europa, ja sogar in seiner
Meinung nach ärmeren und weniger entwickelten Regionen wie Schweden, Dänemark oder
Russland geführt. Auch in Amerika selbst sei ein neuer Markt für das Produkt seiner Silberminen 62
entstanden, zum ersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte sei es etwa in den Regionen der
spanischen und portugiesischen Kolonien zur Entstehung von Märkten gekommen. Außerdem 63
werde das amerikanische Silber im Ostindienhandel eingesetzt, einerseits direkt mittels der aus
Acapulco abreisende Handelsschiffe, andererseits indirekt und in einem noch größeren Umfang
über Europa. Dabei stechen laut Smith zwar zunächst die Holländer und Portugiesen mit ihrem
Engagement in Ostindien heraus, jedoch bestünde selbst von Russland her eine rege
Handelsbeziehung mit China über den Landweg. Vermittler zwischen China und Indien, „den 64
großen Märkten des Orients“ einerseits und Europa andererseits ist somit das Silber der Neuen 65
Welt, wobei Smith von florierenden Verknüpfungen und einem weit ausgedehnten Markt spricht. 66
Insgesamt wird also deutlich, dass Smith einen sich über die entferntesten Regionen der Welt
erstreckenden Markt annimmt, der mit der einerseits der Errichtung von Kolonien dienlich ist,
andererseits durch diese gefestigt wird. Dies wird klar, wenn Smith von der Entdeckung Amerikas
und des Seewegs um das Kap der Guten Hoffnung als wichtigste Ereignisse der
Menschheitsgeschichte spricht. Diese haben die Ausdehnung des Marktes ermöglicht und 67
befördert, die Motivation zu derartigen Unternehmungen beäugt Smith jedoch, wie später erörtert
werden soll, sehr kritisch. Auch wenn er von den Vorteilen, „die Europa aus der Entdeckung
Amerikas und des Weges um das Kap der Guten Hoffnung nach Ostindien“ spricht , wird klar, dass 68
er eindeutig Europa als den Profiteur dieser Ereignisse sieht. Interessant ist, dass Smith dabei gezielt
versucht, eine gesamteuropäische Perspektive einzunehmen, indem er Europa „als einziges großes
Land betrachtet.“ Dabei stellt er fest, dass die gewonnenen Vorteile vor allem in der erhöhten 69
Verfügbarkeit von Genussmitteln und einem gesteigerten Gewerbefleiß in Europa bestehen. Dies 70
vgl. WN, 269.62
vgl. WN, 270. 63
vgl. WN, 272.64
WN, 273.65
vgl. WN, 274.66
vgl. WN, 710.67
WN, 672.68
WN, 672.69
WN, 672.70
!14
betreffe überdies nicht nur die dank ihrer Kolonien direkt mit der Neuen Welt Handel treibenden
Länder wie England, Frankreich, Spanien und Portugal, sondern auch indirekt in Verbindung
stehende Regionen wie Flandern oder Deutschland und sogar Ungarn oder Polen, welche er den
rückständigeren Gebieten Europas zurechnet; obwohl diese Regionen zwar nichts in die Amerikas
exportieren, würde doch auch in ihnen eine beständige Nachfrage nach Genussmitteln wie
Schokolade und Tabak aus der Neuen Welt bestehen . 71
Obwohl ein weltumspannender Markt in den Augen Smith’ besteht, kritisiert er zahlreiche
Mechanismen der Wirtschaftspolitik, wobei vor allem der Bereich der Monopole, wie später
ausgeführt werden soll, in sein Blickfeld tritt (siehe3.3)
3.2 Fehlende Freiheiten in den untersuchten Regionen - Europa und der Rest der Welt im Vergleich
Neben der Ausdehnung des europäischen Marktes untersucht Adam Smith jedoch auch die
wirtschaftlichen Bedingungen in den europäischen Ländern selbst. Der Grundtenor von Smith’
Ausführungen wird dabei jedoch bereits in der Betitelung des untersuchten Kapitals sichtbar: Auf
sehr aussagekräftige Weise nennt er den zweiten Teil des zehnten Kapitels von Buch eins des
Wohlstandes „Ungleichheiten, welche durch die europäische Wirtschaftspolitik veranlaßt sind“ . 72
Bereits damit wird klar, dass Smith eine sehr ambivalente zur europäischen
(Kolonial-)Wirtschaftspolitik einnimmt, die er im folgenden Kapitel anhand seiner Kritik an
bestehenden Freiheitsbeschränkungen vor allem durch die Zünfte in England, Frankreich und
Schottland exerziert. Wenngleich ihm Schottland aufgrund des dortigen Fehlens von Vorschriften 73
in Bezug auf die Lehrzeiten von Gewerben als das Land mit den freiesten Arbeitsbedingungen gilt,
sieht er diese jedoch nirgendwo in Europa in vollem Maße vorhanden. Die Folgen seien für die 74
europäische Wirtschaft fatal: Damit verhindere die europäische Wirtschaftspolitik nicht nur die
Entstehung eines wirklich kompetitiven Marktes für eine Vielzahl an Gewerbezweigen, sondern
führe im Gegenteil zu einer verschärften Ungleichverteilung von Arbeits- und Kapitalvorteilen. 75
Während einerseits etwa die erwähnten Lehrzeitbeschränkungen die Konkurrenz innerhalb gewisser
vgl. WN, 673.71
WN, 176.72
vgl. WN, 178-179.73
vgl. WN, 153.74
vgl. WN, 189. 75
!15
Gewerbe beschränke, werde sie in anderen Bereichen künstlich aufgeblasen und führe daher zum
nämlichen Ungleichgewicht in der Arbeits- und Kapitalverteilung.
Das Fehlen von Freiheit zeigt sich jedoch auch für Smith in anderen Bereichen, die sich auch in der
Kolonialpolitik niederschlagen. Smith stellt die amerikanischen Kolonien Englands die anderer
Staaten gegenüber und stellt fest, dass erstere außer im Bereich des Außenhandels so gut wie überall
eine Freiheit genießen, die anderen Kolonien aufgrund der Herrschaftspolitik ihrer Mutterländer
fehlt. Dies gilt auch für den Bereich der Sklaverei, wenngleich Smith hier die Vorteile von, wie er 76
sagt „absoluten Regierungen“ herausstreicht, wobei er Spanien, Portugal und Frankreich nennt. 77
Diese würden durch ihre direktere Kontrolle ihrer Untertanen eine geringere Willkür der Herren
gegenüber ihren Sklaven bewirken. Im Gegenzug seien jedoch bei absoluten Regierungen die 78
Beamten des Staates der Willkür der Herrschenden ausgesetzt. Dies bewirke insgesamt, dass die 79
englischen Kolonien Nordamerikas auch in der Karibik dank ihrer Freiheit fortschrittlicher seien,
als etwa die französischen Inseln mit Zuckerrohranbau, die unter der Willkürherrschaft des
Mutterlandes stehen. Die in seinen Augen bessere Behandlung der Sklaven in den französischen
Kolonien befürwortet Smith jedoch, wenngleich er aber die Sklaverei insgesamt als unselig und
unrecht empfindet. Die Tatsache dieses Unrechts sowie die Beraubung des kolonisierten Landes 80
von den dortigen indigenen Bevölkerungen kritisiert Smith als Leitmotive der europäischen
Kolonialpolitik scharf. 81
Adam Smith sieht also in vielen Bereichen noch nicht das Maß an Freiheit erfüllt, wie er für sein
Wirtschaftssystem einfordert. Neben den nach wie vor bestehenden Schranken der Arbeitsmobilität
innerhalb Europas prangert er vor allem die Sklaverei an, die die gängige Arbeitsform etwa auf den
Zuckerrohrplantagen der Karibik darstellt. Dies wird dadurch verständlich, dass Smith gut entlohnte
Arbeit als wichtigen Faktor einer florierenden Wirtschaft ansieht , zumal dies den Fleiß und die 82
Reproduktion der Arbeiterklasse gewährleiste. Freie Arbeit ist Sklavenarbeit daher in jedem Falle 83
vgl. WN, 666.76
WN 667.77
vgl. WN, 669.78
vgl. WN, 668.79
vgl. WN, 669. 80
vgl. WN, 670.81
vgl. WN, 125.82
vgl. WN, 134.83
!16
vorzuziehen. Jedoch ist es ein anderer Aspekt, den Smith als das schwerwiegendste Fehlen von 84
Freiheit wahrnimmt: Das monopolistische Verhalten der europäischen Wirtschaftspolitik in Bezug
auf ihre Kolonien.
3.3 Die Schattenseiten europäischer Wirtschaftspolitik in den Kolonien
Die grundsätzlich ablehnende Haltung Adam Smith’ gegenüber Monopolen ist bereits geschildert
worden (siehe 2.3.1). Das Monopol sei grundsätzlich der „Feind guter Wirtschaft“ , die 85
Kapitalisten die größten Profiteure von Monopolen am inländischen Markt. Genauso gravierend 86
sind laut Smith jedoch Monopole im Außenhandel, was er am Beispiel des portugiesischen
Monopols auf Weineinfuhr nach England exerziert. Der im Verhältnis schon aufgrund der
geographischen Lage billigere französische Wein könne nur deshalb nicht eingeführt werden, weil
die Grundsätze von „Krämern“ zu Grundsätzen des Staates geworden sind: Die Portugiesen seien 87
bessere Kunden für englische Fabrikate, daher sei ihrem Wein der Vorzug zu geben. Er spricht sich
gegen eine derartige „Ungerechtigkeit der Beherrscher“ aus, welche mit wirtschaftlichen 88
Schranken dieser Art die Prosperität der Allgemeinheit eindämmen. Darüber hinaus kritisiert er die
Habsucht der Kapitalisten, die schließlich den Nährboden für eine derartige Wirtschaftspolitik
bereitet haben. Er möchte sie überdies niemals an der Herrschaft beteiligt sehen, weil sie gelenkt
würden vom erwähnten Monopolgeist, der ihr Interesse über das Allgemeinwohl stellt.
Dieser Monopolgeist hat laut Smith wie bereits angedeutet jedoch auch im Handel mit den
Kolonien Einzug genommen. Es sei die gängige Praxis seiner Zeit, den Handel mit der jeweiligen
Kolonie durch das jeweilige Mutterland zu monopolisieren. Als Beispiel zieht er sein Heimatland 89
Großbritannien und dessen Monopolisierung des Amerikahandels von englischen Häfen aus heran.
Von einer Aufhebung dieser Schranke erhofft sich Smith die nämliche Steigerung von
Genussmittelverfügbarkeit und Gewerbefleiß wie in Europa auch für die amerikanischen Kolonien
und damit eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung, als dies ohnedies schon der Fall ist.
Smith erkennt in diesem Zusammenhang auch die eindeutige Übervorteilung all jener Staaten
gegenüber England, die nur indirekt am Handel mit Kolonialwaren aus den englischen Kolonien
vgl. WN, 133.84
WN, 209.85
vgl. WN, 528.86
WN, 567. 87
WN, 568. 88
vgl. WN 674 u. 676.89
!17
Nordamerikas beteiligt sind; durch die aus der Monopolstellung Englands resultierende
Möglichkeit, einen entsprechend hohen Preis für die Kolonialwaren von den anderen zu verlangen,
würde die Industrie Englands Impulse erhalten, die allen anderen verwehrt bleiben. Am konkreten 90
Beispiel der Tabakproduktion Marylands kritisiert er dabei explizit die Entscheidungen der
englischen Regierung vor allem in Bezug auf die so genannte Navigationsakte, die das englische
Monopol auf den Kolonialhandel mit englisch Nordamerika errichtete und zu einem massiv Abzug
ausländischen Kapitals aus England geführt habe. Die negativen Auswirkungen müsse dabei 91
jedoch nicht England selbst tragen, sondern die Kolonien, die zwar auch nach Verabschiedung der
Navigationsakte ihr Handelsvolumen steigern, jedoch nicht in dem Maße von ihrem Außenhandel
profitieren konnten, wie sie es unter wirklich freien Handelsbedingungen hätten tun können. Er 92
sieht zudem trotz der zunächst gesteigerten Einnahmen durch das Monopol eine unmittelbare
Gefahr für England, weil der Abfluss von ausländischem und die Konzentration von englischem
Kapital in den beziehungsweise im Kolonialhandel durch die daraus resultierenden Abhängigkeiten
Unsicherheit für die Industrie, den Handel und letztlich den Staat selbst erzeugt habe. In einer 93
Abschaffung der Handelsschranken sieht er die einzige Möglichkeit, die Gefahr für Großbritannien
langfristig zu bannen und erwähnt als warnendes Beispiel den Ausschluss Großbritanniens vom
Kolonialhandel der Niederlande und die Weigerung der nordamerikanischen Kolonien, sich auf die
Einfuhr englischer Waren zu beschränken, was nur durch „vorübergehend[e] und zufällig[e]“ 94
Ereignisse zu keinen wirtschaftlichen Einschnitten für England geführt habe. Als eines der
Ereignisse nennt Smith die erfolgte erste polnische Teilung, welche den polnischen Markt nun auch
englischen Waren geöffnet und eine starke Nachfrage generiert habe. Polen ist somit also bei 95
Smith für den europäischen Markt als Absatzgebiet eröffnet worden, wie bereits zuvor gezeigt
worden ist (siehe 3.1).
Neben England zieht Smith jedoch auch andere europäische Länder heran, um die negative
Auswirkung von Monopolen festzumachen. Explizit erwähnt werden unter anderen Portugal und
Spanien, wo anders als England „die schlimmen Folgen des Monopols“ die Vorteile, die diese 96
vgl. WN, 676.90
vgl. WN, 678.91
vgl. WN, 679.92
vgl. WN, 687.93
WN, 690.94
vgl. WN, 690.95
WN, 693.96
!18
Länder aus dem Kolonialhandel gezogen haben, überbieten konnten. Diese drücken sich vor allem
darin aus, dass die Handelsgewinne der Kapitalisten zwar durch das Monopol leicht gesteigert sind,
jedoch insgesamt die Zunahme des Kapitals innerhalb der Gesamtgesellschaft dadurch gehemmt ist:
, weil die Gewinnsumme nicht so hoch steigen kann, wie sie es unter Bedingungen eines freien
Markten könnte. Dieser kleine Vorteil ist dem Gemeinwohl somit schädlich. 97 98
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die negativen Auswirkungen von monopolisiertem
Kolonialhandel ist die vollständige Auslagerung des Ostindienhandels der Niederlande an die deren
Ostindische Kompanie. Wie auch beim Beispiel der englischen Ostindischen Kompanie 99
ersichtlich, schadet dies nicht vordergründig den Niederlanden selbst, sondern vor allem den
Ländern wie etwa Schweden oder Dänemark, deren Kapital mit der Ostindien-Kompanie als
Handelsgesellschaft wenig produktive Arbeit in den Niederlanden unterstützt. Smith rät diesen 100
Ländern, ihre Waren besser teurer bei anderen Nationen einzukaufen oder ganz auf sie zu
verzichten, um nicht ein von einem monopolisierenden Unternehmen getragenes Wirtschaften zu
fördern.
Das durch Eroberung von der englischen und holländischen Ostindien-Kompanie implementierte
System hält Smith überdies für verderblich, wobei er vor allem die holländische Praxis kritisiert,
Ernteerträge aus dem Gewürzanbau zwecks Aufrechterhaltung des hohen Preises zu vernichten. 101
Im Falle des englischen Engagements in Ostindien sieht er ähnliche Tendenzen, den Ertrag der von
der Kompanie kontrollierten Gebiete einseitig zulasten der potenziellen Ertragssteigerung zu
steuern, wenngleich die Anstrengungen diesbezüglich noch nicht so weit fortgeschritten seien, wie
im niederländisch kontrollierten Gebiet. Mit Nachdruck pocht er auf die Schädlichkeit von
Monopolen, vor allem für jene Länder und Räume, die unter die Herrschaft der Monopolisten
geraten, womit er also vor die Bevölkerungen in den von europäischen Handelsgesellschaften
kontrollierten Gebieten Ostindiens meint. 102
Bei einem weiteren Vergleich der Kolonien mit Europa zieht Smith Parallelen zwischen dem
Weinbau in Europa und dem Zuckeranbau in der Neuen Welt, welche beide weniger Ertrag liefern,
als vom europäischen Markt nachgefragt wird und dadurch einen im Vergleich zu dem Preis, der bei
vgl. WN, 695-696.97
vgl. WN, 697.98
vgl. WN, 717.99
vgl. WN, 718.100
vgl. WN, 722.101
vgl. WN, 728.102
!19
Ausschöpfung der potentiellen Produktionskapazität erreich werden könnte, hohe Gewinne
abwerfen. Dasselbe Problem sieht er beim mittlerweile von den englischen Kolonien Virginia und 103
Maryland monopolisierten Tabakanbau in Nordamerika, wobei dabei die Situation durch die
Zollpolitik der europäischen Staaten verschärft werde: In dem Irrglauben, einzelne Tabakgüter in
Europa schwieriger Besteuern zu können, als die gesamte Tabakeinfuhr beim Zoll, habe man den
Anbau gänzlich verboten. Um den Preis unnatürlich hoch zu halten, würden in den 104
nordamerikanischen Kolonien bei ertragreichen Ernten gewissen Tabaks verbrannt, ganz ähnlich
wie bei den erwähnten Gewürzverbrennungen durch die Niederländer in Ostindien. 105
Smith stellt diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine ganze Reihe weiterer Faktoren
gegenüber, die die wirtschaftliche Entwicklung hemmen und fördern und geht dabei wiederum mit
einigen Vorgehensweisen der Europäer scharf ins Gericht.
3.4 Faktoren für wirtschaftliche Prosperität und solche, die sie verhindern
Bei einem grundsätzlichen Vergleich der Lebensstandards in Europa und Afrika kommt Smith zu
dem Schluss, dass diese aufgrund des technischen Fortschritts Europas nur schwerlich miteinander
vergleichbar sind; es herrsche nämlich ein viel höherer Standard in Europa. Er führt dies jedoch 106
nicht auf eine generell fehlende Disposition der Menschen dieser Region zu wirtschaftlichem
Handeln zurück. Wie bereits dargelegt (siehe 2.1.2), sieht Smith den Menschen allgemein zu
solchem Handeln durch seinen Handelstrieb befähigt, welcher die Arbeitsteilung und den Markt
befördere. Handeln wird bei Smith somit zu einer anthropologischen Grundkapazität und zu 107
einem entscheidenden Prozess in einer prosperierenden Gesellschaft. S.121: Ein weiteres
entscheidendes Merkmal wirtschaftlichen Fortschritts ist für Smith ein starkes
Bevölkerungswachstum, weil dieses auf die Reproduktion der Arbeiterklasse und damit die eine
beflügelte Produktion schließen lässt. Er prognostiziert Großbritannien und dem Rest Europas 108
erst für die nächsten 500 Jahre eine Verdopplung seiner aktuellen Einwohnerzahl, ganz im
vgl. WN, 218-219. 103
vgl. WN, 220. 104
vgl. WN, 221.105
vgl. WN, 57-58.106
vgl. WN, 59 und 61.107
vgl. WN, 121 u. 134.108
!20
Gegensatz zu den nordamerikanischen Kolonien, die er im Aufwind sieht, weil die Bevölkerung
dort auch ohne Einwanderer massiv zunehme. 109
Als weiteren außereuropäischen Raum neben den nordamerikanischen Kolonien betrachtet Smith
China, das zwar seit langer Zeit „eines der fruchtbarsten, bestbebauten, gewerbefleißigsten und
bevölkertsten Länder der Welt“ gilt, jedoch für Smith in wirtschaftlichem Stillstand verharre. Vor 110
allem die Armut der Unterschichten kontrastiert Smith mit der Lage in Europa, und kommt zu dem
Schluss, dass selbst die ärmsten Regionen dieses Kontinents besser aufgestellt seien, als etwa die
chinesische Kanton-Region. Weil dort aber der Arbeitslohn schon seit langem gleich (niedrig)
bleibt, ist die Reproduktion der Arbeiter trotz der Ermordung der nicht ernährbaren Bevölkerung,
wobei Smith zum Gewerbe gewordene Kindstötungen schildert, sichergestellt. Obwohl diese 111
Schilderungen kritisch gelesen werden müssen, wird klar, dass Smith das China seiner Zeit im
Vergleich zu den europäischen Nationen inaktiv und starr betrachtet, ungeachtet des Alters und der
Fortschritte, die diese Kultur bereits erreicht hat.
In einem weiteren Schritt kontrastiert er die Situation Chinas mit jener der nordamerikanischen
Kolonien und Indien. Im von der Englischen Ostindienkompagnie kontrollierten Gebiet befinde 112
sich der Arbeitslohn laut Smith in Abnahme, was Grund für den Hungertod Hunderttausender trotz
des potenziellen Reichtums des Landes ist. Schuld sei die indirekte Kontrolle durch die Ostindische
Handelsgesellschaft, die nicht die gleiche Prosperität gewähre wie in den unter Schutz der
britischen Staatsverfassung stehenden nordamerikanischen Kolonien.
Diese ungleiche Rechtslage, zu der der bereits geschilderte Praxis der Sklaverei in Amerika noch
hinzukommt, ist jedoch einer der Faktoren des Reichtums Europas, die Smith im dritten Buch des
Wohlstandes in Form einer Analyse des Weges zum Reichtum der verschiedenen Nationen Europas
darlegt. Er zeichnet darin eine Wirtschaftsgeschichte des Kontinents vom Römischen Reich bis 113 114
in seine Gegenwart. Als Triebfeder des europäischen Fortschritts sieht er mit einem Wort die
Handelstätigkeit an und führt dafür den zwar über fremde Schiffe abgewickelten aber immer noch
bedeutenden Handel Spaniens und Portugals, sowie den auch nach zahlreichen Kriegen nicht
vgl. WN, 121.109
WN, 123.110
vgl. WN, 124.111
vgl. WN, 124-125. 112
vgl. WN, 447. 113
vgl. WN, 453.114
!21
verminderten Reichtum Flanderns an. Dabei kristallisiert sich bereits heraus, dass der Reichtum 115
des Kontinents oft zulasten anderer erworben wurde - vor allem zulasten der Kolonien.
Einen besonderen Einblick in Smith’ Ansichten diesbezüglich liefert das siebte Kapitel des vierten
Buches, Über Kolonien , wobei er vor allem nach der Motivation zur Gründung von Kolonien 116
durch die europäischen Staaten fragt. Dabei stellt er klar, dass es keine Notwendigkeit war, die die
Errichtung von Kolonien oder auch die Entdeckungsfahrten in ihrem Vorfeld beförderte , sondern 117
einzig die Hoffnung auf Reichtümer . Die Spanier seien dabei zwar auch mit der scheinheiligen 118
Vorgabe, die entdeckten Völker zum Christentum zu bekehren, Vorreiter gewesen, jedoch stünden
ihnen die anderen europäischen Nationen um nichts nach. 119
Neben der Frage nach der Gründung von Kolonien setzt sich Smith auch mit ihrem Gedeihen
auseinander, wobei Smith die „Kolonie eines zivilisierten Volkes“ als äußerst dynamischen 120
Wirtschaftsakteur betrachtet. Dabei wird die Geschichte der verschiedensten von europäischen
Nationen gegründeten Ansiedlungen in der Neuen Welt beleuchtet, im Besonderen geht er jedoch
zum wiederholten Male auf die englischen Kolonien in Nordamerika ein. Als Gründe für deren
ökonomische Dynamik führt er vier Aspekte an. Zunächst sind die große Verfügbarkeit von Land
und andererseits die Freiheit der Selbstverwaltung, von der bereits die Rede war, zu nennen. 121
Darüber hinaus sei durch die Kolonialgesetzgebung im Bereich der Landvergabe eine Situation
durch das Mutterland geschaffen worden, in der Landeigentümer ihre Ländereien bei ausbleibender
Bebauung abgeben müssen. Weiters sichert der niedrige Steuersatz auf Arbeit in den englischen 122
Kolonien, sowie die fehlende Verpflichtung zu etwa Verteidigungdiensten am Mutterland, diesen
einen größeren Anteil am Ertrag ihres Wirtschaftens, als dies in anderen Kolonien der Fall ist. Als 123
letztes Kriterium für den Erfolg der nordamerikanischen Kolonien Englands nennt Smith die
Tatsache, dass der Handel mit ihnen zwar ebenfalls durch das Mutterland monopolisiert, jedoch
vgl. WN, 490-491.115
WN, 635-728.116
vgl. WN, 637.117
vgl. WN, 641.118
vgl. WN, 644.119
vgl. WN, 645. 120
vgl. WN, 652.121
vgl. WN, 653.122
vgl. WN, 654.123
!22
nicht auf einen Hafen oder eine ausgewählte Handelsgesellschaft beschränkt ist. Dadurch sei den 124
dort hergestellten Produkten ein größerer und direkterer Absatzmarkt gesichert. Er begrüßt, dass 125
auch Frankreich eine derart liberale Politik eingeschlagen hat, zumal die Handelsgewinne
Frankreichs aus seinem Kolonialhandel seitdem gestiegen seien und daher für sich sprechen. 126
Auch begrüßt er die Handelsfreiheit zwischen den Kolonien Englands in Ost- und Westindien
(=Amerika), weil dies einen gemeinsamen Markt und, laut Smith, die wirtschaftliche Prosperität
aller Beteiligten befördere. 127
3.5 Europas Vorteile und Zukunft in den Kolonien
Wie bereits festgehalten worden ist, sieht Smith Europa als den eindeutigen Gewinner in Bezug auf
die Entdeckung der Neuen Welt und die weltweite Erschließung von Märkten (siehe 3.1). Trotz
dieser Vorteile sind einige seiner Perspektiven auf die Zukunft düster, sollten die Europa nichts an
ihrer momentanen kolonialen Wirtschaftspolitik ändern.
Obwohl die Kolonien zwar in der Praxis mehr kosten würden, als sie direkt an Steuereinnahmen
einbrächten, würden die neuen Produkte und der erweiterte Markt dieses Defizit für die
Mutterländer ausgleichen. Dass letztere sich jedoch durchwegs das Monopol auf den Handel mit 128
jenen neuen Produkten, wie auch die Dominanz auf den jeweiligen Kolonialmärkte sicherten, sieht
Smith, wie bereits bezüglich der Monopole beschrieben worden ist, äußerst kritisch. In der
Behauptung des Kolonialhandelsmonopols sieht Smith den eigentlichen Zweck jeglicher kolonialer
Anstrengungen Großbritanniens, wie auch der anderen Europäer. Die Profitgier und der Durst 129
nach Gold sei der eigentliche Motivationsfaktor der europäischen Nationen gewesen und habe
schließlich zum unheilvollen Monopol geführt, welches eine Steigerung des Gesamteinkommens in
den Kolonien und damit die Möglichkeit beschränkt, dass diese in naher Zukunft durch direkte
Steuereinkünfte die Ausgaben des Mutterlandes für sie decken könnten. Infolgedessen fürchtet 130
Smith fast schon prophetisch ein Auseinanderdriften von Mutterland und Kolonien speziell in
Bezug auf Großbritannien und seine nordamerikanischen Kolonien, vor allem aufgrund der
vgl. WN, 657-658. 124
vgl. WN, 656. 125
vgl. WN, 658. 126
vgl. WN, 662. 127
vgl. WN, 675-676. 128
vgl. 699. 129
vgl. WN, 702. 130
!23
Befürchtungen der Kolonisten, angesichts ihrer Unterrepräsentanz im Parlament auch politisch
unterdrückt zu werden. Er ahnt jedoch voraus, dass bei anhaltendem Wachstum die Kolonien 131
Englands in Nordamerika ihr Mutterland innerhalb von hundert Jahren was den Steuerertrag betrifft
überholen würde, mit nicht abzusehenden Konsequenzen für das Reich. Die besprochenen 132
Schlüsselereignisse der Menschheitsgeschichte haben laut Smith, wie bereits angeführt, eine
Ausweitung des europäischen Marktes bewirkt (siehe 3.1). Dies stellt für ihn jedoch nicht nur die
positive Errichtung weltweiter Handelsnetzwerke dar, sondern auch die Quelle teils verheerender
Folgen für die indigenen Bevölkerungen in den kolonisierten Gebieten, welche dadurch all ihre
Handelsvorteile letztlich verloren haben. Für die Zukunft stellt er jedoch ein Ende der 133
Ungerechtigkeit der Unterdrückung und eine Gleichheit unter unabhängigen Völkern in Aussicht,
maßgeblich durch Handel befördert, welcher „Mut und Kraft“ der Unterdrückten steigern könnte. 134
Darüber hinaus kritisiert er, wie in den Ausführungen zu Monopolen bereits konstatiert wurde, den
vom Status der amerikanischen Kolonien Englands gänzlich verschiedenen Zustand der unter der
Kontrolle europäischer Handelskompanien stehenden Gebiete Ostindiens. Besonders jene, die 135
unter der Herrschaft dieser Gesellschaften leben müssen, bemitleidet Smith aufgrund der ihnen
auferlegten, verderblichen Wirtschaftsform. Ein Zustand, den er im Interesse der dortigen 136
Bevölkerungen und der Wirtschaft der Mutterländer aufgehoben sehen möchte.
Zum Abschluss sollen nun die hier hergestellten Bezüge mit der theoretischen Grundlage dieser
Arbeit verglichen werden, um eine möglichst fundierte Beantwortung der Forschungsfrage(n) zu
gewährleisten.
4. Conclusio Betrachtet man die Analyseergebnisse zusammenfassend, so zeigt sich, dass Adam Smith bereits zu
seinen Lebzeiten ein durch Entdeckungen, Kolonialanstrengungen und Marktausweitungen Europas
bedingtes weltweites Wirtschaftssystem, was sich weitgehend mit Immanuel Wallersteins
Ausführungen zum Weltsystem deckt. Dies gerade deswegen, weil auch Smith klare
Rollenverteilungen innerhalb dieser Weltwirtschaft verortet, zumal er Europa als den Profiteur, alle
anderen als die ‚Leidtragenden‘ dieser Entwicklung ausmacht. Während Länder wie China in ihrer
vgl. WN, 707.131
vgl. WN, 710. 132
vgl. WN, 710. 133
WN, 711. 134
vgl. 721f. 135
vgl. WN, 728.136
!24
wirtschaftlichen Lage verharren und ihre Produkte durch die Besitzungen der Europäer in Ostindien
jedenfalls auf den europäischen Markt gelangen, haben bestimmte Regionen Europas wie Polen, das
Smith grundsätzlich als weniger entwickelt als beispielsweise England oder Frankreich sieht, es
geschafft, von den Markterweiterungen positiv zu profitieren. Nicht nur die Produkte der Neuen
Welt, sondern gerade auch die Handelsbeziehungen nach Asien wie im Falle Russlands bereichern
dort die jeweiligen Märkte. Dies deckt sich mit Wallersteins Aussage, wonach gerade Gebiete in
Osteuropa im 18. Jahrhundert Inkoporierungsprozessen ausgesetzt waren, die sie zumindest als
Peripherie in das kapitalistische Welt-System integrierten. Bei seinen Ausführungen versucht 137
Smith zudem gezielt, einen europäischen Standpunkt einzunehmen, um zu zeigen, wie der gesamte
Kontinent von der Ausdehnung seines Marktes über die ganze Welt profitiert hat.
Die inegalitäre Aufteilung der Profite innerhalb dieses Weltmarktes möchte Smith gerade durch
seine Theorie von wirtschaftlichem Handeln ausgeglichen sehen, zumal das bereits in seiner
Lebenszeit vorhandene Weltsystem des Handels eine Reihe von Ungleichheiten aufweist, die sich
mit seiner fast schon utopischen Vorstellung der Marktausdehnung und der Installierung des
natürlichen Systems der Freiheit nicht decken. Dies ist seiner Auffassung nach vor allem der
europäischen Wirtschaftspolitik geschuldet, die einerseits in Europa selbst unnötige Schranken etwa
im Bereich der Arbeitsmobilität setzt, andererseits vor allem in Übersee mit monopolistischem
Vorgehen nicht die Möglichkeiten ausschöpft, die es unter freieren Bedingungen genießen würde.
Die Sklaverei als unfreie Arbeitsform und die Behandlung der Ureinwohner der kolonisierten
Gebiete prangert Smith in dieser Hinsicht an, zumal sie nicht produktiv und daher wenig
kapitalfördernd ist. Sein schlimmstes Gräuel sind jedoch die Monopole, die zwischen den Kolonien
und ihren Mutterländern großteils bestehen. Wie retrospektiv gesagt werden kann, wurden viele der
von Smith bekrittelten Beschränkungen im Laufe des 19. Jahrhunderts abgebaut - die „heile Welt
des Freihandels“ hat jedoch nie zur Gänze nach Smith’schen Vorstellungen funktioniert. Diese 138
Ungleicherelation spiegelt auch Wallersteins Welt-System-Theorie wider, welche von einer
hierarchischen, auf Arbeitsteilung basierenden Ordnung zwischen den verschiedenen Welt-
Regionen ausgeht, wenngleich diese nicht zwangsläufig an Kolonialismus gekoppelt ist. Die
Unfreiheit der Arbeit, wie auch bei Smith in Form der Sklaverei oder auch in seinen Schilderungen
über die unfreie Arbeit in China, ist jedoch ein eindeutiges Charakteristikum für periphere Bereiche.
vgl. Wallerstein 1989, S.184f.137
Ambrosius, Gerold: Liberale vs. institutionelle Integration von Wirtschaftspolitiken in Europa. Baden-Baden: 2009, 138
S.29.!25
Smith sieht seine Ängste vor Monopolisierung auch bereits im Zustand einiger Kolonialreiche
seiner Zeit bestätigt, wenn er etwa vom Zustand Spaniens und Portugals schreibt. Auch in Bezug
auf letztere wird aber klar, dass die Vorteile aus dem Kolonialreich selbst trotz hoher Kosten für das
Mutterland immer bei diesem gelegen sind. Nicht nur diese Ungleichheit, sondern auch die
Motivation solche Reiche überhaupt zu gründen, lehnt Smith ab: Gier sei die eigentliche Triebfeder
dafür gewesen und sei es, wie die Ausbeutung weiter Teile Ostindiens durch europäische
Handelsgesellschaften für ihn belegen.
Dementsprechend warnt er auch vor Entwicklungen in den an sich prosperierenden
nordamerikanischen Kolonien Englands und nimmt damit einige Ereignisse vorweg, die sich nur
wenige Jahre nach der Veröffentlichung des Wohlstandes bewahrheiten sollten: Ein
Auseinanderdriften zwischen jenen Kolonien und dem Mutterland, welche die Ungleichheit, die
auch im Bereich der politischen Repräsentanz besteht, dank ihres raschen Bevölkerungswachstums
und ihrer daraus resultierenden wirtschaftlichen Stärke innerhalb der nächsten hundert Jahre
abschütteln könnten. Er hätte nicht richtiger liegen können.
Beachtlich ist die europäische Perspektive, die Smith bei seinen Beobachtungen einzunehmen
versucht. Dieser Fokus verstärkt den Eindruck, wonach Adam Smith das von ihm analysierte
Wirtschaftssystem nicht nur als auf Europa zentriert, sondern als genuin europäisch versteht. Wurde
im 18. Jahrhundert bereits ein europäisches Welt-System skizziert? Für Adam Smith trifft dies zu,
wenngleich er in seinem Wohlstand der Nationen nicht nur dieses Welt-System in seiner
bestehenden Form untersuchte und kritisierte, sondern vor allem einen Verbesserungsvorschlag
entwarf, der tatsächlich dafür intendiert war, sich für alle Beteiligten dieses Systems zu lohnen.
Dass es zwar bis in die Gegenwart Versuche gegeben hat, Smith’ Prämissen in der einen oder
anderen Form umzusetzen, beweist nicht zuletzt die Tatsache, dass auch heute von Institutionen wie
der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds Freihandel und andere Smith’sche
Prinzipien als richtungsweisend für den wirtschaftlichen Aufstieg von Entwicklungsländern
propagiert werden. Dabei ist oft auch die Arbeitsteilung ein Leitmotiv, wobei den betroffenen 139
Regionen geraten wird, sich auf die Produktion und die Ausfuhr der Waren zu spezialisieren, bei der
sie einen Kostenvorteil besitzen - was ihnen jedoch, wie die aktuelle ökonomische Situation in
vielen der ehemals kolonisierten Gebiete der Erde zeigt, zwar die Partizipation am internationalen
Handelssystem ermöglicht, darin aber eine hierarchisch niedrigere Position zuteilt. Dabei haben es
jedoch einige wenige Weltregionen, denen aufgrund ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen
vgl. Fieldhouse, David Kenneth: The West and the Third World. Trade, Colonialism, Dependence and 139
Development.Oxford: 1999, S.20. !26
Möglichkeiten schon von Smith ökonomische Stärke vorausgesagt wird, den Aufstieg ins Zentrum
des Weltsystems geschafft: Spätestens seit 1945 können die Vereinigten Staaten von Amerika als
weltweit agierende politische und ökonomische Größe angesehen werden, welche darüber hinaus
mit ihrem Einfluss in Weltbank, Internationalem Währungsfonds und anderen Institutionen wie
zuvor beschrieben Smith’sche Prämissen für Entwicklungsländer, aber auch ganz allgemein in ihrer
Wirtschaftspolitik anzuwenden sucht. Auch die aktuelle Debatte über das Transatlantische
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA belegt diese Intentionen.
Dass in Bezug auf Entwicklungsländer jedoch der einseitige Versuch, Regionen für den Welthandel
mittels internationaler Arbeitsteilung zu gewinnen, oft verheerende Folgen für diese und durchaus
keinen Wohlstand bringt und dass im Grunde auch bereits Adam Smith derartige Entwicklungen
skizziert hat, ist jedoch in den Köpfen der Proponenten des unbeschränkten Freihandels noch nicht
angekommen. Adam Smith’ Theorie stellt somit global betrachtet bis heute in meinen Augen eine
Utopie dar, wobei nur einzelne Punkte herangezogen werden, um egoistische oder zumindest
eigennützige Wirtschaftspolitiken zu propagieren. Auf die Einrichtung des „einleuchtende[n] und
einfache[n] System[s] der natürlichen Freiheit“ wartet der Großteil der Menschen bis heute. 140
WN, 775.140
!27
5. Anhang
a) Zitate
1 „Die große durch die Arbeitsteilung herbeigeführte Vervielfältigung der Produkte aller verschiedenen Künste ist es, die in einer wohlregierten Gesellschaft jene allgemeine Wohlhabenheit hervorbringt, die sich bis auf die untesten Stände des Volkes erstreckt. Jeder Arbeiter hat eine große Menge seiner Arbeitsprodukte [...] zur Verfügung. [...] [E]in allgemeiner Überfluß verbreitet sich durch alle Stände der Gesellschaft. (WN, 56)
2 „Indem die Monopolisten den Markt nie vollständig versorgen und die wirksame Nachfrage nie völlig befriedigen, verkaufen sie ihre Waren weit über dem natürlichen Preise, und steigern ihre Vorteile [...] weit über ihren natürlichen Satz.“ (WN, 111)
3 „[C]’est cette accumulation sans répit du capital qui peut être tenue pour sa principale activité et pour sa differentia specifica.“ (Wallerstein, Immanuel: „L’Occident, le capitalisme et le système-monde moderne“, in: Sociologies et sociétés 22/1: 1990, S.19)
4 WN 871, Bildung Im Fortschritt der Arbeitsteilung wird die Beschäftigung des größten Teiles derer, die von ihrer Arbeit leben, d.h. der großen Masse des Volkes, auf wenige sehr einfache Verrichtungen [...] beschränkt. Der Verstand der meisten Menschen wird aber selbstverständlich durch ihre gewöhnlichen Beschäftigungen beeinflusst. Der Mann, dessen ganzes Leben ein paar einfachen Verrichtungen gewidmet ist, deren Wirkungen vielleicht stets dieselben [...] sind, hat keine Gelegenheit, seinen Verstand anzustrengen oder seine Erfindungskraft zu üben, um Hilfsmittel gegen Schwierigkeiten aufzusuchen, die ihm niemals begegnen. Er verliert mithin natürlich die Gewohnheiten solcher Übungen, und wird gewöhnlich so dumm und unwissend, wie es ein menschliches Wesen werden kann. [...] Sie schädigt sogar die körperliche Rüstigkeit und macht ihn unfähig, seine Kraft in einem andern Geschäfte, als zu dem er erzogen ist, mit Anstrengung und Ausdauer zu gebrauchen. Seine Geschicklichkeit in seinem Gewerbe scheint also auf Kosten seiner geistigen, geselligen und kriegerischen Fähigkeit erworben zu sein. Dies ist der Zustand, in welchem in jedem zivilisierten Volke der arbeitende Arme, d.h. die Masse des Volkes, notwendig versinken muss, wenn die Regierung nicht Vorsorge dagegen trifft (WN 871).
!28
b) Bibliographie
Siglenschlüssel:
WN = Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, 1776. Übers. v. Franz Stöpel. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 2009 (Lizenzausgabe).
zitierte Literatur:
Aldcoft, Derek / Ville, Simon P. (Hg.): The European Economy 1750 -1914. A thematic approach. Manchester / New York: 1994.
Berend, Ivan T.: Markt und Wirtschaft. Ökonomische Ordnungen und wirtschaftliche Entwicklung in Europa seit dem 18. Jahrhundert. Göttingen: 2007
Fieldhouse, David Kenneth: The West and the Third World. Trade, Colonialism, Dependence and Development. Oxford: 1999.
Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit I. München: 19824.
Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: 2011
Recktenwald, Horst Claus: „Adam Smith“, Einführung der 2009 bei Zweitausendeins erschienenen Lizenzausgabe der Franz Stöpel-Übersetzung von Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Frankfurt am Main: 2009
Vries, Peer: „Global Economic History: A Survey“, in: Schneider, Axel / Woolf, Daniel (Hg.): The Oxford History of Historical Writing. Oxford: 2011, S.113-135.
Wallerstein, Immanuel: The Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s. London: 1989.
Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem IV. Der Siegeszug des Liberalismus (1789-1914). Wien: 2012.
Winkler, Heinrich August: Geschichte des Westens. Von den Anfängen in der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München: 2009.
!29
Konsultierte und weiterführende Literatur:
Aldcoft, Derek / Sutcliffe, Anthony: Europe and the International Economy 1500 to 2000. Cheltenham / Northhampton: 1999.
Ambrosius, Gerold: Liberale vs. institutionelle Integration von Wirtschaftspolitiken in Europa. Baden-Baden: 2009.
Crowley, John E.: „Neo-Mercantilism and The Wealth of Nations: British Commercial Policy after the American Revolution“, in: The Historical Journal 33 (2), Juni 1990, S.339-360.
Braudel, Fernand: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe - XVIIIe siècle, tome I-III. Paris: 1979.
Cipolla, Carlo M. /Borchardt, Karl: Europäische Wirtschaftsgeschichte 3: Die Industrielle Revolution. Stuttgart: 1985.
Cipolla, Carlo M. / Borchardt, Karl: Europäische Wirtschaftsgeschichte 4: Die Entwicklung der industriellen Gesellschaften. Stuttgart: 1985.
Jones, Eric Lionel: Das Wunder Europa. Umwelt, Wirtschaft und Geopolitik in der Geschichte Europas und Asiens. Tübingen: 1991.
Landes, David S.: The Wealth and the Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor. London: 1998.
Morrison, James Ashley: „Before Hegemony: Adam Smith, American Independence, and the Origins of the First Era of Globalization“, in: International Organisation 66 (3), Juli 2012, S.395-428.
North, Douglass / Thomas, Robert Paul: The Rise of the Western World. A New Economic History. Cambridge: 1973.
Pomeranz, Kenneth: The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton / Woodstock (UK): 2000.
Frank, André Gunder / Gills, Barry K. (Hg.): The World-System: Five Hundred Years or Five Thousand? London / New York: 1993.
Waites, Bernard (Hg.): Europe and the Wider World. Oxford: 1995.
Wallerstein, Immanuel: Das moderne Weltsystem II - Der Merkantilismus. Europa zwischen 1600 und 1750. Wien: 1998.
Winter, Helen/ Rommel, Thomas: Adam Smith für Anfänger. Der Wohlstand der Nationen. München: 2010.
!30