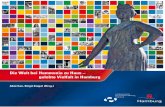Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriffs, in: P. Jung (Hg.), Europäisches...
Transcript of Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriffs, in: P. Jung (Hg.), Europäisches...
s |e | l |psellier european law publishers
| Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint Richterliche Eingriffe in den Vertrag
Droit privé européen: l’unité dans la diversitéL’intervention du juge dans le contrat
herausgegeben von / édité par Peter Jung
Sonderdruck
63
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s*
Ulrike Babusiaux
Eine altbekannte Divergenz zwischen dem deutschen und dem französischen Recht besteht hinsichtlich der Behandlung des sog. Wegfalls der Geschäft s-grundlage bzw. der théorie de l’imprévision im Privatrecht.1 Beide Institute be-treff en den „richterlichen Eingriff in den Vertrag“, das heisst den Fallentscheid, durch den der Richter den Vertrag umgestaltet oder aufh ebt, um ein vertrags-widriges oder vertragsinkonformes Verhalten zu erzwingen.2 Übereinstimmung besteht nach beiden Rechtsordnungen darüber, dass ein derartiger Vertrags-eingriff grundsätzlich einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Entsprechend sind für verschiedene besondere Vertragstypen Vorschrift en zu fi nden, die es dem Richter ausnahmsweise erlauben, den ursprünglichen Parteiwillen durch seinen eigenen zu ersetzen.3 Ob dem Richter hingegen allgemein die Befugnis zustehen soll, in der beschriebenen Weise in jeglichen Vertrag einzugreifen und unter welchen Voraussetzungen eine derartige generelle Eingriff skompetenz zulässig sein soll, ist eine auch innerhalb der Rechtsordnungen stark umstrittene Frage.
Das altbekannte Th ema erneut einer rechtsvergleichenden Prüfung zu unterziehen rechtfertigt sich daraus, dass mit dem Rapport Catala (RC) vom 22. September 20054 in Frankreich eine Diskussion um die Einführung der théorie de l’imprévision begonnen hat, die die herkömmlich strenge Vertrags-
* Der Beitrag sei dem Gedenken an Prof. Dr. Christian Autexier (24. Februar 1944 – 10. Dezember 2011) gewidmet.
1 Aus rechtsvergleichender Perspektive vgl. Cashin-Ritaine, Imprévision, Hardship und Störung der Geschäft sgrundlage, in: Helms et al. (Hg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswis-senschaft ler, 2001, 85-103; Fauvarque-Cosson, Le changement de circonstances, RDC 2004, 67-71 m.w.N.
2 Begriff nach Giger, Grundsätzliches zum richterlichen Eingriff in den Vertrag, Zeit-schrift des Bernischen Juristenvereins 105 (1969) 316.
3 Zum französischen Recht vgl. zuletzt Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 292, 296 m.w.N.; zum schweizerischen Recht vgl. nur Schmid, Schweizerisches Obli-gationenrecht, I, 9. Aufl . 2008, N 1286 m.w.N.; zum deutschen Recht siehe Brox / Walker, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 35. Aufl . 2011, 284 f.
4 Rapport Catala (Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription) einsehbar unter http: // www.justice.gouv.fr / art_pix / RAPPORTCATA LASEPTEMBRE2005.pdf (letzter Aufruf am 15.1.2012).
64
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
bindung im französischen Privatrecht in Frage stellt.5 Hinzu kommt, dass in Deutschland die Schuldrechtsmodernisierung von 2002 das zuvor richter-rechtlich anerkannte Institut des Wegfalls der Geschäft sgrundlage kodifi ziert hat (§ 313 BGB), das heisst eine gesetzliche Ermächtigung geschaff en hat. Die traditionelle Lösung über das Richterrecht fi ndet sich dagegen im schweizeri-schen Privatrecht, das neben dieser sog. clausula rebus sic stantibus den Grund-lagenirrtum als gesetzlich geregelten Fall der Geschäft sgrundlagenfrage kennt.
Ziel der folgenden Untersuchung wird mithin zum einen sein, die fran-zösischen Reformpläne an den Erfahrungen zu prüfen, die Deutschland mit der gesetzlichen Regelung des richterlichen Vertragseingriff s gemacht hat. Zum andern sind die französischen Lösungsansätze mit dem schweizerischen Sys-tem, einer Kombination von Richterrecht und Gesetzesrecht, zu vergleichen. Zu diesem Zweck sind zunächst die verschiedenen Reformvorhaben zur Zulas-sung der théorie de l’imprévision vorzustellen (A). Sodann ist die französische Reformdiskussion hinsichtlich Voraussetzungen und Wirkungen der théorie de l’imprévision mit dem Status quo in Deutschland und der Schweiz zu verglei-chen (B). Im letzten Schritt soll anhand des Vergleichs der drei Länder unter-sucht werden, ob es sinnvoll ist, den richterlichen Vertragseingriff gesetzlich zu regeln und welche Anforderungen gegebenenfalls an eine derartige Regelung zu stellen sind (C).
A. Die französischen Reformvorschläge aus den Jahren 2005 -2011
Auch wenn der Reformelan des französischen Gesetzgebers etwas ins Stocken geraten zu sein scheint,6 zeigen die verschiedenen Vorschläge, die sich seit dem Avant-Projet (RC) vom 22. September 2005 mit der imprévision beschäf-tigt haben, eine interessante Entwicklung der französischen Diskussion. Um die Darlegung nicht ausufern zu lassen, sei diese Entwicklung nur von ihrem
5 Grundlegend die Entscheidung Canal de Craponne = Cass. civ., 6 mars 1876, Syndicats des arrosants de Pélisanne c. de Gallifet et autres, D. 1876, I, 193 note Giboulot, S. 1876, I, 161, dazu Capitant / Terré / Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 12. Aufl . 2008, Nr. 163. Zum französischen Verwaltungsrecht vgl. CE 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, D. 1916, III, 25 concl. Chardenet, S. 1916, III, 17 sowie CE 9 déc. 1932, Compagnie des Tramways de Cherbourg, D. 1933, III, 17. Zu Unterschieden zur privatrechtlichen Th eorie vgl. zuletzt Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 341.
6 Durchgeführt worden ist bisher nur die Reform des Verjährungsrechts, vgl. Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Zur Reform des Vertragsrechts hat eine Konsultation zu Teilen der Reform stattgefunden, vgl. http: // www.textes.justice.gouv.fr / projets-de-reformes-10179 / reforme-du-regime-des-obligations-et-des-quasi-contrats-22199.html.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
65Ulrike Babusiaux
(vorläufi gen) Endpunkt her umrissen, das heisst mit Blick auf die Proposition de loi visant à permettre la renégociation d’un contrat en cas de changements de circonstances imprévisibles durant son exécution vom 22. Juni 20117 (PL). Dieser letzte Vorschlag, der auf eine parlamentarische Initiative zurückgeht, zielt auf die Einführung eines neuen Absatzes 2 in den berühmten Art. 1134 C. civ. Der neue Art. 1134 al. 2 C. civ. PL soll danach lauten: Si un changement de circonstances imprévisible, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant mais dois continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, le juge peut, si les parties en sont d’accord, procéder à l’adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fi n à la date et aux conditions qu’il fi xe. Die berühmte Aussage des ers-ten Absatzes Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites würde mithin im zweiten Absatz der Vorschrift für den Fall einer Umstandsänderung relativiert.8 Auch wenn die französische Doktrin diesen Vorschlag entweder ignoriert oder ablehnend kommentiert hat,9 zeigt er den-noch, dass sich in Frankreich ein Paradigmenwechsel vollzieht. Eindrücklich belegt dies ein Vergleich des Vorschlages mit der geltenden Gesetzesfassung (art. 1134 Abs. 2 C. civ.): Elles [sc. les conventions] ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Die wesentlichen Etappen dieser Entwicklung bis hin zur PL vom Juni 2011 lassen sich anhand der drei Reformprojekte zum Obligationenrecht nachvoll-ziehen: Es ist dies das Avant-Projet de Reforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil) vom 22. September 2005, besser bekannt unter dem Namen Rap-port Catala (RC).10 Weiter zu nennen sind das offi ziöse Projet de la Chancelle-rie (PC)11 vom September 2008 sowie der Reformvorschlag einer Gruppe von Wissenschaft lern unter der Leitung von Francois Terré, der sogenannte Rapport Terré (RT) vom Dezember 2008.12
7 Proposition de loi visant à permettre la renégociation d’un contrat en cas de changements de circonstances imprévisibles durant son exécution, vgl. http: // www.assemblee-natio nale.fr / propositions / pion3563.asp.
8 Zum Verhältnis dieser Vorschrift zur théorie de l’imprévision vgl. zuletzt Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 292, 297 f.
9 Vgl. Rome, Le droit des contrats à l’Assemblée nationale: Du grand n’importe quoi!, D. 2011, 1961: „A la vérité j’ai d’abord cru à une blague en lisant cette proposition (…)“.
10 http: // www.justice.gouv.fr / art_pix / RAPPORTCATALASEPTEMBRE2005.pdf. Im Folgenden RC.
11 http: // www.freshfi elds.com / download / publications / newsletter / paris / chancellerie.pdf. Im Folgenden PC.
12 Terré (ed.), Pour une réforme du droit des contrats. Réfl exions et propositions d’un groupe de travail, 2009, im Folgenden RT.
66
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
I. Changement de circonstances als Auslöser
Die drei Reformprojekte sind mit der PL von 2011 einig, als Auslöser der impré-vision eine Veränderung der vertraglichen Umstände, un changement de circon-stances, anzusehen.13 Unterschiede bestehen freilich hinsichtlich der näheren Qualifi zierung dieser Umstandsänderung: So verlangt der RC, dass diese eine Störung des vertraglichen Gleichgewichts zwischen Leistung und Gegenleis-tung bewirkt haben muss, die dazu führt, dass eine Partei das Interesse an der Vertragserfüllung verliert.14 Dagegen verweist das PC auf Kriterien, die an die höhere Gewalt (force majeure) erinnern,15 indem es nur die Umstandsänderung anerkennt, die weder vorhersehbar noch überwindbar ist. Weiter sei diese nur anzuerkennen, sofern sie zu einer besonders kostspieligen Erfüllung zu Lasten der Partei führe, die dieses Risiko nicht übernommen habe.16 Der RT verwendet ähnliche Standards, lässt aber die Unvorhersehbarkeit der Umstandsänderung genügen, verlangt also keine Unüberwindlichkeit.17 Dieser letzten Fassung hat sich die PL von 2011 angeschlossen.18
Damit ist im Verlauf der Entwürfe eine Abkehr von der traditionellen An-knüpfung der Äquivalenzstörung an die französische cause erfolgt: Während das Avant-Projet den umstrittenen Begriff noch bewahrte,19 hat das Projet de
13 Drei Projekte verwenden ausdrücklich den Begriff changement de circonstances, vgl. Art. 136 PC: si un changement de circonstances … rend l’exécution excessivement oné-reuse, ebenso Art. 92 RT: par suite d’un changement imprévisible des circonstances sowie Art. 1134 al. 2 PL: Si un changement de circonstances imprévisible … Sprachlich, nicht aber inhaltlich abweichend nur Art. 1135-1 RC: où il adviendrait que, par l’eff et des circonstances, l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé.
14 Vgl. Art. 1135-1 RC: l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé au point que le contrat perde tout intérêt pour l’une d’entre elles.
15 Zur Tradition dieses Kriteriums vgl. Voirin, De l’imprévision dans les rapports de droit privé, 1922, 81-94, der die Gleichbehandlung ablehnt.
16 Vgl. Art. 136 PC: Si un changement de circonstances, imprévisible et insurmontable, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, …
17 Vgl. Art. 92 RT lorsque l’exécution devient excessivement onéreuse pour l’une d’elles par suite d’un changement imprévisible des circonstances et qu’elle n’a pas accepté d’en assu-mer le risque lors de la conclusion du contrat. Die Aufgabe des Kriteriums insurmontable entspricht der Kritik am PC, vgl. Witz, Eff ets, interprétation et qualifi cation, RDC 2009, 322; Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 375.
18 Si un changement de circonstances imprévisible, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque …
19 Zur Frage vgl. Rochfeld, Un avenir pour la cause, in: Cartwright / Vogenauer / Whittaker (ed.), Regard comparatistes sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2010, 91-118.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
67Ulrike Babusiaux
Chancellerie ihn durch den Begriff intérêt substituiert.20 Die Folgeprojekte ver-zichten sogar ersatzlos auf eine derartige Begründung der Vertragsstörung. Grundlage der Neuverhandlungs- wie der Anpassungspfl icht ist nunmehr die vertragliche bona fi des, die bonne foi.21 Dies ist auch ein klares Signal an die Rechtsprechung, die nach wie vor mit der cause, das heisst vor allem mit art. 1131 C. civ. argumentiert. So hat die Chambre commerciale der Cour de cassation im Juni 2010 in einer viel beachteten, wenngleich unpublizierten Entscheidung,22 art. 1131 C. civ. durch das Appellationsgericht als verletzt an-gesehen, da es zu prüfen habe, si l’évolution des circonstances économiques … n’avait pas eu pour eff et, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature … et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffi mat. Hintergrund war der pourvoi en cassation der besagten Gesellschaft Soffi mat, die sich gegenüber der société Exploitation de chauff age (SEC) mit Vertrag vom 24. Dezember 1998 verpfl ich-tet hatte, zwei Motoren eines Heizkraft werkes für eine Zeit von zwölf Jahren oder 43.488 Stunden zu warten. In der Zwischenzeit hatten die Rohstoff prei-se, vor allem für Metall, derart angezogen, dass der vereinbarte Wartungslohn nicht mehr ausreichte, um die Kosten der Soffi mat zu decken. Sie verweigerte daher die Fortführung des Vertrages, wogegen die SEC eine ordonnance sous astreinte erwirkte, die die Soffi mat gegen Zahlung einer Strafe von 20.000 € pro Tag verpfl ichtete, die Wartungsarbeiten auszuführen.23 Das Appellationsgericht bestätigte die Verurteilung, was die Cour de cassation unter Berufung auf Arti-kel 1131 C. civ. sanktionierte: Das Appellationsgericht habe die Vorschrift über die cause verletzt, weil es nicht geprüft habe, ob die Entwicklung der wirtschaft -lichen Umstände und insbesondere der Anstieg der Rohstoff - und Metallpreise seit 2006, der die Kosten für Ersatzteilbeschaff ung stark erhöht habe, nicht die allgemeine Äquivalenz des Vertrages ins Ungleichgewicht gebracht habe (dé-séquilibrer l’économie générale du contrat), so wie sie von den Parteien bei der Unterzeichnung im Dezember 1998 gewollt war, so dass die Verpfl ichtung der
20 Vgl. Mainguy, Défense, critique et illustration de certains points du projet de réforme du droit des contrats, D. 2009, 311-313; Ghozi / Lequette, La réforme du droit des contrats: brèves observations sur le projet de la chancellerie, D. 2008, 2611.
21 So schon de lege lata vgl. Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 798 f. 22 Cass. Com. 29 juin 2010 Soffi mat, n° 09-67, 369; dazu Mazeaud, L’arrêt Canal
‚moins‘?, D. 2010, 2481-2485; sehr kritisch Genicon, Th éorie de l’imprévision … ou de l’imprévoyance, D. 2010, 2485-2488; allgemein Amrani Mekki / Fauvarque-Cosson, Droit des contrats octobre 2009 – novembre 2010, D. 2011, 481.
23 Vgl. Art. 873 NCPC: Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieu-sement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
68
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
Soffi mat sich als eine solche ohne wirkliche Gegenleistung darstellte und die Erfüllung dieser Verpfl ichtung nicht verlangt werden konnte.24
Obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt wird, erinnern die Reformvorhaben damit eher an die berühmte, wenngleich schon etwas zurückliegende Recht-sprechung Huard der Chambre Commerciale der Cour de cassation.25 In dieser statuierte die Cour de cassation eine Verpfl ichtung zur Neuverhandlung aus der bonne foi. Man hat die Entscheidung daher als Ausdruck eines neuen so-lidarisme contractuel sehen wollen;26 jedenfalls beweist sie, dass der bonne foi in Frankreich nun ebenfalls rechtsbegründende Wirkung zukommen kann.27 Diese im RC begonnene Tendenz setzt die PL 2011 fort, indem sie schon syste-matisch an Art. 1134 C. civ. anknüpft . Entsprechend ist die in allen Entwürfen vorgesehene Rechtsfolge der „Neuverhandlung“ (renégociation) Ausprägung der vertraglichen Treuepfl icht, wie sie die Rechtsprechung im arrêt Huard und anderen Entscheidungen konkretisiert hat.28
II. (…) von renégociation, adaptation und résiliation du contrat
So erhält derjenige, der den Vertrag wegen der geänderten Umstände nicht wei-ter erfüllen will und nicht das Risiko der Umstandsänderung auf sich genom-
24 Cass. com. 29 juin 2010: „comme elle y était invitée, si l’évolution des circonstances économiques et notamment l’augmentation du coût des matières premières et des mé-taux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n’avait pas eu pour eff et, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature, en dé-cembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la société Soffi mat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l’obligation dont la société SEC sollicitait l’exécution.“
25 Cass. com. 3 nov. 1992, Huard, JCP 1993.II.22164 note Virassamy, RTD civ. 1993.124 f. obs. Mestre. Aus der unübersehbaren Lit. vgl. Gautier, L’obligation de loyauté du man-dant poussée trop loin? Sur les ‘prix concurrentiels’ de l’agent commercial, RTD civ. 1999, 646 f.; Fin-Langer, L’équilibre contractuel, 2002, 357 f.
26 Zum Begriff vgl. die Beiträge in: Grynbaum / Nicot (ed.), Le solidarisme contractuel, 2004. Vgl. ferner Lokiec, Le droit des contrats et la protection des attentes, D. 2007, 321-327.
27 Vgl. Cornu, in: Avant-Projet (PC) 2005, Introduction, Titre III, Des Obligations: „Toutes ces avancées de la justice contractuelle s’accompagnent (…) du plus grand rayonnement donné à la bonne foi“. Zur Entwicklung und zum Einfl uss des deutschen Rechts vgl. Ranieri, Europäisches Obligationenrecht. Ein Handbuch mit Texten und Materialien, 3. Aufl ., 2009, 1844-1856 m.w.N.
28 Neben dem arrêt Huard vgl. Cass. com. 24 nov. 1998, D. 1999, IR p. 9; JCP 1999, I, 143, obs. Jamin; RTD civ. 1999, p. 98, obs. Mestre et 646, obs. Gautier; Cass. civ 1re, 16 mars 2004, D. 2004, p. 1754.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
69Ulrike Babusiaux
men hat, das Recht, die andere Partei um Neuverhandlung (renégociation) zu bitten. Wie die PL festhält, führt aber weder die Bitte um Neuverhandlung noch der Eintritt in Neuverhandlungen zum Aufschub der vertraglichen Verpfl ich-tungen: mais doit exécuter ses obligations durant la renégociation. Verweigert der andere Teil die Neuverhandlung oder scheitert diese, soll der Richter die Befug-nis haben, mit Einverständnis der Parteien den Vertrag anzupassen (adaptation du contrat). Sind die Parteien dagegen nicht bereit, den richterlichen Eingriff anzunehmen, beschränkt sich die richterliche Macht auf eine Vertragsbeen-digung (résiliation). Diese vorsichtige Abschichtung, bei der den Parteien auf jeder Stufe die Möglichkeit zum Veto eingeräumt wird, ist Ausdruck der nach wie vor bestehenden französischen Angst vor einem gouvernement des juges: Im Verhältnis zu den Parteien soll sich der Richter auf Auslegung und Anwendung des Vertrages beschränken.29
1. Die Anerkennung richterlicher Vertragsanpassungskompetenz
Der genauere Vergleich der verschiedenen Reformprojekte belegt freilich, dass die Vorstellung der richterlichen Vertragsanpassung zwischen 2005 und 2011 etwas von ihrem ursprünglichen Schrecken verloren hat: So betonte der RC im Jahre 2005 noch ganz die Verantwortung der Parteien eine Nachverhandlungs-pfl icht zu vereinbaren, indem der dort vorgeschlagene Art. 1135-1 RC bestimm-te: Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, les parties peuvent s’engager à négocier une modifi cation de leur convention pour le cas où il advien-drait que, par l’eff et des circonstances, l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé au point que le contrat perde tout intérêt pour l’une d’entr’elles. Zu Recht wurde kritisiert, der Hinweis auf die Möglichkeit, eine Nachverhand-lungspfl icht zu vereinbaren, sei tautologisch, da es den Parteien aufgrund der Privatautonomie ohnehin unbenommen sei, vertragliche Nachverhandlungs-pfl ichten zu statuieren.30 Beachtet man freilich den Fortgang der Regelung im Rapport Catala, so wird deutlich, dass der an sich unnötige Hinweis auf die Regelungsmacht der Parteien nur dazu dient, im Fortgang den Richter zur An-
29 So noch die Stellungnahme von Genicon, Th éorie de l’imprévision … ou de l’impré-voyance, D. 2010, 2485: „il faudrait surtout écarter la révision judiciaire (…) outre le doutes que l’on peut avoir sur la compétence et la légitimité du juge pour procéder à une sorte de thérapie commerciale (…), on peut présumer qu’un contrat judiciairement révisé sera souvent voué à l’échec.“
30 Vgl. Mazeaud, Renégocier ne rime pas avec réviser, D. 2007, 765: „On peut légitimement se demander, sauf à croire que les rédacteurs de ce texte étaient persuadés que la pratique des clauses de renégociation était ignorée par les artisans contractuels français, pourquoi ceux-ci se sont crus obligés de graver dans le marbre de la loi une solution que le principe de la liberté contractuelle rend superfl ue.“ Als Hinweis auf die Verantwortung der Par-teien liest dies Witz, Eff ets, interprétation et qualifi cation du contrat, RDC 2009, 321.
70
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
ordnung von Nachverhandlungen zu ermächtigen, wenn eine entsprechende Vereinbarung fehlt.31 Dass es sich um einen derartigen „begründungstechni-schen“ Umweg handelt, zeigen die beiden Folgeprojekte, die schlicht festhalten, dass die Parteien gesetzlich zur Nachverhandlung verpfl ichtet sind, wenn eine entsprechend qualifi zierte Veränderung der Umstände eintritt.32
Auch die Aufl ösung des Vertrages als Folge einer Umstandsänderung ist keine Neuerung der PL von 2011, denn auch sie fi ndet sich bereits im RC,33 im PC34 wie im RT.35 Bemerkenswert ist allerdings die Verbindung der Ver-tragsaufl ösung mit der richterlichen Vertragsanpassung, wie sie die PL von 2011 vorsieht. Die Möglichkeit für den Richter, den Vertrag anzupassen, wenn die Parteien einverstanden sind, kennen erst das PC und der RT, während sie im RC noch fehlt. Allerdings sind die unterschiedlichen Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung im PC und im RT hervorzuheben: Während der RT dem Richter die Entscheidungsmacht verleiht, wenn die Parteien in vernünft iger Frist keine Einigung über die Vertragsanpassung erzielt haben (en l’absence d’accord des parties dans un délai raisonnable), verlangt das PC genau wie die PL nicht nur das Scheitern der Verhandlungen, sondern zusätzlich die Einwilligung der Parteien in die gerichtliche Vertragsadaptation: en cas de refus ou d’échec de la renégociation, le juge peut, si les parties sont d’accord, procéder à l’adaptation du contrat (…).
Entsprechend unterschiedlich sind die Voraussetzungen der Vertragsaufh e-bung im Rahmen des PC und der PL einerseits und dem RT andererseits: Wäh-rend die Aufh ebungsbefugnis im RT eine Alternative richterlichen Handelns neben der Anpassung darstellt, wenn die eigenen parteilichen Bemühungen gescheitert sind, ist die Aufl ösung des Vertrages im PC und PL Folge davon,
31 Vgl. art. 1135-2 RC: À défaut d’une telle clause, la partie qui perd son intérêt dans le con-trat peut demander au president du tribunal de grande instance d’ordonner une nouvelle négociation.
32 Art. 136 PJ: Si un changement de circonstances, imprévisible et insurmontable, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie (…) celle-ci peut demander une re-négociation à son cocontractant, mais doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation; Art. 92 RT: Cependant, les parties doivent renégocier le contrat en vue de l’adapter ou d’y mettre fi n lorsque l’exécution déviant excessivement onéreuse pour l’une d’elles par suite d’un changement imprévisible des circonstances (…).
33 Art. 1135-3 RC: Le cas échéant, il en irait des négociations comme il est dit au chapitre I du présent Titre. Leur échec, exempt de mauvaise foi, ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni dommage.
34 Art. 136 PJ: En cas de refus ou d’échec de la renégociation, le juge peut, si les parties en sont d’accord, procéder à l’adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fi n à la date et aux conditions qu’il fi xe.
35 Art. 92 RT: (…) En l’absence d’accord des parties dans un délai raisonnable, le juge peut adapter le contrat en considération des attentes légitimes des parties ou y mettre fi n à la date et aux conditions qu’il fi xe.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
71Ulrike Babusiaux
dass die Parteien dem Richter die Vertragsanpassung verweigert haben. Dies schliesst zwar nicht aus, dass der Richter auch nach diesen beiden Entwürfen unter dem Sigle adaptation zu einer Vertragsbeendigung gelangen kann, zeigt aber, dass die Parteien nach diesen beiden Projekten auch dann das Heft nicht aus der Hand geben, wenn weder ihr ursprünglicher Vertrag noch ihre Nach-verhandlung eine Lösung des Problems erbracht hat.36
2. Zur Eff ektivität der richterlichen Vertragsanpassungskompetenz
Die in den Entwürfen, ausser im RT, fortdauernde Allmacht der Parteien führt zu der Frage, ob die geplante Regelung überhaupt eff ektiv ist, das heisst über-haupt je zu einer Vertragsanpassung führen wird. Auf den ersten Blick schei-nen die Projekte die Gefahr einer missbräuchlichen Verweigerung der Ver-tragsanpassung durch die Gegenpartei recht unterschiedlich zu bewerten. Das avant-Projet (RC) ist das einzige, dass die Missbrauchsmöglichkeit überhaupt erwähnt: Leur echec (sc. des négociations], exempt de mauvaise foi, ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni dommage. Soweit der président du tribunal de grand instance, durch den Art. 1135-2 RC befugt, die Parteien zur Nachverhandlung anzuhalten, mithin feststellt, dass die Nachver-handlung aufgrund einer grundlosen Weigerung einer Partei oder eindeutig überzogenen Forderungen gescheitert ist, kann er auf Schadenersatz und Kos-tenerstattung verurteilen. Es dürft e nicht schwer fallen, die Verletzung der Ver-handlungsethik als Vertragsverletzung aufzufassen, zumal Art. 1135-3 Abs. 1 RC für die Nachverhandlungen auf den Grundsatz von Treu und Glauben, wie ihn Art. 1104 RC konkretisiert, verweist.37 Mit Schwierigkeiten ist allerdings beim Nachweis der Missbräuchlichkeit zu rechnen, zumal die Verhandlungs-pfl icht keine Werkpfl icht (obligation de résultat), sondern nur eine Wirkpfl icht (obligation de moyens) beinhaltet.
36 Zur Originalität des PC vgl. Witz, Eff ets, interprétation et qualifi cation du contrat, RDC 2009, 322 f.
37 Art. 1104 L’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres, mais ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. L’échec d’une négociation ne peut être source de responsabilité que s’il est imputable à la mauvaise foi ou à la faute de l’une des parties; skeptisch zur Eff ektivität dieser Bestimmung Aubert de Vincelles, Le processus de conclusion du contrat, in: Terré (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, 2009, 136: „si la perte d’une chance est un préjudice réparable, cela signifi erait que la faute consiste dans le fait de la rupture (…). Or, au nom de la liberté contractuelle, la faute consiste dans le seul exercice du droit de rompre et la faute n’a pas de lien causal avec la perte d’une chance, puisque si elle n’avait pas été commise, seul l’exercice du droit aurait été diff érent sans modifi er aucunement l’existence de la rupture.“
72
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
Eine Haft ung nach vertraglichen Grundsätzen (responsabilité contractuelle) dürft e auch bei den Konkurrenzentwürfen des RC mitgedacht sein.38 Hier sind freilich die Voraussetzungen dieser Ersatzhaft ung nicht einmal angetönt, wenn man sie nicht in die Bedingungen, die der Richter bei Vertragsbeendigung fest-legt (conditions qu’il fi xe) des PC und des RT hineinlesen will. Der Nachweis eines entsprechenden Verstosses, insbesondere der Missbräuchlichkeit, kann aber im Einzelfall fast unmöglich sein, so dass man auf entsprechende Kon-kretisierungen und Beweiserleichterungen der Rechtsprechung angewiesen sein wird.39 Unsicherheit besteht dabei freilich hinsichtlich der Bereitschaft der Rechtsprechung, namentlich der Cour de cassation, die neu eingeräumte Mög-lichkeit für sich zu nutzen und die gesetzliche Regelung wirklich mit Leben zu füllen. Bei einer kleinlichen Anwendung besteht bei allen vier Vorschlä-gen durchaus die Gefahr, dass es kaum zu einer Veränderung der bestehenden Rechtspraxis kommt. Aus dem Gesichtspunkt heraus dürft e dem RT der Vorzug zu geben sein, da er allein dem Richter erlaubt, auch gegen den Willen der Par-teien die gestörte Äquivalenz wieder herzustellen.40 Zu Recht ist dieser Entwurf daher als echter Bruch mit der bestehenden Lehre gegen die Zulassung einer théorie de l’imprévision bewertet worden.41 Dieser Bruch garantiert gleichzeitig die Eff ektivität der Regelung, denn die Gegenpartei der um Nachverhandlung bittenden Partei wird sich hüten, die Nachverhandlungen leichtfertig schei-tern zu lassen, wenn anschliessend eine richterliche Vertragsanpassung mit ungewissem Ausgang „droht“. Auch die in den anderen Projekten vorgesehene Vertragsaufh ebung mag zwar eine Bedrohung für die Partei sein, die an der Erfüllung in der Fassung des ursprünglichen Vertragsgefüges festhalten will. Gerade in der Ausgestaltung, wie sie die neue PL vorsieht, nach der die Parteien der richterlichen Vertragsanpassung noch gesondert zustimmen müssen, ist es aber sehr fraglich, ob es zu einem entsprechenden Eingriff kommt. Nicht nur theoretisch besteht daher die Gefahr, dass es auch nach der Einführung einer entsprechenden Reformvorschrift bei der restriktiven Tendenz der Rechtspre-chung bleibt und der Reformentwurf insoweit ad absurdum geführt wird.42
38 Dies entspricht der Praxis zur Durchsetzbarkeit von Neuverhandlungsklauseln. Zur responsabilité contractuelle in einem derartigen Fall vgl. Cass. com. 3 oct. 2006, D. 2007, 765 f.; allgemein Mazeaud, Renégocier ne rime pas avec réviser, D. 2007, 765, der aber auch die exécution forcée en nature nicht sofort und vollständig ausschliessen will.
39 Vgl. Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 805 f. 40 Als Ausdruck eines Prinzips sieht dies Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011,
n° 785. 41 Vgl. Mazeaud, Une nouvelle rhapsodie doctrinale pour une réforme du droit des con-
trats, D. 2009, 1364; Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 376. 42 Vgl. auch Witz, Eff ets, interprétation et qualifi cation du contrat, RDC 2009, 322 zu
Art. 136 PC.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
73Ulrike Babusiaux
Daher soll beim Vergleich der französischen Vorhaben mit dem deutschen und schweizerischen Recht die prozessuale Ausgestaltung der Nachverhand-lungspfl ichten im Vordergrund stehen.
B. Die französische Reformdiskussion im Vergleich mit dem deutschen und schweizerischen Recht
Bei einem Vergleich zwischen Wegfall der Geschäft sgrundlage, clausula rebus sic stantibus und théorie de l’imprévision, ist zunächst der unterschiedliche An-wendungsbereich der drei Regelungen zu beachten. Die wohl umfassendste Konzeption liegt dem deutschen Recht zugrunde, das unter Wegfall der Ge-schäft sgrundlage sowohl die subjektiven Fehlvorstellungen bei Vertragsschluss als auch die nachträglichen Vertragsstörungen fasst.43 Dagegen beschränkt sich die clausula nach schweizerischem Recht auf Fälle, in denen die objektive Ver-tragsgrundlage nach Vertragsschluss entfallen ist. Subjektive Fehlvorstellungen beim Vertragsschluss führen nur dann zur Vertragsaufh ebung, wenn sie die Voraussetzungen des Grundlagenirrtums nach Art. 24 Abs. 1 Ziff . 4 OR erfül-len.44 Übereinstimmung besteht zwischen dem deutschen und schweizerischen Privatrecht insoweit, als die objektive und subjektive Geschäft sgrundlage auch in Deutschland unterschieden werden.45 Die subjektive Geschäft sgrundlage ist aus der Lehre von der Voraussetzung Windscheids46 hervorgegangen, während die objektive Geschäft sgrundlage der gemeinrechtlichen clausula-Lehre ent-spricht.47 Dagegen sind die französischen Entwürfe auf diese objektive impré-vision beschränkt; gemeinschaft licher Motiv- oder Grundlagenirrtum sind dem richterlichen Eingriff unter diesem Stichwort mithin entzogen.
43 Vgl. nur BT-Drucksache 14 / 4060, 174 f. zu § 313 BGB.44 Vgl. Kramer, Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2009, N 296 mit Angaben zum Streit-
stand hinsichtlich der Abgrenzung. Siehe dazu unten C.II. 45 Vgl. Meyer-Pritzl, §§ 313-314. Störung der Geschäft sgrundlage, Rn. 40 f., in: Schmoe-
ckel / Rückert / Zimmermann (ed.), Historisch-kritischer Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch II, 2007.
46 Zur Geschichte vgl. Kegel, Empfi ehlt es sich, den Einfl uß grundlegender Veränderun-gen des Wirtschaft slebens auf Verträge gesetzlich zu regeln und in welchem Sinn?, in: Verhandlungen des Vierzigsten deutschen Juristentages, 1953, 139-162. Windscheids Lehre war auch Grundlage für Art. 24 Abs. 1 Ziff . 4 OR, vgl. Wiegand, Clausula rebus sic stantibus – Bemerkungen zu den Voraussetzungen ihrer Anwendung, in: Forstmoser / Honsell / Wiegand (ed.), Festschrift für H.P. Walter, 2005, 447 f. m.w.N.
47 Vgl. Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Zweiter Band: Das Rechtsge-schäft , 2. Aufl . 1975, 495 f., der sich nicht zufällig auf die schweizerische Kommentar-literatur beruft . In der Tendenz ähnlich Meyer-Pritzl, §§ 313-314. Störung der Geschäft s-grundlage, Rn. 84 f., in: Schmoeckel / Rückert / Zimmermann (ed.), Historisch-kritischer Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch II, 2007.
74
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
I. Voraussetzungen des richterlichen Vertragseingriff s im Rechtsvergleich
Es bleibt zu prüfen, ob der gemeinschaft liche Kern der drei Rechtsordnungen auch an seinen Rändern deckungsgleich ist. Wie gesehen, verlangt das PL für den richterlichen Vertragseingriff zunächst eine nicht vorhersehbare Verände-rung der Vertragsumstände, die die Erfüllung für eine Partei übermässig ver-teuert, die dieses Risiko nicht übernommen hat. Ähnliches fordern das PC und der RT. Gedacht ist dabei vor allem an Dauerschuldverhältnisse, auf die der RC die imprévision noch ausdrücklich beschränkt (contrats à exécution successive ou échelonnée), da bei ihnen der Zeitablauf die Gefahr einer Störung erhöht. Mit diesem Leitbild geht einher, dass sich alle französischen Entwürfe auf Äquiva-lenzstörungen konzentrieren.48 Ein richterlicher Eingriff in den Vertrag soll hier möglich sein, sofern ein solcher durch unvorhersehbare äussere Veränderungen hervorgerufen wird und die veränderten Umstände einen Vertragspartner ent-gegen der vertraglichen Risikoverteilung wirtschaft lich hart treff en. Die théorie de l’imprévision trifft damit vorrangig eine Regelung für Zeiten wirtschaft li-cher Umbrüche und Not oder auch für Zufälligkeiten des Marktes, die für eine Vertragspartei zu ruinösen Ergebnissen führen würden, wenn sie am Vertrag festhalten würde.
Ausgeklammert bleibt im französischen Recht damit eine weitere, im deut-schen wie im schweizerischen Recht, wichtige Fallgruppe: die Zweckstörung.49 Gemeint sind Situationen, in denen der Zweck, den eine Partei mit ihrem Ver-tragsschluss verfolgt, zur gemeinsamen Geschäft sgrundlage geworden ist,50 dann aber – ohne dass die Schwelle der Unmöglichkeit erreicht wird – vereitelt wird. Das einschlägige Lehrbuchbeispiel stammt aus dem englischen Recht: Der Krönungszugfall, bei dem ein Platz am Fenster zur Strasse vermietet wurde, auf der der Krönungszug vorbeiziehen sollte.51 Als der Monarch erkrankte, fi el der Krönungszug aus. Was gilt für den Vertrag? Diese Konstellationen sind in Frankreich schon begriffl ich nicht von der théorie de l’imprévision erfasst, lassen sich aber bereits de lege lata über die théorie de la cause bewältigen.52
48 Zu den Fallgruppen vgl. bereits Bundesministerium der Justiz (ed.), Abschlußbericht der Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts, 1992, 147 f. Im Einzelnen Me-dicus, Vertragsauslegung und Geschäft sgrundlage, in: Jakobs et al. (ed.), Festschrift Flume, I, 1978, 629. Zum schweizerischen Recht vgl. Pichonnaz, Impossibilité et ex-orbitance. Étude analytique des obstacles à l’exécution des obligations en droit suisse, 1997, 170-184, 316-331.
49 Zum deutschen Recht vgl. Beuthien, Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuld-verhältnis, 1969, 53-69; zum schweizerischen Recht vgl. Sulzer, Zweckstörungen im schweizerischen Vertragsrecht, 2002, 204-237.
50 Vgl. Fikentscher / Heinemann, Schuldrecht, 10. Aufl . 2006, Rn. 239. 51 Vgl. P. Krell v. C.S. Henry (1903) 2 KB 740.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
75Ulrike Babusiaux
52Gemeinsamer Nenner der drei nationalen Regelungen ist mithin die Äqui-valenzstörung, sofern sie durch Störungen der objektiven Geschäft sgrundlage hervorgerufen wird. Es überrascht angesichts dieser Heterogenität nicht, dass auch die Regelung des vertraglichen Eingriff s selbst starke Unterschiede er-kennen lässt.
II. Nachverhandlungspfl ichten im deutschen und schweizerischen Recht
Auf den ersten Blick scheint das französische Recht, das die Nachverhandlung als Mittel der Wahl ansieht, gegenüber dem deutschen und schweizerischen Recht einen Sonderweg einzuschlagen. Durch Vermittlung des Einheitsrechts ist die Nachverhandlungspfl icht indessen auch im deutschen und schweizeri-schen Recht angekommen.53 Während sie im deutschen Recht durch die Ein-führung des § 313 BGB auch gesetzlich anerkannt ist, bleibt ihre Ableitung aus Treu und Glauben im schweizerischen Recht umstritten.
1. Zum Diskussionsstand in beiden Ländern
Auch wenn mit der Einführung des § 313 BGB an sich nur bestehendes Richter-recht kodifi ziert werden sollte, verabschiedete sich die Fassung des § 313 BGB von der in Deutschland traditionellen ipso iure-Wirkung des Wegfalls der Ge-schäft sgrundlage und kodifi zierte die sogenannte Anspruchslösung.54 Nach § 313 Abs. 1 BGB (Störung der Geschäft sgrundlage) gilt: „Haben sich Um-stände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Be-
52 Vgl. Beispiele bei Rochfeld, Un avenir pour la cause?, in: Cartwright / Vogenauer / Whit-taker (ed.), Regards comparatistes sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, 2010, 96. Eine präzise Analyse von Geschäft sgrundlage und cause bereits bei H.P. Westermann, Die causa im französischen und deutschen Zivilrecht, 1967, 107-118. Nicht einzugehen ist hier auf den Abschied von der cause im RT vgl. dazu die Überlegungen von Houtcieff , Le contenu du contrat, in: Terré (ed.), Pour une réforme du droit des contrats, 2009, 198-213.
53 Dies ist hier nicht zu vertiefen. Zu erinnern ist an die Hardship-Regelung des unidroit (Art. 6.2.1-Art. 6.2.3) und an Art. 6:111 Change of Circumstances in den PECL.
54 Vgl. Bundesministerium der Justiz (ed.), Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts I, 1992, 551, 576, 623. Zur Rechtsfolge vgl. Heinrichs, Vertragsanpas-sung bei Störung der Geschäft sgrundlage. Eine Skizze der Anspruchslösung des § 313 BGB, in: Lorenz et al. (ed.), Festschrift Heldrich, 2005, 190-193.
76
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.“ Dabei lässt die Formulierung „kann Anpassung des Vertrags verlangt werden“ off en, ob dieser Anspruch sich an den Gegner richtet und diesen zu Nachverhandlungen verpfl ichtet oder ob sich die gestörte Partei direkt an das Gericht wendet mit dem Ziel, eine gerichtliche Vertragskor-rektur zu beanspruchen.55 Wie nun der Bundesgerichtshof klargestellt hat, er-öff net diese den Parteien aber nicht nur die Möglichkeit, den Vertrag vorrangig zu einem richterlichen Vertragseingriff selbst abzuändern, sondern verpfl ichtet die Parteien zunächst selbst über die Neuanpassung zu verhandeln.56
Das Urteil des Bundesgerichtshofes knüpft an die bereits in den 1980er Jahren geführte Diskussion um Nachverhandlungspfl ichten an.57 Damals hatten sich noch die Gegner einer solchen Pfl icht durchgesetzt, indem sie argumen-tierten, die Anpassung des Vertrages erfolge ipso iure, so dass der Vertrag mit Wegfall der Geschäft sgrundlage nicht mehr in den Händen der Parteien liege.58 Wenn nun das Gesetz einen Anpassungsanspruch normiert, ist die Grundlage dieses Arguments entfallen. Auch das in der früheren Diskussion geäusserte Be-denken, die Nachverhandlung schwäche die schutzwürdige Partei,59 verhindert diese Verpfl ichtung nicht, denn der anpassungswilligen Partei wird erlaubt, den
55 Widersprüchlich: Bundesministerium der Justiz (ed.), Abschlußbericht der Kommissi-on zur Überarbeitung des Schuldrechts, 1992, 150 einerseits; BT-Drucksache 14 / 6040, 176 andererseits. Einzelheiten dazu bei Peer, Die Rechtsfolgen von Störungen der Ge-schäft sgrundlage, in: Helms et al. (ed.), Jahrb. Junger Zivilrechtswissenschaft ler, 2001, 66 f.
56 BGH 30.09.2011 – V ZR 17 / 11, NJW 2012, 373: „Der Anspruch der durch eine Störung der Geschäft sgrundlage benachteiligten Partei auf Vertragsanpassung verpfl ichtet die andere Partei, an der Anpassung mitzuwirken. Wird die Mitwirkung verweigert, kann die benachteiligte Partei auf Zustimmung zu der als angemessen erachteten Anpassung oder unmittelbar auf die Leistung klagen, die sich aus dieser Anpassung ergibt.“
57 Vgl. vor allem Horn, Neuverhandlungspfl icht, AcP 181 (1981) 257-288; Eidenmüller, Neuverhandlungspfl ichten bei Wegfall der Geschäft sgrundlage, ZIP 1995, 1063-1068; dagegen Martinek, Die Lehre von den Neuverhandlungspfl ichten – Bestandsaufnahme, Kritik … und Ablehnung, AcP 198 (1998) 329-400. Zum damaligen Diskussionsstand vgl. allgemein Nelle, Neuverhandlungspfl ichten. Neuverhandlungen zur Vertragsan-passung und Vertragsergänzung als Gegenstand von Pfl ichten und Obliegenheiten, 1993, 199-205.
58 Vgl. Martinek, Die Lehre von den Neuverhandlungspfl ichten – Bestandsaufnahme, Kritik … und Ablehnung, AcP 198 (1998) 365m.w.N., der freilich 366 f. einräumt, dass die ipso-iure-Anpassung ihre konstruktiven Schwächen hat und es de facto doch um einen richterlichen Entscheidungsspielraum mit Ermessen gehe. Anders bereits seit 1933 die schweizerische Rechtsprechung, vgl. BGE 59 II 372.
59 Martinek, Die Lehre von den Neuverhandlungspfl ichten – Bestandsaufnahme, Kri-tik … und Ablehnung, AcP 198 (1998) 376.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
77Ulrike Babusiaux
Anspruch auf Anpassung unmittelbar als Anspruch aus Anpassung durchzuset-zen. Auf diese Weise sind weder Verzögerungen noch Verhandlungsnachteile zu befürchten.60 Es könnte sogar sein, dass die mit den Neuverhandlungspfl ichten verbundene Anpassungslösung die schutzwürdige Partei eher gestärkt hat, in-dem ihr der Bundesgerichtshof nun zusätzlich ein Anspruch auf Schadenersatz wegen Scheitern der Vertragsverhandlungen (§ 280 Abs. 1 BGB) zuerkennt.61
Dagegen lehnt die überwiegende schweizerische Doktrin Nachverhand-lungspfl ichten zurzeit als reguläre Rechtsfolge der clausula ab. Trotz der Be-zeichnung clausula rebus sic stantibus werden auch konkludente Anpassungs-klauseln in Verträgen nur mit grosser Zurückhaltung angenommen.62 In erster Linie bleibt der Richter zur Vertragsanpassung berufen.63 Allerdings scheinen sich in der jüngeren Literatur die Stimmen zu mehren, die die Nachverhand-lung auch im schweizerischen Recht als Hauptrechtsfolge der clausula rebus sic stantibus verankern wollen.64 Zur Begründung wird auf die neuere Herleitung der clausula aus der bona fi des verwiesen, die es erlaube, den Parteien zunächst selbst die Vertragsanpassung aufzugeben: si l’on fonde l’adaptation du contrat non sur l’abus de droit mais sur les exigences de la bonne foi en aff aires, il est juste d’imposer aux parties d’adapter elles-mêmes leur contrat.65 Weiter soll die von der Äquivalenzstörung betroff ene Vertragspartei die unverhältnismässige Leistung verweigern können. Diese Forderung steht im Widerspruch zur französischen Konzeption der Nachverhandlungspfl icht: So betont die PL, dass die geschädig-
60 Einzelheiten bei Schmidt-Kessel / Baldus, Prozessuale Behandlung des Wegfalls der Ge-schäft sgrundlage nach neuem Recht, NJW 2002, 2076-2078; Riesenhuber, Vertragsan-passung wegen Geschäft sgrundlagenstörung – Dogmatik, Gestaltung und Vergleich, BB 2004, 2697-2702; Dauner-Lieb / Dötsch, Prozessuale Fragen rund um § 313 BGB, NJW 2003, 921-927.
61 BGH 30.09.2011 – V ZR 17 / 11, NJW 2012, 373. 62 Kramer, in: Berner Kommentar, 1986, Art. 18, N 289: „Dabei ist aber, wie bei der Annah-
me stillschweigender Willenserklärungen ganz allgemein, Vorsicht geboten. (…) Daher kann heute selbstverständlich nicht mehr davon die Rede sein, dass jeder (erst in Zukunft zu erfüllende) Vertrag unter einer stillschweigenden clausula rebus sic stantibus, also unter der Bedingung geschlossen werde, dass sich die Rahmenbedingungen, die Realien des Vertrags, nicht (wesentlich) verändern; im Gegenteil: ‚A priori, on s’engage rebus sic non stantibus‘“. Gleichsinnig Wiegand, Art. 18 N. 112, in: Basler Kommentar, 4. Aufl . 2007 sowie Winiger, in: Commentaire romand I, 2003, Art. 18 N. 207.
63 Kramer, in: Berner Kommentar, 1986, Art. 18 N 297. 64 Vgl. Pichonnaz, La modifi cation des circonstances et l’adaptation du contrat, in: Pi-
chonnaz / Werro (ed.), La pratique contractuelle 2, 2011, 37-41; allgemein Monn, Die Verhandlungsabrede. Begründung, Inhalt und Durchsetzung von Verhandlungspfl ich-ten, 2010, S. 597-506, der aber in N 1594 betont, dass de lege lata eine derartige Ver-handlungspfl icht nicht besteht.
65 Pichonnaz, La modifi cation des circonstances et l’adaptation du contrat, in: Pichonnaz / Werro (ed.), La pratique contractuelle 2, 2011, 37 f.
78
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
te Partei auch während der Neuverhandlung verpfl ichtet ist, ihre Leistungen zu erbringen (mais doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation). Hiervon scheinen auch der RC sowie das PC auszugehen.66 Off en für eine Inter-pretation im Sinne des Erfüllungsaufschubs wäre allein der RT.
Damit ist die prozessuale Ausgestaltung der Neuverhandlung bzw. der rené-gociation in den beiden sie anerkennenden Rechtsordnungen zu prüfen.
2. Prozessuale Ausgestaltung der Nachverhandlung und der renégociation
Obwohl sich die französischen Reformentwürfe selbst wenig zu dieser Frage äussern, lassen sich der Doktrin einige Anhaltspunkte zur Durchsetzung der Verhandlungspfl icht entnehmen. Zunächst fällt auf, dass die dogmatische Ein-ordnung der Neuverhandlungspfl ichten umstritten ist:67 Während einige hierin eine echte Pfl icht erblicken, deren Nichteinhaltung auch durch exécution en nature sanktionierbar sei, beschreiben andere sie als blosses devoir de renégocia-tion, das mithin lediglich zu Schadenersatz (responsabilité contractuelle) führen mag.68 Bereits der Streit zeigt einen wesentlichen Unterschied zum deutschen Recht: Während in Deutschland unmittelbar auf Zustimmung zur Anpassung bzw. auf Anpassung geklagt werden kann, führt das Scheitern der Verhand-lungen nach französischer Vorstellung zunächst nur zum Schadenersatz.69 Ein Grund dafür dürft e sein, dass es nach französischem Vollstreckungsrecht keine Möglichkeit gibt, die fehlende Willenserklärung einer Partei zu ersetzen.70
66 Der RC nennt zwar die Verpfl ichtung zur Fortsetzung der Erfüllung nicht ausdrück-lich. Die Rechtsfolge zeigt aber, dass der Vertrag erst mit Wirkung für die Zukunft beendet wird, falls die Neuverhandlung keinen Erfolg hat. Das PC hält wie der PL fest, dass die Vertragspartei, die die Neuverhandlung verlangt, zur Erfüllung verpfl ichtet bleibt: mais doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation.
67 Vgl. Mazeaud, Renégocier ne rime pas avec réviser, D. 2007, 766: „une exécution forcée en nature de cette obligation mérite de ne pas être complètement éludée“; Aynès, Le devoir de renégocier, RJ com. 1999, n° 24; eher ablehnend Oppetit, L’adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances: la clause de ‘hardship’, JDI 1974, 474 f.
68 Zur vollstreckungsrechtlichen Unterscheidung von devoir und obligation vgl. allgemein Bunge, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, 2008, 120 mit Fn. 642.
69 Mazeaud, Renégocier ne rime pas avec réviser, D. 2007, 765.70 Vgl. allgemein Sonnenberger / Autexier, Einführung in das französische Recht, 3. Aufl .
2000, Nr. 159, 248. Zum Vertrag vgl. Sonnenberger, Verfassungsrechtliche libertés pu-bliques und schuldrechtliche Vertragsfreiheit. Eine Skizze zur Abschlußfreiheit im französischen Recht, in: Hohloch / Frank / Schlechtriem (ed.), Festschrift Stoll, 2001, 397.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
79Ulrike Babusiaux
Konsequenterweise erörtern die französischen Vorschläge daher Einwir-kungs- und Zwangsbefugnisse des Richters im parteiinternen Verhandlungs-prozess. Als mögliches Vorbild dienen die weitreichenden Moderationsbefug-nisse des juge conciliateur in art. L. 611-7 des Code de commerce,71 dem im Rahmen der Insolvenz die Aufgabe zukommt, den Abschluss eines Vergleichs zwischen dem Schuldner und seinen Hauptgläubigern bzw. den üblichen Ver-tragspartnern zu fördern.72 Im Vergleich mit der deutschen Regelung fällt frei-lich auf, dass diese Lösung für die durch die Äquivalenzstörung geschädigte Partei eine Erschwerung bedeutet: Sie muss nicht nur gegebenenfalls mona-telang verhandeln ohne ihre Leistungen einstellen zu können, sondern hat bei Scheitern der Verhandlungen auch erneut eine Klage zu erheben, dieses Mal auf Anpassung des Vertrages durch das Gericht.
Daher erscheint es wünschenswert, die Trennung von Neuverhandlung und adaptation judiciaire aufzugeben. Vorbild könnte die untechnisch sogenannte condamnation à s’entendre sein.73 Teile der französischen Doktrin verstehen hie-runter die Drohung des Gerichts, im Falle der fruchtlosen Verhandlung, den Vertrag richterlich anzupassen, also genau das zu tun, was auch § 313 Abs. 1 BGB nach der nunmehr durch den Bundesgerichtshof gesicherten Auslegung bezweckt. Prozesstechnisch gesprochen setzt ein derartiges Vorgehen freilich voraus, dass die Klage bereits erhoben, das Gericht also überhaupt in den Ver-handlungsprozess eingeschaltet wird. Nicht alle zur Zeit vorliegenden franzö-sischen Entwürfe erlauben dies: So besteht nach dem RC keinerlei Möglichkeit, die adaptation judiciaire mit der Neuverhandlung zu verbinden – hier droht allenfalls der Rücktritt der Partei, für die der Vertrag aufgrund der Äquivalenz-störung jegliches Interesse verloren hat.74 Aber auch das PC und die PL erlauben es den Gerichten nicht, mittels Drohung Druck auf die Parteien auszuüben,
71 Art. L. 611-7 Code de commerce: 1Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fi n aux diffi cultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. 2Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. (…) 4Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. (…) 6En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fi n à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifi ée au débiteur.
72 So der Vorschlag von Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 824 m.w.N.73 Vgl. Manara, Le juge condamne L’Oréal et eBay à s’entendre, D. 2009, 1474f: „Afi n
d’aider les parties à se mettre d’accord, le tribunal leur propose de recourir à une mesure de médiation judiciaire et sursoit à statuer sur le principe de la responsabilité des sociétés eBay pour des faits de contrefaçon dans le domaine des parfums et cosmétiques.“
74 Vgl. Art. 1135-3 PC Leur échec [sc. des négociations] ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni dommage.
80
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
um diese zu einer erfolgreichen Neuverhandlung zu zwingen. Die Möglichkeit, Vertragsanpassung unmittelbar nach Scheitern der Vertragsverhandlungen zu verlangen, besteht nur nach dem RC, da dieser in Art. 92 vorsieht, dass das Gericht den Vertrag anpassen oder beenden kann, wenn die Parteien keine Einigung erzielt haben.75 Sollten sich dagegen die anderen Projekte, vor allem die PL, durchsetzen, bleibt nur ein Ansatz, der die dort vorgesehene Trennung von Neuverhandlung und richterlicher Vertragsanpassung respektiert. So wird etwa die Einführung eines beschleunigten Verfahrens zur Beseitigung von Verhandlungshindernissen vorgeschlagen.76 Im Rahmen dieses référé-contrats soll das Gericht auch die Möglichkeit erhalten, Zwangsmassnahmen gegen die Partei anzuordnen, die sich weigert, die Verhandlungen fortzusetzen, bzw. die Verhandlung durch ihre starre Haltung blockiert.77 Disziplinierende Wirkung könnte auch die Tatsache haben, dass beide, PC wie PL, das Gericht ermäch-tigen, den Vertrag zu beenden, wenn nicht beide Parteien der Anpassung zu-stimmen.
Diese Überlegungen zeigen, dass die alleinige Einführung einer entspre-chenden Vorschrift in den Code civil nicht genügt, um ein eff ektives Instrument zur Bewältigung von imprévision zu schaff en. Mindestens ebenso wichtig wird es sein, die prozessualen Bedingungen der Neuverhandlungspfl icht sowie das Verhältnis von Neuverhandlungspfl icht und richterlicher Vertragsanpassung zu regeln.
Mit dieser Beobachtung ist erneut die Hauptfrage zu stellen, das heisst, ob und inwieweit der Gesetzgeber überhaupt den richterlichen Vertragseingriff regeln soll und kann.78
75 Art. 92 RT: En l’absence d’accord des parties dans un délai raisonnable, le juge peut adapter le contrat en considération des attentes légitimes des parties ou y mettre fi n à la date et aux conditions qu’il fi xe.
76 Vgl. Ancel, Le référé-contrat, D. 2006, 2409, der die Einfügung eines Absatzes 2 in Art. 809 NCPC vorschlägt. Abs. 1 lautet: Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Abs. 2 soll nach diesem Vorschlag lauten: De même, il peut toujours statuer, au besoin par voie d’interprétation, sur toute diffi culté relative au contrat, de nature à compromettre gravement la poursuite des relations contractuelle.
77 Dies scheint die Regelung des RC zu sein, vgl. Art. 1135-2 RC: la partie qui perd son inté-rêt dans le contrat peut demander au président du tribunal de grande instance d’ordonner une nouvelle négociation. Einzelheiten bei Th ibierge, Le contrat face à l’imprévu, 2011, n° 813.
78 So zur clausula etwa Wiegand, Clausula rebus sic stantibus – Bemerkungen zu den Voraussetzungen ihrer Anwendung, in: Forstmoser / Honsell / Wiegand (ed.), Festschrift Walter, 2005, 455: „Die Clausula ist ihrer Natur nach Richterrecht und sollte es bleiben.“
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
81Ulrike Babusiaux
C. Gesetzliche Rechtfertigung vs. Richterrecht
Zu diesem Zweck sind zunächst die Erfahrungen mit der deutschen Rege-lung des Institutes in § 313 BGB zu untersuchen. Sodann ist die ungebrochene richterrechtliche Tradition des schweizerischen Rechts auf Voraussetzungen und Wirkungen zu befragen.
I. Die Folgen der Kodifi kation des Instituts in § 313 BGB
Die Einführung des § 313 BGB durch die Schuldrechtsmodernisierung sollte nach dem Willen des Gesetzgebers nur das bestehende Richterrecht kodifi zie-ren, nicht aber zu einer Rechtsänderung führen. Die seit 2002 bis Ende 2011 ergangenen Urteile des Bundesgerichtshofs zeigen dennoch einen Wandel der Rechtsprechung. Sie betreff en vorrangig das Familienrecht, insbesondere die Regelung des Unterhalts nach der Scheidung,79 die Rückgabe von Schenkun-gen80 und die vermögensrechtlichen Folgen der nichtehelichen Lebensgemein-schaft .81 Weitere Schwerpunkte liegen im Mietrecht82 sowie bei der nachträgli-
79 BGH XII ZR 160 / 08, 2.6.2010, NJW 2010, 2515-2519 (Kindesunterhalt); BGH XII ZR 163 / 04, 28.3.2007, NJW 2007, 2249-2254 (Prozessvergleich über Unterhalt). Zur Inhaltskontrolle von ehevertraglichen Regelungen nach § 313 BGB vgl. BGH XII ZR 296 / 01, 25.5.2005, NJW 2005, 2386-2390; BGH XII ZR 11 / 09, 2.2.2011, FamRZ 2011, 1377-1380.
80 BGH XII ZR 189 / 06, 3.2.2010, BGHZ 148, 190-209 (Schenkung an Schwiegerkind); BGH XII ZR 104 / 08, 21.7.2010, NJW-RR 2010, 1513-1515 (Darlehen von Schwieger-eltern); BGH XII ZR 149 / 09, 20.7.2011 juris (dito).
81 Vgl. BGH XII ZR 261 / 04, 31.10.2007, NJW 2008, 443-445 (§ 313 BGB noch abgelehnt); BGH XII ZR 179 / 05, 9.7.2008, BGHZ 177, 193-211; BGH XII ZR 39 / 06, NJW 2008, 3282 f. (Rechtsprechungsänderung unter dem Eindruck der hohen Scheidungsrate: „Dass nur das Vertrauen von Ehegatten in die lebenslange Dauer ihrer Verbindung rechtlich geschützt ist (§ 1353 Abs. 1 Satz 1 BGB), vermag mit Blick auf die hohe Schei-dungsquote eine unterschiedliche Behandlung nicht überzeugend zu begründen“); seit-dem: BGH XII ZR 92 / 06, 25.11.2009, BGHZ 183, 242-258; BGH XII ZR 190 / 08, 6.7.2011, NJW 2011, 2880-2883. Vgl. Dethloff , Aufgabe des Grundsatzes des Nichtausgleichs in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft , JZ 2009, 418-421; Stein, Ausgleichsansprüche nach Scheitern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft , FamFR 2011, 409-412.
82 BGH XII ZR 175 / 02, 27.10.2004, BGHReport 2005, 283 f. (abgelehnt); BGH VIII ZR 159 / 05, 31.5.2006, NJW 2006, 2771-2773; BGH VIII ZR 181 / 07, 9.7.2008, BGHZ 177, 186-193 (abgelehnt); BGH VIII ZR 83 / 07, 9.7.2008, Grundeigentum 2008, 1046-1048 (abgelehnt); BGH XII ZR 108 / 08, 17.3.2010, NJW-RR 2010, 1016 f.; BGH VIII ZR 60 / 09, 24.3.2010, WuM 2010, 384; BGH VIII ZR 235 / 09, 24.3.2010, juris; BGH VIII ZR 160 / 09, 24.3.2010, NJW 2010, 1663 f. Zur verpassten Miethöhenangleichung in Ostdeutschland vgl. BGH VIII ZR 41 / 04, 22.12.2004, BGHReport 2005, 483-486.
82
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
chen Anpassung von Abfi ndungsvergleichen und Unterlassungserklärungen.83 Aus der früheren Rechtsprechung bekannte Einzelfälle betreff en die Anpassung des VOB-Vertrages84 und die Konstruktion des Leasings.85 Schon diese Aufzäh-lung belegt, dass § 313 BGB vorrangig nicht für Äquivalenzstörungen aufgrund unvorhergesehener Änderungen der Verhältnisse verwendet wird.86 Vielmehr dient die Vorschrift als Eingriff sinstrument, das dem Bundesgerichtshof die gesetzgeberische Lückenfüllung in vermögensrechtlichen Fragen des Familien-rechts oder aber Billigkeitsentscheidungen bei Planungsfehlern oder gemein-samen Irrtümern über die Vergleichsgrundlage erlaubt. Die damit verbundene Ausweitung des Wegfalls der Geschäft sgrundlage zu Lasten anderer Institute gilt es an zwei besonders auff älligen Entscheidungen aufzuzeigen.
1. Statuierung einer Leistungspfl icht als Vertragsanpassung?
Die erste Entscheidung verwendet die in § 313 Abs. 1 BGB vorgesehene Ver-tragsanpassung dazu, eine Leistungspfl icht zu Lasten einer Vertragspartei zu statuieren.87 Anlass war ein Behandlungsvertrag, den die Mutter einer minder-jährigen Tochter mit dem Krankenhaus in dem Glauben geschlossen hatte, es bestehe eine Familienmitversicherung durch den Ehemann. Tatsächlich fehlte der Versicherungsschutz, so dass das Krankenhaus von der Mutter die Kosten für die stationäre Behandlung des Kindes in Höhe von 15.000 € verlangte. Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass dem privatrechtlichen Behand-lungsverhältnis die Geschäft sgrundlage fehle, und dass die deshalb gebotene Vertragsanpassung zu einem Zahlungsanspruch des Krankenhauses gegen die Mutter führe.88 Zur Begründung verwies das Gericht darauf, die Parteien hät-ten bei Abschluss des Vertrages irrtümlich angenommen, die Kosten werde die Krankenkasse übernehmen. Ein derartiger gemeinschaft licher Irrtum über
83 Vgl. BGH VI ZR 154 / 07, 12.2.2008, NJW-RR 2008, 649-652 (Anpassung abgelehnt); BGH VI ZR 296 / 07, 16.9.2008, NJW-RR 2008, 1716 f.; vergleichbar Unterlassungsver-trag BGH VI ZR 52 / 09, 9.3.2010, NJW 2010, 1874-1877 (Anpassung abgelehnt); BGH III ZR 17 / 10, 21.10.2010, MMR 2011, 69 f.
84 Zu den Sondervorschrift en der VOB / B vgl. BGH VII ZR 216 / 08, 23.3.2011 (auch zur Konkurrenz mit § 313 BGB), NJW-RR 2011, 886 f.; BGH VII ZR 13 / 10, 30.6.2011, NJW 2011, 3287-3291.
85 Vgl. BGH VIII ZR 186 / 03, 10.11.2004, BGHZ 161, 90-115; dies entspricht der Rechtspre-chung vor Einführung des § 313 BGB, vgl. BGHZ 94, 44; BGHZ 109, 139.
86 So aber die Rechtsprechung vor der Reform, vgl. die Zusammenstellung bei Meyer-Pritzl, §§ 313-314. Störung der Geschäft sgrundlage, Rn. 41 f., in: Schmoeckel / Rückert / Zimmermann (ed.), Historisch-kritischer Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch II, 2007.
87 BGH III ZR 351 / 04, v. 28.4.2005, BGHZ 163, 42-53.88 BGH III ZR 351 / 04, v. 28.4.2005, Rn. 25.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
83Ulrike Babusiaux
eine wesentliche Voraussetzung des Vertrages sei ein typischer Fall des Feh-lens der Geschäft sgrundlage (§ 313 Abs. 2 BGB). Die damit nach § 313 Abs. 1 BGB notwendige Vertragsanpassung führe in casu dazu, „daß die Klägerin die Vergütung für die stationäre Behandlung von der Beklagten fordern kann“.89
Weniger das Ergebnis, als seine Begründung aus § 313 BGB ist zweifelhaft ,90 denn Vertragsanpassung bedeutet grundsätzlich nicht, einem Vertragsteil ei-ne bis dato nicht bestehende Hauptleistungspfl icht aufzuerlegen.91 Zwar be-schränkt sich die Vertragsanpassung nicht auf die quantitative Anpassung von Leistung und Gegenleistung, sondern kann mit Blick auf das vertragliche Ge-samtgefüge auch die Kosten- oder Schadensteilung bzw. die Statuierung von Nebenpfl ichten umfassen.92 Es ist aber äusserst fraglich, ob die Anpassung an die Umstände des Einzelfalls dazu führen sollte, einer Partei eine Hauptleis-tungspfl icht aufzuerlegen, die sie zuvor nicht hatte.93 Dies widerspricht dem in § 313 Abs. 1 BGB verlangten Interessenausgleich ebenso, wie der im Tatbe-stand verlangten Unzumutbarkeit, die immer auch die Berücksichtigung der gegensätzlichen Interessen beinhaltet.94 So ist fraglich, warum überhaupt die Mutter das Risiko der Kostenübernahme zu tragen hat. Wie der Bundesge-richtshof selbst erörtert, hätten die Allgemeinen Aufnahmebedingungen des Krankenhauses durchaus eine entsprechende Verpfl ichtung vorsehen können.95
89 BGH III ZR 351 / 04, v. 28.4.2005, Rn. 28.90 Schon Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Zweiter Band: Das Rechtsge-
schäft , 1975, 515 f., der bekanntlich die herrschende Lehre vom Wegfall der Geschäft s-grundlage kritisierte, konstatierte: „Die Lehre von der Geschäft sgrundlage wird immer wieder begünstigt durch Entscheidungen, welche im Ergebnis richtig und dadurch, daß sie auf die Lehre von der Geschäft sgrundlage gestützt sind, glauben machen, daß diese Lehre notwendig sei, und zu richtigen Ergebnisse führe, während in Wirklichkeit der Vertrag selbst die Lösung ergibt.“
91 Zum weiten Verständnis der Vertragsanpassung in § 313 BGB vgl. Peer, Die Rechts-folgen von Störungen der Geschäft sgrundlage, in: Helms et al. (ed.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaft ler, 2001, 75 f.
92 Vgl. Weller, Die Vertragstreue: Vertragsbindung – Naturalerfüllungsgrundsatz – Leis-tungstreue, 2009, 300 f.
93 Vgl. Gsell, Pfl icht zur Zahlung von Krankenhauskosten bei irrtümlicher Annahme einer gesetzlichen Krankenversicherung, in: Geisler / Hauger (ed.), jurisPR-BGHZivilR 28 / 2005, Anm. 3: „Die Entscheidung illustriert anschaulich, wie weit der Arm richterlicher Ver-tragsanpassung reichen kann. (…) Damit zwängt der BGH der Beklagten einen grundle-gend anderen Vertragsinhalt auf, auf den sie sich (…) wohl kaum eingelassen hätte.“
94 Zum Interessenausgleich vgl. G. Roth, § 313 Rn. 103, in: Münchener Kommentar, 5. Aufl . 2007. Dies ergibt sich schon aus dem Blickwinkel der Unzumutbarkeit vgl. Neuner, Vertragsauslegung – Vertragsergänzung – Vertragskorrektur, in: Heldrich et al. (ed.) Festschrift Canaris, 2007, 921 f. m.w.N.
95 BGH III ZR 351 / 04, v. 28.4.2005, Rn. 22 f. Konsistent wäre es, die sozialversicherungs-rechtliche Übernahme der Vergütungspfl icht durch die Krankenkasse nicht mehr als
84
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
Das Risiko fehlender Regelung in Allgemeinen Geschäft sbedingungen wäre freilich vom Krankenhaus und nicht vom Patienten oder seinen Angehörigen zu tragen gewesen.96
2. Verzicht auf fehlende Vorhersehbarkeit
Einen Verstoss gegen den Tatbestand des § 313 Abs. 1 BGB zeigt eine Entschei-dung aus dem Jahre 2005, die die Anpassung eines Schenkungsvertrages nach den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäft sgrundlage betrifft .97 Im Rahmen einer testamentarischen Auseinandersetzung schenkte der Vorerbe der Nach-erbin ein Auslandsdepot (Schweiz) der Erblasserin, das diese dem deutschen Fiskus vorenthalten hatte. Als Vorerbe und Nacherbin in Streit gerieten, deckte die Nacherbin das Depot gegenüber dem deutschen Finanzamt auf und ent-richtete die Schenkungssteuer in Höhe von 361.689 DM. Daraufh in nahm das Finanzamt den Vorerben auf die hinterzogene Vermögens- und Einkommen-steuer aus dem Depot in Höhe von 915.000 DM in Anspruch. Mit seiner Klage begehrt der Vorerbe Zahlung des Depotwertes nebst Zinsen von der Nacherbin, sowie Auskunft über die Erträge des Depots. Wie im zitierten Krankenhaus-Fall lehnte der Bundesgerichtshof die ergänzende Vertragsauslegung ab. Da sich der hypothetische Parteiwille nicht ermitteln liess,98 stützt es einen Freistellungs-anspruch des Vorerben gegen die Nacherbin aber auf Wegfall der Geschäft s-grundlage.
Gemeinschaft liche Geschäft sgrundlage sei nämlich die Vorstellung des Vorerben geworden, „dass er durch die Schenkung keine weiteren fi nanziellen Nachteile als den Verlust des Depots erfahren und dass ihm nicht durch eine Nachversteuerung praktisch der Wert der beiden ererbten Eigentumswohnun-gen entzogen werden würde“.99 Diese Geschäft sgrundlage sei durch die Auf-deckung der Steuerhinterziehung der Erblasserin gegenüber den deutschen Steuerbehörden entfallen. Da diese für den Vorerben zu einer Nachversteue-rungspfl icht führe, könne er die Vertragsanpassung des Schenkungsvertrages verlangen. Im konkreten Fall bedeute dies, der Nacherbin im Innenverhältnis
gesetzliche Schuldübernahme, sondern als Schuldbeitritt anzusehen, vgl. Dettling, An-merkung zum Urteil des Bundesgerichtshofs vom 28.04.2005 – III ZR 351 / 04 (Kran-kenhausaufnahmevertrag), VersR 2005, 947.
96 Vgl. BGH VIII ZR 83 / 07, 9.7.2008: „Für eine Berücksichtigung von Störungen der Ge-schäft sgrundlage ist kein Raum, wenn nach der gesetzlichen Regelung derjenige das Risiko zu tragen hat, der sich auf die Störung beruft . Bei der Unwirksamkeit allgemei-ner Geschäft sbedingungen trägt grundsätzlich deren Verwender, mithin vorliegend der Vermieter, das Risiko der Unwirksamkeit und der sich daraus ergebenden Folgen.“
97 BGH X ZR 108 / 03, v. 21.12.2005, NJW-RR 2006, 699-701.98 BGH X ZR 108 / 03, v. 21.12.2005, Rn. 12.99 BGH X ZR 108 / 03, v. 21.12.2005, Rn. 20.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
85Ulrike Babusiaux
den Mehrbetrag der Erbschaft ssteuer aufzuerlegen, der durch den Wert des Depots verursacht wird.100
Neben der vom Bundesgerichtshof verneinten Frage des Vorrangs von schenkungsrechtlichen Spezialfällen des Wegfalls der Geschäft sgrundlage101 wäre zu erörtern, ob wirklich eine Änderung der Geschäft sgrundlage vorliegt, wenn die Parteien sich zunächst entschliessen, die Steuerhinterziehung der Erb-lasserin zu verschweigen, sodann aber eine Partei die Steuerhinterziehung aus Anlass von „Unstimmigkeiten“ off enlegt. Anders als in dem Fall, in dem durch die überraschende Änderung eines Steuergesetzes die Planung der Parteien ver-eitelt wird,102 hat sich hier kein unvorhersehbares und unbeherrschbares äusse-res Risiko manifestiert. Vielmehr beruht der Wegfall der Geschäft sgrundlage, das heisst die Off enbarung der Steuerpfl icht, auf einer Handlung der Parteien.
Man könnte die beiden zitierten Entscheidungen als Billigkeitsrechtspre-chung in besonders gelagerten Einzelfällen beiseitelegen, wenn nicht Kritiker bereits angesichts der Fassung des § 313 BGB den Verdacht geäussert hätten, es würde zu einer Ausweitung des Institutes, zu einer „Karriere“ kommen.103 Man wird diesen Vorahnungen insoweit Recht geben müssen, als konkurrierende Institute, wie die ergänzende Vertragsauslegung oder die Irrtumsanfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB, durch § 313 BGB ausgehebelt werden: Wie der Bundes-gerichtshof selbst ausführt, steht der ergänzenden Vertragsauslegung im Kran-kenhausfall entgegen, dass die Parteien die Kostenübernahme zum Gegenstand des Vertrages erhoben hatten, im Depot-Fall ist dagegen kein hypothetischer Parteiwille ermittelbar.104 Auch eine Anfechtung der Schenkung des Depots
100 BGH X ZR 108 / 03, v. 21.12.2005, Rn. 22. 101 Das allgemeine Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäft sgrundlage sei kumulativ an-
wendbar, soweit der Sachverhalt außerhalb des Bereichs der speziellen Herausgabean-sprüche des Schenkers liegt, vgl. auch BGH XII ZR 1 / 89, 17.1.1990, NJW-RR 1990, 386.
102 Vgl. z.B. FG Hamburg 6 K 74 / 08, 30.03.2009, juris: gesetzliche Verlängerung der Spe-kulationsfrist. (Auch dort § 313 BGB in concreto abgelehnt, weil Risikoübernahme). Zum Steuerirrtum und § 313 BGB vgl. Wollweber, Der Steuerirrtum. Zu den Rechts-folgen steuerlicher Fehlvorstellungen bei Vertragsschluss, in: Binnewies / Spatscheck, Festschrift Streck, 2011, 284-287.
103 Zur Kritik vgl. Dauner-Lieb, Kodifi kation von Richterrecht, in: Ernst / Zimmermann, Zivilrechtswissenschaft und Schuldrechtsreform, 2001, 321-323: „Die Gefahr, daß die neue Norm insbesondere im heiklen Bereich der subjektiven Geschäft sgrundlage ge-genüber anderen Instituten und zu Lasten des Grundsatzes pacta sunt servanda Karri-ere macht, ist nicht von der Hand zu weisen.“
104 BGH III ZR 351 / 04, v. 28.4.2005, Rn. 24: „Eine ergänzende Vertragsauslegung, wonach die Beklagte eine (subsidiäre) Haft ung für die Krankenhausbehandlung ihrer Tochter trifft , hätte eine Regelungslücke – eine planwidrige Unvollständigkeit – vorausgesetzt.“ BGH X ZR 108 / 03, v. 21.12.2005, Rn. 12: „Die Lückenfüllung scheitert indessen an der weiteren Voraussetzung einer ergänzenden Vertragsauslegung, dass sich der hypothe-tische Parteiwille ermitteln lässt.“
86
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
gemäss § 119 Abs. 2 BGB wäre daran gescheitert, dass der Vorerbe über den Wert der Sache, nicht über die wertbildenden Faktoren irrte.105 Dagegen scheint die Anwendung von § 313 BGB nicht abwendbar.106 Ein derart weitgehender Rückgriff auf eine ursprünglich ausserordentlichen Situationen vorbehaltene Rechtsfolge zerstört feingesponnene dogmatische Begrenzungen und Voraus-setzungen für die Rückgängigmachung oder Aufh ebbarkeit von Verträgen. Noch bedenklicher ist aber, dass die ihren Anwendungsbereich sprengende Vorschrift zur Durchsetzung eines Anpassungsanspruchs dient, der sogar zu einem „(…) unzumutbaren Kontrahierungszwang“ führen kann.107
Um zu klären, ob und wie derartige Aufweichungen verhindert werden können, ist die deutsche Kodifi kation mit der schweizerischen Rechtslage, das heisst einer unverändert richterrechtlichen Lösung des richterlichen Vertrags-eingriff s, zu vergleichen.
II. Die richterrechtliche Lösung in der Schweiz
Zunächst ist nochmals an die Begrenzung der clausula-Lehre auf die objektive Geschäft sgrundlage zu erinnern. Während § 313 Abs. 2 BGB den gemeinschaft -lichen Irrtum der objektiven Geschäft sgrundlage ohne weiteres gleichstellt,108 sind die Voraussetzungen für den Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff . 4 OR enger gefasst: Relevant sind nach dieser Vorschrift nur Irrtümer, die auch objektiv wesentlich sind, das heisst vom redlichen Verkehr als für den Vertrag erheblich angesehen werden.109 Diese Begrenzung ist sachgerecht und angemes-sen,110 da es den Rückgriff auf bloss behauptete Motive der Parteien vermeidet.
105 Zu Anwendungsfällen des § 119 Abs. 2 BGB in vergleichbaren Konstellationen vgl. OLG Stuttgart, 19 U 150 / 08, 29.1.2009, FamRZ 2009, 1182 f.; OLG Düsseldorf I-3Wx 12 / 08, 3 Wx 123 / 08, 5.9.2008, NJW-RR 2009, 12 f.; OLG Düsseldorf I-3 Wx 21 / 11, 3 Wx 21 / 11, 31.1.2011, FamRZ 2011, 1171 f.
106 Vgl. U. Huber, in: Ernst / Zimmermann, Zivilrechtswissenschaft und Schuldrechtsre-form, 2001, 79 Fn. 176; ausführlich Peer, Die Rechtsfolgen von Störungen der Geschäft s-grundlage, in: Helms et al. (ed.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaft ler, 2001, 68 f.
107 Vgl. Lobinger, Die Grenzen rechtsgeschäft licher Leistungspfl ichten. Zugleich ein Bei-trag zur Korrekturbedürft igkeit der §§ 275, 311a, 313 BGB n.F., 2004, 271 f.
108 § 313 Abs. 2 BGB: Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, sich als falsch heraus-stellen.
109 Art. 24 Abs. 1 Ziff . 4 OR: Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentli-cher, (…) 4. wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäft sverkehr als eine notwendige Grundlage des Ver-trages betrachtet wurde, vgl. dazu Kramer, in: Berner Kommentar, 1986, Art. 18 N 301; Schmidlin, in Commentaire romand I, 2003, Art. 23-24, N 44-47.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
87Ulrike Babusiaux
Erkauft wird die Klarheit durch ein Abgrenzungsproblem,110das die schweizeri-sche Lehre und Rechtsprechung spaltet: Soll auch der Irrtum über zukünft ige Sachverhalte unter Art. 24 Abs. 1 Ziff . 4 OR fallen?111 Die überzeugendste Lö-sung trennt die Wirkungsbereiche derart, dass die Anfechtung wegen Grund-lagenirrtum auch über zukünft ige Sachverhalte eingreifen kann, wenn die Par-teien hierzu konkrete Vorstellungen entwickelt haben. Haben sich die Parteien dagegen keine weiteren Gedanken über die Zukunft gemacht, kann der Vertrag allenfalls richterlich korrigiert werden, wenn die Voraussetzungen der clausula rebus sic stantibus vorliegen.112 Subjektive Störungen der Geschäft sgrundlage berechtigen den Richter – somit anders als im deutschen Recht – nicht zum Vertragseingriff , sondern bleiben in der Selbstverantwortung der Parteien.
Die eigentliche clausula-Lehre ist, ähnlich wie die früher auf § 242 BGB gestützte deutsche Rechtsprechung, auch im schweizerischen Recht an eine Ermächtigungsnorm angelehnt.113 Allerdings ist hinsichtlich der clausula um-stritten, ob sie aus dem Rechtsverweigerungsverbot des Art. 1 Abs. 2 ZGB114 oder aus dem Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB115 abzu-leiten ist. Die traditionelle Auff assung, die sich auf Art. 2 Abs. 2 ZGB stützt, betont die Notwendigkeit der Unzumutbarkeit des Festhaltens am Vertrag; die neuere Lehre sieht den Wegfall der Geschäft sgrundlage dagegen eher als
110 Vgl. oben C.I.111 Ausführliche Übersicht bei Kramer, in: Berner Kommentar 1986, Art. 18, N 303-309.112 Kramer, in: Berner Kommentar 1986, Art. 18, N 309.113 Zum Unterschied von Eingriff s- und Ermächtigungsnormen in diesem Zusammen-
hang vgl. Giger, Grundsätzliches zum richterlichen Eingriff in den Vertrag, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 105 (1969) 313 f.
114 Art. 1 Abs. 2 ZGB: Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entschei-den, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. Für die Anwendung dieser Vorschrift vgl. zuletzt Honsell, Art. 2 N 19, in: Basler Kommentar, 4. Aufl . 2010.
115 Art. 2 Abs. 2 ZGB: Der off enbare Missbrauch eines Rechtes fi ndet keinen Rechtsschutz. Die traditionelle Formel des Bundesgerichts lautet. Vgl. dazu BGE 97 II 390: „Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB hat der Richter einen Vertrag dann zu ändern oder aufzuheben, wenn durch nachträgliche, nicht voraussehbare Umstände ein derart off enbares Miss-verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist, dass das Beharren einer Partei auf ihrem Anspruch als missbräuchlich erscheint.“ Ähnlich: BGE 100 II 345; BGE 104 II, 314; BGE 107 II 343; BGE 122 III 97. Eher im Sinne des Art. 18 dann in der „Jolieville“-Entscheidung, BGE 127 III 300: „Ein richterlicher Eingriff in einen Vertrag aufgrund veränderter Umstände setzt nach herrschender Auff assung unabhän-gig von der dogmatischen Grundlage (…) voraus, dass die Verhältnisänderung weder vorhersehbar noch vermeidbar war, für Fälle wie den vorliegenden eine gravierende Äquivalenzstörung zur Folge hat und der Vertrag nicht vorbehaltlos erfüllt wurde (…).“
88
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
Problem der richterlichen Lückenfüllung.116 Das Bundesgericht scheint in jün-geren Entscheidungen einer pragmatischen Richtung zu folgen und lässt die Rechtsgrundlage off en.117 Richtig erscheint daran, dass sich beide gesetzlichen Anknüpfungspunkte nicht ausschliessen, sondern ergänzen: Art. 2 Abs. 2 ZGB liest sich als Defi nition des Erreichens der Eingriff sschwelle, während Art. 1 Abs. 2 ZGB die Rahmenbedingungen des richterlichen Eingriff s fi xiert. Auch wenn sich beide Operationen gedanklich nicht vollständig trennen lassen – vor allem bei Ermittlung der Lücke des Vertrages werden Elemente beider Vor-schrift en zu prüfen sein118 –, erscheint diese doppelte Begründung der clausula rebus sic stantibus als ein entscheidender Vorteil der schweizerischen Lösung.
So zwingt die Berufung auf Art. 2 Abs. 2 ZGB bei Feststellung des Tat-bestandes zu einer restriktiven Prüfung der Voraussetzungen: Die Verhält-nisänderung muss nach Vertragsschluss eintreten, unvorhersehbar gewesen sein und eine gewisse Schwere aufweisen. Weiter ist eine Berufung auf die clausula ausgeschlossen, wenn die Partei das Risiko der Änderung zu tragen hat oder wenn der Vertrag trotz der veränderten Umstände vollständig und vorbehaltlos erfüllt wurde.119 Vor allem aber berechtigt die Feststellung des Tatbestandes noch nicht zur Vertragsanpassung. Vielmehr bestimmt erst die richterliche Lückenfüllung nach Art. 1 Abs. 2 ZGB, an welchen Vorgaben sich der richterliche Vertragseingriff zu orientieren hat. Die Off enheit der Vorschrift erklärt, warum – ähnlich wie in der aktuellen französischen Reformdiskus-sion – lange Zeit umstritten war, ob es dem Richter auch erlaubt sein sollte, den Vertrag anzupassen anstatt ihn nur aufzulösen.120 Das Bundesgericht hat diesen Streit zugunsten der Vertragsanpassung mit dem Argument gelöst, die Vertragsaufl ösung sei ein Unterfall der Anpassung – für die Zukunft oder die
116 Vgl. Kramer, Art. 18 N. 325 ff ., in: Berner Kommentar 1986; Wiegand, Art. 18 N 117, in: Basler Kommentar 4. Aufl . 2007.
117 Vgl. die „Jolieville“-Entscheidung, BGE 127 III 300: „Ein richterlicher Eingriff in einen Vertrag aufgrund veränderter Umstände setzt nach herrschender Auff assung unabhän-gig von der dogmatischen Grundlage (…) voraus, dass die Verhältnisänderung weder vorhersehbar noch vermeidbar war, für Fälle wie den vorliegenden eine gravierende Äquivalenzstörung zur Folge hat und der Vertrag nicht vorbehaltlos erfüllt wurde (…).“
118 Zur Ermittlung der Lücke durch Auslegung vgl. Bischoff , Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus. Risikozuordnung in Verträgen bei veränderten Verhältnissen, 1983, 51 f.; ein Grenzfall bei Sulzer, Zweckstörungen im schweizerischen Vertragsrecht, 2002, 207: „Das Rechtsmissbrauchsverbot spielt in den seltenen Fällen eine Rolle, in denen keine Anpassungslücke vorliegt, weil der Vertrag oder das Gesetz eine entsprechende Regel vorsehen, das Festhalten an einer derartigen Regel im Einzelfall aber off ensicht-lich rechtsmissbräuchlich wäre.“
119 Vgl. nur Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, I, 9. Aufl . 2008, N 1280, 1298-1300; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 6. Aufl . 2012, N 35.06-35.09.
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen Vertragseingriff s
89Ulrike Babusiaux
Vergangenheit.120121 Trotz der grundsätzlichen Zulässigkeit der Anpassung geht aber der Anpassungsentscheidung unter Geltung des Art. 1 Abs. 2 ZGB die erneute Prüfung voraus, ob im konkrweten Fall eine Anpassung erfolgen soll. Hier muss der entscheidende Richter erneut untersuchen, ob es 1. im konkre-ten Fall mit dem Gebot richterlicher Zurückhaltung vereinbar sein kann, den Vertrag anzupassen, und ob 2. nicht normative Gründe, wie Vorhersehbarkeit, Selbstverschulden oder Geringfügigkeit der Störung gegen eine Vertragsan-passung im konkreten Fall sprechen.122 Gelangt das Gericht bei seiner Prüfung zum Schluss, dass eine Vertragsanpassung im Einzelfall geboten ist, sind die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten gegeneinander abzuwägen: Der da-bei eröff netet Katalog an Möglichkeiten entspricht durchaus den in § 313 BGB unter dem Stichwort „Anpassung“ erörterten Entscheidungsalternativen.123 Ein entscheidender Unterschied zum (neuen) deutschen Recht besteht aber in der andauernden Rückbindung der Anpassungsentscheidung an den Parteiwillen: So betont jedenfalls die auf Art. 1 Abs. 2 ZGB gestützte neuere Auff assung, dass eine Anpassung des Vertrages nicht zulässig ist, wenn die Parteien eine Aufl ösung verlangen und umgekehrt.124 Dazu gehört auch die fortdauernde Berücksichtigung des hypothetischen Parteiwillens im schweizerischen Ver-tragsanpassungsrecht, während der deutsche Bundesgerichtshof diesen in § 313 BGB gerade anders als für die ergänzende Vertragsauslegung unberücksichtigt lässt.125 Damit bleiben die Parteien – anders als im deutschen Recht – die Her-ren des Vertrages.126 Nur dort, wo der Parteiwille keinen Aufschluss gibt, z.B. weil sich die Interessen der Parteien widersprechen, hat der Richter nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB) zu entscheiden.127
Schon diese knappe Beschreibung der schweizerischen clausula-Lehre lässt erkennen, dass sie eine extensive Anwendung des richterlichen Vertragsein-griff s ebenso vermeidet wie eine kleinliche Überwachung: Eine erste Begren-zung der richterlichen Macht gilt zunächst gegenüber den Parteien, denen es nach Art. 24 Abs. 1 Ziff . 4 OR selbst überlassen bleibt, einen Grundlagenirrtum geltend zu machen. Eine weitere Begrenzung ist trotz oder vielleicht gerade wegen des Bekenntnisses des schweizerischen Zivilgesetzbuches zum richter-
120 Vgl. die Nachweise bei Sulzer, Zweckstörungen im schweizerischen Vertragsrecht, 2002, 210 f.
121 BGE 59 II 372, 375. 122 Ausführlich Kramer, in: Berner Kommentar, 1986, Art. 18 N 333-351. Ähnlich BGE 60
II 209: Gebot der Rücksichtnahme im Einzelfall. 123 Überblick bei Bischoff , Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, 1983, 230-237. 124 Kramer, in: Berner Kommentar, 1986, Art. 18 N 357.125 Vgl. oben C.I.126 Vgl. Wiegand, in: Basler Kommentar 4. Aufl . 2007, Art. 18 N 116.127 Art. 4 ZGB: „Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der
Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treff en.“
90
Gesetzesbindung und Vertragsbindung des Gerichts
Ulrike Babusiaux
lichen Ermessen auch gegenüber dem Gesetzgeber erkennbar: Dieser hat auf eine generalklauselartige Ermächtigung wie § 313 BGB ebenso verzichtet wie auf eine Gängelung des Richters durch wiederholte Zustimmungserfordernisse der Parteien, wie sie die meisten französischen Entwürfe ausmachen. Damit ist der Richter gleichzeitig in einer komfortablen wie unbequemen Situation: Gerade weil das Gericht die Befugnis hat, „wie ein Gesetzgeber“ (Art. 1 Abs. 2 ZGB), „nach Recht und Billigkeit“ (Art. 4 ZGB) zu entscheiden, dürft e es grös-sere Anstrengungen unternehmen, die im Einzelfall gerechte, das heisst alle Interessen berücksichtigende Entscheidung zu treff en.
Entscheidendes Kriterium für den Erfolg der schweizerischen Regelung ist damit die Eigenverantwortlichkeit des Richters.
D. Schluss
Während man in Deutschland Richterrecht zum Wegfall der Geschäft sgrund-lage kodifi ziert hat, soll in Frankreich das die théorie de l’imprévision negieren-de Richterrecht durch den Gesetzgeber beseitigt werden. Der Vergleich beider Rechte mit dem schweizerischen Recht zeigt die Schwierigkeiten und Grenzen, die der Gesetzgeber zu überwinden hat: Während man in Frankreich darum ringen muss, eine effi ziente Regelung zu schaff en, um das Gesetz angesichts viel-fältiger Mitwirkungsbefugnisse der Parteien nicht zum toten Buchstaben werden zu lassen, hat die Kodifi kation des ursprünglich richterrechtlichen Instituts in Deutschland zum Anwendungsexzess geführt. Man könnte geneigt sein, diese Folgen als jeweils typisch für die Kodifi kation bzw. die Derogation von Richter-recht anzusehen.128 Angesichts der Schwierigkeiten der deutschen wie französi-schen Gesetzgebung könnte man auch die Frage aufwerfen, ob nicht Richterrecht generell die bessere Lösung für Äquivalenz- und Zweckstörungen darstellt.129
Jedenfalls dürft e die Untersuchung gezeigt haben, dass simplifi zierende An-sätze – sei es die Abwälzung der Verantwortung auf die Parteien in Frankreich, die legislatorische Anordnung der Vertragsanpassung in Deutschland – dem komplexen Problem nicht gerecht werden. Hier gilt: „il y a pire que l’imprévu, ce sont les certitudes! “130
128 Diese Frage ist methodologisch noch nicht ausreichend entfaltet, vgl. bisher Fleischer / Wedemann, Kodifi kation und Derogation von Richterrecht. Zum Wechselspiel von höchstrichterlicher Rechtsprechung und Reformgesetzgebung im Gesellschaft srecht, AcP 209 (2009) 597-627. Im Zusammenhang mit der Geschäft sgrundlage weiterfüh-rend bereits die Überlegungen Kegels, Empfi ehlt es sich, den Einfl uß grundlegender Veränderungen des Wirtschaft slebens auf Verträge gesetzlich zu regeln und in welchem Sinn?, in: Verhandlungen des Vierzigsten deutschen Juristentages, 1953, 189.
129 Eher skeptisch U. Huber, in Bundesministerium der Justiz (ed.), Gutachten und Vor-schläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, I, 1981, 775.
130 Pennac, La petite marchande de prose, Gallimard 1990, 279.
I
Inhaltsverzeichnis
Richterliche Eingriff e in Verträge in der Praxis des schweizerischen BundesgerichtsKathrin Klett
Le rôle du juge dans les codifi- cations doctrinales internationales du droit des contratsClaude Witz
Das Verhältnis des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts zum RichtlinienrechtWilliam Swadling
Le rôle du juge dans le droit dérivé européen des contratsEvelyne Tichadou
Die gesetzliche Rechtfertigung des richterlichen VertragseingriffsUlrike Babusiaux
La qualifi cation du contrat de travail par le juge: réfl exions comparatives à partir des droits français et helléniqueBarbara Palli
Kriterien der Vertragstypen-zuordnung durch den EuGH: Der Kauf einer noch herzustellenden Sache in europäischer PerspektiveSaskia Kümmerle
La décision du juge suisse sur la nature impérative de la loiAriane Morin
Der Entscheidungsspielraum des Gerichts bei der Bestimmung der UngültigkeitsfolgenDavide Giampaolo / Claire Huguenin
Le contrôle des prestations dans les contrats portant sur des droits de propriété intellectuelle – Étude de droit comparé franco-suisseJean-Luc Piotraut
Die Pflichtenstruktur des Maklervertrags in BGB und DCFR – Methodologische, historische und rechts-vergleichende SkizzenChris Thomale
Le principe d’égalité de traitement des salariés en droit françaisJean-Michel Gasser
Contrôle par le juge du contenu des conditions générales de contrat – Approches plurielles d’une question récurrenteLiliane Nau
Die richterliche Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen im schweizerischen Recht: Ein rückblickender Ausblick in die ZukunftThomas Probst
Le contrôle prétorien du contrat de société en faveur des actionnaires investisseursAndra Cotiga
Richterliche Kontrolle von Bürgschaften naher AngehörigerChristiana Fountoulakis
La «convergence parallèle» de l’office des juges français et italiensen matière de rupture de contrat de travail pour motif économiqueRaphaël Dalmasso
Schlussbemerkung zur Tagung „Richterliche Eingriff e in den Vertrag“Ernst A. Kramer
Tagungsbericht: Richterliche Eingriffe in den VertragThomas Raff
Compte rendu du colloque portant sur «l’intervention du juge dans le contrat»Violaine Kocher
ISBN (print) 978-3-86653-237-3ISBN (eBook) 978-3-86653-976-1 www.sellier.de