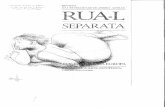Europa – ein Appellbegriff
Transcript of Europa – ein Appellbegriff
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
Appellbegriffe
Es gibt in der Sprache Begriffe, die eine Sache, einen Sachverhalt nicht nur bezeich-nen, sondern postulieren. Sie postulieren nicht allein die Existenz der zu bezeich-nenden Sache. „Gott“ ist wohl der bekannteste und problematischste unter den pos-tulatorischen Begriffen, aus deren Verwendung die Existenz analytisch zu folgern ist.Denn entwickelt man den Inhalt, der mit dem Begriff „Gott“ bezeichnet wird, genau-er gesagt: den Sinn des Begriffes „Gott“, dann stellt man fest, daß in diesem Falle derSinn die Bedeutung 1, und das heißt hier die Existenz Gottes postuliert. Denn dieswar der Einfall des Anselm von Canterbury, nämlich aus der intellektuellen Existenzdes Gottesbegriffes seine reale Existenz zu erschließen. 2 Die Gegenargumente gegenden anselmischen Gottesbeweis beruhen daher alle auf der Verweigerung des Postu-lats – und dies ist recht so, wenn man sich denn einem Postulat entziehen kann. Sogarin der euklidischen Geometrie kann man sich einem Postulat entziehen, mit der Fol-ge allerdings, daß man auch den zu demonstrierenden Lehrsatz nicht nachvollziehenkann. Man muß also nicht von Gott reden, aber wer so wie Anselm von Gott redet,der postuliert mit ihm dessen Existenz.
Nun gibt es Begriffe, die nicht nur die Existenz einer Sache postulieren, sonderneinen Sachverhalt. Mit „Sachverhalt“ meine ich nicht die faktische Gegebenheit einerSache, sondern einen Zusammenhang von Sachen und Umständen, in dem dieseSachen – wenn es sie denn gibt – notwendig (d.h. der Sache nach) verbunden sind.Und diese Umstände sind Wertungen, empirisch kontrollierbare Daten, aber auchpsychische Zustände und kommunikative Strukturen, schließlich auch logische undontologische Verhältnisse, und dies zumeist als Paradoxien oder Antinomien. Es sindwahrscheinlich alle abstrakten Namen Begriffe dieser Art, denn sie bezeichnen nichtnur (wenn überhaupt) eine Sache, sondern ein Syndrom von Verhältnissen und sogarSachverhalten.
Das Wort „Amt“ z.B. bezeichnet eine Aufgabe einer Person mit bestimmtenKompetenzen und Tätigkeiten, mit technischen und praktischen Mitteln zur Durch-
1 „Sinn“ und „Bedeutung“ hier in der von Frege festgelegten Verwendung: Gottlob Frege, Über Sinnund Bedeutung, in: Ders., Funktion, Begriff, Bedeutung, hrsg. v. Günther Patzig, Göttingen 1969,S. 40-65.
2 Sancti Anselmi Proslogion, PL 158, 223-242. Geréby György, Amit Anzelm és Gaunilo mondtakegymásnak, in: Magyar Filófiai Szemle 1999, S. 651-663.
195
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
führung der Aufgaben, und es bezeichnet u.U. auch die Tätigkeit, die mit dem Amtverbunden ist. Soweit handelt es sich noch um verschiedene Denotate, die teilweisehomonym, jedenfalls aber paronym (analog) mit dem Wort bezeichnet werden.
Neben Denotaten gibt es aber auch Konnotate, die mit dem Wort verbundensind. Manche Konnotate nun können in den Vordergrund rücken, etwa in dem Aus-druck „Amtskirche“, der oft in Kontexten auftritt, in denen vor allem Amtsanma-ßung kritisiert, oder gerade solche Kritik zurückgewiesen wird. Denn Amtsanma-ßung sollte gerade dem Begriff und der Sache nach aus dem Amt ausgeschlossensein, wenn denn etwa die Amtskirche ihr Amt im vollen und berechtigten Sinneausübt. Aber es gibt im Wort „Amt“ auch innere Konflikte, vor allem den – der alsAmtsanmaßung kritisiert wird –, daß nämlich die Ausübenden eines Amtes immerauch oder gar zuerst Personen, Menschen mit Individualität sind. Der Begriff „Amt“enthält daher zugleich für den, dem er zusteht, die Aufforderung, eben dieses Amtnicht etwa dadurch zu mißbrauchen, daß er seine persönlichen Probleme und Sor-gen, seine Interessen in der Weise verfolgt, in der er die Aufgaben des Amtes ausführt.Dann allerdings enthält der Begriff „Amt“ einen Appell an den Amtsträger, sein Amtordnungsgemäß und treu zu den eigentlichen Aufgaben auszuführen. Somit wird dasAmt für seinen Inhaber eine Bürde, und das ist recht so. Der Begriff konzentriert sichauf die appellative Konnotation.
Es gibt zahlreiche solche Begriffe, die ich Appellbegriffe nennen möchte, mitdenen zwar eine Sache oder ein Sachverhalt bezeichnet zu werden pflegt, von denenaber ein Appell als Hauptbezeichnung übrig bleibt, wenn alle Denotationsweisen undKonnotationen geklärt sind, und dies so sehr, daß der Appell letztlich die eigentlicheBedeutung ausmacht. Wie beim Amtsbegriff zu sehen ist, lassen sich die Sachverhalteund Sachen klären und sogar mit anderen Wörtern genauer bezeichnen. So ist dasAmt des Bürgermeisters mit Bezeichnungen aus dem Wortschatz der Verwaltung,des Repräsentierens, der Geschäftsführung etc. sehr gut zu beschreiben. Der Appellan die Person, die dieses Amt bekleidet, bleibt jedoch ein Plus über allen Tätigkeitenund Mitteln.
„Ökologisch“ ist ein aktuelles Beispiel für einen Appellbegriff, denn der Begriffgeneriert ein individuelles oder politisch-soziales Sollen. Der Sachverhalt ist in sichkomplex und am ehesten als ein kybernetischer Zusammenhang zu beschreiben: Le-bewesen verhalten sich den faktischen Bedingungen ihres Lebens entsprechend. Soentstand die Ökologie aus der Lebensphilosophie und Biologie am Anfang des 20.Jahrhunderts (Jakob von Uexküll). In einem alltäglichen Beispiel (statt eines poli-tisch brisanten): Gras, das regelmäßig von Kühen gefressen wird, wächst dicht; da-gegen Gras, das von Pferden gefressen wird, verkümmert, weil die Pferde mit ihrenSchneidezähnen die Wurzeln beschädigen. Das ist Ökologie. Während für Natur-
196
Ausdruck vom 27.11.2009
Ach, Europa!
dinge die Umwelt gerade nur das ist, was unbefragbar da ist, und aus dem sich dieBedingungen des Lebens oder Nichtlebens faktisch ergeben, ist sie für den Menschenein prekäres ökologisches System, das der Pflege bedarf. Daher muß man, um dieWeide nicht zu zerstören, dem Gras Zeit zum Nachwachsen und den Pferden Heugeben. Das ist ökologisches Handeln des Menschen. „Ökologisch“ heißt dann: „Dusollst . . . “ und „Du sollst nicht . . . “; und das ist ein Appell.
„Humanismus“ ist ein typischer Appellbegriff, denn er besagt, daß der MenschMensch werden soll, und dies zudem als Individuum durch die allgemeine Humani-tät oder als die gesamte Menschheit durch individuelle Freiheit und Bildung. 3 Alleswas man über den Humanismus seit dem frühen 19. Jahrhundert geschrieben hat (äl-ter ist der Begriff allerdings nicht), läßt sich auf diesen Appell reduzieren, wenn mandie Sachverhalte wie Bildung, Freiheit, Gerechtigkeit etc. geklärt hat. Es ist auch of-fenkundig, daß der Begriff gerade durch seine Kombination von Allgemeinheit undIndividualität voller Antinomien ist. Er ist ein Begriff, der auffordert, ein Paradoxauszuhalten, nämlich individuell motiviert und interessiert zu sein und gerade da-durch die Humanität zu vertreten und zu fördern.
Vielleicht sind alle Appellbegriffe paradoxe Begriffe bzw. solche, die auffordern,ein Paradox für einen Sachverhalt zu halten. Das gilt auch für den Europabegriff. 4
Ach, Europa!
Aus der umfangreichen Literatur zum Thema „Europa“ fallen wenigstens zwei Schrif-ten dadurch auf, daß sie den Begriff mit einem Ausrufungszeichen versehen: ThomasManns Aufruf „Achtung Europa!“ und Hans Magnus Enzensbergers daran anknüp-fende Aufsatzsammlung „Ach, Europa!“ 5 Natürlich gibt es zahlreiche Programm-und Mahnschriften, die in gemäßigter Form appellieren, indem sie Europa als „Ver-mächtnis“, „Verpflichtung“, oder zu gestaltende „Wirklichkeit“ beschwören. 6 Die-se Sprache ist im Laufe der Jahrzehnte weitgehend zurückgenommen worden, aber
3 Vgl. Paul Richard Blum, Humanismus, in: Enzyklopädie Philosophie, Hamburg 1999, I, S. 566-570. Vgl. hier das Kapitel über Jacques Maritain.
4 Im folgenden geht es nicht um europäische Realien (vom Straßenatlas bis zur Lyrik), sondern umsolche Quellen, die den Europabegriff reflektieren oder propagieren.
5 Thomas Mann, Achtung, Europa!, in: Ders., Politische Schriften und Reden, Bd. 2 (= Das essayis-tische Werk, Taschenbuchausgabe in acht Bänden), Frankfurt 1968, S. 314-324. Thomas MannsRede wurde übrigens in der ersten Fassung in Ungarn veröffentlicht, 1935 im Pester Lloyd (vgl.Fabian Goppelsröder in Der neue Pester Lloyd, 3. 11. 1999). – Hans Magnus Enzensberger, AchEuropa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Mit einem Epilog aus dem Jahre 2006, Frankfurt1987 (suhrkamp taschenbuch 1690, Frankfurt 1989).
6 Zwei Beispiele: Jürgen Fischer (Hrsg.), Europa, Vermächtnis und Verpflichtung, Frankfurt 1957;Europa als Idee und Wirklichkeit (Freiburger Dies Universitatis 3, 1954/55), Freiburg 1955. Dabei
197
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
selbst in der Rede vom (zu bauenden oder zu bewohnenden) „gemeinsamen Haus Eu-ropa“ 7 steckt der Appell noch verborgen, zumal diese Metapher in den Achtziger undNeunziger Jahren des 20. Jahrhunderts von Michail Gorbatschow verwendet wurde,um politische Ansprüche anzumelden. Es ist ein Symptom der Verunsicherung, daßder Mittelalterhistoriker Jacques Le Goff in der Präsentation der Buchreihe „Europabauen“ zwar auf die ‚aktive‘ Konnotation des Titels verweist, dann aber in Skepsisausweicht: „Es scheint in der Tat nicht an der Zeit, eine Universalgeschichte Europaszusammenzufügen. Wir wollen das Thema mit Essays umkreisen ( . . . ).“ 8 Auch inder konstruktivistischen Auffassung des Europabegriffs, die selbst Symptom der Su-che nach kulturellen Beschreibungskategorien ist, taucht der Appell unter der Maskeder Entlarvung wieder auf. 9 Im Gegenzug mag, wer Lust hat, elektronische Biblio-thekskataloge nach der Wortkombination „Europa“ und „Hoffnung“ absuchen. 10
Mann und Enzensberger nun drücken im Titel Sorgen aus, die sie im Text aus-führen. Enzensberger scheint an dem Gedanken zu verzweifeln, daß es eine integra-tive Kraft in Europa geben könnte, die Europa zu einer Einheit werden läßt; Manndagegen sieht Europa in Gefahr und zwar in dem, was er implizit für das Gemeinsameund wesentliche an Europa hält. Enzensberger sieht am Schluß das Ende dessen, wasals Sozialismus und Kommunismus Europa einmal eine Einheit gegeben haben mag –sei es als Feindbild, sei es als Erbe eines Humanismus. Thomas Mann schreibt mitder brennenden Sorge eines alten Mannes, während Enzensberger sich von jugendli-cher Wißbegier durch die Länder führen läßt. Enzensberger kennt die menschlichenSchwächen von Funktionären, Mann fürchtet die Unkultur der Massen. Und beidefragen sich: Was ist Europa? Der ältere fragt es mit sorgenvollem Blick auf die Zu-kunft, der jüngere mit weiser Ironie für die jüngere Vergangenheit. Und beide sindsie Europäer, indem sie das tun: Denn Europäer sein heißt offenkundig für beide,sich dem Appell des Europabegriffs stellen und seine Paradoxien aushalten.
Natürlich kann Enzensberger mit Ismen nichts anfangen, denn er weiß, IngeborgBachmann und Shakespeare zitierend: Böhmen liegt am Meer, 11 will sagen, selbst die
darf man nicht erwarten, daß solche Schriften den Schlüsselbegriff reflektieren, oft genügt es dort,die Höhepunkte der Kulturgeschichte zu feiern oder historische Fakten zu repetieren.
7 Wulf Köpke und Bernd Schmelz (Hrsg.), Das gemeinsame Haus Europa, Handbuch zur europäi-schen Kulturgeschichte, München 1999.
8 Jacques Le Goff: Vorort, in: Michel Mollat du Jourdin: Europa und das Meer, München 1993, S. 5.9 Reinhold Viehoff und Rien T. Segers (Hrsg.), Kultur, Identität, Europa: Über Schwierigkeiten und
Möglichkeiten einer Konstruktion (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1330), Frankfurt 1999.10 Aber vgl. auch: Cornelia Grosser, Sándor Kurtán, Karin Liebhart, Andreas Priberski, Genug von
Europa. Ein Reisejournal aus Ungarn und Österreich, Wien 1999.11 William Shakespeare, The Winter Tale, Act 3, Sc. 3. Ingeborg Bachmann, „Böhmen liegt am Meer“,
in: Dies. Liebe: Dunkler Erdteil. Gedichte aus den Jahren 1942-1967, München 1991, S. 54: „ . . .Grenzt hier ein Wort an mich, so laß ich’s grenzen./ Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich dem
198
Ausdruck vom 27.11.2009
Ach, Europa!
geographischen Begriffe Europas sind intellektuelle Konstruktionen, wenn auch vombesten, was Europa zu bieten hat.
Fragt man nun den Text Thomas Manns danach, was für ihn Europa ist, mußman sich durch ein Lamento hindurchlesen, das auch nach der Entschuldigung desVerfassers mit seinem Alter und der damit vielleicht gegebenen „Altersverstimmung“(S. 314) eine gewisse Peinlichkeit hat. Es stören ihn die Massen, die ihn zu Reflexio-nen über das Kollektive und das Individuelle zwingen (S. 316); es schreibt der Dichterdes Ich und der „Selbstverantwortung“ (S. 317) gegen den „Rausch“ des Nachkriegs-europäers und gegen den „Typ, der durch den Krieg hindurchgegangen“ ist. Dereigentliche, der bedrohte Europäer ist der des 19. Jahrhunderts. Denn das Europades fast siebzigjährigen Thomas Mann ist so jung wie sein Humanismus.
Und doch, auch der Schriftsteller der „Buddenbrooks“ weiß, es ist das nämlicheJahrhundert, das die Massen erst hervorgebracht hat nach Zahl und Art. An José Or-tega y Gasset erinnernd erwähnt er die „tragische Einsicht, daß die Generosität desneunzehnten Jahrhunderts ( . . . ) unter deren wissenschaftlichen und sozialen Wohl-taten die europäische Bevölkerung sich verdreifachen konnte ( . . . ), schuld ist an allerRatlosigkeit unserer Gegenwart ( . . . )“ (S. 317). Das gehört jedoch zum Charakterdes Europa vom Typ 19. Jahrhundert, denn Europa ist paradox: „Im 19. Jahrhundertgab es eine Gesellschaft, die fähig war, die europäische Ironie und Doppelbodigkeit(sic!), die idealistische Bitterkeit und das moralische Raffinement“ seiner Kultur zupflegen (S. 318). Läßt man also die Ambivalenz derselben Kultur bestehen, derenUntergang spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, dann kann mannach Thomas Mann einige Charakterzüge des alten Europa namhaft machen: „poli-tischen und sozialen Vernunftwillen ( . . . ) zum Frieden“ und generell die Gesinnung„jeder geistigen Zucht und Gesittung“ (S. 321). Für Thomas Mann, den Schöpferdes Gustav Aschenbach und des „Dr. Faustus“, ist natürlich nicht das Individuumder Feind Europas, sondern der „wildgewordene Kleinbürger“, der „Massenmensch“(S. 321), der die Segnungen der europäischen Kultur gegen sie wendet. „Unter deneuropäischen Ideen, die er dank seiner Erfahrung für endgültig erledigt hält: Wahr-heit, Freiheit, Gerechtigkeit, ist die Wahrheit ihm die verhaßteste, unmöglichste. Waser dafür einsetzt, ist der ‚Mythus‘ ( . . . )“ (S. 322). Unverkennbar, daß Mann hier aufHitler und seine Ideologen vom „Mythus des 20. Jahrhunderts“ anspielt, 12 aber esist auch lehrreich, daß er den Mythus als Substitution oder Surrogat eines idealen
Meere wieder./ Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. . . . “ Vgl. auch Volker Braun,Böhmen am Meer. Ein Stück, Frankfurt 1992.
12 Vgl. dazu vor allem Thomas Mann, Deutsche Hörer!, August 1942, in: Politische Schriften(Anm. 4), Bd. 3, S. 234; hier verwendet Mann übrigens auch die Metapher vom zu bauenden Eu-ropa, allerdings als Zitat der nationalsozialistischen Überheblichkeit.
199
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
Begriffs setzt, den er dem 19. Jahrhundert par excellence zuschreibt. Sándor Máraihat es noch kürzer ausgedrückt: „Der Bürger hat Europa aufgebaut. Und der Spie-ßer hat vernichtet.“ 13 Die wildgewordenen Spießbürger des Nach-Biedermeier müs-sen erkannt haben, indem sie die Bildungsideale des alten Jahrhunderts gegen dessenKultur anwandten, daß auch deren Ideale Appelle an den Menschen waren, die durchandere Appelle austauschbar sind – nur daß Thomas Mann meint, ein solches Sur-rogat bleibe nicht ohne Rest, und den gelte es zu retten. Die „Ersatzabsolutheiten“der Massen (S. 323) machen die Absolutheiten des Bürgers von Lübeck zu „Dop-pelbodigkeiten“, denen die Ironie des Schriftstellers gelten durfte, weil er sie kannte,durchschaute und schätzte.
Da aber die Ideale des 19. Jahrhunderts gerade in der Chance des Individuumsbestanden, für sich selbst verantwortlich und gegebenenfalls auf eine Künstlerexistenzzurückgezogen zu sein, ist Thomas Manns Forderung an Europa genau die, sich aufdiese europäischen Tugenden wieder zu besinnen. Diese sind faktisch identisch mitdem Humanismus der Klassik, wie er in das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhundertsherabgekommen ist. Ohne daß Mann die sachlichen Elemente des Humanismus be-schreibt, weil sie ja schon mit seinem Begriff vom Europäertum angegeben wordensind (nämlich politische und soziale Vernunft, Wille, Zweckorientierung und Mo-ralität in Verbindung mit Bildung), konstatiert er sofort auch die Ambivalenz desHumanismus, so wie er schon die Schwäche und Stärke der europäischen Bildungerkannt hatte, nämlich die Fähigkeit, das ihm entgegengesetzte mitzudenken: Dieeuropäische Geisteshaltung weiß um die Zwielichtigkeit hoher Ideale und gefährdetdadurch selbst seine eigene, postulatorische Existenz: „In allem Humanismus liegt einElement der Schwäche, das mit seiner Verachtung des Fanatismus, seiner Duldsam-keit und seiner Liebe zum Zweifel, kurz: seiner natürlichen Güte zusammenhängtund ihm unter Umständen zum Verhängnis werden kann.“ (S. 324) So endet dennManns Warnung Europas vor seinem Untergang in einem Appell zu einem neuenHumanismus, diesmal einem „militanten Humanismus“ (S. 324).
Es sei darauf hingewiesen, daß ein Humanismus mit Attribut in sich schon pa-radox ist, weil Humanismus als Abstraktion ein umfassender Begriff sein müßte, derdurch ein Attribut (wie: christlich, sozialistisch, real, neu) entmachtet wird und da-durch auch seine postulatorische Kraft verliert, denn Appellbegriffe als Abstraktionenbeziehen ihre Appellfunktion daher, daß sie jenes Plus gegenüber den bezeichnetenSachverhalten haben. Qualifizierungen durch Adjektive machen es dagegen möglichoder gar nötig, den Begriff in seiner konkreten Anwendung oder als bloße Speziesvon etwas Umfassenderem zu verstehen. Allerdings sind die Adjektive, die zumeist
13 Sándor Márai, Geist ist im Exil, Hamburg 1959, S. 23.
200
Ausdruck vom 27.11.2009
Ach, Europa!
zur Qualifizierung von Humanismus verwendet werden, selbst entweder universal(z.B. christlich, real) oder wiederum postulatorisch (wie: neu, oder hier: militant).
Die Ambivalenz des Attributs ‚militant‘ zu ‚Humanismus‘ wird aus Jan PatockasAuffassung der ‚nach-europäischen Situation‘ klar. Für ihn bestimmt der Logos alsStifter des Allgemeinen und der Universalität das, was Europa ausmacht. Die Aufklä-rung mit dem Primat des Handelns vor dem Sein hatte diese Universalität in Expan-sion umgesetzt. Um eine ‚nacheuropäische Kultur in Europa‘ zu retten, fordert er,nach der „Welteroberung“, deren Manifestationen Thomas Mann geklagt, den Wegder „Welterschließung“ „wiederzufinden und zu Ende zu gehen“. 14 Nimmt man Pa-tockas Analyse der „Sorge für die Seele“ als bestimmenden Zug abendländischen po-litischen und metaphysischen Denkens zum Ausgangspunkt, kommt man leicht aufden Gedanken, daß der Humanismus des 19. Jahrhunderts nichts anderes ist als dieSorge um den Verlust der Seele durch die Aufklärung: Man redet von dem, was mannicht hat. 15 Denn die „nacheuropäische Periode“ besteht für ihn genau in der „Kri-tik am Europa des 19. Jahrhunderts“, das den Idealen die Glaubwürdigkeit geraubthat (S. 216). Militanz wäre in diesen Kategorien nur ein Replikat der Verluste, die derneue Humanismus kaschiert. Die für den Europabegriff wichtige Beobachtung ist dieKonnotation des Expansiven, das für den tschechischen Denker eine veräußerlichteForm der Einsicht und Welterschließung ist. Das Expansive am Europäischen dürf-te sich unter den Bedingungen der Verlusterfahrung, von der Thomas Mann oderEnzensberger schreiben, ins Appelative wenden.
Expansion, die dann auch die Form von Mission, Imperialismus und Kolonisati-on annehmen kann, ist auch für Lucien Febvre in seiner Vorlesung von 1944/45 dasgenuin humane Charakteristikum Europas: „( . . . ) nous sommes à la recherche d’uneEurope humaine, d’une Europe faite de groupes humains capables de créer, capablesde partager, capables de propager une civilisation européenne, spécifiquement eu-ropéenne.“ 16 Im Jahr 1940 übt Eberhard Grisebach scharfe Kritik am Mythos vomHumanismus. Seiner Beobachtung nach hat Europa aus dem klassischen Altertum„den Universalismus, den Imperialismus und die Heimatlosigkeit“ geerbt. 17 Alle dreiCharakteristika bedingen einander: der Allgemeinheitsanspruch der Vernunft greiftdemnach in intellektuelle, politische und soziale Herrschaft über (an der schon die
14 Jan Patocka, Europa und Nach-europa. Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme,in: Ders., Ketzerische Essais zur Philosophie und ihrer Geschichte, hrsg. von Klaus Nellen u. JiriNemec, Stuttgart 1988, S. 207, 212.
15 Ebd. S. 281 f. (§XI).16 Lucien Febvre, L’Europe. Genèse d’une civilisation. Cours professé au Collège de France en 1944-
1945, Paris 1999, S. 74.17 Eberhard Grisebach, Die Schicksalsfrage des Abendlandes. Sturmzeit, Grundlagenbestimmung,
Aufbaugedanken, Bern/Leipzig 1942, S. 55.
201
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
antike Kultur zugrundegegangen sei) und verschleiert zugleich die Heimatlosigkeit:„Indem der Mensch sich selbst in dieser Weise überhöht, ein Übermenschentum inhehren Sphären begründet, hofft er die Heimatlosigkeit, den Verlust der Mensch-lichkeit und Wirklichkeit zu überwinden.“ (S. 59) Deshalb empfiehlt Grisebach, sich„mit einer Berufung auf diese geistige Grundlage zurückzuhalten“ (S. 61). Stattdes-sen appelliert er an das für europäische Menschen durchgehend typische Arbeitsethos,auch in der Philosophie, aus dem sich erst (wieder) Heimat ergebe. 18
Patocka, Febvre und Grisebach schreiben mit sehr vorsichtigen Andeutungen un-ter dem Eindruck der „Verlegenheit des Europäers“ angesichts des Zweiten Weltkriegsund des Nationalsozialismus, in dem „ein einzelner Mensch oder ein einzelnes Volk( . . . ) uns als unser Schicksal begegnet“ ist. 19 Nähme man diese Analysen als Text-basis, so müßte man meinen, daß humanistische Europa gäbe es entweder gar nichtoder sollte es besser nicht geben. Denn die vielbeschworenen Erfolg und Werte sindmit ihrer Selbstvernichtung erkauft. Worauf Thomas Mann mit Stolz verweist, dieIronie der bürgerlichen Kultur, erscheint bei ihnen als innere Tragik, nämlich sichveräußerlichen, propagieren und damit gegen sich selbst wenden zu müssen. Wenndies das Wesen der Sache ist, wie mag es erst um den Begriff stehen? Es ist zu vermu-ten, daß die Sache, Europa, von diesem Begriff so genau erfaßt wird, daß sein Inhaltsich auf den Appell des Aufbaus und der Vermeidung der Destruktion konzentriert,wenn nicht reduziert.
Thomas Mann ist also für einen militanten Humanismus 20, „der seine Männ-lichkeit entdeckte“, um sich gegen die Ausbeutung durch seine eigenen Prinzipien,nämlich Freiheit, Toleranz und Selbstkritik, verteidigen zu können – andernfalls wird„ein Europa ( . . . ) sein, das seinen Namen nur noch ganz historischerweise weiter-führen wird und vor dem es besser wäre, sich ins Unbeteiligt-Zeitlose zu bergen“(S. 324). Das ist die Konklusion, Warnung und Empfehlung des ungeduldigen altenEuropäers: Europa und der Humanismus sind dem Begriff nach permanente Re-naissancen, Potentiale zur Wiedergeburt von Ideen. 21 Wenn diese akut sind, sindsie notwendig auch militant. Wenn sie ihre Militanz aufgeben, verschwinden sie al-lerdings keineswegs ins Nichts, sondern einerseits in die Geschichte und anderer-seits „ins Unbeteiligt-Zeitlose“. Von da her können sie jederzeit wieder auferstehen(q.e.d.). Das Unbeteiligt-Zeitlose enthält zusammen mit der an Martin Heidegger
18 Ebd. S. 283-285, 299-301.19 Ebd. S. 18.20 Zum militanten Humanismus bei Mann s. Mádl Antal, Thomas Mann világ- és emberképe [Tho-
mas Manns Welt- und Menschenbild], Budapest 1999, S, 16-27.21 Vgl. Samuel Szemere, Kunst und Humanität. Eine Studie über Thomas Manns ästhetische Ansich-
ten, 2. durchges. Aufl., Budapest/Berlin 1967, S. 120: “Europa ist für Thomas Mann tatsächlichesErlebnis und eine noch zu lösende Aufgabe . . . “
202
Ausdruck vom 27.11.2009
Ach, Europa!
gemahnenden Verbform „sich bergen“ noch eine weitere Ironie und Doppeldeutig-keit: Nicht allein verschwindet der europäische Humanismus oder das humanistischeEuropa in die Geschichte als Serie objektiv-faktischer Daten oder Namen, sonderner geht auch in das Zeitlose, das Ewige auf. Dort aber löst er sich nicht ins Unver-bindliche und Abstrakte auf, sondern er verbirgt sich dort und bewahrt sich – bereitzur Wiederkunft. Schließlich aber ist das Zeitlose nicht das unkonkrete Allgemeine,sondern zugleich das Unbeteiligte, also die Höhe jener unaufgeregten Distanz, dieden weisen Dichter des europäisch-humanistischen Ideals ausmacht, das selbstver-antwortliche Individuum. Daher endet Thomas Manns Lamento über den Unter-gang der Kultur, in der er lebt, in einem Kassandraruf, der weiß, daß er vergeblichbleiben wird, und in einer Warnung: Wartet nur, wenn wir Dichter wiederkommen!Achtung, seid euch bewußt, daß Europa – solange es auch nur dem Namen nachbesteht – immer wiederkehren wird!
Was hier in einer einzelnen Interpretation deutlich wurde, läßt sich an zahlrei-chen Texten zeigen. Es scheint ein Konsens darin zu bestehen, daß der Humanismusbzw. das politische Bildungsideal im 19. Jahrhundert den Europabegriff geprägt ha-ben. Zu diesem Begriff gehört dann immer auch die Konnotation von Gefährdung.Man redet von dem, was man nicht hat. Nach Ansicht von Heinz Gollwitzer entste-hen die Begriffe ‚Abendland‘ und ‚Europa‘ sogar erst in „Stunden, da diese neue Weltin ernster Gefahr schwebte“, und verweist dabei auf die „Gotengeschichte“ des Jor-danes (ca. 550 n. Chr.). 22 Das hieße, die Gefährdung und die Mahnung zur Abwehrderen primäre Konnotate von „Europa“ von Anfang an. Deshalb sind die meistenReden von Europa zugleich Paränesen, Ermahnungen, Warnungen, Aufrufe und Ap-pelle – selbst dann, wenn es gelegentlich heißt „Europa schweigt, schweigt schonwieder“. 23
Besonders intensiv politisch intendiert, kulturell begründet und im Ergebnis of-fen waren die Bemühungen von Richard Coudenhove-Kalergi, der 1922 mit einemBuch „Paneuropa“ eine gesamteuropäische Bewegung gründete. Worauf er sich stüt-
22 Heinz Gollwitzer, Zur Wortgeschichte und Sinndeutung von „Europa“, in: Saeculum 2 (1951)S. 161-172; hier 163.
23 Sándor Petofi, Gedicht mit der Anfangszeile: „Európa csendes, újra csendes“ vom Januar 1849,das beklagt, Ungarn sei von Europa im Stich gelassen worden, und zugleich dessen Führung imeuropäischen Freiheitskampf beansprucht. – An dieser Stelle sei angemerkt, daß das Begriffsfeld‚Mitteleuropa‘ hier nicht behandelt werden kann, da es sich der Sache nach um ein völlig ande-res Problem handelt. Vgl. hierzu: Jacques Le Rider, Mitteleuropa. Auf den Spuren eines Begriffes,Wien 1994. Dort S. 21 ein Zitat von Jeno Szücs (Les trois Europes, Paris 1985), das eine der Kon-notationsparadoxien des Begriffs andeutet: Mitteleuropa definiert dieser als den „westlichen RandOsteuropas im geographischen Sinn und den östlichen Rand Westeuropas im strukturellen Sinn“.Vgl. ferner in dem Europa gewidmeten Heft 5/6 (1997) der Zeitschrift Rubicon, S. 43-48: IgnácRomsics, Közep- és/vagy Kelet-Európa? [Mittel- und/oder Ost-Europa?].
203
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
zen kann, ist jener Humanismusbegriff des 19. Jahrhunderts, den er um aktuelleGeistesströmungen anreichert. Man vergleiche nur zwei seiner Aufsätze von 1936und 1966 mit dem identischen Titel „Europas Seele“. Er diagnostiziert in ihr „dreiDimensionen“, zuerst sind dies Individualismus, Sozialismus und Heroismus, dreißigJahre später ist die europäische Seele „dreidimensional: christlich die Tiefe, hellenischdie Weite, germanisch die Höhe“. 24 Dieses Beispiel zeigt, daß eine kulturelle inhalt-liche Bestimmung des Europäischen sich durch den Lauf der Zeiten immer wiederfrustrieren muß, so daß als festes Ergebnis nur bleibt: „Europa ist keine Tatsache –sondern eine Forderung.“ 25
Geist der Geographie
Das alles schließt nicht aus, daß der Begriff Europa nicht auch sachliche Denotate,also reale Referenten hätte. Wenn es um Konflikte über Europa geht, dann werdensie meistens um eben jene Referenten ausgetragen, um die Bedeutung, die man mit„Europa“ verbindet, während man sich über seinen Sinn streitet. Wie man aber Fe-derico Chabods Übersicht entnehmen kann, ist der Europagedanke im Laufe derGeschichte zumeist nicht von inneren Sachverhalten, sondern von Gegenbegriffenbestimmt: Im Gegensatz zu Asien, zur Tyrannis, zu Nichtchristen, zur Ostkirche, zurBarbarei, zur Nation und anderem. 26 Es liegt nahe, daß die Beschäftigung des Italie-ners mit dieser Geschichte von der unmittelbar überlebten Barbarei des italienischenFaschismus motiviert war. Er kommt zu dem Ergebnis, daß „Europa“ eine Kultur,ein Seinsverhalten, ja eine forma mentis bezeichnet (S. 11), die folglich nicht vor unsliegen kann, sondern das Ergebnis der Geschichte in ihrer Fülle ist.
Doch kommt es auch vor, daß die Existenz dessen, was mit „Europa“ bezeichnetsein soll, bestritten wird. Dann wird Europa zugleich zu einem bedeutungslosen Ort,
24 R. N. Coudenhove-Kalergi, Europa ohne Elend. Ausgewählte Reden, Paris/Wien/Zürich 1936,S. 30; Richard Coudenhove-Kalergi, Paneuropa 1922-1966, Wien/München 1966, S. 121.
25 Coudenhove-Kalergi, 1966, S. 119. – Ähnlich schon Graf Hermann Keyserling, Das SpektrumEuropas, Berlin/Leipzig, vierte Auflage 1928, S. 400 89-492; 492: „In diesen letzten Betrachtungensprach ich viel von ‚Sollen‘. Das ist, weil Europa noch nicht ist.“ Vgl. Hugh Setton-Watson, Whatis Europe, Where is Europe? From Mystique to Politique, in: Encounter 65/2 (1985) S. 9-17, zitiertnach Norman Davies, Europe. A History, Oxford 1996, S. 14: „Let us not underrate the need for apositive common cause ( . . . ) – a need for an European mystique.“
26 Federico Chabod, Der Europagedanke von Alexander dem Großen bis Zar Alexander I., Stuttgart1963 (Urban Taschenbücher 71; Storia dell’idea di Europa, Rom 1959). – Für Ennea Silvio Piccolo-mini ist Europa vor allem das Gebiet, das es von den Türken zu befreien gilt: Pii Secundi PontificisMaximi Commentarii, hrsg. von Ibolya Belus u. Iván Boronkai, Budapest 1993-1994, lib. 5 § 11,S. 254 f., lib. 12 § 30, S. 597 u.ö.
204
Ausdruck vom 27.11.2009
Geist der Geographie
allerdings muß die Appellfunktion verschoben werden. Es scheint, daß mit der Be-deutungsentleerung keineswegs die Appellstruktur verschwindet, vielmehr wird sieauf einen neuen Begriff übertragen. Das eklatanteste Beispiel ist Oswald Spenglers„Der Untergang des Abendlandes“ (1917). Wem leuchtet es bei dem Titel nichtsofort ein, daß es hier etwas zu retten gilt? In Wirklichkeit war der Buchtitel be-kanntlich ein Marketingtrick, bei dem der Verleger sich auf eben die Signalfunktiondes Europabegriffes verlassen konnte. Jedoch mußte „Europa“ durch „Abendland“ersetzt werden, denn der Sache nach verlegt Spengler seine Untersuchung weg voneiner Affirmation der europäischen Kultur hin zu einer vergleichenden Morphologie,bei der Europa keine Entität ist, sondern nur eine Morphose der Weltkulturen unteranderen, eben das Abendland. 27
Dagegen meint Eugen Rosenstock-Hüssy, das „Pathos des Humanisten-NamensEuropa“ habe lediglich „das Pathos des ‚Abendlandes‘“ abgelöst. 28 Dabei versteht erunter Abendland die antike Kultur im Unterschied zum christlichen Mittelalter undzur Neuzeit „von 1492 bis 1918“; seither, nämlich seit dem Engagement der USAim Ersten Weltkrieg, sei Europa aufgrund der neuen Perspektive zur „Alten Welt“mutiert. 29 Im Unterschied zu jenen, die Europa in der Antike und im Christentumwurzeln lassen wollen, ist für Rosenstock-Hüssy Europa „ein überschreitender Gren-zebegriff, der etwas verschweigt“, nämlich eben diese Wurzeln, somit also zwar keinAppellbegriff, aber doch ein Pathosbegriff, ein „Protest“ und ein „Konkurrenzbegriff“zum „Abendland“, und darin besteht sein Inhalt (S. 37 u. 45).
Auch Arnold Toynbee, der unter dem universalen Titel „A Study of History“ diewelthistorische Forschung infragestellt, verweist die Existenz Europas als etwas vonAsien verschiedenes in das Reich der Phantasien. Dabei greift er niemand geringe-ren an als den Vater der Geschichtsschreibung, nämlich Herodot: „The dichotomyof Europe and Asia was one of the least useful legacies which the Modern Worldhad accepted from the Hellenic world.“ 30 Umgekehrt könnte man Herodot selbstdafür in Dienst nehmen, daß der Europabegriff nebulös ist, denn seiner Beschrei-bung nach ist Europa zwar weit genug, sich im Norden über ganz „Libyen“ (Afrika)und Asien zu erstrecken, aber weder kennt irgendjemand seine Grenzen nach Westen
27 Vgl. dazu Jörn Rüsen (Hrsg.), Westliches Geschichtsdenken. Eine interkulturelle Debatte, Göttin-gen 1999.
28 Eugen Rosenstock[-Hüssy], Die europäischen Revolutionen. Volkscharaktere und Staatenbildung,Jena 1931, Seite 47. Vgl. dazu Gollwitzer, Wortgeschichte, S. 161.
29 Rosenstock S. 43. Für die US-amerikanische Perspektive s. Lindsay Waters, On the Idea of Europe.Second thoughts on the drive for cultural unity, from a once-devout Europhile, in: Boston Review,April/May 1997 [online], mit weiterer Literatur.
30 Arnold J. Toynbee, A Study of History, Abridgement of volumes VII-X by D. C. Sommervell,Oxford/London 1957, S. 240.
205
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
und nach Norden, noch warum die eine Erde drei Namen, zumal von Frauen, hatund wer die Erdteilgrenzen festgelegt hat. 31 Was für Toynbee die Abgrenzung nachOsten, ist für Herodot die nach Nordwesten: unbestimmt. Die Ironie in Herodotstrotz vielzitierter 32 Bestimmung Europas scheint nur Lucien Febvre aufgegangen zusein. 33 Auch auf Mark Aurels „Meditationen“ (§ 33) hätte Toynbee sich berufen kön-nen, für den Asien und Europa nur ein paar kleine Stückchen der Welt sind, so wieder Athos eine Scholle. Darstellungen, in denen Europa als wohlgestaltete Dame mitidentifizierbaren Gliedern erscheint, sind die Ausnahme. So bei Sebastian Münster(in Ost-West-Ausrichtung) mit Spanien als Kopf, Sizilien als Reichsapfel und Böh-men als Herz. 34 Als der polnische Dichter Juliusz Slowaki dieses Bild 1836 übernahm(natürlich mit Warschau im Herzen), gerieten schon Petersburg, Odessa und andereStädte zu Nägeln an den Füßen, während Neapel Europas blaue Augen und – geo-graphisch etwas schwierig – Paris der Kopf sein sollte. 35 Noch Gottfried Benn – wohlin Nachfolge von Spengler und Toynbee – nennt Europa einen Nasenpopel aus einerKonfirmandennase. 36 Und für den ungarischen Dichter Lajos Parti Nagy ist Europasoetwas wie ein flauer Wurstlprater im Winter. 37 All das sind Provokationen gegenden Konsens, und auf den kommt es hier an.
Merkwürdigerweise beruft sich auch Ernst Robert Curtius in der Einleitung zuseinem Buch „Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter“ 38 auf Toynbee. Al-
31 Historien IV, 45. Zum antiken Wortgebrauch außer Gollwitzer, Wortgeschichte, siehe Siefried Ep-perlein, Zur Bedeutungsgeschichte von „Europa“, „Hesperia“ und „occidentalis“ in der Antike undim frühen Mittelalter, in: Philologus 115 (1971) 81-92.
32 Übrigens beherrscht Herodots Geographie auch noch die „Gesta Hungarorum“ des Anonymus„P.“, der sie verwendet, um die Hereinkunft der Ungarn nach Europa zu schildern; dies ist umsodeutlicher, als er diese „Gesta“ als Fortsetzung bzw. Parallelstück zur Geschichte Trojas vorstellt:Emericus Szentpétery (Hrsg.), Scriptores rerum Hungaricarum, vol. 1, Budapest 1937 (ReprintBudapest 1999), S. 33 und 34-37; über Entstehungsschichten dieser Chronik zusammenfassend:László Veszprémy, Gesta Hungarorum: Die Anfänge nationaler Chronistik im Mittelalter, in: Al-fried Wieczorek und Hans-Martin Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000, Stuttgart 2000, Bd. 2,S. 868-870.
33 Febvre, Europe, S. 58: „Ainsi, à cet esprit sagace et critique, il est difficile d’ajuster sur la realité lanotion théorique, la notion précaire et hazardeuse de continent déjà fort grande.“
34 Sebastian Münster, Cosmographia universalis, Basel 1550-1554; Abbildung in Davies, Europe, S. 1.Diese Darstellung wurde für Karl V. entworfen, so Rosenstock, Revolutionen, S. 35.
35 Davies, Europe, S. 1.36 Gottfried Benn, Gedicht „Alaska“, in ders., Gesammelte Werke in acht Bänden, hrsg. von Dieter
Wellershoff, Bd. 1, Wiesbaden 1960, S. 20.37 So im Titelgedicht von Lajos Parti Nagy, Europink, Pécs/Budapest 1999, S. 70: „egy lanyha téli
vurstliban, / Európa itt van, umtata“. Das Gedicht besteht nur aus despektierlichen Antiphrasender Titel spielt mit der Farbe Rosa und der ungarischen Possessivendung „-nk“ (Europánk – unserEuropa).
38 Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 11. Aufl. Tübingen/Basel
206
Ausdruck vom 27.11.2009
Geist der Geographie
lerdings nicht, weil er dessen globale Relativierung Europas teilt, sondern weil erunter Berufung auf das Buch von Ernst Troeltsch über den „Historismus und sei-ne Probleme“ die Auffassung teilt, daß akute historische Probleme durch historischeForschung überwunden werden müssen, und weil Curtius selbst den Begriff des „Eu-ropäischen“ revidieren möchte. Vorsätzlich wehrt er sich, Europa als bloßen geogra-phischen Namen aufzufassen, vielmehr ist es für ihn „eine historische Anschauung“,d.h. eine Betrachtungsweise des Gegenstands Europa. Das Historische ist eine Be-dingung dafür, Europa überhaupt als Sinneinheit zu erkennen. Dann allerdings darfder Begriff nicht in der Aufzählung von Gegenständen aufgehen, denen das Etikett„europäisch“ zufällig anhaftet. Denn die innere Dynamik der Inventarisierung des-sen, was zu Europa gehört, zerlegt den Anschauungsbegriff in unzusammenhängendeTeile, in „Raumstücke“, wie Curtius es nennt, und in zufällig einander folgende Epo-chen (Antike, Mittelalter, Neuzeit) ohne jede „Gesamtansicht“ (S. 16). Und sofortfolgt der Aufruf: „Europäisierung des Geschichtsbildes ist heute politisches Erforder-nis geworden, und nicht nur für Deutschland.“ (S. 17)
Es zeichnet Curtius’ Weitblick aus, daß er an dieser Stelle erkennt, daß letztlichdie Dichtung – eine „von der Phantasie geschaffene Erzählung (fiction)“ – der Auf-gabe gewachsen sein kann, die Globalisierung und Sinngebung des Europabegriffeszu leisten (S. 17 f.). Denn lange vor der Diskussion um die Narrativität der Histo-rie 39 hat Curtius gesehen, daß die Sinnstiftung der Historie nicht von Datenmaterialabhängt, sondern von der Phantasie, an die die Historie appelliert.
Curtius will Europa verstehen und erklären. Deshalb trennt er den geographi-schen Sachverhalt ab und konzentriert sich auf den historisch-zeitlosen. Denn ersucht nach einem Sinneinheit stiftenden Aspekt, einer Erzählperspektive, aus derdie Einheit Europas plausibel wird – eine Erzählung, die als Aufgabe und Auftragin die Zukunft gereicht werden kann. Statt nun in eine Allgemeinheit auszuweichen,wie das mancher Verteidiger Europas getan hat, greift Curtius die lateinische Spracheauf, in dem vollen Bewußtsein, mit dieser Wahl anderen Sachverhalten, die dieserNarrativität entgegenstehen, Unrecht zu tun: in seinem eigenen Vergleich z.B. derGeographie. Denn die „Literatur des ‚modernen‘ Europa ist mit der des mittelmee-rischen so verwachsen, wie wenn der Rhein die Wasser des Tiber aufgenommen hät-
1993. Vgl. Manfred S. Fischer, Europäisches und nationales Selbstverständnis bei Ernst RobertCurtius, in: Hugo Dyserinck und Karl Ulrich Syndram (Hrsg.), Europa und das nationale Selbst-verständnis (Aachener Beiträge zur Komparatistik 8), Bonn 1988, S. 321-366.
39 Paul Veyne, Writing history: Essay on Epistemology, Middletown, Conn.1984; Hayden White, TheContent of Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore/London 1987; M.C. Lemon, The discipline of History and the History of Thought, London/New York, 1995, ch.2; Chris Lorenz, Can History be True? Narrativism, Positivism, and the ‚Metaphorical Turn‘, in:History and Theory 37 (1998), 309-329.
207
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
te“. 40 Hat er aber nicht, könnte Enzensberger antworten, es sei denn Böhmen liegtam Meer.
Diese geographische Metapher sagt aber doch so viel, daß viele Teile des geo-graphischen Europa, bei Curtius sogar Deutschland, um ihre geistige Zugehörigkeitkämpfen müssen. Patocka hat dies in einem Artikel über die tschechische Bildung inEuropa, ausgerechnet im Jahr 1939, dargestellt. Anders als Curtius sieht der Philo-soph aber nicht in einer bestimmten literarischen Qualität, sondern in der Fähigkeitdes Denkens, „Allgemeinheit“ nicht nur zu abstrahieren sondern auch zu intendieren,das einigende Band Europäischen Denkens, das freilich immer durch Zersplitterunggefährdet ist. 41
Weiterhin spielt Curtius mit den Raum-Zeit-Dimensionen und nennt die „euro-päische Literatur ( . . . ) der europäischen Kultur koextensiv“: „Die europäische Lite-ratur als Ganzes zu sehen, ist nur möglich, wenn man sich ein Bürgerrecht in allenEpochen von Homer bis Goethe erworben hat. ( . . . ) Man ist Europäer, wenn mancivis Romanus geworden ist.“ (S. 22) Von der Entgrenzung des geographischen Euro-pabegriffs geht es schnell zum Rechtsbegriff des Europäers. Europa konstituiert einRecht, auf das man sich berufen kann, und eine Pflicht, sich entsprechend zu verhal-ten.
Vordergründig wendet sich Curtius’ Polemik gegen die herrschende Germanistikund die durch den Klassizismus geförderte Mißachtung der lateinischen Literatur desMittelalters. Dabei übersieht er berufsmäßig, daß die Kultur des Mittelalters auch um1950, erst recht aber im 19. Jahrhundert durchaus noch ihre Verehrer hatte, allerdingsweder unter nationalem Gesichtspunkt noch mit spezifisch europäischen Interessen,sondern unter der selbstverständlichen Annahme (trotz vereinzelter Gegenstimmen)einer historischen wie übernationalen Einheit – nämlich innerhalb der katholischenNeuscholastik, für die das, was als mittelalterliche Philosophie und Theologie galt,Höhepunkt einer philosophia perennis war. 42
Mit seiner Polemik und seinem latinistischen Programm muß Curtius aber im-plizit eingestehen, daß es eben Divergenzen gibt, daß nicht alle Disziplinen glei-chermaßen zur europäischen Sinneinheit beitragen können (er nennt als Beispieldie Kunstgeschichte), und daß schließlich sein Europabegriff eine Überwindung desKonzepts von Nationalliteraturen verlangt, die für das Mittelalter leicht, für das 17.
40 Curtius, Europäische Literatur, S. 20. Vgl. Febvre, Europe, S. 82, über die Zugehörigkeit der Rhei-nischen Städte zum Imperium Romanum. Zur römischen Komponente der europäischen Kulturvgl. Rémi Brague, Europa, Eine exzentrische Identität, Frankfurt 1993 (Europe. La voie romaine,Paris 1992)
41 Jan Patocka, Die tschechische Bildung in Europa, in: ders., Kunst und Zeit, hrsg. von Klaus Nellenu. Ilja Schubar, Stuttgart 1987, S. 351-386; hier 353.
42 Stellvertretend: Otto Willmann, Geschichte des Idealismus, 3 Bde., Braunschweig 1894-1897.
208
Ausdruck vom 27.11.2009
Unendliche Teleologie Europas
bis 19. Jahrhundert jedoch kontrafaktisch ist. So läßt er sich positiv auf Hugo vonHofmannsthals Wertung Goethes ein: „Goethe kann als Grundlage der Bildung eineganze Kultur ersetzen.“ (S. 25) Denn er ist sich der römischen Wurzeln Goethes be-wußt und sieht in ihm das Ende der europäischen Kultur. Jedoch übergeht Curtiusdas Paradox, daß mit Goethe spätestens die postulierte europäische Literatur in einedeutschen Nationalliteratur aufgeht, deren römische Quellen längst in einen eige-nen Strom aufgegangen sind. Zudem schließt Curtius willentlich und wieder unterBerufung auf Goethe die griechischen Quellen aus, obwohl er wissen muß, daß dieOption gegen die römische und für die griechische Tradition gerade eine nationa-le Besonderheit des deutschen Verhältnisses zur Klassik im Unterschied zu England,Frankreich und Italien war. 43 Hinter dem Postulat einer europäischen Literatur imlateinischen Mittelalter lauert also wieder die geographische und sprachliche Zertei-lung, und es melden sich Stimmen, die ebenfalls Einlaß in die Appellinstanz Europafordern.
Unendliche Teleologie Europas
Die seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts vielstimmige Rede von der ‚Rückkehrnach‘, dem ‚Eintritt in‘ oder die ‚Aufnahme in Europa‘, dazu der semantische Wechselder politisch-wirtschaftlichen Struktur einer „Europäischen (Wirtschafts-) Gemein-schaft“ zu einer „Europäischen Union“, basiert nach den vorgebrachten Belegen aufeinem Begriff von Europa, dessen Schwäche die inhaltliche Unterbestimmtheit unddessen Stärke die Vielzahl unaussortierter Konnotate ist, von denen das Appellativeam meisten konstant bleibt. Der semantische Unterschied zwischen Gemeinschaftund Union besteht im Wechsel von der Perspektive der Mitgliedern eines freien Zu-sammenschlusses zur Perspektive der Einheitsicherungsinstanz, so daß der Ortsname„Brüssel“ polemische Konnotation 44 erhält. Dieses Problem wird unter dem BegriffSubsidiarität diskutiert, wonach der guten Absicht nach die Selbstbestimmung derMitglieder erhalten bleibt, während nur solche Verwaltungs- und Rechtsregeln zen-tral aufgestellt werden, die naturgemäß alle betreffen. Dabei übersieht man oft, daßdieser Begriff der Subsidiarität aus der christlichen Soziallehre stammt 45 und systema-
43 Ludwig (!) Curtius, Die antike Kunst und der moderne Humanismus (zuerst in: Antike und Abend-land 3, 1927, S. 1-16), in: Hans Oppermann, (Hg.), Humanismus (Wege der Forschung 17),Darmstadt 1970, S. 49-65, hier S. 51.
44 Paul Michael Lützeler, Die Schriftsteller und Europa von der Romantik bis zur Gegenwart, Mün-chen 1992 (Serie Piper 1418), dort das Kapitel über Enzensberger. Vgl. Paul Michael Lützeler(Hrsg.), Hoffnung Europa. Deutsche Essays von Novalis bis Enzensberger, Frankfurt 1982.
45 Vgl. z.B. Oswald von Nell-Breuning (Hrsg.), Soziallehre der Kirche. Erläuterung der lehramtlichenDokumente, Wien 1983 (Soziale Brennpunkte 5).
209
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
tisch (nur) eine Umkehrung des einer christlichen Kirche wohl anstehenden Prinzipsder Hierarchie ist, nämlich das Durchdringen des einigenden Prinzips auf alle jeweilseigenberechtigte Ebenen. Auch dieses Schwanken zwischen Ideal und Organisationist nicht neu.
Friedrich Schlegel z.B. konstatiert, daß die Moderne noch gar nicht angebrochensei und mit ihr auch noch nicht Europa. Er sieht sich selbst noch „in dem wahrenMittelalter leben“ 46 – die Neuzeit ist das, was vor ihm liegt. Da er von einem orga-nischen Nationenbegriff ausgeht, muß er der Nation einen Charakter mit je eigenerIndividualität zusprechen. Geomorphologisch betrachtet kann es daher für ihn keinorganisches und natürlicherweise einheitliches Europa geben, wenn denn Klima undandere geographische Umstände die Entwicklung des Individuums prägen. Auf dasindividualorganische Denkmuster folgt das der Verwandtschaft, und Schlegel führtdie Kontraste zwischen den Religionen auf eine gemeinsame Verwandtschaft in In-dien zurück (S. 98 f.). Damit ist die Aufgabe Europas klar: Die Zukunft liegt in dergemeinsamen Vergangenheit. „In der gänzlichen Verderbtheit Europas selbst sind dieKeime der höheren Bestimmung sichtbar.“ (S. 103) So also lautet der Auftrag, deraus der Beschreibung der Zergliederung und Vielfalt Europas folgt: „das eigentlicheEuropa muß erst noch aufstehen. Wir ( . . . ) selbst sollen mitwirken, die tellurischenKräfte in Einheit und Harmonie zu bringen, wir sollen die Eisenkraft des Nordens,und die Lichtgluth des Orients in mächtigen Strömen überall um uns her verbreiten;moralisch oder physisch, das ist hier einerlei ( . . . )“ (S. 105).
Die Denkform, daß die Gegenwart der Anbruch einer Zukunft ist, die aus einerentfernten Vergangenheit ihre Motive, ihre Legitimation und ihre Inhalte bezieht,ist nicht außergewöhnlich, auffällig jedoch ist die in dem Appell postulierte Einer-leiheit von moralischen und physischen Kräften. Wenn diese hier kein Widerspruchsein sollen, wenn also nicht der intellektuellen Überzeugungskraft mit Gewalt nach-geholfen werden soll, die dann unmoralisch wäre, dann lassen sich beide wohl nurin einem juristischen Sinne vereinigen: moralisch verbindliche und durch Sanktions-möglichkeiten erzeugte Harmonie widerstrebender Interessen und Kräfte. Aus dieserSicht wirkt Saint-Simons Vorschlag nüchtern und praktikabel, aber immerhin als ei-ne mögliche Lösung der Paradoxien des Europabegriffs, nämlich Einigung Europasdurch Verträge: „Wollen, daß Europa durch Verträge und Kongresse im Friedens-Zustande sey, heißt wollen, daß ein gesellschaftlicher Körper durch Konventionenund Vergleiche bestehe; an beyden Seiten muß eine Zwangs-Macht da seyn, wel-
46 Friedrich Schlegel, Reise nach Frankreich [1803], in: Paul Michael Lützeler (Hrsg.), Europa, Ana-lysen und Visionen der Romantiker (insel taschenbuch 638), Frankfurt 1982, S. 95-105, hier 96.
210
Ausdruck vom 27.11.2009
Unendliche Teleologie Europas
che die Willens-Meinungen vereinigt, die Bewegungen berathschlägt, das Interessegemeinschaftlich, und die Verpflichtung dauerhaft macht.“ 47
Damit ist auch klar, daß Versuche, Europa geographisch zu verstehen, deshalbimmer wieder scheitern müssen, weil die Topographie nur ein Element unter vie-len ist und letztlich wohl nicht entscheidet, auch hierfür gilt das Bild von Böhmenam Meer. Symptomatisch ist der Versuch Tomáš G. Masaryks, die politische undkulturelle Lage Mitteleuropas zugleich machtpolitisch und geographisch (etwa durchLinien wie Rom-Berlin-Wien-Bagdad) zu erfassen, um dann für das Recht der ‚klei-nen Völker‘ zu plädieren. 48 Dieser 1917 entstandene Schrift ist ein polemisches Pro-gramm gegen den Pangermanismus, der vermutlich charakteristisch für ein raum-geographisches Denken in machtpolitischer Absicht zur Zeit des Ersten Weltkriegsist. Wird der geographische Raum kulturell und zugleich machtpolitisch betrach-tet, ist Homogenisierung das Mittel der Wahl, d.h. Europa müßte auf kontrafakti-sche Weise geeint werden. Geographische Bestimmung unter Wahrung von Vielfaltscheint vielleicht auf den ersten Blick plausibel, scheitert aber an dem Einheitsap-pell, den der Europabegriff gerade als Erbe dieses Widerspruchs von Geographie undKultur hat. Was Patocka an Masaryks Demokratiebegriff kritisiert, daß er ihn fürein quasi naturgesetzliches Stadium der politischen Entwicklung hält, ohne sachlicherschlossen zu werden, 49 ließe sich mutatis mutandis auch auf seinen Europabegriffanwenden: weil er inhaltlich unbestimmt ist, scheitert auch seine geographische Be-stimmung.
Schon Eugen Rosenstock-Hüssy hat auf die „eigentümliche Mischbedeutung vonGeographie und Geist“ hingewiesen, die in den Begriff von Europa „hineingefahren“sei. 50 Offenbar handelt es sich um eine – wie auch immer gerechtfertigte – Projek-tion des Anspruchs kulturelle Vorherrschaft über die gesamte Welt, ausgehend voneinem „Privilegs“, das dem „Vorgebirge von Asien“ zusteht. Rosenstock-Hüssy ent-deckt hier den Raum als programmatisches Konzept: „Dieser Raumglaube ( . . . ) istein Glaube, der sich auf das Sichtbare, im Raume sich Darstellende richtet.“ (S. 35)In ihm geht ideologische Idealität in handgreiflichen Materialismus über, denn dasgeistige Privileg materialisiert sich in Eroberung. Für Rosenstock-Hüssy ist diese Vor-stellung eines überlegenen Europa mit dessen Expansion über dessen Grenzen hinausverbunden, weshalb er das Entstehen dieses „Europa im pathetischen Sinn der euro-
47 Claude Henri de Saint-Simon und Augustin Thierry, Von dem Wiederaufbau der europäischenStaaten-Gesellschaft [1814], in: Lützeler, Europa, 283-310, hier 286.
48 Tomáš G. Masaryk, Das neue Europa [1922], Berlin 1991, S. 17 f., 41. f.49 Patocka, Die tschechische Bildung, S. 369.50 Rosenstock, Revolutionen, S. 34.
211
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
päischen Kultur“ nicht in die Antike, sondern in das Zeitalter der Entdeckungen seitder Renaissance datiert (ebd.).
Für Lucien Febvre wäre die geographische Definition bloß äußerlich („du de-hors“), weshalb er sich auf Europa als Kultur („civilisation“) 51 konzentriert: „( . . . )elle se définit du dedans par ses manifestations mêmes“, und dazu zählt er (in dieserReihenfolge): Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst, die spirituelle und religi-öse Bewegungen. Indem er aber diese Kultur in ihren Manifestationen aufzuspürenwünscht, kann er in seiner Vorlesung durchaus nicht auf eben die geographischenGewichtsverlagerungen verzichten. Insofern interpretiert er die von ihm wiederholtzitierte Formel Marc Blochs: „Europa entsteht, als das Römische Reich zusammen-bricht“, als geographische Verschiebung vom Mittelmeer nach Norden. Die Abtren-nung des Orients und Nordafrikas sind für ihn, zusammen mit der Öffnung nachGermanien, die Bedingungen für die Entstehung dessen, was man Europa nennenkann. Der treibende Motor dieses neuen Gebildes sind dann allerdings wieder zweiGrundbewegungen, die die genannten Manifestationen auf zwei zu reduzieren schei-nen, nämlich auf dem Gleichmarsch von Organisation und Kultur: „Un! pousséed’organisation. Deux! poussée de culture. Un! poussée d’organisation. Deux! pousséede culture, etc.“ (S. 96) Man beachte den Kasernenhofappell. Herauskommt, viel-leicht gegen Febvres Intention, Europa als Vereinheitlichungsbewegung mittels Poli-tik und Religion.
Das wußte übrigens schon der Renaissance-Utopist Tommaso Campanella. Dennin seiner „Sonnenstadt“ (1602) stellt er dar, was er in seinen politischen Schriftenausführt, daß nämlich die Einheit des westlichen Christentums (den Begriff Euro-pas verwendet er nicht) nur unter einer monarchischen Zentralregierung möglich ist,d.h., in den Gegensatz von Einheits-Ideal und geographische Räumlichkeit übersetzt:daß nur eine politisch leitende Macht eine Einheit durchsetzen kann, die sich auf eineanerkannte Universalität berufen kann. Anders als später Novalis, der eine Wieder-herstellung der zentralen und einheitlichen Christenheit als geistiges Band Europasfordert, 52 ist Campanellas Papst-Christentum zwar politisch, aber theologisch undmetaphysisch begründet. Das Resultat wäre nicht nur die Eliminierung kulturellerUnterschiede (ablesbar am Bildungsprogramm der „Città del Sole“), sondern auchdie Aufhebung von Geschichte und vor allem – was im Habsburgerreich, in dem dieSonne nicht unterging, denkbar war, de facto aber unmöglich ist – das Verschwindenäußerer Grenzen Europas. 53
51 Febvre, L’Europe, s. 66 f. über den Doppelsinn von „civilisation“.52 Novalis, Die Christenheit oder Europa, in: Lützeler, Europa, S. 57-78.53 Vgl. hierzu Joachim Fritz-Vannahme, Spiel ohne Grenzen. Was Europa ist, wurde lange Zeit nur
durch Inhalte definiert. Nun ist auch die politische Geographie gefragt, in: Die Zeit, 20. Januar
212
Ausdruck vom 27.11.2009
Unendliche Teleologie Europas
Die Annihilation der äußeren Grenzen Europas mittels Expansion bis hin zurWeltherrschaft ist für Febvre, der sich hierauf Henri Pirenne stützt, ursprünglichesund fortdauerndes Ziel Europas. Und genau daraus folgt auch seine permanente Kri-se. Daraus ergibt sich, daß „Europa“ in sich zu einem Krisen- und Panik-Begriffwird: „Notion de crise, notion de peur si vous préferez, vore de panique.“ 54 Die In-vokation Europas signalisiert daher für ihn die permanente Angst des Europäers, sichselbst an fremde oder fremdes zu verlieren, und diese ist dem „europäischen Mythos“immanent, so daß es scheint, „l’Europe n’est plus en Europe“ (S. 104). Demnachwären die Ängste eines Thomas Mann oder Sándor Márai vor entfesselten Spießernein aktualisierter Ausdruck dieser inneren Struktur des Begriffes, nämlich wegen ei-ner Gefährdung von außen und durch Expansion immer auch den Erhaltungsappellmitzuführen.
Johann Amos Comenius hat dies, natürlich in propagandistischer Absicht, zurEinleitung seiner Enzyklopädie, die er als Protestant um des Universalansprucheswillen „katholisch“ nennt, in das Bild von Europa als einem Schiff gebracht: WirEuropäer betrachten von diesem gemeinsamen Schiff aus die Asiaten, Afrikaner undAmerikaner in ihren Booten im gemeinsamen Mehrheit der Kalamitäten (nämlichIgnoranz, Aberglaube und Sklaverei), und als Christen laden wir sie zu uns als Ge-nossen ein. 55 Die „Schiffsangst“ verstärkt den Rückgriff auf das eigene als das derReform Bedürftige.
Am Verhältnis Europas zu mehr, daß bekanntlich einen Großteil seiner geogra-phischen Grenzen ausmacht und nicht bloß Metapher ist, hat Michel Mollat du Jour-din dieses Wechselspiel von Innen und Außen dargestellt. „Das mehr erwies sich inder europäischen Geschichte als entscheidender Faktor der Einigung.“ 56 Seiner Be-obachtung nach „regte die Expansion nach Übersee das erwachen eines europäischenBewusstseins an. Im 19. wie im 16. und 17. Jahrhundert projizierten die Europäer einBild ihrer eigenen Heimat auf die neuen Welten, aber gleichzeitig übertrugen sie auchihre Rivalitäten nach Übersee.“ (Ebd.) Wenn das stimmt, dann ist nicht nur der Euro-
2000, S. 37, darin der Schluß: „Wer will, kann den eurasischen Zipfel vom Nordkapp bis zumZweistromland, von Lissabon bis Wladiwostok strecken. Europas politische Idee allerdings wirdsich dann irgendwo dazwischen verlieren. Eine versteppte Utopie.“ Und voller Pathos Karl FriedrichKoch, Europa-Manifest. Gedanken zu einem geistigen Europa, Bern 1979, S. 35: „irgendwo blühtdie glühende Hoffnung auf die Vereinigten Staaten der Welt! ( . . . ) Die letzte Vereinigung, dieSuper-Uno, indem es keine Begriffsdifferenzen mehr gibt ( . . . ).“
54 Febvre, L’Europe, S. 103.55 Johann Amos Comenius: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, Prag 1966.
Vgl. das Vorwort an „Europae lumnia“, S. 6f.: „Nos nimirum Europei una quasi communi vehimurNavi . . . “. Vgl. dazu Heinz Gollwitzer: Europabild und Europagedanke. Beiträge zur deutschenGeistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, München 1951, S. 47 f.
56 Mollat du Jourdin, europa, s. 281.
213
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
zentrismus Europa unvermeidlich mitgegeben, dann sind nicht nur Kolonisation undKulturexport konstitutiv für Europa selbst, sondern (und das ist begriffsgeschichtlichrelevant) dann ist das europäische Selbstbewußtsein, psychologisch gesprochen, dieKompensation einer Entfremdung und der Begriff Europas nichts als der Versuch,seine eigene Negativität zu annullieren. Denn: „Erst als die Europäer in Übersee zuihren jeweiligen Heimatländern auf Distanz gingen, hatten sie Gelegenheit zu ent-decken, was ihnen gemeinsam ist, und zu fühlen, was sie trennt.“ (Ebd.) Nun kanndiese Beobachtung des Historikers auch falsch sein (was sich meiner Kontrolle ent-zieht), aber dann ist seine Interpretation die Projektion eines Europabildes, das ebendiese Züge der Entfremdung und inneren Negativität trägt. Der Ritt der Europa aufdem Stier symbolisiert nach Norman Davies schon im Mythos jene Rastlosigkeit, diedie europäischen Völker außerhalb und innerhalb des Kontinents umtreibt. 57 Die-selbe Dialektik von Export und Selbstzerstörung diagnostizierte Robert Spaemann:„Nachdem Europa einmal, willentlich oder nicht, diese Zivilisation geschaffen hat,muß es nun missionarisch sein mit Bezug auf denjenigen Gedanken, ohne den dieserExport nichts anderes als eine universale Entmenschlichung des Menschen wäre.“ 58
Daß auch die Binnendifferenzierung mit dem Europabegriff fallen kann, hatFriedrich Nietzsche klargemacht, indem er ihn kurzerhand mit dem der Mode gleich-gestellt hat: So wie in der Kleidermode „der Europäer nicht als Einzelner, noch alsStandes- und Volksgenosse auffallen will“ so nivelliert der Bezug auf Europa allge-mein die Unterscheidungen, denn er bedeutet „die Ablehnung der nationalen, stän-dischen und individuellen Eitelkeit“. Damit parallel läuft die Aufhebung des geo-graphischen Europabegriffs, denn einerseits „gehört Amerika hinzu, soweit es ebendas Tochterland unserer Cultur ist. Andererseits fällt nicht einmal ganz Europa unterden Cultur-Begriff ‚Europa‘; sondern nur alle jene Völker und Völkertheile, welcheim Griechen-, Römer-, Juden- und Christenthum ihre gemeinsame Vergangenheithaben.“ 59 Zwar meinte Nietzsche mit ‚Kulturbegriff‘ noch den Inhalt einer universalgeltenden Bildung, indem er aber europäisches Denken mit Mode gleichsetzt, bahnter der Auffassung von Europa als einer bloßen und eventuell inhaltlich leeren Kon-struktion den Weg.
Es ist zu beobachten, ohne in der gegenwärtigen Diskussion um die EuropäischeUnion einzugreifen, daß politisch gesicherte Verträge eine denkbare Konsequenz ausder ideologischen Struktur des Europabegriffs sind. Die völkerrechtliche Auffassung
57 Davies, Europe, S. xvi.58 Robert Spaemann, Universalismus oder Eurozentrismus, in Krysztof Michalski (Hrsg.), Europa und
die Folgen. Castelgandolfo-Gespräche 1987, Stuttgart 1988, S. 313-322, 321.59 Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II, Nr. 215, in: Ders., Kritische Studienaus-
gabe, hrsg. von Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, Bd. 2, Berlin 1988, S. 648-650.
214
Ausdruck vom 27.11.2009
Unendliche Teleologie Europas
Europas gibt es jedoch offensichtlich auf, eben auf den Appell zu hören, der „Euro-pa“ seiner Natur nach ist, und verweigert sich, das Paradox auszuhalten, das nicht inder Unwilligkeit zur Klarheit derer besteht, die versuchen, Europa als kulturellen Be-griff zu denken, sondern in der Natur kultureller Begriffe. Der nahe politische Erfolgeines ökonomisch geeinten Europa hat nach Ansicht von André Reszler das europäi-sche Selbstbewußtsein in ein schlechtes Gewissen verkehrt: „La mauvaise consciencequi se substitue à la conscience européene interdit pratiquement tout engagementeuropéen qui de vient ainsi la victime d’une ‚êre su supçon‘ nihiliste ( . . . ).“ 60WasThomas Mann als „Doppelbodigkeit“ der selbstbewußten Kultur des 19. Jahrhun-derts pries, hat offenbar etwas von Skeptizismus, so daß der politisch-ökonomischeErfolg der Europa-Appelle unter Verdacht gerät. Sobald das politisch-administrativeEuropa allgegenwärtig ist, verliert es seine Faszination im eigenen Hause. 61 – „Ach,Europa!“
Weil Europa ein kultureller Appellbegriff ist, sind es auch immer wieder dieSchriftsteller gewesen, von denen hier nur einige wenige genannt wurden, die überden Europabegriff zur Politik stellunggenommen haben. Und da sie Schriftstellersind, haben sie keine Angst, paradoxe Gedanken als Ergebnisse vorzulegen. 62 Someint etwa Victor Hugo, ein politisch geeintes Europa werde den Tag bringen, „woes keine anderen Schlachtfelder mehr geben wird als die Märkte . . . . und die Geis-ter“, 63 als wären gerade diese dann versöhnbar. Auch der Historiker Norman Davieskann in einem Ausfall gegen die „Eurocrates“ der Europäischen Wirtschaftsgemein-
60 André Reszler, Introduction, in: Alison Browning (Hrsg.), L’Europe et les intellectuels. Enquêteinternationale, Paris 1984, S. 15 und 13. Diese Sammlung von Interviews mit Historikern undSchriftstellern ist eine instruktive Sammlung von Gemeinplätzen zum Thema. So vermischt auf pa-radigmatische Weise Emmanuel Le roy Ladurie (ebd. S. 184) Geographie, Geschichte und Kultur,indem er die begriffliche Extension von der zeitlichen in die geographische und kulturelle wechselnlässt: „L’Europe, c’est un passé culturel et historique assez vaste qui s’étend de l’Espagne à la Russieet d’une certain fasson aux Ètats-Unis.“ Eugène Ionesco identifiziert Europa mit dem Humanis-mus (S. 144), Stephen Spender mit dem „Butterberg“; Denis de Rougemont (Gründer des CentreEuropéen de la Culture): „( . . . ) nous ne sommes pas là pour devenier l’avenir mais pour le faire“(S. 250); Michel Tournier (S. 295): „L’Europe, c’est moi.“
61 Reszler, S. 16: „Car, dés que l’Europe est partout, elle cesse de fasciner, d’interpeller chez soi.“62 Lützeler, Hoffnung Europa, s. 29 f.: „Europa als Thema und der Essay als Form mußten sich als
Wahlverwandte finden, denn beiden war als gemeinsames Drittes das Flexible, nicht Festlegbare,das Proteushafte eingeschrieben.“ Vgl. auch Peter Delvaux und Jan Papiór (Hrsg.), Eurovisionen.Vorstellungen von Europa in Literatur und Philosophie, Amsterdam 1996 (Deuitse Kroniek 46).NB: „Eurovision“ war im Deutschen Fernsehen lange Zeit der Titel für internationale Fernsehüber-tragungen, z.B. bei Fußballmeisterschaften (Kennmelodie war eine Ouverture von J. B. Bach).
63 Rede von 1849, zit. nach: Paul Michael Lützeler, Der Schriftsteller als Politiker. Zur Essayistik inVergangenheit und Gegenwart, Stuttgart 1997 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur,Abhandlungen der Klasse Literatur, Mainz 1997, Nr. 3), S. 6.
215
Ausdruck vom 27.11.2009
Europa – ein Appellbegriff
schaft diesen nichts Genaueres als „3000 years of laour by our diverse ancestors“entgegensetzen, Anstrengungen, die es zu erhalten und zu erneuern gelte. 64 Der zumamtierenden Politiker gewordene Schriftsteller Václav Havel kondensiert die Span-nung des in der Geschichte unentschiedenen Inhalts des Europabegriffs in die Aufga-be, eben jene Undeutlichkeit zu perpetuieren: „Die einzig sinnvolle Aufgabe für dasEuropa des nächsten Jahrhunderts besteht darin, sein bestes Selbst zu werden, dasheißt, seine besten geistigen Traditionen ins Leben zurückzurufen und dadurch aufschöpferische Weise eine neue Art des globalen Zusammenlebens mitzugestalten.“ 65
Schärfer kann man den Appell „Europa!“ wohl nicht frei von Inhalt sezieren.Europa, so muß man schließen, ist eine Aufgabe ohne Auftraggeber außer den
Arbeitenden selbst und ohne Ziel außer der Selbstbezüglichkeit der Aufgabenstel-lung. 66 Wohlgemerkt, dies ist die Implikation der semantischen Undeutlichkeit, dienicht auf Mangel an Klarheit des Denkens, sondern vielmehr auf die intellektuel-le Gelassenheit gegenüber dem Paradoxen zurückzuführen ist. Wenn ein Appell einAuftrag ist, dann ist dessen Ausführung das Ziel. In philosophischer Terminologiekann man daher die Existenz Europas in den Horizont des Denkens europäisch er-zogener Menschen übersetzen und die Begriffsbestimmung in das Telos. Nach allembisher beobachteten ist dieses Telos – insofern es wesensnotwendig unerreicht ist –in einer wenn nicht permanenten, so doch immer wieder neu festzustellenden Krisemanifest.
In diesem Sinne hielt Edmund Husserl im Mai 1935 in Wien eine Rede über„Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie“. 67 Ausgehend voneiner Unterscheidung zwischen geistiger Umwelt und umweltlicher Natur (S. 24)fragt der Philosoph nach der geistigen Gestalt Europas und antwortet: „die ihr imma-nente Teleologie, die sich vom Gesichtspunkt der universalen Menschheit überhauptkenntlich macht als der Durchbruch und Entwicklungsauftrag einer neuen Mensch-heitsepoche, der Epoche der Menschheit, die nunmehr bloß leben will und lebenkann in der freien Gestaltung ihres Daseins, ihres historischen Lebens aus Ideen derVernunft, aus unendlichen Aufgaben“ (S. 26). Europa in dem jeweiligen historischenAugenblick (für Husserl natürlich das Deutschland der Nationalsozialisten) ist derSchnittpunkt „einer Unendlichkeit von Aufgaben, von denen jederzeit eine Endlich-keit schon erledigt und als bleibende Geltung bewahrt ist. Diese bildet zugleich denFond von Prämissen für einen unendlichen Aufgabenhorizont als Einheit einer allum-
64 Davies, Europe, S. 15.65 Lützeler, Der Schriftsteller, S. 15, Rede in Aachen 1996.66 Vgl. das oben erwähnte Arbeitsethos bei Grisebach, Schicksalsfrage, Kap. 10.67 Edmund Husserl, Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie, hrsg. von Bern-
hard Waldenfels, Weinheim 1995 (nach Husserliana 6).
216
Ausdruck vom 27.11.2009
Unendliche Teleologie Europas
greifenden Aufgabe.“ (S. 33) Konsensfähig bei den meisten der Theoretiker Europasdürfte die Beschreibung der Tradition in ihrer Historizität und Aktualität als ‚erledig-te Aufgaben‘ sein. Beunruhigend aber muß die Unendlichkeit der vorausliegendenZielsetzungen sein. Auch für den begriffsscharfen Philosophen hat die „immanenteTeleologie“ Europas keinen Namen, keinen Inhalt außer der Dynamik der Dring-lichkeit.
An dieser Stelle setzt Jan Patocka ein und zeigt in ausdrücklichem Anschluß anHusserls Rede, daß die von vielen Europa-Begeisterten beschworene Historizität, dasgeistige Sein, die forma mentis, einen präzisen Namen und zahlreiche Verwicklungenhat, nämlich die philosophische Anstrengung des Begriffs. Die Wendung der Selbst-aufklärung des Menschen hat in der Praxis nicht nur die Aufklärung und ihre Hin-wendung zu den politischen und wirtschaftlichen Realitäten gebracht, sie hat nichtnur die Welteroberung verursacht, sondern die Selbstaufklärung des Menschen als„Sorge für die Seele“ behält selbst noch in den technokratischen Defizienzmodi dasPotential, das Patocka dreifach beschreibt: als ontologischen Entwurf, als politischesGemeinwesen und als inneres Leben. 68 Wenn man sich einige aktuelle Problemeinnerhalb Europas vor Augen führt: Defizit an demokratischer Legitimität, multi-kulturelle Verunsicherung, Globalisierung (d.h. Einebnung von Unterscheidungen),Verschwinden von Menschlichkeit usw., dann kann man mit Patocka sagen: wir kom-men am Philosophieren nicht vorbei, denn nur die Philosophie fragt was ist und wassein soll.
Die eingangs erwähnte konstruktivistische Auffassung kann, wie am Beispiel vonSchlegel und Saint-Simon zu sehen war, nur für die Verrechtlichung des Europa-begriffs optieren. Sie spiegelt sie in der Weise wieder, daß die Unmöglichkeit einerklaren Antwort zu dem Frageverbot zu führen scheint, was denn „Europa“ bedeutet.Denn die Diagnose des Konstruktivismus an einem Begriff beinhaltet immer auchdie Ausblendung der Möglichkeit eines wirklichen Referenten. Das kommt der Ver-weigerung gegenüber dem Postulat oder Appell gleich, und damit nimmt man sichselbst auch die Chance zu einer inhaltlichen Aussage, wenn denn, wie gezeigt, dasPostulatorische der konstante Sinn des Begriffs ist. Dann aber, wenn es ad libitumdiskutierbar und zugleich arbiträr bleibt, welche geographischen Daten, welche kul-turellen Leistungen und welche Zielvorstellungen konkret Europa ausmachen, dannwird Europa möglicherweise nicht am Schreibtisch von Dichtern und Philosophen,sondern in den Büros von Politikern und Juristen gemacht. Doch „Europas größteGefahr ist die Müdigkeit“. 69
Archiv für Begriffsgeschichte 43 (2001) 149-171.68 Patocka, Nach-Europa, S. 265.69 Husserl, Krisis, S. 69.
217