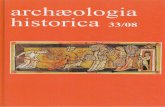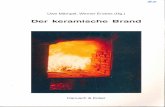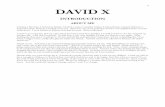Verortete Macht. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Rathäuser als institutionelle Eigenräume...
-
Upload
tu-dresden -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Verortete Macht. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Rathäuser als institutionelle Eigenräume...
GrRD ScHwsnsonn @resden)
Verortete Macht
- Mittelalterüche und fnihneuzeitliche Rathäuser als institutionelle Eigenräumeotädtischer Politik
.3. :
trl;,Gödiz 1527 - überwdltigt im Raum der Macht;ii.{,
tr$.sqätpmqer des Jahres 1527 war die politische Atmosphdre in der nieder-Stadt Görliz so angespannt wie selten.l Bereits zwei Jahre nwor
.SfrT df rlchmacher ihre Giavintna gegen die Gewerbepolirik des Ratesrtötgebracht. Einige der Beschwerdepunktä verrieten eine funäamentale unzu-':&denheit_vreler Bürger mit dem städtischen Regiment. In den Bierhöfen wur-de offene Kritik- geübt, an den Hauswänden kointe man kritische Anschläge
sogar in den Kirchbänken verstreuten unzufriedene injuriöse pasquill-e.pci {em großen stadtbrand, so wurde kolportiert, hatten sich die Handwerkerbbi den Iöscharbeiten an den Häusetn aer Reictt..r und Mächtigen verdächtigiilttickgehalten.
';" Ant 1. September, einem sonn-tag, dem vortag der Ratswahl, spitzte sich die'Shration zu. $7ährend die vier ,Äiesten Herrei' zusafiünen mii dem stadt-
.,1tht*.1 auf dem Rathaus-die Kt;9t#teten, versammelten sich Gruppen;$n Tuchmaglrern und anderen Handwerkern auf dem urrt..-urt i;Jrtö;idrnn in die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Dort kritisierre der Wortführer derfrchmacheq Alrcxander Boltze, wortreich die stadtspitze Die vier Herren ge-btauchten die Güter der Bürger als ir eigen gufi sie legten niemandem Rechän-ichaft über ihre Einnahmen und Ausgabän ab; o- g.irrg. ursachen würden siehrrte strafen verhängen; und vor auä wtiraen sie-in d-en Rat wählen, wen sieVbllten; ktxz: Sie wollen allein burger und bem sein. Sie aorachten die hanhaerger, wollentlc in ruthen be1 inen nicht leiden... Höhepunkt seiner Invektiven war die Aäprrrrg.-nrng des Bürgermeisters Georg Roseler ahs tiran.2 Bolze riet der V.6attytlnig
fryllfy.tt. fiit die Ereignisse von 1527 snd die - freilich außerordentlich parteilichen! -Aufzeichnungcn des stadtschreibersJohannes Hass, die z. T. aufeigenem EdeLen, z.T. abetAufleiChnungcn des StadlschreibersJohannes Hass, die z. T. ".rf.ig.n.mruch auf amtlichcn Aktcnstücken wiä z. B. Verhömiotokollen ho"i"ä. ,,.luch aut amtlichcn Aktcnstücken wie z, B. verhörprotokollen basieien, vgl, Hass, Rathsanna_
tt".' l. ?t?-+, Bünd{p Darstellung und Analyse dir Ereignisse bei Beiiri'sch, Staatisctre ou-rigkcit, S,94ff,
2 Aua cincm rndcrcn Text geht hen'or, dmr dic vict Alrclren da dic uicr fmtun bezeichnetwurdcn, die'men nicht mcfu hrban wolle: fit gl,tgn hi n*btJn dh kdr fu"r"tli, *a itirgo)ii
216 Gerd Schwerbof
eine Delegation von vier Männern auf das Rathaus zu schicken, um eine Ver-schiebung der Ratswahl und weitere Verhandlungen mit der Burgergemeinde zuerreichen. Natudich würde der Rat nicht gerne einwilligen, die Delegation müs-se hatt bleiben und dürfen sich nicht schrecken lassen. Dazu, so schloss derTuchmachermeister, sei es zweckmäßig, während der Verhandlung stehen zubleiben, den ein mann der do stunde, were manbaftiger und kuhner Tureden, den der sosse.3
Die Ratsdltesten, durch Diener von den Vorgängen in der Kirche unterrich-tet, waren alarmiert. Sie ließen die Versammelten ,bei ihrem geschworenen Ge-horsam' auffordern, sofort auf dem Rathaus zu erscheinen, wo sich zur selbenZeit dte anderen Ratsherren zusammenfanden. Tatsächlich kam um elf Uhrabends auf dem Rathausvorplatz eirte große Volksmenge zusarrunen, allerdingsweniger als gehorsame Untertanen des Rates denn als potentielle Aufruhrer.Dem Vorschlag Boltzes folgend wählten die Versammelten eine - allerdingssechsköpfige - Abordnung aus verschiedenen Zunftverteterfl, um dem Rat dieBeschwerden vorzubringen. Diese Vertreter nun begaben sich ins Rathaus.Nicht zum erstefl Mal verhandelten Vertreter der Handwerker mit den Altestenin deren Amtsräumen. 1,524 bereits hatten diese den oppositionellen Tuchma-chern dort ebenso selbstbewusst wie provokativ entgegnet, sie hätten genug vonderen Protest; wenn sie so klug wären, sollten sie die Schlüssel (ob der Stadtoder des Rathauses, ist nicht ganz Har) an sich nehmen und die Herrschaft aus-übena - ein Vorschlag, der kaum ernst gemeint war, sondem abschrecken sollteund dies wohl auch damals getan hatte.
Vetmudich musste die Abordnung der vor dem Rathaus versammeltenBürger an jenem Sonntagabend ihren Weg durch den großen Saal des Rathausesnehmen, wo auch Gericht gehalten wurde. Durch ein schmales Portal, ge-schmückt mit einem Christuskopf sowie Heiligen und Engelsgestaltens, trat siein die Ratsstube im ersten Stock ein, wo die Ratsherren .warteten. In der sichanschließenden Verhandlung erwiesen sich die Bikgermeister als die taktischeindeutig Übedegenen. Sie nutzten gewissermaßen den Vorteil des ,Heimspiels'@ehrisch) aus und ergriffen sofort die Initiative, indem sie demonstrativ etwasUnübliches taten: Sie blieben sitzen, und forderten die Delegierten auf, sichebenfalls zu setzen. Die Handwerker weigerten sich, und auf das wiederholtcGebot des Bürgermeisters schoben sie eine übemus ungeschickte Begrundungnach: Ihnen sei befohlen zu stehen und nicht zu sitzen. Umgehend kam dicNachfiage, wer das befo/en, adir weme sie gehorsam Tuthun geschworen! Anstatt in dicinhaldiche Diskussion der Gravamina einzusteigen, zwang der Rat den Stehen-
als die diebe und btter, Hass, Rathsannalen, S. 39. Zum Potenzial des Vorwurfs der Tyrannciund Alleinherrschaft in der Stadt Boockmann, Stadt-Tyrannen.Hass, Rathsannalen, S. 49f.lYie sie gewut weren bei d.enen eldi$en hen 4fn mtham, dis ,roldan mrhr anden qt inon.ge.ragat hahen, virhetten eaer anlaufcrc tnd uusnl tthier.4enu.g wonne ir don .ro kltg wit, do ltaht ir dio .n'ltlatul, .riotryl allrr, I-iass, l{athsanr-rnlcn, S. 4.5.
Vgl. zun'r llnthaus llechtcr, l(unntrlcnkrnälcr, Sachscn I, S. 3tlSfl,t l,crrrpcr, (iiirlitz, S, 1(XrllI lnss. lluthnannulcn. S, 32,
Veronete Macltt 217
den damit ein Gespräch über die Legitimität ihrer Mission auf; er ermahnte siezum Gehorsam gegenüber der einzigen Instanz, der sie Gehorsam schuldeten(n?imüch dem Rat) und erzwang schließLich kleinlaute Demutsgesten.
In kurzer Zeit warcn so aus potenziellen Verhandlungspartnerlr unterwürfi-ge Bittsteller geworden. Der Rat ließ sich dazuherab, ihr Anliegen halb gnädig,halb ungeduldig anzuhören, und schickte sie dann rror die Tür, um sich zu bera-ten. Anschließend eröffnete er den Wartenden, man wolle nichts übers I(niebrechen und müsse erst abwarten, ob niemand einen Aufiuhr anzettele. Gede-mütigt traten die Delegierten um Mitternacht vor die wartende Menge. A-lexan-der Boltze, der Sfortführer der Tuchmacher, tadelte sie mit den Worten, er habegleich gesagt, der Rat werde so schnell nicht nachgeben, die Delegation hättesich nicht so abspeisen lassen dürfen. Er orakelte, das Ergebnis sei ,eine böseSache', die Ätesten würden sich wieder ein Herz fassen.T Wie recht er damithatte, zeigte sich schon am nächsten Tag. Die Altesten konnten sich so sicherfühlen, dass die Ratskur wie üblich und ohne Störung vonstatteri ging. Es folg-ten einzelne Verhaftungen, die eine Konspiration zum Sturz des Ratsregiments(ausgeheckt wiederum häufig belm bier, also in den Bierhöfen8) auslösten, diewiederum verraten wurde; ein blutiges Suafgericht über die angeblichen Rädels-führer, sofern sie nicht - wie Boltze * geflohen waren, beendete den I{onflikt.
Jenseits dieser dramatischen Ereignisse gibt es gute Gründe dafirr zu un-terstellen, dass bereits jene Verhandlungeo in der Ratsstube die Waagschaleentscheidend zu Gunsten des bestehenden oligarchischen Ratsregiments senk-ten.e Offenbar ließen sich die Vertreter der Handwerker von der Autorität des
Rates an seinem aflgestammten Ort so beeindrucken, dass sie unverrichteterDinge das Feld räumten. Und offenbar hatte keiner der Delegierten das persön-liche Format, es mit Vertretern der Macht wirklich aufzunehmen. Vielleichthätten sich die Dinge anders entwickelt, wenn der redegewandte AlexanderSoltze sich dazu entschlossen hätte, Mitglied der Delegation zu sein.1o'SV'enn
überhaupt, dann hätte er das notwendige Charisma besessen, um vor den Mäch-tigen nicht einzuknicken und seine Gefihrten mitzureißen. Ohne dieses gleich-aam kontingente Element standen an jenem Septemberabend zwei unterschied-lich stark institutionalisierte Geltungsansprüche gegeneinander, die sich auch inFnderen Städten dingfest machen lassenll: jener der Handwerker auf transparen-te Finanzftihrung und bürgediche Partizipation, und jener der führenden Rats-
l-ibd., s. 34.Z. B. Hass, llathsannalen, S. 43. Vgl. zur Ausprägung des Göditzer Gastgewerbes und zumdort praktizicrtcn lteihcbraurecht Lindenau, Brauen und herrschen.So llehrisch, Städtische Obrigkeit, S. 99.Naclr <Jcnr lJcricht von I-lass, llathsannalcn, S. 50, war cs desscn cigenu Fürgeben, es sei besser,cinc andcrc Zuntt führe nuf clcm ltathnus das Wort, dnmit cs nicht so aussehe, als wären die'['uchmncher iroliert.Zur lurtrrcnrot'ienticrtctt llctnrt:hrrli tlie llciffiigc in Schrcincr/Mcicr, Stultrc'girncnt und lli.r-gerliciheiti vgl, nut:h M*gct, ( icnorncnrclrali,
,|
It,
l(l
lt
J
4
5
6
218 Gerd Schwerhof
herren auf Untertanentreue und GehorsamJz lm Gegensatz zu vielen anderenStädten orientierten sich die städtische Verfassung und die politische Kultur inGöditz nicht am Leitbild der ,,konsensorientierten" Herrschaft, sondern warenerheblich autokratischer ausgerichtet. Vielleicht affnete das Rathaus, Ort derManifestation der Ratsmacht, etwas von diesem autokratischen Geist und nahmso den Vertretern der Handwerker ihren Mut und Widerspruchsgeist.
2.Das Rathaus als institutionelle Vetdichtung kommunaler Existenz
Die europdische Stadt, so hat Gert Melville jüngst konstatiert,
schuf sich vom 1,2./1,3. Jahrhundert an ein institutionelles, soziales, kulturelles Eigenle-ben, auf das eine nichtstädtische Macht im Grunde kaum mehr gestalterisch zugreifen,sondern sich allenfalls - wie es vornehmlich die Fi:rsten taten - seiner bedienen odersich in ihm integrieren konnte.13
Die Stadt habe sich ihre eigenen Maße, ihre eigenen Sozialnormen, ihre eigenenlsligiösen Strukturen und Symbole, füte denen habituellen Formen der Kom-munikation und ihre eigenen Selbstrepräsentationen geschaffen. Ja sie habe sichsogar, wie Melville unter Referenz awf Le Goffs berühmtes Diktum von der
,Zeit der Händler' formuliert, ihre eigene Zeit in Gestalt der mechanischen Uhrkreiert. Geschaffen habe sie endlich auch ihren eigenen Raum, wobei et konktetauf den besonderen, herausgehobenen Rechtsbereich der Kommune abhebt.Das Rathaus, Hauptarena jener dramatischen Ereignisse in Göditz 1.527, darfals eine andere Form räumlicher Ausgestaltung der städtischen Welt des Mittel-alters und der Fnihen Neuzeit gelten. Mehr noch, es handelte sich um die räum-lich-institutionelle Verdichtung kommunaler Existenz schlechthin. Institutionel-le Ordnungen bedütfen deratiger Eigen-Räume ebenso wie anderer Mechanis-men (Eigen-Zeiten, Eigen-Geschichten), um Stabilität und Dauer zu etlangen.l4
Kaum eine andere soziaJe und politische Ordnung der europäschen Vormo-derne hat aber einen so t'?ischeo Eigenraum hervorgebracht wie das Rathaus,das als die markanteste Verortungls der kommunalen politischen Welt betrach-tet werden kann. Mitten in der Stadt konstituierte die domus ciuium ein Symbolbütgedicher Eigenregierung. Dabei verkölperte der Bau nicht nur in Architek-tur und Bildschmuck die kommunalen \ü7erte, sondern er war zugleich lebendige
In seiner Antwort auf die Vorbringungen der Delegieten erinnert der Rat immer wieder an
die Eide, Gelübde und Gehorsamspflichten der Görlitzet Bürger und formuliert ganz kllrseine Unabhängigkeit vom bürgerlichen Votum: Der rathe hette die raßksre, nicht nn jnen ldcnBärgern, GSf, sundir uon der obrikeit, keisem und konige qtt Behnenn..., Hass, Rathsannalen, S. 34.
Melville, Zeichen der Stadt, S. 17f.Vgl. zur Institutionenforschung Melville, Instirutionen im Mittelalter; Rehberg,,,F'iktionalität"von Präsenz und Dauer; Melville, Instirutionalität und Symbolisierung; Mclville/Vodäntlcr',Gelnmgsgeschichten. - Spezieller zum Zusammcnhang von ltaum und Offcntlichkcit in dctvormoderncn Stadt ltau,/Schwcrl-urff, Zwischcn (lrxtcshrus uncl "l'nverne; ltnu/llochrnuth,Machträume.Zur Untcrschcidung von ,,()rt" unrl ,,llnrrrn" vgl, ltchlrrg, Mncht-llüutnc,
Verortete Macht 219
Arena frit die kommunale Politik. Diese Charakterisierung soll nicht bedeuten,überholte idealisierte Bilder des 19. Jahrhunderts vom mittelaltedichen Stadt-bürgertum als Vodäufer des modernen Bürgertums und vom Rathaus als stein-gewordenem Ausdruck mittelaltedichen Bürgersinns zu pelpetuieren. Vielmehrteilt die Geschichte des Rathauses viele Ambivalenzen des vormodernen Stadt-bätgertums, die in der folgenden Släzze kurz aufgeschlüsselt werden sollen -eine Skizze, die u. a. aufgrund des teilweise mangelhaften Forschungsstandesnotwendig unvollkommen sein muss.16
Tatsächlich darf das kommunale Rathaus als das erste politische Funktions-gebäude im nachantiken Europa gelten. Rathäuser in den Städten gab es, langebevor überregionale Ständeversammlungen sich eigene Tagungsstätten schu-fen17. Anders als Pfalzen und Burgen, Schlösser und Residenzen von adligenHerrschern waren sie funktionale Gebäude, die öffendichen Zwecken dientenund in denen in der Regel keine Herrschaftsträger wohnten. Aber keine Beo-bachtung ohne Ausnahme: Im zweiten Stock des spätmittelalterlichen Palazzodel Popolo, dem eigendichen Machtzentrum von Florenz, wohnten die achtPrioren und der Bannerträger der Gerechtigkeit in streng bewachter Abgeschie-denheit.l8 In der Regel waren es jedoch nicht die Herrschenden, die das Rathausbewohnten, sondern höchstens subalterne Bedienstete. In Köln nahm der ehe-malige Ratsherr Hermann von Weinsb erg 1.542 die wenig ehrenvolle, aber ein-ftägliche Tätigkeit eines Burggreven (Hausmeisters) unter dem Rathaus an. Indieser Funktion hatte er den Ort und die dort eingehenden Gelder zu bewachenund auswärtigen Gästen aufzu'warten Weil er nicht vom'Weinzapf und von derprivaten Beherbergung lassen wollte, geriet er immer einmal wieder in Konfliktmit dem Rat - ein Hinweis auf Spannungen zwischen den öffentlichen und dencher,,privaten" Funktionen des Ortes.le
Dass Herrschaftsträger in der Regel nicht im Rathaus wohnten, hatte deneinfachen Grund, dass ihre Herrschaftsdauer begrenzt war, meist auf ein Jahr.Die Entstehung des Rathauses ist eng verknüpft mit jener füt die Vormoderneeher ungewöhnlichen, fur die Stadt aber charakteristischen ,,Herrschaft aufZeit",20 Verkö1pert wurde sie von jener Institution des Rates, die regeimdßig imRathaus tagte. Rat und Rathaus entstanden in der Konstituierungsphase kom-tnunaler Autonomie, in Deutschland in der Zeitvor und nach 1200.21 Nicht von
Zum deftzittaten Forschungsstand Albrecht, Mittelaltediche Rathäuser, S. 9f. Eine erste Skizzezum Nachfolgenden bereits bei Rau/Schwerhof{ Öffentliche Räume, S. 40ff. Dott und beiAlbrecht weitere Literatur. Seither wichtig Frieddchs, Rathaus als kommunikativer Raum.Vgl. exemplarisch Denk/Matzerath, Die drei Dresdner Parlamente.Mciet, f)ic Sicht- und Hörbarkeit der Macht, S. 246. Möglich wutde die strenge Klausur derSignoria durch dic extrcm kurzc Amtszeit von zwei Monaten.Schwerhoff, I-l andlungswissen, S. 79f.Den Prinzip tler Hcnschaft auf Zcit blicb dabci prinzipiell gewahrt, egal ob der Magistrat sichdutch clie Wnhl dcr liütgerochaft odcr - wic iiftcr und so auch in Görlitz - eher durch dieKrxrptation dcu (iretnirrnrn konrtituicrte, Vgl. zu clcn Wahlcn in tlcr vormoderncn Stadt im-mcr trttch Scltkrttctonc, l{atrrwrrhll Sclrulz, Wnhlcru l(cllo:. Wnhltirrmcn.Albtccht, Mittelnltqliche lkthüutrer, S, I llf,
l612
1314
1zIE
iq30
15
!
220 Gerd Scbwerhof
Beginn an tagrc die politische Führung der Birgerschaft in einem eigens dafürvorgesehenen Gebäude; zunächst konnte es auch ein Privathaus oder ein städti-sches Kaufhaus sein wie etwa in Minden, vielleicht auch eine Kapelle oder einGotteshaus wie das S7estwerk der Stiftskirche St. Patroklus in Soest.22 Neubau-ten von Rathäusern im späteren Mittelalter wie während der Frühen Neuzeitmochten meist dem Bedirrfnis nach funkdonaler Erweiterung und/oder pracht-vollefef Repräsentation folgen, konnten aber auch zur Kompensation füt den
Vedust politischer Macht dienen wie etwa in der französischen Metropole Ly-on.23 Dass schließlich der sächsische Kurfürst August det Statke 1'707 nacheinigen vergeblichen Anldufen den Dresdner Rat zwang, sein altes Rathaus zu-
gunsten fiirstlicher Repräsentationsansprüche aufzugeben, zeugt von derSchwäche der bürgedichen Selbstregierung in der Residenzstadt.2a Dass Rathäu-
ser nicht die konkurenzlosen öffendichen Räume des Politischen in der vor-modetnen Stadt gewesen sind, wird unten noch nfüer datzulegen sein.
Die Tätigkeit des ehemaligen Kölner Ratsheren Hermann von Weinsbergals Hausmeister im Rathaus weist auf ein anderes Grundmerkmal der meisten
vormodernen Rathäuser hin, das in einem gewissen Spannungsverhältnis zu
ihrer Charakterisierung ais politische Funktionsraum steht: ihre - mitderweilesprichwörtliche - Multifunktionahtät.zs Nach einem zeitgenössischen Berichtbarg das Dortmunder Rathaus um 1760 neben det
G.ft(u) und kleine(n) Raßrtube die Cämmerei, die Renhammer, die Raß-Rtgistratur, das Stadtar-
chiu, d.en Rats-Kombod.en, die Haaphaache, samt allerhand Gefingniwn, Kellea Kiegs-' Nistung*
aach Spitqen- und mehrere Feuergertitschafis-ßmisen etc.26
Neben dem Bestimmungszweck, als Tagungsort für die Fläte und ihre verschie-
denen Ausschüsse zu dienen, waren mithin im Rathaus auch die Finanzverwal-tung das Archiv, das Gericht und Gefingnisräume, Stadt- und Feuerwache unddas Lager für die kommunalen Kornvorräte angesiedelt. Neben diesen durchaus
typischen und verallgemeinerbaren Zweckbestimmungen dürfen die ephemeren,
nicht unmittelbar aus der Raumbeschreibung ablesbaren Funktionen nicht ver-nachlässigt werden. Das betrifft etwa die öffendich- repräsentativen Aufgabendes Rathauses, wenn hohe Besucher empfangen und bewirtet, üppige Gelagc
anlässlich von Feiertagen und Amtswechseln gehalten wurden. Gerade in klei-neren Städten wurden auf dem Rathaus in Ermangelung andeter passender
Gebäude abet auch pfivate Tanz-, Musik- und Theatervorfiihrungen veranstal-
tet, za denen die Bürger den Ratssaal mieten konnten, bis hin zur Hochzeitsfei"er.
Ebd., S. 71; Rothert, \Westwerk.
Hier diente der Neubau des Rathauses an der Stelle des alten protcstantischcn Tempclszugleich als Apotheose für den Sieg des Katholizismus, vgl. llau, ltäumc dcr St,rclt, S. lslll.Löffler, Das alte Dresden, S. 280ff.F'ranz-Josef Adinghaus spricht statt von clcr Multifunktionnlitiit licbt:r von cittctn ,,integrrtlctrllaurnkonzcpt", vgl. Arlinghrus, ltlumkonzeptc, S. 102f.
Spohn, llatl-rnurbnutcrr. S. l2(r; vgl, zulctzt Albrccht, Mittelrrltctlit:lrc ltlthütrnct, li, l3lT,
Vemrtete Macht 221
Das Rathaus als institutionellen Eigenraum städtischer Politik zu verstehen,bedeutet mithin keineswegs, ihm einen exklusiv politischen Charakter zuzvspre-chen. Die historisch gewachsene Multifunktionahtät des Rathauses kann allge-
mein als räumliche Ausdrucksform einer noch nicht funktional ausdifferenzier-ten, stratifikatorischen Gesellschaft gelesen werden. Die örtliche Funktionsviel-falt entspricht im Übrigen sachlich dem breiten Aufgabenspektrum des Haus-herrn, des städtischen Rates. Mit der räumlichen Konzentration ging eine sach-
hche Zentrahsierung des Politik- und Verwaltungshandelns beim Rat einher' Beider Lektüte der Ratsprotokolle auch und gerade größerer Kommunen stichtdessen Ailzuständigkeit ins Auge. Zwei- oder dreimal in der Woche hatten sich
Ratsherren durch eine breite Materie hindurchzukämpfen, die jeden heutigenI(ommunalvertreter schnell ins Schwizen bringen würde: Reichspolitik, Streitmit Stadt und Landesherren, Verteidigungsangelegenheiten und Rechtsstreitig-keiten, aber auch die kleinen Dinge des städtischen Alltages wie die Reinigungvon Straßen, Brunnen und einzelner Privats, der Äbtritte, wurden auf dem Rat-haus verhandelt.
3. Das Rathaus im Spannungsfeld von,,öffentlich" und,,geheim"
Nicht nur das Rathaus ist in der Forschung als ein vielfültig genutzter Ort be-
schrieben worden. Diese Charakterisierung verbindet es mit anderen öffendi-chen Räumen in der Stadt, den Wirts- und Gasthäusern ebenso wie den Kir-chen.21 Während die Wirtshäuser allerdings neben ihrem ursprünglichen Be-stimmungszweck, dem Ausschank alkoholischer Getränke, funktional für die
verschiedensten Nutzungen offen waren, lässt sich frit die Beschreibung vonKirchenräumen ffotz aller Multifunktionalität eine dominante Leitdifferenzherausarbeiten, nämlich diejenige von ,,sakral" und ,,profan", ein Spannungs-
veth:iltnis, dass alletdings keineswegs als die unterschiedLichen Pole einer Di-mension verstanden werden sollten.28 In vergleichbarer Sfeise lässt sich das
Rathaus durch das Spannungsverhdltnis von ,,öffendich" und,,geheim" charak-
terisieren.2eEinerseits kann das Rathaus als der ,,öffendiche Ort" in der Stadt par excel-
lence angesprochen werden, als Brennpunkt der politischen Kultur und des
diffendichen Lebens. Das gilt insbesondere für die Außenseite und die Umge-lrung des Rathauses. Der Platz vor dem Rathaus war nicht nur in Göditz der
Ort frit politische Versammlungen, Musterungen und Fesdichkeiten. Von Lau-ben, Ralkonen und Fenstern aus wurden häufig die städtischen Satzungen und
Zur nähcrcn llcstimrnung öffcntlichcr l{äumc als für vicle unterschiedliche Akteure zugängli-
cfic l(orrrmrrnil<ntions- irltl lnte'trktionstäunre vgl. llau/Schwcrhoff, Öffentliche Räume,
s, 4ftfl:Schwerlrofl, Srrkralit iit rtnatr',r,{cnr('nl.Alrrrliclr rclrort l)ott'h, tt*tnwllrl itt wt.rrtliilirelrcrr Stäthclt, S, 207f .
2223
2425
26
!rH
l')
222 Gerd Schwerhof
Morgensprachen vedesen, oder sie wurden an die Rathaustür angeschlagen.Ganz programmatisch stellte die Schauseite reichsstädtischer Rathäuser einveritables Stück öffentlich wirksamer Herrschaftsarchitektur dar, die fur Bür-gerversammlungen eine besonders eindrucksvolle I{ulisse bildete. Deren l(ehr-seite war die Vollstreckung von Ehrenstrafen, weswegen Pranger und Halseisen,Lastersteine und Narrenhäuslein noch heute bisweilen die Rathausmauerschmücken. Derartige Strafen lebten von ihrem öffentlichen Vollzug und des-wegen war ihre Verortung am Rathaus kein Zufall.
Mit der Öffendichkeit der Rathausumgebung korrespondierte auf der ande-ren Seite der Versuch, die Exklusivität zumindest bestimmter Räume und dieHeimlichkeit der Ratssitzungen zu gannrieren - wir denken an die beeindruck-ten Göditzer Tuchweber, die im Arkanbereich der Macht plözlich weiche Kniebekamen. Überall sollten die Amtseide sicherstellen, dass ein Ratsherr des RahtsHeinligkeit heblen und wahren ... müsse.3O Sffeng wurde in Rietberg darauf geachtet,dass die Diskussion im Rat nicht ,,in die Wirtshäuser getragen" wurde; 1695sorgte dort der Vorwurf gegen einen Magistratsherren, in Gegenwart eines Wie-denbrücker Brirgers conclusa magistratus verraten zu haben, für eine weitläufigeUntetsuchung. Archive waren selbstverständlich den Bürgern und oft auch dengewohnlichen Ratsherren unzugänglich, Akteneinsicht gab es wohl nur gegenbesondere Erlaubnis.
Exklusivität und Heimlichkeit waren in der Regel auf bestimmte Räumebzw. auf besondere Ereignisse begrenzt: natüdich auf die regelmäßigen Bera-tungen von Rat und Ausschüssen, aber auch auf besondere Regierungsakte,etwa die Besuche auswärtiger Großer, bei denen das Rathaus eigens abgeschlos-sen und bewacht wurde. Ansonsten gingen eine Vielzahl von Menschen
^)rWahrnehmung ihrer alltäglichen Geschäfte in deutschen Rathäusern ein undaus. Rechtsstreitigkeiten und vor allem die Übergabe von Bittschriften (SuppLi-ken) zu allen Aspekten des täglichen Lebens sorgten für regen Publikumsver-kehr.31 Zu bestimmten Anlässen war das Rathaus nicht nur für einzelne Birrger,sondern auch flir die Bürgerschaft insgesamt geöffnet. Der Empfang auswärti-ger Gäste oder des Stadtherren sowie Huldigungszeremonien wurderr häufig beigeöffneten Fenstern vollzogen, eben um Öffendichkeit herzustellen. Bei dcrRatswahl drängelte sich die Btirgerschaft zudem in manchen Städten - etwa inMünstet - im Erdgeschoss des Rathauses, wo die Ratswahlordnung vedesenund die l7ahlmänner bestimmt wurden. In Rietberg versammelten sich im Juni1530 Rat und die gesamte Birrgergemeinde auf STeisung des Stadtherren auf'dem Rathaus; der Rat und die Gemeindevertreter verhandelten mit dem Grafcnoben im Saal und übermittelte die Beratungsergebnisse dann der Bürgergemcin-de im Erdgeschoss. Bereits 100Jahre zuvorwzrr in Dortmund ein Streit dadurchbeendet worden, dass der Bürgermeister, wie der Chronist Johann I(etckhrlrtleschrieb, die Einigungspunkte op dem Raethu.rc uzr ansen
"gemeinen borgonn aet ,qc.rfnt
Itolf, Illornbcrg, S. 51.Schwcrhof{, l(iihrcr Supplil<cnwcr{clr,
Vemrtete Macht 223
ken hat. Dass die Bürgerschaft darüber hinaus den Rathaus-Raum im Kontextinnerstädtischer Aufläufe auch gewaltsam okkupieren konnte, zeigen etwa die
Geschehnisse des Jahres 1683 in Köln. Dort hatte sich unter Führung des
Kaufmanns Nikolaus Gülich eine machtvolle Opposition gebildet. Anders als
die Görlitzer Bürgerabordnung rund 150 Jahre zuvor ließ sich die l(ölner Op-position auch auf dem Rathaus nicht einschüchtern. Als Girlich im Februar
i683 dorthin vorgeladen wufde, um sich wegen ,,Tumultieren" zu rechtfertigen,erschien er in Begleitung seiner Änhänger und bestritt vehement das Recht des
Rates, ihn überhaupt vefhöfen zu dütfen. Er stünde mit seiner Sache ,,unter der
Gemeinde". Einige Monate später, Anfang Juni, sollten dte Tinfte das Rathaus
stirrmen und die Ratsherren in der Ratsstube festsetzen.32
Das sich im Rathaus manifestierende Spannungsverhältnis von ÖffentLich-keit und Geheimnis verweist auf die Eigenart der städtischen politischen Kultur.Das betrifft weniger die Seite des Geheimnisses, denn die Wahrung der arcana
imperü gehörte zu den Konstituenten füihneuzeitlicher Politik, ob in der Repu-
b[k oder im Fütstenstaat.33 Dass dieser, auch sachLiche einleuchtende, politische
Imperativ aber immer wieder von dem Bedrirfnis bzw. der Forderung nach
Herstellung von Öffentüchkeit herausgefordert wutde, hängt mit dem Legitima-
tionszwang jener typisch städtischen Hertschaft aaf Zeit zusammen, von der
bereits die Rede war. In wesentlich höherem Maß als die feudale Adelsherr-
schaft war die Ratshetrschaft auf den immer wieder elneueften Konsens der
Bü,rgergemeinde angewiesen. Selbst patrizisch regierte Städte konnten auf diesen
Konsens, auf die - wenn auch nur sehr vermittelt symbolisiette -Patizipationder Bürgergemeinde, nicht völlig verzichten. Dazu gehörte eben auch die par-
tielle unä zeitweilige Herstellung von Öffentlichkeit am und auf dem Rathaus.
Dass Mächtige wie die GöÄttzer Altesten 152734 andefefseits immer wieder
endere Legitimationsquellen ins Feld führten, etwa die Ableitung ihrer Herr-schaft von Gott oder dem I{önig - ändert das Gesamtbild nicht völlig. Die
$pannungsbafance zwischen öffendicher Zugänglichkeit und..Exklusivität am
Rrth"or [ehört zu den durchgängigen Eigenarten bütgerlicher Öffentlichkeit bis
zum Ende des Äncien Regime.
4, I(ommunale Selbstrepräsentationen an und im Rathaus
Bild- und Figurenprografnme an und in deutschen Rathäusern sind einer der
benser untefsuchten Aspekte ihrer Geschichte.35 Zwar sieht die Forschung heu-
l)rchcr, Nikolaus (iiirlich, S. 57 und 61f; zu den westftlischen Beispielen Poeck, Ratswahl inwertfiilischcn Stiidtcn, S. 253ff,Strrllein, Arcru'tr irrrpcrii.Vgl, obcn Arrrn, 12,
Meier, Vonr Mytlrorr rlcr llrpublikt'l'ipton, llcs Prrhlicr bcnc orclinntn; I latrpt, (iroßc Ratsstu-
bc irn l,iincbLrtgct' Ittllttun.
32
33141530
3l
224 Gerd. Schwerhof
te den alten Gemeinplaa vom Rathausschmuck als ,Spiegel' bürgedicher bzw.republikanischer Programmatik aufgrund weitreichender Gemeinsamkeiten mitanderen Bautypen eher skeptisch. Aber einzelne Themenkreise lassen sich dochals Reflex politischer Problemlagen in der Kommune lesen. Darstellungen städ-tischer libertates und eine weitgespannte Reichssymbolik können als versuchetatsächlicher oder angeblicher Reichsstädte gedeutet werden, ihre Unabhängig-keit von Territorialhenen zu behaupten. Allegorische und historische Darstel-lungen von Herrschertugenden oder der alttestamendichen Fundierirng techt-mä:ßiger Obrigkeit sind sicherlich als Versuche lesbar, gegenüber der eigenenBütgerschaft konsensunabhängige Legitimtätsressourcen sichtbar zu machen.Insofern handelt es sich bei den Bildprogrammen in der Regel um die Selbst-darstellung nicht der Bifugerschaft, sondern fürer Führungselite. Aber auch andie eigene Adresse, an die Teilöffendichkeit des Rates, richteten sich die Dar-stellungen: In weltgerichtsbildern und sinnsprüchen wurde zur Gerechtigkeitgemahnt vrie etwa im Türschild jener Ratsstube von Göditz, wo die anfangsbeschriebenen Verhandlungen stattfanden: ut aliis aequus aut iniquwjudexfueris, itaquoque judicium dei expectabis (,,...*i. Du über andere ein gerechter oder ungerech-ter Richter sein wirst, so musst Du das Gericht Gottes erwarten...').36
Je nach Situation konnten die Rezipienten natürlich wechseln, wie der Be-richt des Hamburger Chronisten Sperüng über eine innerstädtische Unruhe des
Jahres 1684 illustriert. Birgermeister Flinrich Meurer wurde in der Admiralitäts-stube des Rathauses festgesetzt und von einigen aufständischen Bürgern be-wacht. Diesen erläuterte der Bürgermeister die Szenen auf den Wandschilden -etwa jene, die den antiken Gelehrten Perillus zeigSe, wie er in dem von ihmselbst hergestellten Folterinstrument, einem metallenen und glühend gemachtenOchsen, zu Tode gemartert wurde. Diese allegodsche lfarnung an schlechteRatgeber sollte die Aufständischen offenbar bewegen, von ihrem Tun Abstandzu nehmen - was nichts fruchtete. Immerhin war der Bürgermeister offenbar inder Bilderwelt seines Rathauses wohl bewandert. Keine Selbstverständlichkeit,denn diese Bilder stellten in der Tat, wie einmal Mathias Mende mit Blick aufdas Nürnberger Rathaus bemerkt hat, einen Code von Eingeweihten fur Einge-weihte dar.37 Wie wenig sogar die Führungsschicht einer Stadt zu diesen Eirg.-weihten gehören musste, verdeutlicht eine Befragung des kaisedichen Kommis-sars Johannes Hardenrath in Herford 1570. Manche der befragten Bürgermeis-ter, Rentmeister, Schöffen und Ratmannen wussten von Monumenten am Rat-haus überhaupt nichts zu sagen, einige erinnerten sich immerhin an das einge-mauerte Brustbild am Rathausgiebel mit einer Krone auf dem Kopf - was es ahursei und bedeute kann er in lYahrheit nit sagen..., so gab der ;i.lteste der Schöffen zr.r
Protokoll.3s Es handelte sich um ein Bildnis Kads der Großen. Leitideen unclEigengeschichten konnten auch in Vergessenheit geraten ...
Vgl. oben Anm. 5.
Tipton, Rcs publica bcnc orclinaur, S. 81.l,auc, I lcrfordcr l{olancl, S, 2(r,
Verortete Macht 225
5. Das Rathaus im Netz des öffendichen Stadtraums
So sehr sich das politische Leben der Stadt im und um das - in der Regel imZentrum der Stadt gelegene - Rathaus verdichtete, so reichhaltig waren die
Bezüge, die es mit anderen markanteri öffendichen Orten verknüpften. Bereits
das Eingangsbeispiel der Göditzer Geschehnisse von 1'527 hat diese Bezüge
gezeigr, indem die Bierhöfe als Stätten informeller Debatten, Kritik und Kon-spiration oder die Pfarrkirche als Versammlungsort der protestierenden Bürger-schaft deutlich hervortraten. Die interaktiven, performativen und symbolischenNetzwerke, die sich vom Rathaus in den städtischen Raum hinein entfalteten,waren in keiner Stadt völlig gleichartig, sodass jedes einzelne Gemeinwesen eineigenes spatiales Gefüge ausprä5e. Gut zu beobachten sind derartige Netzwer-ke im Spiegel kommunaler Rituale, etwa von Prozessionen.3e Vor allem das
häufig sehr komplexe Geschehen des Ratswandels edaubt es, die topographi-sche Dimension der rituellen Choreographie nachztzeichnen, mit deren Hilfedie städtische Gesellschaft die gefähdichen Momente det Änarchie zu bannenguchte, die aufgrund des Herrschaftswechsels entstanden.o Variantenreichkonnten neben dem Rathaus verschiedene Stifts- und Pfarrkirchen, aber auch
andere Amtsgebäude und wichtige öffentliche Plätze eingebunden sein. InSoest, um nur ein Beispiel herauszugreifen, waren in den \X/ahlakt weder die
benachbarte Pfarr- und RatskLche St. Petd noch die ebenfalls unmittelbar ne-
ben dem Rathaus situierte Stiftskirche St. Patrokli, in deren Westwerk sich derRat in der Frühzeit versammelt haben mag, direkt eingebunden. Der Stadtpat-
f6n St. Patoklus wurde vielmehr in Gestalt einer Statue ins Rathaus hineinge-
holt, vor der sich alle Wahlmänner und die Ratsherren einzeln zu verneigenhatten, und in deren Angesicht die Bürgermeister gewählt wurden. Daftir spieltdcr sog. Seel, das Amtshaus det S7ollenweber, als Versammlungsort der Wahl-männer und als Schauplatz wichtiger Festmahle neben dem Rathaus eine her-
lusgehobene Rolle.alAbstrahiert man vofl den konkreten Handlungskontexten in den einzelnen
$tädten, so ließe sich das Verhdltnis des Rathauses zu andefen öffendichen Or-t€n in der Stadt als ein Spannungsverhdltnis von Kontrolle und Konkurrenzverstehen.a2 Da waren erstens die Häuser der Gilden und Zünfte. Der Rat be-
hielt sich in vielen Städten das Recht vor, Vetsammlungen der Korporationenru genehmigen. Eine ständige Verschwörungsangst ließen alle Zusarnmenkünftevon Bürgern verdächtig erscheinen. Auch die $Tirtshäuser wurden deshalb zwei-
tens mit;inem dichten Netz von Reglementierungen überzogen, was die Über-flachung von Fremden, die Einhaltung der Spertstunden und die Wahrungdttlich anständigen und obrigkeitskonformen Vethaltens der Gäste anging.
39404t42
3637
38
Vgl, cxcrnplarirch Signori, ltitual uncl l'ircignis; L<ithcr, Ptozessionen.Pocck, ltitualc der I{attswnhl,l,:b(1., S. tt7ff.; vgl. (ilcbn, llilrgcrwclt, S. 26,
Vgl, nillrer Sclrwcthoff, Offcnrliclrc llihrnrc,
226 Gerd Schwerbolf
Immer wieder versuchten die Räte, die STirte firr unbotmäßiges Verhalten haft-bar zu machen und sie als Ägenten soztaler Kontrolle zu instrumentalisieren.Parallel dazu wurden drittens Kirchenräume ebenfalls als öffentliche Orte ver-standen und geflutzt wie auch im Göditzer Fan za sehen. Nicht nur wurdenwichtige Edikte an Kirchentirren angeschlagen, auch sollten bestimmte Ge-oder Verbote - oft, aber nicht immer Religionsdinge beteffend - von denKanzeln verkündet werderi.
Soweit die Kontrollperspektive. Die politisch-soziale Praxis sah anders aus.Die Interaktionsdynamiken der vormodernen Präsenzkultur ließ sich kaumobrigkeitlich kanalisieren und regeln. Ein wenig zugespttzt (und unter kalkulier-ter Inkaufnahme eines Anachronismus) könnte man davon sprechen, in denöffentlichen Räumen abseits des Rathauses habe sich eine kommunale Gegen-öffendichkeit konstituieren können. Besonders evident ist das in einer multipo-laten Meuopole wie Köln, einer Stadt, die vergleichsweise stark von einer politi-schen Kultur der Paruzipation geprägt v/ar. Den vielen Weinschenken undBrauhäusern kam bei der politischen und lsligiösen Meinungsbildung eine zent-rale Bedeutung ztr. Und selbst in Bezug auf die Kirchen gelang dem Rat erstrecht keine völlige Instrumentalisierung des katholischen und deshalb weitge-hefld autonomen Klerus
Insgesamt konnte das Rathaus keineswegs beanspruchen, als öffentlicherOt ein Monopol innerhalb der vormodernen Stadt zu beanspruchen. Diekommunale ,Öffentlichkeit' spannte sich gleichsam im städtischen Raum zwi-schen den verschiedenen Orten auf, wo öffendiche Interaktion und Kommuni-kation stattfanden. Anders, als es Jürgen Habermas in seinem klassischen Ent-wurf über den ,strukturwandel der Öffentlichkeit' 1961 postulierte, erschöpftesich diese Öffentlichkeit keineswegs in einer repräsentativen Dimension, beiderHerrschaft ,vor' dem Volk zur Schau gestellt wurde. Aber auch den an aufkldre-rischen Normen orientierten Idealq,pus der ,bütgerlichen Öffentlichkeit', beider vernünftige Deliberation und abwägendes Raisonnement im Mittelpunktstehen, wird man bei Geschehnissen wie dem bürgedichen Protest in Göditz1527 ncht ohne weiteres dingfest machen können. Vielmehr handelte es sichum einen Machtkampf zwischen städtischer Elite und bürgedichen Mittel-schichten, der vor dem Flintergrund unterschiedlicher politischer Konzepte mitArgumenten, aber auch mit dem Druck der Straße und auch mit - oppositionel-ler oder obrigkeitlicher * Gewalt ausgetrageri wurde. Die Topographie des Pro-testes verweist auf vielFältige Schauplätze. Aber nicht zufilhg präjudizierten dicVerhandlungen im Rathaus den Ausgang der innerstädtischen Unruhe, denndieses Rathaus war keine austauschbare Bühne kommunaler Interaktion, sondern das topographische Zentrum der Macht, wo sich symbolisch wie matericlldie Identität der Stadt verdichtete.
Vemrtete Macbt 227
Bibliographie
Albrecht, S., Mittelaltediche Rathäuser in Deutschland, Darmstadt 2004.
Adinghaus, FJ., Raumkonzepte der spätmittelaltedichen Stadt. Zur Verortung von Gericht, Kanz-
lei und Archiv im Stadttaum, in: B. Fritzsche u. a. (Hg), Sndtepknung- Pknungtttädte,ZiÄch2006, s. 101-123.
Bechter, B. u. a. (Bearb.), Georg Dehio. Handbuch fur deuttchen Ktn$denknäler. Sachsen I, München
1996.Behdsch, L., Stidtische Obigkeit und n{ale Kontrolle. GörliQ 1450-1600, Epfendorf/Neckat 2005.
Boockmann, H., Späfiüttelaltediche deutsche Stadt-Tyrannen, rn Blätterfür deutsche L"andcsgevhicbte
119 0983), S. 73-91.Denk, Ä./Mazerath,J., Die drei Dretdner Parlamente. Die sächsischen l-.andtage und ihn Bauten,'Wolf-
ratshausen 2000.
Dreher,8., Vor )00 Jahrcn - Nikokus Gülich Q{Jene Schriften zut Kölner Sadtgeschichte 4), Köln1986.
Friedrichs, C., Das städtische Rathaus als kommunikativer Raum in eutopäischer Perspektive, in:
J. Burkhatdt/C. $Terkstetter (Ig.), I(onnunikation und Medien in derFrühen Neuryit, München
2005, s. 159-174.Gleba, G., Über Bütgerwelt und Gemeindeleben im spätmittelaltedichen Soest, in: H.-D. Hei-
mann (Hg.), Sout. Gescltichte dcr Stadt,Bd. 2, Soest 1996, S. 19-56.
I-Iass,J., GörtitqgrRatbsannalen, ed. E.E. Struve,3. Band (Scriptores Rerum Lusaticarum I!, Göt-htz 1870.
Haupt, M.G., Die Gnfe Rattstube in l-,tinebargr Ratltaus (1564-1584). Selbstdarstellung einer pmte$anti-
vhen Obrigkeit, Marburg 2000.
Keller, H., Wahlformen und Gemeinschaftsvetständnis in den italienischen Stadtkommunen (12./
14. Jahrhundert), in: R. Schneider/H. Zinmermann (1g.), lYahkn und lYählen in Mit*lalter,
Sigmaringen 1990, S. 345-374.Laue, C., ,,Am Rathaus am Giebel ein Brustbild eingemauer." Die Etfindung des Herforder
Roland und die Herforder Stadtgeschichtsschreibung, in: Rauensbetgrr Blätter 2 (1994), S. 13-28.
l,cmper, E.-H., Görlit4 Eine hiilorivhe Topogr@hie, Zrttau 2007.
Lindänau, I{-, Brauen und hen'schen. Die Görlitryr Braubürger ak stidtische Elite in Spätnittelalter und
Früher N euryit, Letpzig 2008.
l,öffler, F.,Das alte Dretdcn. Gescltichn seinerBauten,Lerpzrg 1981. 15. Aufl.'2002.füther,4., Proqessionen in spätnitteklterlicben Städten. Politisclte Parti{pation, obigkeitliche InsTenierang
ttädtirh e E in heit, Kötn 1999.Mager, W., Genossenschaft, Republikanismus und konsensgestütztes Ratstegiment. Zu Konzep-
tualisierung der politischen Ordnung in der mittelaltedichen und frühneuzeidichen deutschen
Stadt, in: L. Schom-Schütte (Hg), AsPekte fur politivhen Konmunikation in Eumpa det 16. and
17. Jahrhanfut't,München 2004, S. 13-1'22.Mcict, U., Vom Mlthos der Republik. Fotmen und Funktionen spätmittelaltetlichet Rathaus-
ikonographie in Deutschland und Italien, in: Ä. Löther u.a. (FIg), Mundus in inagine. Bildtr'grache und l-tbensaelten im Mittelalter. Fettrchrif f)r Klaus Schreiner, München 1996, S. 345*388.
Mcici, U., Die Sicht- und Hörbarkeit der Macht. Der FlorentinerPzlazzo Vecchio im SPätmittelal-
ter, in: Rau/Schwerhoff, Zuiscben Gotteshaus undTaaeme,S' 229-271.
Mclvillc, G., Institutionen im Mittelalte4 in: Brlletin dt la Sociitd des Anis de I'Institut Historiqae Alle'ntand 4 (1998), S. 1 1-33.
Mclvillc, C;. (I-lg.), In$itutionalität nnd Slnholisientrg. Verstetigang kalturellcr Ordnangsmt$er in Veryan-
,qonltoil ud C)ogenuart,l{i\ln u, a. 2001 .
Melvillc, (i., Zcichcn clcr Stnclt. /.trnr nritttrlnltcrlichcrn ,,lmq4innirc" clcs Urbanen, in: K-U. Jäsch-kc/(;. Schtcnk (l lg,), Ur'l,,r n*u'lth int Mimhlnr ig,\'ldlt? ,\'llhtnnr.ttändni.r, lt$enichl und Erschei-
w44rltihlr ntimlilarlir:lur,l'tthln I lcilbrorrrt 20()7, S. 9' 23,
228 Gerd Scbwerhof
Melville, G./Vorländet, H. (Hg), Geltungsgeschichnn. Über die Stabiliierung und I-.egitinierung institatio-neller Ordnungen, Köln u. a.2002.
Poeck, D., Ritua.le der Ratswahl in westfiIischen Städten, in: B. Stollberg-Rilinger (Hg.),Vornod.emepolirivhe Verfahren, Bedin 2001, 5.207-262.
Poeck, D., Ntuale drr Ratswabl. Zeichen und Zeremoxiell drr Ratsse@ng in Europa ( 2.-18. Jahrhundert),Köln 2003.
Rau, S./Schwerhoff, G. (Hg.), Zwivhen Gottesltaas and Tawnte. Öfenttrhe Räume in Spamitekher undF*her Neuryit, Köln 2004.
Rau, S./Schwethoff, G., Öffendiche Rliume in der Frühen Neuzeit. Überlegungen zu Leitbegriffenund Themen eines Fonchungsfeldes, in: dies., Zuivhen Gotteshaar und Taaene,S. '11,-52.
Rau, S./Hochmuth. C. (Hg.), Machträune dzrfrühneuryitlichn Stadt,Konstanz 2006.Rau, S., Rliune der Stadt - Kulturen der Rtiama SoSabilität und die Trantfornation uon kiiumen einerfrüh-
neuryitlichen Stadt (.yon, ca. 130U1800), masch. Habilitarionsschrift Dtesden 2008.Rehberg, K.-S., Die stabilisierende ,,Fiktionalität" von Präsenz und Dauer. Institutionelle Änalyse
rrnd historische Forschung, in: R. Blänkner/B. Jussen SIg.), Institutionen und Ereignis. Über his-toisclte Prakiken und Vorstellungen gesellscbqftlichen Ordnens, Göttingen 1998, S. 381407.
Rehbetg, I{.-S., Macht-Riume als Obiektivationen sozialer Beziehungen - institutionenanalltischePetspektiven, in: Rau/Hochmuth, Macltträune, S. 41-55.
Rolf, H.-W, 400 Jahre Rathaus in Bknberg 1587-/ 987, Blomberg 1987.Rothert, H., Das \X/estwerk von St. Pattokli in Soest. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des deut-
schen Rathauses und zugleich eine Gabe zur Tausendjahrfeier des Patoklimünsterc, in: lYest-
fäli$he Zeißchifr 103 / 4 (1954),5. 13-29.Schlotterose, 8., Die Ratswahl in dcn d.eutsthen Städtefi dßs Mittelalters, masch. Diss. Phil. MüLnster 1953.Schreiner, K./Meier, U. $1g), Stadngnent und Btugfryibeit Handlungstpielrriune in &ußcben ilnd italieni-
vhen Stidten drs Späten Mittelalters und derFrühen Neuryit, Göttingen 1994.Schulz, I(, Watrlen und Formen der Mitbestimmung in der mittelaltedichen Stadt des 12./13.
Jahrhunderts. Voraussetzungen und \üandlungen, in: R. Schneidet/H.Zimmermann (Hg.),lYahlen undIYäblcn irl Mitteklter, Sigmaringen 1990, S. 323-344.
Schwerhoff, G., Das Kölner Supplikenwesen in der Frtfüen Neuzeit - Annäherungen an ein Kom-munikationsmedium zwischen Untertanen und Obrigkeit, in: G. Mölich/G. Schwerhoff (Hg.),Köln ak Kowmunikationsryrtrum. Studien ryrfrühneuryitlichen Stadtgeschichte,Bonn 2000, 5.473496.
Schwerhoff, G., Öffentliche Räume und politische Kultur in der {iüLhneuzeitlichen Stadt: EincSl<tzze am Beispiel der Reichsstadt I(öln, in: R. Schlögl (Hg.),Innraktion und Herrschafi. Die Po-
litik dcrfrühneuryitlichen Stadt, Konstanz 2004, S. 113-136.Schwethoff, G., Sakalitätsmanagement. Zur Analyse teligiöser Räume im späten Mittelaltet und in
der frühen Neuzeit, in: S. Rau/G. Schwerhoff $1g.), Topograp])ien des Sakralen. Rliunliche Dinensionen reügiövr Kultar in der Vornodeme, Hamburg 2008, S. 38-69.
Schwethoff, G., Handlungsvrissen und Wissensräume in der Stadt. Das Beispiel des Kölner Ratsherm Hetmann von Weinsberg (1518-1597), in: J. Rogge, Tradieren - Vernitteln - AnwendenZun Umgang nit l%isnnsbutänden in spätnittelaheilichen undfühneilryitlicbeil Städten,Bethn 200t1,s. 61-102.
Signori, G., Ritual und Ereignis: Die Straßburger Bittgänge zur Zeit der Butgunderkriege (1474-1,477),n: Histoiyhe Zeitvbrif 264 0997), S. 28-328.
Spohn, T., Die Rathausbauten im Umkreis Dortmunds von den spätmittelaltcdiclrfrühneuzeidichen AnPingen bis zu den preußischen-,,rathäuslichen Reglements", in ßrtlhilnlrin SpAtuifielalter und in drr Friihen Neuryit. W. Slnposion des lYesemnaissance-Masans Schhf |lr,tke in Zusammenarbeit nit dtr Stadt Hörter aon 17. bb ryn 20. Nouember 1994 in Höxnr, Marlrurg1994, S. 123-143.
Stolleis, M., Arcana inperii md Rntio statut, Bemerkarger qnr politischen Theorie de.r.fiühur I 7. .lthrhnluh,Göttingen 1980.
Tipton, 5., Res publiu bene ordinata. R4enhns/>ie,gel rnd BiLhr nn ,ytltil llqitunl, Ilalnnykkorathnru itr
der Frilhen Netry4 Flildcshcinr 1996.
Pnrnn JouÄNEK (Ntünster)
I(ad IV und Heinrich von Herford
Am 15. November 1,377 ntt Kaiser Kad IV. in der westftlischen BischofsstadtMinden ein. Knapp zwei Wochelt zuver, kurz nach dem Allerseelentag, war eraus Tangemünde, seiner Residenz in der Mark Brandenburg aufgebrochen, umsich auf den Weg nach Paris zv machen, zu einem Besuch beim französischenKönig, bei IGrl V.1 Dabei glng es vermudich um dynastische Politik, auch wenndie Reise in das Gewand einer Pilgerfahrt nach Saint-Maur-des-Foss6s gehulltwar. Die Reise wurde als Wallfahrt mit eifriger Reliquienverehrung inszeniert,und auch der französische I{önig unterstrich diese Verhullung, indem er seinenOnkel überall wie einen Pilger empfangen ließ (um ihn nicht als l(aiser empfan-gen zw müssen) und ihm als Abschiedsgeschenk unter anderem zwei goldene,muschelförmige Flaschen überreichte, mit einer Darstellung St. Jakobs, der Karldem Großen den STeg nach Spanien weist, vnd zwar. mit der Bemerkung, erbefinde sich ja auf einer Pilgerfahrt.2
Die Darstellung auf diesen Preziosen mit ihrem Hinweis auf Kad den Gro-ßen vermag anzudeuten, dass diese der Diplomatie gewidmete Pilgerfahrt aucheine Reise in die Erinnerurrg, an die Stätten derJugend des Luxemburgers gev/e-
sen ist. Dort in Paris hatte er entscheidende Jahre seiner Jugend verbracht,wichtige Elemente seiner Bildung empfangen, dort ist aller Wahrscheinlichkeitnach sein politisches Denken zumindest teilweise nachhaltig gePrägt worden.Vor allem hatte er damals in der Obhut seines Onkels IGrls IV. von Frankreichden Namenswechsel von Väclav zuKarl vo[zogen, und selbstverständlich spie-gelt sich in dieser Namenswahl neben den verwandtschaftlichen Beziehungender Luxemburger zu den Valois-Königen auch die politische Religiosität derVerehrung Kads des Großen 21s Hsiliger.3 Kaiser Kad IV. ist der erste Heff-scher des Reichs, der seit gut 450 Jahren vrieder den Namen Kad trug, und seit
der Heiligsprechung I3rls des Großen unter der Regierung Friedrich Barbaros-$as hatte kein anderer deutscher Herrscher den lGdskult so intensiv betriebenwie er. Und auch bei dieser letzten Reise des I(aisers, die da im Herbst 1377
begann, war Karl der Große und sein Gedächtnis in mannigfacher Weise prä-8ent.
Itl VIII, Nr. 5828a; licrmann von l,erbeck, Ciatalogus, S. 78, vgl. auch S. 207.Z,u rlicscr llcirc vgl, l)clachcnrl, l-listoitc dc (lhatlcs Y,5.61-122; Kintzinger, Der vreißeItciter, S.331*339; Srnnhcl, ()erstt Karlu lV,, bcs, S. 144-l4t mit l(arten zum Reiseweg; zumZwcck tler ltcirc noch Lunt, llutuch. S. 3(X). zu tlcn (icnchcnkcn linrls V, cbd,, S. 333.
Zu elicrctrt Nntncnnwccltncl vp,l, v,rr. Schrrt'itlet', linrrltrn, cltri ct Wtrttclrltrrrs, S. 3Ulf,
I,