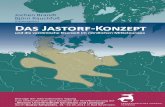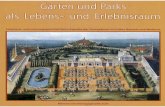”Macht der Banken". Analytisches Konzept oder politischer Topos?
Transcript of ”Macht der Banken". Analytisches Konzept oder politischer Topos?
318 Andreas Ernst
Jakob Tanner, "Macht der Banken" . Analytisches Konzept oder politischer Topos? Zum Bedeutungswandel einer kontroversen Kategorie, in: Andreas E~st u.a. (Hg.), Kontinuität und Krise. Sozialer Wandel als Lernprozess, BeIträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Schweiz, Zürich (Chronos Verlag) 1994, S. 319-342.
«Macht der Bankem): analytisches Konzept oder politischer Topos?
Zum Bedeutungswandel einer kontroversen Kategorie
Jakob Tanner
319
Mitte der J960er Jahre bemerkte Raymond Aron, Macht sei ein Wort mit einer sakralen Aura und sein Aussprechen löse mysteriöse und schreckerregende Echos aus. Tatsächlich ist es nicht einfach, über Macht zu reden, weil hier - wie Aron feststellt - «demokratische Prosa» und «dämonische Poesie» ineinanderfliessen.! Als Topos gehört «Macht» ins Arsenal der Propagandasprache und stellt ein Elemente politischer Mythologien dar.2
Erzählungen über Macht handeln vom Walten und Wirken verborgener, gefahrlicher Kräfte, die Faszination und Angst gleichermassen ausstrahlen. Die «wirkliche Macht» ist unsichtbar und in den Händen einer Clique, einer Elite vereinigt. Dieses Muster der Zentrizität ermöglicht es, Schuldzuweisungen zu adressieren. Komplexe gesellschaftliche Probleme können so auf einfache Weise zugeordnet und begreifbar gemacht werden. Die projektive Beschwörung des hintergründig Mächtigen und der gleichzeitige Hang zur totalisierenden Wahrnehmung des Phänomens erzeugt das, was Raymond Aran «dämonische Poesie» nennt. Neben diesem Zugang zum Thema gibt es einen anderen, der davon ausgeht, dass «Macht» und «Herrschaft>, unverzichtbare sozialwissenschaftliche Konzepte darstellen. Zur Diskussion steht hier ein begriffliches Instrumentarium, das sich zur Analyse asymmetrischer Sozialbeziehungen eignet. Es wird davon ausgegangen, dass das komplexe Geflecht gesellschaftlicher Interaktion ohne eine Vorstellung von «oben» und «unten», von «reich» und «arm», von «Herrschaft» und «Beherrschtwerden», von «Superiorität» und «Unterordnung», von «Macht» und «Ohnmacht» unverständlich bleibt. Gleichzeitig wird Macht hier aber weder substantialistisch als ein «Besitz» definiert noch auf solche hierarchische Dichotomien reduziert, sondern als Wirkung unterschiedlicher Verursachungszusammenhänge begriffen. Macht wird durch verschiedenste soziale Mechanismen, durch Handlungslogiken und Interaktionsmuster generiert, sie findet in Widersprüchen, Spannungsfeldern, Bruchlinien und KonfIiktachsen ihren Ausdruck - und es ist gerade ihre Dispersion, ihre Dezentrierung, die es verunmöglicht, sie eindeutig zu definieren, sie genau zu orten und sie beispielsweise zu «erobern». Macht, integriert in Alltagsroutinen und Lebensgewohnheiten, in Sprechweisen und Umgangsformen, ist ubiquitär. Sie kann gerade aufgrund dieser Omnipräsenz und Simplizität ein Gefühl deprimierender Ohnmacht und Fremdbestimmung erzeugen. Macht, die Lebensbedingungen in vielfacher Weise prägt, wird so einer schonungslos nüchternen Thematisierung zugänglich: Aron bezeichnet das als «demokratische Prosa». Bezogen auf das Thema «Bankenmacht» zeigt sich im historischen Rückblick auf das
----------------- -- _ ..
320 Jakob Tanner
19. und 20. Jahrhundcrt, dass «dämonischc Pocsic» das semantische Elixier populärer Propaganda war, währenddem sich der wissenschaftliche Diskurs an dic «demokratische Prosa» anlehnte. «Poesie» und «Prosa» lassen sich allerdings nicht ohne weiteres auseinanderhalten. Nicht nur dass mythologisierende Propaganda sich zum Zwecke der Legitimation immcr wieder auch einen szientistischen Anstrich zu geben versucht hätte. In cpistemologischcr Hinsicht erweist sich vielmehr die Unterscheidung von Wissenschaft und Mythos generell als schwierig. Beidcmale ist nämlich dcr Gegenstand ihrer Aussagcn bzw. das Objekt der Erkenntnis auch diskursiv und symbolisch konstruiert. Dennoch sind wissenschaftliche Ret1exion und politische Mythologie nicht deckungsgleich. Sie bilden vielmehr ein Spannungsfeld, in dem sich die «Dialektik der Aufklärung» entfaltet hat und in dem die fundamentale Ambivalenz der Moderne aufgehoben ist.3
Politische Mythologien sind eingewoben in das kollektive Gedächtnis, sie entziehen sich individueller Verfügung und üben dort ihre Wirksamkeit aus, wo Erinnerung und Erfahrung zu einem ideologisch-weltanschaulichen Amalgam verschmolzen werden können. Das Redcn von «Macht» appclliert an gcmeinsam geteilte Bedrohungsgefühle - und die Verständigung über das Feindbild vcrmag in unsicherer Zeit Orientierungssicherheit zu stiften und die Gesellschaft als «Volksgemeinschaft», als «Nation» oder als «Klasse» erlebbar zu machen. Die lärmende Abwehr «fremder Macht» lässt sich dann auch
. interpretieren als die Projektion der eigenen heimlichen Allmachtsphantasien auf die attackierten Institutionen.
Eine wissenschaftliche Analyse versucht demgegenüber zu zeigcn, wie und unter weIchen Umständen asymmetrische Machtbeziehungen und Herrschaftsverhältnisse demokratisch legitimierte Entscheidungsprozesse blockieren. Sozialhistorische Erklärungs
. ansätze versuchen insbesondere zu zeigen, in welchen gesellschaftlichen Situationen Mythen ihre grösste Wirksamkeit entfalten können. Dabei erweisen sich längerfristige konjunkturelle Wechsellagen als wichtiger Erklärungsfaktor. In der «modernen Wachstumsgesellschaft», die das zentrale Thema der Analysen von Hansjörg Siegenthaler bilden, lösen sich Phasen struktureller Stabilität mit Krisenperioden auf dem Hintergrund eines beschleunigten sozialen Wandels ab.4 Während sich Prosperitätskonstellationen durch intaktes Regelvertrauen auszeichnen, lassen sich Krisenjagen durch «den Verlust an Vertrauen in die Verlässlichkeit historisch begründeter Entscheidungshorizontc»5 charakterisieren. In solchen «Phasen [ ... ] von besonders grosser Offenhei!>}6 kommt es zur Artikulation divergierender Interessenorientierungen und zu komplexen sozialen Lern- und Suchprozesscn, im Verlaufe derer verschiedene Gruppen versuchen, neue Deutungsmuster der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft durchzusetzen. Dies ist der Zeitpunkt, in dem «dämonische Poesie» (im Sinne Arons) optimale Resonanzbedingungen vorfindet und in der das Thema «Macht» regelmässig zum Kristallisationspunkt von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wird. Es würde sich allerdings analytisch als ungcnügend erweisen, die in gesellschaftlichen Krisenphasen sich verstärkende Machtkritik ausschliesslich als das Werk von Feindbildprojektionen interpretieren zu wollen. Die Marktdynamik verändert vielmehr laufend die kommunikativen Vernetzungen und die Informationsgewinnungsprozesse, die der «bounded rationality» der handelnden (Wirtschafts-)Subjekte zugrunde liegen, die in ihre Erwartungshaltungen eingehen und die das Spektrum von (erkannten) Wahlmöglichkeiten erweitern oder verengen.7 Märkte versetzen Handlungsparameter von Individuen
J
«Macht der Banken» 321
und Gruppen; diese sehen solche Veränderungen in aller Regel nicht einfach als einen Effekt anonymer RegeJmechanismen, sondern interpretieren sie als Verbesserung ihrer Situation oder aber als Verletzung von Ansprüchen, die als legitime ausgewiesen werden. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts mobilisierte die kapitalistische Industrialisierung Ressourcen in bisher nicht gekannter GrÖssenordnung. Damals zeigte sich besonders eindrücklich, dass in einer «modernen Wachstumsgesellschaft» die Fähigkeit, die Kontrolle über materielle, personelle und finanzielle Ressourcen und eine strategische Position in gesellschaftlich-wirtschaftlichen Informationskreisläufen zu erlangen, ein entscheidender Faktor der Interessendurchsetzung und der Zielverwirklichung darstellt. Diese Fähigkeiten waren sehr ungleich verteilt . Dic Wahrnehmung sozialer Auf- und Abstiegsprozesse, die Statuspositionen von Gruppen und Klassen relativ zueinander veränderten, war in starkem Ausmass durch solche Erfahrungen geprägt; der Wachstumsprozess erwies sich deshalb in einer Phase, in der sich die Grossindustrie und dcr Finanzsektor herausformten, generell als sehr konfliktträchtig. E~ ist evident, dass gerade in Krisenlagen über die Rolle demokratischer Partizipationsrechte und über die Bedrohung wirtschaftlicher Existenzmöglichkeiten (z. B. von Bauern, von Handwerkern, die durch Zinssteigerungen oder Preiszerfall unter Druck geraten) öffentlich nachgedacht wurde und dass sich Kritik am Phänomen der «Macht» entzündete . In diesem Aufsatz geht es somit um janusköpfige Bezeichnungen, die immer wieder ganz unterschiedlich und in verschiedenen Kontexten gebraucht, für verschiedene politische Zielsetzungen instrumentalisiert wurden. Gerade deshalb macht es einen wichtigen Unterschied, ob die Kontroverse um Macht und Herrschaft auf Erfahrungen gegründet ist und sich am normativen Massstab einer demokratischen Gesellschaft und am Modell rationaler Verständigung zwischen widerstreitenden Interessen orientiert - oder ob die «Macht» verschwörungstheoretisch zum Popanz aufgeblasen und als Vehikel politischer Mobilisierung eingespannt wird und damit einer argumentativen Auseinandersetzung gerade entzogen werden soll. Auch wenn diese Diskurse keineswegs trennscharf zu unterscheiden sind, soll im folgenden versucht werdcn, diese beiden Aspekte
der Machtkritik analytisch auseinanderzuhalten. Mit diesen Bemerkungen habe ich bereits einige Themen, die in der Folge aufgegriffen werden, bezeichnet. Ich gehe davon aus, dass im Verlaufe des 19. Jahrhunderts in Europa und in den USA das «grosse Geld» und die «Hochfinanz» zu eigentlichen Emblemen der «Macht» werden. «Bankenmacht» und «Geldherrschaft» fungieren in der bürgerlichen Gesellschaft als ideologische Brenngläser, die oppositionelle Energien bündeln und sie auf das I<reditsystem lenken. E~ entstehen diffuse, ambivalente Kampfbegriffe, die fortan für den sozialen Protest und für die politische Interessenartikulation «von unten» eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig lässt sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine wissenschaftliche Fundierung von Machtkonzepten, die sich auf das Bankensystem
und den Finanzektor beziehen, feststellen. Diese Vorgänge werden im folgenden mit einem Ansatz untersucht, der das diskursanalytische Instrumentarium mit sozialhistorischen Erkenntnissen anreichert. Systematische Überlegungen werden dabei mit Fallbeispielen kombiniert.sIn einem ersten Kapitel wird die politische Mythologie der «Banken macht» untersucht und mit einer demokratisch inspirierten Dankenkritik verglichen. In einem zweiten Kapitel geht es um die ökonomische Theoriebildung über «Bankenmacht» . Das dritte Kapitel befasst sich mit
322 Jakob Tanner
politischer Machtkritik und wissenschaftlicher Machtanalysc in der Schweiz der 1930er
Jahrc; dieselbe Thematik wird im abschliessenden vierten Kapitcl für die Phase nach 1968 nachgezeichnet. Es wird sich dabei zeigen, wie sehr die historische Analyse von einer
angemessenen Problematisierung des Machtphänomens abhängt - und wie sehr sie damit
auch zurückgebunden bleibt an die Kontroversen, die sie zu erklären beabsichtigt.
«Herrschaft der Hochfinanz» und «Brechung der Zinsknechtschaftn: Zur Archäologie und zur Wirksamkeit einer politischen Mythologie
Raoul Girardet unterscheidet in einer anregenden Studie vier politische Mythologien: die
Konspiration, das Goldene Zeitalter, den ErretterlErlöser und die Einheit. Girardet betont, dass diese «mythischen Rezitative» in einen kulturellen Code eingeschrieben sind, der
überindividuell ist und der sich historisch als äusserst resistent gegenüberwissenschaftlieher Kritik erwiesen hat. Er weist darauf hin, wie polymorph und wie ambivalent politische
Mythologien sindY Die Ausführungen, die Girardet zur «Konspiration» macht verdeutli
chen, dass es sich bei «Bankenmacht» und «Geldherrschaft» um zwei Komponenten eines äusserst zählebigen Mythos des Komplotts handelt. Empirische Beobachtungen erfuhren
durch ihre Integration in diese mythische Konstruktion eine «eigentliche qualitative Mutation»:10 Die empirisch objektivierbaren und erfahrbaren Probleme, die Menschen im
Zusammenhang mit Preis- und Zinsschwankungen, mit Banken-, Börsen- und Arbeits
marktentwicklung hatten, wurden als Beweis für das Vorhandensein unsichtbarer, verborgener Kräfte interpretiert. Ein Bankbankrott kann sich so in einen heimtückischen Anschlag aus dem Hintergrund verwandeln, durchgeführt von Agenten, die hinter den
Kulissen die Fäden in den Händen halten. Im Zentrum dieser Kulpabilisierung, die um so wirksamer wird, je vollständiger sie sich schliesslich von der Erfahrungswelt ablöst und sich auf willkürliche Zuschreibungen reduziert, stehen - als Stereotype - «der Jude» und
«der Freimaurer».11 In den «Protokollen der Weisen von Zion», einem um die Jahrhundert
wende in Umlauf gesetzten antisemitischen Falsifikat aus der Feder eines russischen Ochrana-Agenten,12 wird die Strategie der jüdischen Weltverschwörung wie folgt beschrie
ben: In den Industriestaaten haben die Kräfte der Konspiration eine rigorose Kontrolle des Bankensystems und damit der Investitionstätigkeit in der gesamten Wirtschaft durch
gesetzt. Durch den Zugriff auf die Staatsverschuldung und die Inbeschlagnahme des
Grundeigentums wird dieses ökonomische Dispositiv zur Erringung der Weltherrschaft vervollständigtY Die ganze Gesellschaft ist somit klandestinen Akteuren ausgeliefert, die
einen «Grossen Plan» zu realisieren und der Weit die «Eine Ordnung» aufzuzwingen
beabsichtigen. Dieser demagogische Diskurs appellierte an xenophobe Reflexe und
rassistische Vorurteile. Seit der Jahrhundertwende, verstärkt seit dem Ersten Weltkrieg,
machte die politische Mythologie der Konspiration aus den Juden, Freimaurern, Marxisten
und Bolschewisten - oft in einem Atemzug genannt - eine «Partei des Auslandes»; sie
wurden zur inneren Bedrohung, zur Inkarnation des Fremden, zum Antiprinzip der bio
logisch definierten <<Volksnation». Zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeitete der deutschjüdische Soziologe Georg Simmel in
seiner «Philosophie des Geldes» den Zusammenhang von Antisemitismus und
verschwörungstheoretischen Vorstellungen der «Bankenmacht» heraus. Simmel erwähnt,
d
«Macht der Banken» 323
der «Machtcharatker des Geldes» würde dort «fast am fühlbarsten, wenigstens am
unheimlichsten da hervortreten, wo die Geldwirtschaft nicht vollkommen durchgedrungen und selbstverständlich ist».14 Suziologisch definiert Simmel Geldbesitz als «Superaddi
turn»Y «Die reine Potentialität, die das Geld darstellt, insofern es bloss Mittel ist,
verdichtet sich zu einer einheitlichen Macht- und Bedeutungsvorstellung, die auch als
konkrete Macht und Bedeutung zugunsten des Geldbesitzers wirksam wird [ ... ].»16
Aufgrund seiner «Überall-Verwendbarkeit» ist das zum «Grosskapitab> sich akkumulierende Geld eine «raumüberspringende Macht» und mithin «das deutlichste Symbol für
den absoluten Bewegungscharakter der Welt»;17 zugleich steHt es den «gemeinsamen
Schnittpunkt der Zweckreihen [ ... ], die von jedem Punkt der ökonomischen Welt zu jedem andern laufem" dar. 1H In den mentalen Mustern einer vorindustriellen, noch stark
natural- und subsistenzwirtschaftlich geprägten Welt - so Simmel- stand Geld (als das anonym-nomadisierende Mobilium) in einem schroffen Gegcnsatz zum Grundbesitz
(dem sicht- und fassbaren Immobilium). Geld war das Fremde, das in den Kreis des Eigenen, des Bekannten und Gewohnten einbrach. Die «Relation zwischen dem Geldwesen und dem Fremden» analysierend, konstatierte Simmel, «nicht nur der Händler ist
ein Fremder, sondern auch der Fremde ist dazu disponiert, ein Händler zu werden». Das «Geldgeschäft» wurde so zur «ultima ratio sozial benachteiligter und bedrückter Elemente», die durch die Anhäufung finanzieller Vennögen zu wichtigen Protagonisten des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens aufsteigen konnten. Simmel spricht von einem «Hass des Volkes auf die grossen Finanzhäusef»: «Es war der Hass des nationalen Empfindens gegen das Internationale, der Einseitigkeit, die sich ihres spezifischen Wertes bewusst ist, und sich dabei von einer indifferenten, charakterlosen Macht vergewaltigt fühlt, deren Wesen ihr im Fremden als solchem personifiziert wurde.» Für Simmel
existiert damit ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der «Zerstreuung [der Juden] in alle UindeT» und dem «Umherflattern des Geldkapitals», denn insbesondere bei den
Juden zeige sich die «ganze Korrelation zwischen Zentralität des Geldinteresses und sozialer Gedrücktheil>': «Dass der Jude ein Fremder war, ohne organische Verbindung
mit seiner Wirtschaftsgruppe, das wies ihn auf den Handel und dessen Sublimierung im reinen Geldgeschäft hin.» Die sozial- und wirtschaftshistorische Forschung hat inzwischen gezeigt, dass «seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert [ ... ] nur noch ganz wenige Juden in der Lage (waren), bei grösseren Geldgeschäften mit christlichen Finanziers zu konkurrieren» und dass die wirtschaftliche Existenzbasis der Juden damit auf besonders
konfliktanfällige Bereiche - das Pfandgeschäft vor allem - eingeengt wurde. 19 Obwohl Simmel diesbezüglich den Zusammenhang zwischen Geld und Juden überbetont, zeigt er doch die Mechanismen der Mythcnbildung in einer mustergültigen Art und Weise auf.
Der Stereotyp des «reichen Juden» war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als in
den kapitalistischen Industrieländern das moderne Bankensystem entstand, schon voll
ausgeprägt; im antisemitischen Deutungsmuster wurde der damals feststellbare volks
wirtschaftliche Bedeutungszuwachs des Finanzsektors als ein Vormarsch internationali
stischer, «volksgefahrlicher» Kräfte gedeutet. Zum Zeitpunkt, als Simmel seine Analyse
verfasste, wurde der «Zeitgeist» bereits in starkem Masse durch eine ideologisch aggressive Mischung aus Volksnationalismus und Antisemitismus dominicrt. Die «internatio
nale Hochfinanz» geriet unter systematischen Beschuss durch Bewegungen, die im Namen von «nationalem> und «völkischen» Interessen auftraten.
324 Jakob Tanner
Ablehnung der ((Geldherrschaft» als Vehikel der Demokratiekritik
Die gegen die parlamentarische Demokratie gerichtete Kritik an der «Hochfinanz» soll zuerst exemplarisch an der Rezeptionsgeschichte eines 1910 publizierten Traktates verfolgt werden. Der (im Zweiten Weltkrieg als Kollaborateur endende) französische Sozialist Francis Delaisi entwickelte in «La democratie et les financiers»20 eine Interpretation der Bankenmacht in Frankreich, die eine weitere Variation der alten These von der Herrschaft der «200 Familien» darstelltY Die (1871 gegründete) Dritte Republik hatte die «Wahl" und die «Demokratie» eingeführt; für Delaisi handelte es sich dabei bloss um eine «grobe Lisl», eine «Posse», die zu einer «Herrschaft der Unfähigen», zur «Ausbeutung des Volkes [ ... ] in seinem eigenen Namen» führt: Weit davon entfernt, Gegner der Demokratie zu sein, sind die «55 Geldmännef», die Frankreich heimlich regieren, <<im Gegenteil ihre Führer und treuesten Stützen; ich hätte beinahe gesagt: die Erfinder». Die Demokratie ist «die spanische Wand, hinter der sich ihre ausbeuterische Tätigkeit versteckt, und zugleich das beste Mittel zur Verteidigung gegen das Volk».22 Der Traum der «sozialistischen Partei» von der «gänzlichen Beseitigung der Geldherrschaft» und von der Vernichtung der «laüngelherrschaft des Geldes» ist - das ergibt sich aus diesen Prämissen - mit Demokratie nicht zu realisieren. Für Delaisi ist «Sozialdemokratie» eine contradictio in adjecto, denn: «Sozialismus [ ... ] ist das Gegenteil der Demokratie». Von dieser Position aus stellt sich für ihn die Frage, wieso sich «die Sozialisten vom demokratischen Räderwerk» haben «fangen lassen»:2J «Anstatt die Demokratie zu besiegen, hat der Sozialismus sich von ihr aufsaugen lassen» und sei zum «Volksvertretungssozialismus» verkommen. Delaisis Pamphlet fand einige Jahre nach seinem Erscheinen eine explizite Würdigung beim wahldeutschen Populärautor Houston Stewart Chamberlain. In seinem um die Iahrhundertwende veröffentlichten langfädigen Haupt- und Machwerk mit dem Titel «Die Grundlagen des XIX. Iahrhunderts»24 setzte Chamberlain den Aufstieg zur Zivilisation mit der Überwindung des «rassenlosen Völkerchaos» gleich und propagierte ein manichäisches Rassenkampf-Weltbild; den «Eintritt der Juden in die Weltgeschichte» interpretierte er als Ausbreitung eines dunklen Prinzips, das die Rassenreinheit der Germanen bedrohe. 1917 publizierte Chamberlain eine Schrift,25 die sich stark an Delaisi anlehnte, der als «unverdächtiger», der «fortgeschrittensten Gruppe» angehörender «Sozialist» vorgestellt wurde. Chamberlain strich heraus, sein Gewährsmann sei <~edenfal1s also über allen Verdacht erhaben», «unter dem Einflusse konservativer, agrarischer, junkerhafter Vorstellungen» zu stehen. «Möge Delaisis Schilderung manchem Schlummernden die Augen aufreissen!»26 führte er aus, und weiter: «Denn selbst wenn das, was wir in Frankreich und in den Vereinigten Staaten erlebten, nicht überall zuträfe - dass nämlich die Vampyre der Finanz sowie aller materiellen Ausbeutung und moralischen Verrollung diese Regierung der Unfahigen ZLl ihren Zwecken gebrauchen und damit das Volk unfehlbar zugrunde richten - so liegt es doch auf der Hand, dass eine Staats- und Regierungsform, die überal1 das Mittelmässige bevorzugt und das Tüchtige zurückstellt, die denkbar rückständigste Lösung des schwierigen politischen Problems sein muss, einzig geeignet, uns nach und nach in die Barbarei zurückzudrängen.»27 Die Kritik an der Hochfinanz geht hier nahtlos über in einen Angriff auf die Demokratie. Chamberlain schlug denn auch vor, «den Stier bei den Hörnern zu packen, indem wir es klipp und klar
g
«Macht der Banken" 325
aussprechen: der Parlamentarismus selbst ist das Grundübel unserer Zeit. Wissenschaftlich betrachtet ist er ein Ungeheuer: allen wissenschaftlichen Erfordernissen [ ... ] schlägt er ins Gesicht; völkisch betrachtet ist er ein Wahnsinn: kein Mensch auf Erden besitzt ein <Recht> auf Wahlzettel, und kein Mensch auf Erden wird um ein Tüttelchen besser, weiser, glücklicher dadurch, dass ihm dieses Recht verliehen wird».28 Der Nationalsozialismus, der in Chamberlain einen Vordenker gefunden hatte, verknüpfte die Kritik am Parlamentarismus von Anfang an mit der <<Judenfrage» und dem «Kampf gegen die Hochfinanz». Programmatisch formuliert wurde dies in dem von Gottfried Feder redigierten und verfassten Programm der NSDAP, welches 1927 erstmals aufgelegt wurde und das einen einzigen Rundschlag darstellt gegen das «Raubeigentum der Bankund Börsenschieber», gegen «die brutalste Macht, die Geldrnacht», gegen «die Blutsauger von Bank und Börse», gegen die «rnasslosen Wuchergewinne der Banken, die ohne Müh und Arbeit, als Tribut vom Lcihkapital erpresst werden», gegen «die anonyme Geldmacht», gegen «die gesetzlich zulässigen Raubzüge des Finanzkapitals», gegen «die Allmacht des Bank- und Börsenkapitals» etc.29 Der Nationalsozialismus, als dessen «gefühlsmässiger Unterbau» der «Antisemitismus» bezeichnet wurde, bezeichnete sich selber als Bewegung gegen die «Geld- und Zinsherrschaft der alljüdischen Hochfinanz». Es gehe um ein «klares Erkennen des Weltfeindes: des den Erdkreis überschattenden Grosskapitals und seines Trligers, des Iuden».30 Die «Brechung der Zinsknechtschaft [ als] das Herzstück des Nationalsozialismus» war damit gleichbedeutend mit Judenverfolgungen. Weit davon entfernt, nur eine finanzpolitische Forderung zu sein, handle es sich hier um «die stählerne Achse, um die sich alles dreht».31 Eine vergleichende Untersuchung vermag sichtbar zu machen, dass diese nationalsozialistischen Propagandaklischees keineswegs auf Deutschland beschränkt war. Auch die rechtsextreme Frontenbewegung, die in der Schweiz ab 1933 einen Aufschwung zu verzeichnen hatte, bediente sich dieser politischen Topoi, um Distanz zu den etablierten Institutionen zu markieren und um die bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen feststellbaren fremdenfeindlichen Abwehrreflexe antisemitisch aufzuladen und sie für eine oppositionelle politische Mobilisierung von rechts gegen Parlamentarismus, Demokratie, Judentum, Freimaurerei, Sozialismus, Marxismus und Bolschewismus zu nutzen.
Bankenmacht als Bedrohung der Demokratie
Schon vor dem Aufkommen eines antisemitisch motivierten, auf national-autoritäre Regierungsformen hinzielenden Kampfes gegen Hochfinanz und Geldherrschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es eine Kritik an wirtschaftlicher Macht, die zwar auch einem simplifizierenden Erklärungsraster unterlag, die sich jedoch innerhalb der politischen Kultur anders definierte. In diesem Fall ging es nicht um eine Bekämpfung demokratischer Institutionen, sondern gerade umgekehrt um deren Verteidigung gegenüber demokratisch nicht legitimierten Machtkonzentrationen. Diese Kritik resultierte daraus, dass neue Tatbestände in bedrohlicher und jedenfalls unberechenbarer Weise in die vertraute Welt hineinwirkten und dass Menschen neue Erfahrungen der Ohnmacht und der Unterordnung machen mussten. Bereits seit den 1850er Jahren lief europaweit eine Diskussion um den Typus der Crcdit-mobilier-Banken an. Diese neuen, vor allem
326 Jakob Tanner
zur Eisenbahnbaufinanzierung gegründeten «Dampfmaschinen des Kredits» schienen die rasche Expansion und Krisenanfälligkeit der industriellen Wirtschaft gleichermassen zu verkörpern. Neugegründete Eisenbahnfinanzierungsgesellschaftcn setzten Sparer bisher unbekannten Risiken aus; gleichzeitig verminderten diese grossen Invcstitionsprojekte die Liquidität auf verschiedenen (noch nicht national integrierten, jedoch international vernetzten) Kapitalmärkten. Im Kanton Zürich spitzte sich der Gegensatz zwischen den wirtschaftsliberalen «Bundesbaronen» und einer demokratischen Opposition in den 18GOer Jahren ZU.32 Die von der Unternehmerlobby des «Eisenbahnkönigs» und Gründers der Schweizerischen Kreditanstalt Alfred Escher dominierte Politik geriet nun als «System Eschen> ins Kreuzfeuer der Kritik. Die Tatsache, dass die hypothekarische Belastung der Bauern, Kleingewerbler und Handwerker über das Verkraftbare hinaus stieg und dass verschiedene Sparformen sich als unsicher erwiesen hatten, wurde als Ausdruck einer neuen Machtkonstellation perzipiert: «Geldadel» und «Bankenaristokratie» schienen die Errungenschaften der als genuin schweizerisch empfundenen liberalen Demokratie wieder zunichte zu machen. Die sich nun formierende «Demokratische Bewegung» lancierte im Kanton Zürich den Slogan «Volksbank gegen Herrenbank». Interessant ist die Fokussierung eines breiten Unbehagens in der Forderung nach einer Kantonalbank, die neben der Verfassungsrevision von 1867 zu den Hinterlassenschaften dieser Demokratischen Bewegung gehörte.33
In den folgenden Jahrzehnten brach eine demokratisch-linke Kritik an der «Geldrnacht» nicht mehr ab - auch wenn sie sich seit den ausgehenden 1870er Jahren mit der «antikapitalistischen oder vielmehr antiplutokratischen Rhetorik» der «konservativen Krisenliteratur» vermengte.34 Demokratische, progressive, linke und sozialistische Kräfte perzipierten die sich vervielfaltigenden volkswirtschaftlichen und internationalen Kreditbeziehungen als neue Machtmedien. «König Mammon» (Conrad Conzett) und die «Vampyrnatur des Kapitals» (Carl Bürkli) gerieten ins Kreuzfeuer einer Kritik, die sich insbesondere gegen Banken, Finanzierungs- und Holdinggesellschaften (<<Trusts») richtete.35 Katholische Sozialtheoretiker, die sich seit den 1880er Jahren verstärkt auch wirtschaftlicher Fragen anzunehmen begannen, integriertcn die Ablehnung von Banken und Kapitalmärkten in die antijudaistische Tradition des Christentums und warnten etwa vor dem «christusfeindlichen Börsenjudenthume».36 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kritik an der «Banken macht» und an der «Geldherrschaft» in Europa und in den USA nochmals akzentuiert; dabei ging es nicht mehr nur um volkswirtschaftliche Machtkonzentrationen, sondern auch um die internationale Dimension der Problematik, d. h. um die imperialistischen Machtrivalitäten und um die Auf teilung und Ausbeutung der Kolonien. In den USA entstand in den 1890er Jahren das Progressive Movement, das über ein Jahrzehnt hinweg einen publicitywirksamen Kampf gegen «corporate power» führteY In Europa war es vor allem die aufstrebende Arbeiterbewegung, die mit Hilfe der sozialistischen Weltanschauung und eines marxistischen Theorieansatzes eine klassenkämpferische Kritik an der Wirtschafts- und Bankenmacht zu fomulieren begann. In der Schweiz ist auch auf den Schweizerische Bauernbund von 1893 hinzuweisen, der «seine Angriffe gegen alle Konzentration von Macht, Besitz und Prestige» richtete.3s
r
«Macht der Banken"
Markt, Unternehmen, Wirtschaftssystem: Kontroverse Positionen in der ökonomischen Theorie
327
In jener Phase, in der «Bankenmacht» einerseits mit antidemokratischer Zielsetzung mythologisiert -und andererseits unter Berufung au.~ deren fehlende demokratische Legitimität kritisiert wurde, verabschiedete sich die Okonomie als Wissenschaft weitgehend aus dieser Debatte. Seit der «marginalen Revolution», d. h. seit jenem Paradigmawechsel, der seit den 1870er Jahren den Aufstieg der Grenznutzenschule einleitete und die Ausarbeitung von allgemeinen Gleichgewichtsmodellen ermöglichte, wurden -wie der französische Ökonom Fran~ois Pcrroux feststellte - «Machtfragen [ ... ] ganz bewusst vom ökonomischen Denken ferngehalten».39 Diese Ausblendung der Machtproblematik sollte in der Folge andauern. Perroux kritisiert, dass die «meisten der geläufigen Schemata und ModelIe [ ... ] den Gedanken der wirtschaftlichen Macht nicht» enthalten würden. 40 John Kenneth Galbraith konstatierte vor einigen Jahren: «Das Streben nach Macht und dem finanziellen und psychischen Gewinn daraus ist naeh wie vor das grosse Schwarze Loch der orthodoxen Nationalökonomie»"! «Neoclassical economics, the dominant school in contemporary Western academia, has had the very least to say about power», bemerkt Randall Bartlet! in einer neue ren Studie.42
Die Wirtschaftstheorie war allerdings seit jeher in Kontroversen verstrickt, und der Durchbruch der Grenznutzenschule im ausgehenden 19. Jahrhundert brachte alternative Deutungsmodelle keineswegs zum Verschwinden, sondern forderte diese gerade im Gegenteil heraus. Innerhalb der marxistischen Theorietradition blieb Macht eine Grundvoraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise. Mit Rand all Bartlett lässt sich verallgemeinernd feststellen, dass in dem Masse, in dem die Mainstream-Theorie dem Machtaspekt eine höchst randständige Bedeutung zuzumessen begann, gerade diese Frage für jene Richtungen, die vom Mainstream als peripher betrachtet wurden, zentral
d . 43 gewor en seI. .... 45 . In der Theorietradition der Neoklasslk44 lassen SIch mIt Fran~ols Perroux vIer eng zusammenhängende «Machtausblendungsstrategien»46 erkennen: Die erste beruht auf der ;,begrifflichen Unterscheidung zwischen wirtschaftlich und
olitisch». Wenn Macht mit politischen Institionen und mit der öffentlichen Gewalt Pleichgesetzt wird, dann kann eine ordnungspolitische Haltung eingenommen werden, ~ie Machtbeziehungen innerhalb der Wirtschaft ausklammert. Im abstrakten Modell eines vollkommenen Markt, in welchem unbehinderte Konkurrenz, volle Informations
transparenz, Friktionslosigkeit und unendliche A~passungsges~hwindi~keit ~.er~sch~n, ist die Bildung von Monopolstrukturen und damJ! von MachtdlfferenlIalen tatsachhch ausgeschlossen.47 Diese Modellannahmen, denen die neo~lassische ~heorie ihre :orm~le Eleganz verdankt,4s leisten der Vorstellung Vorschub, dIe Macht hege ausschhesshch
auf der Seite des Staates. Die zweite von Perroux erwähnte Strategie besteht in einer anderen Grundunterscheidung, die das Wirtschaftliche vom Sozialen absetzt. Wenn alles, was freie Markttransaktionen
ewährleistet, als «wirtschaftlich», und alles, was «zur Korrektur des Marktgeschehens !uf Minderung oder Verhindemng des privaten Gewinnstrebens abzielt», als «sozial» definiert wird, dann erweist sich das «Soziale» per definitionem als «Gefährdung der privatwirtschaftlichen Ordnung» und wird deswegen mit Macht assoziiert.
--------------________ J
328 Jakob Tanner
Die dritte Strategie basiert auf der Vorstellung, die Ökonomie sei eine Wissenschaft von den Mitteln zur Erreichung bestimmter Zwecke; sie habe nicht Ziele festzusetzen, sondern zu zeigen, wie unter der Bedingung relativer Knappheit die von den politischen oder sozialen Eliten formulierten Zielsetzungen optimal erreicht werden könnten. Für Perroux handelt es sich hier um «eine merkwürdige Arbeitsteilung im gesellschaftlichen Zuständigkcitsbereich», die der grundsätzlichen «Finalität menschlichen Handelns» widerspreche und die Tatsache übersehe, dass jede Mittelwahl unvermeidlich auch (deklarierte oder versteckte, bewusste oder unbewusste) Zielvorstellungen ent
halte. Als vierte Strategie bezeichnet Perroux «die Unterscheidung zwischen Daten und Variablen». Diese werde meistens in einer Weise vorgenommen, dass die für eine Machtanalyse relevanten Aspekte, insbesondere ,<die Eigentumsordnung und die Spielregeln der industriellen und sozialen Beziehungen», der ökonomischen Analyse vorausgesetzt würden.49
Am andern Pol des wirtschaftswissenschaftlichen Spektrums wird demgegenüber die These verfochten, politische Macht und ideologische Hegemonie seien im wesentlichen ein Derivat wirtschaftlicher Macht.sll Die Protagonisten dieser Theorien gehen davon aus, dass es in einem Wirtschaftssystem, in dem der Zugang zu Informationen und die Verfügung über materielle/finanzielle Ressourcen ungleich verteilt ist, immer auch Macht gibt und dass in deren geräuschlosem Funktionieren gerade ihre Effektivität zum Ausdruck gelangt. Die Macht eines Diskurses, der den «Kunden als König» inthronisiert und Markt mit Freiheit konnotiert, legt aus dieser Sicht den Diskurs über die Macht still und verunmöglicht ein sinnvolles, theoriegeleitetes Reden über dieses Phänomen,sr Macht folgt dem «Rumpelstilzchenprinzip»: Wer ihren Namen ausspricht, hat bereits begonnen, ihre Legitimität zu unterminieren. Und wer zudem ihre Funktionsmechanismen durchschaut, kann sie wirksamer bekämpfen. Für Kar! Marx beruhte die Mehrwertproduktion, die den kapitalistischen Akkumulationsprozess speiste, nicht direkt auf Macht; die Ausbeutung der Arbeitskraft durch das Kapital war aus seiner Sicht unverzichtbar mit dem Funktionieren des Wertgesetzes verbunden. Die Marxsche Arbeitswerttheorie ist zugleich eine Ausbeutungstheorie; das Kapital als ein gesellschaftliches Verhältnis, das auf der «Unterordnung des Arbeitsprozesses unter den Verwertungsprozess» beruht, lässt sich ohne die Kategorie der Macht nicht denken.52
Mit Rudolf Hilferding erhielt die solchermassen politisch intendierte Theoretisierung von Macht und Herrschaft in der kapitalistischen Wirtschaft ihre elaborierteste Ausformung. In seinem 1910 publizierten, die Marxsche Kritik der Politischen Ökonmie fortsetzenden und aktualisierenden «Finanzkapital» stellte Hilferding fest: «Ökonomische Macht bedeutet zugleich politische Macht. Die Herrschaft über die Wirtschaft gibt zugleich die Verfügung über die Machtmittel der Staatsgewalt.»53 Grundlegend für die Hilferdingsche Argumentation ist die These von der Suprematie des Finanzkapitals in der kapitalistischen Produktionszweise: Durch die Fusion von Bank- und Industriekapital ist ein neuer, mächtiger Typ der Unternehmensorganisation entstanden, und gleichzeitig ist das Kreditsystem zum neuralgischen Sektor der Wirtschaft geworden, in dem sich die Krisentendenzen des Systems am eklatantesten offenbaren würden. Hilferding bringt den Aufstieg des Finanzkapitals in einen direkten Zusammenhang mit der imperialistischen Ideologie des «starken Staates», die «der des Liberalismus völlig
c
«Macht der Banken» 329
entgegengesetzt» ist.54 Die «Rassenideologie» erweist sich damit als «eine naturwissenschaftlich verkleidete Begründung des Machtstrebens des Finanzkapitals. [ ... ] An Stelle des demokratischen Gleichheitsideals ist ein oligarchisches Herrschaftsideal getreten.»55 Die Verve, mit der Hilferding seine Macht- und Herrschaftskritik vorträgt, darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine analytischen Kategorien theoretisch in verschiedener Hinsicht unterbelichtet bleiben.sr, Sein Insistieren auf dem Machtaspekt machte seine Analyse indessen inkompatibel mit den Argumentationsvoraussetzungen der Neoklassik. Aufgrund dieses Theoriehiatus sollten sich die Verständigungsschwierigkeiten, die zwischen der nun als «bürgerlich» etikettierten Nationalökonomie und marxistisch inspirierten Erklärungsansätzen schon immer existierten, in der Folge nicht nur aus politischen Gründen noch verstärken. Die politischen Implikationen der Ausblendung resp. der Kritik der Wirtschaftsrnacht sind offensichtlich. Indem die Mainstream-Theorie in der Nationalökonomie den Machtaspekt «vergass» und der Fiktion des machtfreien Marktes Vorschub leistete, legitimierte sie den Kapitalismus und erschwerte sie den Staatsinterventionismus. Sie lieferte die argumentative Munition gegen jene politischen Konzepte, die auf eine Verstärkung politischer Regulierungen und einen Ausbau der Staatsfunktionen und des öffentlichen Sektors abzielten. Die Linke setzte einer solchen Status-quo-Politik eine Reform- respektive Revolutionsperspektive entgegen. Dabei verquickte sie die Machtkritik mit ihren Machtaspirationen. Das Ziel, den «anarchistischen Markt» durch den «vernünftigem Plan» zu substituieren und so eine optimale Organisation der Industrieproduktion mit einer gerechten Verteilung des Sozialprodukts zu kombinieren, liess sich ohne angemessene Machtmittel nicht erreichen. Der Niedergang des kapitalistischen Marktes und der Aufbau der sozialistischen Planwirtschaft wurden deshalb als Korrelate gedacht. Diese deterministische Sichtweise entlastete das revolutionäre Ereignis von strukturbildenden Aufgaben, denn die neuen Strukturen, auf denen eine sozialistische Wirtschaftsplanung basieren konnte, waren bereits im Kapitalismus im Entstehen begriffen. Besonders eindrücklich formuliert wurde diese Ansicht durch Rudolf Hilferding: «Das Finanzkapital bedeutet seiner Tendenz nach die Herstellung der gesellschaftlichen Kontrolle über die Produktion. [ ... ] Die vergesellschaftende Funktion des Finanzkapitals erleichtert die Überwindung des Kapitalismus ausserordent1ich. Sobald das Finanzkapital die wichtigsten Produktionszweige unter seine Kontrolle gebracht hat, genügt es, wenn die Gesellschaft durch ihr bewusstes Vollzugsorgan, den vom Proletariat eroberten Staat, sich des Finanzkapitals bemächtigt, um sofort die Verfügung über die wichtigsten Produktionsweige zu erhalten.»57 Aus der «Diktatur der Kapitalmagnaten» geht damit die «Diktatur des Proletariats» hervor.58 Dieser anvisierte Übergang von der einen Diktatur zur andercn verdeutlicht, wie sehr sich «Macht» zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Diskussionszusammenhang und in den Theoriekonzepten der Linken verdinglicht hatte. Sie erschien als substantielle Mächtigkeit, sie konnte «erobert» und zum Nutzen der ganzen Bevölkerung «vcrwendet» werden. In verschiedensten Varianten überlebte in der Folge ein derartig verdinglichter und verörtlichter Machtbegriff (Macht als etwas, das zuoberst in der Gesellschaft lokalisiert ist und deswegen erobert werden kann) im
theoretischen Diskurs der Linken.
330 Jakob Tanner
Politische Machtkritik in gesellschaftlichen Orientierungskrisen: Die Schweiz in den 1930er Jahren
Das Spannungsfeld zWischen politischer Mythologie und wissenschaftlicher Analyse, in dem die Kritik am Bankensystem oszillierte, soll im folgenden am Beispiel der Schweiz in den 1930er Jahren dargestellt werden. Als Ausgangspunkt dient dabei die «These [ ... l, es stelle sich in Krisenphasen die Aufgabe der Rekonstruktion der Geschichte einer Gesellschaft in einer Weise, die die Rede von der Kontinuität. begünstigl».s9 Für die Schweiz . lässt sich zeigen, wie die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre nach einer Phase politischer Verunsicherung und kultureller Desorientierung schon vor dem unteren Wendepunkt der Konjunkturentwicklung (1936) in eine neue Phase gesellschaftlicher Restabilisierung einmündete. Ab 1934 gewann das Deutungsmuster der "Geistigen Landesverteidigung» an politisch-institutioneller Integrationskraft. In der neuen, konsensualen Atmosphäre näherten sich bisher unvereinbare programmatische Positionen zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft einander an und machten in den ausgehenden 1930er Jahren einen breit abgestützten innenpolitischen Schulterschluss möglich. Dennoch brach während dieser ganzen Zeit das oppositionelle Donnergrollen der Bankenkritik nicht ab. Aus konflikttheoretischer Perspektive wird deutlich, dass in solchen Phasen, in welchen sich die Gesellschaft in einem krisenhaften sozioökonomischen Umbruchprozess befindet, die Wiederherstellung von Regelvertrauen und Orientierungssicherheit gerade auch über anhaltende Abgrenzungsrhetorik in bestimmten Bereichen erreicht wurde. In der soziokulturellen Destabilisierungsphase, die Ende der 1920er Jahre einsetzte und die sich in den beginnenden 1930er Jahren akzentuierte, praktizierte die Linke auch in der Schweiz eine deutliche Kritik an der Bankenmacht. Die damals einsetzende Wirtschaftskrise setzte das Bankensystem neuen Belastungsproben aus und ermöglichte es, die seit langem gefordert gesetzliche Normierung der Banktätigkeit durch ein Spezialgesetz zum Abschluss zu führen, wobei dieser Legiferierungsprozess in starkem Ausrnass durch die Interessen der Banken selbst geprägt wurde und das Bankgeheimnis mit einem speziellen strafrechtlichen Schutz ausstattete.611
Die auch in der Schweiz mit einer relativ hohen Arbeitslosigkeit verbundene Wirtschaftskrise der 1930er Jahre wurde von der Arbeiterbewegung sowohl als fundamentale Systemkrise wie auch als besonders ausgeprägte konjunkturelle Depression perzipiert.61
Beide Krisenwahrnehmungen konvergierten indessen in einer geharnischten Kritik am Bankensystem, die damit die ideologische Kohäsion innerhalb der Gewerkschaften zu festigen imstande war. Fritz Giovanoli, ein massgeblicher Wirtschaftstheoretiker der Sozialdemokratischen Partei, konstatierte 1931, «wie stark das Aktienwesen vom Bankund Finanzkapital beherrscht wird und wie die eigentlichen Industriellen und Fabrikanten die in einer früheren Periode des Aktienwesens das Feld beherrschten, in den Hi~tergrund gedrängt wurden» .62 Diese Argumentation veränderte sich im Verlaufe der 1930er Jahre kaum. Ende 1938 erschien unter dem einprägsamen Titel «Im Schatten des Finanzkapitals» eine Untersuchung desselben Autors, welche - wie der SPS-Sekretär Werner Stocker festhielt - die «verdienstvolle Aufgabe» verfolgte, «die zentrale Hochburg und Festung des heutigen Grosskapitals, ihre Generäle und Truppen und den weiten Wirkungsbereich ihrer Geschütze» in «scheinbar trockener Sprache» zu beschreiben.63
«Macht der Banken» 331
Giovanoli baute seine Analyse auf dem Hilferdingschen Axiom auf, «die kapitalistische Wirtschaft der gegenwärtigen Epoche» sei, weil durch «die Vorherrschaft des Bank-, Finanz- und Trustkapitals gekennzeichneb>, eine «finanzkapitalisIische Periode».64 Das Finanzkapital habe mittels «grosser Trustgebilde» eine «monopolistische Beherrschung des Marktes geschaffen» und «mit seinen riesigen Kapitalgebilden und den weitgehenden Verschachtelungen und internationalen Verbindungen mit einer frappanten Rücksichtslosigkeit das Heft und den Führungsanspruch des Kapitalismus an sich» gerissen.6S
«Der Fabrikant von altem Schrot und Kom wurde an die Wand gedrückt. Der Finanzier und Bankherr übernahm auch in der Industrie das Kommando.» Damit diktiere nun eine «seidenpapierdünne Schicht der Kapitalisten vom Grosskapital [ ... ] die Marschroute».66 «Auch die schweizerischen Grosskapitalisten seien mit dem internationalen Finanzkapital stark verhängt»; aus diesem Grunde würden sie auch «vor den Vorstössen des faschistischen Imperialismus kapitulieren» und hätten mit der «schweizerischen TraditiOll» deshalb nichts mehr gemeinsam.67
Die nach 1933 aufstrebende «Frontenbewegung» griff Elemente dieses oppositionellen Diskurses auf und integrierte sie in eine antikapitalistisch-antisemitisch-nationalistische Agitation gegen «die Banken». Bankenmacht galt hier indessen per definitionem als «unschweizerisch». Der schweizerische Rechtsextremismus rekurrierte auf das Selbstbild einer heilen Schweiz: "Unsere Volkswohlfahrt hat historisch in der Einfachheit der Lebensansprüche, vereint mit einem hochentwickelten Schulwesen, Fleiss und Sparsamkeit, ihre Prägnanz. Wir kennen keinen Imperialismus», wurde in der «Front», dem ab Ende August 1933 zweimal wöchentlich erscheinenden «Zentralen Kampfblatt der Nationalen Front», vermerkt."" Die «Hochfinanz» stellte aus frontistischer Optik eine von aussen kommende Bedrohung der «nationalen Eigenart» der Schweizer dar. Die «faule Bankenwirtschaft» wurde kontrastreich abgesetzt von der «gesunden» Volkswirtschaft. An diesem Punkt begann sich der nationalistische Diskurs der Rechten der ebenfalls auf nationale Positionen einschwenkenden Programmatik der Linken anzugleichen: <<In neuerer Zeit beherrschten die Banken je länger je mehr die Wirtschaft: diese Geldgewalt aber wurde nur im Profitinteresse einer kleinen Finanzschicht ausgeübt und musste daher in vielen Fällen volkswirtschaftlichen Interessen geradezu zuwiderlaufen», hielt die "Front» am 21. November 1933 fest; dies im Zusammenhang mit dem Beinahekonkurs der «Banque de Geneve», der «Tausende kleiner Sparer um ihre sauer verdienten Batzen zu bringen drohte und durch ihre gewissenlosen Spekulanten auch gebracht hätte, wäre nicht der Bund zu Hilfe geeilt».~Y Wenn wir nach den tieferliegenden Gründen für diese Gemeinsamkeiten fragen, so finden wir sie in der Gegenüberstellung von wertschaffender Arbeit und parasitärem Einkommen. Sowohl die linke als auch die rechte Kritik am real existierenden Kapitalismus beruht auf Unterscheidungen wie «produktiv/unproduktiv», ',nützlich/ullnütz», die mit moralischen Dichotomien wie <<legitim/illegitim», «sauber/schmutzig», «ehrlichlkriminell» konnoliert war. Legitime Einkommen durch nützliche industriell-gewerblich-landwirtschaftliche Arbeit (<<NationalökonomieNolkswirtschaft») werden abgegrenzt von illegitimen Profiten durch Geldgeschäfte «<Bankengeschäft», <<Internationale Hochfinanz»). Die Kernkategorien dieses Interdiskurses70 sind die «Arbeitskraft» und die «Nation». Das «arbeitende
(Männer-)Volk» bildete den Motor der nati~nalen ~ohlstandsprodu~tion.71 Die von d~n damaligen Sozialdemokraten und KommUnIsten gleichermassen geteilte Auffassung, die
332 Jakob Tanner
auch Giovanolis Interpretation des «Finanzkapitals» zugrunde liegt, folgt dieser Erklärungslogik. Auch die Marxsche Theorie unterstellt einen strukturellen Antagonismus zwischen produktiver, mehrwertschaffender Arbeit und mehrwertaneignendem Kapital, dem auch nichtproduktive, mehrwertabsorbierende Segmente (wie Banken, Börsen, Assekuranz etc.) zuzurechnen sind. Die Arbeitswerttheorie und der darauf beruhende SurpillsAnsatz impliziert eine von den historischen Konkretisierungen der kapitalistischen Produktionsweise unabhängige These der Ausbeutung und der Beherrschung der Arbeitskraft durch das Kapital. Der Finanzsektor gewährleistet die Mehrwertzirkulation, stellt jedoch einen Kostenfaktor und zugleich ein Machtdispositiv dar.72 Von einer handfesten Detinition mehrwertschaffender Arbeit ausgehend, hatte Marx das «Kreditsystem» als das «reinste und kolossalste Spicl- und Schwindelsystem» bezeichnet, da~ der «Bereicherung durch Ausbeutung fremder Arbeit» dieneJ3 Im Gegensatz zu dieser theoretisch gehaltvollen marxistischen Konzeption von Arbeitskraft, Mehrwertproduktion und Kapitalverwertung, die bis heute wichtige Impulse für die nationalökonom ische Theorieentwicklung geliefert hat, basierte die Unterscheidung von «raffendem» und «schaffendem» Kapital auf einer ideologischen Polarisierung zwischen <<internationalem Leihkapital» und «nationalgebundenem Produktionskapitab. Für Gottfried Feder, der diese Wortschöpfungen dem Programm der NSDAP zugrunde gelegt hat, stellt das transnationale Bankensystem den Inbegriff einer parasitären Institution dar; die Nazis ergänzten deshalb ihrcn Aufruf zur «Brechung der Zinsknechtschaft» durch die Forderung nach rechtlicher Anerkennung und staatlichem Schutz des «ehrlich erworbenen und erarbeiteten Eigentums».74 Wenn die Haltung der Arbeiterbewegung und der Frontenbewegung zu Demokratie und parlamentarischer Staatsform untersucht wird, so zeigt sich für die Schweiz, dass die Funktion der Kritik an der Bankenmacht eine diamentral entgegengesetzte war.75 Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz war 1933, nach der Machtergreifung Hitlers, von ihrer alten Parole, dass Dcmokratisierung sich nur aus dem Kampf für den Sozialismus ergeben könne, abgerückt und räumte nun der Sicherung des Erreichten die Priorität ein. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, in dem sich die Fronten anschickten, mit einer korporatistischen, durch faschistische Leitbilder inspirierten Volksiniative zum endgültigen Sturm auf das scheinbar morsche Gebälk des liberalen Bundesstaates von 1848 bzw. 1874 zu blasen. Für den sozialdemokratischen Bankkritiker Giovanoli stellt die Herrschaft des Finanzkapitals eine Bedrohung der parlamentarischen Demokratie dar, währenddem die «Front» hier eine Manifestation eines «faulen Parlamentarismus»76 ortete. Im Gegensatz zu Giovanolis Analyse, der festhielt, ein «sehr wichtiger Flügel» der schweizerischen «Kapitalistenklasse» sei «mit seinen Herrschafts- und Ausbeutungsinteressen sehr eng mit dem faschistischen Imperialismus Deutschland und Italiens verbunden»,77 betonte die «Front» gerade umgekehrt, skrupellose Financiers, «welche das nationale Volksvermögen zur Ergattcrung von Profiten ausnützen» sässen im «fascistischen Italien» und im «nationalsozialistischen Deutschland" schon längst «hinter Schloss und Riegel».78 Und währenddem Giovanoli die Behauptung, «das schweize
rische Aktienwesen, namentlich aber das Bankenwesen und die Finanzierungsgesellschaften seien von Juden beherrscht», aufgrund von statistischen Daten als «einfach nicht wahr» zurückwies, dominiert in der «Front» eine penetrante antisemitische Propaganda, welche die «Juden als Fremdkörper»79 angriff. Dabei wurde - getreu der Komplottphobie - eine geheime Identität von jüdischen Kapitalisten und sozialistischen
«
«Macht der Banken» 333
Marxisten vermutet. Die «Herren Sozialisten» seien «wieder auf dem besten Wege, mit dem Finanzkapital einen stillschweigenden unrühmlichen Pakt abzuschliessen».8o Die linke Kritik am Bankensystem war insgesamt - und dies unterschied sie deutlich von der frontistischen Kritik - empirisch fundiert; Daten über ungleiche Eigentumsverteilung stützten die oppositionelle Rhetorik, der antisemitische Grundtenor von rechts wurde mit dem Hinweis auf Zahlen abgewiesen.81
In der Konsolidierungsphase der «Geistigen Landesverteidigung» koexistierte also eine zweischneidige Kritik an «Bankenmacht» und «Hochfinanz», die im politischen Koordinatensystem sowohl links und als auch rechts anzusiedeln ist. Im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges veränderte sich diese Konstellation. Die SPS stimmte ihre Kritik am Bankensystem auf das sozialpolitische Reformprojekt «Die Neue Schweiz» von 1942 ab: "Das Kapital wird in den Dienst der Arbeit gestellt. Der Kredit steht als öffentlicher Dienst unter staatlicher Kontrolle. Die Währung ist derart zu handhaben, dass vom Geld keine wirtschaftlichen Stönmgen ausgehen»,82 wurde hier im Duktus einer in ganz Europa an politischer Plausibilität gewinnenden (linkskeynesianischen) Reformprogrammatik fcstgehalten. Nach Kriegsende kam es dann in verschiedenen Ländern (nicht aber in der Schweiz) zu auch von sozialreformerischen bürgerlichen Kräften unterstützten Kontroll-und Verstaatlichungsmassnahmen. Demgegenüber bedeutete die Niederlage des «Dritten Reiches» auch den Zusammenbruch des rechtsextremen Kampfes gegen die «jüdische Hochfinanz». Die Bestrebungen verlagerten sich nun auf die Abwehr kommunistischer Welteroberungspläne, die totalitarismustheoretisch begründet wurden. Die politische Mythologie von der globalen Konspiration verschwand damit nicht; sie löste sich aber von ihrer bisherigen Fixierung auf das «grosse Geld» und kreiste fortan um die «Macht des Bösen». Für die Schweiz hat Jean Rodolphe von Salis schon zu Beginn der 1960er Jahre nicht ohne Sarkasmus darauf hingewiesen, dass gerade jene, die in den 1930er Jahren für nationalsozialistisches Ideengut besonders empfanglich waren, nun eine «antikommunistische Angstpsychosc» zu verbreiten versuchten.83
Die Debatte um Bankenmacht im Gefolge von '68
Damals, in den 1950er und 60er Jahren, herrschte Kalter Krieg, und dieser wurde auch auf der Ebene analytischer Konzepte geführt. Im sowjetischen Machtbereich wurde das marxistisch-leninistische Konstrukt des «staatsmonopolistischen Kapitalismus» propagiert. Die «Vereinigung der Macht der Monopole mit der des bürgerlichen Staates» hätte - so diese These - die «Hauptfunktion [ ... ], die wirtschaftliche und politische Macht der Monopolbourgeoisie zu vergrössern» und den «Übergang zum Sozialismus» zu verhindern.84 Demgegcnüber gingen Apologeten der Marktwirtschaft davon aus, es gäbe «keine wirtschaftliche Macht». Volkmar Muthesius z. B. versuchte 1960 in einer dem Sprachduktus des kommunistischen Manifests folgenden Abhandlung «<Ein Gespenst geht um: die wirtschaftliche Macht ... ») nachzuweisen, dass es «im wirtschaftlichen Leben nur solche Macht [gibt], die vom Staat ausgeht, von ihm entliehen ist».85 Wer von genuin «wirtschaftlicher Macht» spreche, sei Opfer eines Aberglaubens und unterliege der «furchterregenden Zwangsvorstellung», privates Eigentum könne «zur Beherrschung anderer Menschen» verwendet werden.s6
334 Jakob Tanner
Diese beiden politisch instrumentalisierten und theoretisch abgenutzten Positionen sahen sich seit den ausgehenden 1960er Jahren verstärkt von neuen Interpretationsansätzen herausgefordert. Steven Lukes hat darauf hingewiesen, dass Macht in der okzidentalen Tradition nicht nur - wie dies ein negativ besetzter Machtbegriff suggeriert - asymmetrisch, sondern auch symmetrisch gedacht werden kannP In diesem Falle wird sie als Kooperation und Konsens, im anderen als Hierarchie und Herrschaft begriffen. Den «symmetrischen» Argumentationsstrang verfolgen die damals breit rezipierten strukturfunktionalistischen, systemtheoretischen und organisationssoziologischen Ansätze.88 Diese versuchten, das Machtproblem grundsätzliCh zu entmoralisieren und von seinen werthaitigen Implikationen zu reinigen. An konzeptuellc Vorleistungen von Talcott Parsons anschliessend, definiert Niklas Luhmann Macht als «symbolisch generaliSiertes Kommunikationsmedium» und als «lebensweItliches Universale gesellschaftlicher Existenz».89 Macht erweist sich damit als eine der zentralen Ressourcen gesellschaftlicher Systeme: Indem sie Differenzierung und Komplexitätssteigerung ermöglicht, stellt sie eine evolutionäre Errungenschaft dar. Macht wird geradezu kostbar: Nicht mehr wie bisher ein Zuviel an Macht ist das primäre Problem, sondern die Aufmerksamkeit richtet sich verstärkt auf Machtverluste und die damit zusammenhängenden Funktionsdefizite. Diese Überlegungen werden auch auf das wirtschaftliche Subsystem übertragen. Als «grundlegender Stabilisierungs- und Regulierungsmechanismus sozialer Interaktion, und damit (ein) integraler und unvermeidlicher Bestandteil allen kollektiven Handelns»90 stellt Macht hier ein zentrales «Steuerungsmedium für Unternehmungsprozesse» dar. Als Mechanismus der Komplexitätsreduktion ist sie aus dieser Sicht ebenso wichtg wie als Veraussetzung für die Initiierung und Aufrechterhaltung unternehmerischer Aktivitäten.91 Hansjörg Siegenthaler hat 1983 festgehaIten, die Banken hätten seit einiger Zeit ihre Macht «selber ausdtiicklich zur Kenntnis genommen, nach aussen hin legitimiert, für die weitere Zukunft auch beansprucht [ ... ] mit der zweifellos triftigen Begründung, ein Bankensystem müsste funktionlos sein, wenn es keine Macht besässe»Y2 Eine solche strukturfunktionalistische Argumentation schliesst eine kritische Auseinandersetzung mit dem Machtphänomen selbstredend nicht aus; der generell pejorative Machtbegriffwird hier jedoch ersetzt durch jenen des «Machtmissbrauchs»: Macht kann dann dysfunktional werden, wenn sich «Organisationsmacht von der im Gesellschaftssystem konstituierten politischen Macht» abkoppelt.93 Solange Akteure aufgrund einer privilegierten Position innerhalb eines Regelsystems nur «Einfluss» ausüben - so wurde etwa argumentiert -, ist das regelkonform. Missbräuchliche Macht beginnt erst mit der Fähigkeit, die Regeln zu verändern, die dem rationalen Entscheidungsverhalten zugrunde liegen. Zu Machtmissbrauch neigen demnach jene wirtschaftlichen Akteure, die Strategien zu entwickeln vermögen, um ökonomische Daten in Variable und umgekehrt Variable der Konzernpolitik in den makroökonomischen Datenkranz, der den mikroökonomischen Entscheidungsprozessen vorausgesetzt ist, zu verwandelnY4 Weil Macht an sich aber weder «gut» noch «böse», sondern vielmehr funktional notwendig ist, kann es nur noch darum gehen, solche dem reibungslosen Funktionieren und der optimalen Anpassungsfähigkeit des wirtschaftlichen (Sub-)Systems hinderlichen Machtmissbräuche zu verhindern. Damit wurde das Problem wirtschaftlicher Macht auch von dezidiert bürger lieh-marktwirtschaft lichen Theoretikern und Politikern für relevant erklärt. Die Forderung nach Fusionsbeschränkungen und Kontrolle der Bankenmacht
«Macht der Banken» 335
wurden das, was sie im angelsächsischen Bereich schon lange waren: nämlich politikfähigYs Um entsprechende Postualte zu realisieren, musste das Konzept der «Macht» operationalisiert werden"~ Dabei zeigte es sich, dass das Monopolkonzept zu kurz greift, d. h. dass dic Macht eines Einzelunternehmens nicht allein auf den Anteil zurückführt werden kann, den dieses auf verschiedenen Märkten aufweist. Die Folge war eine Relativierung der Marktanteilsmacht und eine verstärkte Berücksichtigung des Aspekts der Kontrolle von Ressourcen.97 Die ressourcentheoretischen Argumentationen weisen darauf hin, dass die MarktsteIlung eines Unternehmens nicht auf dessen Marktanteil reduziert werden kann. In Anlehnung an eine Unterscheidung von C. D. Edwards lässt sich formulieren, dass «monopolistic power» (d. h. Marktmarkt) gegenüber «power derived from big business»98 (d. h. erhöhte Überlebenswahrscheinlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit von Firmen aufgrund von Grösse) an Bedeutung verloren hat. «Grösse» wiederum hängt von drei Faktoren ab: a) von Quantität, d. h. von «Grössenmacht» (die auch Finanzkraft einschliesst); b) vom Grad der Diversifikation, d. h. von der dntegrationsmacht», die insbesondere auf der Fähigkeit beruht, auf einem Markt erworbene Macht auf andere Märkte zu übertragen, und c) von der Flexibilität der Ressourcen, d. h. von der «Flexibilitätsmachl». Wichtigste Variable ist dabei die «Finanzkraft», die zum neuen zentralen «Tatbestandsmerkmai» für die Beurteilung von Machtpositionen aufrückte. «Finanzkraft» wird dabei definiert als «die Gesamtheit der finanziellen Mittel und Möglichkeiten eines Unternehmens, insbesondere die Finanziemngsmöglichkeiten nach Eigen- und Fremdfinanzierung» sowie nach dem «Zugang zum Kapitalmarkt».99 Hier kommen nun wiederum direkt die Banken ins Spiel, denn «eine Verschuldungsreserve und Bankenvertreter im Aufsichtsrat und im Beirat des Unternehmens verstärken das Signal für die Wettbewerber, dass das Unternehmen über potentielle Finanzkraft verfügt».I(I() Parallel zu diesen Bestrebungen intensivierte sich seit Anfang der 70er Jahre auch die Debatte um eine grundsätzlich der Asymmetriethese verpflichtete, partiell an Marxsche Argumentationslinien anknüpfende Machtkritik. 101 Drei Hauptansatzpunkte dieser Diskussion lassen sich auseinanderhalten. Erstens wurde die Stellung des Finanzsektors im «kapitalistischen Wel!system»1lI2 und insbesondere die Rolle von Banken bei der wirtschaftlichen Ausbeutung der südlichen Hemisphäre zum Gegenstand von Untersuchungen gemacht. In der Schweiz wurde eine besonders vehemente Kritik an Drehscheibengeschäften, an Fluchtgeldtransaktionen, am «money laundering» und an der Drittweltverschuldung geübtyn Gefordert wurden ein griffigeres Bankengesetz, eine effizientere staatliche Aufsicht über das Bankensystem und ein Ausbau der internationalen Rechtshilfe. Zweitens wurde die klassische Problematisierung wirtschaftlicher Macht aktualisiert und mit dem Postulat einer bankengestützten staatlichen Investitionslenkung resp. einer Bankenverstaatlichung kombiniert. Ausgangspunkt war die Einsicht, dass «auch das Hauptgeschäft der Banken - die Kreditvergabe - für sich genommen einige Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die übrige Wirtschaft (bietet), da die Entscheidung einer Bank, ob für bestimmte Investitionen Kredite zur Verfügung gesteIlt werden sollen, ein wichtiges - in Krisenzeiten oftmals <lebenswichtiges> - Datum für die Investitions- und Finanzpolitik einer Unternehmung isl».lll4 Dabei ging es um das ganze Arsenal direkter und indirekter Einflussmöglichkeiten der Banken aufIndustrie, Gewerbe, Dienstleistungssektor und Landwirtschaft: Depotstimmrecht, Beteiligungen an Nichtbankunternehmen und Verwaltungsratspräsenz in diesem Bereich. Drittens wurde erkannt, dass das Banken-
336 Jakob Tanner
system fahig war, geld- und kreditpolitische Zielsetzungen von Zentralbanken und Staat zu unterlaufen. Die Diagnose einer Aushöhlung wirtschaftspolitischer Souveränität von Nationalstaaten konnte aber - da sich die Kritik auch an die Institutionen von Bretton Woods richtete - nicht mit prospektiven Lösungsvorschlägen kombiniert werden. In der Schweiz kam es im Zusammenhang mit dem sogenannten Chiasso-SKAndaJlUj vom April 1977, der den Höhepunkt einer nicht abbrechenden Kette von Bankrotten uns! Skandalen bildete, zu einer politischen Mobilisierung gegen die Banken. Die von der SPS damals lancierte «Banken initiative» verband beide Aspekte der Kritik und vereinigte arbeitsmarktpolitische Anliegen der traditionellen Arbeiterbewegung mit antiimperialistischen und humanitären Zielsetzungen der Drittweltbewegung.106 Unter dem Motto «Finanzplatz gegen Werkplatz» wurde der exportschädigende Höhenflug des Schweizerfrankens kritisiert, und 1978 wurden aus Gewerkschaftskreiscn auch Forderungen nach Devisenbewirtschaftungsmassnahmen (Wechselkurssplitting) vorgetragen. Diese Vorschläge verebbten in den beginnenden 1980er Jahren wiederum, und das sozialdemokratische Volksbegehren scheiterte 1984 deutlich an der Abstimmungshürde. Im Verlaufe der 1980er Jahre wurden in dieser kritischen Tradition angesiedelte Analysen der Macht stärker mit konstruktivistischen Ansätzen verbunden, die Machtausübung als einen Effekt asymmetrischer Kommunikations- und Informationsgewinnungsprozesse diskutieren. Davita Silfen Glasberg hat dabei versucht, Bankenmacht in einen Bezug zu kultureller Hegemonie und Definitionsmacht zu bringen. Die Autorin stellt in ihrer Studie «The power of collective purse strings»!Il7 fest, die «banking community» habe inzwischen - dies im Gegensatz zur Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre - durch systematische Organisationsprozesse eine strukturelle Vereinheitlichung und eine Kontrollc kompetitiver Prozesse erreicht. Die zentrale These der Untersuchung lautet, das Bankensystem sei fähig geworden, Krisen- und Nichtkrisensituationen zu definieren. Wenn Banken davon ausgehen, es herrsche keine Krise, erweitern sie mit Krediten die Wachstums- und Reorganisationsmöglichkeiten von Unternehmen und die Reformspielräume von Regierungen. Im andern Falle werden solche 'dynamisierenden Impulse blockiert - was die Krisendiagnose der Bankenwelt im Sinne einer «selffulfilling prophecy» bestätigt.I(JH Glasberg zielt damit über eine Machtdefinition hinaus, die auf der strukturellen Position der Banken im Kreditsystem, auf dem Aktienmarkt und in den persönlichen Netzwerken innerhalb der wirtschaftlichen Elite beruht. Die Autorin spricht vielmehr von «Hegemonie» und bezeichnet damit das Vermögen, massgebend in gesellschaftliche Selbstdefinitionsprozesse zu intervenieren.109 Prosperität und Krisen sind aus dieser Sicht soziokulturelle Konstrukte; sie sind Teil der gesellschaftlichen Konstruktion dcr ökonomischen und der politischen Wirklichkeit.110 Das Argument ruft natürlich nach der Frage, wieso die Banken dazu kommen, sich so oder anders zu verhalten. Für Glasberg handelt es sich nicht um einen dezisionistischen Vorgang. Sie geht davon aus, dass für ein ansonsten wettbewerbsorientiertes Bankensystem gcmeinsame Situationsdeutungen dann aktuell werden, wenn die grundlegenden Funktionsprämissen des internationalen Währungssystem auf dem Spiel stehcn - das Vermögen, solche angcmessen zu bestimmen und sie zum geeigneten Zeitpunkt zu verbindlichen, handlungsleitenden Maximen zu erheben, stellt demnach den zentralen Vorgang dieses institutionellen Lernprozesses dar. 1ll Indem Glasberg das Konzept der «kulturellen Hegemonie» als einen Lernprozess begreift und auf Kommunkations- und Informations-
«Macht der Banken» 337
verarbeitungs prozesse bezieht, vermag sie ihre Vorstellung von «Definitionsmacht» aus den Verstrickungen einer konspirativen Mythologie herauszulösen und analytisch zu
begründen. Eine solche Konzeption von kultureller Hegemonie scheint mir indessen in doppelter Hinsicht ergänzungsbedürftig, wobei es beide Male darum geht, den Begriff der «Definitionsmach\» auf die gcsellschaftlichen Bedingungen und Voraussetzungen für soziale Konstnlktionsprozesse zu beziehen. Zum einen hilft hier Michel Foucaults Vorstellung einer «Mikrophysik dcr Macht» weiter. Foucault löst den Machtbegriff aus institutionellen Verengungcn und radikalisicrt den Beziehungscharakter des Phänomens, indem er feststellt, Macht sei «der Namc, den man ciner komplexen strategischen Situation in der Gesellschaft gibt». Macht vollzieht sich «von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher beweglicher Bcziehungem>.112 Sie ist damit strikt relation al und wirkt über infinitesimale Mechanismen. Als konstitutives Momcnt jeder Vergesellschaftung ist Macht immer schon da, sie durchwirkt alle sozialen Interaktionen, sic durchzieht das personelle Bezichungsgeflecht und die Bewusstseinsformen bis in dic feinsten Fasern hinaus. Andererseits provoziert Maeht stets Kritik und Widerstand. Eine solche Konzeptualisierung von Macht ermöglicht es, «Geld» sowohl auf grosse Organisationen (Banken) als auch auf unscheinbaren Alltagspraktiken (Einkaufen, Schenken, Spielen) zu beziehen und sie damit als sozialhistorische Untersuchungskategorie neu zu fassen.! 13
Zum andern ginge es damm, Überlegungen zur Bankenmacht stärker mit den Argumenten der Informationsökonomik und der Theorie der «bounded rationality» zu verbinden. 114 Die Fähigkeit von Organisationen, Ressourcen zu akkumulieren und auf diese Weise Macht auszuüben, kann in Kategorien der Informationsgewinnung und _verarbeitung übersetzt werden: Indem Banken die Selbstreferenz des ökonomischen Systems «bewegen» und als «Beobachter der Wirtschaft in der Wirtschaft» fungieren, verfügen sie über ein im Vergleich zu anderen Branchen geschärftes Sensorium für die Nutzung komparativer Vorteile; und sie sind aufgrund ausserordentlicher Vernetzungsleistungen in der Lage, Risiken zu diversifizieren und partiell zu verarbeiten, d. h. Kontingenz (der Reproduktion von Zahlungsfähigkeit) durch Technik (der Finanzierung) zu substituieren. 1l5 Von seiner strukturellen Position her kann das Bankensystem damit eine Infonnationsasymmetrie nutzen; in Kreditgeschäften müssen demgegenüber einzelne Bankinstitute mit einer gerade umgekehrten Informationsasymmetrie umzugehen lernen (denn sie verfügen als Kreditoren über weniger Informationen als die Debitoren).ll(' Die Macht der Banken könnte damit als Resultante von zwei Vektoren in ~inem Kräftefeld, das aus Informationsgefallen besteht, begriffen werden. Solche Uberlegungen stecken indessen heute noch immer in den Anfangen. l17 Sie könnten jedoch, da [nformations- und Risikoverarbeitung, Erwartungsbildung und Handeln unter Bedingungen relativer Unsicherheit nicht nur in ökonomischen Entscheidungsprozessen, sondern darüber hinaus in der ganzen Gesellschaft stattfinden, zu einem neuen, demokratisch-
rosaischen Verständnis von Macht und Herrschaft führen. ~Macht» erwcist sich damit als eine komplexe Kategorie. Der historische Exkurs zum Thema Bankenmacht wollte jedoch zeigen, dass es sich um eine Thematik handelt, die sich für wirtschafts- und sozialwissenschaftliehe Analysen als sehr anregend erweist. Voraussetzung ist allerdings, dass eine angemessene wissenschaftliche Problematisierung angestrebt wird. Um dies zu erreichen, ist es wiederum notwendig, das rationale
338 Jakob Tanner
Räsonnement, ohne das die Diskussion innerhalb der Scientific community nicht möglich ist, auch auf die Beziehungen zwischen Macht und Wissen, zwischen Herrschaftsformen und Wissenschaftspraxis auszudehnen.
Allmcrktlllgcll
Aran Raymond: Macht, power, puissance: dcmocratic prosc or dcmoniac poctry, in: Ders.: Power, Modcrnity and Sociology. Selectcd Sodological Wrilings, hg. v. Dominique Schnappe r, Aldcrshot 1988, S. 70-89. Grundlegend für eine sozialwissenschaflliche Analyse des Machtbegriffs sind Weber Max: Soziologische Grundbegriffe, Tübingcn '1984, S . 89 (erstmals 1913); Russell ßertrand: Power: A New Sodal Analysis, London 1938; Arendt Hannah: Macht und GewalI, München 1970; Lukes Steven: Power: A Radical View, Lendon 1974; Duke 18mes T.: Connici ""d Power in Social Life, Provo (Utah) 1975; Luhmann Niklas: Macht, Stultgart 1975; U1lrich Olto: Technik und Herrschaft, Fmnkrurt a. M. 1977.
2 Zur «politischen Mythologie Gimrdet Raoul : Mythes et mythologies politiqucs, Paris 1986; ßlumcnberg Hans: Arbeit am Mythos, Frankfurt a. M. 1979.
3 Vgl. dazu Baumann Zymunt: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Hamburg 1992; zur Rolle der <,vernunft» vgl. auch Gellner Ernes!: Pflug, Schwert und Buch, München 1993, S. 43 ff., und Habennas Jürgen: Faktizität und Geltung, Frankfurt a. M. 1992, S. 17 ff.
4 Siegenthaler Hansjörg: Kapitalbildung und sozialer Wandel in eier Schweiz 1850-1914, in: Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 193, 1978, S. 1-29.
5 Siegenthaler Hansjörg: Entscheidungshorizonte im sozialen Wandel, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte (33) 1983, S. 419.
6 Siegenthaler (wie Anm. 5), S. 420. 7 Vgl. Simon Herbert A.: Homo ra tionalis. Die Vernunft im menschlichen Leben, Frankfurt a. M. 1993. 8 Zur Diskursanalyse vgl. White Hayden: Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen, Stuttgart
1986, S. 7 ff. 9 Girardet (wie Anm. 2), S. 15 f., 18,51.
10 Ebd., S. 52. 11 Girardet erwähnt luden, lesuiten und Freimaurer; mit dem Abflauen des Kulturkampfes rückte das
Bild der weUverschwiirerischen Jesuiten seit dem ausgehenden 19. JahrllUndert in den Hiutergrund. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahmen die ßolschewisten resp. die Marxisten diese Rolle; ßegriffsbildungen wie jene der «freimaurerisch·judeo·bolschewistisch-marxistische Wel1verschwörung» weisen darauf hin.
12 Vgl. Cohn Norman: Die Protokolle der Weisen von Zion. Der Mythos von der jüdischen WeItverschwörung, Köln 1969; Lüthi Urs: Der Mythos von der Wellverschwiirung. Die Hetze der Schweizer Frontisten gegen luden und Freimaurer - am Beispiel des Berner Prozesses um die «Protokolle der Weisen von Zion", Basel 1992.
13 Girardet (wie Anm. 2), S . 26,39. 14 Simmel Georg: Philosophie des Geldes, Frankfurt a. M. 1989, S. 317. 15 «Das Superadditurn des Geldhesilzes ist nichts als eine einzelne Erscheinung dieses, man möchte
sagen, mctaphysischen Wesens des Geldes, dass es über jede Einzelverwendung seiner hinausreicht und, weil es das absolute MiHel ist, die Möglichkeit aller Werte als den Wert aller MögliChkeiten zur Geltung bringt .• Simmel (wie Anm. 14), S. 281.
16 Simmel (wie Anm. 14), S. 276. '17 Ebd., S. 714. 18 Ebd., S. 284; die folgenden Zitate stammen aus S. 284-290. 19 Haverkamp Alfrcd: Lebensbedingungen der Juden im spätmittelallerlichen Deutschland, in: Blasius
Dirk, Diner Dan (Hg.): Zerbrochene Geschichte. Leben und Selbstverständnis der luden in Deutsch
land, Frankfurt a. M. 1991, S. 27. 20 Ich zitiere aus einer an der Universitätsbibliothek Basel zugänglichen, maschinengeschriebenen
«autorisierten Übersetzung»: Dlauner Emil: Volksherrschaft und Geldherrschaft, 1957. 21 Vgl. Scdillot Rene: Les deux cents familles, Paris 1988. Im Second Empire behaupte.t: Georgc
Duchene, das gesamte mobile Kapital Frankreichs würde von 183 Individuen (d. h. Familien) kon
trolliert; Ernest Renan sprach 1848 von «Plutokmtie».
«Macht der Banken"
22 B1atlner (wie Anm. 20), S. 70.
23 Ebd., S. 215 ff.
339
24 Chamberlain Huston Stewart: Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts, Miinchen 1909 (erstmals 1899). 25 Chamberlain Huston Stewarl: Demokratie und Freiheit, 2. Aun., München 1917.
26 Ebd., S. 59. 27 Ebd., S. 65 f. 28 Ebd., S. 70. 29 Feder GOllfried: Das Programm der N. S. D. A. P., 166.-169. Aun., München 1935, S. 19, 20, 21,22,
25. 30 Ebd., S. 27, 25. 31 Ebd ., S.19, 25,28. . .. 32 Schaffner Martin: Die demokr:ltische Bewegung der 1860cr lahre: Beschreibung und Erklarung der
Zürcher Volksbewegung von 1867, Basel 1982. 33 Decurtins Daniela, Grossmann Susi: Die Bedeutung kommunikativer Vernctzung für die Gründung
der Zürcher Kantonalbank 1870, in: Cassis YOllsscf, Tanner l akob (Hg.): Banken und Kredit in der Schweiz. Banqucs et crcdil en Suis.'iC (1850-1930), Zürich 1993, S . 105-128.
34 Thomas Widmer: Die Schweiz in der Waehstumskrisc der 1880er lahre, Zürich 1992, S. 129, vgl. vor allem Kap. 6.2: «Die Kritik 3m Finanzkapitalismus», S. 133 ff.
35 Zil. nach Widmer (wie Anm. 34), S. 712 bzw. 134; die Ausdrücke stammen aus den heginnenden
1880er Jahren. 36 Eberle Karl: Soda I-politische Fragen der Gegenwart, beantwortet im Sinne und nach den Aussprüchen
bewährter wissenschaftlicher Auctoritäten, Stans 1889, S. 97. 37 Mitchell Neill.: The Generous Corporation. A Political Analysis of Economic Power, New Haven
1989, S. 86, 89, 100; die Machtkritik des Progressive Movement.wurde in der Weltwirtschaflsk~ise der 1930er lahre aktualisiert. Vgl. die von Adolf A. Berle und GardIner C. Means verfasste, 1932 In New York veröffentlichte Studie «The Modern Corporat!on and Private Properly». D!e Autor~n wiesen i~ der US-Wirtschaft einen extrem hohen Konzentrallonsgrad nach und argumentIerten, dIe Macht seI unwiederbringlich auf die Unternehmensführungen übergegangen.
38 Widmer (wie Anm. 34), S. 689. 39 Perroux Fran~ois : Wirtschaft und Macht, Bern 1983, S. 25.
40 Ebd. " "k . h 41 G Ib 'th John K.: Die Entmythologisierung der Wirtschaft. Grundvomussetzungen 0 'onomlsc cn
D:nk~~S, Wien 1988, S. 14"1, vgl. auch, S. 342. Galbraith h.at sich in seit.ler Theorie der «countervailing power» auf anregende Weise mit dem Machtproblem In demokratisch verfassten Gesellschaften
auseinandergesetz1. . . , . 42 Bartlc1t RandalI: Economics and Power. An InqUlry IOta human relatIOns and markets, Cambndge
1989, S. 4.
43 Ebd., S. 3. . .. N kl 'k 44 Bei der Neoklassik handelt es sie.h um die Weiterentwi~klu~g der klassls~he? Theone. Die co aSsl
ist durch das Marginalkalkül (Ubergang von der ob~e~tlven zur subjektIven Wertlehr~) und den zentralen Stellenwert des Allokationsaspektes charaktenslert. In.den.1950er ~ahrcn ~urde elll~ ,,~rosse Neoklassische Synthese» angestrebt, welche die «marginale» Mlkrookonomlk und dIe keyn~sJaOlsch~n Makroökonomie zu verbinden beabsichtigte. Auf dieser theoretischen Grundlage wurde eme Thcone des allgemeinen Gleichgewichts, in Anlehnun~ an ~hre Er~nder « Arr?w-~eb~eu-Wet~bewerbsgleichgewicht» genannt, entwickelt. Vgl. Ilell DaOlel, KnstollrvlOg (Hg.): DIe Knsc Iß der WIrtschafts
theorie, Berlin 1984, S. IX. 45 Pcrroux (wie Anm. 39). 46 Um den nichtintentionaleil Charakter des Vorgangs zu hetonen, wäre der Begriff «AusblendungseITckte»
angemessener. . ..' . ... . 47 Keine «Macht» he isst auch, dnss keine Akteure die Fahlgkelt ~ur «Surpl~sabsch.opfung» (:-Vle ~Ie von
Ricardo und Marx unterstellt wurde) haben. Ocr neoklasslsch~n Glelchgewlchtstheone, die von Aliokationsüberiegullgen ausgeht, liegt diese «no surplus»-Bedlllgung zugrunde. Vgl. dazu Hahn F' k: Die allgemeine Gleichgewichtstheorie, in: Bell/Kristol (wie Anm. 44), S. 163.
48 B~a~\el1 (wie Anm. 42), S. IX, bcmerkt dazu: «Thc instit~tional struetures of the real world, and of its markets, are fare rieher 1lnd more complex than the mythlcal ones of the abstmct models.»
49 Alle Zitate aus Perraux (wie Anm. 39), S. 30-33. 50 1902 publizierte J. A. Hobson seine: s~wohl. f~ir Hilferd~~g wie .auch fü: Lenin wegweise.nde
Imperialismustheorie, die die damals SIch Ißtenst:'IJ~ rende Kntlk an wlr1schafthcher Macht analytIsch zu verliefen versuchte. Vgl. Hobsan 1. 11.: Impenaltsm: A Study, Ann Arbor 1971 (Nachdr., erstmals
340 Jakob Tanner
1902); Lenin W, 1.: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: W, I. Lenin, Ausgewählte Werke, Bd. lll, Berlin 1970, S. 763-873 (erstmals Petrograd 1917),
51 Noch 1980 sollte Reinhard H. Schmielt die Frage stellen: «Kann man Ober die <Macht der BankeIl> wissenschaftlich Reden?», in: Reber Gerharel (Hg,), Macht in Organisationen, Stuttgart 1980, S,283-299,
52 Vgl. Claudio Napoleoni, Ricardo und Marx, hg, v, Cristina Pennavaja, Frankfurt a. M. 1974, S. 64, 123. 53 Hilferding Rudolf: Das Finanzkapital, 2 Bele., Frankfurt a. M, 1973, S. 507,
54 Ebd" S, 456, 55 Ebd., S. 458. 56 Zur Auseinandersetzung mit Hilferdings Ansatz im speziellen Vgl. Wellhöner Volker, Grossbanken
und Grossindustrie im Kaiserreich, Göttingen 1989, S. 11 ff. 57 Hilferding (wie Anm. 53), S. 503, 58 Ebd" S. 507, 59 Siegenthaler Hansjörg: Die Rede von der Kontinuität in der Diskontinuität des sozialen Wandels - das
Beispiel der dreissiger Jahre, in: Brändli Sebastian et al.: Schweiz im Wandel, Basel 1990, S. 420. 60 Bönziger Hugo: Die Entwicklung der Bankaufsicht·in der Schweiz seit dem 19, Jahrhundert, Bern
1986. 61 Scheiben Oskar: Krise und Integration, Wandlungen in den politischen Konzeptionen der Sozial·
demokratischen Partei der Schweiz 1928-1936. Ein Beitrag zur Refurmismusdcbatte, Zürich 1987, 62 Giovanoli Fritz: Wirtschaft, Tantieme und Verwaltungsrat eier Schweizerischen Aktiengesellschaften,
SGB-Materialiensammlung, Nr, 5, März 1931, S, 14, In diesem Zusammenhang interessant ist auch die Studie von Macb.ch Fritz: Kartelle, Trusts und Sozialwirtschaft, Bern 1932.
63 Giovanoli Fritz: [m Schatten des Finanzkapitals, hg, v, der SPS, Zürich 1938, S. 3. Eine Fortsetzung der Analysen Giuvanolis leistete Pollux: Trusts in der Schweiz. Die schweizerische Politik im Schlepp· tau der Hochfinanz, Zürich 1944.
64 Giovanoli (wie Anm, 63), S, 5, 65 Ebd., S. 5. 66 Ebd., S, 6, 67 Ebd., S. 20. 68 Die Front, 2. Jg., Nr, 42, 20. 4. 1933. 69 Die Front, L Jg., Nr, 25, 21. 11. 1933. 70 Vgl. dazu: link jürgen: Noch einmal: Diskurs. interdiskurs, macht, in: kultuRRevolution, Nr. 11,
februar 1986, S, 4-7. 71 Der «menschliche Motor» als primum movens der ganzen industriellen Produktionsmaschinerie: Das
ist eine kulturell tiefsitzende Vorstellung, die erst mit der Automatisierungsdebatte und dem Tertiarisierungstrend seit den 1950er Jahren im Gleichschritt mit einem ökonomischen Internationali· sierungsschub aufgeweicht wurde. VgL dazu Rabinbach Anson: Tbc Human Motor. Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity, Berkeley 1992.
72 Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der sowjetischen und der osteuropäischen Zentralverwaltungswirtschaften basierte bis zu ihrem Zusammenbruch im wesentlichen auf einem restriktiven MaterialProdukt-Konzept, das die Vorstellung einer gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion zurückwies und einer handfesten Vorstellung des «wirklichen Reichtums» verpflichtet blieb.
73 Marx Karl: Das Kapital, Bd. ur, MEW, Bd. 25, Berlin 1973, S. 457. 74 Feder Gottfried: Kampf gegen die Hochfinanz, München 1933; ders.: Das Programm der N. S. D. A. P.
und seine weltanschaulichen Grundgedanken, München 1930, S. 44, 75 Die «Freigeldler», die ebenfalls mit «Zinsknechtschaft»-Parolen operierten und deren Hauptforderung
die Abschaffung des Zinses und die Errichtung einer «natürlichen Wirtschaftsordnung» war, wiesen politisch starke Affinitäten zur keynesianischen Linken und zur Genossenschaftsbewegung auf. Vgl. Gesell Silvio: Die Natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, Les Hauts Geneveys 1916 (= gesammelte Werke, Bd. 9, Lütjenburg 1991).
76 Die Front, 1. Jg., Nr, 35, 27. 12. 1933. 77 Giovanoli (wie Anm, 63), S. 26. 78 Die Front, 1. Jg., Nr. 26, 24,12.1933. 79 Ebd., Nt. 1,29.8.1933 (Robert Tobler) 80 Ebd" Nr. 29,5. 12. 1933, 81 Vgl. für die Kriegsjahre auch Pollux (wie Anm. 63). 82 Die Neue Schweiz, hg. v, der SPS, Zürich 1942, 83 SalisJean Rodolphe von: Die Schweiz im Kalten Krieg, in: Schwierige Schweiz. Beiträge zu Gegenwarts
fragen, Frankfurt a, M. 1968, S, 197, vgl. vor allem S. 188. Der Text entstand im Jahre 1961.
«Macht der Banken» 341
84 Eine geraffte Zusammenfassung der Theorie des «staatsmonopolistischen Kapitalismus» findet sich in Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. Klaus Georg, Buhr Manfrcd, Rcinbek 1972 (Erstausgabe 1964), Bd. 2, S. 554 f, (Zitate aus diesem Text).
85 Muthesius Volkmar: Das Gespenst der wirtschaftlichen Macht, Frankfurt a. M. 1960, S. 9.
86 Ebd., S, 10, 13, 87 Luke, Steven: Panoptikum. Macht und Herrschaft bei Weber, Marx und Foucault, in: Kursbuch (70)
1982, S, 135-148. 88 Vgl. Luhmann Niklas: Macht, Stllttgart 1975; Friedberg Erhard: Macht und Organisation, in: Reber
(wie Anm. 51). 89 Luhmann (wie Anm. 88), S. 90. 90 Friedberg (wie Anm. 88), S, 124, 91 Krüger Wilfried: Unternehmungsprozess und Operationalisierung von Macht, in: Reber (wie Anm. 51),
S.236. 92 Siegenthalcr (wie Anm. 5), S, 429; vgl. auch Kilgus Ernst: Die Grossbanken, eine Analyse untcr dem
Aspekt von Macht und Recht, in: Kägi Wemer, Siegenthalcr Hansjörg(Hg.): Macht und ihre Begrenzung im Kleinstaat Schweiz, Zürich 1981, S. 191-210.
93 Luhmann (wie Anm. 88), S. 104, 94 Arndt Helmut: Wirtschaftliche Macht: Tatsachen und Theorien, München 1980, 95 Für die Schweiz vgl. etwa Schuster Leo: Macht und Moral der Banken, Bern 1977; Kilgus (wie
Anm.92), 96 Vgl. ZeIger Josef: Konzepte zur Messung der Macht, Berlin 1975. 97 Albach Horst: Finanzkraft und Marktbeherrschung, Tübingcn 1981, S. 9.
98 V gL ebd., S. 6 ff, . 99 Bericht des bundesrcpublikanischen Wirtschaftsausschusses des Bundestages vom 12.6. 1973, Zlt. nach
100 101
102 103
104 105 106 107
]08
109 110 111 112 113
114 115
116
117
Albach (wie Anm, 97), S. 39 f. Ebd., S. 107, Vgl. dazu die differenzierte Darstellung in Moesch Irene, Simmcrt Diethard B,: Banken, Strukturen,
Macht, Reformen, Köln 1976. Wallerstein Immanuel: The capitalist world economy, Essys, Cambridge 1983, VgL insbesondere Strahm Rudolf [I,; Überentwicklung - Unterentwicklung, Nürnberg 1975; Haymoz
Urs: Finanzplatz Schweiz und Dritte Welt, Basel 1978.
Moesch (wie Anm. 101), S, 68. "" Mabillard Max, de Weck Roger: Scandale au Credu SUisse, Geneve 1977. Finanzplatz gegen Werkplatz; Dossier SPS/PSS, Bern 1978, Glasberg Davita Silfen: Thc Power of Collective Purse Strings. The Effects of Bank Hegemony of
Corporations and the State, Berkcley 1989.
Ebd" S. 2,181. Ebd., S. 3, 182, Ebd., Kap. 7: The Social Construction ofEconomic and Political Reality, S. 181 Cf.
Ebd., S, 182 f. Foucault Michel: Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen, Frankfurt a. M. 1977, S, 113 ff, Einen interessanten Ansatz verfolgen Aglietta Michel, Orleans Andre: La violence d. la monnaie,
Paris 1984, Vgl. zusammenfassend Si mon (wie Anm, 7). . . " , Baeckcr Dirk: Womit handeln Banken? Eine Untersuchung zur RISIkoverarbeitung 10 der Wirtschaft,
Frankfurta. M, 1991, S.13,52. Vgl. Leeland Hyne E" Pyle David H.: Informational Asymmetries, Fin~ncial Structure, and Financial Intermediation, in: Journal of Finance (32) 1977, S. 371-387; Maccnmmon Kenncth R" Wchrung Donald A.: Taking Risks: The Management of Unccrtainty, New York 1986. Vgl. Tilly Richard: Banken und industrielle Entwicklung, Ms., 1991.