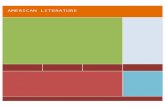»Wir sind viele«. Zum Konzept dichterischer Kollektivrede bei Goethe, Ralph Waldo Emerson und Walt...
Transcript of »Wir sind viele«. Zum Konzept dichterischer Kollektivrede bei Goethe, Ralph Waldo Emerson und Walt...
COMPARATIOZeitschrift
für Vergleichende Literatur-
wissenschaft
Herausgegeben von
linda simonis
annette simonis
kirsten dickhaut
Wissenschaftlicher Beirat
elena agazzi (Bergamo)
michael bernsen (Bonn)
andreas beyer (Paris)
michel espagne (Paris)
andreas gelz (Freiburg) achim hölter (Wien)
barbara kuhn (Eichstätt)
jörn steigerwald (Bochum)
alain viala (Oxford)
julia zernack (Frankfurt a.M.)
rüdiger zymner (Wuppertal)
UniversitätsverlagwinterHeidelberg
pers
onal
isie
rter
Son
derd
ruck
/ pe
rson
aliz
ed o
ffprin
t for
OR
DE
R-I
D W
V-2
015-
0003
32, e
rste
llt a
m /
crea
ted
30.1
1.20
15
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Band 5 (2013), Heft 2, Seiten 181-203
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
BeitragSina, Kai‚Wir sind viele‘. Zum Konzept dichterischer Kollektivrede beiGoethe, Ralph Waldo Emerson und Walt Whitman
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
herausgeber
Prof. Dr. Linda SimonisRuhr-Universität Bochum, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Germanistisches Institut, Universitätsstr. 150, 44780 Bochum
Prof. Dr. Annette Simonis Justus-Liebig-Universität Gießen, Allgemeine und Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft und Neuere deutsche Literatur-wissenschaft, Otto-Behaghel-Straße 10 G, 35394 Gießen
Privatdozentin Dr. Kirsten Dickhaut
Justus-Liebig-Universität Gießen, Karl-Glöckner-Str., 35394 Gießen
Die für COMPARATIO bestimmten Manuskripte sind an einen der obengenannten Herausgeber zu senden. Für die Einrichtung der Manuskripte ist ein Merkblatt maßgebend, das bei der Redaktion erhältlich ist. Keine Gewähr für Postverluste.Die Autoren erhalten für Beiträge 25 Sonderdrucke. Honorar wird nicht gezahlt.
Besprechungsexemplare nur an Frau Prof. Dr. Linda Simonis, Ruhr-Universität Bochum, Allgemeine und Vergleichende Literatur-wissenschaft, Germanistisches Institut, 44780 Bochum.
Die Herausgeber sind nicht verpflichtet, Besprechungen nichtver-langt zugesandter Bücher zu veröffentlichen. Die bibliographischen Angaben sind ohne Gewähr. Eingesandte Artikel und Bücher werden im allgemeinen nicht zurückgesandt.
erscheinungsweise: 2 Hefte jährlich mit einem Gesamtumfang von ca. 360 Seiten.
bezugspreise: Jahresabonnement � 66,– zzgl. Versandkosten. Einzelheft � 39,–.
Abbestellungen mit einmonatiger Kündigungsfrist zum Jahresende.
Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verlag.
issn 1867-7762
Printed in Germany.Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg,Postfach 106140, D-69051 HeidelbergSatz: Yvonne JoeresDruck: Memminger MedienCentrum, D-87700 Memmingen
Inhaltsverzeichnis
BEITRÄGE
KAI SINA (Göttingen)
‚Wir sind viele‘. Zum Konzept dichterischer Kollektivrede bei Goethe, Ralph Waldo Emerson und Walt Whitman 181
FRANZISKA HUMPHREYS (München – Paris)
Die graue Arbeit des Diskurses. Überlegungen zu einer Literaturgeschichtsschreibung mit und bei Michel Foucault 205
THIBAUT CHAIX-BRYAN (Paris)
D’une langue à l’autre. Auto-traduction et décentrement 223
MARTINA KOPF (Mainz)
‘In the Land of Chimeras’. The Rousseauian Alpine Landscape and its Making 233
ANDREAS MAHLER (Berlin)
Joyce’s Bovarysm. Paradigmatic disenchantment into syntagmatic progression 249
VERMISCHTE BEITRÄGE
VÉRONIQUE GÉLY (Paris)
Hypatie (Ὑπατία). Une figure féminine emblématique des usages modernes de l’Antiquité 297
MICHAEL DALLAPIAZZA (Urbino) UND ANNETTE
SIMONIS (Gießen)
Romulus Augustulus. Überraschendes ‚Nachleben‘ des ‚letzten Römers‘ in Moderne und Gegenwart 307
THOMAS EDELING UND NINA LANGE (Gießen)
Bewegte Zeiten. Über (im-)mobile Körperräume in Paul Morands Roman L’homme pressé 319
JÜRGEN VON STACKELBERG (Göttingen)
Bettinellis ‚Völkerkunde‘. Zur ‚Imagologie‘ der Lettere Inglesi von 1766 333
BESPRECHUNGEN
Steffen Schneider: Kosmos, Seele, Text. Formen der
Partizipation und ihre literarische Vermittlung:
Ficino, Ronsard, Bruno (Linda Simonis) 341
Hans Feger (Hg.): Handbuch Literatur und
Philosophie (Bernhard Stricker) 343 Anja Ernst / Paul Geyer (Hg.): Die Romantik: ein
Gründungsmythos der Europäischen Moderne (Bernhard Stricker) 345 Helmut J. Schneider: Genealogie und
Menschheitsfamilie. (Kristina Bonsignore) 348 Jürgen Lüsebrink / York-Gothart Mix (Hg.): Französische Almanachkultur im deutschen
Sprachraum (1700–1815) (Annette Simonis) 350 Roman Lach: Der maskierte Eros: Liebesbrief-
wechsel im realistischen Zeitalter (Linda Simonis) 353 Dieter Lamping (Hg.): Handbuch Lyrik.
Theorie, Analyse, Geschichte (Annette Simonis) 356 Monika Schmitz-Emans: Literatur-Comics
(Laura Muth) 358
KAI SINA (GÖTTINGEN)
‚Wir sind viele‘ Zum Konzept dichterischer Kollektivrede bei Goethe, Ralph Waldo Emerson
und Walt Whitman
L’article présent s’interroge sur la relation de Walt Whitman à Goethe. Plus précisément, il pose la question de savoir dans quelle mesure la conception poétique de Goethe a concrètement influé sur les notions de la poésie et de l’auteur proposées par Whitman. Dans le cadre de cette investigation, nous prêtons une attention particulière au concept du discours poétique collectif esquissé dans les remar-ques autoréflexives de l’œuvre tardif de Goethe et adapté par Whitman dans son poème poétologique « Song of Myself ». Sur le fond de ces observations, nous explorons les implications plus vastes de la relation poétique en question pour y découvrir les germes d’un paradigme de réception poétique se poursuivant jusqu’à présent. Ainsi, notre étude ne se borne pas à analyser l’influence d’un auteur sur un autre, mais elle présente une enquête comparatiste à plus grande échelle sur des relations littéraires américo-allemandes. The following article explores in how far and to what extent Johann Wolfgang Goethe has influenced Walt Whitman’s poetic concepts, notably his notion of authorship. The investigation focuses on the concept of poetic language as a form of collective speech, as it is conceived of and amplified in the late self-characterizations and -commentaries of Goethe as well as in Whitman’s poetological, self-reflective poem “Song of Myself”. On the basis of these insights, the further consequences and wider implications of the poetic relationship in question – in which the writings of Ralph Waldo Emerson function as a principal mediator – can be assessed. Insofar this study does not only aim at an investiga-tion into the influences between singular author personalities, but also provides a comparative study of the German-American literary relationships.
I.
So intensiv die Forschung sich mit der Frage nach der Rezeption Walt Whit-mans in der deutschsprachigen Literatur und Kultur befasst hat (weiterhin ein-schlägig ist hier vor allem die wegweisende Studie von Walter Grünzweig),1 so unzusammenhängend und nur oberflächlich ist bislang in umgekehrter Blick-
* Hervorgegangen ist dieser Aufsatz aus einem Vortrag, den ich auf der Göttinger Unitaris-
mus-Konferenz „Von Ralph Waldo Emerson zu Albert Schweitzer – Geschichte und Zu-kunft liberaler Religion in Deutschland“ (Oktober 2012) halten durfte (Organisation: Hein-rich Detering, Göttingen; Dan McKanan, Cambridge, MA; Rev. Eric Hausman, Charlotte). Für Hinweise und Anregungen in unterschiedlichen Entstehungsphasen dieses Textes dan-ke ich Heinrich Detering (Göttingen), Claudia Hillebrandt (Jena), Christoph Jürgensen (Wuppertal), Frank Kelleter (Göttingen/Berlin) und Tom Kindt (Jena).
1 Walter Grünzweig: Walt Whitmann [sic!]. Die deutschsprachige Rezeption als interkultu-relles Phänomen. München 1991.
pers
onal
isie
rter
Son
derd
ruck
/ pe
rson
aliz
ed o
ffprin
t for
OR
DE
R-I
D W
V-2
015-
0003
32, e
rste
llt a
m /
crea
ted
30.1
1.20
15
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kai Sina
182
richtung die Rezeption der deutschsprachigen Dichtung und Philosophie durch Whitman untersucht worden. Wenngleich Floyd Stovall in seiner bereits 1974 veröffentlichten Studie The Foreground of „Leaves of Grass“ mit Nachdruck auf den hohen Stellenwert u.a. von Herder und Hegel, Goethe und Heine für Whitman hingewiesen hat2 – eine systematische und differenzierte Unter-suchung dieser Einflussbeziehungen muss bis heute als Desiderat gelten (was nicht zuletzt auf eine recht diffuse Quellengrundlage zurückzuführen sein mag). Näher umreißen lässt sich diese Schwachstelle der Whitman-Forschung an-hand eines einschlägigen Autoren-Handbuchs; so weist das von J. R. LeMaster und Donald D. Kummings besorgte, 1998 erstmals unter dem Titel Walt Whit-man. An Encyclopedia erschienene und 2011 als Routledge Encyclopedia of Walt Whitman neuaufgelegte Kompendium zwar zu jedem der hier beispielhaft genannten Personen einen kurzen Eintrag auf – und stützt somit Floyd Stovalls allgemeine Relevanzbehauptung –,3 ohne aber den jeweiligen Einfluss auf das Denken und Schreiben Whitmans wirklich präzise benennen zu können. Dass die den Einträgen angefügten Literaturlisten auf keine oder nur vereinzelte und zudem recht alte Beiträge verweisen,4 stützt den Verdacht eines weitgehenden Desinteresses der bisherigen Forschung an einem zwar als wichtig erachteten, aber dennoch nie eingehender analysierten ,deutschen Hintergrund‘ des Ameri-kaners Walt Whitman. Dieses Desiderat kann und soll an dieser Stelle nicht in Gänze behoben wer-den. Vielmehr will ich den Blick auf jenen Protagonisten des deutschen Geistes-
2 Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’, Charlottesville 1974, darin die Ab-
schnitte S. 129–137 (zu Goethe), S. 184–204 (zu den deutschen Philosophen) und S. 222–230 (zu Heine).
3 Vgl. mit Blick auf die genannten Autoren die jeweils recht kurzen Artikel von Mark Bau-erlein (zu Hegel, S. 271 f.), Walter Grünzweig (zu Heine, S. 272 f., und Herder, S. 273) und Phillip H. Round (zu Goethe, S. 256) in J. R. LeMaster, Donald D. Kummings (Hg.): The Routledge Encyclopedia of Walt Whitman, New York, London 2011.
4 Zu Heine siehe: Russell A. Berman: „Poetry for the Republic. Heine and Whitman“, in: Peter Uwe Hohendahl, Sander L. Gilman (Hg.): Heine and the Occident. Multiple Identi-ties, multiple Receptions, Lincoln 1991, S. 199–223; zu Herder siehe Gene Bluestein: „The Advantages of Barbarism: Herder and Whitman’s Nationalism“, in: Journal of the History of Ideas 24, 1 (1963), S. 115–126; Kurt Müller-Vollmer: „Herder and the Formation of an American National Consciousness during the Early Republic“, in: Ders. (Hg.): Herder To-day. Contributions from the International Herder Conference, Nov. 5–8, 1987, Stanford, California. Berlin, New York 1990, S. 415–430; im Goethe-Beitrag wird pauschal hinge-wiesen auf Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’ [o.S., i.e. S. 129–137]; zu Hegel findet sich keine Angabe eines themenspezifischen Artikels; verwiesen wird statt-dessen auf jene Studien, die sich mit den einschlägigen Quellen Whitmans befassen (nach-gewiesen ist, dass sich Whitman sowohl auf F. H. Hedges Prose Writers of Germany, 1848, als auch auf Joseph Gostwicks German Literature, 1854, bezieht, die beide Zusam-menfassungen des Hegel’schen Denkens inkludieren). In sämtlichen Beiträgen der Rout-ledge Encyclopedia wird zudem verwiesen auf die Grundlagenstudie von Henry A. Poch-mann: German Culture in America. Philosophical and Literary Influences, 1600–1900, Madison 1957.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
183
lebens richten, dessen Werk Whitman nicht nur nachweislich kannte, sondern dessen Ideen zudem grundlegende Folgen für die poetologische Konzeption der Gedichtsammlung Leaves of Grass einschließlich des ihr eingeschriebenen Au-torschaftskonzepts nach sich zogen – nämlich Goethe.
II. Dabei erscheint die Frage nach Whitmans Auseinandersetzung mit Goethe, nach einem konkreten Einfluss auf Whitmans Denken und Dichtung gar, auf den ers-ten Blick alles andere als naheliegend. Befragt nach seiner Haltung gegenüber Goethe, äußerte Whitman immer wieder grundlegende Skepsis, ja auch un-verhohlene Ablehnung. Unmissverständlich zum Ausdruck kommt dies in einer nachgelassenen Notiz, die auf den 18. Februar 1856 datiert:
There is one point of the Goethean philosophy which without appeal and forever inca-pacitates it from suiting America or the forthcoming years;—It is the cardinal Goethean doctrine too, that the artist or poet is to live in art or poetry alone apart from affairs, politics, facts, vulgar life, persons, and things—seeking his „high ideal.“5
Nach einigen weiteren, ähnlich kritischen Anmerkungen zu Goethe und dessen Kunst- und Literaturauffassung, deren (angeblich) einsinniger Individualismus in einem unaufhebbaren Widerspruch zur geistigen Verfassung der ‚neuen Welt‘ gesehen wird, verhängt Whitman vier Tage später, am 22. Februar, sein ver-meintlich letztgültiges Urteil; aus seiner Formulierung spricht das selbstbewuss-te Distinktions- und Emanzipationsbestreben des jungen Amerika gegenüber der ‚alten Welt‘ mit ihrem Geistesleben: „To the genius of America he [Goethe; K.S.] is neither dear nor the reverse of dear. He passes with the general crowd upon whom the American glance descends with indifference. ― Our road is our own.“6 5 Walt Whitman: Notebooks and Unpublished Prose Manuscripts, hg. von Edward F. Grier,
New York 1984, Volume V: Notes, S. 1826. 6 Ebd., S. 1828. Vgl. zu Whitmans Goethe-Bild auch eine späte Gesprächsnotiz, in der Whit-
man zwar das Bildungskonzept Goethes durchaus bewundernd anerkennt, um es jedoch gleich darauf – erneut – wegen seiner exklusiven Ausrichtung auf das ‚Ich‘ zu verwerfen: „W[hitman] himself spoke of Goethe. [...] ‚Goethe impresses me as above all to stand for essential literature, art, life ― to argue the importance of centering life in self ― in perfect persons ― perfect you, me: to force the real into the abstract ideal: to make himself, Goethe, the supremest example of personal identity: everything making for it: in us, in Goethe: every man repeating the same experience.‘ Goethe would ask: ‚What are your forty, fifty, hundred, social, national, phantasms? This only is real ― this person.‘ [...]‚Goethe seemed to look upon personal development as an end in itself: the old teachers looked for collective results. I do not mean that Goethe was immoral, bad ― only that he laid stress upon another point. Goethe was for beauty, erudition, knowledge ― first of all for culture. I doubt if another imaginist of the first order in all literature, all history, so deeply put his stamp there. Goethe asked ‚What do you make out of your patriotism, army,
Kai Sina
184
Die umfangreiche, in Gänze kaum noch überschaubare Whitman-Forschung hat sich mit dieser Zurückweisung, soweit ich sehe, bislang weitgehend zufrieden gegeben – und dies hat auf den ersten Blick durchaus seine Berechtigung. Denn in der Tat lassen sich die Vorstellungen einer ausschließlich auf die Kunst und den Künstler bezogenen Lebensform, die Goethe hier – in entstellender Verein-fachung – zugeschrieben wird, mit Whitmans Poetik nicht vereinbaren; für den ‚wahren‘ Künstler gelte schließlich vielmehr, wie Whitman im Jahr 1888 in ei-nem Vorwort zu einer erneuten Auflage seiner Leaves of Grass betont, „what Herder taught to the young Goethe, that really great poetry is always (like the Homeric or Biblical canticles) the result of a national spirit, and not the privilege of a polish’d and select few [...].“7 Folgt man darüber hinaus der bisweilen grel-len Stilisierung Whitmans zum „nationale[n] Kosmos“,8 dessen herausgehobene Stellung sich ausschließlich im Kontext der amerikanischen Kultur in ihrem Streben nach Unabhängigkeit von europäischen Vorbildern entfaltet, so liegt es zunächst denkbar fern, ausgerechnet in Weimar nach möglichen Einflüssen, vielleicht gar Wurzeln seiner Poetik zu suchen. Nun ist Whitmans Bemerkung, er habe zwar eine Meinung zu Goethe, wisse aber so gut wie nichts über ihn,9 im Lichte der Forschung mit Nachdruck zu-rückzuweisen. Schon Stovall stellt hierzu fest, Whitmans Interesse an Goethe habe zwischen 1846 und seinem Tod im Jahr 1892 zu keinem Zeitpunkt wirklich nachgelassen.10 Der Beginn dieser fast vierzigjährigen Beschäftigung mit Goe-the lässt sich für Stovall dergestalt klar datieren, weil Whitman in diesem sowie in dem darauf folgenden Jahr die von Parke Godwin übersetzte Autobiography of Goethe. Truth and Poetry: From my Life (Band 1 und 2 erschienen 1846, Band 3 und 4 erschienen 1847) las und ihr sogar zwei kurze und durchaus be-geisterte Besprechungen im Brooklyn Daily Eagle widmete („the simple easy truthful narrative of the existence and experience of a man of genius“).11 Außer-
state, people?‘ It was all nothing to him.‘“ Horace Traubel: With Walt Whitman in Cam-den, Volume Three: November 1, 1888 – January 20, 1889, New York 1914, S. 159 f.
7 Walt Whitman: „A Backward Glance O’er Travel’d Roads“, in: Ders.: Leaves of Grass and Other Writings. An expanded and revised edition based on the Norton Critical Edition […], hg. von Michael Moon. New York, London 2002, S. 471–484, hier S. 484. Fortan zi-tiere ich aus dieser Ausgabe mit der Sigle CE.
8 So das seither vielfach fortgeschriebene ‚Label‘ dieses Autors; vgl. beispielhaft Rolf Geis-ler: [Art.] „Whitman, Leaves of Grass“, in: Walter Jens (Hg.): Kindlers Neues Literatur-lexikon. München 1998, Bd. 17, S. 611 ff., hier S. 612.
9 Das entsprechende Zitat findet sich im oben angegebenen Gespräch mit Traubel: „W[hitman] stopped and laughed. ‚So you see I have an opinion while I confess I know nothing about Goethe.‘“ (Horace Traubel: With Walt Whitman in Camden, S. 160).
10 Vgl. Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’, S. 129–137, hier S. 132. 11 Beide abgedruckt in The Uncollected Poetry and Prose of Walt Whitman, hg. von Emory
Holloway. Garden City, N.Y., Toronto 1921, Bd. 1, S. 132 und S. 139 ff., hier: S. 140. Die Besprechung des ersten Bandes nimmt in Holloways Edition – mit umfangreicher Erläute-rung der Herausgeberin in der Fußnote – nur knapp eine Druckseite in Anspruch, während
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
185
dem befasste sich Whitman nachweislich – wahrscheinlich im Jahr 1857, mögli-cherweise aber auch schon früher – mit Thomas Carlyles Critical and Miscella-neous Essays (erstmals publiziert 1838–39, dann erneut in einem Einzelband im Jahr 1845), von denen sich allein sechs Stücke mit Goethe befassen.12 Nicht zu-letzt bestätigen zahlreiche Notizen auf unterschiedlichen Papieren im hand-schriftlichen Nachlass Whitmans fortwährendes Interesse an Goethe.13 Doch so langanhaltend und nachdrücklich sich die Auseinandersetzung Whitmans mit Goethe aus der Perspektive der Philologie auch ausnimmt – in letzter Konsequenz lief sie scheinbar bloß auf jene eingangs umrissene harsche und zudem oberflächliche Abgrenzung hinaus, die auf lange Sicht dazu führte, dass mögliche Beziehungen im Denken und Schreiben Whitmans und Goethes kaum in den Fokus der Forschung geraten sind.14 Dabei hätte schon die betonte Ausdrücklichkeit in Whitmans Abgrenzung aufhorchen lassen können, vielleicht müssen: Warum markiert Whitman über-haupt eine so dezidierte Distanznahme, wenn Goethe doch in einer allgemeinen Masse von Dichtern untergehe, „upon whom the American glance descends with indifference“? Schon die bloße Artikulation dieses Satzes verfängt sich in einem Widerspruch. Doch damit der Merkwürdigkeit nicht genug. Richtet man den Blick außerdem auf Whitmans Poetik im engeren Sinne, so lässt sich eine litera-turgeschichtlich bedeutsame, von der bisherigen Forschung allerdings nicht an-gemessen gewürdigte, ja nicht einmal ausdrücklich benannte Überschneidung mit dem dichterischen Selbstverständnis Goethes bestimmen, die Whitmans Au-torschafts- und Dichtungsprogramm nicht nur berührt, sondern möglicherweise im Kern bestimmt hat: Es handelt sich um die Idee vom Autor als einem Medi-um, in dessen einer Stimme sich die Stimmen vieler Menschen bündeln und zum Ausdruck bringen. „[M]ein Lebenswerk ist das eines Kollektivwesens, und dies Werk trägt den Namen Goethe“,15 so bekennt der Weimarer Dichter kurz vor seinem Ableben in einem Gespräch; etwas mehr als zwei Jahrzehnte später wird sich Whitman in seinem berühmten „Song of Myself“, der in der Erstfas-sung den noch deutlicher referenzialisierenden Titel „Poem of Walt Whitman, an American“ trägt, folgendermaßen selbst charakterisieren: „I am large, I con-
die Besprechung des zweiten Bandes nur sieben Druckzeilen umfasst. Ich werde auf diese Besprechung im Folgenden noch eingehen.
12 Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’, S. 132. 13 Ebd., S. 133 f. 14 Soweit ich sehe, gibt einzig Floyd Stovall (The Foreground of ‘Leaves of Grass’, S. 129)
einen Hinweis in diese Richtung, wenn er schreibt, Goethes Autobiographie habe „the con-ception“ wenn nicht gar „the composition“ der Leaves bestimmt.
15 Johann Wolfgang Goethe: Die letzten Jahre. Briefe, Tagebücher und Gespräche von 1823 bis zu Goethes Tod. Teil III: Vom Dornburger Aufenthalt 1828 bis zum Tode, hg. von Horst Fleig, Frankfurt a. M. 1993, S. 521 f.
Kai Sina
186
tain multitudes.“16 Mitnichten handelt es sich hierbei – so die Leitthese meines Artikels – um eine nur akzidentelle, punktuelle Kongruenz zweier poetologi-scher Konzepte. Vielmehr liegt es nahe, von einem konkreten Einfluss Goethes auf Whitman auszugehen, der sich indessen nicht über eine direkte Lektüre voll-zog, sondern im Rahmen einer vermittelten Rezeption. Ralph Waldo Emersons Essays las Whitman erstmals im Sommer 1854,17 und er stellte später über seine Lektüre fest, erst durch sie habe er zu sich gefun-den: „I was simmering, simmering, simmering; Emerson brought me to a boil.“18 Als mögliche Impulse für die parallel zu diesen Lektüren entstehenden und ein Jahr später in ihrer Erstfassung publizierten Leaves of Grass werden in der Forschung unterschiedliche Essays Emersons diskutiert, allen voran „The Poet“ (1844).19 Aber auch Emersons Essaysammlung Representative Men (1850), die eine Reihe von ‚Lectures‘ in Buchform versammelt, wird als eine mögliche Inspirationsquelle Whitmans genannt,20 und das letzte Kapitel in eben diesem Band ist nun wiederum jenem Dichter gewidmet, der das Denken Emer-sons seinerseits tief und anhaltend geprägt hat, nämlich Goethe.21 In seinem Es-
16 Walt Whitman: „Song of Myself“, in: CE, S. 26–78, V. 1325, Einklammerung des Zitats
hier entfernt. Zitate aus dem „Song of Myself“ werden im Folgenden in nachgestellten Zif-fern im Fließtext nachgewiesen.
17 Den entscheidenden – und von der Forschung grundsätzlich als glaubwürdig erachteten – Hinweis hierauf formulierte John Townsend Trowbridge in seinem Text „Reminiscences of Walt Whitman“ (1902). Die entscheidende Passage darin lautet: „Whitman talked frankly on the subject, that day on Prospect Hill, and told how he became acquainted with Emerson’s writings. He was at work as a carpenter (his father’s trade before him) in Brooklyn, building with his own hands and on his own account small and very plain houses for laboring men; as soon as one was finished and sold, beginning another, – houses of two or three rooms. This was in 1854; he was then thirty-five years old. […] Along with his pail he usually carried a book, between which and his solitary meal he would divide his nooning. Once the book chanced to be a volume of Emerson; and from that time he took with him no other writer.“ Der ursprünglich im Februar 1902 in der Zeit-schrift The Atlantic Monthly publizierte Text ist im Internet abrufbar (http://www.theat-lantic.com/past/docs/unbound/poetry/whitman/walt.htm). Die Bedeutung Emersons für Whitman ist in der Forschung vielfach belegt und intensiv untersucht worden. Vgl. als jüngsten Beitrag hierzu nur John Michael Corrigan: American Metempsychosis. Emerson, Whitman, and the New Poetry, New York 2012.
18 Dieses pointierte Zitat entstammt, freilich, der Erinnerung von John Townsend Trow-bridge: „Reminiscences of Walt Whitman.“
19 Vgl. für einen Nachweis zahlreicher Parallelstellen Floyd Stovall: The Foreground of ‘Lea-ves of Grass’, S. 296–304.
20 Zur besonderen Bedeutung der Representative Men für Whitman – wenn auch nicht zu dem darin enthaltenen Goethe-Essay – Joel Porte: Representative Man. Ralph Waldo Emerson in His Time, New York 1979, S. 314 ff.
21 Die Bedeutung Goethes für Emerson, die Kon- und Divergenzen ihres Schreibens und Denkens sind eingehend und umfassend erforscht. Vgl. an neueren Publikationen hier nur Peter A. Obuchowski: Emerson and Science. Goethe, Monism, and the Search for Unity, Great Barrington 2005 und Philipp Mehne: Bildung vs. Self-Reliance? Selbstkultur bei Goethe und Emerson, Würzburg 2008. Eine genuin literarische (und daher gesondert er-
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
187
say „Goethe, or the Writer“ vollzieht Emerson eine Umdeutung des von Whit-man als individualitätsfixiert verworfenen Kunst- und Persönlichkeitskonzepts Goethes, indem er dem Dichter die gesellschaftlich unerlässliche Funktion als Allversöhner einer dissoziierten Moderne zuschreibt. In dieser romantisierenden Lesart, so wird im Folgenden zu zeigen sein, wirkt Goethes Idee auf Whitmans Poetik ebenso vermittelt wie grundlegend ein. In methodischer Hinsicht verbindet mein Ansatz eine philologisch fundierte Textanalyse mit der Bestimmung einer konkreten Einflussbeziehung. Dabei richte ich den Fokus nicht vordringlich auf die vielfältigen religiösen, philoso-phischen, historischen usw. Implikationen der behandelten Texte, sondern werde in erster Linie auf Aspekte der Poetik eingehen – ‚Poetik‘ hier verstanden als die individuelle und explizite Selbstreflexion eines Schriftstellers über „die Rolle des Autors und Bedingungen und Strukturen seiner Produktion, die Strukturen der Texte selbst, ihre Relationen zu anderen Künsten, ihre Korrelationen mit der sozialgeschichtlichen Realität oder dem epochalen Denksystem, die Rolle der Rezipienten, ihre Praxis der Textverarbeitung, die Wirkung der Texte auf sie.“22 Mit diesem Vorhaben geht es mir indes nicht allein um den Nachweis, dass ein grundlegender Aspekt in Whitmans Poetik auf einen Einfluss Goethes zu-rückzuführen ist. Über diese werkgenetische, mithin recht eng eingestellte Optik der Einflussforschung23 hinaus will ich eine Interpretation versuchen, die auf folgende zwei Fragen Antworten zu geben sucht: Wenn sich tatsächlich ein über Emerson vermittelter Einfluss Goethes auf Whitmans Poetik nachweisen lässt – warum negierte er diese Bezogenheit in seinen poetologischen Selbstaussagen so vehement? Und was sagt dies über das Konzept seiner vermeintlich au-tochthonen Nationalpoesie aus, die vielfach als Grundstein einer originär ameri-kanischen modernen Dichtung angesehen wird? Die Durchführung der Untersu-chung folgt dabei naheliegenderweise der zur rekonstruierenden Einflussbezie-hung – von Goethe ausgehend dem Umweg über Emerson folgend schließlich zu Whitman.
wähnenswerte) Verbindung von Emerson zu Goethe beschreibt dagegen – in einem aller-dings sehr knappen Artikel – J. Lasley Dameron: „Emerson’s ‚Each and All‘ and Goethes ‚Eins und Alles‘“, in: English Studies. A Journal of English Language and Literature 67, 4 (1986), S. 327–330.
22 Michael Titzmann: [Art.] „Poetik“, in: Volker Meid (Hg.): Literaturlexikon. Begriffe, Rea-lien, Methoden, Gütersloh, München 1993, S. 216–222, hier S. 216. Der hier zur Anwen-dung kommende Begriff der ‚expliziten Poetik‘ unterscheidet sich von der ‚implizite Poe-tik‘, die ermittelt wird über die „Rekonstruktion einer nirgends ausgesprochenen P[oetik], d. h. eine Rekonstruktion der einem Text(korpus) zugrundeliegenden literar[ischen] Nor-men und Regeln, aufgrund derer die Texte bzw. das Korpus produziert werden können.“ (Ebd.)
23 Auf diese nicht untypische Form der Blickfeldverengung zielt die geläufige Kritik an der Einflussforschung; vgl. hierzu Lutz Danneberg: [Art.] „Einfluß“, in: Klaus Weimar et al. (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Berlin, New York 1997, Bd. 1, S. 424–428.
Kai Sina
188
III.
In einem Gespräch, das Goethe mit dem Schweizer Numismatiker und Privatge-lehrten Frédéric Soret am 17. Februar 1832 – also nur knapp einen Monat vor seinem Tod – in Weimar führte, bekannte sich dieser zu einer ‚kollektiven‘ Kon-tur seines Lebenswerks. Das berühmt gewordene Gesprächszitat ist ursprünglich in französischer Sprache überliefert, wird in den heutigen Werkeditionen aber in der Regel in deutscher Übersetzung wiedergegeben; hier seien deshalb beide Versionen zitiert:
Qu’ai-je fait? J’ai recueilli, utilisé tout ce que j’ai entendu, observé. Mes oeuvres sont nourries par des milliers d’individus divers, des ignorants et des sages, des gens d’esprit et des sots. L’enfance, l’âge mûr, la vieillesse, tous sont venus m’offrir leurs pensées, leurs facultés, leur manière d’être, j’ai recueilli souvent la moisson que d’autres avaient semée. Mon oeuvre est celle d’un être collectif et elle porte le nom de Goethe.24 Was habe ich denn gemacht? Ich sammelte und benutzte alles was mir vor Augen, vor Ohren, vor die Sinne kam. Zu meinen Werken haben Tausende von Einzelwesen das ihrige beigetragen, Toren und Weise, geistreiche Leute und Dummköpfe, Kinder, Männer und Greise, sie alle kamen und brachten ihre Gedanken, ihr Können, ihre Er-fahrungen, ihr Leben und ihr Sein; so erntete ich oft, was andere gesät; mein Lebens-werk ist das eines Kollektivwesens, und dies Werk trägt den Namen Goethe.25
Dieser Text enthält – in einer abbreviaturhaften Verdichtung, wie sie für das Spätwerk Goethes im Ganzen charakteristisch ist – mindestens vier grundsätzli-che Aussagen über den Autor, die dichterische Tätigkeit und das literarische Werk. Erstens entwirft Goethe das „Genie“26 als einen Menschen, der nicht al-lein aus sich selbst schöpft, sondern die herausragende Fähigkeit besitzt, sämtli-che Eindrücke, die ihm „vor Augen, vor Ohren“ kommen, produktiv weiter zu verwenden, und das bedeutet hier konkret: in Kunst zu verwandeln. (Hier klingt der späte Goethe also fast wie der moderne Oscar Wilde: „Talent borrows, geni-us steals“). Diese Annahme impliziert zweitens ein Modell literarischer Produk-tivität: Das „Genie“ nimmt seine gesamte Lebenswirklichkeit in sich auf, um sie dann – als eine Art Filter – in sein Werk eingehen zu lassen, und zwar in umge-wandelter, zur ‚Reife‘ gebrachten Form („so erntete ich oft, was andere gesät“). Kennzeichnend für diesen Ansatz ist drittens eine ebenso egalitäre wie univer-selle Ausrichtung: Schlichtweg „alles“, was dem kunstschaffenden Genie be-gegnet – sei es persönlicher, gegenständlicher oder geistiger Natur, sei es geist-reich oder banal, alt oder jung – geht über das „Kollektivwesen“ des Dichters in dessen Werk ein. Dieses Konzept legt viertens nahe, dass der Autor eine (an die-
24 Im Gespräch mit Fréderic Soret am 17. Februar 1832, hier zitiert nach Albrecht Schönes
Kommentar zu Goethes Faust (Frankfurt a. M. 1994, S. 27). 25 Johann Wolfgang Goethe: Die letzten Jahre, S. 521 f. 26 Ebd., S. 521.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
189
ser Stelle allerdings nicht konkret benannte) Form der Repräsentanz verkörpert: Er ist es, der für Viele und für Vieles spricht, die und das Teil seiner Selbst und damit seines Kunstwerks geworden sind.27 Oder anders und den gesamten Ge-dankengang noch einmal zusammenfassend gesagt: Im Dichter, dem als „être collectif“ eine Stellvertreterstellung zugesprochen wird, konzentriert sich die unübersehbare, in jedem Detail gleichberechtigt wahrgenommene und allumfas-send aufgenommene Vielheit der Lebenswelt zur Einheit des Werkes, wenn-gleich diese Vielheit im Werk nicht aufgehoben, sondern vielmehr in konden-sierter Form zum Ausdruck gebracht wird. Die Faust-Dichtungen Goethes, die „wie kein anderes neuzeitliches Werk“ eine „Weltfülle“ ins sich aufgenommen haben,28 lassen sich mit Albrecht Schöne als herausragende Realisationen dieser Poetik lesen. Damit verdichten sich in Goethes Selbstbezeichnung als „Kollektivwesen“ einige Gedankenfiguren sowohl ästhetisch-poetologischer als auch ethisch-anthropologischer Art, die für sein Spätwerk insgesamt von zentraler Bedeutung sind (und in der Vergangenheit bereits so gut erforscht worden sind, dass im Folgenden einige kursorische Bemerkungen hinreichen mögen). Subsumieren lassen sich unter der Zentralformel des „Kollektivwesens“ zunächst sowohl Goethes naturwissenschaftliche Bemühungen – vor allem in der Farbenlehre mit ihrer Integration unterschiedlicher, sowohl mathematischer als auch meta-physischer, mechanischer und moralischer „Arten der Vorstellung“29 – wie auch sein narrativer und lyrischer Altersstil, wie er in den Wahlverwandtschaften und in Wilhelm Meisters Wanderjahren, in der Trilogie der Leidenschaft und den ‚weltliterarischen‘ Gedichten des West-östlichen Divan oder der Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten Gestalt gefunden hat. Die Forschung erkennt zwischen den beiden Werkebenen – Goethes eigener werkpolitischer, um Selbsthistorisierung bemühten Setzung folgend – ein unmittelbares Entspre-chungsverhältnis:
Was im Feld der naturwissenschaftlichen Naturerkenntnis durch den Ansatz einer dif-ferenzbewußten Interdisziplinarität zum Ausdruck kommt, findet […] seine Entspre-chung in einem polyperspektivischen Darstellungsverfahren, das unterschiedliche Sichtweisen aufnimmt und kontrastierend gegenüberstellt. Auch im Bereich der Fikti-on setzt sich Goethe über den Zerfall des modernen Weltbildes in partikulare Perspek-
27 Im Kontext der Ordnung seiner umfangreichen Sammlungen wird Goethe den hier nur
latent erkennbaren Repräsentanz-Anspruch auch ganz explizit formulieren: „Meine Nach-lassenschaft ist so kompliziert, so mannigfaltig, so bedeutsam, nicht bloß für meine Nach-kommen, sondern auch für das ganze geistige Weimar, ja für ganz Deutschland, daß ich nicht Vorsicht und Umsicht genug anwenden kann […]. In diesem Sinne möchte ich diese meine Sammlungen konserviert sehen“ (Johann Wolfgang Goethe: Die letzten Jahre, S. 335, meine Hervorhebung, bis auf „konserviert“).
28 Albrecht Schöne: Johann Wolfgang Goethe: Faust-Kommentare, S. 29. 29 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hg. von Erich Trunz. 13. Aufl., Ham-
burg 1999, Bd. 13, S. 492.
Kai Sina
190
tiven nicht hinweg, er gestaltet ihn vielmehr phantasmatisch aus, um seine Konsequen-zen sichtbar zu machen.30
Die hier nur angedeutete „Konsequenz“ dieses sowohl wissenschaftstheoretisch als auch poetologisch zu begreifenden Verfahrens hat Albert Meier im Hinblick auf die Wanderjahre in einem einzigen Satz bestimmt: „Das vordergründig Dis-parate bringt ein Zusammenspiel der Differenzen hervor, das von keiner Starr-heit eindeutiger Sinngebung mehr bedroht ist.“31
IV.
Nun zeigte Emerson nicht allein an Goethes literarischen Werken, seinen philo-sophischen Ideen und wissenschaftlichen Modellen nachdrückliches und anhal-tendes Interesse, sondern auch – und vielleicht sogar hauptsächlich – an der Be-schaffenheit und Funktionsweise seines Geistes.32 Es kann also kaum überra-schen, dass Goethes Selbstbekenntnis als „Kollektivwesen“ Emersons Interesse auf sich zog; doch mehr noch: Das übersetzte Goethe-Zitat – „What have I do-ne? […] My work is that of an aggregation of beings taken from the whole of nature. It bears the name of Goethe“33 – wird zu einer wichtigen, weil wiederholt angeführten Referenzstelle Emersons. So findet es sich nicht nur in einem Vor-trag aus dem Jahr 1835 über Geoffrey Chaucer,34 sondern auch in dem Essay „Originality and Quotation“.35 In ihm wird Goethes Gedanke zugleich reformu-liert und in anthropologischer Hinsicht interpretiert:
Our knowledge is the amassed thought and experience of innumerable minds: our lan-guage, our science, our religion, our opinions, our fancies we inherited. Our country, customs, laws, our ambitions, and our notions of fit and fair,—all these we never made; we found them ready-made; we but quote them.36
30 Peter Matussek: Goethe. Zur Einführung. 2., verbesserte Auflage, Hamburg 2002, S. 169. 31 Albert Meier: Goethe. Dichtung – Kunst – Natur, Stuttgart 2011, S. 294. 32 Vgl. Robert D. Richardson Jr.: Emerson. The Mind on Fire, Berkeley, Los Angeles, Lon-
don 1995, S. 222. 33 Ralph Waldo Emerson: „Chaucer“, in: The Early Lectures of Ralph Waldo Emerson, hg.
von Stephen E. Whicher und Robert E. Spiller, Volume I: 1833–1836, Cambridge, Mass. 1966, S. 269–286, hier S. 286.
34 Vgl. ebd., S. 285 f. Emersons zitiert hier aus Sarah Austin: Characteristics of Goethe, London 1833, S. 75–77.
35 Das Zitat findet sich noch nicht in der 1868 erstmals in der North American Review veröf-fentlichten Version, wohl aber in der Erstausgabe von Letters And Social Aims (1875), auf deren Erstausgabe ich mich im Folgenden beziehen werde (Ralph Waldo Emerson: „Quo-tation and Originality“, in: Ders.: Letters and Social Aims. Cambridge 1875, S. 155–181, hier: S. 177 ff.).
36 Emerson: „Quotation and Originality“, S. 177.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
191
Emerson formuliert damit die – aus heutiger Sicht fast schon poststrukturalis-tisch anmutende – Idee, dass ein Gedanke immer schon das Zitat eines anderen, früheren Gedankens „aus unterschiedlichsten Stätten der Kultur“ (Roland Bar-thes) darstellt. Blickt man von hier aus auf den Essay „Goethe, or the Writer“, so wird deutlich, dass Emerson allerdings keineswegs von einem Zitat im buch-stäblichen Sinne ausgeht, wenn er von „Quotation“ spricht, sondern – und dies ganz im Sinne Goethes – von einer Umwandlung des Vorgefundenen, oder ge-nauer: von einer Erneuerung und Verfeinerung, die hier zugleich einer Art Ver-lebendigung entspricht:
[I]n man the report is something more than print of the seal. It is a new and finer form of the original. The record is alive, as that which it recorded is alive. In man, the mem-ory is a kind of looking-glass, which, having received the images of surrounding ob-jects, is touched with life, and disposes them in a new order. […] The man coopera-tes.37
Ausgehend von dieser Grundannahme einer Erneuerung, Verfeinerung („new and finer form“) und Verlebendigung („The record is alive“) des in der Erinne-rung Gespeicherten, wendet sich Emerson schließlich dem Dichter zu, dem er „exalted powers for this second creation“38 zuspricht; dabei hebt er besonders jenen egalitären und universellen Zug hervor, der auch Goethes Rede vom „Kol-lektivwesen“ eignet:
Whatever he beholds or experiences, comes to him as a model, and sits for its picture. […] He believes that all that can be thought can be written, first or last; […]. Nothing so broad, so subtle, or so dear, but comes therefore commended to his pen, and he will write. In his eyes, a man is the faculty of reporting, and the universe is the possibility of being reported. In conversation, in calamity, he finds new materials […].39
Nun kann es kaum überraschen, dass Emerson ein herausragendes Beispiel für dieses Autorschaftskonzept bei gerade jenem Dichter findet, an dessen Aussage es offenbar von vornherein geschult war. Zugleich aber geht er über Goethes Argumentation entschieden hinaus, wenn er dessen Idee vom „Kollektivwesen“ in einem romantischen Sinne funktionalisiert:40 Goethe vollziehe in seiner künst-lerischen Erneuerung, Verfeinerung, Verlebendigung des mannigfach Vorge-fundenen nichts Geringeres, so Emerson, als die Re-Synthetisierung einer Mo-
37 Ralph Waldo Emerson: „Goethe, or the Writer“, in: The Collected Works of Ralph Waldo
Emerson. Volume IV: Representative Men: Seven Lectures. Historical Introduction and Notes by Wallace E. Williams. Text established and Textual Introduction and Apparatus by Douglas Emory Wilson, Cambridge, Mass., London 1987, S. 151–166, hier S. 151 f.
38 Ebd., S. 152. 39 Ebd. 40 Vgl. zur eingehend und umfangreich erforschten Anverwandlung der europäischen Ro-
mantik bei Emerson, als Hauptvertreter des so genannten American Romanticism, neuer-dings David Greenham: Emerson’s Transatlantic Romanticism, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2012 (dort auch die für diese Frage einschlägigen weiteren Literaturhinweise).
Kai Sina
192
derne, die in einen unübersichtlichen, allumfassenden und sich beständig aus-dehnenden Pluralismus zerspalten ist, in Mythologien, Philosophien, Literaturen – und so fort. Der Dichter erscheint somit gewissermaßen als die personifizierte „Over-Soul“, als „the eternal ONE“, in dem sich die „parts“ und „particles“ der modernen Lebenswelt zur neuen Einheit fügen:41
The world extends itself like American trade. We conceive Greek or Roman life, life in the Middle Ages, to be a simple and comprehensible affair; but modern life to respect a multitude of things which is distracting. Goethe was the philosopher of this multiplicity, hundred-handed, Argus-eyed, able and happy to cope with this rolling miscellany of facts and sciences, and, by his own versa-tility, to dispose of them with ease […]. The Helena, or the second part of Faust, is a philosophy of literature set in poetry; the work of one who found himself the master of histories, mythologies, philosophies, sci-ences, and national literatures […]; and every one of these kingdoms assuming a cer-tain aerial and poetic character, by reason of the multitude. […] He was the soul of his century. […] He had a power to unite the detached atoms again by their own law. He has clothed our modern existence with poetry.42
Auffällig erscheint die Wechselseitigkeit, mit der hier von der modernen Viel-heit die Rede ist: einmal als ein Negativzustand („a multitude of things, which is distracting“), der zumindest in der Kunst aufgehoben und kompensiert werden könne und solle; dann aber auch als eine Produktivkraft des Dichters, dessen Genie sich erst durch die Aufnahme und Verarbeitung dieser Vielheit entfalte, was ihn zugleich – „soul of his century“ – der Klasse der Representative Men zuordnet, die Emerson in seinem Band in sechs Essays porträtiert (neben Goethe werden behandelt: Platon, Swedenborg, Montaigne, Shakespeare und Napole-on). Diese vereinigende, versöhnende Aufgabe, die dem repräsentativen Dichter in seiner doppelten Stellung gegenüber der ‚multitude‘ zugewiesen wird, sei ge-genwärtig, so Emerson, allerdings niemand zu übernehmen bereit oder auch nur imstande. Fest in die Gesellschaft integriert, komme den Dichtern das Bewusst-sein ihrer ‚heiligen‘ Aufgabe für die Gesellschaft, die Emerson im Modus neu-romantischer Kunstreligion umreißt,43 nicht einmal in den Sinn:
Society has really no graver interest than the wellbeing of the literary class. […] There have been times when he was a sacred person: he wrote bibles; the first hymns; the codes; the epics, tragic songs, Sibylline verses, Chaldean oracles, Laconian sentences,
41 Ralph Waldo Emerson: „The Over-Soul“, in: The Collected Works of Ralph Waldo Emer-
son. Volume II: Essays. First Series. Introduction and Notes by Joseph Slater. Text estab-lished by Alfred R. Ferguson and Jean Ferguson Carr, Cambridge, Mass., London 1979, S. 157–177, hier S. 160, Kapitälchen im Original.
42 Ralph Waldo Emerson: „Goethe, or the Writer“, S. 156 f. 43 Zum Gegenstand der Kunstreligion vgl. die Begriffsbestimmung von Heinrich Detering:
„Was ist Kunstreligion? Systematische und historische Bemerkungen“, in: Albert Meier, Alessandro Costazza, Gérard Laudin (Hg.): Kunstreligion. Der Ursprung des Konzepts um 1800, Berlin, New York 2011, S. 11–27.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
193
inscribed on temple walls. Every word was true, and woke the nations to new life. He wrote without levity, and without choice. […] But how can he be honoured when he does not honour himself, when he loses himself in a crowd […], ducking to the giddy opinion of a reckless public […]; or write conventional criticism; or profligate novels; or, at any rate, write without thought and without recurrence by day and by night to the sources of inspiration?44
Mit seiner Klage über die Verweltlichung der Autorschaft in der Moderne berei-tet Emerson den Boden für den Auftritt des selbsterklärten Nationaldichters Walt Whitman, der sich eben jene kunstreligiöse Emphase, die Emerson den ‚heiligen‘ alten, gegenwärtig aber schmerzlich vermissten Dichtern zuspricht, denn auch ganz unbescheiden selbst zu eigen macht.45 Im Kernstück der Leaves of Grass, dem poetologisch aufgeladenen „Song of Myself“, kommt dies ganz unmissverständlich zum Ausdruck; wir hören ein Sprecher-Ich, das sich selbst als „Walt Whitman“ (496) bezeichnet und den Lesern mit folgenden Versen vorstellt: „Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touched from“ (523). Nun könnte dieses poetologische Komplementärverhältnis für sich genom-men natürlich dem Zufall geschuldet sein (und zudem aus Emersons Essay „The Poet“ mit seiner ins Religiöse reichenden Hypostasierung des Dichters herrüh-ren),46 stünde sie nicht im Zusammenhang mit weiteren, signifikanten Konver-genzen, die sich auf Emerson – und von ihm ausgehend auf Goethe – zurückfüh-ren lassen. Hierzu nun eingehender, hierzu Schritt für Schritt.
V.
In Whitmans „Song of Myself“ findet sich erstens die Betonung einer nicht-originellen, sondern auf sinnlicher Wahrnehmung der Lebensumwelt beruhen-den Dichtung. „O I perceive after all so many uttering tongues, / And I perceive they do not come from the roofs of mouths for nothing“ (118 f.), so wähnt der Dichter, um etwas später ausdrücklich festzuhalten, die Gedanken, die er in sich aufnehme und in seinem Werk entfalte, „the thoughts of all men in all ages and lands, / they are not original with me“ (354 f.); seine Gedanken sind, mit Emer-son gesprochen, also nur eines: „Quotation“. Das Erfassen und, mehr noch, die sich gleichsam vegetativ vollziehende Aufnahme der geistigen, menschlichen, dinglichen Lebensumwelt umschreibt Whitman in diesem Zusammenhang zweimal mit dem Prädikat „breathe“ –
44 Ralph Waldo Emerson: „Goethe, or the Writer“, S. 155. 45 Vgl. eingehend zu Whitman im Kontext genuin prophetischer, mithin kunstreligiöser Rede
Bernadette Malinowski: „Das Heilige sei mein Wort“. Paradigmen prophetischer Dich-tung von Klopstock bis Whitman, Würzburg 2002, S. 363–406.
46 Vgl. die Parallelstellen-Lektüre von Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’, S. 296 f.
Kai Sina
194
„breathe the fragrance“ (15), „breathe the air“ (350). Es ist fast genau dieselbe Formulierung, die auch Emerson in Bezug auf Goethe verwendet: „Goethe, a man quite domesticated in the century, breathing its air [...].“ In dieser Konstellation angelegt ist zweitens die Vorstellung des Dichters als einer Art Filter der absorbierten Lebenswelt, hier – in erneutem Anschluss an Emerson – als eine Forderung von allgemeinmenschlicher Gültigkeit und mit universeller Reichweite formuliert: „You shall listen to all sides and filter them from your self“ (35). Das Prädikat „filter“ schließt den Aspekt einer Verwand-lung, oder mit Emersons Deutung des Goethe’schen Gedankens gesprochen: einer Erneuerung und Verfeinerung des allumfänglich Wahr- und Aufgenom-menen ein. Aber was genau meint Whitman mit diesem offenkundig allererst epistemo-logisch zu verstehenden Prinzip? An dieser Stelle bietet sich zur näheren Erläu-terung ein Seitenblick auf Whitmans Besprechung der Autobiographie Goethes an. In seiner Rezension hebt Whitman hervor, dass Dichtung und Wahrheit zwar aus den unzähligen Einzelheiten des Erlebten und Erfahrenen hervorgegangen sei, sich aber erfreulicherweise keinesfalls damit begnüge, die Einzelheiten als bloße Einzelheiten wiederzugeben, wie es in konventionellen autobiographi-schen Schriften nur zu oft geschehe. Vielmehr gehe es Goethe darum, das Leben trotz, ja gerade in seiner unübersehbaren Vielfalt als Einheit zur Darstellung zu bringen: „What a prodigious gain would accrue to the world, if men who write well would as much think of writing LIFE, as they (most of them) think it neces-sary to write one of the million things evolved from life—Learning!“47 Die syntheseartige Darstellung des Erlebten zum Leben als eines Ganzen („LIFE“) setzt allerdings einen Prozess der künstlerischen Verarbeitung voraus, den Whitman in seiner Besprechung ebenfalls benennt (wenngleich nicht näher erläutert); das in diesem Zusammenhang verwendete Prädikat ‚to render‘ scheint mir in poetologischer Hinsicht etwa auf dasselbe hinzudeuten, was in den Lea-ves mit dem Verbum ‚to filter‘ bezeichnet wird – nämlich einen Prozess der Verdichtung beziehungsweise des Zuschnitts: „This Life of Goethe ― this fa-mous Dichtung und Wahrheit ― seems shaped with the intention of rendering a history of soul and body’s growth […].“48 Der Gedanke universeller Einbeziehung und dichterischer Gestaltung mag Whitman also nicht (oder nicht nur) aus jener durch Emerson vermittelten Selbstbezeichnung Goethes als „Kollektivwesen“ bekannt gewesen sein, son-dern darüber hinaus aus Godwins Übersetzung von Dichtung und Wahrheit – und darin wiederum konkret aus der Vorrede des Verfassers. „[T]he wide world, the images of a hundred famous men, who had more or less directly influenced me“, „the prodigious fluctuations of general politics“ – all diese Eindrücke und
47 Emory Holloway: The Uncollected Poetry and Prose of Walt Whitman, S. 140, Hervorhe-
bung im Original. 48 Ebd., meine Hervorhebung bei „render“.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
195
Einflüsse seien durch den Selbstbiographen hinsichtlich ihrer persönlichkeitsbil-denden Kraft für den Künstler zu reflektieren, denn:
[F]or the main point in biography is, to present the man in all his relations to his time, and to show to what extend it may have opposed or prospered his development, what view of mankind and the world he has shaped from it, and how far he himself, if an artist, poet, or author, may be an external reflection of its spirit.49
Der Künstler erscheint auch hier als ein Repräsentant seiner Zeit („the man in all his relations to his time“), der seine Lebenswirklichkeit in ihrer gesamten Viel-heit zunächst wahrnimmt und auf sich wirken lässt, um sich auf dieser Grundla-ge sein Welt- und Menschenbild zu gestalten („view of mankind and the world he has shaped from it“), das wiederum Ausdruck in seinem Dasein als Künstler finde (als „external reflection of its spirit“). Oder kürzer: Goethe will in seiner Biographie nachzeichnen, wie sich die Vielheit des Erlebten und Erfahrenen zur Einheit seiner Persönlichkeit geformt habe. Verbunden damit ist eine konkrete, im hier angegebenen Zitat von Goethe nur implizit angedeutete werkästhetische Funktion: Über die Autobiographie soll den Lesern seiner Werke ermöglicht werden, die Vielheit seines Werks als eine Einheit wahrzunehmen, weil es als Ergebnis – oder im deutschen Wortlaut: als ‚Abspiegelung‘50 – eben jener Per-sönlichkeitsbildung durch Welterfahrung zu verstehen ist. Es ist dieser biogra-phisch wie künstlerisch zu begreifende Bildungs- und Gestaltungsprozess, den Whitman mit den Begriffen ‚to render‘ oder ‚to filter‘ bezeichnet. Das Strömen der kollektiven Stimmen durch den Dichter hindurch um-schreibt Whitman – in stillschweigender Anlehnung an das traditionelle Konzept des poeta vates – mit der wiederholten Formel „through me“, zum Beispiel: „Trough me many long dumb voices“ (508), oder: „Through me forbidden voi-ces“ (516). Gerade der Ansatz, die bislang verstummten, unterdrückten, verbo-tenen Stimmen in der dichterischen Rede zum Sprechen zu bringen, deutet drit-tens auf eine egalitäre, oder wie Whitman in seinem Gedicht wörtlich und im-mer wieder sagt: auf eine genuin demokratische Ausrichtung seiner Poetik hin. Erstaunlicherweise drückt er sich dabei bis in den Wortlaut hinein fast selbst wie Goethe aus, den er doch ausgerechnet aufgrund seiner vermeintlich selbstbezo-genen Kunstauffassung verurteilt: „I am of old and young, of the foolish as much as the wise“ (330). An dieser Stelle zum Vergleich noch einmal die ent-sprechende Stelle bei Goethe: „Zu meinen Werken haben Tausende von Einzel-wesen das ihrige beigetragen, Toren und Weise, geistreiche Leute und Dumm-köpfe, Kinder, Männer und Greise“. Egalitär ist Whitmans poetologische Selbst-zuschreibung dabei auch insofern – und dies nun tendenziell anders als im Fall
49 [Johann Wolfgang Goethe:] The Autobiography of Goethe. Truth und Poetry: From My
Life, ed. by Parke Godwin. First Part, New York 1846, S. vii f. 50 „wie er [der Dichter, K.S.] sich eine Welt- und Menschenansicht […] gebildet, und wie er
sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt hat.“ (Goethes Werke, Bd. 9, S. 9, meine Hervorhebung).
Kai Sina
196
Goethes und Emersons –, als er sich dem Kollektiv, das er in sich bündelt, aus-drücklich und immer wieder selbst zurechnet („I am of“), wenngleich er sich damit in ein offenkundig widersprüchliches Spannungsverhältnis zur kunstreli-giösen Exklusivierung seiner Person begibt. Eingeschlossen sind in das gleichsam inkorporierte Kollektiv der „many long dumb voices“ aber nicht nur die Lebenden, sondern besonders auch die Toten – eine Vorstellung, die in Goethes Rede vom „Kollektivwesen“ noch nicht vorge-sehen ist, während sie in Emersons Konzept einer ‚Verlebendigung‘ des Vorge-fundenen und Aufgenommenen allenfalls implizit angedeutet wird (denn was ‚verlebendigt‘ werden soll, muss ja zunächst als ‚tot‘ vorausgesetzt werden). Whitmans Poetik läuft demgegenüber auf einen regelrechten Totenkult hinaus, prägnant entfaltet in dem poetologischen Kurzgedicht „Pensive and Faltering“, das der Edition der Leaves of Grass von 1871 beigegeben ist:
Pensive and faltering, The words the Dead I write, For living are the Dead, (Haply the only living, only real, And I the apparition, I the spectre.)51
Der Dichter wird hier unversehens zu einer ‚Figur des Dritten‘, die zwischen dem Reich der ‚bloß‘ Lebenden („only living“) und der Sphäre der Hingeschie-denen vermittelt, oder genauer: Durch seinen magisch-animistisch verstandenen Schreibakt („The words the Dead I write“) regt der Autor die Toten zum Wider-gehen („living are the Dead“) an, und zwar in der Gestalt des Autors selbst, der folgerichtig als Geist oder auch Gespenst („I the apparition, I the spectre“) er-scheint. Dass die Religion und mit ihr die Kirche im Zuge der Moderne ihre Al-leinstellung als Verwalterin des Totenkults verliert, wie der Historiker Philippe Ariès dargelegt hat,52 und sich infolgedessen vielfach die Kunst dieser Aufgabe bemächtigt – in diesem kulturgeschichtlichen Prozess lässt sich auch Whitmans Gedicht verorten; der Amerikaner steht in dieser Hinsicht (und vermutlich nur in dieser Hinsicht) in einer Reihe mit Dichtern wie Rainer Maria Rilke, Stéphane Mallarmé, Stefan George, Ossip Mandel’štam oder auch Paul Celan, die unter höchst unterschiedlichen literatur- und kulturhistorischen Umständen und auf je eigene Weise ebenfalls totenkultische Gedichtkonzeptionen entwickelt haben. Aus dem egalitär-demokratischen, auf universelle Inklusion ausgerichteten und außerdem – wie zuletzt gezeigt – totenkultisch aufgeladenen Ansatz Whit-mans leitet sich viertens ein deutlicher Anspruch auf Repräsentanz ab, gipfelnd in der vielleicht berühmtesten Formel des Gesangs, die einen Zentralbegriff Emersons aufgreift, den dieser auch in seinem Goethe-Essay verwendet und
51 CE, S. 381. 52 Philippe Ariès: Geschichte des Todes. Aus dem Französischen von Hans-Horst Henschen
und Una Pfau, München 1980, S. 715–770.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
197
konzeptualisiert:53 „I am large, I contain multitudes.“ (1325) Die semantische Nähe zu Goethes Rede vom „Kollektivwesen“ liegt auf der Hand. Dabei bezieht Whitman dieses Kollektiv, das bei Goethe unspezifisch bleibt, zum einen auf die amerikanische Nation, als deren kollektives Sprachrohr er sich inszeniert: „Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son“ (497).54 Zum anderen aber nennt er in seinem Gedicht die allgemeine Massenhaftigkeit der Moderne als seinen Re-ferenznahmen, eine Massenhaftigkeit, die er durch den Dichter – und damit durch sich selbst – stellvertretend repräsentiert sieht, ganz ähnlich also wie Emerson das 19. Jahrhundert in der Gestalt Goethes: „And mine a word of the modern, the word En-Masse.“ (478) In der hier vorgenommenen Zusammenschau legen also genau vier Aspekte eine Rezeption Goethes durch Whitman nahe: die Nicht-Originalität des Dich-ters und seine Abhängigkeit von der sinnlich wahrgenommenen, in ihn aufge-nommenen Lebenswelt; die Umwandlung der absorbierten Lebenswelt in die Kunst; die universelle und zugleich egalitäre Ausrichtung sowie der Anspruch des Dichters auf Repräsentanz.55 Dass dieser Einfluss allerdings indirekt über Emerson verlief, zeigt sich nicht nur in der bisweilen überschneidenden Lexik (Emerson: „breathing its air“, Whitman: „breathe the air“). Mehr noch und auf konzeptueller Ebene lässt sich dies an Whitmans kunstreligiöser Funktionalisie-rung des Goethe’schen Modells erkennen. Emersons romantisierende Lesart des „Kollektivwesens“, vor allem aber der Auftrag, den er aus diesem Konzept her-leitet und im Schlusssatz seines Goethe-Essays zusammenfasst, liest sich auch diesbezüglich wie eine argumentative Vorlage:
We too must write Bibles, to unite again the heavenly and the earthly world. The secret of genius is […] to realize all that we know; in the high refinement of modern life, in arts, in sciences, in books, in men, to exact good faith, reality, and a purpose; and first, last, midst, and without end, to honour every truth by use.56
Der literarische Text als eine ‚heilige Schrift‘, die syntheseartig zusammenfügt, was in der modernen Welt in einer unübersichtlichen, unübersehbaren Vielheit
53 Vgl. hier z.B. das oben bereits angeführte Zitat: „but modern life to respect a multitude of
things, which is distracting“ (Ralph Waldo Emerson: „Goethe, or the Writer“, S. 156). 54 Vgl. hier auch den Schlusssatz im Vorwort zur Erstauflage der Leaves: „The proof of a
poet is that his country absorbs him as affectionally as he has absorbed it.“ CE, S. 636, meine Hervorhebung.
55 Dass Whitman einzelne Aspekte dieser Konzeption zugleich an Emersons Essay „The Poet“ schulte – so vor allem den Gedanken der Repräsentanz des Dichters, durch den viele andere Stimmen ‚gefiltert‘ sprechen, oder auch die herausragende Fähigkeit zur allumfas-senden Absorption seiner Umwelt (vgl. Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’, S. 296 f.) – steht meiner Annahme, die in dieser Hinsicht als eine Ergänzung zu den bereits bekannten Einflussbeziehung zu verstehen ist, durchaus nicht entgegen. Im Ge-genteil wäre vielmehr zu prüfen, inwiefern nicht auch das in „The Poet“ entfaltete Konzept auf poetologischen Ideen Goethes fußt.
56 Ralph Waldo Emerson: „Goethe, or the Writer“, S. 166.
Kai Sina
198
zerspalten vorliegt – so bestimmt Emerson den ausgleichenden Auftrag des mo-dernen Dichters. Whitman folgt ihm im Grundsatz nach, wenn er die Dichter als „prophets en masse“ bestimmt, dies nun allerdings in dezidiert nationalpatrioti-scher Zuspitzung:
Of all Nations the United States with veins full of poetical stuff most need poets and will doubtless have the greatest poets and use them the greatest. Their Presidents shall not be their common referee so much as their poet shall. [...] He is the arbiter of the di-verse and he is the key. He is the equalizer of his age and land … he supplies what wants supplying […].57
Indem er ihn als Versöhner der Verschiedenen beschreibt („arbiter of the diver-se“), als Erfüller des zu Erfüllenden („supplies what wants supplying“), schreibt auch Whitman dem Dichter eine ausgleichende Funktion für seine Zeit und sein Land zu („equalizer“). Und zu diesem Anspruch passte es, dass Whitman die 1860 erschienene dritte Edition der Leaves in seiner materialen Gestalt einer ein-fach gebundenen King James-Bibel des späten 19. Jahrhunderts annäherte.58 Allerdings erfährt das poetologische Modell in Whitmans literarischer Um-setzung eine markante Akzentverschiebung gegenüber Emerson, die hier nicht verschwiegen sei: Wo Emerson von der Möglichkeit einer Aufhebung der ‚Mul-titude‘ durch den Künstler in seiner Kunst ausgeht, geht es Whitman, dem Groß-städter, eher um ein Ertragen, ein Aushalten der modernen Welt in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit, die er in seinem Gedicht in all seinen Facetten – und dabei auf Entgrenzung, auf ekstatische Gemeinschaft gerichtet59– zur Darstellung bringt. Das heißt, Whitman vollzieht zwei gedankliche Bewegungen zugleich: Zwar übernimmt er Emersons Idee einer heilenden Synthese der modernen Dissoziati-on, um sie zugleich aber, im Gestus romantischer Ironie, als uneinlösbar zu un-terlaufen – und erklärt Widersprüchlichkeiten wie diese offen zu seinem Pro-gramm: „Do I contradict myself? / Very well then .... I contradict myself“ (1314f.). Das spannungsvolle persönliche Verhältnis zwischen Whitman und Emerson erklärt sich nicht allein,60 aber wohl auch im Hinblick auf diese wichti-ge Akzentverschiebung. Vor dem Hintergrund der hier vollzogenen Rekonstruktion stellt sich die ein-gangs aufgeworfene Frage, warum Whitman einen Einfluss Goethes – und sei er auch vermittelt über Emerson – nicht nur verschwieg, sondern ihn sogar aus-drücklich von sich wies, mit gesteigerter Dringlichkeit. Die Antwort hierauf wird man nicht allein in Whitmans inhaltlicher Kritik an Goethe finden, son-dern, mehr noch, in Goethes Stellung als paradigmatischem Vertreter des euro- 57 So Whitman im Vorwort zur Erstauflage (CE, S. 619f.). 58 Walt Whitman: Leaves of Grass, 1860. The 150th Anniversary Facsimile Edition, hg. von
Jason Stacey, Iowa City 2009, vgl. hierzu im Vorwort des Herausgebers S. x. 59 Vgl. Helmuth Kiesel: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung
im 20. Jahrhundert, München 2004, S. 111 f. 60 Stovall schreibt hierzu ebenso allgemein wie treffend: „Emerson was an intellectual, Whit-
man a man of feeling“ (Floyd Stovall: The Foreground of ‘Leaves of Grass’, S. 304 f.).
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
199
päischen Geisteslebens. Denn so eindringlich Whitman die Forderung nach ei-ner autochthonen amerikanischen Literatur formuliert – mit ihm selbst als ihrem ersten und zugleich hervorragendsten Vertreter –, so unvermeidlich geht damit die Zurückweisung ihrer abendländischen Wurzel einher: „Still further, as long as the United States continue to absorb and be dominated by the poetry of the Old World [...], so long will they stop short of first-class Nationality and remain defective.“61 Die bemerkenswerte Vehemenz, mit der sich Whitman von Goethe absetzt, erweist sich vor diesem Hintergrund als eine nationalpatriotische Spiel-art der von Harald Bloom beschriebenen „anxiety of influence“.62 Tatsächlich aber gilt für diesen Fall: Brooklyn und Weimar trennen keine Welten – es be-durfte nur eines Umwegs über Concord, Massachusetts. Folgenreich nimmt sich die hier nachgezeichnete Einflussbeziehung im Hin-blick auf die breite und lang anhaltende Whitman-Rezeption in der amerikani-schen Literatur- und Kulturgeschichte aus, wie nun in einem abschließenden Schritt zumindest ausblickhaft angedeutet sei. Von den unzähligen Beispielen, die sich in diesem Zusammenhang anführen ließen, will ich an dieser Stelle nur zwei nennen, die Whitmans Poetik auf je eigene Weise fort- und umschreiben. Dass diese Beispiele zeitlich weit auseinander liegen, ja dass sie einen Zeitraum vom frühen 20. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart umspannen, un-terstreicht die anhaltende Bedeutung Whitmans für die amerikanische Poesie – und belegt die nicht nur historische, sondern bis in die Gegenwart hineinrei-chende Wirksamkeit der hier beschriebenen Konstellation.
VI.
Wenn der amerikanische Dichter Edgar Lee Masters in seiner 1915 erstmals in Buchform veröffentlichten Spoon River Anthology in 246 freiversigen Gedicht-monologen die toten Bewohner einer erfundenen, nur in Einzelheiten auf den Ort Lewiston im Bundesstaat Illinois verweisenden Kleinstadt im Mittleren Westen zur Sprache kommen lässt, so bezieht er sich damit ganz unverkennbar auf einige poetologischen Grundannahmen Whitmans. Eingehende Kenntnisse der Whitman’schen Dichtung und Dichtungstheorie können bei Masters – als Biograph Whitmans63 – zweifelsfrei vorausgesetzt werden; mehr noch: In der Literatur war von Masters als „the natural child of Walt Whitman“64 die Rede. Der Einfluss Whitmans auf Masters’ hocherfolgreiche und in viele Sprachen übersetzte Anthologie (dt. Die Toten von Spoon River, 1924) zeigt sich bereits in 61 Walt Whitman: „A Backward Glance O’er Travel’d Roads“, S. 584. 62 Harald Bloom: The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, New York 1973. 63 Edgar Lee Masters: Whitman [1937], New York 1968. 64 Ronald Primeau: Beyond Spoon River. The Legacy of Edgar Lee Masters, Austin 1981, S.
94. Der Hinweis auf dieses Zitat verdankt sich Wesley A. Britton: [Art.] „Masters, Edgar Lee (1868?–1950)“, in: J.R. LeMaster, Donald D. Kummings: Encyclopedia of Walt Whit-man, S. 418.
Kai Sina
200
der sozialen Kontur des in ihr versammelten Kollektivs. „The tender heart, the simple soul, the loud, the proud, the happy one“,65 so umreißt das programmati-sche Eingangsgedicht „The Hill“ das Personal der Anthologie, womit Whitmans Ideal einer ‚demokratischen‘ Poetik aufgegriffen wird, das sich in seinem Egali-tätsgestus – wie hier gezeigt – auf Emerson und von dort auf Goethe zurückfüh-ren lässt.66 Und wie sein Lehrmeister Whitman so legt auch Masters dabei den besonderen Fokus auf die an den gesellschaftlichen Rand Gestellten, deren ‚ver-botene‘ Stimmen bislang unerhört geblieben sind.67 Im Sinne einer amerikani-schen Geschichte ‚von unten‘ zählt das Inhaltsverzeichnis der Anthologie – ne-ben den alphabetisch sortierten Namen der einzelnen Sprecher (von „Armstrong, Hannah“ bis „Zoll, Perry“) – denn auch „Blind Jack“ oder sogar „[The] Un-known“ auf,68 die wie all die anderen auf dem Friedhof von Spoon River begra-ben liegen, allerdings: „with no stone to mark the place.“69 Schlichtweg vorausgesetzt wird dabei die Annahme, dass der Dichter tatsäch-lich dazu in der Lage ist, die Stimmen der Toten im Medium der Dichtung he-raufzubeschwören – eine Prämisse, die schon bei Whitman kaum eingehender erläutert wird. Mag auch die Anthologia Palatina – jene berühmte Sammlung von Grabinschriften, Gelegenheitsgedichten und Epigrammen, deren Entstehung den gesamten Zeitraum von der griechischen Antike bis zum Byzantinischen Reich umfasst – einen wichtigen Einfluss auf Masters’ anthologisches Projekt darstellen: Der genuin moderne dichterische Anspruch der Totenbeschwörung mit seiner Vorstellung von Realpräsenz geht über vordringlich memoriale Text-praktiken, wie etwa die Epitaphdichtung, entschieden hinaus. In diesem Sinne lesen sich die ersten Verse der Spoon River Anthology im voranstehenden Programmgedicht „The Hill“ tatsächlich wie ein Beschwö-rungsgesang:
WHERE are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley, The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter? All, all, are sleeping on the hill. One passed in a fever, One was burned in a mine, One was killed in a brawl, One died in jail, One fell from a bridge toiling for children and wife— All, all, are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.70
65 Edgar Lee Masters: Spoon River Anthology, New York 1992, S. 1. 66 Dass sich Masters selbst dieses ideengeschichtlichen Hintergrunds nicht bewusst gewesen
sein kann, zeigt die Tatsache, dass er in seiner Whitman-Biographie dessen Goethe-Kritik unhinterfragt wiedergibt. (Edgar Lee Masters: Whitman, S. 241 ff.).
67 Wenngleich auch einige wenige prominente Sprecher in der Anthologie auftauchen, so etwa Theodore Dreiser oder auch einige Abraham Lincoln nahestehende Personen.
68 Edgar Lee Masters: Spoonriver Anthology, S. [iii]–ix. 69 Ebd., S. 56. 70 Ebd., S. 1, Kursivierung des gesamten Abschnitts im Original, hier entfernt.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
201
Es ist, als würden die Toten einer Art Anrufung des Dichters folgen („WHERE are …“), wenn sie in den an diese Verse anschließenden Gedichtmonologen aus der erlebten Ich-Perspektive ihre Lebensgeschichten erzählen – und zwar durch die Stimme desjenigen ‚kollektiven‘ Dichters, dessen Autornamen (‚by Edgar Lee Masters‘) wir auf dem Titel der Erstausgabe lesen und der somit als schöp-ferische Instanz hinter jedem einzelnen der versammelten Gedichte vorausge-setzt werden muss (umgekehrt wäre es ja auch denkbar, dass Masters sich para-textuell als Herausgeber bezeichnet). Anders ist die Frage, wessen Stimme aus den Gedichten der Anthologie zu uns spricht, logischerweise nicht zu beantwor-ten: Durch den als Medium begriffenen Schriftsteller und seine Gedichte wen-den sich die Toten, die von ihrem Leben und Sterben in Versform berichten, an uns, die Leser. Springen wir nun vom frühen 20. Jahrhundert mit einem großen Satz in die unmittelbare Gegenwart. „I’m not a playwright. The people in my songs are all me“ – mit diesem Statement äußert sich Bob Dylan, als er in einem Interview nach den vielen Rollen-Ichs in den szenischen Monologen seiner späten Song-Poetry gefragt wird. Dylan reformuliert und aktualisiert mit dieser Aussage – wie schon Masters ohne ausdrücklichen Bezug – Whitmans Konzept der dichte-rischen Kollektivrede, wie Heinrich Detering bemerkt. Den ‚Multitude‘-Charakter der Dylan’schen Gleichung hebt Detering in der syntaktischen Um-kehr hervor: „Me are all the people in the songs.“71 In dieser Satzstellung ist die Nähe zwischen Dylans ‚Me‘ und Whitmans ‚I‘ sowie Goethes ‚Kollektivwesen‘ tatsächlich unübersehbar. Das bei Dylan entfaltete Konzept kollektiver Dichterrede geht nun damit ein-her, dass der ontologische Status der song characters sowohl von konventionel-len künstlerischen Figurenkonzeptionen als auch von realweltlichen Personen grundlegend unterschieden wird: „[I]t’s not a character like in a book or a mo-vie. He’s not a bus driver. He doesn’t drive a forklift. He’s not a serial killer. It’s me who’s singing that, plain and simple.“ Der Anspruch des hier beschriebenen „me“ könnte – bei aller Lakonie im Tonfall – selbstbewusster nicht sein: So wie der Künstler Bob Dylan im Laufe der Jahrzehnte in immer neuen Maskenspielen zu ‚einem Anderen‘ wurde (vom ‚Hobo‘ der frühen Jahre über den Country-Sänger der Siebziger zum religiös Erweckten der achtziger Jahre usw.), so wird auch der Sänger in seinen musikalischen Hervorbringung stets zu einem Ande-ren, der sich durch ihn – als Medium – zum Ausdruck bringt. Auch wenn dieses Autorschaftskonzept bei Dylan eher leise anklingt, fühlt man sich doch an
71 Heinrich Detering: Die Stimmen aus dem Limbus. Bob Dylans späte Song Poetry, Mün-
chen 2012, S. 45 f. (dort auch das und die folgenden Dylan-Zitate mit Quellenangaben). Anzumerken ist hier, dass in Dylans geistigem und dichterischem Kosmos Whitman ohne-hin eine zentrale Stellung zukommt (Heinrich Detering: Bob Dylan, Stuttgart 2007, S. 58). Entsprechende findet sich zu „Whitman, Walt [1819–1892]“ denn auch ein eigener Eintrag in Michael Grays Bob Dylan Encyclopedia (New York, London 2006, S. 703), der aller-dings nur einen Rückverweis auf den Eintrag „poetry, American, pre-20th century“ enthält (er findet sich auf den Seiten 541 ff., hier allerdings nur ganz kurz zu Whitman S. 542).
Kai Sina
202
Whitmans sehr viel weniger zurückhaltende Selbstbezeichnung als ‚Geist‘ oder ‚Gespenst‘ erinnert: „I the apparition, I the spectre“. Ebenfalls im Sinne Whitmans und, wie wir nun wissen, im Sinne Goethes erscheint in Dylans Äußerung die Nennung ausgerechnet des „bus drivers“ oder auch des „serial killers“ in seinen Songs: Das Spektrum der künstlerisch Einbe-zogenen erschöpft sich auch hier nicht allein in Dichtern, Künstlern und Philo-sophen, sondern es schließt die Missachteten, die Unerhörten und Verfemten immer schon mit ein. Diese moderne Idee einer egalitär-inkorporierenden Au-torschaft schreibt auch Dylan zu einem Totenkult fort, wie ihn Whitman und in seiner Folge Masters entwerfen. Dem liegt zunächst die Überzeugung zugrunde, dass sich die Toten als Unerlöste in einer Art Zwischenreich aufhalten, das Dy-lan mit Rekurs auf die religiöse Tradition denn auch als „some purgatory“ be-zeichnet:
It must be the Southern air. It’s filled with rambling ghosts and disturbed spirits. They’re all screaming and forlorn. It’s like they are caught in some weird web – some purgatory between heaven and hell and they can’t rest. They can’t live, and they can’t die. It’s like they were cut off in their prime, wanting to tell something. It’s all over the place.
Dylans Konzept einer kollektiven Dichterrede, in dem von Geistern und Seelen zunächst ja gar keine Rede ist, gewinnt vor diesem Hintergrund eine neue Quali-tät im Sinne des Totenkults: Die „characters“, die sich in seinen Songs ausdrü-cken, das sind (auch) die unerlösten Toten im Limbus. Die Songs geraten in die-ser Logik – im engsten Sinne – zur Totenbeschwörung, wie sie ähnlich bereits Masters in seinem Eingangsgedicht vornimmt („WHERE are …“). Unmissver-ständlich umrissen wird dieser Gedanke in Dylans Neubearbeitung des Blues-klassikers „Rollin’ and Tumblin’“, der sich in dieser Hinsicht geradezu als ein poetologischer Grundlagentext erweist: „The night’s filled with shadows, the years are filled with early doom / I’ve been conjuring up all these long dead souls from their crumblin’ tombs.“ So deutlich Detering den Hinweis auf Dylans Whitman-Referenz in seiner Untersuchung herausstellt, so assoziativ bleibt seine Bestimmung der – hier bloß strukturell begriffenen Nähe – des Dylan’schen Modells zu Goethes „être collec-tif“.72 Diese geahnte Nähe lässt sich vor dem Hintergrund der vorliegenden Un-tersuchung stützen und konkret fassen: Ohne dass sich Dylan des ideenge-schichtlichen Hintergrunds seines Ansatzes bewusst sein wird (und ohne dass er sich dessen bewusst sein muss), bezieht er sich mit seinem Rekurs auf Whitman stets auch auf einen durch Emerson vermittelten Goethe. Dylans auf Inhaltsebe-ne in erster Linie auf die amerikanische Kultur bezogenes Spätwerk erweist sich somit in seinem Grundansatz als ein kulturell hybrides, oder mit Goethe gespro-chen: als ein ‚weltliterarisches‘ Gebilde, was sich auf dem Album Modern Times von 2006 auch in den zahlreichen – allerdings bewusst gesetzten – Anspielun-
72 Heinrich Detering: Die Stimmen aus dem Limbus, S. 45.
Zum Konzept dichterischer Kollektivrede
203
gen auf das abendländische Erbe andeutet, so etwa auf die Tristien und die Epistulae ex Ponto des ins Exil verbannten Ovid.73 Eines zeigt der kurze Ausblick auf Dylans Songs und Masters’ Anthologie, die hier ausschnitthaft für die reiche, über Dichter wie etwa William Carlos Wil-liams und Allen Ginsberg verlaufende amerikanische Whitman-Rezeption vor-gestellt worden sind, sehr deutlich: Selbst dort, wo die amerikanische Dichtung mit ihrem Bezug auf Whitmans Idee der ‚multitude‘ ganz bei sich zu sein scheint, steht sie zugleich doch immer schon – unbewusst – in einer indirekten Beziehung zum „Kollektivwesen“ Goethes und damit zum Geistesleben der ‚al-ten Welt‘. Was der Songdichter Neil Young in einem seiner bekanntesten Lieder über die Unsterblichkeit des Rock’n’Roll feststellt, lässt sich auf das Fortleben Goethes im Kontext der amerikanischen Whitman-Rezeption somit bruchlos übertragen: „There is more to the picture / than meets the eye“.
73 Ebd., S. 27–44.