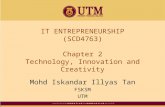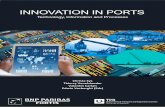Innovation - Die frühe Graphik und das Konzept der Erneuerung
Transcript of Innovation - Die frühe Graphik und das Konzept der Erneuerung
1
Innovation - Die frühe Graphik und das Konzept der Erneuerung
Lothar Schmitt
Vortrag Dresden, Kupferstich-Kabinett, 8. 1. 2014
Es wundert Sie vielleicht, dass ich Ihnen die Druckgraphik des späten 15. Jahrhunderts als innovative Kunst präsentieren möchte. Ist innovative Kunst nicht eher eine Sache der Moderne?
Einerseits ja, aber in der bildenden Kunst ist "Innovation" auch vorher schon in einem allgemeineren Sinn eng mit dem Themenkreis der Erfindung verbunden. Denn Erneuerung und Erfindung verbinden sich im Bereich der Kunst auf eine charakteristische Art und Weise. Die Bedeutung der Erfindung ist bislang meist im Rahmen der Kunsttheorie gesehen worden. Dort wurde der entsprechende lateinische Begriff "inventio" seit der Renaissance verwendet. Es war Leon Battista Alberti (Abb.1 rechts), der ihn aus dem Verständnis der antiken Rhetorik herleitete.
Abb. 1
"Inventio" ist dort die Lehre, wie man Argumente findet, aus denen man eine Rede aufbaut. Die Gabe des Erfindens wird durch Eigenschaften des Redners gefördert, zu denen die Einbildungskraft gehört. Diese Einbildungskraft, das "ingenium",
2
bestimmt nach Alberti auch das geistige Vermögen zur schöpferischen Erfindung in Skulptur und Malerei. Weil die Erfindung der Sphäre des Geistes zugeordnet wird, steht dessen gestalterisches Instrument - der Entwurf - dem praktischen Tun eines bildenden Künstlers besonders fern. Im Prozess der "Erfindung" ist der Künstler dem Schriftsteller näher als dem Handwerker.
Es gibt aber noch einen zweiten Traditionsstrang, der den Begriff der Erfindung entscheidender geprägt hat. Er ist auch für die Kunsttheorie relevant: und zwar die technische Erfindung. Die antike Quelle ist hier vor allem Plinius der Ältere, der in seiner "Naturgeschichte" Neuerungen in Malerei und Skulptur als Erfindungen beschreibt. Auch Plinius folgt rhetorischen Regeln. Denn in einer Lobrede wird eine Person unter anderem gerühmt, indem man würdigt, welche Leistung sie erstmals vollbracht hat.
Diese Art der Wahrnehmung von innovativen Tendenzen in der Kunst, die der praktischen Seite bildnerischen Gestaltens breiteren Raum gewährt als ihr Alberti zugesteht, halte ich für beachtenswert. Alberti betont nämlich den intellektuellen Akt des Entwerfens zulasten seiner gestaltenden Umsetzung in die Realität, ohne die ein Kunstwerk aber nicht entstehen kann.
Dies zu hinterfragen, ist mir deshalb so wichtig, weil die Druckgraphik regelmässig als technisch geprägte Gattung der Kunst beschrieben wird. Bei ihr ist das Konzept der "Erfindung" nicht auf den genialen Entwurf beschränkt, sondern wird in starkem Masse von der cleveren Ausführung bestimmt.
Theoretische Überlegungen zum Kupferstich sind uns aus dem 15. Jahrhundert nicht überliefert. Das ist beim frühen Buchdruck, der sich ja als technische Neuerung etwa gleichzeitig durchsetzt, anders. Hier liegt ein ausserordentlich interessantes Quellenmaterial vor. Es handelt sich um Erwähnungen der Erfindung des Buchdrucks, die in den Büchern selbst untergebracht wurden. Man findet sie zum Beispiel am Textende in Kolophonen, die alle wichtigen Informationen zum Buch enthielten, bevor sich um 1500 das Titelblatt durchzusetzen begann, oder die Widmungsvorreden, die Autoren Freiräume für Formen der Selbstdarstellung und Vermarktung boten.
Gleich in einem der frühesten gedruckten Kodizes, dem Mainzer Psalter von 1457 (Abb. 1 links), findet man am Schluss folgende Passage:
"Vorliegendes Buch der Psalmen, durch die Schönheit der Initialen geschmückt und mit unterschiedlichen Rubriken hinlänglich versehen, ist durch die kunstreiche Erfindung zu drucken" entstanden.
Sie sehen also: die Idee vom positiven Wert "innovativer" Technik ist Mitte des 15. Jahrhunderts gegenwärtig.
Üblicherweise beschäftigen sich solche Texte nicht mit Bildern sondern ausschliesslich mit Büchern. Dennoch findet sich ein Gedankengang, der für die Kunstgeschichte ausgesprochen wichtig ist, bislang allerdings dafür noch nicht herangezogen wurde: Der Buchdruck wird nämlich teilweise mit den
3
Spitzenleistungen der antiken Kunst verglichen, die vor allem bei Plinius besprochen werden, den ich ja schon erwähnt habe.
In einer kurz nach 1460 in Strassburg erschienenen Bibelausgabe findet sich nämlich am Schluss des Exemplars der British Library ein handschriftliches Lob, das ein Basler Dozent (Rudolf von Langen) dem Drucker des Bandes, Johannes Mentelin, widmete. Darin stellt er die Leistung Mentelins denen des Bildhauers Phidias und des Malers Apelles zur Seite, die im alten Griechenland berühmte Bildnisse der Göttin Athena und des Herrschers Alexander schufen. Das mit der Skulptur und Malerei verbundene, fest etablierte Ensemble von Werten unterstützt auf diese Weise das Ansehen des noch neuen Buchdrucks.
Dass auch der Kupferstich als technische Innovation gewürdigt wurde, ist spätestens seit der Mitte des 16. Jahrhunderts belegt. Damals schrieb Giorgio Vasari in seiner Sammlung von Künstlerbiographien, es sei ein Florentiner, Maso da Finiguerra, gewesen, der als erster Kupferstiche hergestellt habe (Abb. 2 links). Eine Behauptung, die dann wenige Jahre später von dem Strassburger Autor Johann Fischart (Abb. 2 rechts) brüsk zurückgewiesen wurde: Längst vor Finiguerra hätten, so schreibt Fischart, oberrheinische Künstler bereits als Kupferstecher gewirkt. Nicht zufällig verweist Fischart bei dieser Gelegenheit auf den Buchdruck, der seit 1458 in Strassburg und Mainz betrieben worden sei, und dem die Erfindung des Kupferstichs vorausgegangen sein müsse. Diese übrigens ganz einzigartige Verknüpfung der Ursprünge von Kupferstich und Buchdruck, zeigt, dass es spätestens zu Fischarts Zeiten möglich war, die Erfindung beider Techniken argumentativ miteinander zu verknüpfen.
4
Abb. 2
Diese theoretischen Überlegungen passen sehr gut zu Befunden aus der Praxis. Denn das Drucken von Büchern ist in den Jahrzehnten vor 1500 ebenso stark von innovativen Experimenten geprägt wie das gleichzeitige Drucken von Bildern. So finden wir - um zwei beliebige Beispiele herauszugreifen - bereits 1482 erste erfolgreiche Versuche, Texte mit Blattgold zu drucken (Abb. 3 links). Der Drucker, dem dies gelang, ist der Augsburger Erhard Ratdolt, der damals in Venedig tätig war. Er kehrte später nach Augsburg zurück und hat dort erstmals aufwendige Farbholzschnitte von mehreren Druckstöcken als Illustrationen seiner Bücher eingesetzt. Zu den Experimenten, die damals im Bilddruck erprobt werden, gehören Samt-, Flitter- und Teigdrucke (Abb. 3 rechts). Solche Drucktechniken zielten allesamt darauf ab, ausgerechnet das zu überwinden, was wir seit dem 19. Jahrhundert als Eigenschaften von Graphiken besonders schätzen. Die Betonung der Linie, die Monochromie und die unverstellte Wirkung des Papiers als Trägermaterial. Statt dessen ermöglichten die neuen, kurzlebigen Techniken des 15. Jahrhunderts höchst effektvolle Relief- und Farbwirkungen und lebten von der täuschenden Imitation von Metallen, Stoffen und Edelsteinen. Das mag uns befremden, war jedoch in höchstem Masse innovativ!
5
Abb. 3
Soviel allgemein zur Geschichte der Innovation im Buch- und Bilddruck. Ich möchte dies als Ausgangspunkt nutzen, um an einem anschaulichen Beispiel zumindest anzudeuten, wie man die gängigen Fragen, die Kunsthistoriker an Kunstwerke richten, um Überlegungen erweitern kann, die der Technik und der Funktion von Kupferstichen gelten. Und dies, wie sie sehen werden, im Milieu des frühen Buchdrucks der burgundischen Niederlande.
Die Erforschung niederländischer Kupferstiche ist eng an Dresden und die hiesige Sammlung gebunden, denn hier war die Wirkungsstätte eines der besten Kenner der Graphik des 15. Jahrhunderts - Max Lehrs (Abb. 4).
6
Abb. 4
Lehrs hat vor allem von Dresden aus über einen langen Zeitraum hinweg beharrlich den Plan verwirklicht, ein Verzeichnis aller Kupferstiche zu erstellen, die im 15. Jahrhundert nördlich der Alpen entstanden sind. Nach aufwendigen Vorarbeiten veröffentliche er zwischen 1908 und 1934 dieses neunbändige Verzeichnis. Bis heute kann man Kupferstiche des 15. Jahrhunderts nicht erforschen ohne immer wieder "den Lehrs" zu konsultieren. Denn es gibt wohl keinen Kunsthistoriker, bei dem Kennerschaft in solchem Masse persönliche Vertrautheit mit jedem einzelnen Werk bedeutet. Und das sind im Fall der Kupferstiche viele tausend Objekte. Von Lehrs' Kennerschaft profitieren wir also noch heute. Und das haben wir auch Dresden und seinem Kupferstich-Kabinett zu verdanken.
Dennoch ist das von Max Lehrs zusammengetragene Material nicht ganz vollständig. Es gibt nach meiner Schätzung etwa 200 Kupferstiche, die nicht bei Lehrs aufgelistet sind. In vielen Fällen kannte Lehrs diese Blätter zwar, doch wurde er zu spät auf sie aufmerksam, um sie noch in den passenden Band seines Katalogs aufzunehmen. Manchmal hat Lehrs solche Kupferstiche dann in separaten Publikationen bekannt gemacht. Und auf einen dieser nachträglich publizierten Blätter möchte ich etwas ausführlicher zu sprechen kommen: Es ist der Jason-Stich des Museum of Fine Arts in Boston (Abb. 5).
7
Abb. 5
Dieser Kupferstich ist auf den ersten Blick gar nicht innovativ: Er bietet in technischer Hinsicht nichts neues und mehrere gestalterische Details sind aus älteren Werken übernommen. Darauf komme ich noch zurück. Aber in anderen Bereichen bietet das Blatt aus Boston mehrere wichtige Neuerungen. Es ist die erste bekannte Darstellung des Jason-Mythos im Kupferstich und es gehört zu einer kleinen Gruppe von Buchprojekten, in denen Kupferstiche als Illustrationen erprobt wurden. Auch hier haben wir also einen Fall, in dem innovative Tendenzen in Buch- und Bilddruck parallel zueinander auftreten.
Im Rahmen meines Beitrags zur Publikation, die die aktuelle Ausstellung begleitet, hatte ich mich mit diesem Blatt schon ein wenig beschäftigt. Denn es ist ein charakteristischer Fall für eine eigenständige Form der Auseinandersetzung mit der Antike, die man während des 15. Jahrhunderts nördlich der Alpen insbesondere in der Druckgraphik beobachten kann. Auch das ist ein wichtiger innovativer Impuls. Wir haben es hier mit dem paradoxen Phänomen eines Rückbezugs auf die antike Kultur zu tun, der sonst meist als Errungenschaft der italienischen Renaissance aufgefasst wird. Für die Ausstellung, in der ja die kennzeichnenden Leistungen des
8
italienischen und des niederländischen Kupferstichs Seite an Seite präsentiert werden, schien mir das ein geeigneter Ansatzpunkt.
Als anonyme niederländische Arbeit hätte Max Lehrs den Jason-Stich eigentlich im vierten Band seines Verzeichnisses besprechen müssen, der 1921 erschien. Dafür war es aber offenbar zu spät, denn Lehrs hat das Blatt noch im selben Jahr in einem kurzen Aufsatz veröffentlicht. Dort wird erwähnt, der Kupferstich stamme aus der Sammlung Sewall und befinde sich im Museum of Fine Arts. Über die Sammlung Sewall sind wir heute besser unterrichtet als Lehrs. Bei ihrem Besitzer handelt es sich um Henry Foster Sewall, Mitglied einer angesehenen Familie aus Neuengland, der 1816 in New York geboren wurde und 1896 dort starb. Sein Vater war Mitinhaber einer Firma, die sich erfolgreich im Überseehandel und in der Passagierschifffahrt betätigte. Auch Henry Sewall selbst hat sich später an der Firmenleitung beteiligt. In seiner Freizeit baute er eine gut 20.0000 Blatt umfassende Sammlung von Altmeistergraphik auf, die nach seinem Tod für das Museum of Fine Arts angekauft wurde. In dessen Besitz befindet sich das Blatt seit Ende 1897. Max Lehrs hat die Bostoner Sammlung nie gesehen, aber der damalige Leiter des Print Departments, Sylvester Koehler, ein Künstler der aus Leipzig stammte und um 1850 in die Vereinigten Staaten ausgewandert war, hatte Lehrs über die dortigen Graphik-Bestände unterrichtet. Da der Jason-Stich damals jedoch als italienische Arbeit galt, erfuhr Lehrs von seiner Existenz zunächst nichts. Koehlers Amtsnachfolger (Fitzroy Carrington) machte jedoch seinen Londoner Kollegen vom British Museum, Campbell Dodgson, auf den Jason aufmerksam. Dodgson war mit Lehrs gut befreundet und unterrichtete ihn von dem neuen Fund.
Lehrs hatte keine Mühe, den Kupferstich sowohl inhaltlich als auch formal richtig einzuordnen: Das Blatt ist 17,8 × 13,4 cm gross, die Masse der Einfassungslinie betragen 17,1 × 12,5 cm. Ausserhalb der Einfassungslinie sind in den Ecken Abdrücke von Nägeln zu erkennen, mit denen die Platte auf einer Unterlage befestigt gewesen sein muss.
In einer verbindenden Landschaft werden mehrere Abenteuer gezeigt, die Jason, der Anführer der Argonauten, in Kolchis erlebte, als er das Goldene Vlies raubte. Der Horizont ist ganz weit nach oben gerückt, um möglichst viel Platz auf der Bildfläche zu schaffen, damit verschiedene Szenen gezeigt werden können, in denen der Held einige seiner Taten vollbringt. Denn König Aietes gewährte ihm, das Goldene Vlies aus Kolchis wegzuführen, nur unter der Bedingung, dass es Jason gelinge, die dort lebenden feuerspeienden Stiere vor einen Pflug zu spannen und Drachenzähne in der durchfurchten Erde zu säen. Jason stellte sich diesen Aufgaben, die er dank der zauberkundigen Königstochter Medea tatsächlich bewältigte.
Im Vordergrund des Kupferstichs steht Jason breitbeinig vor den Stieren. Er bekämpft sie jedoch nicht mit seinem Schwert, das unbenutzt in der Scheide steckt,
9
sondern hebt mit seiner rechten Hand lediglich einen Ast empor. Währenddessen streckt er mit der linken Hand den Stieren ein Salbengefäss entgegen, aus dem er ein Elixier giesst, dass ihm Medea zu seinem Schutz mitgegeben hat. Die Stiere wenden sich mit ihren ehernen Hufen und feuerspeienden Nüstern kampfbereit gegen Jason. Die Felsen, die sie umgeben, und der dichte Wald hinter Jason unterstreichen die Bedrohlichkeit der Situation, unterstützen aber auch die Trennung zum Mittelgrund, wo Jason rechts erneut gezeigt wird.
Diesmal bricht er dem besiegten Drachen die Zähne aus, die er weiter hinten in einer zweigeteilten Szene aussät und unterpflügt. Dort steht er am linken Bildrand und hält in seiner rechten Hand einen Drachenzahn. Er wendet sich über einen Weg hinweg nach rechts, wo er auf einem von Furchen durchzogenen Feld den Pflug lenkt, den die beiden besänftigten Stiere am Joch ziehen. Aus dem Feld klettern kleine Soldaten empor, die nach der Argonautensage aus der Saat der Drachenzähne hervor wuchsen. Anstatt jedoch, wie von Aietes erhofft, gegen Jason zu kämpfen, töteten sich die Soldaten - von unserem Helden zum Brudermord angestachelt - gegenseitig.
Die charakteristische Rüstung, die Jason trägt, hilft, um zu erkennen, dass es immer dieselbe Figur ist, die im gleichen Bildraum in wechselnden Szenen gezeigt wird. Er trägt einen mit kleinen Metallbuckeln gepanzerten Lentner. Die weiten Ärmel sind halblang. Seinen Helm zeichnet eine tief herabhängende Helmfeder, ein kräftig geschwungenes Visier und ein mit Kugeln besetzter Nackenschutz aus.
Abb. 6
10
Diese Art der Rüstung findet sich in recht gut vergleichbarer Form auf den Kupferstichen des Monogrammisten W mit dem Schlüssel (Abb. 6), die Motive aus den Feldlagern der Burgunderkriege unter Karl dem Kühnen zeigen. Die Herleitung des Motivs aus dem burgundischen Kontext bietet einen ersten Anhaltspunkt dafür, wann und wo der Jason-Stich entstanden ist. Die weiterführende Analyse seines Stils ist jedoch komplexer als man auf den ersten Blick vermuten könnte, denn die Darstellung verarbeitet bildliche Vorlagen, die sich mit der gestalterischen Umsetzung des Stechers vermischen. Auf einige Werke, die aus dem Kreis des Vorlagenmaterials stammen, komme ich noch zu sprechen.
Eine Betrachtung der Stichtechnik und zeittypischer Besonderheiten der dargestellten Motive führt auf Anhieb zu brauchbaren Ergebnissen. Dies gelingt deshalb, weil das singuläre Sujet des Jason-Stichs verwertbare Parallelen zu einem anderen Thema besitzt, das in der Druckgraphik des 15. Jahrhunderts häufig dargestellt worden ist: der Drachenkampf des Hl. Georg.
Abb. 7
Betrachtet man nun einen frühen Drachenkampf wie den des Meisters der Nürnberger Passion (Abb. 7), der sich im Kunstmuseum Basel befindet, so fallen einige Gemeinsamkeiten auf. Sie tragen dazu bei, dass der Jason-Stich etwas altertümlich wirkt. Dazu gehört der weit nach oben gelegte Horizont, und die Art, wie Felsen charakterisiert werden. Ihre Bruchkanten sehen in beiden Fällen ein wenig wie die von Eisbergen aus. Ein Element des Basler Drachenkampfs war jedoch
11
so aus der Mode gekommen, als der Jason-Stich entstand, dass es dort nicht mehr zu finden ist: Gemeint ist die Verwendung von Musterbuch-Motiven, die der Stecher des Basler Blatts noch in der Nachfolge des Meisters der Spielkarten verwendet.
Abb. 8
Auch mit dem Georgskampf des Meisters ES (Abb. 8) verbinden den Jason-Stich einige Gemeinsamkeiten. Auf eine echte Motivübernahme hat bereit Max Lehrs aufmerksam gemacht: die Stadt im Hintergrund, in deren Zentrum eine Kirche mit zwei Türmen steht, und die von einer Mauer umgeben wird, zu deren einem Tor eine hölzerne Brücke führt, hat der anonyme Stecher des Jason-Blatts seitenverkehrt nach dem entsprechenden Detail des Meisters ES übernommen. Eine von ihm häufig verwendete, zeittypische Darstellungskonvention ist auch im Jason-Stich präsent: Es sind die krautartig wachsenden Pflanzen, die meist im Vordergrund auf dem Boden verteilt werden. Die Pflanze in der linken unteren Ecke und der von Blättern umgebene Felsblock darüber sind im vorliegenden Fall erneut nach dem Georgskampf des Meisters ES kopiert. Auch darauf hat schon Lehrs hingewiesen.
Eine Entwicklung, die der Stecher des Jason-Blatts nicht vollzieht, ist die Ausrichtung der Stichtechnik am Vorbild Martin Schongauers und seiner Zeitgenossen. Es sind dies die geschwungenen, formumschreibenden Schraffuren, mit denen es teils sogar gelingt, die Texturen von Oberflächen wiederzugeben. Ein Beispiel aus dem niederländischen Raum ist der Drachenkampf des Meisters FVB
12
(Abb. 9), der in Details wie der Felsformation am rechten Rand und den Schwingen des am Boden liegenden Drachen den Neuerungen in frühen Arbeiten Schongauers folgt.
Abb. 9
Aus den bisher genannten Beobachtungen kann man herleiten, dass der Jason-Stich etwa in den 1470er Jahren, kaum jedenfalls früher und wohl auch nicht viel später entstanden sein dürfte. Zwei der genannten Vergleichswerke - die Blätter des Meisters der Nürnberger Passion und des Monogrammisten FVB - stammen zudem aus der Region des Niederrheins und der Niederlande. Dies erlaubt die Vermutung, dass der Jason-Stich ebenfalls aus diesem Raum stammt. Aber das liegt aus anderen Gründen sowieso auf der Hand.
Denn der Jason-Mythos ist eng mit den burgundischen Niederlanden verbunden. Es war Philipp der Gute, Herzog von Burgund, der 1430 den Orden vom Goldenen Vlies gründete. Der Ritterorden, der die bedeutendsten Adligen des Landes zu einer Gemeinschaft vereinte, stand auf Wunsch Philipps unter der Schirmherrschaft des antiken Helden Jason. Und das, obwohl dessen eheliche Untreue ihn in den Augen von Kritikern dafür ebenso ungeeignet machte wie seine zum Liebeswahn neigende Gefährtin Medea. Aus den Kreisen des hohen Klerus gab es deshalb Versuche, den heidnischen Jason durch den biblischen Helden Gideon zu ersetzen, dem ein Vlies
13
als göttliches Siegeszeichen gedient hatte. Philipp der Gute verfolgte jedoch eine andere Strategie. Die Jason-Legende wurde auf seinen Wunsch hin so umgeschrieben, dass die Tugend des Helden nicht mehr in Frage gestellt werden konnte. Einer der Autoren, der sich dieser Aufgabe annahm, war der Kaplan des Ordens, Raoul Lefèvre.
Abb. 10
Seine "Histoire de Jason" entstand um 1460 wohl im Auftrag Philipps des Guten. Das Exemplar der Handschrift, das Lefèvre dem Herzog gewidmet hat, befindet sich heute in der Bibliothèque de l'Arsenal in Paris (ms. 5067). Es enthält auf fol. 105r (Abb. 10) eine Miniatur mit einer sehr ähnlichen Zusammenstellung von Szenen wie der Kupferstich. Ausserhalb der Halle, wo Medea ihren Jason mit Zaubersprüchen und dem unsichtbar machenden Elixier ausstattet, tritt Jason vorne den feuerspeienden Stieren entgegen. Im Mittelgrund tötet er den Drachen, weiter hinten säet er dann die Drachenzähne, aus denen die Krieger wachsen. Zu guter Letzt zieht er dem Widder das goldene Fell über die Ohren. Aber es gibt auch Unterschiede: Anders als im Kupferstich nähert sich Jason in der Miniatur den Stieren mit gezücktem Schwert. An die Stelle der Tötung des Widders tritt im Stich der pflügende Bauer. Dennoch ist die inhaltliche Nähe zwischen den beiden Jason-Darstellungen insbesondere in der gleichzeitigen Darstellung mehrerer Szenen auffällig.
14
Seit der Mitte der 1470er Jahre wurden mehrere Drucke von Lefèvres Jason-Geschichte in den Niederlanden und in Frankreich veröffentlicht. Um 1484 gesellte sich eine erste illustrierte Ausgabe hinzu. Deshalb könnte man erwarten, dass auch der Jason-Stich als Bildausstattung einer Inkunabel verwendet werden sollte.
Abb. 11
Der Holzschnitt der Haarlemer Ausgabe (Abb. 11), der Jasons Abenteuer in Kolchis zeigt, unterscheidet sich allerdings deutlich vom Bostoner Blatt. Links im Hintergrund liegt die Argo vor Anker, während der gerüstete Jason mit hoch erhobenem Schwert am Strand von Kolchis steht und sich anschickt, den hintereinander aufgereihten Tieren den Garaus zu machen. Nicht den Stieren, sondern dem Drachen geht es zuerst an den Kragen. Er sieht einem Krokodil nicht unähnlich und stimmt darin mit dem Drachen des Jason-Stichs recht gut überein. Ansonsten sind die Verbindungen jedoch geringer als man erwarten könnte.
Es gibt jedoch einen anderen Druck, der einen Holzschnitt enthält, der tatsächlich deutliche Parallelen zum Jason-Stich besitzt. Es ist die Illustration zum Jason-Kapitel (Abb. 12) in der französischen Prosabearbeitung von Ovids Metamorphosen, die im Mai 1484 von Colard Mansion in Brügge herausgegeben wurde. Die Illustration entspricht der Hauptszene des Kupferstichs recht genau, zeigt in einigen Details aber auch Verbindungen zu dem Haarlemer Holzschnitt. Links liegt erneut die Argo am Ufer von Kolchis. Breitbeinig steht dort der gerüstete Jason. Er erhebt sein Schwert gegen die beiden Stiere und schützt sich mit einem Gefäss, in dem sich das Zauberelixier befindet, vor ihrem feurigen Atem. Die zum Angriff vorgestreckten Hufe des oberen Stiers und die Felsformation hinter ihm, entsprechen deutlicher als bei allen bisher gesehenen Vergleichsbildern dem Kupferstich aus Boston. Die Felsen sind im Holzschnitt jedoch überzeugender motiviert als im Kupferstich, denn
15
diesmal erkennt man den Drachen, der eine Höhle bewacht, in die sich der Widder zum Schutz zurückgezogen hat. Anders als im Kupferstich wird hier also nicht der ganze Verlauf der Geschichte in einem Bild zusammengedrängt, sondern der Handlungsakzent auf den furiosen Auftakt der Prüfungen gelegt, die Jason zu bestehen hat.
Abb. 12
Die ausführliche Schilderung der Jason-Legende in den Prosafassungen des "Ovide moralisé", von denen Colard Mansions Druck eine Variante bildet, war im Milieu des burgundischen Hofes natürlich genauso gut aufgehoben, wie Lefèvres "Histoire de Jason". In Mansions Ovid-Edition wird der Kampf Jasons mit den Stieren, dem der Holzschnitt gewidmet ist, besonders ausführlich geschildert. Der Holzschnitt illustriert also im besten Sinne den Text.
Dass Mansion in unserer Geschichte just an dieser Stelle auftritt, ist ein wichtiges Indiz dafür, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Denn Mansion, eine führende Figur im Handel mit kostbaren Handschriften für den burgundischen Hof, war es, der sich auch auf die Produktion von besonders luxuriösen Buchdrucken spezialisierte. Sie sollten einen ähnlichen Kundenkreis ansprechen. Deshalb sind sie in französischer Sprache verfasst und aufwändig bebildert. Und es ist sicher kein Zufall, dass es ausgerechnet Mansion war, der als erster Verleger überhaupt versuchte, ein gedrucktes Buch mit Kupferstichen zu illustrieren. Denn genau so etwas dürfte es ja sein, was uns auch mit dem Bostoner Blatt vor Augen steht.
16
Abb. 13
Dieser erste bekannte Buchdruck, der mit Kupferstichen ausgestattet wurde, ist eine französische Übersetzung von Boccaccios "De casibus virorum illustrium" (Abb. 13 links). Mansion hat sie 1476 in Brügge verlegt. Das Bild, das in Mansions Boccaccio-Ausgabe dem ersten Buch vorangestellt wurde, zeigt Adam und Eva, die an Boccaccios Schreibpult treten, um ihm von ihrer Geschichte zu erzählen. Dieses Bild existiert heute in drei Versionen, die alle von unterschiedlichen Stechern stammen. Zwei davon sind nur jeweils in einem einzigen Exemplar erhalten. Die erste, ein Fragment in Paris (Abb. 13 rechts), wird oft als Werk des Hausbuchmeisters bezeichnet. Die zweite, heute in Wien, ähnelt Miniaturen des Meister der Maria von Burgund, der Handschriften für das höfische Umfeld illuminierte. Die von Mansion verwendete Variante ist eine vereinfachte Kopie nach dem Stich in Paris und wurde teils dem Meister des Dresdener Gebetbuchs, teils auch dem Brügger Goldschmied Marc le Bongeteur zugeschrieben. Sie übersetzt die feingliedrige Stichelführung der Vorlage in eine leichter zu druckende, robustere Liniensprache.
Das gleichzeitige Vorkommen dreier stilistisch sehr verschiedener Fassungen wird seit Max Lehrs' Interpretation meist so verstanden, das Mansion mehrere Stecher aufforderte, eine geeignete Darstellungsform für die Illustration seiner Boccaccio-Ausgabe zu entwickeln, und dass seine Wahl auf die langweiligste, dafür aber am
17
professionellsten ausgeführte Version fiel, deren Stecher dann den Auftrag erhielt, auch den Rest der benötigten Bilder anzufertigen. Ob es genau so war, wissen wir natürlich nicht. Aber wenn gleichzeitig mehrere eigenständige Künstler in Mansions Umfeld tätig waren, dann ist auch leichter verständlich, warum der Jason-Stich, der von keinem der drei genannten Künstler stammen dürfte, ebenfalls für Mansion gearbeitet haben könnte.
Es gibt aber noch einen weiteren Faktor, der den Brügger Verleger ins Spiel bringt: Colard Mansion unterhielt enge Verbindungen zu einem der bedeutendsten Büchersammler seiner Zeit: Lodewijk van Gruuthuse, Diplomat im Dienste der burgundischen Herzöge unter Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen. Er besass in Brügge einen Palast, in dem er die grösste Sammlung illuminierter Handschriften aufbewahrte, die es neben der herzoglichen Bibliothek gab. An die 200 Handschriften sollen es gewesen sein. Ein Grossteil von ihnen erwarb später der französische König Ludwig XII. Sie werden heute in der Bibliothèque Nationale in Paris aufbewahrt. Mansion hatte offenbar Zugang zu diesen Handschriften, denn mehrfach dienten sie als Grundlage für seine Buchdrucke.
Abb. 14
In Gruuthuses Bibliothek befand sich nun auch eine illuminierte französische Ovid-Übersetzung (Abb. 14), die vor 1480 in Brügge angefertigt wurde (BNF, ms. fr. 137). Ihre Miniaturen werden heute dem Meister der Margarete von York und seiner Werkstatt zugeschrieben. Auf fol. 86v enthält die Handschrift am Beginn des Jason-
18
Kapitels ein Bild, das für unsere Fragestellung von grösster Bedeutung ist. Der Zusammenhang zwischen der Pariser Handschrift und Mansions Druck ist zwar von der Forschung schon erkannt worden, die sehr viel engere Verbindung der Miniatur mit dem Stich wurde bislang jedoch übersehen. Um es deutlich zu sagen: Wahrscheinlich ist das Blatt in Boston nach der Handschrift in Paris kopiert.
Jason hält nämlich erstmals so wie auf dem Bostoner Blatt einen Ast statt eines Schwerts in der Rechten. Die Gestaltung der Stiere entspricht sich in beiden Fällen bis hin zu Merkmalen des Körperbaus. Auch der Drachenkampf und der pflügende Bauer, der bislang in keinem Vergleichswerk zu finden war, stimmen weitgehend überein. Das gilt ebenso für die Verteilung der Szenen in der Landschaft. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Stecher des Bostoner Blatts sich bei der Gestaltung seines Bildes ganz unmittelbar an der Miniatur des Meisters der Margarete von York orientierte.
Dennoch gibt es erneut Unterschiede (Abb 15), von denen einige in anderen Vergleichswerken besser übereinstimmen. Die Form der Bäume etwa ähnelt dem Ovid-Holzschnitt des Mansion-Drucks. Das würde auch von dem Bodenbewuchs gelten, wenn wir nicht wüssten, dass er nach dem Meister ES kopiert worden ist. Und die Felsformationen, auf die ich bei der Besprechung von Georgs Kampf mit dem Drachen hinwies, die der Meister der Nürnberger Passion schuf, haben in der Brügger Miniatur einen anderen Charakter. In der Summe bleibt jedoch festzuhalten, dass der Bostoner Jason wahrscheinlich während der 1470er Jahre in Brügge entstand und Vorbildern aus dem Milieu der burgundischen Hofkunst folgt, darunter insbesondere der Handschrift aus dem Besitz Gruuthuses.
Abb. 15
19
Da unter den Holzschnitten von Mansions "Ovid moralisé" nur die Jason-Szene mit einem Bild der Pariser Handschrift Ähnlichkeiten besitzt, diese Ähnlichkeiten im Bostoner Stich aber um weitere Parallelen bereichert werden, ist es gut möglich, das der Holzschnitt, nicht nach der Miniatur, sondern nach dem Stich kopiert wurde. Davon ganz unabhängig macht die Nähe zwischen dem Jason in Boston und dem Holzschnitt der Ovid-Ausgabe den Kupferstich umso interessanter.
Denn über das bisher gesagte hinaus deutet er im grösseren Zusammenhang der europäischen Druckgraphik des 15. Jahrhunderts auf die Bedeutung von Kupferstichen im Metier des Buchdrucks (Abb. 16). Die Einschätzung die in der Forschung über die Rolle von Kupferstichen als Buchillustrationen von Frühdrucken vorherrscht, hat nämlich meines Erachtens eine Imagekorrektur dringend nötig. Bisher gilt die Verwendung von Kupferstichen in gedruckten Büchern als entwicklungsgeschichtliche Sackgasse. In der Tat passen die Herstellungsverfahren des Hochdrucks, der für die Bücher, und des Tiefdrucks, der für die Kupferstiche verwendet wird, nicht zusammen. Text und Illustration können also anders als bei Holzschnitten nicht in einem Arbeitsgang gedruckt werden. In der Forschung werden deshalb Buchprojekte, in denen dennoch Kupferstiche zum Einsatz kamen, zwar gern als Kuriosum erwähnt, aber ansonsten kaum weiter beachtet. Bekannt sind vor allem die Florentiner Ausgaben von Antonio da Sienas "Monte santo di Dio" (1477) und Dantes "Commedia" (1481; Abb. 16) sowie Mansions Boccaccio-Ausgabe.
Abb. 16
20
Sowohl sie als auch die beiden Florentiner Drucke zeigen an den erhaltenen Exemplaren dieser Bücher, dass es beim Druck zu erheblichen Problemen kam. In der Dante- ebenso wie in der Boccaccio-Ausgabe, sind die Stiche nur selten an den dafür freigelassenen Stellen in den Text gedruckt worden. Dass war aufwendig und ungenau. Statt dessen hat man die Stiche meist nachträglich in die vorgesehenen Lücken hinein geklebt. Das ist eigentlich auch nicht verwunderlich. Denn eine der wichtigsten Funktionen, für die Kupferstiche im 15. Jahrhundert verwendet wurden, war es nun mal, als Illustrationen in Handschriften geklebt zu werden. Gerade am Niederrhein und in den Niederlanden gab es mehrere Künstler, die sich auf die Anfertigung solcher Bilder spezialisiert hatten. Bei den mit Kupferstichen illustrierten Inkunabeln wird das Einkleben der Bilder jedoch meist als Indiz dafür gewertet, dass diese Projekte gescheitert seien. Aber trotz der Schwierigkeiten, mit denen man in den Offizinen zu kämpfen hatte, wurde immer wieder versucht, den Kupferstich mit dem Buchdruck zu vereinen. Für mich ist das kein Zeichen von Uneinsichtigkeit, sondern von Innovationswillen. Wer sich im 15. Jahrhundert auf das noch wenig erprobte Unternehmen einliess, Bücher zu drucken, der musste wagemutig sein. Und deshalb sind solche Druckexperimente wie die von Mansion keine Fehlschläge, sondern ein wichtiges Zeichen dafür, wie man versuchte, etwas neues zu leisten.
Auch im Fall des Bostoner Blatts geht der innovative Impuls höchstwahrscheinlich vom Buchgewerbe aus. Mansion versuchte, besonders luxuriöse Drucke herzustellen, die den Qualitäten von Handschriften nahe kamen. Dafür schienen ihm vermutlich Kupferstiche geeigneter als die bereits weit verbreiteten Holzschnitt-Illustrationen. Das ist zum einen durch das kleinteilig differenzierte Liniennetz eines Kupferstichs bedingt, mit dem ein Holzschnitt nicht konkurrieren konnte. Zum anderen könnte es aber gerade auch der grosse technische Aufwand sein, den Mansion nicht scheute, um so ein Produkt anbieten zu können, dass niemand anderes im Sortiment hatte. Auch das ist schliesslich eine Form von Luxus.
Solch innovative Impulse blieben nicht auf Mansions Anteil an den Buchprojekten beschränkt, sondern prägen das Bostoner Blatt, dass ja auch als eigenwertiges Kunstwerk bestehen kann. Denn der Stecher hat nicht einfach die vorhandene Miniatur der Pariser Handschrift kopiert, sondern mit mehreren anderen Vorlagen zu einem neuen Werk verarbeitet, das selbst einen unverwechselbaren Charakter hat und dem Holzschnitt der Ovid-Ausgabe vielleicht sogar seinerseits als nachahmenswerte Anregung diente. Mit der Kombination mehrerer Szenen in einem Bildfeld wurde der Jason-Stich ebenso wie die Miniatur dem Zweck gerecht, die Handlung der Legendenerzählung zu illustrieren. Gleichzeitig wurde das gestalterische Muster in eine neue Technik übertragen, bei der die Feinheit der Linien an die Stelle der Leuchtkraft von Farben trat. Der Jason Stich ist also kein Ersatz für Bestehendes sondern etwas erkennbar Neues. Auch das macht aus dem Jason-Stich einen höchst kreativen Beitrag zum Medienwandel an der Schwelle vom Mittelalter zur frühen Neuzeit.