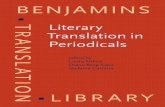Die Rolle der Berliner Indologie und Indienkunde im "Dritten Reich"
Topographische Struktur und Medialität: Zu Walter Benjamins Konzept des Eingedenkens in der...
Transcript of Topographische Struktur und Medialität: Zu Walter Benjamins Konzept des Eingedenkens in der...
1
Topographische Struktur und Medialität: Zu Walter Benjamins Konzept des Eingedenkens in der Berliner Kindheit um neunzehnhundert Andreas Kirchner ([email protected])
1. Einleitung
Ungewöhnlich für ein autobiographisches Werk erscheint Walter Benjamins Berliner Kindheit um neunzehnhundert schon allein in seiner Materialität: Mit etwas mehr als hundert Seiten ist es ein recht schmales Bändchen. Dieser etwas befremdliche erste Eindruck verstärkt sich beim Betrachten des Inhaltsverzeichnisses. Auffallend viele der selten über zwei Seiten langen Kapitel sind mit Ortsangaben überschrieben. Seien es solche, die eindeutig auf Berlin verweisen, wie «Die Siegessäule», «Tiergarten», «Stieglitzer Ecke Genthiner», oder andere, die keiner bestimmten Stadt zuzuordnen sind wie «Verstecke» oder «Krumme Straße». Bereits jetzt wird deutlich, dass Benjamins Kindheitsbuch nicht den Konventionen einer chronologisch nacherzählten Kindheit folgen wird, sondern statt einer zeitlichen eine räumlich orientierte Ordnung etabliert. Eine weitere Besonderheit der Berliner Kindheit geht ebenfalls bereits aus dem Studium des Inhaltsverzeichnisses hervor: Zwölf der insgesamt 42 Stücke befinden sich im Anhang, der mit «Fragmente aus früheren Fassungen» überschrieben ist.1 Allein aus der beträchtlichen Anzahl der Fragmente wird erkennbar, dass es sich nicht um geringfügige Veränderungen zwischen den einzelnen Fassungen handeln kann.
Im Gegenteil: Nicht nur was die Auswahl der Stücke, sondern auch, was deren Form und Inhalt betrifft, weisen die verschiedenen Fassungen erhebliche Unterschiede auf , die von Bedeutung für die Entwicklung des Benjaminschen Erinnerungskonzepts ist. Um dies zu verdeutlichen, wird im Folgenden zunächst die Textgenese von der Berliner Chronik bis zur Berliner Kindheit in der Fassung letzter Hand skizziert. Anschließend soll auf Benjamins Konzept des Eingedenkens, das der Berliner Kindheit um neunzehnhundert zu Grunde liegt, selbst eingegangen werden. Dabei stehen zwei Thesen im Zentrum des Interesses: Die erste bezieht sich auf die Etablierung der topographischen Grundstruktur und die Notwendigkeit zur Umarbeitung als Folgen von Benjamins Erinnerungskonzept. Im Anschluss daran wird die Frage nach einer authentischen Fassung der Berliner Kindheit behandelt. Die zweite These betrifft das Verhältnis von individueller und kollektiver Erinnerung unter Einbeziehung der medialen Implikationen der Berliner Kindheit. Den Ausgangspunkt hierfür wird die Beleuchtung des Verhältnisses von
1 Benjamin, Walter: Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Fassung letzter Hand und Fragmente aus früheren Fassungen. Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno. Frankfurt am Main 1987, S. 6 (fortan zit.: FlH). Alle bisherigen Aussagen beziehen sich auf diese Ausgabe.
2
Benjamins Konzept des Eingedenkens zu Marcel Prousts mémoire involontaire bilden. Abgeschlossen werden die Überlegungen mit einer kurzen Untersuchung einiger Entsprechungen zwischen der Berliner Kindheit und Benjamins letztem Werk, den Thesen Über den Begriff der Geschichte, die als erkenntnistheoretische Grundlage nicht nur Benjamins historischer, sondern auch seiner autobiographischer Schriften angesehen werden können.
2. Die Textgenese «Manchmal träume ich den zerschlagenen Büchern nach – der berliner Kindheit
um neunzehnhundert und der Briefsammlung – und dann wundere ich mich, woher ich die Kraft nehme. ein neues ins Werk zu setzen.»2
2.1. Kleine Geschichte der Berliner Kindheit
Die ältesten Texte, die später Eingang in die Berliner Kindheit finden, erschienen «erstmals am 03.12.1926 unter dem Titel ‹Kinder› in der Literarischen Welt.»3 Zwei Jahre später wurden sie, bereits auf sechs Texte erweitert, unter der Überschrift «Vergrösserungen» Bestandteil von Benjamins im Berliner Ernst Rowohlt Verlag erschienenen ersten Buchveröffentlichung Einbahnstraße.4 Wie Nicolas Pethes feststellt, verweisen die sechs Texte vor allem formal bereits auf die Berliner Kindheit. Konsequent verwirklicht Benjamin in ihnen sein Credo «das Wort ‹ich› nie zu gebrauchen»5, was ihm als Qualitätsmerkmal einer guten Sprachbeherrschung gilt.6
Nachdem es im Oktober 1931 zu einem Vertrag zwischen Benjamin und der Literarischen Welt über «eine Folge von Glossen» über Berlin «in loser, subjektiver Form» (GS VI, S. 476) kam, nahm das Buchprojekt der Berliner Chronik konkrete Formen an.7 Dieser erste, die Lebensgeschichte Benjamins von seiner Kindheit über die Schulzeit bis hin zu seinen ersten Aktivitäten in der Berliner Jugendbewegung noch relativ kontinuierlich erzählende Versuch einer Autobiografie wurde allerdings nicht vollendet und erst 1970 von Gershom Scholem publiziert.8
2 Benjamin, Walter: Briefe. Hg. und mit Anmerkungen versehen von Gershom Scholem und Theodor W. Adorno. Zweiter Band. Zweite Auflage. Frankfurt am Main I993, S. 695 (fortan zit.: Br. 2). 3 Witte, Bernd: Bilder der Endzeit. Zu einem authentischen Text der Berliner Kindheit von Walter Benjamin. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Hg. von Richard Brinkmann und Walter Haug. Band 58 (1984), S. 570. 4 Ebd. 5 Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften. Hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main 1972ff. Band VI, S. 475. (fortan zit.: GS) 6 Vgl. hierzu auch: Pethes, Nicolas: Mnemographie. Poetiken der Erinnerung und Destruktion nach Walter Benjamin. Tübingen 1999, S. 268. 7 Vgl. hierzu Günter, Manuela: Anatomie des Anti-Subjekts. Zur Subversion autobiographischen Schreibens bei Siegfried Kracauer, Walter Benjamin und Carl Einstein. Würzburg 1996, S. 111. Während Günter im Beginn der Berliner Chronik einen Bruch mit dem Topos der Autobiografie als ‹Herzensschrift› sieht, sei mit Pethes (s. Anm. 6) darauf verwiesen, dass auch Rousseau seine Arbeit selbst als Auftragsarbeit inszeniert. Die Inszenierung eines äußeren Grundes für das Schreiben einer Autobiografie stellt selbst ein Topos in der Autobiographik dar. Man denke nur an Goethes Dichtung und Wahrheit. 8 Vgl. hierzu Witte (s. Anm. 3), S. 572, Pethes (s. Anm. 6), S. 269 und Günter (s. Anm. 7), S. 111.
3
Für die hier angestellten Überlegungen sind vor allem die methodischen Selbstreflexionen der Berliner Chronik von Interesse, auf die im Folgenden noch mehrfach eingegangen werden wird.
1932 erfolgte eine völlige Umarbeitung der Berliner Chronik hin zur Berliner Kindheit, in die etwa zwei Fünftel des Materials eingearbeitet wurden. Ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Erinnerungswerken liegt darin, dass sich Benjamin in der Berliner Kindheit gänzlich vom chronologischen Erzählen löst und stattdessen Textminiaturen den Vorzug gibt, die in keinem zeitlichen oder kausalen Verhältnis zueinander stehen.9
Zwar spricht Benjamin bereits in einem Brief an Gershom Scholem vom 28. Februar 1933 davon, dass er den Text «als abgeschlossen ansehen [kann], da mit der Abfassung des letzten Stücks [«Die Mummerehlen», AK] – der Reihenfolge nach das erste, denn es ist als Anfangsstück ein Pendant zum letzten, dem ‹bucklichten Männlein› geworden – die Zahl von dreißig erreicht ist» (Br. 2, S. 563). Dies hält ihn jedoch nicht davon ab, die Berliner Kindheit bis 1938 mehreren Überarbeitungen zu unterziehen, womit zwischen den ältesten, in der Literarischen Welt veröffentlichten Texten und der Fassung letzter Hand zwölf Jahre liegen.
Die Anfang 1933 an Scholem gesendete Fassung konnte Benjamin an die Frankfurter Zeitung verkaufen, «die daraus im Februar und März 1933 drei Folgen mit insgesamt zwölf Stücken publizierte.»10 Eine Veröffentlichung des gesamten Buches im Kiepenheuer Verlag, dem Benjamin das Manuskript angeboten hatte, kam nicht zustande; vermutlich auch, weil der Verlag seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten selbst erhebliche Probleme bekommen hatte.11
Die politische Lage machte es für Benjamin zusehends schwieriger, überhaupt noch Texte in Deutschland zu publizieren, weshalb er sich im Sommer 1933 im Exil auf Ibiza mit Jean Selz daran machte, Teile der Berliner Kindheit ins Französische zu übersetzen. Währenddessen arbeitete Benjamin auch an neuen Texten, wie er Gretel Adorno in einem undatierten Brief berichtet:
Bevor ich ganz in dieser Lektüre [zur Vorbereitung eines Gedenkartikels zu Wielands 200-sten Geburtstag, AK] verschwinde, hoffe ich aber sehr, ein weiteres Stück der «Berliner Kindheit» abzuschließen, das «Der Mond» heißt. Die Ähnlichkeit, welche Du zwischen den «Loggien» und dem «Fieber» bemerkt hast, besteht natürlich. Mir selber aber stehen die beiden Stücke sehr unterschiedlich nah; weit näher als das frühere das erstgenannte, in dem ich eine Art von Selbstporträt erblicke. Wahrscheinlich werde ich es anstelle jenes photographischen, das in den «Mummerehlen» enthalten ist, an die erste Stelle des Buches setzen. Mit der französischen Übersetzung geht es langsam, doch auf sehr zuverlässige Art voran (Br. 2, S. 591).
Einige der neuen Stücke wurden unter Pseudonymen als Einzelstücke bis zum August 1934 in der Frankfurter Zeitung und der Vossischen Zeitung publiziert. Am 7. April sandte Benjamin ein Manuskript einer erweiterten und neu angeordneten Fassung an Gretel Adorno und bot es – abermals erfolglos – dem Erich Reiss Verlag zur Publikation an.12
9 Vgl. Pethes (s. Anm. 6), S. 268f. 10 Witte (s. Anm. 3), S. 574. 11 Ebd. 12 Vgl. ebd.
4
Eine letzte tiefgreifende Umarbeitung erhielt die Berliner Kindheit im Frühjahr 1938, möglicherweise auch motiviert durch die Hoffnung auf eine Publikation in Buchform, die allerdings ein weiteres Mal nicht zustande kam. Lediglich sieben Stücke aus dieser deutlich gestrafften Fassung wurden in der Exilzeitschrift Maß und Wert veröffentlicht.13
Erst 1950 erschien die Berliner Kindheit in einer Fassung von Theodor W. Adorno, die er nach mündlichen Äußerungen Benjamins und eigenen Erinnerungen zusammengestellt hat, als Buch. Diese Fassung liegt auch der 1972 im IV. Band der Gesammelten Schriften veröffentlichten Adorno-Rexroth-Fassung zu Grunde, in der die in der 1950er Fassung fehlenden Stucke ergänzt und einige Texte durch neuere Versionen ersetzt wurden, soweit solche verfügbar waren.14 Giorgio Agamben fand 1981 in der Bibliothèque Nationale im Nachlass von Georges Bataille ein Textkonvolut mit Manuskripten Benjamins, unter dem sich ein Typoskript mit der Aufschrift «Handexemplar komplett» befand, das als Fassung letzter Hand im VII. Band der Gesammelten Schriften und 1987 um Fragmente früherer Fassungen erweitert als Einzelausgabe in der Bibliothek Suhrkamp erschien.15 Neben der lange Zeit nicht zugänglichen Giessener Fassung, die vermutlich zwischen Dezember 1932 und Mitte Januar 1933 entstanden ist, handelt es sich bei der Fassung letzter Hand um die einzige Version, die Anweisungen Benjamins zur Auswahl und Anordnung der Texte betrifft. Zur Frage, ob die Fassung letzter Hand deshalb als authentische Fassung der Berliner Kindheit anzusehen ist, wird im Rahmen der konkreten Besprechung von Benjamins Poetik der Autobiografie Stellung genommen werden.
2.2 Von der Chronik zur Kindheit
Die grobe Skizzierung der Entstehungs- und Publikationsgeschichte von den ersten, in der Literarischen Welt erschienenen Texten, bis hin zur Fassung letzter Hand, sollte bereits deutlich gemacht haben, das es nicht unproblematisch ist von der Berliner Kindheit als Walter Benjamins Autobiografie zu sprechen. Anhand ausgewählter Passagen soll nun herausgearbeitet werden, wie sich die ständigen Umarbeitungen konkret in den Texten niederschlagen. Als Basis für den Vergleich dienen die in Band VI der Gesammelten Schriften abgedruckte Berliner Chronik, die Adorno-Rexroth-Fassung aus Band IV und die in der Bibliothek Suhrkamp veröffentlichte Fassung letzter Hand.
In einer der in der Berliner Chronik noch zahlreich anzutreffenden theoretischen Reflexionen distanziert sich Benjamin ausdrücklich vom ‹klassischen›, chronologisch aufgebauten Modell der Autobiografie:
Erinnerungen, selbst wenn sie ins Breite gehen, stellen nicht immer eine Autobiographie dar. Und dieses hier ist ganz gewiß keine. auch nicht für die berliner Jahre, von denen hier ja einzig die Rede ist. Denn die Autobiographie hat es mit der Zeit. dem Ablauf und mit dem zu tun, was den stetigen Fluß des Lebens ausmacht. Hier aber ist von einem Raum, von Augenblicken und vom Unstetigen die Rede. Denn wenn auch Monate und Jahre hier auftauchen, so ist es in der Gestalt, die sie im Augenblick des Eingedenkens haben (GS Vl, S. 488).
13 Ebd. 14 Ebd., S. 575. 15 Ebd., S. 575f.
5
Es wird allerdings schnell deutlich, dass Benjamin seinen eigenen Ansprüchen in der Berliner Chronik noch nicht gerecht wird. So gelingt es ihm nicht, die zeitliche Struktur der herkömmlichen Autobiographik in die von ihm intendierte räumliche umzusetzen. Auch wenn die Berliner Chronik allein schon durch die zahlreichen selbstreflexiven Passagen keine chronologische Nacherzählung seiner Kinder- und Jugendzeit darstellt, wie es die Bezeichnung seiner Arbeit als Chronik nahe legt, bleiben die einzelnen Teile doch zeitlich eindeutig aufeinander beziehbar. Zudem lassen sich verschiedene Stadien der Entwicklung Benjamins von der frühen Kindheit bis hin zur Berliner Phase der Jugendbewegung hin erkennen. Eine topographische Grundstruktur, wie sie bereits aus dem Inhaltsverzeichnis der Berliner Kindheit in der Fassung letzter Hand durch die zahlreichen auf Orte bezogenen Überschriften hervorgeht, ist der Berliner Chronik nicht zu attestieren.
Aber auch auf anderen Ebenen lässt sich Benjamins deutliche Abgrenzung zur konventionellen Autobiographik entkräften. Wie Manuela Günter treffend herausarbeitet, fällt die Stimme des Erzählers
wie in der Autobiographie, mit derjenigen des Autors zusammen, die lch-Perspektive des Autors/Erzählers ist derjenigen der erzählten Figur übergeordnet und die frühen Bilder sind von der Interpretation des Erwachsenen deutlich zu unterscheiden.16
Mit Philippe Lejeune gesprochen ist der Fortbestand des autobiographischen Pakts somit zweifellos gewährleistet.17 Benjamin etabliert sich bereits zu Beginn des Textes als ein aus zeitlicher und räumlicher Distanz auf seine Kinder- und Jugendzeit zurückblickender Autor, den Inhalt der Berliner Chronik bilden in erster Linie erinnerte Ereignisse und Erfahrungen: Er problematisiert seine Sozialisation als Kind einer großbürgerlichen jüdischen Familie um die Jahrhundertwende, seine
Kritik des wilhelminischen Schul- und Universitätsbetriebs geht in diejenige der bürgerlichen Jugendbewegung über, in der sich Benjamin stark engagiert hatte, und die Retrospektive nennt Namen von Freunden (Fritz Heinle, Franz Hessel), berühmten Zeitgenossen (Franz Pfempfert, Else Lasker-Schüler) sowie literarische Präferenzen (Proust, Aragon).18
Zudem flechtet Benjamin nicht nur Bezüge zu seinem eigenen Werk, sondern neben den die Autobiographik betreffenden auch gesellschaftskritische Reflexionen in die Berliner Chronik ein. Manuela Günter beschreibt das Erinnerungsmodell, das der Berliner Chronik zu Grunde liegt, als analog zum psychoanalytischen Verfahren, weshalb sie die Vorgaben des autobiographischen Musters nicht durchbrochen sieht.
Was sich im Text reproduziert ist das einsame Subjekt, das seine kritische Kraft auf die Realität zu richten vermag und hierüber Selbstbewußtsein und, auf der Ebene der Textproduktion, Werkherrschaft gewinnt. Insofern steht die Berliner Chronik eindeutig in der Tradition der Autobiographie, die in der Weimarer Republik durch die verstärkte Thematisierung sozialer
16 Günter (s. Anm. 7), S. 111. 17 Vgl. Lejeune, Philippe: Der autobiographische Pakt. Frankfurt am Main 1994, S. 27ff. 18 Günter (s. Anm. 7), S. 112.
6
Probleme erhebliche Modifikationen erfahren hat, ohne daß das Modell als ganzes in Frage gestellt worden ist.19
Auch wenn die Berliner Chronik den von Benjamin selbst gestellten Ansprüchen nicht genügt – die bereits zitierte Forderung nach der Vermeidung des «ich» wird beispielsweise erst in der deutlich entsubjektivierten Fassung letzter Hand annähernd erreicht – stellt sie durch ihre zahlreichen Reflexionen über das Erinnern eine Art «poetologische[r] Konstruktionsskizze der späteren Fassung»20 dar, die hilfreich für die Analyse derselben sein kann.21
3. Benjamins Eingedenken als zentraler Begriff seines autobiografischen Schreibens – zwei Thesen
In der bereits zitierten Passage der Berliner Chronik fällt der für Benjamins autobiographisches Schaffen zentrale Begriff des Eingedenkens, der die von Benjamin unter dem Einfluss und in Abgrenzung von Prousts mémoire involontaire entwickelte Methode der autobiographischen Erinnerung beschreibt. Im Folgenden soll der Begriff des Eingedenkens beleuchtet und seine Bedeutung für die Berliner Kindheit herausgestellt werden. In einem ersten Schritt wird gezeigt, wie die konsequente Applikation des Eingedenkens sich auf die Grundstruktur der Berliner Kindheit auswirkt. Anschließend sollen die medialen Implikationen des Eingedenkens im Zentrum des Interesses stehen und abschließend seine Bedeutung für die Verschränkung von individueller und kollektiver Erfahrung erarbeitet werden. Der Gedankenskizze liegen zwei Thesen zu Grunde:
1. Der Begriff des Eingedenkens fördert nicht nur die Ab- und Auflösung der zeitlichen Grundstruktur der Berliner Chronik durch eine topographische Grundstruktur der Berliner Kindheit, sondern erzwingt durch seine starke Bindung an die Jetztzeit des sich Erinnernden auch eine permanente Umarbeitung der Autobiografie. Diese Annahme steht Bernd Wittes These von der Fassung letzter Hand als authentischer Fassung der Berliner Kindheit diametral entgegen, da es folglich keine authentische Fassung geben kann.
2. Einer der Hauptkritikpunkte Benjamins an Prousts mémoire involontaire ist seine Beschränkung auf das Private. Mit dem Begriff des Eingedenkens versucht Benjamin, individuelle und kollektive Erinnerungen miteinander zu verbinden und gleichzeitig die Spuren seines eigenen Subjektes in der Berliner Kindheit zu minimieren. Die Einbeziehung der modernen (Massen)Medien, die um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert in Konkurrenz zu den Leitmedien Buch/Schrift treten, unterstützt dies. Auf diese Weise gelingt es ihm außerdem, ein die Vorteile der verschiedenen Medien in sich vereinendes Medienkompendium zu schaffen, ohne letztlich das der Schrift zu verlassen.
19 Ebd., S. 112f. 20 Pethes (s. Anm. 6), S. 269. 21 Vgl. Günter (s. Anm. 7), S. 114f.
7
3.1. Die Etablierung einer topographischen Grundstruktur
Auch wenn Benjamin in der Berliner Chronik weiterhin einer zeitlichen Grundstruktur verhaftet bleibt, gibt er doch mit dem Hinweis auf den Begriff des Eingedenkens das Stichwort für die Auflösung einer temporalen zu Gunsten einer topographischen Anordnung. Das Benjaminsche Eingedenken steht einer «scheinbaren chronologischen Kontinuität» der Vergangenheit entgegen und
unterbricht den Fluß des Geschehens, trennt Bruchstücke heraus und erweist sich damit als Form, die sich auf die Diskontinuität – im historischen Prozeß wie in der individuellen Lebensgeschichte – richtet. Dementsprechend zeigen sich dem Erinnernden keine Abläufe oder Entwicklungen, sondern Bilder.22
Die Verbindung des Eingedenkens mit aus der Kontinuität herausgelösten, diskontinuierlichen Bildern macht bereits deutlich, dass die «Erinnerung bei Benjamin ein[en] durchweg medialen Charakter [bekommt]»23, erinnert die Beschreibung des Verfahrens doch stark an die Praxis des Fotografierens.
Bereits zu Beginn der Berliner Chronik erläutert Benjamin sein langjähriges Vorhaben, die erinnerte Zeit als «Raum des Lebens – Bios – graphisch», gleich einem «Pharusplan» oder einer «Generalstabskarte» (GS VI, S. 466) zu gestalten, worauf «die erinnerten Augenblicke [...] sich dann zum Gedächtnis wie die markierten Stellen zu einem Stadtplan»24 verhalten. Für Benjamin ist
das Gedächtnis nicht ein Instrument zur Erkundung der Vergangenheit [...] sondern deren Schauplatz. Es ist das Medium des Erlebten wie das Erdreich das Medium ist, in dem die toten Städte verschüttet liegen (GS VI. S. 486).
Dies bedeutet allerdings nicht, dass Benjamin intendiert, auch generalstabsmäßig geplant durch die Topografie seiner Erinnerung zu schreiten. Stattdessen etabliert er in der Miniatur «Tiergarten» eine Kunst des Verirrens, die nicht nur von einer traumhaft-surrealistischen Stadtwahrnehmung zeugt, sondern sich auch auf Benjamins Erinnerungsmethode und das Konstruktionsprinzip seines Kindheitsbuchs übertragen lässt:
Sich in einer Stadt zurechtfinden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man sich im Walde verirrt, braucht Schulung. Da müssen Straßennamen zu dem Irrenden so sprechen wie das Knacken trockner Reiser und kleine Straßen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten so deutlich wie eine Bergmulde widerspiegeln. Diese Kunst habe ich spät erlernt; sie hat den Traum erfüllt, von dem die ersten Spuren Labyrinthe auf den Löschblättern meiner Hefte waren. Nein, nicht die ersten, denn vor ihnen war das eine, welches sie überdauert hat. Der Weg in dieses Labyrinth, dem seine Ariadne nicht gefehlt hat, führte über die Bendlerbrücke, deren linde Wölbung die erste Hügelflanke für mich wurde. Unweit von ihrem Fuße lag das Ziel: Der Friedrich Wilhelm und die Königin Luise. […] Daß es mit diesem Irrgarten etwas auf sich hat, erkannte ich seit jeher an dem breiten, banalen Vorplatz, der durch nichts verriet, daß hier, wenige Schritte von dem Korso der Droschken und Karossen abgelegenen, der sonderbarste Teil des Parkes schläft. Davon empfing ich ein Zeichen (FlH, S. 23).
22 Günter (s. Anm. 7), S. 113. 23 Steinmayr, Markus: Mnemotechnik und Medialität. Walter Benjamins Poetik des Autobiographischen. Frankfurt am Main 2001, S. 174. 24 Günter (s. Anm. 7), S. 113.
8
Indem sich Benjamin in seine Vergangenheit wie das Kind in das Labyrinth seiner animistisch beseelten Umgebung begibt, entstehen die für die Berliner Kindheit um neunzehnhundert so charakteristischen Bilder, die «als reflexive Momentaufnahmen nebeneinander [stehen] und […] ausschnitthaft die Topographie der Kindheit [umschreiben].»25
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese Methode stellt das Stück «Loggien» dar, das sich am Anfang der Fassung letzter Hand befindet:
Wie eine Mutter, die das Neugeborene an ihre Brust legt ohne es zu wecken, verfährt das Leben lange Zeit mit der noch zarten Erinnerung an die Kindheit. Nichts kräftigte die meine inniger als der Blick in die Höfe, von deren dunklen Loggien eine, die im Sommer von Markisen beschattet wurde, für mich die Wiege war, in die die Stadt den neuen Bürger legte. Die Karyatiden, die die Loggia des nächsten Stockwerks trugen, mochten ihren Platz für einen Augenblick verlassen haben, um an dieser Wiege ein Lied zu singen, das wenig von dem enthielt, was mich für später erwartete, dafür jedoch mit dem Spruch, durch den die Luft der Höfe mir berauschend blieb. Ich glaube, daß ein Beisatz dieser Luft noch um die Weinberge von Capri war, in denen ich die Geliebte umschlungen hielt; und es ist eben diese Luft, in der die Bilder und Allegorien stehen, die über meinem Denken herrschen, wie die Karyatiden auf der Loggienhöhe über die Höfe des Berliner Westens (FlH, S 11).
Bereits die ersten Sätze der «Loggien» sind von eminenter Bedeutung für die Berliner Kindheit. Durch die Einführung zweier ‹Kinder› – der Erinnerung und des erinnerten Kleinkindes selbst – wird dem Leser bereits nahegelegt, die Erinnerungsarbeit in engem Zusammenhang mit der Kindheit selbst zu betrachten. Direkt danach wird auf die besondere Bedeutung der Loggien sowohl für die Erinnerung der Kindheit als auch für die Kindheit selbst hingewiesen: Die den Hinterhöfen zugewandten Loggien erwecken nicht nur die Erinnerung des Erwachsenen an seine Kindheit, sondern werden ihm im konstruierenden Eingedenken der Vergangenheit zur Wiege und damit zu einem denkbar wichtigen Ort der Kindheit. So wie die Loggia zur Wiege des Kindes wird, wird die Stadt zu seiner Mutter, da sie es ist, die den neuen Bürger in seine Wiege legt. Die sofortige Kennzeichnung des Kindes als «Bürger» ist auffällig, und dass Benjamin dieses Hineingeborensein in das Großbürgerturn nicht positiv besetzt, lässt sich in der Dunkelheit der Loggien erkennen, deren Markisen bereits in jüngsten Jahren einen Schatten auf das weitere Leben des Kindes werfen. Dass dem so ist, bestätigt der weitere Verlauf des Ausschnitts: Die Luft der Loggien als Medium der Gerüche und Geräusche beeinflusst noch den späteren Denker Benjamin, dem die Wärme und die liebevollen Wünsche aus den Wiegenliedern der vom Kind beseelten Karyatiden verwehrt blieben.
Die Loggia stellt einen Zwischen- und Schwellenraum zwischen der großbürgerlichen Innen- und der Außenwelt dar: Auf der einen Seite kündet sie bereits durch ihre Architektur von Glanz und Reichtum des Großbürgertums, auf der anderen Seite ermöglichen sie den Blick in den Hinterhof, als Ort hinter der Fassade, in dem sich dem Kind auch Armut und Klassengegensätze der Außenwelt offenbaren. Der Begriff der Loggia als Schwelle ist allerdings nicht nur räumlich zu sehen:
25 Lindner, Burkhardt. Das ‹Passagen-Werk›, die ‹Berliner Kindheit› und die Archäologie des ‹Jüngstvergangenen›. In: Passagen. Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Hg. von Norbert Bolz und Bernd Witte. München 1984, S. 28.
9
Das Kind merkt auf die Lücken in der glatten Oberfläche. Seinen Wohn- und Lebensraum vergleicht es mit einem abgelegenen Warteplatz: das Verborgene, das die Neugierde nährt, ist hier lokalisiert. lm Warten wird dem Kommenden gleichsam ein Platz bereitet. Geschichte wird gerade im Abseits, dort wo sie nicht hinzugelangen scheint, als umbruchbedürftig erfahren. Loggia und Hof sind als Warteplatz ein Zeit-Raum: das Aufgeschobene kündigt sich an.26
Die Verschränkung von Raum und Zeit im Denkbild der «Loggien» wird besonders am Ende der Miniatur deutlich:
Seitdem ich Kind war, haben sich die Loggien weniger verändert als die anderen Räume. Sie sind mir nicht nur darum nahe. Es ist vielmehr des Trostes wegen, der in ihrer Unbewohnbarkeit für den liegt, der selbst nicht mehr recht zum Wohnen kommt. An ihnen hat die Behausung des Berliners ihre Grenze. Berlin – der Stadtgott selber – beginnt in ihnen. Er bleibt sich dort so gegenwärtig, daß nichts Flüchtiges sich neben ihm behauptet. In seinem Schutze finden Ort und Zeit zu sich und zueinander. Beide lagern sich hier zu seinen Füßen. Das Kind jedoch, das einmal mit im Bunde gewesen war, hält sich, von dieser Gruppe eingefaßt, auf seiner Loggia wie in einem längst ihm zugedachten Mausoleum auf (FlH, S. 13).
Neben der nochmaligen Betonung der Loggia als räumlich-zeitlichem Schwellenort wird am Ende des Textes gewissermaßen der Bogen von der Geburt des Kindes bis zu seinem Tod geschlagen, das Selbstportrait über den räumlichen Umweg der Loggia abgeschlossen, in dem die bürgerliche Geburt des Kindes als Totgeburt entlarvt wird.27 So steht die Zeit in «Loggien» – wie in der gesamten Berliner Kindheit – unter einer eigentümlichen Spannung: Gerade weil die Loggien in ihrer Unveränderlichkeit die vergangene Epoche des Bürgertums symbolisieren, spricht Benjamin ihnen einen in die Zukunft gerichteten Erkenntniswert zu.28
Die Verschränkung der Zeitebenen
In dem der Fassung letzter Hand vorangestellten Vorwort, das als letztes Überbleibsel der ausgedehnten, explizit selbstreflexiven Passagen der Berliner Chronik anzusehen ist, formuliert Benjamin seine Hoffnung auf den Zukunftsbezug der Berliner Kindheit folgendermaßen:
Dagegen sind die Bilder meiner Großstadtkindheit vielleicht befähigt in ihrem Innern spätere geschichtliche Erfahrung zu präformieren. In diesen wenigstens, hoffe ich, ist es wohl zu merken, wie sehr der, von dem hier die Rede ist, später der Geborgenheit entriet, die seiner Kindheit beschieden war (FlH. S. 9f).
Benjamin distanziert sich in dieser Passage explizit von der Vorstellung, dass er als Autor dazu in der Lage ist, rückblickend seine Kindheit zu beschreiben, wie sie gewesen ist. Stattdessen betont er, dass den Texten der Berliner Kindheit seine spätere psychologische und soziale Lebenssituation eingeschrieben ist ,und reflektiert damit seine Position als Autor und den Prozess seiner Textproduktion. Auf diese Weise ist auch Benjamins Kennzeichnung der «Loggien» als Selbstportrait zu verstehen, das sich keineswegs nur auf seine Kindheit bezieht:
26 Stüssi, Anna: Erinnerung an die Zukunft. Walter Benjamins «Berliner Kindheit um Neunzehnhundert». Göttingen 1977, S. 138. 27 Vgl. Schweppenhäuser, Hermann: Physiognomie eines Physiognomikers. ln: Zur Aktualität Walter Benjamins. Hg. von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main 1972, S. 171. 28 Vgl. für das Panorama Bub, Stefan: Sinnenlust des Beschreibens. Mimetische und allegorische Gestaltung in der Prosa Walter Benjamins. Würzburg 1993, S. 16.
10
Und was sind die [in den «Loggien» genannten, AK] Bilder und Allegorien anderes als Metaphern eines poetischen Produktionsprozesses, der alle folgenden Miniaturen der ‹Berliner Kindheit› mit der gleichen Luft erfüllen wird. Eingeschrieben ist also dem Text als verborgenes Bild der (Schrift-)Zug seines eigenen Schaffensprozesses: Selbst-Porträt.29
Während sich in der Berliner Chronik die selbstreflexiven Passagen noch eindeutig von den Kindheitserinnerungen unterscheiden lassen, verwebt Benjamin in der Berliner Kindheit mit Ausnahme des kommentierenden Vorwortes in der Fassung letzter Hand diese beiden Textebenen zunehmend zu einem schwierig aufzulösenden Geflecht.
Aus der Betonung der Beziehung zwischen der geschilderten Vergangenheit und der jeweiligen Jetztzeit des sich Erinnernden ergibt sich nicht nur eine weitere Verschränkung der Zeitebenen und eine subtile Art der Selbstreflexion im Text, sondern auch eine Möglichkeit zur bzw. Erklärung für die mehrfache Umschreibung der Autobiografie gerade durch den Verzicht auf den Anspruch auf eine authentische Darstellung durch ein autonomes Autorsubjekt. Nach Nicolas Pethes, der eine strikt selbstreferentielle Lesart der Berliner Kindheit verfolgt,
handelt [es] sich also um eine Verschränkung aller Zeitebenen durch die Identifizierung von Schreiben und Lesen. von Bahnung und Wirkung der Erinnerungs-Spur: Im Jetzt des Schreibens bildet sich das Lesen des Vergangenen als Vorausdeutung der Zukunft.30
Der Begriff des Lesens ist hier in Anlehnung an Hofmannsthals Diktum «Was nie geschrieben wurde, lesen»31 in einem umfassenden, nicht auf schriftliche Texte beschränkten Sinn zu verstehen.
Gibt es eine authentische Fassung?
Unter Berücksichtigung der bisher erarbeiteten Teilergebnisse soll nun auf die Frage eingegangen werden, ob die Fassung letzter Hand als authentische Fassung der Berliner Kindheit anzusehen ist. Bernd Witte entwickelt diese Auffassung in seinem 1984 erschienenen und bereits mehrfach zitierten Aufsatz «Bilder der Endzeit. Zu einem authentischen Text der Berliner Kindheit von Walter Benjamin.»32 Witte charakterisiert die Struktur der Fassung letzter Hand folgendermaßen:
Nicht nur ist sie durch eine stete Aufnahme und Variation einiger weniger Themen durchkomponiert, sie folgt einem tektonischen Plan, den es als sinntragende Struktur des Ganzen zu entdecken gilt. So entspricht dem ersten Ensemble von fünf und sieben Texten, die zusammen mit dem Einleitungstext eine Dreizehnergruppe bilden, am Ende des Werkes eine ebensolche Sequenz, zunächst eine Fünfergruppe, die sich um den zentralen Text ,«Krumme Straße» versammelt, dann eine Siebenergruppe mit ,«Unglücksfälle und Verbrechen» im Mittelpunkt, schließlich der Text «Zwei Blechkapellen», der für sich allein stehend, die grundsätzliche Polarität des Werkes ins Bewußtsein hebt und so die Textfolge abschließt.33
29 Muthesius, Marianne: Mythos, Sprache, Erinnerung. Untersuchungen zu Walter Benjamins ,«Berliner Kindheit um neunzehnhundert.» Basel und Frankfurt am Main 1996, S 65. 30 Pethes (s. Anm. 6), S. 304 Pethes verweist an dieser Stelle auf Stüssi (siehe Anm. 26), S. 87: «Die Erinnerung vermag das heterogene Leben zu raffen und lesbar zu machen. In der blitzartigen Erleuchtung der Erinnerung erscheint das Leben als ‹Schrift›, als sinnträchtige Figur.» 31 Hofmannsthal, Hugo von: Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Gedichte, Dramen I 1891–1898. Hg. von Herbert Steiner. Frankfurt am Main 1979, S. 298. 32 Witte (s. Anm. 3). 33 Witte (s. Anm. 3), S. 590.
11
Zwischen diese beiden Dreizehnergruppen versucht Witte einen aus fünf Stücken bestehenden und sich um den Text «Der Fischotter» gruppierenden Mittelteil zu etablieren. Nach der zweiten Dreizehnerguppe bildet «Das bucklichte Männlein» den Abschluss der Struktur der Fassung letzter Hand. Eine eingehende Analyse, inwiefern die Einteilung in die verschiedenen Gruppen und Subgruppen, wie Witte sie vornimmt, unter thematischen Gesichtspunkten überhaupt sinnvoll erscheint, kann an dieser Stelle nicht geleistet werden. Stattdessen soll auf anderen Ebenen gegen Wittes Authentifizierungsversuch der 1938er Fassung argumentiert werden.
Bereits die Tatsache, dass es Witte selbst nicht gelingt, das Stück «Zwei Blechkapellen» besser in das zweite Dreizehnerschema einzuarbeiten als mit dem Argument, dass es, «für sich alleinstehend, die grundsätzliche Polarität des Werkes ins Bewußtsein hebt»34, lässt die Konstruktion brüchig erscheinen, von dem schwer abgrenzbaren Mittelteil ganz zu schweigen. Dazu kommt noch, dass Witte die «Loggien» als Einleitungstext versteht, ihn aber im Gegensatz zu dem Schlusstext «Das bucklichte Männlein» in eine Dreizehnergruppe zu integrieren versucht. Die Binnenstruktur um die von ihm als zentral bezeichneten Miniaturen «Krumme Straße» und «Unglücksfälle und Verbrechen» bleibt ebenfalls zweifelhaft, erfahren diese Texte in der einschlägigen Sekundärliteratur doch deutlich weniger Aufmerksamkeit als beispielsweise die sich in Wittes Schema in der Peripherie befindenden Stücke «Die Mummerehlen», «Markthalle» oder «Tiergarten».
Dabei soll an dieser Stelle weder abgestritten werden, dass Benjamin die Arrangements seiner Stücke mit Bedacht und Sorgfalt ausgewählt hat, noch dass der Fassung letzter Hand als der historisch jüngsten Fassung eine besondere Bedeutung zukommt. Es handelt sich bei ihr allerdings nicht um die einzige Version, in der die Reihenfolge als eine von Benjamin selbst festgelegte identifiziert werden konnte: Wie bereits angedeutet, existiert mit der Giessener Fassung bereits eine deutlich ältere, die zwar ebenfalls dreißig Stucke enthält und deren Anordnung sich bereits grob mit der der Fassung letzter Hand deckt (vgl. hierzu GS Vl, S. 721ff). Durch die Eingliederung neuer und das Fallenlassen älterer Texte verändern sich die Strukturen der verschiedenen Fassungen jedoch so weit, dass Wittes komplexe Sinnkonstruktion der Fassung letzter Hand – sollte ihr überhaupt Folge geleistet werden – lediglich für diese Version gelten kann.
Das Hauptargument gegen Wittes These von der Fassung letzter Hand als authentischer Version der Berliner Kindheit liegt jedoch nicht in ihren eigenen Ungereimtheiten, sondern in Wittes Missachtung von Benjamins an die jeweilige Jetztzeit des sich Erinnernden gebundenen Erinnerungskonzeptes, von dem nicht nur die bereits angeführten zahlreichen Umarbeitungen eindrucksvoll Zeugnis ablegen. In diesem Zusammenhang ist eine Passage aus dem oben angeführten Brief an Gershom Scholem vom 28. Februar 1933 von Interesse, in der Benjamin über die Arbeit an der Berliner Kindheit folgendes schreibt: «Im Übrigen kann ich seit einigen Wochen den Text, wenn ich es will, als abgeschlossen ansehen, da mit der Abfassung des letzten Stucks […] die Zahl von dreißig erreicht ist» (Br. 2, S. 563). Die Textlänge erscheint somit als
34 Ebd.
12
das einzige, was Benjamin wirklich festgelegt hat, die Äußerung, nach der er den Text als abgeschlossen ansehen kann, wenn er es will, kann auf seine gesamt Arbeit an seiner Autobiografie bezogen werden. Benjamin setzt willkürlich Zeitpunkte – beispielsweise wenn Aussicht auf Publikation besteht –, zu denen der Text vorläufig abgeschlossen wird, während die Erinnerung als «das Vermögen endloser Interpolation im Gewesenen» (GS VI, S. 476) letztlich nie vollendet werden kann.
Als wesentlich gestraffte und von zu persönlichen Erinnerungen befreite Fassung erscheint sie auch tatsächlich als konsequenteste Ausführung der [...] Poetik des Textes. Allerdings ist die letzte Hand nur als die historisch letzte zu sehen. Denn der dargestellte Entstehungsprozess ist nicht nur historisch, sondern vor allem auch poetologisch relevant. Wenn der Text von vornherein immer auch die Geschichte seiner Transformation erzählt und Benjamin die Umarbeitungen auch noch fortsetzt, als keinerlei Aussicht auf eine Publikation mehr besteht, verbietet sich seine Fixierung ex post von selbst. Vielmehr ist der Umarbeitungsprozeß selbst als Teil des Erinnerungsprozesses zu lesen.35
Durch die enge Bindung der Erinnerung an die Jetztzeit des sich Erinnernden als elementarem Bestandteil des Benjaminschen Erinnerungskonzepts wird es nahezu unmöglich, überhaupt von der Möglichkeit einer authentischen Fassung der Berliner Kindheit zu sprechen, auch wenn die Fassung letzter Hand durch die Tilgung persönlicher Erinnerungen als Teil der Umarbeitung von einer Individualgeschichte hin zu einem Kombinat aus Individual- und Kollektivgeschichte dem bereits in der Berliner Chronik formulierten Programm am ehesten gerecht wird. Diese Entwicklung und die damit verbundene Entfernung vom klassischen autobiografischen Schreiben werden im Zentrum der weiteren Betrachtungen stehen.
3.2. Mémoire involontaire und willkürliches Eingedenken
Den wohl wichtigsten Bezugspunkt für die Entwicklung von Benjamins eigenem Erinnerungskonzept stellt das von Marcel Proust verfolgte Konzept der mémoire involontaire dar, mit dem sich Benjamin während seiner Übersetzungsarbeit von Prousts Roman A la recherche du temps perdu eingehend auseinander setzte. Für Proust «ist die Vergegenwärtigung der Kindheit nur durch die mémoire involontaire möglich, die den Betroffenen ohne Willensanstrengung in die eigene Vergangenheit zurückführt.»36 Benjamin bringt in seinem Essay Zum Bilde Prousts dessen Erinnerungsmethode auch mit dem Vergessen in Verbindung, wenn er fragt: «Steht nicht das ungewollte Eingedenken, Prousts mémoire involontaire dem Vergessen viel näher als dem, was meist Erinnerung genannt wird?»37
Gegenüber dieser unwillkürlichen Erinnerung, die bei Proust durch bestimmte Sinneseindrücke – wie den Biss in eine Madelaine – hervorgerufen werden kann, entwickelt Benjamin sein Konzept des Eingedenkens als absichtlich hervorgerufene Erinnerung: «Ich will mir die zurückrufen, die
35 Pethes (s. Anm. 6), S. 270. 36 Schöttker, Detlev: Erinnern. In: Benjamins Begriffe. Erster Band. Hg. von Michael Opitz und Erdmut Wizisla. Frankfurt am Main 2000, S. 263. 37 Benjamin, Walter: Medienästhetische Schriften. Hg. von Detlev Schöttker. Frankfurt am Main 2002, S. 9 (fortan zit.: MS).
13
mich in die Stadt eingeführt haben.» (GS VI, S. 465) lautet Benjamins erster Satz der Berliner Chronik und im Vorwort zur Fassung letzter Hand der Berliner Kindheit schreibt er:
Ich hatte das Verfahren der Impfung mehrmals in meinem inneren Leben als heilsam erfahren, [...] und rief die Bilder, die im Exil das Heimweh am stärksten zu wecken pflegen – die der Kindheit – mit Absicht in mir hervor (FlH, S. 9).
Bei aller Abgrenzung ist der Einfluss des Proustschen Konzeptes auf Benjamin bei einer zweifachen Bezugnahme darauf an exponierter Stelle offensichtlich. Benjamin selbst schreibt der mémoire involontaire ein konstruktives Moment zu, dass seiner Meinung nach grundlegend für jegliche Erinnerungsarbeit ist:
Zur Kenntnis der mémoire involontaire: ihre Bilder kommen nicht allein ungerufen, es handelt sich vielmehr in ihr um Bilder, die wir nie sahen, ehe wir uns ihrer erinnerten. Am deutlichsten ist das bei jenen Bildern, auf welchen wir – genau wie in manchen Träumen – selber zu sehen sind (MS, S. 24).
Für sein eigenes Konzept des willkürlich hervorgerufenen Eingedenkens stellt er den Konstruktionscharakter der Erinnerung noch deutlicher heraus:
Die Sprache hat es unmissverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument zur Erkundung der Vergangenheit ist sondern deren Schauplatz. Es ist das Medium des Erlebten wie das Erdreich das Medium ist, in dem die toten Städte verschüttet liegen. Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muß sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Das bestimmt den Ton, die Haltung echter Erinnerungen. Sie dürfen sich nicht scheuen, immer wieder auf einen und denselben Sachverhalt zurückzukommen; ihn umzuwühlen wie man Erdreich umwühlt. Denn Sachverhalte sind nur Lagerungen, Schichten, die erst der sorgsamsten Durchforstung das ausliefern, was die wahren Werte, die im Erdinnern stecken, ausmacht: die Bilder, die aus allen früheren Zusammenhängen losgebrochen als Kostbarkeiten in den Trümmern unserer späten Einsicht – wie Trümmer oder Torsi in der Galerie des Sammlers – stehen. Und gewiß bedarf es, um Grabungen mit Erfolg zu unternehmen, eines Plans (GS VI, S. 486).
Detlev Schöttker verweist darauf, dass sich Benjamin durch die Verwendung der Metapher des Archäologen, mit der er «den Zusammenhang zwischen dem Gedächtnis als Medium des Bewahrens und Vergessens und der Erinnerung als Aktualisierung von Gedächtnisinhalten»38 beschreibt, auf Sigmund Freud bezieht, der die psychoanalytische Arbeit bekanntermaßen ebenfalls mit der des Archäologen vergleicht:
Aber wie der Archäologe aus stehengebliebenen Mauerresten die Wandungen des Gebäudes aufbaut, aus Vertiefungen im Boden die Anzahl und Stellung von Säulen bestimmt, aus den im Schutt gefundenen Resten die einstigen Wandverzierungen und Wandgemälde wiederherstellt, genau so geht der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven Äußerungen des Analysierten zieht.39
Ein Hauptkritikpunkt Benjamins an der mémoire involontaire, der er im Baudelaire-Essay einen «ausweglos privaten Charakter» (MS, S. 35) bescheinigt, bezieht sich auf deren stark subjektive Prägung und ihre notwendige Beschränkung auf die Sphäre des Individuellen: «Sie beschränkt sich ganz auf die individuellen Erfahrungen, diejenigen des Kollektivs finden keine
38 Schöttker (s. Anm. 36). S. 266. 39 Freud, Sigmund. Gesammelte Werke. Sechzehnter Band. Werke aus den Jahren 1932–1939. Hg. von Anna Freud u.a. Frankfurt am Main 1999, S. 45. Zum Verhältnis von Freud, Proust und Benjamin vgl. Steinmavr (s. Anm. 23), S. 186–222.
14
Berücksichtigung»40. Gerade an einer Verschränkung zwischen individueller und kollektiver Erfahrung ist es Walter Benjamin mit seiner Konzeption des Eingedenkens, die auch den Gegensatz zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Erinnerung zu überwinden sucht, gelegen:
Wo Erfahrung im strikten Sinne obwaltet, treten im Gedächtnis gewisse Inhalte der individuellen Vergangenheit mit solchen der kollektiven in Konjunktion. Die Kulte mit ihrem Zeremonial, ihren Festen, deren bei Proust wohl nirgends gedacht sein dürfte, führten die Verschmelzung zwischen diesen beiden Materien des Gedächtnisses immer von neuem durch. Sie provozieren das Eingedenken zu bestimmten Zeiten und blieben Handhaben desselben auf Lebenszeit. Willkürliches und unwillkürliches Eingedenken verlieren so ihre gegenseitige Ausschließlichkeit. (MS, S. 36).
Die Verschränkung von individueller und kollektiver Erfahrung in Benjamins Berliner Kindheit um neunzehnhundert
«Müßig wäre es, an Benjamins Texten das Subjektive vom Objektiven prinzipiell trennen zu wollen: ähnlich wie in der Monadologie ist das eine stets durch das
andere mitrepräsentiert.»41
Bereits der Titel der Berliner Kindheit um neunzehnhundert bietet Anlass zur Reflexion indem er suggeriert, dass in ihr die Schranken der subjektiven Erinnerung überwunden werden:
Es handelt sich nicht um Erinnerungen des Autorsubjekts Walter Benjamin, sondern um Darstellungen einer allgemein und überindividuell zu verstehenden ‹Berliner Kindheit›. Der temporale Kollektivsingular Kindheit verweist auf die Abbildung einer intersubjektiven Lebensepoche, die – durch das Berliner – eng an die Realität einer spezifischen Stadt gebunden wird. Daß darüber hinaus nicht die Geschichte eines Subjekts, sondern vielmehr das Erinnerungsbild einer Epoche kenntlich werden soll, bezeichnet das neunzehnhundert im Titel. Bis hinein in das vage um verweist die Titelgebung auf das Undeutliche, nicht Festzulegende dieses Erinnerungsbildes […].42
Es handelt sich also dem Titel nach nicht um eine auf Benjamins individuelle Kindheit beschränkte Autobiografie, sondern um die Beschreibung einer typischen Kindheit in der Stadt Berlin um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die den Siegeszug der Moderne gegenüber den überkommenen ästhetischen Normen, auch in der Autobiographik, markiert. Im Zusammenhang mit dem Erinnerungskonzept Benjamins sind besonders die sich während dieser Zett vollziehenden Umwälzungen im Bereich der Mediengeschichte von Interesse. Einen zweiten Gesichtspunkt, der im Folgenden behandelt wird, stellt die durch die Einbindung der Medien vorangetriebene Strategie der Entsubjektivierung des autobiografischen Schreibens dar.
Die Einwirkungen der neuen Medien und die Marginalisierung der Individualität
Nach Heiko Reisch lassen sich Spuren der Medienkonkurrenz in einer Reihe von autobiografischen Texten nachweisen, die von Augustinus, der sich «im Spannungsfeld einer
40 Günter (s. Anm. 7), S. 119. 41 Pethes (s. Anm. 6), S. 278. 42 Ebd.
15
oral/schriftlichen Kultur»43 befindet, bis hin zu Marcel Proust und Walter Benjamin reichen und sich bis in die vom Prozess der Digitalisierung gekennzeichneten Gegenwart weiterverfolgen ließen. Proust und Benjamin verortet Reisch in einem Spannungsverhältnis zwischen der Schrift als dem Medium der Autobiografie selbst und den «visuell-analogen Speichermöglichkeiten»44 der Fotografie bei Proust45 und dem Daumenkino als Vorläufer des Films bei Benjamin. Benjamins Berliner Kindheit auf dieses Medium zu reduzieren, würde ihr allerdings nicht gerecht.
Mit Daguerres öffentlicher Präsentation der Fotografie 1839 begann eine Reihe technischer Entwicklungen, die die Medienlandschaft und mit ihr sowohl die menschlichen Wahrnehmungs- als auch die Erinnerungsstrukturen von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an entscheidend beeinflussten. 1872 entwickelte Muybridge die Bewegungsfotografie, vier Jahre später meldeten Gray und Bell ihre Telefonpatente an, 1887 erfand Berliner das Grammophon und 1895 präsentierten die Gebrüder Lumière den Kinematografen der Öffentlichkeit. Diese technisch hochentwickelten Medien traten in Konkurrenz zu den althergebrachten und lösten sie – zumindest teilweise – nach und nach ab.
Benjamin behandelt in seinem Stück «Kaiserpanorama» eines der Medien, das sich im 19. Jahrhundert als einer der Vorläufer des Kinematografen großer Beliebtheit erfreute, um die Jahrhundertwende allerdings schon deutlich weniger frequentiert wurde:
Platz fand man immer. Und besonders gegen das Ende meiner Kindheit, als die Mode den Kaiserpanoramen den Rücken kehrte, gewöhnte man sich, im halbleeren Zimmer rundzureisen. [...] Die Künste, die hier überdauerten, sind mit dem zwanzigsten Jahrhundert ausgestorben. Als es einsetzte, hatten sie in den Kindrn ihr letztes Publikum (FlH, S. l4).
Das Panorama wird gekennzeichnet als Repräsentant des überkommenen 19. Jahrhunderts. Ihm gegenüber gestellt wird in «Das Telephon» eine jener Entwicklungen, die im 20. Jahrhundert zu Massenmedien und -kommunikationsmitteln werden sollten:
Es mag am Bau der Apparate oder der Erinnerung liegen – gewiß ist, daß im Nachhall die Geräusche der ersten Telephongespräche mir anders in den Ohren liegen als die heutigen. Es waren Nachtgeräusche. Keine Muse vermeldet sie. Die Nacht, aus der wir kamen, war die gleiche, die jeder wahren Geburt vorhergeht. Und eine neugeborene war die Stimme, die in den Apparaten schlummerte. Auf Tag und Stunde war das Telephon mein Zwillingsbruder. Ich durfte erleben, wie es die Erniedrigungen seiner Erstlingsjahre im Rücken ließ. Denn als Lüster, Ofenschirm und Zimmerpalme, Konsole, Gueridon und Erkerbrüstung, die damals in den Vorderzimmern prangten, schon längst verdorben und gestorben waren, hielt, einem sagenhaften Helden gleich, der in der Bergschlucht ausgesetzt gewesen, den dunklen Korridor im Rücken lassend, der Apparat den königlichen Einzug in die gelichteten und helleren, nun von einem jüngeren Geschlecht bewohnten Räume. Ihm wurde er der Trost der Einsamkeit. Den Hoffnungslosen, die diese schlechte Welt verlassen wollten, blinkte er mit dem Licht der letzten Hoffnung. Mit den Verlassnen teilte er ihr
43 Reisch, Heiko: Das Archiv und die Erfahrung. Walter Benjamins Essays im medientheoretischen Kontext. Würzburg 1992, S. 63. 44 Ebd., S. 67. 45 Ebd., S. 71: «In der Theorie der Erfahrung und Wahrnehmung, die Proust in der Recherche entwickelt hat, spielen optische Metaphern eine zentrale Rolle. Das technische Medium Fotografie, das alte Gewissheiten zerstört und die Malerei in eine fundamentale Krise gebracht hatte, ist im gesamten Werk als konstituierender Begriff präsent. Sie erhält bei Proust einen besonderen theoretischen Stellenwert als Leitmedium der Mnemotechnik.»
16
Bett. Die schrille Stimme, die ihm im Exil geeignet hatte, klang nun, wo alles auf seinen Anruf wartete, abgedämpft.
Nicht viele, die den Apparat benutzen, wissen, welchen Verheerungen einst sein Erscheinen in den Familien verursacht hat. Der Laut, mit dem er zwischen zwei und vier, wenn wieder ein Schulfreund mich zu sprechen wünschte, anschlug, war ein Alarmsignal, das nicht allein die Mittagsruhe meiner Eltern, sondern das Zeitalter, in dessen Herzen sie sich ihr ergaben, gefährdete (FlH, S. 18).
Anhand dieses Ausschnittes wird deutlich, auf welch vielfaltige Weise Benjamins Mediendiskurs geführt wird. Benjamin verdeutlicht den Aufstieg des Telefons durch die Aufwertung, die es erfährt, in dem es von den hinteren in die repräsentativen Räume verlagert wird. Das Telefon läutet bei Benjamin buchstäblich den Untergang des 19. Jahrhunderts ein, die individuelle Erinnerung an die eigene Kindheit wird durch die Verdichtung des Telefonschellens zum Alarmsignal für das überkommene Jahrhundert an die gesellschaftlichen Folgen des neuen Mediums gekoppelt; individuelle Erinnerung und kollektive Geschichte gehen eine Symbiose ein.
Aber auch die Erinnerung selbst wird mit dem Medium des Telefons als Übermittler von Geräuschen über große Distanzen in Verbindung gebracht, wenn Benjamin fragt, ob es nun an der veralteten Technik der frühen Telefonapparate oder an der Erinnerung selbst liegt, dass ihm die Geräusche der ersten Telefongespräche «anders in den Ohren liegen» als die späteren. Dass die Erinnerung nach Benjamin immer eine konstruierte ist, wurde bereits thematisiert. Interessant ist an dieser Stelle, dass Benjamins Erinnerung eine akustische ist, die durch das Telefon überhaupt erst geschaffen wurde und die er in das Medium der Schrift überträgt. Benjamin reagiert also auf die Tatsache, dass die neuen Medien nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Erinnerung umstrukturieren und integriert dies in sein autobiografisches Schreiben.
Analog zu den bereits beschriebenen «Loggien» beinhaltet «Das Telephon» ebenfalls eindeutige Hinweise auf die Jetztzeit des Schreibenden, indem zum einen konkret auf den Wandel der Bedeutung des Telefons in der Exilzeit der 1930er Jahre sowie auf die gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz des Telefons im Verhältnis zur Jahrhundertwende eingegangen wird. Eine weitere Analogie zwischen den beiden Texten stellt sich darüber ein, dass Benjamin das kindliche Vermögen der mimetischen Anverwandlung an seine Umwelt in die Texte einschreibt:46 Wurden in den «Loggien» die Karyatiden, die dem Kind Wiegenlieder sangen, animistisch beseelt, wird das Telefon sogar zum «Zwillingsbruder» des Heranwachsenden. In beiden Stücken spielen akustische Erinnerungen eine dominante Rolle, die allerdings nur eine Form in einer ganzen Reihe von in der Berliner Kindheit behandelten Medien darstellen. Sprache, Schrift, Fotografie und Film sind weitere zentrale Reflexionspunkte Benjamins.
46 Vgl. GS IV, S. 260ff: In dem für die Berliner Kindheit als zentral anzusehenden Text «Die Mummerehlen» beschreibt Benjamin die produktive Leistung des mimetischen Vermögens: «In einem alten Kinderverse kommt die Muhme Rehlen vor. Weil mir nun ‹Muhme› nichts sagte, wurde dies Geschöpf für mich zu einem Geist: der Mummerehlen. Das Mißverstehen verstellte mir die Welt. Jedoch auf gute Art; es wies die Wege, die in ihr Inneres führten. Ein jeder Anstoß war ihm recht.» Vgl. außerdem die in engem Zusammenhang damit stehenden Texte Lehre vom Ähnlichen (MS, S. 117–122) und Über das mimetische Vermögen (MS, S. 123–126), in denen sich Benjamin mit dem Medium der Sprache auseinandersetzt.
17
Reisch spricht deshalb von einem «Medienkompendium in der Berliner Kindheit»47, wobei er den Texten «Die Mummerehlen», in dem die Medien Schrift und – in der älteren Fassung – Fotografie behandelt werden, «Loggien», hier dient vor allem die Geräuschkulisse als Erinnerungsmedium, und dem Schlussstück «Das bucklichte Männlein», in dem verschiedene Medien verdichtet werden, besondere Bedeutung beimisst.48
Während Reisch die Fotografie-Passage, die in der 1938er Fassung der «Mummerehlen» fehlt, dahingehend interpretiert, dass das Fotografische Medium «eher zufällig [...] doch nützlich [ist], da es die Entstellungssituation selber produziert»49, soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Benjamin keineswegs dem Medium selbst, sondern lediglich der Verwendung des Mediums in der Portraitfotografie während der Jahrhundertwende skeptisch gegenüberstand. Eine Parallelstelle zur selbst erfahrenen Entstellung findet sich in seinem Aufsatz Kleine Geschichte der Photographie, in der eine Fotografie Kafkas beschrieben wird:
Damals sind jene Ateliers mit ihren Draperien und Palmen, Gobelins und Staffeleien entstanden, die so zweideutig zwischen Exekution und Repräsentation, Folterkammer und Thronsaal schwankten und aus denen ein erschütterndes Zeugnis ein frühes Bildnis von Kafka bringt. Da steht in einem engen, gleichsam demütigenden, mit Posamenten überladenen Kinderanzug der ungefähr sechsjährige Knabe in einer Art von Wintergartenlandschaft. Palmenwedel starren im Hintergrund. Und als gelte es, diese gepolsterten Tropen noch stickiger und schwüler zu machen, trägt das Modell in der Linken einen unmäßig großen Hut mit breiter Krempe, wie ihn Spanier haben. Gewiß, daß es in diesem Arrangement verschwände, wenn nicht die unermesslich traurigen Augen diese ihnen vorbestimmte Landschaft beherrschen würden (MS, S. 306f).
In der Beschreibung der eigenen Ateliersituation, in der Benjamin schildert, dass er sich zwar «Wohnungen, Möbeln, Kleidern» (GS IV. S. 261) anverwandeln konnte, im Fotoatelier aber seinem eigenen Bilde nicht ähnlich war, nimmt Benjamin direkt auf dieses Kafka-Bildnis Bezug:
Wohin ich blickte, sah ich mich umstellt von Leinwandschirmen, Polstern, Sockeln, die nach meinem Bilde gierten wie die Schatten des Hades nach dem Blut des Opfertieres. Am Ende brachte man mich einem roh gepinselten Prospekt der Alpen dar, und meine Rechte, die ein Gemsbarthütlein erheben mußte, legte auf die Wolken und Firnen der Bespannung ihren Schatten. Doch das gequälte Lächeln um den Mund des kleinen Älplers ist nicht so betrübend wie der Blick, der aus dem Kinderantlitz, das im Schatten der Zimmerpalme liegt, sich in mich senkt. Sie stammt aus einem jener Ateliers, welche mit ihren Schelmen und Stativen, Gobelins und Staffeleien etwas vom Boudoir und von der Folterkammer haben (GS IV, S. 261).
Diese Art der Atelierfotografie steht – ähnlich wie das Kaiserpanorama oder die veraltete Einrichtung des großbürgerlichen Elternhauses in «Das Telefon» – für das immer noch der Romantik verhaftete 19. Jahrhundert. So verkommen die Fotografien um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert für Benjamin zu kitschigen Abbildern von Gemälden einer längst vergangenen Zeit, die das Bürgertum künstlich am Leben zu erhalten sucht.
Die Fotografie kann aber auch konstruktiv-entlarvend genutzt werden, wie es Benjamin später beispielsweise im Werk von August Sander verwirklicht sieht (vgl. MS, S. 311). In seinem Kunstwerk-Aufsatz spricht Benjamin Fotografien die Fähigkeit zu, «Beweisstücke im historischen
47 Reisch (s. Anm. 43), S. 80. 48 Ebd. 49 Ebd., S. 83.
18
Prozeß» (MS, S. 362) sein zu können. Fotografien können als weitgehend entsubjektivierte Speichermedien aufgefasst werden, die in der Lage sind, ein intersubjektives Gedächtnis zu forcieren und gleichzeitig mit ihren Hilfsmitteln «Zeitlupen, Vergrößerungen» das ,,Optisch-Unbewußte[]» (MS, S. 303), das er analog zum Triebhaft-Unbewussten Freuds denkt, aufzudecken.50
Es handelt sich in der Fotoatelier-Passage also keineswegs um eine rein subjektive Erinnerung Benjamins, da diese Art der Fotografie massenhaft in der Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhundert verbreitet war, und die während dieser Zeit entstandenen Fotografien für die folgenden Generationen auch durch ihre genaue zeitliche Verortbarkeit Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses sind. Dennoch fällt auch diese Passage der Entsubjektivierungsstrategie Benjamins zum Opfer, die die persönlichen Erinnerungen in der Berliner Kindheit zunehmend marginalisiert. Reisch bringt dies mit einer generellen Verschiebung der Perspektive Benjamins in Verbindung:
In den frühen 30er Jahren beschäftigen Benjamin die Medientransformationen, während in den späten 30er Jahren die geschichtsphilosophisch motivierte Rekonstruktion des 19. Jhs. aus dem Exil heraus in den Vordergrund tritt.51
Bevor nun zum Abschluss der Überlegungen der Fokus ebenfalls auf die geschichtsphilosophischen Implikationen der Berliner Kindheit um neunzehnhundert gelegt werden wird, soll noch einmal auf den Schlusstext, «Das bucklichte Männlein», eingegangen werden, dessen Reflexionen über das Daumenkino – vergleichbar mit der Streichung der Fotografie-Passagen aus den «Mummerehlen» – in der Fassung letzter Hand weitestgehend gekürzt wurden. Deshalb wird an dieser Stelle auf die ältere Fassung Bezug genommen:
Ich denke mir, daß jenes «ganze Leben», von dem man sich erzählt, daß es vorm Blick der Sterbenden vorüberzieht, aus solchen Bildern sich zusammensetzt, wie sie das Männlein von uns allen hat. Sie flitzen rasch vorbei wie jene Blätter der straff gebundenen Büchlein, die einmal Vorläufer unserer Kinematographen waren. Mit leisem Druck bewegte sich der Daumen an ihrer Schnittfläche entlang; dann wurden sekundenweise Bilder sichtbar, die sich voneinander fast nicht unterscheiden. [...] Das Männlein hat die Bilder auch von mir. Es sah mich im Versteck und vor dem Zwinger des Fischotters, am Wintermorgen und vor dem Telephon im Hinterflur, am Brauhausberge mit den Faltern und auf meiner Eisbahn bei der Blechmusik, vorm Nähkasten und über meinem Schubfach, in Blumeshof und wenn ich krank zu Bett lag, in Glienicke und auf der Bahnstation. Jetzt hat es seine Arbeit hinter sich. Doch seine Stimme, welche an das Summen des Gasstrumpfs anklingt, wispert über die Jahrhundertschwelle mir nach: «Liebes Kindlein, ach, ich bitt, / Bet fürs bucklicht Männlein mit!»(GS IV, S. 303f)
Die Schlusspassage führt nicht nur noch einmal verschiedene Schauplätze der Berliner Kindheit zusammen, sondern auch die
Geräusche und Bilder, die die Berliner Kindheit auferstehen lassen, treten in der großen Metapher vom ‹bucklichten Männlein› am Schluß der Szenenfolge noch einmal zusammen. Sie führt die
50 Vgl. Stenmayr (s. Anm. 23), S. 156f. 51 Reisch (s. Anm. 43), S. 71.
19
Photographiemetapher der Berliner Chronik (1932), die die Momentaufnahme als Medium des Gedächtnisses bestimmt hatte, fort52
und erweitert sie zugleich:
Statt einzelne Fotos zu sammeln, bindet sie das bucklichte Männlein zu einem Buch, das die Urszene des Films darstellt. Explizit am Kinematographen orientiert verschmelzen Buch, Fotobild und Bild als drei verschiedene Archivierungsmethoden zu einer Metapher. Als straff gebundene Blätter setzen sich einzelne Bilder zu einem Ganzen zusammen, das als Buch die Bewegung durch die Zeit speichern kann.53
Die fragmentarische Gesamtstruktur, die sich durch Benjamins Montage von Denkbildern, die sich nicht in ein zeitliches Kontinuum pressen lassen, entspricht der Erinnerung des fragmentarischen Daseins des modernen Menschen, dem eine chronologisch nacherzählte Lebensgeschichte nicht mehr gerecht werden kann.
Die Bilder, die das bucklichte Männlein angesammelt hat, entfaltet der Autor der Berliner Kindheit um Neunzehnhundert (1932–1938) zu einer Buchstabenfolge, die in einem Medienwechsel jene Bilder zu einem Text transformiert, in denen die Struktur des Gedächtnisses bewahrt bleibt. Das Archiv des Augenblicks wird zu einem von Dauer überführt, ohne seine Eigenart gänzlich zu verlieren.54
Auch wenn die kinematographischen Bilder des bucklichten Männleins als das Leitmedium von Benjamins Konzeption des Eingedenkens angesehen werden dürfen, fehlt in dieser Metapher noch die akustische Erinnerung, wie sie am Beispiel des «Telephons» und der «Loggien» aufgezeigt wurde. Über die Erinnerung an den Kindervers über das bucklichte Männlein selbst, die am Ende der Berliner Kindheit steht, wird auch die akustische Dimension an die Erinnerungsmetapher gebunden und mit ihr die Multimedialität der Benjaminschen Erinnerung vervollständigt.
4. Anknüpfungspunkte zu den Thesen Über den Begriff der Geschichte
Im vorangegangenen Abschnitt wurde versucht, Benjamins Konzept des Eingedenkens als Verquickung von individueller und kollektiver Erinnerung darzustellen. Im Zentrum des Interesses standen dabei vor allem zwei Strategien, mit denen Benjamin diese Verbindung herzustellen versucht: Die Einbindung der modernen Massenmedien, die durch ihre Einwirkungen auf die Struktur der Wahrnehmung und der Erinnerung eine Öffnung der individuellen Erfahrung hin zu einer kollektiven unterstützen, und die Tilgung subjektiv eingefärbter Passagen im Verlauf der Umarbeitung von der Berliner Chronik bis zur Berliner Kindheit in ihrer Fassung letzter Hand. Beide Strategien greifen ineinander, da die Einbeziehung der Massenmedien selbst bereits eine Entsubjektivierung der Erinnerung mit sich bringt. Will die
52 Reisch (s. Anm. 43), S. 85. 53 Ebd., S. 86. 54 Ebd.
20
Berliner Kindheit ihrem Anspruch gerecht werden, so muss es Entsprechungen in Benjamins letztem Werk, den Thesen Über den Begriff der Geschichte aus dem Jahr 1940 geben, in denen Benjamin eine Art Gegen-Geschichtsschreibung zum vorherrschenden Historismus zu etablieren versucht. Im Folgenden sollen kurz einige zentrale Motive vorgestellt werden, die sich in beiden Werken finden.55
So lässt sich beispielsweise eine Verknüpfung zwischen dem Schlusstext der Berliner Kindheit und der VI. Geschichtsthese herstellen. In der bereits zitierten Passage aus «Das bucklichte Männlein» schreibt Benjamin:
Ich denke mir, daß jenes «ganze Leben», von dem man sich erzählt, daß es vorm Blick der Sterbenden vorüberzieht, aus solchen Bildern sich zusammensetzt, wie sie das Männlein von uns allen hat. Sie flitzen rasch vorbei wie jene Blätter der straff gebundenen Büchlein, die einmal Vorläufer unserer Kinematographen waren. (GS IV. S. 304)
Der Abschlusstext kann dahingehend interpretiert werden, dass er das erinnerungspoetische Konzept der gesamten Berliner Kindheit in Kurzform wiedergibt: Die Erinnerungen der Berliner Kindheit bestehen aus einer Reihe von kurz aufflackernden Bildern, wie sie der Kinematograph oder seine Vorform, das Daumenkino, liefern, weshalb dieses auch mit Reisch zu Recht als Leitmedium der Berliner Kindheit bezeichnet werden kann. Die kryptische Figur des bucklichten Männleins56 steht metaphorisch für das in der Berliner Kindheit verfolgte Erinnerungskonzept, das durch eine Kombination von mémoire involontaire und willkürlichem Eingedenken die Erinnerung konstruiert. Benjamin macht dies in der VI. These zur Grundlage der Historik: «Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, ‹wie es denn eigentlich gewesen ist›. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt» (GS l, S. 695). Auf das Moment der Gefahr und dessen Bedeutung in Bezug auf die Berliner Kindheit hat Bernd Witte aufmerksam gemacht:
Die Konzeption der Umarbeitung des Erzähltextes der ‹Berliner Chronik› zur Kurzprosa der ‹Berliner Kindheit› fällt in die Zeit einer schweren lebensgeschichtlichen Krise Benjamins. Private Schwierigkeiten, der völlige Misserfolg seines Schreibens und die sich ankündigende faschistische Gewaltherrschaft, von der er zu Recht die Vernichtung seiner bisherigen Lebensform und die seiner Klasse erwartete, ließen in ihm den von langer Hand vorbereiteten Plan reifen, sich kurz nach seinem vierzigsten Geburtstag das Leben zu nehmen. Er führte die Tat nicht aus, begann aber unmittelbar nach diesem entscheidenden Datum mit der Umformung seiner Kindheitserinnerungen.57
Das Resultat dieser Umarbeitung ist die bereits eingehend beschriebene achronistische, topographische Struktur der Berliner Kindheit. Auch wenn Witte bis zu diesem Punkt Folge geleistet wird, wurde bereits im zweiten Abschnitt darauf hingewiesen, dass seine
55 Für eine kritische Lektüre des Verhältnis von Benjamins Berliner Kindheit zu seiner Geschichtsphilosophie vgl. Kauffmann, Kai: Rudolf Borchardts und Walter Benjamins Berliner Kindheiten um 1900. In: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge. Band 8 (1998), S. 374–386. 56 Zur Interpretation der in These I wiederkehrenden Figur des buckligen Zwergs in Bezug auf die Berliner Kindheit vgl. Stüssi (s. Anm. 26), S. 84. 57 Witte, Bernd: Paris - Berlin - Paris: Zum Zusammenhang von individueller, literarischer und gesellschaftlicher Erfahrung in Walter Benjamins Spätwerk. In: Passagen. Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Hg. von Norbert Bolz und Bernd Witte. München 1984, S l7f.
21
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Fassung letzter Hand als authentischer Fassung der Berliner Kindheit nicht geteilt werden, da sie die Anbindung der Erinnerung – sei sie individuell oder kollektiv – an die Jetztzeit des Erinnernden unterschätzt.
Als Stütze dieses Standpunktes kann These XIV herangezogen werden, die die Jetztzeit des sich Erinnernden als konstitutiv für die Geschichtskonstruktion ansieht. «Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet. Sie ist der Tigersprung ins Vergangene (GS i, S. 701).» Auch die monadologische Grundstruktur der Berliner Kindheit, wie sie am Beispiel des Stuckes «Das Telephon» aufgezeigt wurde, findet ihre theoretische Fundierung in den Thesen Über den Begriff der Geschichte:
Der historische Materialist geht an einen geschichtlichen Gegenstand einzig und allein da heran, wo er ihm als Monade entgegentritt. In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des Geschehens, anders gesagt, einer revolutionären Chance im Kampfe für die unterdrückte Vergangenheit. Er nimmt sie wahr, um eine bestimmte Epoche aus dem homogenen Verlauf der Geschichte herauszusprengen; so sprengt er ein bestimmtes Leben aus der Epoche, so ein bestimmtes Werk aus dem Lebenswerk. Der Ertrag seines Verfahrens besteht darin, daß im Werk das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der Epoche der gesamte Geschichtsverlauf aufbewahrt ist und aufgehoben (GS I, S. 703).
Die Möglichkeit der Verquickung von individueller und kollektiver Geschichte liegt in der hier beschriebenen Figur der Monade. Mit der Anwendung dieser Figur löst Benjamin die starre «Subjekt-Objekt-Spaltung»58 und mit ihr den Gegensatz von subjektiver und objektiver Geschichte auf.
5. Zusammenfassung
Ziel des vorliegenden Beitrags war es, über die Beleuchtung verschiedener Dimensionen von Benjamins Begriff des Eingedenkens eine Annäherung an das von ihm in der Berliner Kindheit um neunzehnhundert verfolgte autobiografische Konzept zu leisten.
Eine Rekonstruktion der Textgenese bildete den Einstieg in die Ausführungen. Benjamin selbst erschienen seine Kindheitserinnerungen bereits 1935 als zerschlagenes Buch (vgl. Br. 2, S. 695), drei Jahre nachdem er mit der Umarbeitung der Berliner Chronik begonnen hatte und drei Jahre bevor er die historisch jüngste Fassung in der Biblothèque Nationale in Paris zur Verwahrung hinterließ. Die Beschäftigung mit der zweifellos bereits an sich interessanten Textgenese sollte nicht Selbstzweck bleiben: Ihr wurde ein enger Zusammenhang mit Benjamins stark an die Jetztzeit des sich Erinnernden gebundenen Konzeption des Eingedenkens zugesprochen. Die von ständigen Umarbeitungen geprägte Entstehungsgeschichte der Berliner Kindheit diente nicht nur als Möglichkeit, Unterschiede zwischen und Entwicklungen zu den einzelnen Fassungen zu verdeutlichen, sondern wurden als schriftlich fixierter Ausdruck einer prozessual aufgefassten
58 Schweppenhäuser (s. Anm. 27), S. 153.
22
Erinnerungsarbeit Benjamins angesehen. Diese Prozessualität des Eingedenkens, die Ergebnis der Verbindung der erinnerten Zeit mit der des sich Erinnernden im Eingedenken ist, wurde als Hauptargument gegen die Authentifizierungsversuche der Fassung letzter Hand verwendet.
Die Konstruktion des Eingedenkens schlägt sich nicht nur im Entwicklungsprozess der Berliner Kindheit, sondern auch in ihrer Struktur nieder. Zum einen wird in der Berliner Kindheit durch die erinnerten Bilder eine topographische anstatt der für das autobiografische Schreiben sonst üblichen zeitlichen Struktur etabliert. Zum anderen stehen diese Bilder auch unter einer eigentümlichen zeitlichen Spannung: Das Eingedenken versucht, «das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen» (GS I, S. 695), die erinnerten Bilder sollen «in ihrem Innern spätere geschichtliche Erfahrung präformieren» (FlH, S 9).
Nicht nur die Zeitebenen werden in der Berliner Kindheit miteinander verschränkt, es treten auch «Inhalte der individuellen Vergangenheit mit solchen der kollektiven in Konjunktion» (MS, S. 36). In diesem Zusammenhang wurde das Augenmerk vor allem auf zwei Strategien Benjamins gerichtet: auf die sukzessive Marginalisierung der persönlichen, direkt auf Benjamins individuelle Kindheit bezogenen Passagen und auf die Einbeziehung der sich um 1900 immer weiter verbreitenden modernen (Massen)Medien in das autobiografische Konzept. Die Einbindung der modernen Medien hat nicht nur Einfluss auf die Gesamtstruktur der Berliner Kindheit, die in der früheren Version des «bucklichten Männleins» explizit auf die vorbeihuschenden Bilder des kinematographischen Mediums und des Daumenkinos als dessen Vorläufer bezogen wird (vgl. GS IV, S. 304 u. GS I, S. 695). Sie bewirkt zudem eine weitere Unterminierung des Subjekts, und das gleich von zwei Seiten: In der vom Subjekt unabhängigen Wahrnehmung durch den Apparat der Kamera sieht Benjamin die Möglichkeit der Aufspürung des «Optisch-Unbewußten» (MS, S. 303) gegeben. Die massenhafte Verbreitung solcher technisch erzeugten Bilder durch die Medien der Fotografie und des Films trägt darüber hinaus zur Kollektivierung der Erinnerung bei.
6. Literatur Benjamin, Walter: Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Fassung letzter Hand und Fragmente aus früheren
Fassungen. Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno. Frankfurt am Main 1987.
—: Briefe. Hg. und mit Anmerkungen versehen von Gershorn Scholem und Theodor W. Adorno. Zweiter Band. Zweite Auflage. Frankfurt am Main 1993.
—: Gesammelte Schriften. Hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main 1972ff.
—: Medienästhetische Schriften. Hg. von Detlev Schöttker. Frankfurt am Main 2002.
Bub, Stefan: Sinnenlust des Beschreibens. Mimetische und allegorische Gestaltung in der Prosa Walter Benjamins. Würzburg 1993.
Freud, Sigmund: Gesammelte Werke. Sechzehnter Band. Werke aus den Jahren 1932–1939. Hg. von Anna Freud u.a. Frankfurt a Mmain 1999.
Günter, Manuela: Anatomie des Anti-Subjekts. Zur Subversion autobiographischen Schreibens bei Siegfried Kracauer, Walter Benjamin und Carl Einstein. Würzburg 1996.
23
Hofmannsthal, Hugo von: Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Gedichte, Dramen I. 1891–1898. Hg von Herbert Steiner. Frankfurt am Main 1979.
Kauffmann, Kai: Rudolf Borchardts und Walter Benjamins Berliner Kindheiten um 1900. In: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge. Band 8 (1998), S. 374–386.
Lejeune, Philippe: Der autobiographische Pakt. Frankfurt am Main 1994.
Lindner, Burkhardt: Das ‹Passagen-Werk›, die ‹Berliner Kindheit› und die Archäologie des «Jüngstvergangenen». In: Passagen. Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Hg. von Norbert Bolz und Bernd Witte. München 1984, S. 27–48.
Muthesius, Marianne: Mythos Sprache Erinnerung. Untersuchungen zu Walter Benjamins «Berliner Kindheit um neunzehnhundert.» Basel und Frankfurt am Main 1996.
Pethes, Nicolas: Mnemographie. Poetiken der Erinnerung und Destruktion nach Walter Benjamin. Tübingen 1999.
Reisch, Heiko. Das Archiv und die Erfahrung. Walter Benjamins Essays im medientheoretischen Kontext. Würzburg 1992.
Schöttker, Detlev: Erinnern. In: Benjamins Begriffe. Erster Band. Hg. von Michael Opitz und Erdmut Wizisla. Frankfurt am Main 2000, S. 260–298.
Schweppenhäuser, Hermann: Physiognomie eines Physiognomikers. In: Zur Aktualität Walter Benjamins. Hg. von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main 1972, S. 139–171.
Steinmayr, Markus. Mnemotechnik und Medialität. Walter Beniarnins Poetik des Autobiographischen. Frankfurt am Main 2001.
Stüssi, Anna: Erinnerung an die Zukunft. Walter Benjamins «Berliner Kindheit um Neunzehnhundert». Göttingen 1977.
Witte, Bernd. Bilder der Endzeit. Zu einem authentischen Text der Berliner Kindheit von Walter Benjamin. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Hg. von Richard Brinkmann und Walter Haug. Band 58 (1984), S. 570–592.
—: Paris – Berlin – Paris: Zum Zusammenhang von individueller, literarischer und gesellschaftlicher Erfahrung in Walter Benjamins Spätwerk. In: Passagen. Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Hg. von Norbert Bolz und Bernd Witte. München 1984, S. 17–26.