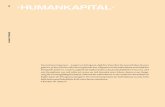Meyer, Jan-Henrik 2004. Gibt es eine Europäische Öffentlichkeit? Neuere empirische Studien zu...
Transcript of Meyer, Jan-Henrik 2004. Gibt es eine Europäische Öffentlichkeit? Neuere empirische Studien zu...
104
PETER A. HALL/DANIEL W. GINGEzuCH HETAUSgEgEbCN
..Spielarten des Kapitalismus" und institutionelle von:Hans-Peter Mül ler
KOmptemenlanlaren tn oer lvlaKrooKonomteEineimpirische Analyse llniT:I-UWL, VORMBUSCH FTANK EttTiCh
Accounting. Die Macht der zahlenim gegenwärtigen Hildegard M' Nickel
Kapitalismus
GÜNTHER SCHMIDGleichheit und Effizienz auf dem Arbeitsmarkt.Überlegungen zum Wandel und zur Gestaltungdes ..Ceschlechtervertrags"
HOLGER LENGFELDSoziale Gerechtigkeit und der Wirkungsgrad
vsr/ERLAG
der Mitbestimmung sozrALwrssENSCHAFrEN
STEPHAN MANNINGPublic Private Partnership als ,,Negotiated Order". Sonderdruck
Aushandlungsprozesse zwischen öffentlicher und privaterWelt in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
CHRISTOPH EGLE/CHRISTIAN HENKES/TOBIAS OSTHEIN4/ALEXANDER PETzuNGSozialdemokratische Antworten auf integrierte Märkte.Das Verhältnis von Markt und Staat, Hierarchie undKonsens
JAN-HENRIK MEYER;{Gibt es eine Europäische Offentlichkeit? Neuere empirische
Studien zu Demokratiedefizit. Lesitimation und Kontrolle inEuropa Band 14 2004
ISSN 0861-1808 Berl. J. Soziol .Be r l i n l l ( 2004 ) I , l - 152
REVIEWESSAY
Jan-Henrik Meyer
Gibt es eine Europäische Öffentlichkeit? Neuere empirische Studien zu De-mokratiedefizit, Legitimation und Kontrolle in Europa
Kevin, Deirdre (2003): Europe in the Media. A Comparison of Reporting, Representation andRhetoric in National Media Systems in Europe. Mahwah, N.J./London: Erlbaum, 216 S.
Klein, Ansgar/Ruud Koopmans/Ludger Klein/Christian Lahusen/Emanuel Richter/DieterRucht/Hans-Jörg Trenz (Hrsg.) (2003): Bürgerschaft, Öff€ntlichkeit und Demokatie in Europa.Opladen: Leske + Budrich,350 S.
Meyer, Christoph O. (2002): Europäische Öffentlichkeit als Kontrollsphäre. Die europäischeKomrnission, die Medien und politische Verantwortung. Berlin: Vistas, 234 S.
Requate, Jörg,Martin Schulze Wessel (Hrsg.) (2002); Europäische Öffentlichkeit. Transnatio-nale Kommunikation seit dem 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M.A.lew York: Campus. 328 S.
l. Einleitung schung ein immer größeres lnteresse an Fragender europäischen Öffentlichkeit entwickelt.
Zunächst stand die Klärung theoretischer Fra-gen europäischer Offentlichkeit im Vordergrund,vor allem wie man den für nationale Gesell-schaften entwickelten Öffentlichkeitsbegriff aufdie europäische Ebene übertragen könne (Eder2003t Eder,4lellmann/Trenz I 998; Eder/Kantner2000; Gerhards 2002; Kaelble 2001, 2002).
und vor allem mangelnder europäischer und damit
Doch da seit den l990er Jahren immer wiederdaraufhingewiesen worden war, dass zum Themaeuropäischer Offentlichkeit keinerlei grundlegen-de empirische Forschung vorliege (Gerhards1993; Gerhards 2002; Kaelble 2001: 159), wurdenin den vergangenen Jahren eine Reihe von großangelegten kooperativen Forschungsprojekten inDeutschland und Europa gestartet (Giesen/Risse1999; Koopmans/Statham 2002; Peters 2002).
Trotz ihres augenfülligen Booms ringt die For-schung zu ewopäischer Offendichkeit mit viell?il-tigsten Problemen konzeptioneller, empirischerund methodischer Art. Zwar sind sich im Hinblickauf die diffuse Funktionszuschreibung, dass Of-fendiclrkeit mit der Legitimität von (europäischer)Staatlichkeit zu tun habe, nahezu alle Forscher ei-nig - von den Kritikem (2.8. Kielmansegg 2003),die gerade deshalb den Mangel an europäischerOffentlichkeit ftir das wichtigste Argument g€gendie Veniefung des europäischen Projekts h€rvor-heben, bis hin zu den hoch motrvienen europäi-
Das aktuelle lnteresse an der Frage nach europäi-scher Offentlichkeit ist ein Nebenprodukt der Be-schleunigung, Vertiefung und Ausweitung der eu-ropäischen Integration. Seit Jahren wird über dasdemokatische Defizit der Europäischen Union inWissenschaft und Feuilleton diskutien, weil im-mer klarer wurde, dass eine Poljtikebene, die ftirgroße Teile der Gesetzgebung zuständig ist und indie alltäglichen Lebenschancen der Bürger in ganzEuropa eingreift, stärkerer demokratischer Legiti-mation und öffentlicher Kontrolle bedarf, als diesim derzeitigen Verfahren der Fall ist. Eines derpolitischen Projekte, die daraus entstanden sind,ist der vorerst gescheiterte Versuch, Europa eineVerfassung zu geben.
Die Debatte über das demokratische Defizitrichtete ihr Augenmerk zunächst auf die Reformder Institutionen (vgl. Chryssochoou 2003). DasProblem schwach ausgebildeter intermediärerVermittlungsstrukturen wie europäischer Parteien
überwiegend national verzerter Medien(bericht-erstattung) wurde oft nur beiläufig erwähnt (Ne-unreither 1994: 300), wohl weil man der Ansichtwar. dass sich daran - anderc als an den Institutio-nen - nur wenig ändem lassen würde. Erst injüng-ster Zeit hat die sozialwissenschaftl iche For- 1 3 5
J.-H. Mever: EuroDäische Öffendichkeit
schen Öffentlichkeitsforschern, die gerade des-halb das /ane Pflänzchen europäischer Öffenl-lichkeit schon don aufspüren, wo es kaum aus derErde herausschaut (Joerges/ Neyer 1998). Aberbereits aufdie Frage, was europäische Offentlich-keit ist oder sein soll, finden sich verschiedenste,oft widersprüchliche Antworten. Dass es europäi-sche Offentlichkeit gibt oder geben kann, wirdvon vielen bestritten. Wo man Offentlichk€it em-pirisch findet, wie man sie nachweist und wie mansre misst und bewenet, z.B. im Verhältnis zu na-tionaler Offendichkeit, ist unklar. Welches dieEntstehungsvomussetzungen europäischer Oflent-lichkeit und die Einflussfaktoren auf ihre mögli-che Veränderung sind, ist unsicher. Wenn manschließlich versucht, europäische Integration undOffentlichkeit in Beziehung zu setzen (vgl. Ger-hards 2000: Gerhards 2002: 145), lässt sich fra-gen. ob dre Entstehung und Enh.vicklung europäi-scher Offentlichkeit in der Praxis ebenso ein Ne-benprodukt der venieften europäischen Integrati-on ist, wie es die Forschung darüber zu seinscheint.
Angesichts dieser Verwirrung mag die Be-tmchtung von vier empirisch angglegten Neuer-scheinungen zum Thema europäische Offentlich-keit hilfreich sein. Sie sollen daraufhin untersuchtwerden. was sie unter europäischer Öffentlichkeitverstehen, auf welche Weise sie diese erforschenund zu welchem Ergebnis sie dabei kommen, vorallem angesichts der Frage. ob es europäische Öf-fentlichkeit gibt. Darüber hinaus ist zu fragen,welche Rahmenbedingungen die Autoren für dieEntstehung europäischer Offentlichkeit für zu-oder abträglich halten. Damit wird europäischeOffentlichkeit nicht mehr nur beschrieben, son-dem versucht, ihr Fehlen oder Entstehen zu er-klären.
2. Europäische Öffentlichkeit undDemokratie
Den wohl umfassendsten Einstieg in das Problemdes euroDäischen Demokratiedefi zits und dessenVerhältnis zu Fragen europäischer Offentlichkeitfindet sich in dem von Ansgar Klein et al. heraus-gegebenen Sammelband,,Bürgerschaft, Offent-lichkeit und Demokratie in Europa". Er umfasstsowohl polit iktheoretische als auch empirischeArbeiten zu drei Aspekten des europäischen De-mokratiedefizits: dem Defi zit an bürgerschaftli-ch€n Engagement, an Offentlichk€it und an lden-tität, nach denen der Band in drei Teile gegliedenist.
Diese drei Aspekte erscheinen den Heraus-gebern zentral, denn sie wollen erfassen, inwie-weit die Voraussetzungen für europäischc Demo-katie vorhanden sind. Ihr anspruchsvolles Demo-katicvcrstzindnis gcht davon aus, dass Demokm-tie - gerade in Europa - sich durch aktive Bürger-schaft, durch politische Partizipation der Bürgerals den Trägem von Demokratie entfaltet. Zudemsei Offentlichkeit als lnfrastruktur der Demokratiewichtig, weil dort Meinungsbildung, polit ischeAuseinandersetzung und die Vermittlung zwi-schen Regierenden und Bürgem stattfinde. Einegemeinsarne ldentität als Substanz von Demokra-tie, als,,identitärer Kitt" sei nötig, aber werdenicht als gegeben betrachtet, sondem könne sichals Produkt bürgerschaftlichen Engagements undöffentlicher Kommunikation herausbilden (9).
Hier sollen nur die Aufsätze zum Thema euro-päische Offentlichkeit betrachtet werden.
ln seiner Einführung zu diesem Teil des Ban-des gibt Hans-Jörg Trenz (16l ff.) einen kurzenUberblick über.den Forschungssrand^zu europär-scher Offentl ichkeil. Er defrnren Offenthchkeitnach Neidhardt (1994) als ,,intermediäre Sphäre",die zwischen Bürgem, politischen Institutionenund ihren Entscheidungsverfahren vemitteln soll-te. Auf der Ebene der EU, so fasst er die bisheri-gen Forschungen zusammen, wisse man einigesüber die elit:iren Offentlichkeiten. über intellektu-elle Eliten und deren Austauschbeziehungen undgeteilten Diskurse, in denen Europa thematisiertund als g€m€insam€r Bezugspunkt gesehen wird{2.B. Ciesen 1999r. Auch zu funktionalen Öffent-lichkeiten, den beider EU angesiedelten Verhand-lungssystemen zu den verschiedensten Politikfgl-dem, an denen zivilgesellschaftliche Akteure undInteressengrupp€n beteiligt sind, habe gerade diepolitikwissenschaftliche Forschung verstärkt ge-arbeitet (vgl. Joerges/ Neyer 1998). Allerdings istumsrrirren, ob es srch lalsächlich um Öffentl ich-keiten hand€lt, denn es findet zwar Vermittlungund Diskussion statt. abgr Transparenz zeichnetderartige funktionale Offentlichkeiten kaum aus.
Daher sei es unumgänglich, die Defizite anVerminlung zwischen Bürgem und dem europäi-schen polit ischen System, mittels medialer Of-fentlichkeiten zu überwinden. Der Frage medialerOffendichkeit widmen sich denn auch die Studienvon Cathleen Kantner, Marianne van de Steeg undJuan Diez Medrano.
Theoretisch wenden sich Kantner und van deSteeg gegen die Behauptung, dass mangels ge-meinsamer Sprache und mangels transnationalerMedien europäische Offentlichk€it unmöglich sei.wie Kantner begreift auch Medrano den Mangelan geteilter europäischer Identität nicht als unver-änderlich gegeben, sondem als durch sich verän-1 3 6
dernde Kommunikation formbar. Alle drei gebensich nicht mit den Einwänden der Skeptiker zu-frieden, sondem versuchen, nicht beim Vergleichmit dem idealisierten nationalstaatlichen Modellstehen zu bleiben, sondem zu erforschen, wie sichAnsätze euopäischer Offentlichkeit in nationalenMedien entwickeln.
Kantners Arbeit ist primär theoretisch, sieweist mittels der Erkenntnisse der Hermeneutiknach, dass das Fehlen einer geteilten Sprache keinfundamentales Hindernis für eine grenzüber-schreitende Kommunikation und europäische öf-fentlichkeit sein müsse. Nationale M€dien leiste-ten die Ubersetzung durch gegenseitige Rezep-tion. Kantner erwartet, dass sich angesichts dergeleilten Probleme und der hohen ,,lnteraktions-dichte" innerhalb Europas eine europäische öf-fentlichkcit herausbilden könne und werde (225).
lm Anschluss an Habermas (1996: 190) defi-niert Kantner europäische Offentlichkeit:,,[G]l€i-che (europapolitische) Themen [werden] zur glei-chen Zeit unter gleichen Relevanzgesichtspunktenkonzeptionalisiert", d.h. in den nationalen Medienbenchtet und diskutiert. Dieses Kriterium derSynchronltäl wenden auch Medrano und Steeg an,wob€i letztere noch darüber hinausgeht. In ihremModell zeigt sich europäische Offendichkeit inden vielldltigen Uberlappungen natronaler ÖffenFlichkeiten. Dazu untersucht sie zusätzlich noch,,diskursive Interaktion". also nachweisbareTransfers von Meinungen und Berichterstattungüber die nationalen Crenzen hinweg (183). Zudemuntersucht sie die Referenzrahmen, d.h. die argu-mentative Einordnung (Framing) von Problemen,z.B. ob ein bestimmtes politisches Problem übe-rall in Kosten,Alutzen-Kategorien bewertet wird.
Empirisch untersucht Steeg die Debatte überdie Osterweiterung in britischen, spanischen, nie-derländischen und deutschen Nachrichtenmaea-zinen zwischen 1989 und 1998.
Ihr Ergebnis: Einerseits gebe es vergleichswei.se wenig diskursive lnteraktion über Crenzen hin-weg, bei vielen Zeitschriften sei der öffentlicheDiskurs klar national orientien, wenig andere Eu-ropäer kommen zu Won. Andererseits folge dieBerichterstattung weitgehend den gleichen Mus-tern, sowohl was die Aufmerksamkeit für dasTh€ma betrifft (184i), als auch bezüglich des Re-ferenzrahmens. Steeg schließt daraus, dass ,deröffentliche Diskurs in allen vier Nachrichten-magazinen einer einzigen Diskursgemeinschaftentstammen muss." Sie geht nicht so weit zu b€-haupten, damit sei die Existenz europaischer öf-fentlichkeit bewiesen. Aber sie begreift dieses Er-gebnis als Widerlegung der Kritiker, die die Mög-lichkeit europäischer öffentlichkeit prinzipiell be-streiten (189).
Berl.J.Soziol., Heft | 2004, S. 135-143
Medrano dagegen betrachtet 607 per Zu-fallsprinzip ausgewählte europapolitische Leitar-tikel und Kommentare aus der britischen, deut-schen und spanischen Qualitätspresse zwischen1946 und 1997. Auch Medrano ist in seinem Er-gebnis vorsichtig optimistisch. Er untersucht dieLeitartikel auf die Frage nach der kommunikari-ven Herstellung einer europäischen,,imaginedcommunity" und zeigt dabei, dass es eine geteilte,,kognitive Rahmung" des Integrationsprozessesgibt - eine positive Bewertung des Binnenmarkts,eine negative, was die Regierungsldhigkeit be-t ifft. Zudem gebe es große Parallelen bei den dis-kutierten Themen. Daher fasst er zusarnmen, dasses wohl Anzeichen ftir eine, wenn auch gegenüberden nationalen Offentlichkeiten sekundär bleiben-de europäische Offentl ichkeit gebe, diese abereher eine ,,versäulte Offentlichkeit" sei, mit wenignachweisbarem Austausch über Grenzen hinwes(210i).
3. Öffentlichkeit als KontrollsphZire
Christoph O. Meyers Band ,,Europäische Offent-lichkeit als Kontrollsphäre" fühlt auf sehr über-zeugende Art und Weise Europaforschung, Kom-munikationswissenschafl und normative Offenflichkeitstheorie zu einer empirisch reichen Studiezusammen,
Meyer geht davon aus, dass Offentlichkeit derSchlüssel zur Verringerung des Legitimitätsde-fizits der Europäischen Union sei, das dem Demo-kratiedefizit der Union entspreche: dem Zuwachsan Kompetenzen der EU, dem kein Anwachsendemokatischer Partizipation und Kontrolle ge-genübersteht (45). Weder die schleichend ent-machteten nationalen Parlamente, noch dasschwächliche europäische Parlament häüen genü-gend Einfluss; erschwerend komme hinzu, dassdie Bürger wenig Interesse und Kenntnisse überEuropa häften. sodass sie kaum in der Lage seien.sich eine europapolitische Meinung zu bilden unddemokatische Mitbestimmung einzufordem.
Vor diesem. Hintergrund schreibt Meyer dereuropäischen Offentl ichleir drei Funkrionen zu(54i), die zur Schließung der Legitimitätslückendes politischen Systems der EU beitragen können:Erstens versorgt Offentlichkeit die Bürger mit derfür Meinungsbildung nötigen Informationsviel-falt, die sie frir Wahlen und andere politische Ent-sch€idungen benötigen; zweitens kontrolliert öf-fentlichkeit die Regierenden und zieht sie öffent-lich ftir ihr Handeln zur Rechenschaft; drittens ha-ben öffentliche Kommunikationsprozesse den Ef-fekt, zur Bildung einer gemeinsamen ldentität und t37
J.-H. Mever: EuroDäische Öffentlichkeit
einem europäischen Bürgerbewusstsein beizuüa-gen.
Ob es eine europäische Offentlichkeit gibt, diediese Funktionen erftillt und so zur Legitimität derEU beitragen kann, ist die forschungsleitende Fra-se in Meyers Arbeit. Er konzentriert sich dabeiiuf die Kontrollfunktion von Öffentlichkeit unddefiniert sie daher ,,als ein Kommunikationssys-tem (... ), das In der Lage isl. nalronale. transnatio-nale und europäische Diskurse in einem für eineEu-weite Meinungsbildung, Kontrolle und/odertdentitätsbildung ausreichendem Maß zu synchro-nisieren" (65). Das, was das Europäische, die Be-gr€nzungen nationaler Gesellschaften überwin-dende, europäischer Offendichkeit ausmache, istdabei die Synchronisierung von Diskursen überGr€nzen hinwgg.
Im Zentrum der Arbeit stehen drei Fallstudienüber Skandale der Brüsseler Europäischen Kom-mission zwischen 1995 und 1999: erstens der Fallvon Korruption im Bereich der Cemeinschafts-oolitik für Tourismus 1995. zweitens der Fall desVerhaltens der Kommission 1996 gegenüber denGefahren, die von der Rinderseuche BSE für diemenschliche Gesundheit ausgehen, drittens d€rFall von Betrug im Bereich des Amts für huma-nitäre Hilfe (Echo) und der Rolle der daftir verant-wortlichen Kommissarin Cresson. Anhand dieserSkandalc zeigt Meyer, wie sich die Bericht-erstattung und die Arbeitsweise der BrüsselerKorrespondenten verändert hat - vom Brüsseler,,Verlautbarungsjoumalismus" hin zu verstärkt in-vestigativem Joumalismus. Zudem fangen Jour-nalisten an. über nationale Crenzen hinweg zu-sammenzuarbeiten, mit d9r Folge, dass sle lmrnerbesser in der Lage sind, europaweit öffentlichDruck auf die Kommission auszuüben. Zur Freu-de, weniger der Kommission, um so mehr aber derbeteiligten Joumalisten und des Autors selbst, dersein Argument bestätigt sieht, fi.ihrte diese Skan-dalisierung erstmals zum Rücktritt einer Europäi-schen Kommission.
Meyer zeigt damit, wie eine durch die Ko-operation Brüsseler europapolilischer Korrespon-denten hervorgebrachte europäische Skandal-öffentlichkeit die Kontrolle der Regierendenerfolgreich erfiillt. Indem er aufdie Kontrollfunk-tion von Offentlichkeit abhebt, gelingt es Meyersehr elegant, eines der schwierigsten Probleme derForschüng zu europäischer Offentlichkeit zu lö-sen. nämlich die abstrakte. normative demokratie-lheoretische Debalre über (europäische) Offenl-lichkeit in empirische Forschungsfragen umzuset-zen.
Aus seiner umfangr€ichen empirischen undvergleichend angelegten Untersuchung schließtMeyer, dass europäische Offendichkeit möglich
ist. Europäische Joumalisten sind in der Lage -wie das Beispiel der Skandalkommunikation zeigt-, über narionale und Sprachgrenzen hinweg eineeuropäische Öffentlichkeit hezustellen, die f?ihigist, durch grenzüberschreitende Kooperation eu-ropäische politische Institution€n zu kontrollierenund zur Rechenschaft ^ ziehen ( l'19\. Zuden zet-ge sich anhand der Entwicklung etwa des Presse-korps, das sich in Richtung eines investigativenJournalismus entwickelt habe, dass diese Ent-wicklung über die untersuchten Skandale hinausvon Dauer sein könnte. Auch habe die Kommis-sion anerkennen müssen, dass sie für ihre Politikrechenschaftspfl ichtig ist.
Meyer versucht nicht nur, das Funktionierenvon Offentlichkeit zu beschreiben und zu bewer-ten, sondem dies auch zu €rklären. Aufder Ebeneder Akteure untersucht er Struktur und Arbeits-bedingungen des Brüsseler Pressekorps und des-sen Veränderung. Vor allem der Zuwachs nordeu-ropäischer englischsprachiger. aber auch jüngerer.weniger in Brüssel verwurzelter Joumalisten inden l990er Jahren im Gefolge der E weiterung,ermöglichte die von ihm beobachtete europäischeZusammenarbert von Journalisten. die eine ge-meinsame, grenzüberschreitende synchrone undähnlich gerichtete Skandalkornrnunikation ermög-lichte. Auf theoretischer Ebene betrachtet MeyerEuropäisierung und lnternationalisierung undstellt fest, dass der Europäisierungsprozess beson-ders durch den gemeinsamen Markt eine neofunk-tionalistische ,,spill-over" Logik nach sich gezo-gen habe. Von Europa profitierende Eliten hättenverstärkt €uropapolitische Informationen nachge-fragt. Leicht zeitverzögert passte sich entspre-chend die Anzahl der Korrespondenten der relati-ven cröße der nationalen Medienmärkte an. EinTransnationalisierungsprozess sei von der gestie-genen Nachfrage nach lnformationen von jenseitsder eigenen Grenzen ausgegangen. Dadurch habesich die transnationale Interaktion der Joumalistenerhöht, was eine Intemationalisierung des Brüsse-ler Journalismus nach sich gezogen habe - imHinblick auf professionelle Normen und politi-sche Wertungen. Insgesamt si€ht Meyer Chancenfür dre Entwicklung europäischer polit ischer Öf-fentlichkeit eher in der Ausweitung solcher Uber-lappungs- und Mischbereiche (also grenzüber-schreitender Austausch, Verbreiterung det Per-spektive bei gleichzeitiger Produktion für den na-tionalen Medienmarkt) als in einer von oben ge-steuerten,,Supranationalisierung" nationaler Of-fentlichkeiten, z.B. durch eine Informationspolitikder Europäischen Union (l84ff.).
1 3 8
4. Europa in Presse und Femsehen
Auch wenn das Wort Offentlichkeit im Titel vonDeirdre Kevins Buch,,Europe in the Media. AComparison of Reporting, Representation andRhetoric in National Media Syst€ms in Europe',gar nicht erscheint, ist es die empirisch wohl brei-teste und umfassendste Studie zu europäischer Öf-fentlichkeit, die bisher erschienen ist. Sie unt€r-sucht nicht nur die Berichterstattung zur Euro-päischen Union, sondem auch die über andere Eu-ropäer, und das sowohl in den Nachrichten alsauch in den übrigen Medieninhalten und -forma-ten, in Zeitungen und im Femsehen.
Das Buch bietet die Auswenung von zwei Stu-dien über Medien und Europa. Die erste umfasstzwei Wochen der Berichterstattung über Europaim weitesten Sinne in der Qualitäts-, Boulevard-und Regionalpresse sowie einem privaten und ei-nem öffentlich-rechtlichen bzw. staatlichen Fem-sehsender in Frankeich, Deutschland, Irland, Ita-lien, den Niederlanden, Spanien, Schweden undGroßbritannien im Mai und Juni 1999. Vier unter-schiedliche Themenbereiche wurden ouantitativund qualitativ ausgewertett der Wahlkampf zumEuropäischen Parlament, der gleichzeitig die Me-dien beherrschende Kosovo-Krieg, aus dem sich€ine Debatte um eine Krise Europas entwickelte,die winschaftspolrtrsche Frage der \4ährungsuni-on und Nachrichten über andere EuroDäer. Diezweite studie untersuchte die Thematisieruns Eu-ropas inJeweils einem öffentlrchen und eineÄ pri-valen Femsehkanal in Frankreich, Deurschland,Italien, Großbritannien, Polen und den Niederlan-den während eines Sechs-Wochen-Zeitraumsebenfalls im Mai und Juni 1999. Hier wurde dasgesamte Programm betrachtet, nicht nur die Nach-richten. Zudem wurden Joumalisten zu den Pro-duktionsbedingungen europapolitischer Nachrich-ten befragl.
Zwar ist die Ausgangsfrage des Buches ledig-lich, wie die europäische Integration in den Medi-en aufgegriffen und begleitet wird; aber auch Ke-vin erwanet von den Medien, dass sie eine öffent-lichkeit schaffen, die Demokatie emöglicht. Vonden bei Meyer genannten Funktionen stehen beiihr die Informationsfunktion und die der Iden-titätsstift ung im Vordergrund.
Medienberichterstattung, so Kevin, könne inzweierlei Hinsicht über Europa infomiereh. Ent-weder trage sie zur Debatte über europäische Po-litik in der nationalen Offentlichkeit bei oder siebringe eine,,Europäisierung" nationaler öffent-l ichkerten aufden Weg, indem sie über gemeinsa-me Trends, Probleme und Chancen berichte( l66) .
Berl.J.Soziol., Heft I 2004. S. 135-143
Dabei ist sie der Ansicht, dass es außer für einekleine Euro-Elite eine von der nationalen unrer-scheidbare europäische Öffentlichkeit nicht gebe.Zentrales Kriterium ihrer Definition europäischerÖffentl ichkeit isr die Exislenz oder Nicht-Exis-tenz europäischer Medien. Ahnlich wie andereForscher schlussfolgert Kevin daraus, dass die Eu-ropaberichterstaftung in nationalen Medien zu stu-dieren sei, bestreitet aber, dass man dies trotzdemeuropäische Offendichkeit nennen könne, zumalsie, anders als Kantner und Steeg, die fehlende ge-meinsame Sprache für ein zentrales Hindemishält. Europa funktioniere vor allem ilber nationaleRepräsentanten, die wiederum transnationale Ver-bindungen hätten. Für die Bürger allerdings seiendie Debatten über Europa nur über nationale M9-dien zu greifen (510. Statt von europäischer öf-fentlichkeit im Singular sollte man daher besservon verschiedenen Offendichkeiten (,,a ,sphere ofdifferent publics"' (Schlesinger/Kevin 2000))oder von überlappenden Offentlichkeiten spre-cnen { )z t .
Die Existenz solcher An europäischer öffent-lichkeiten innerhalb der nationalen bestreitet Ke-vin keinesfalls. In unterschiedlichem Ausmaß ent-stehe innerhalb der einzelnen nationalen Offent-lichkeitcn Raum für Information und Diskussionüber europäische Politik und Kultur. Wie sich z.B.anhand des Wahlkampfes fr.ir das EuropäischeParlament zeigte, verharrte die Berichterstattungim Nationalen. Aber diese Berichterstattunsähnelte sich über dle Crenzen hinweg: auch auiden Berichten über den Wahlkampf in anderen eu-ropäischen Ländern leitet sie ab. dass sich einePerspektive über die nationalen Grenzen hinausentwickelt habe (87).
Cegenüber den Printmedien ft i l l t die Band-breite der Info.mation und der Akteure, die zuWort kommen, beim Femsehen noch einmal deut-lich ab. Auch dort, wo über EuroDa berichtet undEuropa diskutiert wird, kommen kaum andere Eu-ropäer zu Wort, was die Transnationalisierung derDebatte kaum befördert (176).
Die Konstruktion europäischer Identitäten, soKevin, könne mangels gesamteuropäischer Me-dien aufeuropäischer Ebene nur schwer ausgeftilltwerden. Zwar hält sie es flir wichtig zu untersu-chen, wie Medien durch Information, Bildung undUnterhaltung zur ldentifikation mit Europa beitra-gen (37t), doch die Untersuchung europäischerIdentitäten anhand verschiedener Repräsenta-tionen Europas im Femsehen macht deutlich, dasssich selbst dort, wo es gemeinsame Probleme gibt,wenige gemeinsame Perspektiven finden. Viel-fach erscheinen bei der Thematisierung andererTeile Europas diese als fremd. besonders im briti-schen Femsehen. 139
140
J.-H. Mever: EuroDäisch€ Öffentlichkeit
Die Bedingungen der Berichte6tattung überEuropa nehmen bei Kevin breiten Raum ein. AlsMedienwissenschaftle n wamt sie normativ motl-vierte Öffentl ichkeitsforscher: Medieninhaltefolgten w€niger dem europapolitisch oder demo-kratietheoretisch wünschbaren, sondem dem vonden Medienmachem erwarteten Interesse der Le-ser oder Zuschauer, um dgren Cunst die Medienbuhlen. Entsprechend müssen Europa-Themenüber ,,Nachrichtenwert" verfügen, wenn über sieberichtet werden soll. Daher seien sie oft an The-men, die national oder regional oder als Skandal-fall von Interesse sind, angebunden (175).
5. Europäische Öffentlichkeit als,,appellative Instanz"
Der Band von Requate und Schulze Wessel ,,Eu-ropäische Offentlichkeit. Transnationale Kom-munikation seit dem 18. Jahrhundert" nimmt sichunter den politik- und medienwissenschaftlichenUntersuchungen wie ein seltsamer Ausnahmefallaus, geht es doch bis auf ein oder zwei Studien zuaktuellen Themen um historische,,europäischeÖffentlichkeiten". Die Beiträge in der erstenHälfte des Bandes zeigen, wie mittel- und ostgu-ropäische nationale und religiöse Gruppen vom18. bis zum frühen 20. Jahrhundert versucht ha-ben. eine euroDäische Off€ntlichkeit für ihr Anlie-gen - die Abschaffung von Diskriminierung bzw.die Herstellung nationaler Selbstst:indigkeit - zuinteressieren und somit Druck auf die Re-gierenden in ihren Ländem auszuüben. Im zwei-ten Teil werden Kriege und Revolutionsereignissezwischen 1848 und den l990er Jahren (Balkan-kriege) daraufhin untersucht, inwieweit über dieGrenzen hinweg moralisch appelliert und disku-rien wurde, und welche Anzerchen einer europäi-schen Öffentlichkeit sich finden lassen.
Der Frage nach der Existenz europäischer Of-fentlichkeit können sich auch Requate und Schul-ze Wessel nicht entziehen, und sie nutzen das füreine wichtige begriffliche Differenzierung. Of-fentlichkeit als ein dormatives ldeal. als handeln-der Akteur, dem gewisse Funktionen zugeschrie-ben werden, z.B. die Kontrolle der Regierenden inder Demokatie, unterscheide sich von der empi-risch erforschbaren Offentlichkeit. Diese ist aberalles andere als ein einheitlicher Akteur, sondemzerlällt in viele Akteure, Strukturen und Teilöf-fentlichkeiten auf unterschiedlich€n Ebenen.
Entsprechend machen sie klar, dass es zwar eu-ropäische Offentlichkeit als normative Erwartunggebe. Konket und empirisch nachweisbar könne
man aber kaum von einer ..allumfassenden gesam-teuropäischen Öffendichkeit" sprechen, weil eskeine,,kommunikativen Zusammenhänge (gebe),die einerseits die Nationalstaaten entgrenzten undandererserts Europa - sei es die EU. sei es eingrößeres, historisch oder geographisch verstande-nes Europa - begrenzen." Auch wenn Requateund Schulze w€ssel damit die Existenz einer dernationalen übergeordneten und Europa als ganzesumfassenden Offentlichkeit bestreiten, so Iegensie nahe, dass die ,,allenfalls" existierenden..transnationalen Öffentlichkeiten" stattdessendiese Funktion ausüben müssten ( l3).
Diese Unterscheidung ist sehr hilfreich, weilsie Klarheit in das Cewirr der Behauptungen überdie Existenz europäischer Öffentlichkeit bringl.Sie z€igt, dass es nicht darauf ankommt, dass eu-ropäische Offentlichkeit auch empirisch genausowie nationale Öffentlichkeiten beschaffen seinmuss, sondem dass es wichtiger ist, dass die Funk-tion(en) von Offentlichkeit erfüllt werden. Diekonkrete Ausgestaltung der lnstitutionen undKommunikationsströme ist dabei nicht entschei-dend. Daher widmen sich Requate und SchulzeWessel und die Autoren, die zu ihrem Band beige-tragen haben, den untersuchbaren transnationalenKommunikationsstrukturen und deren Diskursen.
lhre Definition unterscheidet sich sehr deutlichvom Mainstream der Forschung zu europäischerÖffentl ichkeir. denn sre begreifen europärsche Öf-fentlichkeit als ,,appellative Instanz". Diese De-finition speist sich nicht aus der Theo e, sondemaus einer Beobachtung. ln öffentlichen Debattenappellieren immer wieder Intellektuelle an ,,Euro-pa" bzw. eine ,,europäische Offentlichkeit", umauf vorgebliches Unrecht, Diskriminierung etc.aufmerksam zu machen. Damit wird versucht,jen-seits der eigenen Grenzen zur Solidarisierung fürein bestimmtes Anliegen aufzufordem (12f.).
Zunächst s€i das Europa, die europäische Of-fentlichkeit, die zum Eingreifen aufgefordertwird, lediglich Fiktion in den Köpfen der Gruppenod€r Intellektuellen, die an sie appellieren. An-dererseits könne gerade di€ser Appell, wenn er €r-folgreich ist, transnationale Kommunikation aus-lösen. Auch wenn es euroDäische Offentlichkeitals funktionierende Kontrollinstanz europäischerPolitik nicht gebe, so könne durch den Appell eintransnationaler Diskurs entstehen, der zur Folgehaben könne, dass sich Einstellungen verändem,Kooperation angeregt oder vielleicht sogar der be-klagte Missstand behoben wird. Im Idealfall wirdsomit die Öffentlichkeit, an die appelliert wird,durch den Appell selbst erst produziert.
Dies mag wie ein Sonderfall europäischer Of-fentlichkeit erscheinen, denn es sind vor allemmachtlose und marginale Gruppen oft aus der Pe-
fipherie Europas, die keinen Zugang zu den natio-nalen Medien haben und sich deshalb ersatzweisedes Appells an die europäische Offentlichkeit be-dienen. Damit zeige sich aber auch, welchen Bei-trag die Peripherie Europas ar der transnationalenKommunikation und damit zur Herausbildung eu-ropärscher Öffent l ichkeit lersler ( l4f.). Ander;eirswird deutlich, wie transnationale Kornrnunikationausgelöst werden kann und wie dies - wenn auchnur in bestimmten Situationen und keineswegs al-lumfassend - zu grenzübergreifenden normativenDiskursen auch über das, was Europa gemeinsamteilen sollte, beigehagen hat.
So ist der Ansatz eine interessante Ergänzungzur politik- und medienwissenschaftlichen For-schung, weil er nicht nur transnationale Kommu-nikation beobachtet und misst, sondem die Dy-namik ihres Entstehens, die Entstehungsbedin-gungen und die Strategien der Akteure über dievergangenen zweihundert Jahre hinweg unter-sucht.
Wenn man das Fehlen grenzüberschreitenderKommunikationsinfrastrukturen beklagt, so zei-g€n Requate und Schulze Wessel, dass dies dasErgebnis der Entwicklung seit der Herausbildungdes Nationalstaats seit etwa zweihundert Jahrenist. Die medialen Rahmenbedingungen transnatio-naler Kommunikation in Europa hätten sich vom18. zum 20. Jahrhundert eher verschlechtert. Zwarhabe die intemationale Kommunikation, vor allemdurch Ausweitung der Korrespondentennetze, zu-genorrnen. Gleichzeitig hätten sich die Kommu-nikationsstrukturen enteuropäisiert. Währendfrühe Zeitungen in französischer Sprache imganzen gebildeten Europa gelesen worden seien,habe es mit dem Aufstieg der Massenpresse undder nationalen Nachrichrenagenturen erne immerstärkere Nationalisierung der Berichterstattungs-perspektive der Medien geg€ben. Daran habe auchdas Femsehen nicht viel geändert, weil Femsehennational organisien wufi,e (22ff.).
Unter diesen Bedingungen war es für die Gruppen, die an eine europäische Offentlichkeit appellie-ren wollten, entscheidend, Strategien zu entwickeln,mit denen si€ europaweit für Aufmerksamkeit sor-gen konntgn. Dazu wandten sie sich ar grof3e eu-ropäjsche Zeitungen vor allem in den Metropolenwie Paris oder London und gründeten don selbstJoumale. Dabei sDielten Bildmaterialien eine wich-tige Rolle, weil sie leichter interkulturell vermittel-bar sind und selbst Suggestivkmft haben (30ff.).
Berl.J.Soziol.. Heft I 2004. S. 135-143
6. Schluss
Trägt man die Ergebnisse dieser ersten Welle vonForschungen zu europäischer Öffentlichkeit an-hand der eingangs aufgeworfenen Fragen zusam-men, so zeigen sich viele übereinstimmende De-fi nitionen und Forschungsergebnisse.I . Was ist europäische Offentlichkeit?
Zunächst ist europäisch€ Offentlichkeit aufnormativer Ebene der kommunikative Unterbaudes europäischen politischen Systems, zu dessenLegitimität sie beitragen soll, indem sie Grund-voraussetzungen für europäische Demokratieschafft. Dazu gehören die Information der Bürgerüber europäische Polit ik, um sie zu polit ischerPartizipation zu befühigen, und die grenzüb€r-schreitende öffentliche Kontrolle der auf euroDäi-scher Ebene Regierenden. Zudem wird erwanet,dass europäische Offentl ichkeit zur Herausbil-dung einer europäischen Identität beitrage.
Europäische Offentlichkeit wird von vielen da-her als intermediäres System konzeptionalisiert,das eine Brücke zwischen Bürgem und Europaschaffen soll, sich aber auch auf seine Systembe-standteile und deren Zusammenspiel hin untersu-chen lässt.
Im Hinblick auf die empirische Erforschungwird europäische Offcntlichkcit als grenzübcr-schreitender, geteilter, zumindest aber diesseitsund jenseits nationaler Grenzen synchroner - undvielleicht sogar von den Relevanzgesichtspunktenund den Referenzrahmen her Darallelcr - Me-diendiskurs begriffen. ln den hier vorliegendenStudien beschränkt sich Offentlichkeit also aufMedienöffentlichkeit.2. Wie lässt sich europäische Offentlichkeit un-tersuchen?
Eine solche Definit ion eignet sich besondersfür Medienanalysen. Diese Methode verwendenfast alle der diskutierten Texte. Schwerpunkt derUntersuchung ist die Zeit nach Maastricht, alsodie l990er Jahre, nur der Band von Requate undSchulze Wessel betrachtet die Zeit davor.
Dan€ben gibt es Fallstudien. Meyer analysiertSkandalkommunikation (vgl. Trenz 2000; 2002),an der sich zeigen lässt, ob europäische Offent-lichkeit in der Lage ist, die ihr zugeschriebenenFunktionen zu emillen. Die Beiträge im Band vonRequate und Schulze Wessel untersuchen auchFälle, anhand derer sie zeigen, wie Orupp€n oderIntellektuelle durch moralischen Appell transna-tionale europäische Kommunikation in Gang set-zen.3. Gibt es europäisch€ Öff€ndichkeit?
Im Hinblick auf die Kontrollfunktion stelltMeyer fest, dass es in den Skandalfällen eine funk- t4l
142
J.-H. Mever: Eurooäische Öffentlichkeit
tionierende europäische Öffentlichkeit gegeben ha-be, und €r ist vorsichtig optimistisch, dass das sobleibt und sich sogar ausweitet. Die mersten derhier vorgestellten Forscherinnen und Forscherargumentieren aber eher verhalten positiv, dass eu-ropäische Offentlichkeit möglich sei. Theoretischwird das bei Kanmer, €mpi sch bei steeg und Me-drano deutlich. Es gibt offensichtliche Parallelenund Gleichzeitigkeit in der Berichterstatnrng, aberMedrano sieht eher ..national versäulte" euro-päische Offendichkeiten im Entstehen, in denen dergrößte Teil der Kommunikation national getrenntbleibt. Ahnlich spricht auch Kevin l ieber von einer,,European Sphere ofPublics", also von gehennten,vielfältigen europäischen offentlichkeiten.
Vor den l95Oer Jahren - darin stimmen Requa-te und Schulze Wessel mit Kaelbles (2001: 171)Forschungsergebnissen übcrein - hat es keine eu-ropäische Offentlichkeit mit Bezug auf europäi-sche Institutionen g€ben können, wohl aber immerwieder punktuell an geteilte europäische Werteappellierende grenzüberschreitende Kommu-nikation.4. Welche Faktoren bedingen und beeinflussendie Entstehung oder Entwicklung europäischerOffentlichkeit?
Einerseits argumentieren die Autoren mit denGroßprozessen Europäisierung und Globalisie-rung, die zur Transnationalisierung und Europäi-sierung der Kommunikation beigetragen hätten(Meyer, Kevin). Die Polit ik der EuropäischenUnion, der zunehmende grenzüberschreitendeHandel und ökonomische Verflechtungen hättendas lnteresse an den polit ischen und ökonomi-schen Entwicklungen gesteigert. Damit sei auchNachfrage nach mehr Berichterstattung entstan-den. Ahnlich argumentiert auch Kantner. Die,,ho-he Interaktionsdichte" auf europäischer Ebene be-vorzuge überdies die europäische Ebene gegenü-berder weltweiten, da die Europäer ein politischesProjekt teilen. Ob das eine etwas idealistische Ein-stellung ist, ob nicht vielmehr- gerade im Bereichder Wirtschaft transnationale Kommunikationdarüber hinausgeht, und inwieweit Europa bei denBürgem wirklich als geteiltes politisches Projektwahrgenommen wird, muss hier offen bleiben.Das hat jedoch große Auswirkungen auf Art undUmfang europapolitischer Berichterstattung undob diese sich in Richtung ein€r europäischen Of-fentlichkeit entwickelt.
Die Forschungsprogramme von Klein €t al.und Requate und Schulze Wessel machen daraufaufmerksam, dass zivilgesellschaftliche Gruppendurch ihr Engagement und eine geschickte Stra-tegie europäische Debatten ansto߀n können.
Die Rolle der Medien als kommetzielle Unter-nehmen und der Joumalisten als ..Verkäufer" von
Nachrichten in elner Konkurrenrsrlualion hebe;Meyer und Kevin als Medienwissenschaftler her-vor- Das gerät bei den demokratietheoretisch mo-tivierten Forscherinnen und Forschem oft ins Ver-gessen: Es ist keineswegs explizites Ziel der Me-dien, europäische Offentlichkeit herzustellen. An-dererseits führt die Entstehung europäischer oderinternationaler Medienkonzerne zu verstärktemeuropäischem Austausch.
Die Bereitschaft von Joumalisten und Medien-institutionen zur KoopeEtion ist in jedem Falleentscheidend. Sie sind es, die die Transfer- undÜbersetzungsleistung vollbringen, die so etwaswie eine europäische Offentlichkeit schaffen, diein der Lage ist, europäische Politik kritisch zu be-gleiten. Entsprechend plädien Kevin - als Politik-empfehlung - nicht so sehr für eine Ausweitungder Informationspolitik, sondem eher ftir etne ver-stärkte Zusammenarbeit europäischer Medien-institutionen. wenn die EU europäische Offent-lichkeit stärken möchte, ist das ein Ansatzpunkt.Von oben verordnen lässt sich europäische Of-fentlichkeit aber nicht.
Literatur
Chryssochoou, Dimitris N. (2003): EU Democracyand the Democratic Dcficit. In: Michelle Cini(Hrsg.), European Union Politics. Oxford.NewYork: Oxford University Press, S. 365-382.
Eder, Klaus (2003): Offentl ichkeit und Demo-kratie. In: Markus JachtenfuchVBeate Kohler-Koch (Hrsg.), Europäische Integration. Opla-den: Leske + Budrich. UTB. S. 85-120.
Eder, Klaus,4(ai-Uwe Hellmann/Hans-Jörg Trenz(1998): Regieren jenseits öffentl icher LegitFmation? Eine Untersuchung zur Rolle von poll-t ischer Offentl ichkeit in Europa. In: BeateKohler-Koch (Hrsg.), Regieren in entgrenztenRäumen. opladen: Westdeutscher Verlag, S.321-344.
Eder, Klaus/Cathleen Kantner (2000)r Trans-nationale Resonanzstrukturen in Europa. EineKritik der Rede vom Öffentlichkeitsdefizit. In:N4auriTio Bach (Hrsg.). Die Europätsierung na-tionaler Gesellschaften. Sonderheft 40 der Köl-ner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-chologie. Opladen: Westdeutscher verlag, S.306-331.
Gerhards, Jürgen (1993): Westeuropäische Inte-gration und die Schwierigkeiten der Entste-hung einer europäischen Offentlichkeit. Dis-cussion PaDer FS III 93-101. Wissenschafts-zentrum ftir Sozialforschung Berlin.
Gerhards, Jürgen (2000): Europäisierung vonOkonomie und Polit ik und die Träsheit der
= Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit.In: Maurizio Bach (Hrsg.), Die Europäisierungnationaler Cesellschaften. Sonderheft 40 derKölner Zeitschrift ftir Soziologie und Sozialp-sychologie. Opladen: Westdeutscher Verlag, S.27'7-305.
Gerhards, Jürgen (2002): Das Offentlichkeitsdefi-/ it der EU im Horizont normaliver Öffentltch-keitstheorien. In: Hartmut Kaelble et al.(Hrsg.), Transnationale Öffentlichkeiten undIdentitäten im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M./New York: Campus, S. 135-158.
Giesen, Bemhard (1999): Europa als Konstruktionder Intellektuellen. Inr Reinhold Viehoff/RienT. Segers (Hrsg.), Kultur, Identität, Europa.Lrber die Schwierigkeiten und Möglichkeiteneiner Konstruktion. Frankfun a.M.: Suhrkamo.s . 130- t46 .
Giesen, Bernhard/Thomas Risse (1999): WhenEurope hits home. Europeanization and Natio-nal Public Discourses. (http://www.fu-berlin.de/atasp/pub/dfggiesen.pdf).
Habermas, Jürgen (1996): Die Einbeziehung desAnderen. Studien zur Dolit ischen Theoric.Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Joerges, Christian/Jürgen Neyer (1998): Vom in-tergouvemementalen Verhandeln zur delibera-tiven Polit ik: Gründe und Chancen für eineKonstitutionalisierung der europäischen Komi-tologie. In: Beate Kohler-Koch (Hrsg.), Re-gieren in entgrenzten Räumen. Opladen: West-deutscher Verlag, S. 207-234.
Kaelble, Hartmut (2001): Wege zur Demokratie.Von der Französischen Revolution zur Euro-päischen Union. StuttgarLMünchen: DeutscheVerlags-Anstalt.
Kaelble, Hartmut (2002): The Historical Rise ofaEuropean Public Sphere. In: Joumal of Euro-pean lntegration History 8, S, 9-22.
Kielmansegg, Peter G. (2003): Integration undDemokratie (mit Nachwort zur 2. Auflage). [n:Markus Jachtenfuchs/Beate Kohler-Koch
Berl.J.Soziol.. Heft 1 2004. S. 135-143
(Hrsg.), Europäische lntegration. Opladen: L€-ske r Budrich. UTB. S. 49-83.
Koopmans, Ruud/Paul Statham (2002)r TheTransformation of Political Mobilisation andCommunication in European Public Spheres.A Research Outline: europub.com projecl.2002. (http://www.leeds.ac.uk/ics/euro/euro-pub.pd0.
Neidhardt, Friedhelm (1994): Offentlichkeit, Of-fentliche Meinung und soziale Bewegungen. In:Ders. (Hrsg.), Offentlichkeit, Offentlich€ Mei-nung, Soziale Bewegungen. Sonderheft 34 derKölner Zeitschrift ftr Soziologie und Sozialpsy-chologie. Opladen: Leske + Budrich, S. l-40.
Neunreither, Karlheinz (1994): The DemocraticDeficit of the European Union: Towards Clo-ser Cooperation between the European Parlia-ment and the National Parliaments. ln: Gover-nment and Opposrtion 29. S. 299-314.
Peters, Bemhard (2002): Die Transnationali-sierung von Offentlichkeit und ihre Bcdeutungftir politische Ordnungen am Beispiel der EU.(httpr//wuv.sfb597.uni-bremen.de/downlo-ads/1083.pd0.
Schlesinger, Philip/Deirdre Kevin (2000): Can theEuropean Union become a sphere of publics?In: Erik Oddvar Eriksen/John Erik Fossum(Hrsg.), Democracy in the European Union: In-tegration through Deliberation? London,NewYork: Routledge, S. 206-229.
Trenz, Hans-Jörg (2000): Komrption und politi-scher Skandal in der EU. Aufdem Weg zu ei-ner Europäischen Offentlichkeit? In; MaurizioBach (Hrsg.), Die Europäisierung nationalerCesellschaften. Sonderheft 40 der Kölner Z€it-schrift für Soziologie und Sozialpsychologie.Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 332-359.
Trenz, Hans-Jörg (2002): Zur Konstitution politi-scher Offentlichkeit in der Europäischen Uni-on. Zivilgesellschaftl iche Subpolit ik oderschaupolitische Inszenierung? Baden-Baden:Nomos.
t43