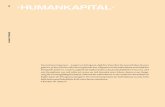Warum 'nicht bleiben' nicht 'werden' ist: Ein Plädoyer gegen die Dualität von 'werden' und 'bleiben'
Das Werden der "Kontrolle": Herkunft und Umfang eines Deleuze'schen Begriffs
-
Upload
uni-marburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Das Werden der "Kontrolle": Herkunft und Umfang eines Deleuze'schen Begriffs
18
Das Werden der „Kontrolle“: Herkunft und Umfang eines Deleuze’schen Begriffs.
Dietmar Kammerer
Der vorliegende Text fällt aus der Reihe der in diesem Band versammelten Beiträge insofern heraus, als es ihm nicht um die Beschreibung einer gesell-schaftlichen Praxis geht, sondern um die Konstruktion und die Beantwortung eines theoretischen Problems. Dabei wird dieses Problem allgemein noch nicht einmal als solches erkannt; im Gegenteil war man, so die Ausgangs-these, bisher zu voreilig mit Antworten zur Hand und hat die richtigen Fragen noch gar nicht gestellt. Damit wäre allerdings wieder auf eine Praxis verwie-sen – in diesem Fall nämlich auf eine mangelhafte oder verbeserungswürdige akademische Praxis im Umgang mit philosophischen Texten. Kurz gesagt, geht es im Folgenden darum, die Begriffe der „Kontrolle“ und der „Kontroll-gesellschaft“, wie sie Gilles Deleuze eingeführt hat, einer erneuten Lektüre zu unterwerfen.
Damit ist einerseits ein wenig originelles Programm formuliert. Schließ-lich macht der Begriff der „Kontrollgesellschaft“ im kriminologischen und soziologischen Diskurs der Überwachung seit einigen Jahren eine beachtliche Karriere (Lindenberg/Schmidt-Semisch 1995; De Marinis 2000; Krasmann 2002; Bogard 2007). Dabei wird der Begriff zumeist als neues Paradigma eingeführt, als ein Konzept, von dem man sich eine Neuausrichtung des ge-samten diskursiven Feldes erwartet oder zumindest eines sehr großen Teils davon. Die „Kontrollgesellschaft“, so die Hoffnung, soll das „Panopticon“ beerben oder ablösen, das als theoretisches Modell zur Beschreibung unserer Gegenwart zunehmend in Kritik gerät und an Erklärungs- wie Überzeugungs-kraft verliert (Lyon 2006).
Andererseits ist damit ein außergewöhnliches Vorhaben markiert. Zwar ist es mittlerweile üblich geworden, von „Kontrollgesellschaft“ zu reden und sich dabei auf das Postskriptum über die Kontrollgesellschaften (Deleuze 1993a) zu berufen. Kaum jemand aber geht auf den Text als solchen ein. Das fängt beim Titel an. Ein Postskriptum ist eine Nachschrift. Deleuze will mit etwas abschließen, er will, am Ende einer längeren Auseinandersetzung, be-reits Gesagtes sortieren, um es neu einzuschätzen. Folglich muss es vor die-
19
sem Text weitere Texte gegeben haben, zumindest weitere Überlegungen, Denkbewegungen, Begriffsschöpfungen, die sich ebenfalls mit den Kontroll-gesellschaften auseinandergesetzt haben oder uns zumindest Auskunft darü-ber geben, was Deleuze jeweils meint, wenn er ›contrôle‹ sagt oder schreibt. Diese begrifflichen Entwicklungen der ›Kontrolle‹ bei Deleuze vorzustellen, ist das Anliegen dieses Textes.
Das Folgende gliedert sich in vier Abschnitte: Erstens, eine Kritik am kriminologischen und soziologischen Diskurs in Hinblick auf dessen Lektüre des Postskriptum. Zweitens wird die Etymologie und die Geschichte des Be-griffs ›Kontrolle‹ nachgezeichnet. Im dritten Abschnitt wird eine Reihe von Texten vorgestellt, in denen Deleuze schon vor dem Postskriptum seine Ge-danken über die Kontrolle oder die Kontrollgesellschaft entwickelt hat. Diese Texte sind: Ein neuer Archivar; Optimismus, Pessimismus, Reisen; Was ist der Schöpfungsakt; Kontrolle und Werden und schließlich das Postskriptum selbst. Abschließend werden zusammenfassend die Charakteristika der Kont-rollgesellschaft skizziert.
Die Rezeption des Postskriptum
Folgende Diagnose wird mittlerweile allgemein unterschrieben oder zumin-dest als diskussionswürdig akzeptiert: Die alten Milieus der Einschließung haben sich weitgehend aufgelöst. Die Disziplin und ihre Institutionen sind in der Krise. Zwang und Einsperrung sind keine Mittel der Herrschaft mehr, oder wenigstens nicht mehr deren erste Wahl. So stellt sich das Problem: Wie beschreiben wir unsere Gegenwart? Was kommt „nach“ der Disziplin bzw. tritt sie ergänzend oder modifizierend an ihre Seite? Überblickt man die kri-minologische, soziologische und medienphilosophische Literatur daraufhin, kann man, sehr allgemein gesprochen, zwei verschiedene Typen von Antwor-ten auf diese Frage finden. Die erste Antwort sagt: Ja, wir sind im postdiszip-linären Zeitalter angekommen, und Deleuze hat einen Begriff dafür gefunden. Allerdings meint „Kontrolle“ letzten Endes nichts anderes, als das, was an-derswo als „neoliberale Selbstoptimierung“ beschrieben wird. Oder als „Gouvernementalität“. Oder als „Regieren durch Freiheit“. Oder als „Proto-koll“. (Krasmann 2004; Opitz 2007; Legnaro 2003; Galloway 2004). So wird Deleuzes Konzept nur aufgerufen, um sogleich durch ein anderes ersetzt und verdeckt zu werden.
Der zweite Typ von Lektüre sagt: Ja, es gibt die Herrschaftstechniken, die Deleuze als Kontrollgesellschaft beschreibt. Aber sie haben die Techni-ken der Disziplin nicht abgelöst, sondern ergänzt. Es gibt Einschließung und Ausschluss, Regieren durch Zwang und Regieren durch Freiheit, flexible und starre Formen von Herrschaft. Macht ist keine Frage des Nacheinander, son-
20
dern des Nebeneinander in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt Techniken der Kontrolle und der Disziplin und sogar noch Elemente der alten, körper-lich strafenden Souveränitätsmacht (Prömmel 2002). Solche Ansätze haben den Vorteil, dass sie immer eine Erklärung für die Vielfalt des empirisch Be-obachtbaren zur Hand haben; erkauft wird diese Anwendbarkeit um den Preis begrifflicher Schärfe.
Kurz gesagt heißt das, dass das Postskriptum oft zitiert und selten beim Wort genommen wurde. Dabei ist der eben skizzierte Umgang mit Deleuzes Aufsatz weder „falsch“ noch „unangemessen“. Die Stärke dieses Textes – oder seine konzeptuelle Schwäche - liegt gerade in seiner enormen Suggestivität, in seinem Vernögen, das Denken und die Begriffsarbeit her-auszufordern. Deleuze schert sich im Postskriptum wenig um argumentative Ausarbeitung, begriffliche Schärfe oder um empirische Belege seiner Thesen. Unverkennbar jedoch löst sich der angebliche ›Erfolg‹ des Konzeptes der „Kontrollgesellschaft“ umso mehr auf, je genauer man hinsieht. Es ist sozu-sagen ein dünnhäutiger Begriff, der durchsichtig wird, wenn man zu nahe an ihn herantritt. Liest man jedoch die Texte, in denen der Philosoph sich lange vor seinem Postskriptum-Aufsatz an einer Analytik der Macht in einer post-disziplinären Gesellschaft versucht hat, dann ergibt sich ein dichteres Gewe-be dessen, was unter „Kontrollgesellschaft“ verstanden werden kann.
Begriffsgeschichte: Das Gegenregister
Zunächst allerdings soll die Begriffsgeschichte befragt werden. Diese lehrt uns, dass „Kontrolle“ ein notorisch vieldeutiges Konzept ist. Mit ihm ist die Prüfung einer Sache oder eines Sachverhalts ebenso bezeichnet wie die Be-herrschung von Individuen oder die technische Lenkung einer Maschine. Kontrolle kann sich auf den Prozess beziehen oder auf das Produkt, sie kann das Mittel wie den Zweck umfassen. Sie kann in medias res einsteigen oder sie kann aus räumlicher oder zeitlicher Distanz ein Ergebnis prüfend begut-achten. Sie kann direkten, steuernden Einfluss nehmen oder mittelbaren durch einschränkende Regulierung. Sie kann, schreibt der Sprachwissen-schaftler Wilmar Laute, das gesamte Spektrum umfassen von der „Prüfung zum Zwecke der Bestätigung“ bis zur absoluten Herrschaft durch das „Auf-zwingen des eigenen Willens“. (Laute 1969: 167)
Im Deutschen ist „Kontrolle“ eine junge Vokabel. Bis vor dem Ersten Weltkrieg war es ein Fremdwort und nur in Fachkreisen gebräuchlich. In Meyers Großem Konversations-Lexikon von 1905 liest man unter dem Stichwort „Kontrolle“ Folgendes: „Kontrolle (franz. contrôle, „Gegen-register“), Gegenaufzeichnung bei einer Rechnungsführung durch eine zweite Person zu dem Zweck, die Rechnung auf ihre Richtigkeit zu prüfen; in
21
staatswissenschaftlicher Hinsicht überhaupt die Überwachung der Regel-mäßigkeit und Gesetzlichkeit der öffentlichen Verwaltung, sowohl in Finanz-sachen als in Beziehung auf alle übrigen Gegenstände.“
Entlehnt wurde der Begriff aus dem Französischen und bedeutete zu-nächst nichts anderes als Rechnungsprüfung im Rahmen einer Amts-aufsicht. Der Begriff stammt aus der Verwaltung des Staates. In Frankreich war der Contrôleur seit dem Mittelalter ein Beamter, der die Finanzen des Staates im Namen des Souveräns kontrollierte, indem er ein Gegenbuch – das contrarotulus – über Ausgaben und Einnahmen führte. Kontrolle bedeutet hier die Überprüfung eines Ressorts durch ein anderes Ressort in höherem Auftrag. Übernommen hat die französische Verwaltung diese Praxis aus Eng-land, das um die Mitte des 14. Jahrhunderts bereits über hoch entwickelte Techniken der der Archivierung, Buchführung und Rechnungsprüfung ver-fügte. In der Folge jedoch spreizten sich das kontinentale und das insulare Verständnis von „Kontrolle“ aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen von Herrschaft und Verwaltung auseinander. So verfügte der anglo-normannische Kontrollbeamte über ein weites Spektrum von Aufgaben und Befugnissen, die richterliche ebenso wie exekutive Kompetenzen umfassten. Im Gegensatz dazu war der französische Contrôleur général des finances ein hoch stehen-der Finanzprüfer, der nur dem König Rechenschaft schuldig war. Seine Auf-gabe lag allein in der Prüfung und Überwachung der ausführenden, niederen Behörden. Die Einflussnahme, die solch ein Contrôleur ausüben kann, ist le-diglich eine mittelbare: diese Kontrolle ist regulierend, ein-schränkend, ist ei-ne Korrektur oder eine Zügelung. Fünf Punkte müssen festgehalten werden.
Erstens. Wie die Sprachwissenschaft nachgewiesen hat, hat „Kontrolle“ wortgeschichtlich eine im französischen bzw. anglonormannischen Sprach-raum jeweils unterschiedliche Karriere durchlaufen: In der Bedeutung von „eine Sache beherrschen, entscheidend beeinflussen“, ist es aus dem Engli-schen to control zu uns gekommen. In der Bedeutung „einen Sachverhalt überwachen und auf Richtigkeit prüfen“ geht es auf das französische contrôler zurück. Nach dem französischen Verständnis bedeutet die Aus-übung von contrôle ausdrücklich, sich vom Handeln freizumachen, jegliche Aktion zu suspendieren. Wie fremdartig im Französischen „Kontrollieren“ und „Handeln“ im Bereich von Politik und Verwaltung gegeneinander sind, belegt der Eintrag im Littré aus dem Jahr 1956: „Dans le langage politique et administratif le contrôle est opposé à l‟action; c‟est un principe que le contrôle et l‟action doivent être separés“(Zitiert nach Laute 1969: 1331).
1 „Im politischen und administrativen Sprachgebrauch ist Kontrolle dem Handeln ent-gegengesetzt; es gilt als Prinzip, dass die Kontrolle vom Handeln getrennt wer-den muss.“
22
Zweitens. Ein manipulativer, operativer Aspekt einerseits, und ein exa-minierender, prüfender, überwachender Aspekt andererseits sind heute im Begriff der Kontrolle in einer Weise verbunden, die historisch absolut neu ist und auf die Zeit nach 1945 datiert werden kann. In die semantische Nähe von „absoluter Herrschaft“ ist das deutsche „Kontrolle“ erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelangt. In den sechziger Jahren sei „Kontrolle“ im öffentlichen Diskurs schließlich zu einem „Modewort“ geworden, das, so der Sprach-wissenschaftler Laute, immer dann eingesetzt werde, wenn es gelte, die Un-durchschaubarkeit oder Verworrenheit der Herrschafts- oder Macht-verhältnisse anzuzeigen.
Drittens. Kontrolle ist expansiv, sie löst die Grenzen der traditionellen Ressorts und Kompetenzen auf. In England haben die Beamten des Königs auf einer gewissermaßen horizontalen Ebene den Kreis ihrer Befugnisse stets erweitern können und so schließlich in ihrem Amt die Trennung von Exeku-tive und Rechtssprechung aufgehoben, sie wurden Richter und Polizist in ei-ner Person. In Frankreich verlief die Expansion vertikal, der der Kontrolleur wurde in den Rang des Contrôleur général erhoben. Horizontale Ausweitung der Kompetenzen einerseits, vertikale Erhöhung des Ranges andererseits.
Viertens. Als Herrschaftsinstrument ist Kontrolle, wenigstens an ihrem Ursprung, ein Verhältnis innerhalb staatlicher Institutionen, sie ist eine Ein-schränkung staatlichen Handelns durch sich selbst. Freilich zielt der Staat dabei nicht auf eine Selbstbeschränkung seiner Macht, sondern im Gegenteil darauf, Verschwendung und Veruntreuung von Finanzmitteln zu unterbinden und damit seine Handlungsfähigkeit zu erhalten.
Fünftens. Als Verwaltungshandeln entsteht Kontrolle als Herrschaft im Modus der Schriftlichkeit. Schematisch gesprochen kann man die Funktion jeder Verwaltung darin erkennen, dass sie Sachen und Sachverhalte auf-schreibt, dass sie alles, was sich auf dem Territorium des Souveräns befindet, als Daten verzeichnet. Die Besonderheit der Kontrolle besteht nun darin, dass sie nicht mehr Dinge, sondern Daten in Daten verdoppelt. In der Sprache der Systemtheorie würde sie gewissermaßen auf der Ebene der zweiten Beobach-tung operieren.
Das Werden der Kontrolle bei Deleuze
1975 verfasst Gilles Deleuze eine Rezension des kurz zuvor erschienenen Buches Surveiller et punir seines Freundes Michel Foucault unter dem Titel Ecrivain non: un nouveau cartographe: Kein Autor, sondern ein neuer Kar-tograph (Deleuze 1977). Darin geht er auf zwei entgegengesetzte Diskurse zur Gefängnisreform ein, die seiner Ansicht nach beide falsch sind. Weder, behauptet Deleuze, hätten diejenigen Recht, die in den Bemühungen um eine
23
Reform des Gefängnisses einen wirklichen Fortschritt sehen; noch ist denje-nigen zuzustimmen, die darauf bestehen, dass sich im Kern der Dinge über-haupt nichts ändere. „[T]atsächlich werden das Diagramm oder die Parzellie-rung bald unter harten, kompakten und getrennten Formen verwirklicht, […] bald werden die Formen geschmeidig, verstreut, beweglich und bilden eher ein allgemeines Netz als eine Kette aus getrennten Gliedern.“ (Deleuze 1977: 122).
Die disziplinarische Gesellschaft, so Deleuze im Jahr 1975, bleibt beste-hen. Aber: sie tritt in eine andere Modalität ein, sie verteilt ihre Funktionen neu, sie entfaltet neue Strategien. Deleuze nennt als Beispiel „die Kontroll- und Überwachungsaufgaben, die heute unter dem Gesichtspunkt einer Ge-fängnis- oder Psychiatriereform den „Sozialarbeitern“ zugeschrieben wer-den“ (ebd.: 122-123). Bereits in den siebziger Jahren hat Deleuze sich dem-nach mit der Frage der Herrschaft nach der Zeit der Gefängnisse und Ein-schließungen, nach den Disziplinarmechanismen beschäftigt. Und schon hier gebraucht er den Begriff der „Kontrolle“, wenngleich auch noch in unsyste-matischer Weise und nicht unterschieden von disziplinären und also über-wachendenden Formen von Herrschaft.
Optimismus, Pessimismus, Reisen. Brief an Serge Daney
Überall die Kontaktlinse. Deleuze
Es dauert ein Jahrzehnt, bis Deleuze sich erneut mit dem Problem eines post-disziplinären Diagrammes der Macht auseinandersetzt. 1985 schreibt er, wie-der in einem Freundschaftsdienst, das Vorwort zu Ciné journal, einer Samm-lung von Essays und Rezensionen des Filmkritikers Serge Daney . Diesem Vorwort gibt Deleuze die Form eines Briefes (Deleuze 1993b). Zugleich ist dieses Vorwort und dieser Brief ein medienpolitisches Pamphlet, eine Vertei-digung des Kinos gegen das Fernsehen. Das Fernsehen will nichts weniger als den Tod des Kinos, behauptet Deleuze. Denn das Kino ist der Ort des „Supplements“. Dieses Supplement ist vor allem Aufschub und Ergänzung. Für Deleuze bezeichnet es die Funktion des Kinos, Dinge, Bewegungen und Menschen aufzubewahren, sie vor dem Vergessen und Verschwinden zu be-wahren. Im ihm erfülle sich die eigentlich ästhetische Funktion des Kinos, so der Philosoph. In ihm gehe es darum, die Bilder auf eine Zukunft hin offen zu halten. Das Fernsehen hingegen dulde keinen Aufschub, denn es kenne nur das Live-Format der unmittelbaren Gegenwart sowie das instant replay, die sofortige Wiederholung (wie sie vor allem in der Sportberichterstattung ver-breitet ist). Mit anderen Worten, alles, was im Fernsehen geschieht, geschieht im Modus des Jetzt (und zwar ganz gleich, ob es sich bei dem Gesendeten in Wirklichkeit um eine Aufzeichnung handelt). Deshalb nennt Deleuze das
24
Fernsehen eine „unmittelbar soziale Technik, die keinerlei versetzte Bezie-hung zum Sozialen bestehen lässt, es ist die Sozialtechnologie im Reinzustand [und die Form], in der die die neuen ›Kontroll‹-Mächte unmit-telbar und direkt werden“ (Deleuze 1993b: 110-111).
Zwei Logiken der Bilder sind damit gegeneinander gestellt: Einerseits eine Logik des bewahrenden Aufschubs, der versetzten, indirekten Beziehung zu einem Sozialen, eine Logik der Offenheit auf eine Zukunft hin. Das Kino, so könnte man hier Deleuze mit Nietzsche umschreiben, richtet sich an Alle und Keinen, an ein Publikum, das es noch nicht gibt, das nur virtuell, seiner Möglichkeit nach, vorhanden ist. Dem gegenüber steht andererseits eine Lo-gik der unmittelbaren Verwertung und der endlosen Gegenwart, die keinen Fortschritt und keine Verwandlung mehr kennt und die mit dem Publikum in direkten Kontakt tritt.
Was heißt in diesem Fall „Unmittelbarkeit“, worin besteht ihre Funktion? Das Fernsehen, so lautet Deleuzes bündige Diagnose, suche weder nach Schönheit noch folge es einer Bewegung des Denkens. Es sei weder ein Abenteuer der Wahrnehmung noch eines der Vergeistigung. Beide Möglich-keiten schlage das Fernsehen aus und es entscheide sich statt dessen für ein Drittes: für das Abenteuer des Kontaktes. Im Fernsehen, so Deleuze, werfen „alle Bilder […] mir ein einziges zurück: das meines leeren Auges, in Kon-takt mit einer Un-Natur, kontrollierter Zuschauer, der in die Kulissen über-gewechselt ist, in Kontakt mit dem Bild, in das Bild eingeblendet“ (Deleuze 1993b: 106). Das Publikum hat seine Sitze verlassen und ist in die Kulissen gewechselt. Deleuze erinnert daran, dass das Dabeisein im Studio, dass die Teilnahme an der Produktion in der Fabrik der Bilder, zum eigentlichen Spektakel der Unterhaltung geworden ist. Alles Fernsehen ist, wörtlich ver-standen, „Fernsehshow“. Denn das Fernsehen zeigt als erstes sich selbst, es zeigt, wie es als Show hergestellt wird und lässt alle dabei zusehen. Darin liegt das Prinzip jeder Casting-Show und jeder Suche nach dem nächsten „Superstar“ oder dem kommenden „Supermodel“, die zugleich einzigartig sein sollen und in Serie hergestellt werden. Es geht um nichts anderes als um „how a star is born“, welche Mühen es kostet und welche Arbeit am Selbst geleistet werden muss, um es im Fernsehen „ganz nach oben“ zu schaffen. Das Versprechen des Fernsehens lautet: Jeder und jede kann daran teilneh-men, kann in Berührung mit der Medienmaschine kommen und kann Teil von ihr werden, während die anderen Zuschauer Anteil an seinem oder ihrem Aufstieg oder Fall nehmen. Nicht diese oder jene zur Schau gestellte Leis-tung des Individuums (gut singen gut tanzen, gut aussehen), sondern das Ma-king of ist die eigentliche Attraktion solcher Fernsehformate, ist ihr eigentli-cher Schauwert. In den Worten von Deleuze heißt das: „Es geht nicht um Schönheit oder Denken, sondern darum, in Berührung mit der Technik zu kommen, Technik anfassen zu können.“ (ebd.: 107)
25
Was genau also ist am Fernsehen zu kritisieren? Was ist daran auszu-setzen? Deleuze sagt nicht: Das Fernsehen will euch für dumm verkaufen. Er sagt nicht: Das Fernsehen ist hässlich, es ist eine Lüge, ein Verblendungs-zusammenhang, eine Illusion, etwas, das die wahren Verhältnisse der Welt von euch fern hält oder die Welt falsch darstellt. Im Gegenteil. Was Deleuze kritisiert, ist gerade die Perfektion des Fernsehens. Nicht seine Botschaft, sondern seine Fähigkeit, eine unmittelbare, sofortige Beziehung zum Zu-schauer herzustellen und sein Verzicht auf die ästhetische Funktion lässt das Fernsehen in Deleuzes Analyse zur Form werden, „in der die die neuen ›Kontroll‹-Mächte unmittelbar und direkt werden“ (ebd.: 110-111).
Man muss an dieser Stelle noch genauer werden. „Fernsehen“ versteht Deleuze weder als staatliche oder private Institution noch als technischen Apparat. In erster Linie ist „Fernsehen“ für Deleuze ein neues Bildschema, eine neue Art und Weise, Bilder zu sehen. Im Fernsehen schaut man nicht „auf ein Bild“, wie noch im Kino, noch schaut man, wie in der Malerei, „durch ein Bild“ wie durch ein Fenster hindurch. Im Fernsehen setzt man sich ins Bild, man wird ins Bild eingesetzt, („inséré dans l‟image“). Dieser Wunsch, dabei zu sein, der Partizipation am Bild, ist die wesentliche Be-stimmung des „Fernsehens“ bei Deleuze. Die Frage, ob „das Fernsehen“ als Institution die Welt falsch oder ungenügend oder verzerrt wiedergibt, stellt sich in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Denn die Welt ist Fernsehen. Oder genauer: „die Welt selbst macht nun Film, irgendwie Film, und genau das ist Fernsehen, wenn die Welt irgendwie Film macht“ (ebd.: 112).
Alle Welt macht Film, und eben darin besteht das Fernsehen. Der Film-wissenschaftler Drehli Robnik (2006) deutet diesen Satz auf zweierlei Weise. Erstens bringt er die Formel von der Welt, die Film macht, in Verbindung zu der Redeweise ›ein Theater machen‹. Wer ›ein Theater macht‹, tobt sich aus, führt sich auf, er oder sie ›inszeniert sich‹. Daher könne man, so Robnik, die Aussage auch wie folgt verstehen: „Alle Welt führt sich auf“, alle Welt will sich inszenieren. Zweitens verweise Deleuze damit auf „eine Sättigung, eine Durchdringung der Welt mit Filmischem. Film geht in beliebigen Facetten weltweiter Alltage auf“ (Robnik 2006: 10). Le monde se met a faire ›du‹ cinéma2. Für Robnik nimmt dieser Satz eine Situation vorweg, in der die Pro-duktion, Zirkulation und Rezeption von Bildern sich weder auf spezielle Be-reiche (Journalismus, Kunst, Tourismus, Werbung) noch auf spezifische An-lässe beschränkt, sondern prinzipiell überall und zu jeder Zeit stattfinden kann. Seit Mobiltelefone nur noch selten ohne Kamerafunktionen ausgestattet werden und seit das Internet-Portal YouTube das Motto „broadcast yourself“ ausgegeben hat, können wir alle Teil des Films werden, den eine Welt macht, in der wir uns selbst aufführen. Robnik macht den schönen Vorschlag, genau
2 „die Welt selbst macht nun Film“
26
diesen Punkt zum Dreh- und Angelpunkt der Unterscheidung zwischen fordistischer Disziplin- und postfordistischer Kontrollgesellschaft zu machen: Musste man sich im Zeitalter der Disziplin vor allem „ordentlich aufführen“, so gilt heute bekanntlich der Imperativ „sich so richtig ordentlich aufzu-führen“, eine Fulltime-Performance mit allen Sinnen und allen Affekten ab-zuliefern, in der die Fähigkeiten und die Wünsche, das gesamte Begehren und die gesamte Ausdruckskraft des Subjekts zum Einsatz kommen sollen.
Es verlangt unseren vollen Einsatz, wenn wir ins Bild eingesetzt werden, aber die Bilder machen es uns auch leicht, sie stürmen auf uns zu und wollen „immersiv“ werden. Jeder Oberfläche wird zum Touchscreen, der auf Berüh-rung reagiert. Schon lange sind wir im Kino vom Surround-Sound umgeben, seit neuestem (und schon wieder) hält die dritte Dimension dort Einzug, für die jeder Zuschauer mit einer High-Tech-Brille ausgestattet wird. So sieht unmittelbarer Kontakt mit Technik heutzutage aus, man muss sich nicht mehr ins Studio begeben, die Bildfabrik kommt zu einem, wird zum umfassenden Milieu. Schon lange wird uns das interaktive Fernsehen versprochen. Jeder Leser soll sein eigener Reporter werden, bezahlte Journa-listen werden zu embedded journalists. Um es mit einem von Deleuze geborgten Wort zu sa-gen: Egal, wohin man in der Medienwelt blickt: Überall herrscht die Kontakt-linse. Partout la lentille de contact. (Deleuze 1998: 15).
Was ist der Schöpfungsakt?
Dass das Kino sich einer ›Kontrollmacht‹ widersetzen kann oder muss, ist ein Thema, das Deleuze erneut in einem Vortrag am 17. März 1987 vor Studie-renden der Pariser Filmhochschule FEMIS aufgreift. Darin verschiebt Deleu-ze die oben skizzierte antagonistische Konstellation der Medien: Nicht mehr das Fernsehen, sondern die Informationsgesellschaft bildet nun die neue Kontrollmacht, gegen die das Kino und die Künste zu Widerstand aufgerufen werden. Deleuze spricht ohne vorgefertigten Text und aus dem Stegreif, er argumentiert zugespitzt und polemisch. Er stellt die Frage: Was ist Kommu-nikation? Und gibt die Antwort: „Als erstes ist die Kommunikation Über-mittlung und Verbreitung einer Information. Was aber ist eine Information? Das ist nicht kompliziert, jedermann weiß es: eine Information ist eine Ge-samtheit von Losungen, Befehlen, Parolen. Wenn man Sie informiert, sagt man Ihnen, was Sie glauben sollen. Mit anderen Worten, informieren heißt eine Losung in Umlauf bringen.“ (Deleuze 2005: 305) Und weiter: „Man kommuniziert uns Informationen, man sagt uns, was zu glauben wir imstande oder verpflichtet oder gehalten sind. Man verlangt nicht, dass wir glauben, sondern dass wir uns so verhalten, als glaubten wir.“ (ebd.)
27
Kontrolle, so Deleuze, zielt auf das sichtbare Verhalten ab, und nicht auf den Glauben, die Überzeugungen oder auf die ›Seele‹ des Subjekts. Das wäre ein weiterer Unterscheidungspunkt zur Disziplin, deren Ziel Foucault be-kanntlich bestimmt hat in der Verinnerlichung eines Befehls, in der Verinner-lichung einer Norm. In der Disziplin, so Foucault, wird die Seele zum Ge-fängnis des Körpers (Foucault 1994: 42). Aber damit hat es nun ein Ende, sagt Deleuze und gebraucht in diesem Vortrag zum ersten Mal den Begriff der „Kontrollgesellschaften“ (Deleuze 2005: 306), der sociétés de contrôle, in denen die Einschließungsmilieus nicht mehr benötigt würden, in der sie auf-gelöst werden. Einschränkend fügt Deleuze hinzu, dass sich diese Entwickung in der Gegenwart noch nicht vollständig durchgesetzt habe, dass Reste der Disziplin womöglich noch für Jahre weiterbestehen, dass man aber voraussichtlich in ›vierzig, fünfzig Jahren‹ endgültig in der neuen Gesell-schaft angekommen sei.
Den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Diagramm der Macht erläutert Deleuze anhand eines überraschenden Beispiels: der Auto-bahn. Eine Autobahn schließt niemanden ein, aber wer eine Autobahn baue, vervielfache die Möglichkeiten und Instrumente der Kontrolle, sagt Deleuze. – Wie ist dieses Beispielzu verstehen? Als erstes fällt auf, dass Deleuze schon wieder das Medium gewechselt hat: Es geht ihm weder um Kommunikation noch um Information, sondern um Zirkulation. Es geht also darum, etwas in Bewegung und am Laufen zu halten. Es geht um die Beherrschung und die Kontrolle einer Geschwindigkeit. Nach dem französischen Philosophen Paul Virilio allerdings führt die Erhöhung der Geschwindigkeit zu einem „rasen-den Stillstand“, der der absoluten Unbeweglichkeit gleichkommt (Virilio 1992). Durch den Sicherheitsgurt fixiert, sitzt man stundenlang hinter dem Lenkrad und sieht dabei zu, wie links und rechts die immergleiche Land-schaft vorbei rauscht, während man immer noch nicht angekommen ist. Um diesen Zustand zu verlassen, muss der Fahrer erst die nächste Ausfahrt oder den nächsten Parkplatz erreichen, vorher hat er keine andere Wahl, als wei-terhin aufs Gas zu drücken und unterdessen keinen Unfall zu riskieren.
So beschrieben, lässt sich allerdings auch eine Autobahn als ein ›Milieu der Einschließung‹ verstehen, als etwas, das unter Androhung sofortiger Sanktion, das heißt körperlichem oder wenigstens Blech-Schaden, klare Re-geln aufsetzt und strikte Disziplin von seinen Insassen einfordert. Jeder hat das Recht, den Fuß aufs Pedal zu stellen, aber niemand hat die Freiheit, auf einer Autobahn zu wenden. Diese Sichtweise kann man eine schwache Vari-ante von Kontrolle nennen: Kontrolle ist, wenn Subjekte in einer Bewegung eingeschlossen werden, wenn sie zur Zirkulation, zur Kreisbewegung ver-dammt sind. Es gibt darüber hinaus aber noch einen zweiten Aspekt, der an diesem Beispiel zu berücksichtigen ist, nämlich die zunehmende Informatisierung der Mobilität. Bei den Stichworten autoroute und contrôle
28
denken Deleuze und seine Zuhörer nicht nur an das Befahren einer Schnell-straße, sondern auch daran, dass man dafür bezahlen muss. Bekanntlich hat Frankreich ein flächendeckend ausgebautes Mautsystem. Auch das ist eine Form von Kontrolle im Sinne von Deleuze, insofern sie einen Befehl an uns richtet, der nicht unseren Glauben, sondern lediglich die Anpassung unseres Verhaltens von uns verlangt, wobei es von unserem konformen Verhalten abhängig ist, ob wir Zutritt zu einem überwachten Raum erhalten. Und be-kanntlich ist heute diese Art von Informatisierung der Mobilität schon we-sentlich weiter geschritten, als es 1987 noch der Fall war: Man denke nur an die automatische Mauterfassung, die ja auch hierzulande eingeführt wurde, an Nummernschilderkennung, an GPS-Systeme, an Navigationsgeräte, usw. All das bildet ein Ensemble von Information, Kommunikation und Zirkulati-on, den man als eine starke Variante von Kontrolle erkennen kann.
Kontrolle und Werden
Nächster und vorletzter Beitrag von Deleuze zum Thema der Kontrolle. Im Frühjahr 1990 wird in der Zeitschrift Futur antérieur unter dem Titel Kon-trolle und Werden ein Interview von Antonio Negri mit Deleuze veröffent-licht. Hierin führt Deleuze seine scharfe, vielleicht übermäßig pointierte Kri-tik an der Informationsgesellschaft weiter. Die Situation ist folgende: Negri gibt sich optimistisch. Vielleicht ist gar nicht alles schlecht an den neuen Techniken und Technologien der Kommunikation und Information. Viel-leicht lässt sich mit ihrer Hilfe die Marx„sche Utopie des Kommunismus verwirklichen, eine „freie Assoziierung freier Individuen“ zu bilden, so Neg-ri. Doch Deleuze wehrt ab: Kommunikation ist schrecklich, die Kontrollge-sellschaft funktioniert „durch unablässige Kontrolle und unmittelbare Kom-munikation“ (Deleuze 1993c: 250). Die Unterschiede zwischen Arbeit und Schule seien aufgehoben, in der Kontrollgesellschaft erwarte uns eine „schreckliche permanente Fortbildung“ (ebd.: 251), so Deleuze. Die Kont-rollgesellschaft ist etwas, mit dem das Subjekt nie abschließen kann.
Deleuze ist hier mehr als skeptisch gegenüber Hoffnungen, dass die Un-terdrückten und die Minoritäten nur ›das Wort ergreifen‹ müssten, um sich zu befreien. Vielleicht sind Wort und Kommunikation verdorben, weil sie völlig und ihrem Wesen nach vom Geld durchdrungen sind, mutmaßt der Philosoph und schlägt statt dessen vor, „störende Unterbrechungen“, „Zwischenräume der Nicht-Kommunikation“ zu schaffen, um der Kontrolle nicht zu widerste-hen, aber um ihr zumindest zu entgehen (ebd.: 252). Welche konkreten Formen emanzipativer, widerständiger oder evasiver Prak-tiken Deleuze dabei im Blick hat, lässt er unausgeführt.
29
Postskriptum über die Kontrollgesellschaften
An dieser Stelle kann man zurückblicken. In welchen Texten hat Deleuze über die Kontrollgesellschaft geschrieben? In einer Rezension, in einem Brief oder Vorwort, in einem Interview, in einem mündlichen Vortrag. Was folgt darauf? Ein Postskriptum. Das Schreiben nach dem Schreiben. Die kleine Form. Das Angehängte. Es ist auffällig, wie sehr Deleuze es einerseits ver-meidet, sich ausführlich auf die Frage nach der Postdisziplin zu äußern, und wie ihn diese Frage andererseits über Jahre hinweg beschäftigt. Im Postskrip-tum fasst er noch einmal all seine Überlegungen zusammen, um ein Fazit zu ziehen.
Deleuze skizziert Geschichte, Logik und Programm der Kontroll-gesellschaften. Die Funktionsweise der Disziplinierungen beschreibt er in Worten, die gänzlich ohne Verweis auf Panoptismus, ohne Verweis auf Ver-hältnisse des Sehens und Gesehenwerdens auskommen. Das „ideale Projekt der Einschließungsmilieus“ operiert als Verhältnis von Kräften, die sich wie folgt äußern: „konzentrieren; im Raum verteilen; in der Zeit anordnen; im Zeit-Raum eine Produktivkraft zusammensetzen, deren Wirkung größer sein muss als die Summe der Einzelkräfte“ (Deleuze 1993a: 254).
Die Disziplin ist wie eine Fabrik, sie setzt auf die Steigerung der Produk-tivkraft. Die Kontrolle hingegen ist wie ein Unternehmen, in ihr dreht sich al-les darum, Produkte in Umlauf zu bringen, es zirkulieren zu lassen. Deleuze stellt Elemente und Merkmale beider Regimes paarweise gegenüber: die Fab-rik gegen das Unternehmen, das Gleichgewicht gegen die Meta-Stabilität, die Schule gegen die permanente Weiterbildung, den scheinbaren Freispruch ge-gen den unbegrenzten Aufschub, die Signatur gegen die Chiffre, Masse und Individuum gegen Stichproben und Datenbanken, den Goldstandard gegen die schwankenden Wechselkurse, den Maulwurf gegen die Schlange, die al-ten Sportarten gegen das Surfen, die energetische Maschinen gegen die In-formationsmaschinen, die Gussformen gegen Modulation. Deleuze vergleicht das Wirken der Disziplin mit einer Gussform, in die das Subjekt gepresst werde, dessen Form damit ein für allemal definiert worden sei. In der Kont-rollgesellschaft hingegen werde das Subjekt einer permanenten Modulation unterworfen.
Kontrolle: Das Ende des Enden-Könnens und die Aufhebung der Grenzen der Grenzen.
Zwar ist zutreffend, dass für Deleuze das Aufkommen der Kontroll-gesellschaft mit einer ›Krise der Einschließungsmilieus‹ einhergeht. Es ist je-doch unzulässig, das eine auf das andere zu reduzieren. Die krisenhafte Auf-lösung der alten disziplinarischen Institutionen (Gefängnis, Hospital, Schule, Fabrik usw.), die Deleuze zu Recht als Signum unserer Gegenwart konsta-tiert, ist nicht das Prinzip der kontrollierenden Macht, die damit nur ex
30
negativo und also unterbestimmt wäre. Wir verlassen die Disziplin, aber wo-rin treten wir ein? Worin bestehen die Techniken der Kontrolle? Die theoreti-sche Soziologie gibt folgende Antwort: „Kontrolltechniken entsprechen […] dem Kalkül (neo-)liberaler Gouvernementalität, insofern sie von direkten Anweisungen Abstand nehmen und stattdessen zu einer bestimmten Aktivität durch die Gestaltung situativer oder virtueller Kontexte anreizen. Man be-treibt ein indirektes Management von Gelegenheitstrukturen“ (Opitz 2007: 53). Kontrolle soll also im Modus der Indirekten, des Umwegs wirksam wer-den. Einer solchen Deutung steht jedoch entgegen, dass der Einsatz der Frei-heit von Deleuze an keiner Stelle als exklusives Spezifikum der Kontrolle genannt wird. Im Gegenteil sagt er ausdrücklich, dass sich in jedem Regime „Befreiungen und Unterwerfungen einander gegenüberstehen“ (Deleuze 1993: 255), wenn auch in jeweils verschiedener Weise und unter verschiede-nen Bedingungen. Der Begriff der ›Freiheit‹ spielt im Postskriptum keinerlei systematische Rolle, ebensowenig wie der des ›Regierens‹. Die Kontrollge-sellschaft kennt weder Spielräume noch Auszeiten.
Schließlich ist die Kontrollgesellschaft nicht das ›Ende‹ von irgend et-was, sondern genauer das Ende des Enden-Könnens. „In den Disziplinar-gesellschaften hörte man nie auf anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der Kaserne in die Fabrik), während man in den Kontrollgesellschaften nie mit irgend etwas fertig wird“ (Deleuze 1993a: 257). Nicht durch „Locke-rung“ oder „Befreiung“ zeichnen sich die Techniken der Kontrolle aus, son-dern dadurch, dass sie „permanent“, „in kontinuierlicher Variation“ und als „unbegrenzter Aufschub“ operieren (ebd.). Das Ende wird aufgeschoben, es wird endlos hinausgezögert. Betrachtet man die Kontrolltechniken von dieser Funktion des ›Un-Endlichen‹ her, werden sie der Logik der Prävention vergleichbarwie es beispielsweise an den Imperativen medizinischer Gesund-heitsvorsorge erkennbar wird wird (Ullrich 2009). Sich der Logik der Gesundheitsvorsorge zu unterwerfen heißt anzuerkennen, dass man niemals wissen kann, ob ›genug‹ getan worden ist. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem ›genügend‹ oder ›das Richtige‹ getan wurde, um etwa endgültig einem Herz-infarkt vorzubeugen. Solch ein Beweis kann stets nur negativ geführt werden: Erleidet man einen Anfall, wurde nicht genügend, oder nicht auf die richtige Weise, Prävention betrieben. Zugleich unterwirft sich das präventive Subjekt einem endgültigen Urteil: Ein Herzinfarkt kann eintreten. Man akzeptiert die Möglichkeit als real und beginnt, seine Handlungen entsprechend zu kontrol-lieren und jede seiner Tätigkeiten daraufhin zu überprüfen, ob sie das Risiko eines Infarkts verstärkt oder abschwächt.
Mit der Logik der Prävention und dem Ende des Beenden-Könnens ist nur ein Aspekt der Techniken der Kontrolle benannt. Wesentlich für die Ope-rationen der Kontrolle ist darüber hinaus, dass sie auf ›kontinuierlicher Varia-tion‹ und also auf Modulation beruhen. Modulation ist eine Operation, die
31
beide Seiten umfasst: die ›handelnde‹ und die ›erleidende‹ (die damit streng genommen so nicht mehr bezeichnet werden können). Eine Modula-tion ist eine Veränderung, in der die Parameter der Veränderung selbst veränderlich werden. Deleuze beschreibt sie als eine Art „sich selbst verfor-mende[r] Gussform, die sich von einem Moment zum anderen verändert“, die sich selbst deformiert (Deleuze 1993a: 256). Setzten die ›Gussformen‹ der Diszip-lin dem Subjekt noch absolute Grenzen, durch die es geformt wurde, so be-wirkt der Eintritt in die Kontrollgesellschaft nicht etwa einfach deren ›Auf-hebung‹, sondern genauer die Aufhebung der Grenzen der Grenzen, mithin eine Freisetzung der Grenzen, die nicht abgeschafft, sondern unendlich varia-bel werden. Mit anderen Worten: Nicht (nur) das ›Subjekt‹, sondern die Techniken der Kontrolle werden ›freigesetzt‹. Denn die unend-liche Variabi-lität betrifft, darin besteht der Clou der Modulation, immer deren beiden Sei-ten oder Aspekte, das „Modulierende“ und das „Modulierte“.
Nehmen wir die Videoüberwachung. Gewiss können Videokameras als Bestandteil einer ›Krise der Einschließungsmilieus‹ verstanden werden. Nicht nur im Gefängnis, in allen Institutionen - in Schulen und Fabriken ebenso wie in Krankenhäusern - sind heute Kamerasysteme im Einsatz, die dazu bei-tragen sollen, die ›Krisen‹ dieser Institutionen zu bewältigen. Videokameras kontrollieren zudem einen Großteil des so genannten öffentlichen Raums, sie erlauben also die Überwachung von Subjekten, die in ihrer Bewegung frei sind. Damit aber ist ihre Logik bei weitem nicht hinreichend erfasst. Video-überwachung wird darüber hinaus Teil einer umfassenden Modulation, inso-fern sie nicht nur das Verhalten der Subjekte möglicherweise verändert, son-dern ebenso ihre eigenen Funktionen und Parameter einer permanenten Ver-änderung unterwirft. Das lässt sich zum einen in der Erkenntnis zusammen-fassen, dass es ›die‹ Videoüberwachung überhaupt nicht gibt, sondern nur immer neue Funktionen, andere Organisationsformen, andere Technologien, andere rechtliche Kontexte. Videoüberwachung ist ständig dabei, sich zu entgrenzen, und zwar mindestens in territorialer, in zeitlicher, in funktionaler und in organisatorischer Hinsicht (Kammerer 2008: 64-67). Zum anderen wird Überwachung selbst entgrenzt, sie verbindet sich mit anderen Netzwer-ken und Strömen visueller Kultur. Überwachungsbilder finden Eingang in Spielfilme, in die Werbung, ins Fernsehen und in die Bildende Kunst. Digita-le Kameras in privaten Mobiltelefonen zeichnen Ereignisse auf, die von den staatlichen Sicherheitsbehörden verwendet werden. Zugleich wird in Prakti-ken der ›Counter-surveillance‹ die Polizei selbst unter Beobachtung gestellt, in der Hoffnung, in Fällen von Polizei-gewalt oder Amtsmissbrauch Beweise zur Hand zu haben. Solche Bilder können jedoch ebenso gegen die eingesetzt werden, die sie produziert haben, wenn die Polizei die Aufnahmen von Pro-testen beschlagnahmt und auswertet, um mit ihrer Hilfe Demonstrierende zu
32
identifizieren. Die Modulationen der Kontrolle sind endlos, und sie betreffen alle Positionen.
Literatur
Bogard, William (2006): Wecome to the Society of Control. The Simulation of
Surveillance Revisited. In Kevin D. Haggerty & Richard V. Ericson (Hg.): The
new politics of surveillance and visibility. Toronto: Univ. of Toronto Press.
Deleuze, Gilles (1977): Ein neuer Kartograph. In Gilles Deleuze & Michel Fou-
cault: Der Faden ist gerissen. Berlin: Merve.
Deleuze, Gilles (1993): Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. In ders. Un-
terhandlungen 1972-1990. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (1993a)
Deleuze, Gilles (1993): Brief an Serge Daney. Optimismus, Pessimismus und
Reisen. In ders.: Unterhandlungen 1972-1990, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
(1993b)
Deleuze, Gilles (1993): Kontrolle und Werden. In ders. Unterhandlungen 1972-
1990. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (1993c)
Deleuze, Gilles (1998): Optimisme, pessimisme et voyage: Lettre à Serge Daney.
In Serge Daney, Ciné journal 1 (1981-1982). Paris: Cahiers du cinéma, S. 9-
25.
Deleuze, Gilles (2005): Was ist der Schöpfungsakt? In ders. Schizophrenie und
Gesellschaft. Texte und Gespräche von 1975 bis 1995. Frankfurt am Main:
Suhrkamp.
Foucault, Michel (1994): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Foucault, Michel (2003): Die Disziplinargesellschaft in der Krise (Interview vom
18. April 1978). In ders. Schriften, Bd. 3. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Galloway, Alexander (2004): Protocol. How Control Exists after Decentraliza-
tion. Cambridge: MIT Press.
Kammerer, Dietmar (2008): Bilder der Überwachung. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp.
Krasmann, Susanne (2002): Videoüberwachung in neoliberalen Kontrollgesell-
schaften, oder: ›Smile, you are on camera‹. In Widersprüche. Zeitschrift für so-
zialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 22 (86), S.
53-68.
Krasmann, Susanne (2004): Monitoring. In Ulrich Bröckling & Susanne
Krasmann & Thomas Lemke (Hg.): Glossar der Gegenwart. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
Laute, Wilmar (1969): Control. Die Entstehung und Entwicklung der Wortfamilie
mit Ausblicken auf Parallelentwicklungen im Deutschen und Französischen.
Bonn: Universitätsverlag.
Legnaro, Aldo (2003): Präludium über die Kontrollgesellschaften. In Kriminolo-
gisches Journal 35 (4), S. 296-301.
33
Lindenberg, Michael; Schmidt-Semisch, Henning (1995): Sanktionsverzicht statt
Herrschaftsverlust. Vom Übergang in die Kontrollgesellschaft. In Kriminologi-
sches Journal 27 (1), S. 2-17.
Lyon, David (2006): Theorizing surveillance. The Panopticon and Beyond. Cul-
lompton: Willan Publishing.
Marinis, Pablo de (2000): Überwachen und Ausschließen. Machtinterventionen in
urbanen Räumen der Kontrollgesellschaft. Pfaffenweiler: Centaurus VG (Rei-
he Beiträge zur rechtssoziologischen Forschung, Bd. 13).
Opitz, Sven (2007): Eine Topologie des Außen. Foucault als Theoretiker der In-
klusion/Exklusion. In Roland Anhorn & Frank Bettinger & Johannes Stehr
(Hg.): Foucaults Machtanalytik und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Verlag für So-
zialwissenschaften.
Prömmel, Erdmann (2002): Kontrolle statt Disziplinierung oder Kontrolle durch
Disziplinierung? Überlegungen zum Verhältnis von Kontrollgesellschaft und
sozialer Disziplinierung. In Kriminologisches Journal 34 (4), 242-256.
Robnik, Drehli (2006): „Kino und Kontrolle: Fernsehen, Nahfühlen, Nachtragen“.
In Silver Magazin 8 (Juli 2006), S. 10-11.
Ullrich, Peter (2009): Überwachung und Prävention, oder: Das Ende der Kritik. In
Leipziger Kamera (Hg.): Kontrollverluste. Interventionen gegen Überwachung.
Münster: Unrast.
Virilio, Paul (1992): Rasender Stillstand. München & Wien: Hanser.
Walters, William (2006): Border/Control. In European Journal of Social Theory 9
(2), S. 187-203.