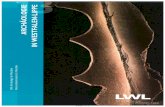Warum 'nicht bleiben' nicht 'werden' ist: Ein Plädoyer gegen die Dualität von 'werden' und...
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Warum 'nicht bleiben' nicht 'werden' ist: Ein Plädoyer gegen die Dualität von 'werden' und...
Linguistische Berichte 215/2008 © Helmut Buske Verlag, Hamburg
Semantik
Warum nicht bleiben nicht werden ist:
Ein Plädoyer gegen die Dualität von
werden und bleiben*
Barbara Schlücker
Abstract
This paper addresses the question whether the German copular verbs bleiben (‚remain‘) and
werden (‚become‘) can be adequately described in terms of duality, as proposed by Löbner
(1990). It is argued that bleiben and werden contrary to Löbner’s proposal are not duals, on the
basis of two main arguments: First, apparently equivalent copular constructions with bleiben
and werden do not refer to the same sort of situations, i.e. states or events. Second, bleiben
possesses a meaning element that werden does not, namely a contrasting alternative. Apart
from these main claims which concern bleiben- and werden-constructions in general, two
more constructions are discussed, comparative structures as well as constructions with the past
participle. The paper also discusses the consequences of the claim that werden and bleiben are
not duals for the semantic description of these verbs. This is especially important for bleiben
which has often been described in the literature so far by taking the duality relation as a basis.
1 Einleitung
Der traditionelle, aus der Logik stammende Begriff der Dualität (beispielsweise Barwise & Cooper 1981) wurde maßgeblich von Löbner (1987, 1989, 1990) geprägt und bezeichnet eine Äquivalenzbeziehung zwischen zwei Ausdrücken, die durch zweifache Negation entsteht. In der Literatur ist die Diskussion des Dualitätsbegriffs eng mit der Analyse der (deutschen) Phasenpartikeln schon und noch verbunden. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem Löbners 1989er
* Für wertvolle Hinweise danke ich dem Publikum der Konferenz Sinn und Bedeutung 2005 in
Berlin. Mein besonderer Dank gilt Ewald Lang, Claudia Maienborn sowie zwei anonymen Gut-achtern.
346 Barbara Schlücker
Artikel, der explizit die Dualitätsbeziehungen zwischen schon, erst und noch zum Gegenstand hat. Zuvor sind die semantischen Beziehungen zwischen schon und noch bereits in den Arbeiten von Doherty (1973), Abraham (1977, 1980), König (1977) beschrieben worden, teils in ähnlicher Weise wie bei Löbner. Löbner (1989) beschränkt sich bei der Beschreibung der Dualitätsrelation je-doch nicht auf das Deutsche, sondern beansprucht darüber hinaus auch eine sprachübergreifende Gültigkeit der Dualitätstheorie für die Äquivalente von schon und noch in anderen Sprachen wie für englisch already, still, nieder-ländisch al, nog und französisch déjà, encore (1989:170). Diese Phasenpartikeln werden u.a. in Vandeweghe (1986, 1990, 1992) und van Baar (1992) für das Niederländische, Horn (1970), Hirtle (1977) und Michaelis (1993) für das Eng-lische, Garrido (1992) für das Spanische und in König (1991) und van de Auwe-ra (1998) sprachübergreifend behandelt.
Weniger Beachtung haben in der Literatur jedoch andere duale Paare erfah-ren, die bei Löbner (1990) ebenfalls diskutiert werden, wie beispielsweise manchmal und immer, möglich und notwendig, lassen und zwingen. Dies gilt auch für die Kopulaverben bleiben und werden. Zwar hat bereits Fabricius-Hansen (1975) die semantische Beziehung zwischen bleiben und werden auf vergleichbare Weise beschrieben und ist die Dualitätsbeziehung zwischen blei-
ben und werden – ausgehend von Löbner (1990) – auch Gegenstand eines Arti-kels von Lenz (1996). Bei der Analyse der Semantik von bleiben greifen Steinitz (2000) und Bierwisch (2004) ebenfalls auf die Dualitätsrelation zwischen wer-
den und bleiben zurück. Eine kritische Auseinandersetzung mit der postulierten Dualität von bleiben und werden findet in diesen Arbeiten jedoch nicht statt.
Der vorliegende Aufsatz hat nun die Dualitätsbeziehung zwischen den Ko-pulaverben bleiben und werden explizit zum Gegenstand. Ich argumentiere hier dafür, dass bleiben und werden keine Duale sind. Eine vergleichbare Diskussion hat auch das duale Paar schon und noch erfahren, vgl. van der Auwera (1993), Mittwoch (1993), Löbner (1999). Es wird sich im Folgenden zeigen, dass insbe-sondere zwischen bleiben und noch interessante und für die Analyse relevante Parallelen bestehen. Einige der bei van der Auwera (1993) und Mittwoch (1993) diskutierten Aspekte spielen daher auch für die Diskussion von bleiben und werden eine wichtige Rolle.
Im Folgenden werden zunächst einige Grundannahmen über werden und bleiben sowie die Dualitätshypothese eingeführt (Abschnitte 2 und 3). Daran anschließend werden die Argumente gegen eine Dualitätsrelation zwischen bleiben und werden diskutiert: In Abschnitt 4 wird argumentiert, dass werden und bleiben keine Duale sein können, weil sie – in scheinbar äquivalenten Kon-struktionen – unterschiedlichen Situationsbezug aufweisen. In Abschnitt 5 wird gezeigt, dass bleiben und werden in scheinbar einander entsprechenden Kompa-rationskonstruktionen eine (über den Situationsbezug hinausgehende) unter-schiedliche semantische Interpretation erfahren. Abschnitt 6 hat Konstruktionen mit dem Partizip II zum Thema und zeigt, weshalb die Dualitätshypothese in diesen – scheinbar ähnlich gelagerten – Fällen keine Anwendung finden kann.
Warum nicht bleiben nicht werden ist 347
In Abschnitt 7 wird argumentiert, dass ein wichtiger Bestandteil der Bedeutung von bleiben der Alternativenbezug ist und sich bleiben damit von werden, das über eine solche Bedeutungskomponente nicht verfügt, grundlegend unterschei-det, was wiederum ein Argument gegen eine Dualitätsbeziehung zwischen wer-
den und bleiben darstellt. In Abschnitt 8 schließlich werden problematische Daten zum Situationsbezug aus Abschnitt 4 noch einmal aufgegriffen und disku-tiert; den Schluss bildet eine Diskussion in Abschnitt 9.
2 Werden und bleiben
2.1 Komplementselektion
Werden und bleiben bilden zusammen mit sein die Gruppe der (eigentlichen) Kopulaverben im Deutschen. Als Kopulaverben stellen sie die Verbindung zwi-schen Subjekt und Prädikativ her, wobei werden einen Wechsel in den vom Prädikativ denotierten Zustand bezeichnet, bleiben hingegen das Andauern die-ses Zustands. Im Vergleich zu werden weist bleiben eine weniger restriktive Prädikativ-(Komplement-)selektion auf, vgl. (1), (2). Die Beispiele unter (2) zeigen außerdem, dass werden, anders als bleiben, nicht nur als Kopula fungiert, sondern in Konstruktionen mit Infinitiv und Partizip II auch als Temporal- und Modalhilfsverb sowie als Passivauxiliar auftritt. In der Kopulafunktion von werden hingegen sind Infinitive und Partizipia II nicht zulässig.
(1) a. Peter wird / bleibt hungrig1 b. Peter wird / bleibt Lehrer c. Peter wird / bleibt der Größte d. Peter *wird / bleibt in der Schule e. Peter wird / bleibt größer (als Susi)
(2) a. Peter *wirdKOP / wirdAUX / bleibt stehen b. Die Tür *wirdKOP / wirdAUX / bleibt geöffnet c. Die Anfrage *wirdKOP / *wirdAUX / bleibt unbeantwortet
Die Dualitätsrelation zwischen werden und bleiben wird daher im Folgenden für Konstruktionen mit adjektivischen und substantivischen Prädikativen diskutiert. Dazu gehört insbesondere auch die Frage nach dem Status des Partizip II bei Konstruktionen mit werden und bleiben und den Konsequenzen in Hinblick auf die Dualitätshypothese (siehe Abschnitt 6).
1 Wie Beispiel (1a) zeigt, sind Adjektive bei werden grundsätzlich als Prädikativ zulässig. Aus-
nahmen bilden einzelne Adjektive wie nackt, kostenlos, ursächlich (*Hildegard wurde nackt, *Die
gelben Seiten werden kostenlos etc.). Zur Analyse dieser Beschränkungen siehe Härtl (2005).
348 Barbara Schlücker
2.2 Situationsbezug
Über den Situationsbezug2 der Kopula werden herrscht in der Literatur insofern Übereinstimmung, als dass allgemein angenommen wird, dass werden Zustands-wechsel (d.h. dynamische telische Situationen) denotiert und aus einem Ver-laufs- oder Prozessteil einerseits und einem Resultatszustand andererseits be-steht. In der Regel wird die Bedeutung von werden mit dem intervallbasierten BECOME-Operator bei Dowty (1979: 139ff) bzw. dessen ereignisbasierter Umsetzung bei von Stechow (1996: 96) gleichgesetzt, siehe beispielsweise Musan (1999: 202), Steinitz (1999: 124), Härtl (2005: 355). Kontrovers disku-tiert hingegen wird insbesondere bei Musan (1999) und Steinitz (1999) die Fra-ge, ob werden ausgedehnte und/oder punktuelle Zustandswechsel denotiert (Accomplishments bzw. Achievements) und auf welchen Situationstyp werden + kompariertes Adjektiv referiert.3 Steinitz (1999) nimmt an, dass werden bezüg-lich der drei in Frage kommenden Situationstypen Accomplishment, Achieve-ment und Prozess unterspezifiziert ist. Sie setzt einen unspezifischen Ver-änderungsoperator CHANGE an; die Spezifikation bezüglich Prozesshaftigkeit/ Telizität kommt danach durch das jeweilige Prädikativ zustande. Musan (1999) hingegen weist darauf hin, dass eine Analyse als Accomplishment nicht aus-schließt, dass der Zustandswechsel im Einzelfall auch punktuell sein kann. Sie will den Situationstyp Achievement für solche Verben / VPs4 reservieren, die ausschließlich punktuelle Zustandswechsel denotieren (z.B. finden, ankommen) und analysiert werden daher einheitlich als Accomplishment.
Der Situationsbezug von bleiben hingegen ist in der Literatur weit weniger (kontrovers) diskutiert worden. Übereinstimmend wird angenommen, dass blei-
ben das Andauern eines Zustands denotiert und daher ein Zustandsausdruck ist. Lediglich für die so genannte BECOME-Lesart von bleiben, die an dieser Stelle jedoch keine Rolle spielt, ist ein Ereignisbezug diskutiert worden.5
2 Die Redeweise von Situationen bzw. Situationstypen basiert zum einen auf Davidsons (1967)
Annahme, dass Situationen genau wie Objekte Individuen in der Welt sind, auf die durch sprachliche Ausdrücke referiert werden kann. Von Vendler (1967) wiederum stammt die (seither in der Literatur immer wieder verfeinerte / veränderte) Subkategorisierung von Situationen in die Situationstypen Zustand, Prozess, Accomplishment und Achievement, wobei letztere ausgedehnte bzw. punktuelle Zustandswechsel bezeichnen und oft unter dem Begriff Ereignis zusammengefasst werden. Dabei werden die Begriffe Accomplishment, Achievement etc. in der Literatur üblicherweise nicht nur für die Situationstypen selbst, sondern auch für die Verben/VPs verwendet, die einen solchen Situa-tionsbezug aufweisen.
3 Zum Situationsbezug von werden + kompariertes Adjektiv siehe Abschnitt 5. 4 Auf die Tatsache, dass die Zuweisung der Situationstypen für die meisten Verben (ausgenom-
men Partikel- und Präfixverben) erst auf der VP-Ebene erfolgen kann, weisen unter anderem Dowty (1979: 60ff), Herweg (1990: 42 ff) und Zybatow (2001) hin. Auch Vendler (1967) selbst bezieht sich nicht nur auf Verben, sondern auch auf Verbalphrasen. Insofern sind im Folgenden auch immer VPs mitgemeint, wenn von der Klassifizierung der Verben gesprochen wird.
5 Es ist wiederholt beobachtet worden, dass bleiben neben der bekannten Lesart, in der das An-dauern eines Zustands denotiert wird, auch über eine zweite Lesart verfügt, in der bleiben keinen
Warum nicht bleiben nicht werden ist 349
3 Die Dualitätshypothese (Löbner 1987, 1989, 1990)
Die Relation der Dualität bezeichnet eine Äquivalenzbeziehung zwischen zwei Prädikaten, die auf zweifacher Negation, innerer und äußerer Negation, beruht. Für die Kombination zweier Prädikate ergeben sich durch die beiden Negations-arten vier mögliche Konstellationen: (1) Q ◦ P, (2) Q ◦ (¬ P) [innere oder Sub-negation], (3) (¬Q) ◦ P [äußere Negation] und (4) die Kombination beider Ne-gationsarten, die duale Negation: (¬Q) ◦ (¬P). Dabei steht Q für einen Quantor6 und P für ein quantifiziertes Prädikat. Die Mitglieder einer solchen Dualitäts-gruppe sind durch Negation des Quantors und des Prädikats semantisch aufein-ander bezogen. D.h. durch die Analyse eines der Mitglieder kann die Bedeutung der anderen drei Mitglieder abgeleitet werden: wie das Dualitätsdiagramm in (3) zeigt, ist die Anwendung von zwei verschiedenen Negationsoperationen äquiva-lent zur Anwendung der dritten.
(3)
Das Dualitätsdiagramm unter (4) illustriert diese Relationen für schon und noch. Generell gilt für alle Dualitätsgruppen, dass Typ 1 und Typ 2 immer lexikalisiert sind, Typ 3 nicht durchgehend und Typ 4 nur selten, vgl. die Aufstellung in Löbner (1990: 89). Dies gilt auch für schon / noch. Die Typen 3 und 4 werden hier durch äußere Negation von Typ 1 und 2 abgeleitet. Schon P und noch P können durch duale Negation ineinander überführt werden, schon P kann durch Subnegation in nicht mehr P überführt werden usw., siehe (5).
Zustand, sondern einen Zustandswechsel zu denotieren scheint. Steinitz (2000) hat dafür die Be-griffe REMAIN- bzw. BECOME-Lesart geprägt. Die BECOME-Lesart ist insbesondere bei Kon-struktionen mit infinitem Positionsverb zu finden (vgl. Krämer 2004), wie z.B. Mit quietschenden Reifen
blieb das Auto vor der roten Ampel stehen. In Schlücker (2007) argumentiere ich dafür, dass bleiben auch in diesen Konstruktionen ein Zustandsausdruck ist.
6 Löbner (1990) führt die Dualitätsrelation am Beispiel der klassischen Quantoren ∃ und ∀ ein. Ausdrücke wie schon / noch oder bleiben / werden werden von Löbner als Phasenquantoren be-zeichnet (vgl. Löbner 1990: 88, 118).
Typ 1
Typ 4 Typ 3
Typ 2
Duale Negation
Äußere
Negation
Äußere
Negation Subnegation
[Löbner: 1990, 106]
350 Barbara Schlücker
(4)
(5) a. Es ist schon dunkel ≡ Es ist nicht der Fall, dass es noch hell ist b. Es ist schon dunkel ≡ Es ist nicht mehr hell
In prädikatenlogischer Notation können die Äquivalenzen zwischen schon und noch wie in (6) angegeben werden.
(6) schon P ≡ ¬[noch [¬P]]
Löbner (1990) analysiert nun werden und bleiben ebenfalls als duales Paar. Das Diagramm unter (7) zeigt, dass sie in ihrer Dualitätsgruppe Typ 1 und Typ 2 belegen und dass Typ 3 und 4 auch hier nicht lexikalisiert sind.
(7)
Unter (8) sind die Äquivalenzen für alle vier Typen mit Hilfe der Operatoren BECOME und REMAIN (vgl. Dowty 1979) in prädikatenlogischer Notation repräsentiert und in (9) durch natürlichsprachliche Beispiele illustriert:
(8) Typ 1: [BECOME Px] ≡ [¬[ REMAIN [¬Px]]] Typ 2: [REMAIN Px] ≡ [¬[ BECOME [¬Px]]] Typ 3: [¬[ BECOME Px]] ≡ [REMAIN [¬Px]] Typ 4: [¬[ REMAIN Px]] ≡ [BECOME [¬Px]]
schon P
nicht mehr P noch nicht P
noch P
Duale Negation
Äußere
Negation Äußere
Negation Subnegation
werden P
nicht bleiben P nicht werden P
bleiben P
Duale Negation
Äußere
Negation
Äußere
Negation Subnegation
Warum nicht bleiben nicht werden ist 351
(9) a. Peter wird krank ≡ Peter bleibt nicht gesund b. Peter bleibt krank ≡ Peter wird nicht gesund c. Peter wird nicht krank ≡ Peter bleibt gesund d. Peter bleibt nicht krank ≡ Peter wird gesund
In (9) ist die interne Negation durch lexikalische Antonymie realisiert. Interne Negation kann jedoch auch in Form von un-Präfigierung (bei genuinen Adjek-tiven, Partizipia II und Substantiven) und Komposition mit nicht (bei Adjektiven und Substantiven) vorliegen.
(10) a. Das Problem wird deutlich ≡ Das Problem bleibt nicht undeutlich b. Das Problem wird besprochen7 ≡ Das Problem bleibt nicht unbe-
sprochen c. Für mich wird das keine Möglichkeit ≡ Für mich bleibt das eine
Unmöglichkeit
(11) a. Peter wird Raucher ≡ Peter bleibt nicht Nichtraucher b. Die Beziehung wird amtlich ≡ Die Beziehung bleibt nicht nicht-
amtlich
Die bei Löbner (1990) postulierte Äquivalenzbeziehung zwischen werden und bleiben ist intuitiv nachzuvollziehen und die Beispiele unter (9), (10) und (11) sind unproblematisch. In den folgenden Abschnitten wird jedoch Evidenz dafür geliefert, dass hier nur scheinbar Äquivalenzen vorliegen und dass sich die Be-deutung von bleiben entgegen Löbners Annahme nicht durch zweifache Negati-on in die Bedeutung von werden überführen lässt (und anders herum). Dabei soll es u.a. auch um die Frage gehen, aus welchem Grund werden und bleiben in Konstruktionen wie unter (9), (10) und (11) zunächst als bedeutungsäquivalent erscheinen.
4 Der Situationsbezug von bleiben und werden
Das erste Argument gegen eine Dualitätsbeziehung zwischen bleiben und wer-
den betrifft den Situationsbezug der beiden Kopulaverben. Das Hauptargument ist dabei, dass scheinbar äquivalente bleiben- und werden-Kopulakonstruktionen, wie beispielsweise in (9), auf unterschiedliche Situationstypen referieren und somit nicht bedeutungsäquivalent sind.
Die unter der Dualitätshypothese angenommene Bedeutungsäquivalenz rührt daher, dass sich der Ereignisbezug von werden sowie die Zustandsreferenz von bleiben unter Negation so zu verschieben scheint, dass negiertes werden auf Zu-stände, negiertes bleiben hingegen auf Ereignisse referiert, vgl. (12) und (13). Damit wäre eine der Voraussetzungen für eine Bedeutungsäquivalenz zwischen
7 Zur Konstruktion werden + Partizip II siehe Abschnitt 6.
352 Barbara Schlücker
werden und bleiben durch duale Negation gegeben. Tatsächlich zeigt sich aller-dings, dass zumindest ein identischer Situationsbezug für die Konstruktionen unter (12a) nicht vorliegt.
(12) a. Peter wird krank ≡ Peter bleibt nicht gesund ⇒ EREIGNIS b. Peter bleibt krank ≡ Peter wird nicht gesund ⇒ ZUSTAND
(13)
werden bleiben Ohne Negation Ereignis Zustand Mit Negation Zustand Ereignis
4.1 Temporale Spezifizierung
Für die Zuordnung eines Verbs oder einer Verbalphrase zu einem bestimmten Situationstyp sind in der Literatur verschiedene Diagnostiken bekannt. Zum einen kann die Klassifizierung durch die Spezifizierung mit Temporal-adverbialen überprüft werden (vgl. beispielsweise Herweg 1990). Durativ- oder Zeitdaueradverbiale wie eine Stunde (lang), tagelang können bei atelischen Verben, also bei Zuständen und Prozessen, auftreten. Zeitrahmen- oder Zeit-spannenadverbiale wie in einer Stunde, innerhalb von zwei Tagen hingegen sind nur bei Verben, die einen Zustandswechsel denotieren, also bei Ereignissen (im engeren Sinn) zulässig. Genauso funktioniert die Einbettung in temporale Fra-gekontexte: nur Zustände und Prozesse können in Fragen wie Wie lange …? verwendet werden, und ausschließlich Ereignisse sind in Fragen wie Wie lange
dauerte es bis …? zulässig. Zum anderen kann eine Klassifizierung mit Hilfe von Manner-Adverbien wie schnell und langsam erfolgen (siehe beispielsweise Maienborn 2003: 43): nur Prozesse und Ereignisse, für die alle das Merkmal der Dynamizität gilt, lassen solche Adverbien zu; Zustände hingegen nicht.
Mit Hilfe dieser Diagnostiken soll zunächst der (angenommene) Ereignis-bezug der Konstruktionen in (12a) überprüft werden. Wenn werden und negier-tes bleiben gleichermaßen ein Ereignis denotieren, dann ist erstens zu erwarten, dass ereignisbezogene Modifikatoren, also Zeitrahmen- oder Zeitspannenadver-biale, zulässig sind, zustandsbezogene Modifikatoren wie Zeitdaueradverbiale hingegen nicht. Zweitens sollte die Kombination mit Manner-Adverbien zuläs-sig sein.
(14) und (15) zeigen, dass werden Zeitspannenadverbiale sowie entspre-chende Fragekontexte zulässt, das scheinbar äquivalente nicht bleiben hingegen nicht. Das Manner-Adverb langsam in (16) ist bei werden zulässig, aber nicht bei nicht bleiben. Die Beispiele (14) bis (16) sind daher Evidenz dafür, dass werden Ereignisbezug hat, nicht bleiben hingegen nicht. Umgekehrt zeigt der Test mit Zeitdaueradverbialien bzw. den entsprechenden Fragekontexten in (17) und (18), dass Zustandsmodifikation bei werden nicht, bei negiertem bleiben hingegen sehr wohl möglich ist, was darauf hinweist, dass nicht bleiben, anders
Warum nicht bleiben nicht werden ist 353
als werden, auf Zustände referiert. Für viele Sprecher führt die Zustands-modifikation in (17b) allerdings zu einer markierten Konstruktion. Um dies zu erklären, muss zuvor noch eine andere Eigenschaft von bleiben eingeführt wer-den, wir werden daher in Abschnitt 8 auf diese Frage zurückkommen. Die Bei-spiele (14) bis (18) zeigen deutlich, dass die scheinbar äquivalenten werden- und nicht bleiben-Konstruktionen unterschiedlichen Situationsbezug aufweisen.
(14) a. Peter wurde innerhalb von zwei Stunden krank b. Peter blieb *innerhalb von zwei Stunden nicht gesund
(15) a. Wie lange dauerte es bis Peter gesund wurde? b. * Wie lange dauerte es bis Peter nicht gesund blieb?
(16) a. Peter wurde langsam krank b. Peter blieb *langsam nicht gesund
(17) a. Peter wurde *zwei Tage lang krank b. Peter blieb ?zwei Tage lang nicht gesund
(18) a. * Wie lange wurde Peter krank? b ? Wie lange blieb Peter nicht gesund?8
Mit Hilfe der Beispiele (19) bis (23) lässt sich nun umgekehrt die (angenomme-ne) Zustandsreferenz der Konstruktionen unter (12b) überprüfen. Hier zeigt sich ein etwas anderes Bild: die Zeitspannenadverbiale bzw. der entsprechende Fra-gekontext in (19) und (20) sind sowohl bei der bleiben- als auch bei der nicht
werden-Konstruktion unzulässig, genauso wie das ereignisbezogene langsam in (21). Beide Konstruktionen erlauben hingegen die Spezifizierung durch das Zeitdaueradverbial bzw. das Auftreten im entsprechenden Fragekontext, siehe (22) und (23). Diese Tests bestätigen also die Annahme, dass sowohl bleiben als auch nicht werden keine Ereignis-, sondern Zustandsreferenz aufweisen.
(19) a. Peter blieb *innerhalb von zwei Stunden krank b. Peter wurde *innerhalb von zwei Stunden nicht gesund
(20) a. * Wie lange dauerte es bis Peter gesund blieb? b. * Wie lange dauerte es bis Peter nicht gesund wurde?
(21) a. Peter blieb *langsam krank b. Peter wurde *langsam nicht gesund
(22) a. Peter blieb zwei Tage lang krank b. Peter wurde zwei Tage lang nicht gesund
(23) a. Wie lange blieb Peter krank? b. Wie lange wurde Peter nicht gesund?
8 Nicht darf hier nicht als Subnegation, also mit Skopus über gesund interpretiert werden.
354 Barbara Schlücker
Der entscheidende Befund an dieser Stelle lautet also, dass negiertes bleiben entgegen der Vorhersage durch die Dualitätshypothese keinen Ereignisbezug aufweist. Negiertes bleiben und werden sind diesbezüglich nicht äquivalent. Offensichtlich ändert sich der Situationsbezug von werden unter Negation, nicht jedoch der von bleiben: negiertes wie nichtnegiertes bleiben referiert auf Zu-stände, vgl. (24):
(24)
werden bleiben Ohne Negation Ereignis Zustand Mit Negation Zustand Zustand
Die unter Beispiel (8) (Typ 1) aufgeführte Äquivalenz zwischen werden P und ¬bleiben ¬P gilt also nicht, insofern lässt sich also die Bedeutung von werden nicht durch duale Negation in die von bleiben überführen. Bleiben P und ¬wer-
den ¬P (Typ 2) hingegen weisen zwar identischen Situationsbezug auf, denn beide referieren auf Zustände. Die nächsten Abschnitte liefern jedoch noch wei-tere Argumente, weshalb auch diese Ausdrücke nicht dual zueinander sind.
4.2 Interne Ereignisstruktur
Bleiben und werden weisen also, auch in scheinbar semantisch äquivalenten Konstruktionen, unterschiedlichen Situationsbezug auf. Dies lässt Rückschlüsse auf die internen Ereignisstrukturen dieser Verben zu, die einander offensichtlich weniger entsprechen, als dies für eine Dualitätsbeziehung erforderlich wäre. Ausschlaggebend ist hierbei insbesondere die Assertion: werden assertiert einen Zustandswechsel und präsupponiert einen Vorzustand, der konträr zu dem vom Prädikativ bezeichneten Ziel- oder Resultatszustand ist. Werden hat damit eine dreigliedrige Ereignisstruktur: Vorzustand (ausgedehnter oder punktueller), Zustandswechsel, Nachzustand. Bleiben assertiert einen Zustand und präsup-poniert einen identischen Vorzustand. Die interne Ereignisstruktur von bleiben ist also zweigliedrig und besteht (terminologisch in Analogie zu werden) aus Vorzustand und Nachzustand. Ein Zustandswechselintervall hingegen fehlt und kann auch unter Negation nicht entstehen: dies erklärt, weshalb bleiben nie Ereignisbezug hat und ereignisbezogene Modifikatoren unzulässig sind, auch wenn ¬bleiben ¬P äquivalent zu werden P zu sein und ein Ereignis zu deno-tieren scheint.
Von zentraler Bedeutung ist nun das Zusammenspiel von Ereignisstruktur und Negation. Negierte Zustands- und Ereignisausdrücke unterscheiden sich dahingehend, dass die Negation eines Zustandsausdrucks einen konträren Zu-stand ergibt, wohingegen aus der Negation eines Ereignisses kein konträres Ereignis folgt. D.h. negierte Ereignisausdrücke denotieren nicht das Stattfinden eines negativen Ereignisses, sondern drücken das Nicht-Stattfinden des Ereig-nisses aus.
Warum nicht bleiben nicht werden ist 355
Bei der Negation von werden wird also das Ausbleiben des Zustandswechsels behauptet, die Präsupposition des Vorzustands hingegen bleibt erhalten. D.h. wenn werden P einen Zustandswechsel von ¬P zu P assertiert und einen Vorzu-stand ¬P präsupponiert, dann bedeutet nicht werden P das Ausbleiben des Zu-standswechsels zu P. Damit gilt weiterhin der Vorzustand ¬ P.9 Dies erklärt, weshalb sich der Situationsbezug von werden unter Negation ändert, so wie es die Daten unter (19) bis (23) gezeigt haben. Die Änderung des Situationsbezugs ermöglicht das Auftreten von Zeitdaueradverbialen wie in (22b), die grundsätz-lich nur atelische Verben spezifizieren können. Zwei Tage lang nicht gesund
werden bedeutet also, dass für eine Dauer von zwei Tagen kein Zustandswechsel stattfindet und daher zwei Tage lang der Vorzustand ¬P gilt.
Da bleiben ein Zustandsausdruck ist, hat die Negation hier andere Auswir-kungen: Wenn bleiben P das Vorliegen eines Zustands P assertiert und einen direkt vorangehenden identischen Vorzustand P präsupponiert, dann bedeutet nicht bleiben P das Nichtvorliegen von P und damit das Ausbleiben des Andau-erns von P. Die Negation des Zustands P ergibt wiederum einen Zustand, ¬P. Anders als bei werden ändert sich der Situationsbezug von bleiben unter Nega-tion nicht, sodass ereignisbezogene Modifikatoren bei negiertem bleiben unzu-lässig sind, siehe (14)–(16). Die Zustandsmodifikation durch das Zeit-daueradverbial zwei Tage lang wie in (17b) hingegen ist nicht ungrammatisch: es ist nicht der Fall, dass Peter (weiterhin) gesund ist, und dieser Zustand gilt zwei Tage lang. Dennoch wird das Auftreten eines solchen Zeitdaueradverbials von vielen Sprechern als markiert befunden. Wie bereits gesagt, soll jedoch, um diesen Befund zu erklären, zunächst eine andere Eigenschaft von bleiben einge-führt werden, sodass wir in Abschnitt 8 darauf zurückkommen werden.
Es soll hier außerdem auf eine erste Parallele zwischen bleiben und der Pha-senpartikel noch verwiesen werden: In seiner temporalen Verwendung assertiert noch ebenso wie bleiben das Vorliegen eines Zustands und präsupponiert einen unmittelbar vorangehenden Zustand. Insofern sind die bleiben- und die noch sein-Beispiele in (25) identisch: beide denotieren einen Zustand des Krankseins von Peter, unmittelbar vorangegangen von einem (weiteren) Zustand des Krank-seins.10
(25) a. Peter bleibt krank b. Peter ist noch krank
Auch Mittwoch (1993: 80) weist auf diese Übereinstimmung: „It may be noted that the presuppositional component of still is like that of the aspectual verbs continue, stop, remain (…). All of these presuppose that an associated situation obtained prior to evaluation time.“
9 Siehe beispielsweise Bierwisch (2004, 2005). 10 Zum Bedeutungsunterschied zwischen (25a) und (b) siehe Abschnitt 7.
356 Barbara Schlücker
Die unterschiedliche interne Ereignisstruktur von bleiben und werden erklärt also den unterschiedlichen Situationsbezug und stellt damit ein massives Pro-blem für die Annahme einer Dualitätsbeziehung zwischen werden und bleiben dar.
5 Komparierte Adjektive
Sowohl Kopulakonstruktionen mit bleiben als auch mit werden selegieren kom-parierte Adjektive als Prädikativ, siehe (1e) und (26).
(26) Peter wird / bleibt dicker (als sein Vater)
Auch für werden- und nicht bleiben-Konstruktionen mit kompariertem Adjektiv gilt, dass sie aufgrund des unterschiedlichen Situationsbezugs nicht äquivalent zueinander sind. Neben diesem Bedeutungsunterschied weisen werden und negiertes bleiben mit kompariertem Adjektiv allerdings noch einen weiteren Bedeutungsunterschied auf. Damit stellen diese Konstruktionen ein weiteres Argument gegen die Dualitätsbeziehung zwischen werden und nicht bleiben dar. Bei Konstruktionen mit dem Positiv eines relativen Adjektivs wird eine be-stimmte Norm bezeichnet (z.B. alt – für eine/n Katze / Stadt / Mensch). Werden + relatives Adjektiv im Positiv nimmt daher diesen festen Normwert als Ver-gleich, vgl. (27).
(27) Mäuschen wird alt
Bei Konstruktionen mit dem Komparativ hingegen findet kein Vergleich mit einem kontextuell induzierten Normwert, sondern mit einem beliebigen Ver-gleichswert statt (z.B. Peters Schwester). Durch die freie Wählbarkeit des Ver-gleichswerts ist auch der bezeichnete Wert normunabhängig (größer als Peters
Schwester), vgl. (28).
(28) Peter wird größer als seine Schwester
Bleiben + kompariertes Adjektiv mit einer Vergleichsphrase wie (29) bezeichnet ebenfalls einen Wert, der abhängig vom Vergleichswert ist, und denotiert dabei das (Nicht-)Andauern eines Zustands.
(29) a. Peter bleibt größer als seine Schwester b. Peter bleibt nicht größer als seine Schwester
Abgesehen vom unterschiedlichen Situationsbezug von werden und nicht blei-
ben erfahren diese Komparationskonstruktionen also eine vergleichbare Inter-pretation, nämlich den Vergleich mit einem externen Wert und daraus resultie-rend die Zuweisung eines von diesem Wert abhängigen, normunabhängigen Werts für den Subjektreferenten.
Dies gilt jedoch nicht für Komparationskonstruktionen ohne Vergleichs-phrase. Werden-Konstruktionen mit kompariertem Adjektiv ohne Komplement
Warum nicht bleiben nicht werden ist 357
wie (30) werden elliptisch interpretiert. In der Regel wird dabei jedoch nicht mit einem externen Wert verglichen, so wie bei den Konstruktionen mit Vergleichs-phrase wie in (28), sondern mit dem gleichen Wert zu einem früheren Zeitpunkt. (30) wird demnach interpretiert als Peter wird größer als er vorher war, vgl. beispielsweise von Stechow (1984), Bierwisch (1987), Musan (1999),11 es sei denn, der Kontext erzwingt eine Interpretation als Vergleich mit einem externen Wert.
(30) Peter wird größer
Bei komplementlosen bleiben-Konstruktionen wie (31) ist jedoch eine Interpre-tation, bei der, wie bei werden, mit dem gleichen Wert zu einem früheren Zeit-punkt verglichen wird, nicht möglich. Die einzig mögliche Interpretation besteht hier im Vergleich mit einem elliptischen, durch den Kontext erschließbaren externen Wert, also identisch mit den Beispielen unter (29).
(31) a. Peter bleibt größer b. Peter bleibt nicht größer
Werden-Konstruktionen mit einem explizit genannten Vergleichswert bezeich-nen einen Zustandswechsel in einen vom externen Vergleichswert abhängigen Resultatszustand. Werden ist hier Accomplishment. In Konstruktionen ohne Komplement denotiert werden hingegen einen Prozess (Steinitz 1999: 133ff) bzw. ein Accomplishment, das durch iterative Umdeutung Prozesscharakter erhält (Musan 1999: 205ff). In beiden Fällen haben wir es mit einer Ereignis-denotation im weiteren Sinne (Prozess bzw. Zustandswechsel) zu tun.
Weil aber bleiben-Konstruktionen immer als Vergleich mit einem ellip-tischen, durch den Kontext erschließbaren externen Wert interpretiert werden, kann es keine Konstruktion mit bleiben geben, die der komplementlosen wer-
den-Konstruktion mit Prozesscharakter in (30) entspricht, bei der mit dem-selben Wert zu einem früheren Zeitpunkt verglichen wird: nicht kleiner bleiben kann niemals als Vergleich mit demselben Wert zu einem früheren Zeitpunkt, sondern immer nur elliptisch interpretiert werden, vgl. (33). Die Dualitäts-hypothese scheitert also für komplementlose werden- und nicht bleiben-Kon-struktionen mit kompariertem Adjektiv.
(32) Peter wird größer [als er vorher war] ≠ Peter bleibt nicht kleiner [als XY extern]
(33) a. Peter wird größer ≠ Peter bleibt nicht kleiner b. Der Ballon wird kleiner ≠ Der Ballon bleibt nicht größer
11 Steinitz (1999) hingegen weist eine Ellipsenerklärung für komplementlose werden + kom-
pariertes Adjektiv-Konstruktionen zurück.
358 Barbara Schlücker
Dieses Problem tritt zwar bei den Komporationskonstruktionen mit Vergleichs-phrase in (34) nicht auf: in beiden Konstruktionen wird ein Vergleich mit einem externen Wert beschrieben.
(34) a. Peter wird größer als seine Schwester ≠ Peter bleibt nicht kleiner als seine Schwester
b. Der Ballon wird kleiner als meine Hand ≠ Der Ballon bleibt nicht größer als meine Hand
Weiterhin bestehen bleibt hier jedoch der im vorangegangenen Abschnitt disku-tierte Unterschied in Hinblick auf den Situationsbezug von werden und (negier-tem) bleiben: größer werden denotiert ein Ereignis, nicht kleiner bleiben einen Zustand. Damit sind auch diese bleiben- und werden-Konstruktionen nicht äqui-valent zueinander.
6 Konstruktionen mit dem Partizip II
Ein über die in Abschnitt 4 dargestellten Schwierigkeiten hinausgehendes Prob-lem ergibt sich auch bei Konstruktionen mit dem Partizip II. Solche Konstrukti-onen sind sowohl bei bleiben als auch bei werden möglich, siehe (35). Auch hier liegt das bereits bekannte Problem des unterschiedlichen Situationsbezugs vor: ereignisbezogene Modifikatoren wie langsam oder sorgfältig sind in der wer-
den-Konstruktion zulässig, nicht jedoch in der „äquivalenten“ Konstruktion mit negiertem bleiben, siehe (36).
(35) a. Der Brief wird verschlossen ≠ Der Brief bleibt nicht geöffnet b. Der Brief bleibt verschlossen ≠ Der Brief wird nicht geöffnet
(36) Der Brief wird schnell verschlossen ≠ Der Brief bleibt *schnell nicht geöffnet
Der Unterschied zwischen den beiden scheinbar äquivalenten Formen ist in diesem Fall tatsächlich jedoch anderer Art als bei den in Abschnitt 4 diskutierten Konstruktionen. Die bisher betrachteten bleiben- und werden-Konstruktionen sind unstrittig Kopulakonstruktionen. Für Konstruktionen mit Prädikativen in Form eines Partizip II kann diese Einordnung bei näherer Betrachtung nicht aufrecht erhalten werden. Denn bei werden + Partizip II handelt es sich nach allgemeiner Auffassung nicht um eine Kopulakonstruktion, sondern um Passiv, siehe auch (2b).12 Die funktionale Einordnung von bleiben im Partizipialkontext ist weniger eindeutig: so wird mitunter in der Literatur die Auffassung vertreten,
12 Die Funktion von werden als Passivauxiliar ist allerdings das Ergebnis eines Grammati-
kalisierungsprozesses, an dessen Beginn werden (wie auch sein und bleiben) + Partizip II als Kopula fungiert (siehe beispielsweise Dal 1956, Grønvik 1986, Kotin 2000a, b). Werden + Part. II drückte danach den Eintritt eines Zustands aus (wurde geöffnet – „wurde ein Geöffneter“).
Warum nicht bleiben nicht werden ist 359
dass es sich bei bleiben + Part. II ebenfalls um eine Passivparaphrase handele (beispielsweise Leirbukt 1969, Glinz 1971, Vaagland 1974, Askedal 1984, Ro-senthal 1984, Helbig 1987, Eisenberg 1994, Lenz 1996, Weinrich 2003). Eine solche Analyse geht meist mit einer Analyse von sein + Part. II als Zustandspas- siv einher (‚Genus verbi-Analyse‘), wobei bleiben + Part. II dann als durative Variante des Zustandspassivs betrachtet wird.
Gegen den Passivstatus von bleiben bzw. sein + Partizip II ist inzwischen an verschiedener Stelle ausführlich argumentiert worden.13
Eines der Hauptargumente ist dabei die Zulässigkeit von un-präfigierten Par-tizipien in diesen Konstruktionen. Un- ist (im Deutschen) ein nominales, aber kein verbales Präfix (*unschlagen, *unöffnen), und kann sich nur mit einem adjektivierten Partizip II verbinden. Ein mit un- präfigiertes Partizip hat daher eindeutig adjektivischen Charakter und zeigt, wenn prädikativ verwendet, das Vorliegen einer Kopulakonstruktion an. Nicht-präfigierte Partizipien können adjektivischer oder verbaler Natur sein und daher sowohl als Teil einer Passiv- als auch einer Kopulakonstruktion auftreten. Die Zulässigkeit von unpräfigier-ten Partizipien in bleiben-Konstruktionen, im Gegensatz zu werden-Konstruk-tionen, zeugt also vom Kopulastatus von bleiben, vgl. (37), (38).
(37) a. Der Brief wird verschlossen ≠ Der Brief bleibt nicht unverschlossen b. Der Brief bleibt verschlossen ≠ *Der Brief wird nicht unverschlossen
(38) a. Der Brief wird nicht geöffnet ≠ Der Brief bleibt ungeöffnet b. Der Brief bleibt nicht geöffnet ≠ *Der Brief wird ungeöffnet
Problematisch für die Dualitätshypothese ist hier allerdings nicht in erster Linie die Selektionsbeschränkung der werden-Konstruktionen in den (b)-Sätzen, son-dern vor allem der dieser Beschränkung zugrunde liegende kategorielle Unter-schied zwischen bleiben und werden + Partizip II. Kopulakonstruktion und Vorgangspassiv unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der Genus verbi-Zugehörigkeit (Aktiv – Passiv), sondern auch hinsichtlich ihrer grammatischen Funktion: während die Aufgabe der Kopulaverben darin besteht, eine Beziehung zwischen Subjekt und Prädikativ herzustellen (wobei dies bei sein schlicht das Zutreffen des vom Prädikativ ausgedrückten Zustands ist, bei werden der Über-gang in und bei bleiben das Andauern des vom Prädikativ ausgedrückten Zu-stands ist), wird bei werden + Part. II ein Vorgang beschrieben und zwar aus einem ganz bestimmten, nämlich nicht-agentiven Blickwinkel. Aufgrund des kategoriellen Status stellt sich der Situationsbezug der werden- und bleiben-Konstruktionen auch anders dar als in den bisher besprochenen Konstruktionen: die Kopulakonstruktionen mit bleiben sind grundsätzlich Zustandsausdrücke. Der Situationsbezug des werden-Passivs hingegen ist abhängig vom Situations-
13 Zu sein insbesondere Rapp (1997, 1998), Kratzer (1994, 2000), Maienborn (2007), zu bleiben
Schlücker (2007).
360 Barbara Schlücker
typ des jeweiligen Vollverbs und kann Zustands- oder Ereignisbezug haben (Der
Brief wird geöffnet – Ereignis / Peter wird geliebt – Zustand). Werden- und bleiben-Konstruktionen mit partizipialem Komplement können
also nicht dual zueinander sein, weil sie keine gemeinsame kategoriale Grundla-ge aufweisen. Mit anderen Worten: die Dualitätshypothese postuliert eine Äqui-valenzbeziehung zwischen den Kopulaverben werden und bleiben, da werden hier jedoch keine Kopula ist, fehlt die Vergleichsgrundlage. Insofern stellen diese Konstruktionen auch kein Argument gegen die Dualitätshypothese dar. Dass die Diskussion der Daten im Zusammenhang mit der Dualitätshypothese an dieser Stelle nicht jedoch überflüssig ist, zeigen die Beispiele (35), (37a), (38a), die intuitiv eine solche Äquivalenzbeziehung nahelegen.
7 Der Alternativenbezug bei bleiben
Die in den vorangegangenen Abschnitten diskutierten Argumente gegen eine Dualitätsrelation zwischen werden und bleiben treten nicht in allen Konstruk-tionen auf, sondern betreffen einzelne Konstellationen (z.B. Negation, Kompa-ration). Das zentrale Argument dieses Abschnitts hingegen liegt kon-struktionsunabhängig vor und besteht in der Beobachtung, dass in der Bedeu-tung von bleiben ein Alternativenbezug enthalten ist, in der von werden hinge-gen nicht, und dass es sich bei diesem Alternativenbezug um einen lexikalisch verankerten Bedeutungsbestandteil von bleiben handelt. Auch unter diesem Gesichtspunkt lässt sich die Bedeutung von werden nicht in die von bleiben (und anders herum) überführen.
Bleiben tritt typischerweise in Kontexten auf (bzw. zwingt den Hörer, solche Kontexte zu erschließen), in denen die Negation des Zustands, den bleiben as-sertiert, viel wahrscheinlicher erscheint als der tatsächlich assertierte Zustand.
(39) a. Trotz der angedrohten Streiks bleibt die Bahn unnachgiebig14
b. Mit Mühe setzte sich der VfL Gummersbach gegen den MKB Veszprem durch und bleibt Tabellenführer der Gruppe F15
c. Obwohl er heute vor 30 Jahren gestorben ist, bleibt Elvis Presley wohl für immer unvergesslich16
In diesen drei Beispielen wird durch den Kontext jeweils eine Motivation ge-liefert, weshalb der Gegenzustand wahrscheinlicher ist als der tatsächlich asser-tierte Zustand. So wäre in (39a) angesichts der angedrohten Streiks zu erwarten, dass die Bahn nachgiebig ist, in (39b) weist der mühsame Sieg auf die wahr-
14 http://www.n-tv.de/862696.html; 12.10.2007 15 http://www.kicker.de/news/handball/startseite/artikel/370600/; 12.10.2007 16 http://www.fernsehen.ch/blog/archives/393-Elvis-Presley-im-Fernsehen-Der-King- bleibt-unvergesslich.html; 12.10.2007
Warum nicht bleiben nicht werden ist 361
scheinliche Möglichkeit, dass Gummersbach nicht Tabellenführer bleibt und in (39c) wird das Unvergessensein von Elvis Presley kontrastiert mit der Tatsache, dass er schon vor 30 Jahren gestorben ist, was erwarten ließe, dass er im Gegen-teil inzwischen längst in Vergessenheit geraten ist. Bleiben assertiert also einen Zustand vor dem Hintergrund des Gegenzustands und unterscheidet sich damit auch von sein, das einen Zustand assertiert, ohne gleichzeitig auf mögliche Al-ternativen zu verweisen.
Dass dieser Alternativenbezug tatsächlich Teil der Bedeutung von bleiben ist und es sich nicht lediglich um eine kontextabhängige Interpretation, ausgelöst beispielsweise durch Konjunktionen wie trotz und obwohl, handelt, zeigen die Beispiele unter (40) und, als Varianten von (39), die Beispiele unter (41). Hier steht bleiben in neutralen Kontexten und weist dennoch einen Alternativenbezug auf.
(40) a. Frankfurt bleibt DEL-Tabellenführer17
b. Beck: Sozialismus bleibt aktuell18
c. Westerwelle bleibt Fraktionschef19
(41) a. Die Bahn bleibt unnachgiebig b. Der VfL Gummersbach bleibt Tabellenführer der Gruppe F c. Elvis Presley bleibt wohl für immer unvergesslich
Wenn der Alternativenbezug von bleiben lexikalisch verankert ist, ist daher auch zu erwarten, dass das Auftreten von bleiben in Kontexten, die einen solchen Gegenzustand ausschließen, markiert ist. Tatsächlich ist es relativ schwierig, solche Kontexte ausfindig zu machen. Dies spricht nun aber nicht gegen einen lexikalisch verankerten Alternativenbezug, sondern zeigt vielmehr, dass der Alternativenbezug verschiedene Ausprägungen haben kann: in Abhängigkeit vom sprachlichen und außersprachlichen Kontext kann der alternative Gegenzu-stand erwartet sein (beispielsweise in (39b)). Diese „Erwartung“ kann aber auch zu einer bloßen Möglichkeit abgeschwächt sein, vergleiche (39a), oder aber ein Zustand wird vor dem Hintergrund seiner Negation, also als Kontrast, behaup-tet, wie in (39c). Wenn die Alternative aber auch lediglich erwartet oder möglich sein kann, dann kann es nur wenige Kontexte geben, in denen die Verwendung von bleiben aufgrund des Alternativenbezug markiert oder gar ausgeschlossen ist.
Eine solche Konstellation (und damit zusätzliche Evidenz für die Annahme, dass der Alternativenbezug von bleiben lexikalisch verankert ist) liegt nur dann vor, wenn das Prädikativ einen irreversiblen Zustand denotiert: bei bleiben sind
17 http://www.sportgate.de/wintersport/eishockey/artikel/frankfurt-bleibt-del-tabellenfuehrer-1697/; 12.10.2007 18 http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/31/0,3672,7102911,00.html, 12.10.2007 19 http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/FDP-Guido-Westerwelle;art122,2382068; 12.10.2007
362 Barbara Schlücker
nur solche Prädikative zulässig, die einen reversiblen Zustand denotieren. Denn nur bei reversiblen Zuständen wäre ein Wechsel zum alternativen Gegenzustand überhaupt möglich. D.h. dass der Alternativenbezug wiederum eine Bedingung der Möglichkeit des Wechsels voraussetzt. Irreversible Zustände wie tot und vorbei in (42a, b) erfüllen diese Bedingung nicht. Auch Partizipia II denotieren Resultatszustände von Ereignissen, die in der Regel nicht reversibel sind.20 Dies erklärt die Unwohlgeformheit der bleiben-Konstruktionen in (42c) und (d).21
(42) a. # Peter bleibt tot b. # Das Spiel bleibt vorbei c. # Die Tablette bleibt im Wasser aufgelöst d. # Das Spiel bleibt verloren
Die Phasenpartikel noch weist nun nicht nur eine Parallele mit bleiben im Hin-blick auf die Vorzustandspräsupposition (siehe Abschnitt 4.2), sondern auch auf den Alternativenbezug auf: auch noch hat Alternativenbezug, macht aber im Gegensatz zu bleiben eine Aussage über einen zukünftigen Wechsel zum Ge-genzustand, d.h. zu einer Zeit nach der Betrachtzeit, und nicht gleichzeitig zur Betrachtzeit. Genau hierin liegt nun auch der Bedeutungsunterschied zwischen (25a, b), hier wiederholt als (43):
(43) a. Peter bleibt krank b. Peter ist noch krank
Die bleiben-Konstruktion denotiert die Erwartung / Möglichkeit / Wahrschein-lichkeit, dass Peter zur Betrachtzeit nicht krank ist. Die Konstruktion mit noch (sein) hingegen drückt die Erwartung / Möglichkeit / Wahrscheinlichkeit aus, dass Peter zu einer Zeit nach der Betrachtzeit gesund ist. Beide Konstruktionen stimmen hingegen darin überein, dass sie das Kranksein Peters zur Betrachtzeit assertieren und einen unmittelbar vorangehenden Zustand des Krankseins prä-supponieren. Allerdings nimmt van de Auwera (1993: 623ff) in seiner ‚Double Alternative Hypothesis‘ an, dass noch (bzw. still) den assertierten Zustand nicht
20 Bei den Resultatszuständen müssen die so genannten Resultant States von Target States
unterschieden werden (siehe Parsons 1990: 234f). Resultant States sind irreversibel und meinen den Nachzustand eines jeden Ereignisses, den Zustand, dass ein bestimmtes Ereignis vorbei ist („If Mary eats lunch, then there is a state that holds for ever after: The state of Mary’s having eaten lunch.“ (Parsons 1990: 234)). Manche Ereignisse haben darüber hinaus noch einen Target State, einen unabhängig identifizierbaren Zustand, der das Resultat eines Ereignisses ist und der reversibel sein kann. Partizipien, die einen reversiblen Target State denotieren, sind in bleiben-Konstruktionen zulässig: Die Tür bleibt geschlossen (vgl. Schlücker 2007: 254ff).
21 Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei irreversiblen Prädikativen eine Uminterpretation als re-versibler Zustand stattfinden kann, weil die Frage, wann ein Zustand als irreversibel angesehen werden muss, auch vom jeweiligen Kontext abhängt. Daher handelt es sich hier nicht um gramma-tische Verletzungen, sondern um pragmatisch markierte Konstruktionen, was durch „#“ angezeigt wird. D.h. es bedarf hier einer Uminterpretation, um den durch das Prädikativ denotierten Zustand als reversibel zu interpretieren, was wiederum Voraussetzung für die lexikalisch verankerte Erwar-tung des Gegenzustands ist.
Warum nicht bleiben nicht werden ist 363
nur mit einem zukünftigen, sondern auch mit einem (zur Betrachtzeit) gleich-zeitigen Gegenzustand kontrastieren kann. Im aktuellen Kontext ist dann jeweils einer dieser beiden alternativen Zustände prominenter als der andere. Auch Max & Malink (2001: 98) verweisen auf die Möglichkeit, den Gegenzustand von noch als ‚kontrafaktische Gegenwartsalternative‘ zu interpretieren. So kann mit einem Satz wie (25b) – in einem geeigneten Kontext – auch ohne Probleme Bezug genommen werden auf die wahrscheinliche Möglichkeit, dass Peter zur Betrachtzeit eben nicht krank ist.22
Die bleiben- und werden-Konstruktionen in (44) sind also auch deshalb nicht dual zueinander, weil in der Bedeutung von bleiben ein Alternativenbezug ver-ankert ist, in der von werden hingegen nicht: so wird mit der bleiben-Konstruktion in (44a) Bezug genommen auf die Erwartung / Möglichkeit / Wahrscheinlichkeit, dass das Kind zur Betrachtzeit dick ist. Bei der entspre-chenden werden-Konstruktion hingegen ist dies nicht der Fall.23
(44) a. Das Kind bleibt dünn ≠ Das Kind wird nicht dick b. Die Heizung bleibt warm ≠ Die Heizung wird nicht kalt c. Das Auto bleibt schmutzig ≠ Das Auto wird nicht sauber
Die mit dem Alternativenbezug verbundene Selektionsbeschränkung von blei-
ben, dass nur Prädikative zulässig sind, die einen reversiblen Zustand deno-tieren, erklärt dann auch, weshalb bestimmte „äquivalente“ bleiben-Konstruk-tionen gar nicht möglich sind, siehe (45):
(45) a. # Peter bleibt tot ≠ Peter wird nicht lebendig b. # Peter bleibt alt ≠ Peter wird nicht jung
22 Der formale Status des zukünftigen Alternativzustands in der Bedeutung von noch ist in einer
Reihe von Arbeiten diskutiert worden. Löbner (1989: 176; 1990: 118) bezieht einen zukünftigen Alternativzustand bei der Analyse von noch mit dem Argument nicht mit ein, dass die Voraussetzung dafür entsprechende Evidenz über die Entwicklung in der Zukunft sei, diese aber natürlicherweise nicht gegeben sei, wenn die Betrachtzeit identisch mit der Sprechzeit ist. Im Gegensatz dazu ana-lysiert Löbner (1999) allerdings den Zustandswechsel in der Zukunftsdimension wie bereits König (1977) als konversationelle Implikatur. Van de Auwera (1993, 1998) spricht von ‚potentiellen Pha-sen‘, die semantische Komponenten des Lexems seien, enthält sich aber einer genaueren Einord-nung. Max & Malink (2001: 99) wiederum halten in Anbetracht der Interpretation als Erwartung oder Gegenwartsalternative auch eine Analyse als Präsupposition für unproblematisch. In Bezug auf den Alternativzustand bei bleiben argumentiert Schlücker (2007) für eine Einordnung als konven-tionelle Implikatur.
23 Es muss unterschieden werden zwischen dem lexikalisch verankerten Alternativenbezug bei bleiben und einer Alternative, die sich unabhängig von der sprachlichen Form aus dem Kontext in Verbindung mit dem Weltwissen ergibt. Tauscht man beispielsweise die Prädikative in (44b) aus (Die Heizung bleibt kalt; Die Heizung wird nicht warm), so könnte man auch für den werden-Satz eine Alternativenerwartung postulieren. Eine solche Erwartung ergäbe sich dann aber allein aus dem Weltwissen, dass es der Zweck und der Normalzustand von Heizungen ist, warm zu sein, und dass bei Nichtzutreffen dieses Zustands eben das Gegenteil erwartet wird. Anders als bei bleiben wäre eine solche Erwartung aber nicht in der sprachlichen Form verankert, denn bei bleiben liegt der Alternativenbezug eben auch in dem Fall vor, in dem die erwartete Alternative der vom Weltwissen gesteuerten Alternative entgegenläuft, wie in (44b) oben.
364 Barbara Schlücker
Diese Daten zeigen damit einmal mehr, dass die scheinbar semantisch äquiva-lenten bleiben- und werden-Konstruktionen nicht dual zueinander sind. Damit unterscheidet sich das Paar bleiben / werden auch von schon / noch: denn im Gegensatz zu bleiben / werden weisen sowohl schon als auch noch Alter-nativenbezug auf. Van de Auwera (1993) und Mittwoch (1993) argumentieren vielmehr aus anderen Gründen gegen eine Dualitätsbeziehung zwischen noch und schon. Van de Auwera (1993: 618) zeigt, dass zwischen schon und noch keine bidirektionale Implikationsbeziehung besteht, wie es zu erwarten wäre, wenn schon und noch Duale sind, denn nicht nur schon, sondern auch endlich impliziert noch, aber noch impliziert weder schon noch endlich. Mittwoch (1993) wiederum weist eine Dualitätsbeziehung zwischen schon und noch mit dem Argument zurück, dass nur für noch die von Löbner postulierte Vorzu-standspräsupposition gelte, für schon (und noch nicht) hingegen nicht.
8 Der Situationsbezug von nicht bleiben
An dieser Stelle kann nun noch einmal die Frage nach der Zustandsmodifikation bei nicht bleiben aufgenommen werden, für deren Beantwortung der Alternati-venbezug von bleiben relevant ist: Warum ist die Spezifikation durch ein Zeit-daueradverbial wie zwei Tage lang bei nicht bleiben markiert, siehe (17b), hier wiederholt als (46a)? Dieser Satz ist nicht ungrammatisch, aber es besteht eine Interpretationsunsicherheit: Was soll es bedeuten, wenn jemand zwei Tage lang nicht weiterhin gesund ist? Worauf bezieht sich zwei Tage lang?
(46) a. Peter blieb ?zwei Tage lang nicht gesund b. Peter blieb *innerhalb von zwei Stunden / *langsam nicht gesund c. Peter wurde zwei Tage lang nicht gesund
Wie in Abschnitt 4 ausgeführt, entsteht bei Negation eines Zustandsausdrucks ein konträrer Zustand, sodass die Negation von bleiben P einen Zustand ¬P ergibt. Aus diesem Grund ist Ereignismodifikation bei negiertem bleiben unzu-lässig, siehe (46b).
Die Zustandsmodifikation durch zwei Tage lang ist daher auch nicht un-grammatisch. (46a) kann paraphrasiert werden als „Es ist nicht der Fall, dass Peter (weiterhin) gesund ist, und dieser Zustand gilt zwei Tage lang“. Dass blei-
ben auch unter Negation Alternativenbezug hat, lässt sich einfach an einem Beispiel ohne Zustandsmodifikator zeigen: so wird in (47) Bezug auf die Erwar-tung genommen, dass Peter gerade (weiterhin) gesund ist.
(47) Peter blieb nicht gesund
Die Interpretationsschwierigkeit bzw. -unsicherheit entsteht nun dadurch, dass der Hörer, wenn das Andauern des Zustands bei negiertem bleiben explizit ver-neint wird, daraus auf das Stattfinden eines Zustandswechsels schließt (ohne dass dies durch bleiben denotiert würde, wie die Unzulässigkeit von ereignis-
Warum nicht bleiben nicht werden ist 365
bezogenen Modifikatoren bei negiertem bleiben zeigt). Wenn einem Zustand des Nichtgesundseins (also der Krankheit) von Peter ein Zustand des Gesundseins vorangeht, so muss zwischen diesen beiden Zuständen ein Zustandswechsel liegen. Aus (47) folgt also ein Zustandswechsel; in diesem Sinne wird die blei-
ben-Konstruktion uminterpretiert als „Peter wurde krank“. Ein solcher Zu-standswechsel wird für einen bestimmten Zeitpunkt erwartet. Dieser Zustands-wechselpunkt wird vom Kontext bestimmt und ist genau der Zeitpunkt, ab dem das Vorliegen des Gegenzustands erwartet wird.
Ein Zeitdaueradverbial wie in (46a) kann sich erstens nun aber ausschließ-lich auf das Assertionsintervall beziehen und zweitens nur einen Zustand, nicht aber ein Ereignis modifizieren. Das Zeitdaueradverbial erschwert oder verhin-dert damit die Uminterpretation als Ereignisausdruck, die bei nicht bleiben of-fensichtlich regelhaft abläuft. Es ist daher ein konzeptuelles Problem, aufgrund dessen die Verwendung eines Zustandsmodifikators bei negiertem bleiben zwar nicht ungrammatisch, aber dennoch problematisch ist: Zustandsbezogene Modi-fikatoren sind nicht ungrammatisch, aber markiert, weil das – von nicht bleiben – denotierte Nichtandauern eines Zustands als Zustandswechsel uminterpretiert wird, der zu einem bestimmten Zeitpunkt (der mit dem Ende des präsupponier-ten Vorzustands P und dem Beginn des assertierten Zustands ¬P zusammenfällt) erwartet wird und ein solcher Wechsel eben nicht durch einen Zustandsmodifi-kator spezifiziert werden kann. Ereignisbezogene Modifikatoren wie in (46c) hingegen sind bei negiertem bleiben ungrammatisch, weil negiertes bleiben keinen Ereignisbezug hat, sondern einen Zustand denotiert.
Unproblematisch ist temporale Modifikation bei negiertem bleiben daher einzig in Form von rahmensetzender Modifikation (vgl. Maienborn 2003) wie in (48): hier wird durch gestern bzw. letztes Jahr ein temporaler Rahmen spezifi-ziert, innerhalb dessen eine Situation lokalisiert werden kann. Diese Modifikato-ren haben jedoch keinen direkten Situationsbezug und verhalten sich daher neutral gegenüber der Frage, ob ein Zustand oder ein Ereignis denotiert wird.
(48) Peter blieb gestern / letztes Jahr nicht zuhause
9 Diskussion
Die Frage, ob schon und noch Duale sind, ist in der Literatur vielfältig und kon-trovers diskutiert worden. Der vorliegende Beitrag stellt diese Frage für zwei im Zusammenhang mit der Dualitätsrelation wenig behandelte Ausdrücke, die Ko-pulaverben werden und bleiben. Obwohl die von Löbner vertretene Ansicht, dass zwischen bleiben und werden als „aspektuelle Ausdrücke“ (1990: 88) eine Dualitätsbeziehung besteht, nach meinem Wissen in der Literatur nie diskutiert wurde, so wird das Bestehen einer solchen Relation jedenfalls in Lenz (1996), Steinitz (2000) und Bierwisch (2004) angenommen und von letzteren für die semantische Analyse von bleiben zugrunde gelegt.
366 Barbara Schlücker
In diesem Beitrag ist dafür argumentiert worden, dass zwischen bleiben und werden keine Dualitätsbeziehung besteht. Dafür sind zwei Hauptargumente geliefert worden: zum ersten konnte gezeigt werden, dass bleiben und werden in scheinbar äquivalenten Konstruktionen unterschiedlichen Situationsbezug auf-weisen. Dies betrifft die unter (8) (Typ 1) aufgeführte Äquivalenz zwischen werden P und ¬bleiben ¬P: werden P denotiert ein Ereignis, das scheinbar äqui-valente ¬bleiben ¬P hingegen einen Zustand. Insofern lässt sich also die Bedeu-tung von werden nicht durch duale Negation in die von bleiben überführen. Beim zweiten unter (8) aufgeführten Typ, bleiben P und ¬werden ¬P, liegt zwar identischer Situationsbezug vor, denn beide referieren auf Zustände. Eine Duali-tätsbeziehung liegt jedoch auch hier nicht vor. Das zeigt das zweite Hauptargu-ment: werden und bleiben sind keine Duale, weil in der Bedeutung von bleiben (ähnlich wie bei den Phasenpartikeln schon und noch) ein Alternativenbezug lexikalisch verankert ist: bleiben assertiert einen Zustand vor dem Hintergrund des Gegenzustands und tritt daher typischerweise in Kontexten auf (bzw. zwingt den Hörer, solche Kontexte zu erschließen), in denen die Negation des Zustands, den bleiben assertiert, viel wahrscheinlicher erscheint als der tatsächlich asser-tierte Zustand. Bei werden hingegen ist das nicht der Fall. Dieses Argument gilt unabhängig von den in (8) spezifizierten Typen und unabhängig von der Art der Prädikative für alle werden- und bleiben-Konstruktionen. Auch aufgrund des Alternativenbezugs von bleiben können werden und bleiben also nicht als Duale analysiert werden.
Darüber hinaus wurden zwei weitere, konstruktionsspezifische Argumente behandelt: Zum einen wurde im Hinblick auf Konstruktionen mit dem Partizip II argumentiert, dass eine etwaige Dualitätsbeziehung schon bereits daran schei-tert, dass werden und bleiben in diesen Konstruktionen kategoriell verschieden sind, da bleiben + Part. II eine Kopulakonstruktion ist, werden + Part. II hinge-gen ein Passiv. Die Dualitätshypothese hat aber nur für die Kopulaverben wer-
den und bleiben Gültigkeitsanspruch. Obwohl werden und bleiben + Partizip II zunächst als dual erscheinen, ist eine Dualitätsrelation hier daher aus unabhän-gigen Gründen von vorneherein ausgeschlossen. Zum anderen sind Komparati-onsstrukturen angeführt worden, in denen werden und bleiben mit einem kom-parierten Adjektiv ohne Vergleichsphrase auftreten. Hier wurde gezeigt, dass solche Strukturen auf unterschiedliche Art interpretiert werden: während werden + kompariertes Adjektiv in der Regel als Vergleich mit dem gleichen Wert zu einem früheren Zeitpunkt interpretiert wird, ist eine solche Interpretation für bleiben + kompariertes Adjektiv ausgeschlossen: hier kann lediglich der Ver-gleich mit einem nicht genannten, externen Wert gemeint sein. Werden und bleiben sind also in Komparationsstrukturen ohne Vergleichsphrase nicht dual zueinander; die oben genannten Argumente gegen eine Dualitätsrelation bleiben hiervon unberührt.
Diese Argumente und die Beispiele, anhand derer sie illustriert wurden, zei-gen, dass zwischen bleiben und werden keine Dualitätsbeziehung besteht. Die Frage, auf welche Weise dieser Feststellung in der semantischen Analyse von
Warum nicht bleiben nicht werden ist 367
werden und bleiben Rechnung getragen werden muss, ist besonders wichtig in Hinblick auf die Analyse von bleiben, da ja die wenigen bestehenden seman-tischen Analysen von bleiben zum Teil auf einer solchen Dualitätsannahme beruhen (Steinitz 2000, Bierwisch 2004). Im Mittelpunkt steht dabei das Ver-hältnis zwischen den logischen Operatoren REMAIN und BECOME einerseits und den Lexikoneinträgen von bleiben und werden andererseits bzw. die Frage, inwieweit diese miteinander gleichzusetzen sind.24 Der BECOME-Operator ist an verschiedener Stelle definiert worden, siehe Abschnitt 2.2. Eine Definition des REMAIN-Operators geben u.a. Steinitz (2000) und Bierwisch (2004). In diesen Arbeiten erfolgt die Definition von REMAIN allerdings unter Annahme einer Dualitätsbeziehung durch Rückgriff auf den Operator BECOME. Diese Option scheidet jedoch aufgrund der hier vorgelegten Argumente aus.25
Ein grundlegender Unterschied zwischen den Operatoren REMAIN und BECOME in Hinblick auf die Lexikoneinträge von bleiben und werden besteht außerdem darin, dass der BECOME-Operator nicht nur für das Verb werden steht, sondern als Teil der semantischen Beschreibung diverser (Zustands-wechsel-)Verben genutzt wird. Für den REMAIN-Operator gilt das nicht, er wird ausschließlich für die Beschreibung des Verbs bleiben eingeführt. Der BECOME-Operator hat insofern einen völlig anderen Status als der REMAIN-Operator. Diese Tatsache sowie das Nichtvorhandensein einer Dualitätsrelation legen es nahe, auf die Zugrundelegung eines solchen REMAIN-Operators zu verzichten und die lexikalische Semantik von bleiben ohne Rückgriff auf den REMAIN-Operator zu beschreiben. Einen Lexikoneintrag für bleiben, der auf die Einbettung eines REMAIN- (und natürlich auch eines BECOME-)Operators verzichtet, und bei dem gleichzeitig der Alternativenbezug verankert ist, habe ich in Schlücker (2007) vorgeschlagen.
Die vermeintliche Bedeutungsgleichheit von werden und bleiben im Negati-onskontext beruht auf der Tatsache, dass werden und bleiben, ebenso wie sein, als Kopulaverben eine Verbindung zwischen Subjektreferent und einem vom Prädikativ denotierten Zustand herstellen, und dass werden und bleiben, anders als sein, dabei „Phasenbezug“ aufweisen, d.h. auf die Zeitachse bezogen sind (vgl. Lenz 1996: 176 f). Die scheinbare Bedeutungsäquivalenz entsteht dadurch, dass unter Negation scheinbar identische Phasenstrukturen (gleicher Vor- und Nachzustand; unterschiedlicher Vor- und Nachzustand) vorliegen.
24 Dem Vorschlag eines anonymen Gutachters gemäß bestünde eine mit den hier vorgestellten
Befunden kompatible Lösung darin, die Operatoren REMAIN und BECOME weiterhin als Duale im Löbnerschen Sinne zu betrachten und die Unterschiede auf die Einpassung der Operatoren in die lexikalische Semantik der beiden Kopulae zurückzuführen. Dies mag in Hinblick auf den Alterna-tivenbezug eine mögliche Lösung darstellen; der Situationsbezug bzw. die interne Ereignisstruktur betrifft jedoch direkt die Bedeutung der Operatoren und ist davon nicht zu trennen. Im Übrigen bestehen die im Folgenden geschilderten grundsätzlichen Probleme hinsichtlich des Status von REMAIN (versus BECOME) m.E. auch unter dieser Annahme.
25 Rapp & von Stechow (1999: 172) und Krämer (2004: 252) schlagen eine intervallbasierte Definition von REMAIN ohne Rückgriff auf BECOME vor.
368 Barbara Schlücker
Tatsächlich wird aber durch die Reduktion auf diese Phasenstruktur ins-besondere der wesentliche Bedeutungsbestandteil von werden nicht erfasst: die Tatsache nämlich, dass werden, wie in Abschnitt 4.2 diskutiert, gerade kein Zustandsausdruck ist, sondern einen Zustandswechsel assertiert, anders als blei-
ben. Ebensowenig wird dadurch berücksichtigt, dass bleiben zwar ebenso wie sein einen Zustand assertiert, dies aber anders als bei sein vor dem Hintergrund des Gegenzustands. Statt als bedeutungsäquivalent muss die Relation zwischen ¬bleiben ¬P und werden P daher als Folgerung beschrieben werden, siehe (49):
(49) Peter bleibt nicht krank → Peter wird gesund
Wenn nicht krank bleiben bedeutet, dass Peter zur Betrachtzeit nicht krank ist und unmittelbar zuvor krank war, dann folgt daraus auch das Stattfinden eines Ereignisses gesund werden – denotiert wird das jedoch von bleiben nicht.
Aus nicht nur diesem Grunde ist also nicht bleiben nicht werden.
Literatur
Abraham, W. (1977): „Noch und schon als polare Satzfunktoren“. In: K. Sprengel, W. D. Bald & H. W. Viethen (Hrsg.), Semantik und Pragmatik. Akten des 11. linguistischen Kolloqui-ums, Aachen 1967. Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten 50), 3–20.
Abraham, W. (1980): „The Synchronic and Diachronic Semantics of German Temporal noch and schon, with Aspects of English still, yet and already“. Studies in Language 4, 3–24.
Askedal, J. O. (1984): „Zum Stellenwert der Fügungen werden/sein/bleiben + Partizip II im deutschen Passivsystem“. In: J. Tuldava et al., Hrsg., Voprosy obscego i sopostavitel'nogo jazykoznanija. Linguistica 17 (Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis 684), 9–34.
Barwise, J. & R. Cooper (1981): „Generalized Quantifiers and Natural Language“ Linguistics and Philosophy 4, 159–219.
Bierwisch, M. (1987): „Semantik der Graduierung“. In: M. Bierwisch & E. Lang, Hrsg., Grammatische und konzeptuelle Aspekte von Dimensionsadjektiven (= studia grammatica XXVI + XXVII). Berlin: Akademie-Verlag, 91–286.
Bierwisch, M. (2004): BECOME and its Presuppositions. Manuskript, Humboldt-Universität Berlin.
Bierwisch, M. (2005): „The Event Structure of CAUSE and BECOME“. In: C. Maienborn & A. Wöllstein, Hrsg., Event Arguments: Foundations and Applications. Tübingen: Niemey-er, 11–44, (= Linguistische Arbeiten 501).
Dal, I. (1956): „Participium praeteriti mit dem syntaktischen Wert eines Infinitivs im Mittel-niederländischen und Mittelhochdeutschen“. In: E. Karg-Gasterstädt & J. Erben, Hrsg., Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der germanistischen Philologie. Fest-schrift für Theo Frings. Berlin, 130–141.
Davidson, D. (1967): „The logical Form of Action Sentences“. In: N. Rescher (Hrsg.), The Logic of Decision and Action. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 81–95. Wied-erabdruck in Davidson (1980), Essays on Action and Events. Oxford: Clarendon Press, 105–122.
Doherty, M. (1973): „‚Noch‘ and ‚schon‘ and their Presuppositions“. In: F. Kiefer, N. Ruwet, Hrsg., Generative Grammar in Europe. Dordrecht, Holland: Reidel Publishing Company, 154–177.
Warum nicht bleiben nicht werden ist 369
Dowty, D. R. (1979): Word Meaning and Montague Grammar. The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montague’s PTQ. Dordrecht, Boston, London: Rei-del.
Eisenberg, P. (31994): Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler. Fabricius-Hansen, C. (1975): Transformative, intransformative und kursive Verben. Tübingen:
Niemeyer. Garrido, J. (1992): „Expectations in Spanish and German Adverbs of Change“ Folia Linguis-
tica XXVI/3-4, 357–402. Glinz, H. (1971): Deutsche Grammatik II. Kasussyntax – Nominalstrukturen – Wortarten –
Kasusfremdes. Frankfurt a.M: Athenäum. Grønvik, O. (1986): Über den Ursprung und die Entwicklung der aktiven Perfekt- und Plus-
quamperfektkonstruktionen des Hochdeutschen und ihre Eigenart innerhalb des germani-schen Sprachraums. Oslo: Solum Forlag.
Härtl, H. (2005): „*nackt werden: The Combinatorial Restrictions of the German Copula werden and the Notion of Control“. Linguistische Berichte 203, 349–381.
Helbig, G. (1987): „Zur Klassifizierung der Konstruktionen mit sein + Partizip II (Was ist ein Zustandspassiv?)“. In: Centre de Recherche en Linguistique Germanique (Nice), Das Pas-siv im Deutschen. Akten des Kolloquiums über das Passiv im Deutschen, Nizza 1986. Tü-bingen: Niemeyer, 215–233.
Herweg, M. (1990): Zeitaspekte. Die Bedeutung von Tempus, Aspekt und temporalen Kon-junktionen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.
Hirtle, W. H. (1977): „ALREADY, STILL and YET.“ Archivum Linguisticum VIII/1: 28–45. Horn, L. R. (1970): „Ain’t it Hard (Anymore)“. Papers from the Sixth Regional Meeting of the
Chicago Linguistic Society, Chicago Linguistic Society, Chicago: 318–327. König, E. (1977): „Temporal and Non-Temporal Uses of schon and noch in German“. Linguis-
tics and Philosophy 1, 173–198. König, E. (1991): The Meaning of Focus Particles. A Comparative Perspective. London:
Routledge. Kotin, M. (2000a): „Zur Diachronie des Verbs werden: Vollverb – Kopula – Auxiliar“. ZAS
Papers in Linguistics 16, 31–67. Kotin, M. (2000b): „Das Partizip II in hochdeutschen periphrastischen Verfügungen im 9.–15.
Jh. Zur Ausbildung des analytischen Sprachbaus“. Zeitschrift für germanistische Linguis-tik 28, 319–345.
Krämer, S. (2004): „Bleiben bleibt bleiben“. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 23/2, 245–274. Kratzer, A. (1994): „The Event Argument and the Semantics of Voice“. Kapitel 2. Manuscript,
Amherst. Kratzer, A. (2000): Building Statives. Manuscript, University of Massachusetts at Amherst (=
http://semanticsarchive.net/Archive/GI5MmI0M/kratzer.building.statives.pdf, Stand: 28.11.2007). Leirbukt, O. (1969): „Gibt es ein bleiben-Passiv im heutigen Deutsch?“ In: Tilegnet Carl Hj.
Borgstrøm. Et festskrift på 60-årsdagen 12.10.1969 fra hans elever. Oslo – Bergen – Tromsø, Universitetsforlaget.
Lenz, B. (1996): „Sein, bleiben und werden im Negations- und Partizipial-Kontext“. Lingu-istische Berichte 162, 161–182.
Löbner, S. (1987): „Quantification as a Major Module of Natural Language“. In: J. Gro-enendijk, D. de Jongh & M. Stokhof, Hrsg., Studies in Discourse Representation Theory and the Theory of Generalized Quantifiers, Dordrecht: Foris, 53–85.
Löbner, S. (1989): „German schon – erst – noch: An Integrated Analysis“. Linguistics and Philosophy 12: 167–212.
Löbner, S. (1990): Wahr neben falsch. Duale Operatoren als die Quantoren natürlicher Spra-che. Tübingen: Niemeyer.
370 Barbara Schlücker
Löbner, S. (1999): „Why German schon and noch are still duals: a reply to Van der Auwera“. Linguistics and Philosophy 22: 45–107.
Maienborn, C. (2003): Die logische Form von Kopula-Sätzen. Berlin: Akademie Verlag (= studia grammatica 56).
Maienborn, C. (2007): „Das Zustandspassiv: Grammatische Einordnung – Bildungsbeschrän-kungen – Interpretationsspielraum“. Zeitschrift für Germanistische Linguistik 35, 84–116.
Max, I. & M. Malink (2001): „Zur dreidimensionalen Modellierung der Phasenpartikeln um schon“. In: J. Dölling & T. Zybatow, Hrsg., Ereignisstrukturen. Institut für Lingustik, Uni-versität Leipzig, 89–120 (= Linguistische Arbeitsberichte 76).
Michaelis, L. A. (1993): „‚Continuity‘ within Three Scalar Models: The Polysemy of Adver-bial Still.“ Journal of Semantics 10: 193–237.
Mittwoch, A. (1993): „The Relationship between schon/aber and noch/still: A Reply to Löb-ner“. Natural Language Semantics 2, 71–82.
Musan, R. (1999): „Zur Semantik von werden: Ist prädikatives werden transitional?“. ZAS Papers in Linguistics 14, 189–208.
Parsons, T. (1990): Events in the Semantics of English. A Study in Subatomic Semantics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Rapp, I. (1997): Partizipien und semantische Struktur. Zu passivischen Konstruktionen mit dem 3. Status. Tübingen: Stauffenburg (= Studien zur deutschen Grammatik 54).
Rapp, I. (1998): „Zustand? Passiv? – Überlegungen zum sogenannten ‚Zustandspassiv‘“. Zeitschrift für Sprachwissenschaft (1996) 15/2, 231–265.
Rapp, I. & A. von Stechow (1999): „Fast ‚Almost‘ and the Visibility Parameter for Functional Adverbs“. Journal of Semantics 16: 149–204.
Rosenthal, D. (1984): Studien zur Syntax und Semantik des Verbs bleiben. Unter besonderer Berücksichtigung des Niederdeutschen und Niederländischen. Göteborger Germanistische Forschungen 27.
Schlücker, B. (2007): Diskurs im Lexikon. Eine Untersuchung der Kopula bleiben. Tübingen: Stauffenburg (= Studien zur deutschen Grammatik 73).
Steinitz, R. (1999): „Die Kopula werden und die Situationstypen“. Zeitschrift für Sprachwis-senschaft 18/1, 121–151.
Steinitz, R. (2000): „Deutsch werden, bleiben und schwedisch bli, förbli – ein Dualitätsprob-lem“. In: J. Bayer, C. Römer, Hrsg., Von der Philologie zur Grammatik: Peter Suchsland zum 65. Geburtstag, Tübingen: Niemeyer, 315–341.
Vaagland, E. M. (1974): „Zur Fügung bleiben + Partizip II im heutigen Deutsch“. Norwegian Journal of Linguistics 29, 207–236.
Van Baar, T. (1992): „Dualiteit versus Alternatieve Scenario’s“. Gramma/TTT 1, 193–210. Vandeweghe, W. (1986): „Complex Aspectivity Particles in Some European Languages“.
Groninger Arbeiten zur Germanistischen Linguistik 27, 220–231. Vandeweghe, W. (1990): „Negatie en aspectische kwantoren“. Handelingen Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XLIV, 137–150.
Vandeweghe, W. (1992): Perspectivische evaluatie in het Nederlands: de partikels van de AL/NOG/PAS-groep. Gent. (= Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 6/120).
Van der Auwera, J. (1993): „,Already‘ and ;still‘: Beyond Duality“. Linguistics and Philoso-phy 16, 613–653.
Van der Auwera, J. (1998): „Phasal Adverbials in the Languages of Europe“. In: J. van der Auwera & D. P. Ó Baoill, Adverbial Constructions in the Languages of Europe, Berlin, New York, De Gruyter, 25–145.
Von Stechow, A. (1984): „Comparing Semantic Theories of Comparison“. Journal of Seman-tics 3, 1–77.
Warum nicht bleiben nicht werden ist 371
Von Stechow, A. (1996): „The Different Readings of Wieder ‚Again‘: A Structural Account“. Journal of Semantics 13, 87–138.
Vendler, Z. (1967): Linguistics in Philosophy. Ithaca: Cornell University Press. Weinrich, H. (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. Hildesheim, Zürich, New York:
Georg Olms. Zybatow, T. (2001): Grammatische Determinatoren für Zeit- und Sachverhaltsverlauf im
Deutschen. Dissertation, Universität Leipzig. Berlin Barbara Schlücker
Freie Universität Berlin, Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Habelschwerd-ter Allee 45, 14195 Berlin [email protected]