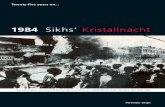1984 Eine Neuere Inschrift von L. Octavius Faustinianus aus Savaria
Transcript of 1984 Eine Neuere Inschrift von L. Octavius Faustinianus aus Savaria
SAVARIA
17-18. KÖTET A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE 1983-1984
EINE NEUERE INSCHRIFT VON L. OCTAVIUS FAUSTINIANUS AUS SAVARIA
ISTVÁN TÓTH
Das im Folgenden darzustellende Inschriftbruchstück wird im Lapidarium des Savaria Museums zu Szombathely aufbewahrt. Das Denkmal wurde von Magdolna Medgyes im Laufe einer Auflegung bei dem Bau des neuen Stadthauses aufgefunden1. Es lag 3 Meter tief auf dem Gebiet eines weit ausgebreiteten Säulengebäudes, in einer Schicht also, die weit unter dem Gehniveau des Gebäudes an der Ecke der heutigen Thököly und Bejczy Straßen lief. Die Inschrift war nach aller Wahrscheinlichkeit noch in der Römerzeit mit anderen Stücken, darunter mit einem aus weißem Marmor geschnitzten weiblichen Torso in die das Gehniveau durchbrechende Grube gekommen, so wird ihr Verhältniß zu den Perioden des dort aufgelegten Gebäudes erst durch die Analyse des gesamten Materials der Ausgrabung zu bestimmen sein.
Das steinerne Denkmal besteht aus einem marmorartigen, kristallenen Kalkstein, seine Höhe beträgt 65, seine Breite 48, seine Dicke 8,5 cm. Die Buchstaben der Inschrift sind außerordentlich schön, sie sind regelrecht eingraviert. In den Buchstaben blieb die originale rote Färbung vollkommen unversehrt erhalten. Sie wurde - Dank der Sorgsamkeit der Restauratorin Judit Szakonyi - gleich nach der Hervorhebung des Steines fixiert. Die Höhe der Buchstaben macht 6,5-6 cm aus.
Über der Inschrift blieb ein kleines Bruchstück des einfach profilierten Rahmens erhalten, dies setzt außer Zweifel, daß die auf uns gebliebene erste Zeile auch im Originalen den Anfang der Inschrift bildete. Alle drei übrigen Seiten der Inschrift sind gebrochen. Das Material des Denkmals und die außerordentlich sorgsame Ausführung weisen darauf hin, daß wir dem Überrest einer einstmal umfangreichen, repräsentativen Tafel - aller Wahrscheinlichkeit nach einer Bauinschrift - gegenüberstehen, deren Ergänzung unsere Kenntniße in Bezug auf die Geschichte von Savaria in mehreren Hinsichten erweitern kann.
Hinsichtlich der erhalten gebliebenen Spuren von Buchstaben, die den Bruch entlang wahrzunehmen sind, muß man Folgendem Aufmerksamkeit schenken :
1. Zeile: Aus dem letzten Buchstaben an der rechten Seite blieb ein senkrechte Hasta : B, D, E, F, H, I, K, L, M, N, P, R sind die Buchstaben, die in Rechnung kommen.
3. Zeile: Die schiefe Buchstabenhasta am Anfang der Zeile kann nur der Überrest von einem R sein : R] A.
4. Zeile: Die senkrechte Linie am Anfang der Zeile ist der Überrest von einem H, I oder N. Zusammengelesen mit dem darauffolgenden Wortbruch ergibt sich NJIANUS als plausibilste Lesung. Am Ende der Zeile sieht man die mittlere Strecke des Kreisbogens von einem С klar : DEC[ .
5. Zeile: Am Anfang der Zeile blieb der Obere Bogen von einem С klar erhalten: C]ENTON.
139
6. Zeile : Der erste Buchstabe ist der obere Kreisbogen von einem О oder Q, über ihm befindet sich eine lange, waagerechte Linie. Sie kann keineswegs mit der oberen Hasta eines T identifiziert werden, sie ist nämlich viel länger und ist auch anderswie abgeschloßen. Nach ihr sieht man den Punkt, der zur Trennung der einzelnen Wörter dient, ganz klar, dann folgt der obere Teil von einem E oder F. Der letzte Buchstabe war sicher kein T, sondern H, I, К oder L.
Die weiteren Buchstaben der Inschrift benötigen keine besondere Erklärung, die Lesung des Bruchstückes lautet folgenderweise (1. Abbildung): - - -]LSORI • Ц / ]NSIVM PO / R]A • QVAM • L • 0[ / N]IANVS • DEC[ / C]ENTON[ ] / [ ] 0 ~ Q • E ~ F I ~ K ~ L .
I.
Den Schlüßel zur Ergänzung und zugleich zur Erklärung der Inschrift gewinnen wir aus dem Personennamen, der in den 3-4. Zeilen steht. Aus dem Bruchstück der 4. Zeile
Jnianus dec[ geht nämlich klar hervor, daß es hier um einen Personennamen, den Widmer der Inschrift, einen Inhaber des Decurio- Amtes handelt. Der übrig gebliebene Teil des genannten Personennamen ermöglicht zusammen mit den Buchstaben LO[ , die vor dem Bruch der 3. Zeile stehen, eine offensichtliche Folgerung auf den Namen des von einer anderen Inschrift bereits bekannten Decurio von Savaria, L. Ocatvius M.f. Faustinianus2. Diese Ergänzung bietet obendrein eine eindeutige Möglichkeit an, die Länge der Inschrift und die Zahl der an beiden Seiten abgebrochenen Buchstaben zu bestimmen. Wenn man nämlich die vollkommen sichere Ergänzung der 1. Zeile [I. o. m. oder Iovi Depujlsori... mit diesem Personennamen vergleicht, so wird sich ergeben, daß es am Anfang der 4. Zeile nur für den Cognomen des Dedikators -[FaustiJnianus - einen Platz gibt. Dementsprechend fehlen - abhängig von dem schiefen Lauf der Bruchlinie - 6 bis 11 Buchstaben an der linken Seite der Inschrift. Die Länge der rechten Seite können wir ebenfalls durch die Vergleichung der 1. und 3. Zeile rekonstruieren. Für die Ergänzung des Namens ergeben sich nämlich zwei theoretische Möglichkeiten : man stellt ihn entweder ohne oder mit der Filiation her. In der 1. Zeile soll dafür nach dem Götternamen nichts Anderes gestanden haben als die am Anfang der 2. Zeile angeführte Formel [pro salute], die sich auf / ] nsium bezog. Sie durfte sich theoretisch ebenfalls auf zweierlei Art und Weise erhalten, und zwar ganz ausgeschrieben oder in der Form [pro sal] gekürzt. Für die Ergänzung in der ganz ausgeschriebenen Form sprechen folgende Argumente: (1.) Der Name des Decurio wurde auch an der anderen bekannten Tafel mit Filiation angeführt, (2.) Die theoretisch möglichen Ergänzungen der 1., 3. und 4. Zeilen stehen miteinander nur im Falle der längeren Variation in einem fehlerlosen Einklang, (3.) Die ganze Textierung der Inschrift - so die restlose Ausschreibung des / / nsium, die Anwendung des Satzgefüges mit der Einleitung quam - bezeugt, daß der Errichter der Inschrift an keinem Raum sparte. So kann man die rechte Seite der 1. Zeile in der Form p[ro salute], den Personennamen der 3. Zeile mit Filiation ergänzt ablesen, wobei man mit 8 bis 13 verlorengegangenen Buchstaben an der rechten Seite der Inschrift rechnen muß. Daher kann man die senkrechte Mittellinie der Inschrift zwischen den Buchstaben R und I der ersten Zeile anziehen und die Länge der einzelnen Zeilen des Textes - abhängig von der unterschiedlichen Breite der Räume zwischen den Wörtern und der der einzelnen Buchstaben - in 21 bis 25 Buchstaben angeben.
141
Aufgrund obiger Gedankenfolge kann man es mit der Rekonstruierung der Inschrift nach folgenden Überlegungen versuchen :
1. Zeile: [I. o. m. Depujlsoripfro salute]. 2. Zeile: Zur Ergänzung des am Anfang der Zeile stehenden Wortes Jnsium
ergeben sich zwei Möglichkeiten. Außer dem offensichtlichen [SavarieJnsium (7 zugeschriebene Buchstaben) muß man auch die mögliche Auflösung [templeJnsium (6 zugeschriebene Buchstaben) in Betracht ziehen, wobei Letztere als Analogie zu einer Inschrift aus Gorsium3 aufgefaßt wird. Die letzte Lösung kann dadurch begründet werden, daß Savaria ebenso ein Zentrum des provinziellen Kaiserkultes in Pannónia superior war wie Gorsium, in Pannónia inferior ferner, daß L. Octavius Faustinianus an der Gipfel seiner Karriere ähnlich zu dem Widmer der Inschrift aus Gorsium die Würde des Oberpriesters der Provinz trug.4
Der Wortbruch poj J an der rechten Seite der 2. Zeile kann nur aufgrund der Annahme ergänzt werden, daß an dieser Stelle der in der Inschrift benannte Bau, der Gegenstand der Gabe bezeichnet werden mußte. Der hier gestandene Ausdruck soll weiblichen Geschlechts gewesen sein („quam") und aus mehreren Wörtern bestanden haben, denn am Anfang der 3. Zeile fehlen viele Buchstaben. In diesem Zusammenhang kann man auch den Bruch der 3. Zeile r[a vor quam, der der Nominativ oder Ablativ einer Feminina sein muß, nicht außer Acht laßen. (Der neutrale Nominativ oder Ablativ in Plural mit der selben Endung -a kann wegen der Singular von quam keineswegs in Rechnung kommen.) Wegen des Akkusativs von quam denkt man an dieser Stelle an keinen Nominativ. So kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen zusammengesetzten Ausdruck schließen, dessen zweites Glied eine Feminina in Ablativ war, die sich sicherlich durch cum an den bevorstehenden Nomen in Akkusativ band. In dieser Form heilßt es: ...poJ...(a с с.) ... cum ... (a b 1.) ...rja, quam... Inhaltlich soll der zu ergänzende Ausdruck am wahrscheinlichsten verschiedene Bestandteile eines Gebäudes bezeichnet haben. Der hier folgende Ergänzungsvorschlag entspricht dieser Bedingung: .. .pojrticum cum / exedrja, quam...
Die für die 3. Zeile vorgeschlagene Ergänzung [exedrja ist natürlich nur vom provisorischen Charakter. (Sie ist nach der Buchstabenzahl nicht ganz geeignet.) Ihr liegt auf alle Fälle die Überlegung zugrunde, daß die weich gebogene Buchstaben hasta vor dem A nichts Anderes sein kann, als die schiefe Hasta von einem R. Demzufolge hat man außer dieser Schlußfolgerung auch andere Ausdrücke, jeweils im gleichen Sinne - z. B. [cum hac arja, usw. - in Betracht zu ziehen.
Die erste Hälfte der 4. Zeile wird durch den Cognomen [FaustiJnianus ausgefüllt. Am Ende der Zeile fängt die Aufzählung der ämtlichen Titel an. An den heute bekannten Inschriften der Decurionen von Savaria5 ist der Stadtname in allen möglichen Formen gekürzt, so können wir auch in diesem Falle kein eindeutiges Muster empfehlen. Der Ergänzung liegt die Überlegung zugrunde, daß der Amtstitel in Bezug auf das in der nächsten Zeile angeführte Collegium wegen Verteilung der Buchstabenräume nur zum Schluß der Zeile gelegt werden konnte. Diese Würde konnte im Falle eines Decurio nur entweder praefectus oder aber patrónus sein und die Benennung soll an der Inschrift unbedingt in einer gekürzten Form als praef. bzw. patr. gestanden haben. Dementsprechend kann die Bezeichnung des Decurionats in der 4. Zeile als dec(urio) fc(oloniae) Cl(audiae) S(avariensium)] (4 zugeschriebene Buchstaben) oder als dec(urio) [c(olo-niae) C(laudiae) Sav(ariensium)] (5 zugeschriebene Buchstaben) hergestellt werden.6
Am Anfang der 5. Zeile stand - dies folgt aus dem Bruche in der Mitte der Zeile с Jenton - , die in Savaria von mehreren Inschriften bekannte Bezeichnung7 collegium
fabrum et centonariorum, jeweils wahrscheinlich in der Form [coll(egium) fahr (um)] centon(ariorum). Zwischen den beiden Elementen des Namens des Collegiums gibt es
142
keinen Platz für das Bindewort 'et', dies stimmt aber mit der Tatsache überein, daß das Bindewort in Savaria bei keinen anderen Erwähnungen der betroffenen Körperschaft angewandt wurde8, so kann man davon auch hier berechtigt absehen. In der zweiten Hälfte der Zeile setzte sich die Aufzählung der Ämter fort. Dessen können wir sicher sein, denn die eindeutige Abkürzung des Wortes q(uin)q(uennalis), die die Ämterliste abschloß, ist noch in der Mitte der folgenden Zeile zu lesen, demzufolge soll den Text von der Benennung des Decurionates in der 4. Zeile bis zur oben erwähnten Abkürzung in der Mitte der 6. Zeile ausschließlich die Aufzählung einzelner Stationen der munizipalen Karriere ausgefüllt haben. Die Ergänzung steht an dieser Stelle nur inhaltlich fest, in Einzelheiten entbehrt sie jeder konkreten Anhaltspunkte. So kann man allein auf die Logik verwiesen - auch den Anfang der 6. Zeile mit in Rechnung gezogen - nur an die Aufzählung verschiedener munizipalen Ämter und Würden - questor bzw. questoricius, aedilis bzw. aedilicius, Hvir iure dicundo, Ilvir quinquennalis - denken9.
Am Anfang der 6. Zeile setzte sich die Aufzählung dieser Würden fort. Zum Anhaltspunkte dient eine charakteristische Abkürzung, die in der Mitte der Zeile erhalten blieb : die waagerechte Linie mit dem gebogenen Abschluß über dem Q durfte nur die Abkürzung des Wortes q(uin)q(uennalis) darstellen10, und zwar in der Form [... Hvir q(uin)] q(uennalis).
Die Ämterliste der 5-6. Zeilen kann infolge der vorgetragenen Argumentation nur in den zunächst zu beschreibenden Formen vorgestellt werden :
- fquaest(oricius) aed(ilicius) / Hvir iure die (undo) q(uin)] q(uennalis), - [quaesi(oricius) aedilicius Hvir q(uin)] q(uennalis), - [aedilicius / Hvir i(ure) d(icundo) Hvir q(uin)] q(uennalis), - fquaest(oricius) aed(ilicius) / Hvir i(ure) d(icundo) Ilvir q(uin)] q(uennalis). Von den vier Möglichkeiten ist die letzte Variante von größter Wahrscheinlichkeit :
sie zählt die Stationen der Munizipalkarriere vollzählig auf. Die höchste Stufe der Munizipalkarriere bedeutete die Besetzung irgendwelcher
Würde eines Stadtpriesters. Der Überrest von den zwei Buchstaben nach der Abkürzung QQ kann am plausibilsten als Anfang des Wortes fl[amen] oder flfaminiciusj aufgefaßt werden. Zur Ergänzung des übrigen Teiles der Zeile bieten sich mehrere Möglichkeiten, darunter scheinen die Lösungen flfamen coloniae] oder vielleicht flfamen divi Cl(au~ diiJJ11 meist akzeptabel zu sein.
Soviel können wir in aller Sicherheit behaupten, daß die Inschrift damit nicht beendet war : es fehlt der Abschluß des mit quam beginnenden Satzgefüges der 2. Zeile, das sich auf den Bau (die Herstellung) bezog. Wieviel Zeilen am unteren Teil der Inschrift fehlen, kann man nicht einmal raten, da die Mannigfaltigkeit der Bauinschriften sowohl eine rechteckige als auch eine quadrale Form der Tafel leicht vorstellbar macht.
Die Ergänzung des erhalten gebliebenen Teiles der oben vorgestellten Inschrift lautet also folgenderweise (2. Abbildung):
[I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Depujlsoripfro salute j Savariejnsium pofrticum cum I ?exedr]a quam L(ucius) Ofctavius M(arci) f(ilius) / FaustiJnianus dec(urio) [c(oloni-ae) C(laudiae) Sav(ariensium) praef(ectus) oder patr(onus) / coll(egii) fabr(um) (et)] centon(ariorum) [quaest(oricius) aed(ilicius) / Hvir i(ure) d(icundo) Hvir q(uin)] q(uennalis) flfamen oder -am(inicius) coloniae oder divi Claud(ii)] [ ( .
144
II.
Der Name und der Lebenslauf des Decurio von Savaria, der an der nun vorgestellten Inschrift eine Rolle spielt, waren aufgrund anderer Denkmäler auch bis jetzt bekannt. Die repräsentative Basis von Carnuntum, die die späteren Phasen der Laufbahn von Faustinianus kundgab, wurde das erste Mal im Jahre 1960 von A. Betz publiziert12. Im Späteren beschäftigten sich H. G. Kolbe13, G. Alföldy14 und L. Balla15 mit diesem Denkmal ausführlich. Die sich aus der Inschrift ergebenen Probleme wurden auch von A. Mócsy und E. Swoboda16 kurz behandelt. Die Inschrift von Carnuntum wurde am 13. August 219 am Postament einer Geniusstatue erstellt, die Faustinianus dem collegium fabrum zu Carnuntum schenkte. Die Person des Donators erscheint in dieser Inschrift bereits als Decurio von Savaria und Carnuntum, Mitglied des Ritterordens (equo publico), sowie als ehemaliger Oberpriester des Kaiserkultes in Pannónia ( sacerdotalis p. P. S.). Die Inschrift zählt auch die einzelnen Stationen der militia equestris von Faustinianus auf17.
Die Inschrift an der Basis von Carnuntum ließ den Familiennamen von Faustinianus unbestimmt: A. Betz und H. G. Kolbe lösten die brüchigen Buchstaben nicht auf18, G. Alföldy schlug die Lesung [L. OJct(avius) M(arci) f(ilius) vor, die auch von L. Balla akzeptiert wurde. Die hier angeführte Inschrift von Savaria spricht in der Hinsicht gänzlich für diese Ergänzung.
G. Alföldy war es, der den Widmer der Inschrift von Carnuntum mit dem anonymen Widmer eines lange bekannten Bruchstückes von Savaria19 in Zusammenhang brachte: und zwar auf der Grundlage, daß auch diese letztere Inschrift eine Person ritterlichen Standes, einen Oberpriester des provinziellen Kaiserkultes erwähnt, jemanden, der zur gleichen Zeit Decurio von Carnuntum und wahrscheinlich auch von Savaria war. (3. Abbildung.) Diese Identifizierung nahm L. Balla an, während A. Mócsy Vorbehalte machte20. Unseres Erachtens ist die Ergänzung von G. Alföldy wegen der auffallenden Übereinstimmung der Titel und ihrer Reihefolge als vollkommen begründet zu betrachten. Dazu kommt noch die enge Verwandtschaft der Buchstabentypen des jetzt vorgestellten Bruchstückes mit denen des anderen Bruchstückes. Daher kann der Widmer des Inschriftbruchstückes von Savaria unter RIU. Nr. 71. fast ganz sicher mit dem Dedikant der Basis von Carnuntum und der jetzt vorgestellten Inschrift von Savaria, mit L. Octavius M. f. Faustinianus identifiziert werden. An dem Denkmal von Savaria unter RIU. Nr. 71. sind die Würden des Inschriftenwidmers die Folgenden: [dec(urio) col(oniae) Cla(udiae)] S(avariensium) dec(urio) [col(oniae) Sept(imiae)] Kam (unten-sium) [equo pjublic(o) [sac(erdos) arjae Auggfustorum duorum) fprovincjiae P(anno-niae) S(uperiroris).21 Dementsprechend kam dieses Denkmal etwas früher als die Basis von von Carnuntum zustande, da der Dedikant der Inschrift hier noch als aktiver Oberpriester der Provinz erwähnt wird und natürlich auch die Aufzählung der Stationen der militia equestris fehlt. Die Erwähnung von den beiden Augusten läßt das Bruchstück von Savaria auf die Zeit der gemeinsamen Herrschaft von Septimius Severus und Caracalla von 198 bis 211 datieren.22
Aufgrund der im Früheren erörterten Fakten waren die heute bekannten drei Inschriften von L. Octavius Faustinianus in der folgenden Reihefolge aufgestellt worden :
/ (ovi) о (ptimo) m(aximo) Depujlsori pfro salute / Savariejnsium pofrticum cum I ?exedr]aquamL (ucius) OfctaviusM (arci) f(ilius) / FaustiJnianus dec(urio) [c(oloni-ae) C(laudiae) Sav(ariensium) praef(ectus) vagy patr(onus) / Ilvir i(ure) d(icundo) Ilvir q(uin)] q(uennalis) fl[amen vagy-am( inicius ) coloniae vagy divi Claud(ii)] [ .]
Die Erste war die jetzt vorgestellte Bautafel. Nach ihr ordnete Faustinianus, der bereits alle Stufen der Munizipalkarriere (omnibus honoribus functus) begangen war, in
145
der Eigenschaft des Decurio von Savaria und als Träger der offiziellen Würde des Stadtpriesters, ferner als praefectus (oder patrónus) des collegium fabrum et centonario-rum Bauarbeiten in der Stadt an. Das von ihm finanzierte gewaltige Bauwerk - zu ihm gehörten eine Säulenhalle und wahrscheinlich auch ein Ratsaal (?) an -, kann man sich mit größter Wahrscheinlichkeit als den Sitz des Collegiums vorstellen, der im südlichen, in der Severus-Zeit ausgebauten neuen Stadtteil23 von Savaria, in der Nähe des Iseums24
und der daran angelegten weiteren Tempel25 stand. Nach übereinstimmender Aussage anderer Denkmäler beherbergte dieses Stadtviertel am Ende des 2. und am Anfang des 3. Jahrhunderts die Gebäude der römischen Stadt, die wir auch heute noch für die representativsten halten: die munera der städtischen Decurionen wurden regelmäßig in dieser Region errichtet. Selbst Faustinianus erstellte seine beiden Inschriften von Savaria in diesem Stadtviertel26.
Der oben analysierte Überrest der Inschrift ergibt keinen Anhaltspunkt für die weiteren Stationen der Karriere von Faustinianus, aber die ausführliche Bekanntgabe seiner Stadtämter in Savaria, ferner das Ausbleiben der Erwähnung des Decurionates in Carnuntum weisen darauf hin, daß der Decurio damals noch kaum imstande war, nach seinem Namen den in Pannónia verhältnißmäßig so selten gebrauchten Titel equo publico in den Stein einmeißeln zu lassen.
Die Inschrift wurde höchstwahrscheinlich in der ersten Hälfte der 90er Jahre des 2. Jahrhunderts - unbedingt vor 19427 - erstellt.
Als Zweites entstand von 198 bis 211 das lange bekannte Bruchstück von Savaria (RIU. Nr. 71.). An ihm spielt Octavius Faustinianus als Decurio von bereits zwei Städten, Savaria und Carnuntum, sowie als Mitglied des ordo equester und als amtierender Oberpriester der Provinz eine Rolle. Da die dafür Erkorenen letztere Würde nur ein Jahr lang trugen28, bezeugt die Inschrift im Falle von Faustinianus, daß er erst nach der Erhaltung des Decurionates von Carnuntum, sowie nach der Aufnahme des Titels equo publico zum sacerdotium der Provinz erhoben wurde.29
In der Eigenschaft des amtierenden Oberpriesters leistete er - ähnlich zu seinen Amtskollegen30 - wieder einmal eine bedeutende Gabe für Savaria. Das erhalten gebliebene Bruchstück der Inschrift sagt davon zwar nichts aus, doch das Äußere und der im Originalen wahrscheinlich großer Ausmaß des Denkmals31 lassen auf eine repräsentative Bau- oder Schenkinschrift folgern. Der Fundort der Inschrift weist darauf hin, daß der Gegenstand der Gabe diesmal ein Tempel oder ein anderes kultisches Gebäude (bzw. irgendwelche Zugehörigkeit dessen) gewesen sein soll: der Fundort in der heutigen Thököly Straße18 (Lange Straße 100.) befindet sich nämlich in der unmittelbaren Nähe des Iseums32. Mit welchem Tempel dieser Gegend die Inschrift in Zusammenhang zu bringen ist33, besagt keine Angabe.
Als Dritte wurde man die Statuenbasis von Carnuntum im Jahre 219 aufgestellt. Zu dieser Zeit wußte Faustinianus nicht nur alle Stufen der amtlichen Karriere, die in einer Provinz überhaupt zugänglich waren, sondern auch die Stationen des für die neuen Mitglieder des Ritterordens des römischen Reiches vorgeschriebenen militärischen Dienstes hinter sich. Er zog sich als militärischer Befehlshaber ritterlichen Standes - er sprang eine formale Stufe der très militiae einfach hinüber34, von dem kommandierenden Posten einer ala milliaria35 in der Hauptstadt der oberpannonischen Provinz in Ruhestand zurück.
Die heute bekannten drei Inschriften entstanden also im Laufe von etwa drei Jahrzehnten, und wir sind in der Lage, mit der Hilfe der aus ihnen gewonnenen Angaben den Ablauf einer keineswegs alltäglichen Karriere in Pannónia aufzuzeichen.
Die zeitgemäß sicheren Anhaltspunkte im Lebenslauf von L. Octavius Faustinianus sind die Folgenden:
146
Um 180 wurde er zum Mitglied des ordo von Savaria. (Dies folgt daraus, daß er vor 194 bereits alle Amtsstufen der städtischen Karriere beging, dabei trug er wahrscheinlich sogar zweimal die alle fünf Jahre zu besitzende Würde des quinquennalis, zuvor betätigte er sich auch als Questor und Aedilis.)
194 oder etwas später36 wurde er zum Mitglied des ordo von Carnuntum. Nach 198 wurde er in das ordo equester aufgenommen. Vor 211 war er sacerdos arae Augg. provinciáé Pannóniáé Superioris. Nach 212 beging er alle drei Dienststufen der ritterlichen Karriere (militia eque-
stris) : tribunus militum legionis XIII Geminae Antoninianae, tribunus cohortis II Mattiacorum milliariae equitate, praefectus alae Hamiorum I Surorum milliariae.
219 lebte er schon vom amtlichen Dienst zurückgezogen in Carnuntum. Aufgrund oben angeführter Angaben können wir versuchen, den Hintergrund
dieser Karriere - jeweils mit Einschaltung von zahlreichen Folgerungen - in der Form einer Biographie zu entwerfen.
III.
Man konnte sich im Allgemeinen erst nach einem Lebensalter von 25 Jahren zum Decurio erheben,.wenn Rechtstellung und begüterte Lage Einen dafür gleicherweise geeignet machten37. Davon ausgehend können wir die Geburtszeit von L. Octavius Faustinianus um 155-160 annehmen. Sein Geburtsort mag sogar Savaria gewesen sein38, aber es scheint noch wahrscheinlicher, daß er oder seine Familie aus Poetovio in diese Stadt kam. Diese Annahme wird von der Dedikation der geradezu vorgestellten Inschrift unterstützt : der Kult von Iuppiter Depulsor war nämlich ganz spezifisch in den religiösen Leben von Poetovio und seiner Umgebung verbreitet39. Unter den religiösen Verhältni-ßen der Kaiserzeit war ziemlich gewöhnlich, daß man von der Heimat entfernt beim gegebenen Anlaß der lokalen Gottheit des verlassenen Geburtsortes eine Inschrift widmete40. Der Familienname Octavius war sowohl in den 1-2. Jahrhunderten als auch in der Severerzeit in erster Linie in Südpannonia und die Bernsteinstraße entlang verbreitet41. Laut Feststellungen der familiengeschichtlichen Forschung waren die Träger dieses Namens hauptsächlich Abkömmlinge von Familien italienischer, dalmatischer und südgallischer Herkunft42. Die großen Markomannenkriege verursachten auch in der Bevölkerung von Savaria bedeutende Menschenverluste43, und nach den Kriegen - d. h. in den 80er Jahren des 2. Jahrhunderts - kamen Träger neuer, charakteristisch italienischer Namen in einer höheren Zahl in der zum Teil unbevölkerten Stadt an44. (Diesen Charakters ist auch der Name Octavius.) Die neuen Einsiedler stammten sicherlich nicht unmittelbar aus Italien, sie schieden sich wohl aus der Bevölkerung der Städte an der südlichen Strecke der Bernsteinstraße - so unter Anderem aus Poetovio - aus. Zu ihnen soll auch Faustinianus gehört haben.
Der in Savaria angekommene junge Mann stammte ohne Zweifel aus einer begüterten Familie, sonst hätte er kaum fast sofort nach der Umsiedlung unter die Mitglieder des ordo decurionum gelangen können. Seine spätere Laufbahn zeugt nicht nur von einer begüterten Lage, sondern auch von einer hohen Stufe persönlicher Ambitionen und Aktivität. So ist kein Wunder, daß er die Stufen der amtlichen Karriere im öffentlichen Leben der Kleinstadt, die sich nach den Kriegen nur langsam erholte45, schnell bestieg. Seine ganze Laufbahn bezeugt, daß er besonders in Wirtschafts- und Handelsbereichen tätig war : in ordo betätigte er sich als Quaestor und Aedilis - er stand also für die Wirtschaftsangelegenheiten und die Versorgung der Stadt zu -, dabei war er Vorsitzender
147
des einzigen heute bekannten Handwerkervereines der Stadt, des collegium fabrum et centonariorum. Wirtschaftlichen und politischen Leitern diesen Typs hatte Savaria zu verdanken, daß es sein Wirtschaftsleben - wenn auch im minderen Umfang - nach der Trauma der Kriegsjahre herstellen konnte. Aber auch die Rekonstruktionen, sowie der Bau von neuen kultischen und öffentlichen Gebäuden waren den Vertretern dieser Schicht zu verdanken.
Die erste Inschrift des Faustinianus, die er für das Heil der ganzen Stadtbevölkerung (pro salute Savariensium) Juppiter Depulsor widmete, legt die beiden Stützpfeiler der Positionen des Stadtvorstehers, der zur Zeit der Erstellung der Inschrift ungefähr 35 Jahre alt war und sich bereits zu den angesehensten Männern des Ortes zählte, klar auf: die ihn im Besitz bedeutenden Gutes entlassene Vaterstadt und die aus eigenen Kräften eroberte Gesellschaft von Savaria. Faustinianus war ein „self made man" im echten Sinne des Wortes, der die Zinsen der Familienerbe im öffentlichen Leben genoß.
Es ist eine charakteristische und zugleich aus dem Gesichtspunkte seiner späteren Laufbahn wesentliche Angabe, daß Faustinianus schon damals ein Vorsteher des Handwerkervereines von Savaria war. Diese Funktion war nehr als ein einfacher Ehrenauftrag, denn Faustinianus schenkte am Ende seines Lebens auch die Geniusstatue auf der Basis von Carnuntum dem örtlichen collegium fabrum. Die lange Jahre anhaltende Verbindung, die Faustinianus zu den Handwerkervereinen der westpannonischen Städte hatte, war sicherlich von geschäftlicher Natur, mag sowohl darin bestanden haben, wie es L. Balla aufwarf46, daß Faustinianus auf dem ager von Savaria größere Wälder besaß, aus denen er den Holz Handwerkern lieferte, die - Zimmerer, Tischler, Faßbinder, Wagner - harten Stoff bearbeiteten, Doch das Wesen des Verhältnißes konnte sogar darin bestehen, daß es von Anfang an in der Sphäre des Zwischenhandels bewog, was in der ersten Linie durch das Vorhandensein des doppelten Decurionates begründet zu sein scheint.47 Die beiden Tätigkeiten bildeten wahrscheinlich zusammen die Grundlage des Kontaktes zwischen Faustinianus und den Handwerkern, Faustinianus, der sich in allen drei bedeutenden Zentren der Bernsteinstraße - Poetovio, Savaria, Carnuntum -wie zu Hause bewand, soll sein Gut unter weitverbreiteten Immobilien und beweglichem Handelskapital aufgeteilt haben48.
Nachdem Faustinianus die Bahn in Savaria belaufen hatte, die ein Decurio in einer Kleinstadt überhaupt belaufen kann, - er hatte die Würde des Oberpriesters der Stadt erreicht -, erwarb er sich auch noch die Aufnahme in das or do von Carnuntum. Die verdoppelte Würde mit doppelten Verpflichtungen konnte nur Einen anziehen, dem die Geschäftsbeteiligungen in beiden erwähnten Städten bedeutenden Gewinn brachten und der von dem zweiten Decurionat einen weiteren Aufstieg im öffentlichen Leben und dadurch eine erneute Erweiterung des geschäftlichen Gewinns erwarten konnte.
Doch der Decurionat in Carnuntum macht auch etwas Anderes klar. Faustinianus war voller Ambitionen. Er wurde in das ordo von Carnuntum aufgenommen als die Stadt, die ehemals den Kaiser Septimius Severus auf seinen Weg entließ, von dem gewesenen Statthalter den Rang einer Colonia erhielt. Faustinianus war eigentlich kein Stadtbürger von Carnuntum49, so mußte der Erhaltung der Würde in der privilegierten Stadt vorgehen, daß er seine Treue zum Septimius Severus, der zum Herrscher erhoben worden war, in irgendeiner Form schon erwiesen hatte : sei es unmittelbar im Statthalterpalast zu Carnuntum geschehen oder auf eine mittelbare Weise, die Faustinianus als ehemaligem flamen des Kaiserkultes in Savaria zugänglich war.
Zu ähnlichen, die Treue zum Kaiser beweisenden Gesten mußte er auch im Späteren Anläße haben, denn die neuen Mitglieder des ordo equestris wurden nicht einfach aufgrund des Güterzensus ernannt50, sondern es fielen dabei auch die Loyalität und Zuverläßigkeit der Erwählten zur neuen Dynastie ins Gewicht. Faustinianus soll 40—45
148
Jahre alt gewesen sein als er in den zweiten Stand der Reichsaristokratie aufgenommen wurde, wodurch sich auch die Bahn zur militärischen Karriere eines Oberoffiziers vor ihm eröffnete. Er machte sich doch nicht gleich daran, die Stufen der très militiae zu besteigen, um sich zu den Machthabern des ganzen Reiches zu erheben. Zuvor hatte er noch ein Jahr lang die höchste öffentliche Würde von Pannónia Superior erfüllt : er war zum sacerdos arae Augustorum worden, der in dieser Eigenschaft seinen Sitz wieder einmal in Savaria gehalten und auch den Posten des Vorsitzenden der Provinzversammlung innhatte. Ihm wurden alle Äußerlichkeiten der Macht zuteil : er trug eine purpurgeränderte Toga wie die Senatoren - auf der Straße begleiteten ihn Lictoren, wie es einem Consulen galt - , im Amphitheatrum war er Ehrenvorsitzender der Spiele und verfügte über Leben und Tod. Die hohe Würde bedeutete aber nicht nur glänzende Äußerlichkeiten. Als Vorsitzender der Provinzversammlung war er tagtäglich im Statthalterpalast bewandt, er schrieb und erhielt Berichte über die Reichsidee - die Angelegenheiten der Kaiserehre -, und in Ausnahmefällen war er sogar berechtigt, sich unmittelbar an den Kaiser zu wenden. Dasselbe galt für den Fall, wenn immer der Statthalter Mißbräuche und Regelwidrigkeiten beging51.
Wir wißen es nicht genau, wieviel Zeit von der Einfüllung der Oberpriesterwürde bis zum Beginn der militärischen Karriere vorbeiging. Es dauerte sicherlich nicht zu lange. Nach 212 finden wir Faustinianus bereits außerhalb der Provinz. Er diente als Tribunus einer Legion im benachbarten Dacia, seine Einheit, die legio XIII Gemina war in Apulum stationiert, später führte er einen Cohors aus tausend Mann in der Provinz Moesia Inferior an der Küste des Schwarzen Meeres. Sein dritter Dienstort lag in Nord -Afrika, wo er schon am Spitze einer ala milliaria stand. - Nachher kehrte er am Ende des Jahrzehnten als bejahrter, erfahrener, weltgereister Mann nach Pannónia zurück. Sein Gut in den Städten der Bernsteinstraße, das in seiner Abwesenheit von Freigelassenen behandelt worden war, hatte sich während der Jahre des Militärdienstes wahrscheinlich nur noch vermehrt wie auch er selbst zu neuen, auch geschäftlich nützlichen Verbindungen gelangt hatte. Nach der Rückkehr siedelte er wahrscheinlich endgültig in Carnuntum, der Hauptstadt von der oberen Pannónia ab. Nach dem Ablauf eines so aktiven Lebens entsprach diese Stadt dem 60-65 Jährigen aus mehreren Gesichtspunkten viel mehr als das damals wieder hinuntergesunkene Savaria54, oder das noch in der Kinderzeit verlaßene und nicht minder Sympthome eines wirtschaftlichen Rückganges aufweisende Poetovio55. Carnuntum erspürte die Krise weniger, hier wirkte noch die Konjunktur, die in der Severerzeit aus den vermehrten Einkünften der Armee entstand56, hier konnte also Faustinianus zu seinen bewährten Geschäften zurückkehren. Als römischer Ritter konnte er nach einer militärischer Laufbahn - im gesamten Reiche zählte sie sich keineswegs zu den Seltenheiten - , die höchste gesellschaftliche Anerkennung in Pannónia genießen. Hier verlieh ihm auch der Ritterstand eine höhere Prestige und als ehemaliger Oberpriester der Provinz fand er sicherlich auf keinen Konkurrenten. Er nutzte wohl die Vorteile, die sich aus seinem Range ergaben : er nahm an den Sitzungen des concilium provinciáé, sowie an den feierlichen Zeremonien des Kaiserkultes teil; er schloß sich der Arbeit der Decurio-Körperschaft zu, entschied über öffentliche Bauarbeiten und Personenfragen. Seine Meinung nahm auch das officium der Statthalterei in Betracht, seine hohe Position ermöglichte, daß er in allen gemeinnützigen Fragen Meinung äußern und im Notfalle Stellung nehmen konnte. Die Handwerker der beiden Städte - zu den er so weitreichende Verbindungen hatte - , betrachteten ihn gewiß nicht als bloßen Geschäftspartner, sondern als eine Persönlichkeit, die himmelhoch über ihnen steht und von der man die Lösung vieler Fragen vom allgemeinen Interesse erhoffen konnte. Die Inschrift an der Rückseite der Basis von Carnuntum57 weist darauf hin, daß die Leitung des Handwerkercollegiums mit dem praefectus an der Spitze bestrebt war,
149
ihren Rang und ihre Prestige dadurch zu erheben, daß sie mit einer Persönlichkeit wie Faustinianus vor dem kürzlich inaugurierten Kaiser - Elegabalus - huldigte. Daran war wirklich nicht Faustinianus schuld gewesen, daß die ihm Jahrzehnte lang eigen gewordene Treue zum jeweiligen Kaiser, ihn diesmal zu einer unwürdigen Person verleitet hatte, dessen Namen einige Jahre später Soldaten von den Inschriften abmeißelten, wobei auch die Basis de Genius Sitz der Handwerker von Carnuntum schwer verletzt wurde.
Nach dem August des Jahres 219 verlieren wir den Faden dieser außerordentlichen Laufbahn in Pannónia endgültig. Soll Faustinianus wirklich um 155-160 geboren sein - er war zur Zeit der Erstellung der Basis von Carnuntum 60-65 Jahre alt - , so konnte er die Konjunktur der Städte an der Limes von Pannónia noch ein gut Jahrzehnt genießen, selbst, wenn diese Konjunktur vom Jahr zu Jahr immer mehr sichere Symptome des Unterganges zeigte. Soll er dafür ein außergewöhnlich hohes Alter erlebt haben, so mußte er als Greise am Ende seiner achtziger Jahre auch noch den großen Zusammenbruch, den Sturz des letzten Severus und demzufolge die rasche Auflösung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens der Städte von Pannónia, darunter auch die von Savaria und Carnuntum wahrnehmen.
Sein Los und Lebenslauf, die sich schon im Aufstieg an die Geschichte dieser Provinz knüpften, hörten zum Schluß der von außerordentlichen Umständen bestimmten Blütezeit von Pannónia auf, zu einer Zeit also, wo auch in der Geschichte von Pannónia eine ganze Epoche zu Ende ging und die Anarchie begann.
ANMERKUNGEN
1. Ich soll auch an dieser Stelle meinen Dank für die Überlassung des Publikationsrechtes, sowie für die Angaben in Bezug auf die Fundumstände und für die vielseitige, freundliche Hilfe zu meiner Arbeit Magdolna Medgyes ausdrücken.
2. A. Betz, Carnuntum Jb. 6 (1960) 29 ff.; Ders., Ebd. 7 (1961-1962) 86 ff. - Die richtige Lesung des Namens: G. Alföldy, Listy Filologické 88 (1964) 265 ff.; An. ép. 1966. 268.
3. J. Fitz, Acta Arch. Hung. 24 (1972) 41. Nr. 5. 4. A. Betz, а. а. О.; H. G. Kolbe, Carnuntum Jb. 8 (1963-1964) 48 FF. 5. Zusammenfassend: L. Balla, in: Die römischen Steindenkmäler von Savaria. Hrsg.: A. Mo-
csy-T. Szentléleky. Budapest 1971. 23 ff. 6. RIU 14: Dec. с. С. Sfav.J, 39: dec. с. С. Savar., 66: dec. с. С. S., \36:decurio col. Claud. Savar.,
139: dec. col. [Cl. Sajvar., A. Barb, Burgenl. Heimatbl. 22 (1960) 166 f.: d. с Cl. - Vgl. noch RIU 71, dazu: G. Alföldy, а. а. О.
7. RIU 118, 139. 8. RIU 139: pr(a)ef. coll. fahr. cent. - Die Inschrift ist intakt das Bindewort 'et' fehlt aus dem
Text. RIU 118: collegifi] fabrorum [et?] centonar[i]or. - Die Ergänzung ist nicht unbedingt notwendig.
9. Vgl. z. В.: RIU 14, 20, 136, 139 usw. 10. RIU 20 mit ähnlicher Ligatur. 11. RIU 20: flamen divi Cl(audii) (Savaria), CIL III 10 347 (=3362): flamini co(loniae) (Vereb),
vgl. noch: CIL III 3368, 10 496 ( = 6452), 14 3593, 15 1881, K. Pöczy, Arch. Ert. 99 (1972) 29. usw.
12. A. Betz, a. a. O. (Anm. 2.), Ders., Fasti Arch. 17. (1962) 6827. 13. H. G. Kolbe, a. a. O.; A. Betz, Fasti Arch. 18-19 (1963-1964) 10 939. 14. G. Alföldy, a. a. O. 265 ff; An. ép. 1966. 268. 15. L. Balla, Ant. Tan. 12 (1965) 264 ff.; Ders., Acta Class. Univ. Scient. Debrecen. 3 (1967) 89
ff.
150
16. A. Mócsy, Acta Arch. Hung. 21 (1969) 367.; E. Swoboda, Carnuntum. Seine Geschichte und seine Denkmäler.4 Graz-Köln 1964. 123 ff. - Neuerdings: J. Fitz, Das Jahrhundert der Pannonier. (Hereditas) Budapest 1982. 31.
17. Vgl. Kolbe, a. a. O.: ...trib. mil. leg. XIIIG. Ant., trib. coh. IIMattiacor. (milliariae) eq.,praef. alae [IJISept. Suror. (milliariae)...- Eine gute Abbildung: M.-L. Krüger, CSIR1/3, Österreich- Die Reliefs des Stadtgebietes von Carnuntums. I. Teil: Die figürlichen Reliefs. Wien 1970. Nr. 152.
18. Vgl. oben : Anm. 13-14. Ihre Lesung :.. .ALF M.f. Faustinianus. S. noch : A. Mócsy, Acta Arch. Hung. 21 (1969) 367. Anm. 288.
19. CIL III 4170.; Die röm. Steindenkmäler... 97. Nr. SO.; RIU 71. 20. L. Balla, a. a. O., A. Mócsy, а. а. О. - RIU 71. 21. G. Alföldy, a. a. О. - Dagegen s. die Ergänzungsvarianten in RIU. 22. L. Balla, а. а. O. nimmt die Datierung auf das Jahr 202 d. h. auf das Jahr des Besuches von
Septimius Severus in Pannonién an. 23. E. Tóth, Arch Ért. 98 (1971) 143 ff. 24. T. Szentléleky, in: Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt, II. Berlin 1965. 381 ff.; Ders.,
A szombathelyi Isis-szentély - Das Isis-Heiligtum von Szombathely. (Savaria romkertjei - Die Ruinengarten von Savaria. 1.) Szombathely 1965.; Ders., In: Die röm. Steindenkmäler... 40 ff. - Zur Datierung: /. Tóth, Acta Arch. Hung. 26 (1974) 165 fi.; Ders., Vasi Szle 29 (1975) 560 ff.; L. Balla, Studia Aegyptiaca 1 (1974) 1 ff.; neuerdings J. Fitz, а. а. О 22.
25. Zusammenfassend: /. Tóth, Acta Class. Univ. Scient. Debrecen. 13 (1977) 63 ff.; Ders., Juppiter Dolichenus tanulmányok. Budapest 1976. 92 ff. - mit der früheren Literatur.
26. RIU 71. Vgl.: L. Balla, in: Studia Ethnographica et Folkloristica in honorem Béla Gunda. Debrecen 1971. 471.
27. Vgl.: L. Balla, Acta Class. Univ. Scient. Debrecen. 3 (1967) 91.; Ders., Ant. Tan. 12 (1965) 266.
28. A. Alföldi, Budapest története (Die Geschichte von Budapest) 1/1. Budapest 1942. 301 f.; P. Riewald, PW-RE I/A (1920) 1653.; J. Dieninger, Die Provinziallandtage der röm. Kaiserzeit. München-Berlin 1965. passim.
29. Vgl.: Kolbe, a.a.O (Anm. 4.) 48 ff. - Ein Anderer Beispiel aus Pannonién: CIL III 10 820 (= 3936): G. D. Q. Victorinus dec. col. Sise. Ilviral. eq. Rom. sac. p. P. Sup. - Vgl. noch: CIL III 10 305.
30. Siehe: RIU 20, 21 : der Nemesis geweihte Altäre die sicherlich mit amphitheatralen Spielen zusammen hängen. RIU 39 :. . . cryptam vi ignis exustam sumptibus suis refecerunt, dazu jüngst : J. Fitz, а. а. O. 22.
31. Die heutige Maßen sind: Höhe: 85,5 Breite: 50 cm. Die ehemalige Breite sollte 120-130 cm, die Höhe konnte ehemals mindestens so viel sein.
32. T. P. Buocz, Savaria topográfiája (Die Topographie von Savaria). Szombathely о. J. [= 1968] 86.
33. L. Balla, Studia Ethnographica et Folkloristica... 471., und Studia Aegyptiaca 1 (1974) 1 f. nimmt an, daß die Inschrift mit dem Bau des Iseums in Zusammenhang gestanden habe.
34. Kolbe, a. a. O. 50. 35. ... praefectus alae II Septimiae Surorum milliariae... 36. Die Jahreszahl ist die der Rangerhöhung von Carnuntum Vgl. Swoboda, a. a. O. 120. ; L. Balla,
Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 3 (1967) 91.; Ders., Ant. Tan. 12 (1965) 266. 37. Kubier, PW-RE 4 (1901) 2319 ff. 38. L. Balla, а. а. O. 39. A. Mócsy, PW-RE Suppl. 9 (1962) 729. Ausführlich: Lj. Zotovic, Starinar IV/17 (1966) 96 ff. 40. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer.2 München 1912. 78 ff. 41. Vgl.: A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonién bis zu den Markomannenkriegen. Budapest
1959. Nr. 2/41 - Emona, 7/1 - Kamnik, 57/15 - Siscia, 64/21 - Potovio, 89/3-4 - Ondód (Umgebung von Savaria), 153/7,154/50,156/39 - Carnuntum, 187/1 -Albertfalva (Umgebung von Aquincum). Aus den späteren Zeiten: L. Barköczi, Acta Arch. Hung. 16 (1964) 328 ff. Nr. 38/47-48 - Poetovio, 78/18 - Carnuntum, 91/18 - Brigetio.
42. Mócsy, а. О. S. 157. s. v. Octavius; L. Ballá, A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Int. Évkönyve 1 (1962) 21.; Ders., in: Die röm. Steindenkmäler... 24 f.
43. A. Mócsy, Arch. Ért. 90 (1963) 17 ff.; L. Ballá, letztens a. O. 17 f. 44. Ebd. 27 ff. 45. L. Ballá, in: Die röm. Steindenkmäler... 30 f.; /. Fitz, а. а. О. 21 f. 46. S. oben Anm. 15. und J. Fitz, а. а. O. 31. 47. A. Alföldi, а. а. О. 310. 48. L. Ballá, Ant. Tan. 12 (1965) 264 ff. 49. Diese Annahme stammt von E. Swoboda, а. а. O. 123. 50. A. Mócsy, Pannónia a késői császárkorban. Budapest 1974. 50 skk. , 51. A. Alföldi, a. a. O. 302. 52. H. G. Kolbe, a. a. O. 53. Über die Libertiner in Savaria: L. Ballá, in: Die röm. Steindenkmäler... 31. 54. Ebd. 28. 55. A. Mócsy, а. а. О. 57 ff. 56. /. Fitz, а. а. О. 14 ff. 57. Ded. Imp. Anftonino Aug.J II et Sacerdote cos. X Kal. Sept. Agente praef. T. Ael. Constant,
magg. coll. Ael. Herculano et Ulp. Marcfeljlino. - Diese Inschrift wurde von einer anderen Hand gemeißelt als die Hauptinschrift. Gute Abbildungen sind in den zitierten Werken von Betz, Kolbe, Swoboda und Krüger.
L. OCT. FAUSTINIANUS ÚJABB FELIRATA SA VARIÁBÓL
A felirat-töredék 1973-ban került elő Szombathelyen, az új Városháza építését megelőző, Medgyes Magdolna által végzett leletmentés során. A lelőhely másodlagos volt: egy nagyméretű, oszlopcsarnokos épület járószintje alatti törmelékkel kitöltött gödör. A három oldalán sérült táblatöredék méretei: M: 65 cm. Sz: 48 cm. V: 8,5 cm. A rendkívül szépen vésett, élénk piros színű betűk magassága: 6-5,5 cm. (A betűkben megőrzött eredeti festés kiváló konzerválása Szakonyi Judit restaurátor érdeme.)
A töredéken a következő betűk olvashatók : ]LSORI[ / JNSIVM • PO / R]A • QVAM • L • 0[
/ ' NJIANVS • DEC[ / C]ENTON[ ] / [ ] 0 ~ Q E ~ F I ~ K ^ L [
E szótöredékek közül egyértelmű feloldást kínál az 1. sor: [I.o.m. vagy IoviDepujl-sori..., és a 4-5. sor: ... dec(urio) c(oloniae) C(laudiae) S(avariae) Ipraef(ectus) vagy patr(onus) coll(egii) fabr(um) (et) cjenton(ariorum)... - A 3-4. sorban álló személynév egy carnuntumi felirat alapján teljes bizonyossággal egészíthető ki L.Ofctavius M (arci) f(ilius) Faustijnianus nevére. - A 2. sorban álló adomány, ill. az 5-6. sorban elhelyezkedő municipiális tisztségek felsorolása csupán tartalmilag biztos, formailag több lehetőség is kínálkozik. - Bizonyos, hogy a jelenlegi állapotában a felirat erősen csonka, a 6. sor után még hosszabb hiányzó szövegrésszel kell számolni.
A fenti megfontolások alapján a felirat kiegészítése a következő : / (ovi) о (ptimo) m(aximo) Depujlsori pfro salute / Savari]nsium po[rticum cum
I ?exedr]a quam L (ucius) Ofctavius M (arci) f(ilius) / Faustijnianus dec(urio) [c(olo~ niae) C(laudiae) Sav(ariensium) praef (ectus) vagy patr( onus) / Ilvir i(ure) d(icundo) Ilvir q(uin)] q(uennalis) flfamen vagy-am(inicius) coloniae vagy divi Claud(ii)] [ .]
L. Octavius Faustinianus személyével és pályafutásával a kutatás már többször, behatóan foglalkozott: A. Betz, H. G. Kolbe, Alföldy G., Ballá L., és Fitz J. minden részletében tisztázták pannóniai viszonylatban kivételes karrierjét és e karrier hátterében álló gazdasági, társadalmi és vallástörténeti motívumokat. A jelen felirat pályafutásának kezdetéhez ill. „életrajzának" körvonalazásához szolgáltat adatokat.
152
A dolgozatban elfogadtuk Alföldy G. és Ballá L. feltevését, mely szerint a RIU 71. sz. Savariabol származó töredék állítója ugyancsak L. Octavianus Faustinianus lehetett.
A három felirat egybevetése alapján meghatározhatók voltak Faustinianus karrierjének biztosan ismert (ill. biztosan kikövetkeztethető) kronológiai támpontjai 180 és 219 között. Eszerint:
180 körül a savariai ordo tagja, 194 táján a carnuntumi ordo tagja, 198 után az ordo equester tagja, 211 előtt tartományi főpap, 212 után befutja a trés ill. quattuor militiae állomásait, 219-ben a hivatali pályától visszavonulva Carnuntumban él. Ezek mellé az adatok mellé járul a most bemutatott felirat alapján az az erősen
valószínű következtetés, amely szerint Faustinianus szülővárosa Poetovio lehetett : Iup-piter Depulsor lokális kultusza ugyanis kizárólag e város körzetére jellemző Pannoniában.
A dolgozat III. része kísérletet tesz L. Octavianus Faustinianus életútjának nyomon kísérésére, Poetoviotól, Savarián keresztül Carnuntumig.
153