EliJahu Katz - Mittelalterliche Hebraische Handschriftenfragmente Aus Bratislava
Transcript of EliJahu Katz - Mittelalterliche Hebraische Handschriftenfragmente Aus Bratislava
Oberrabbiner Elijahu Katz (Bratislava)
MITTELALTERLICHE HEBRAISCHE HANDSCHRIFTENFRAGMENTE AUS BRATISLAVA
“Habent sua fata fragmenta...”
Dieser kurze und biindige, eigenmachtig abgeanderte Satz den ich zum Motto dieser Studie mache, enthalt eine tiefgriindige Wahrheit. £ine der altesten Literaturen der Welt, die hebraische Literatur, kann nur auf eine geringe Zahl mittelalterlicher Handschriften hinweisen, welche uns die Schatze der hebraischen Literatur iiberliefern (dies bezieht sich besonders auf den Donauraum).
liber die Griinde dieser Tatsache herrscht kein Zweifel, Jahrhunderte andauemde Verfolgungen machten den Juden nicht nur ihr Leben schwer, sondem vernichteten auch die Friichte ihrer Geistesarbeit: ob dies nun neuere Werke waren, oder Abschriften alterer Werke und der Urquelle des jiidischen Wissens und der Forschung — der Thora. Und so ist die Literatur die flammende Worte enthalt, den Flammen der Autodaphes zum Opfer gefallen.
Trotz dieser traurigen Tatsache streitet niemand den Juden ein umfangreiches literarisches Erbgut ab. Fur die Erhaltung dieses Erbes biirgte auch die miindliche Uberlieferung, die im Judentum und auch ohne schriftliche Hilfsmittel den Text vieler Bucher von Generation auf Generation wortgetreu beibehielt.
Auf der anderen Seite ist es aber notwendig die Spuren des mittelalterlichen jiidischen Schrifttums auf das eifrigste zu verfolgen, um so Voraussetzungen zu schaffen, eine liickenlose Ubersicht des mit- telalterlichen jiidischen Geisteslebens zu gewinnen.
Bei dieser Arbeit sind wir nun nicht nur auf einzelne, unbeschadigt erhaltene Abschriften angewiesen, sondern wir sind gezwungen auch die kleinsten Fragmente hebraischer Texte aufzufinden und so eine Mosaik des jiidischen mittelalterlichen Geisteslebens und Geistesschaffens zusam- menzufiigen, welche das Bliihen und Gedeihen jiidischer Wissenschaft auch in den Wirrnissen und Verfolgungen des diisteren Mittelalters zweifellos beweisen wird.
In diesem Sinne sagte ich also oben: habent sua fata fragmenta...Eine ausgiebige Fundgrube mittelalterlicher hebraischer Textfrag-
mente sind alte Bucheinbande. Leider ist diese Schatzkammer nicht leicht auszuniitzen, doch von Zeit zu Zeit kommen einige Fragmente zum Vorschein, welche mehr Licht in die Geschichte des mittelalterlichen jiidischen Geisteslebens bringen.
In dieser Studie mochte ich auf einige Fragmente aus Bratislava
17
hinweisen welche mir zum Grossteil von der Bibliothek der Arbeitsstelle der Matica Slovenska (die alteste slowakische Kulturinstitution) in Bratislava zur Verfiigung gestellt wurde. In dieser Bibliothek sind mehrere alte Biicherfonds nicht mehr bestehender Kloster konzentriert, die hier katalogisiert und aufgearbeitet werden. Als in alten Bucher- einbanden Pergamente mit hebraischen Texten entdeckt wurden, wurde ich ersucht, diese naher zu bestimmen. Dafiir bin ich den Herren die sich die Miihe gaben und mir behilflich waren, besonders dem Leiter dieser Bibliothek Dr Boris Balint dankbar und verbunden.
Ich veroffentliche diese Studie bei Dr. Hugo Gold absichtlich. In seinem Sammelwerk: Die Juden und Judengemeinden Bratislava in Vergangenheit und Gegenwart (Brno 1932) veroffentlichte er als erster ein hebraisches Pergament-Fragment aus Bratislava; wenn auch die Ausfuhrungen Dr. Samuel Krauss (Wien) dazu nicht ganz richtig sind. Ich konnte diesen Irrtum in meiner Studie: Jalkut Schimoni Posoniensis erschienen im Sammelwerk: Studia semitica philologica, nechon philo- sophica Bratislava SAV / Academia scientiarum Slovaca, / 1965 Seite 131-137 richtigstellen.
In der vorliegenden Studie fiihre ich die einzelnen Fragmente nicht chronologisch, sondem thematisch geordnet an. Eine prazise chronologische Reihenfolge ist nicht moglich, da die Entstehungszeit der Fragmente nur beilaufig — und zwar in einem Umfang von zwei Jahrhunderten: 14. — 15. Jahrhundert — festgestellt werden kann. Dieser Grund bewog mich eine thematische Anordnung des Materials zu wahlen.
I. B1BEL:1.) Fragment einer punktierten Bibel
Die Masse konnen nicht genau festgestellt werden, da das Fragment noch nicht aus dem Einband gelost ist.
Das Fragment befindet sich im Einband eines handschrifthchen lateinischen Kodex: Breviarium strigoniense aus dem XV. Jahrhundert.
Der Kodex selbst befindet sich in der schon erwahnten Bibliothek der Matica Slovenska in Bratislava (im Folgenden nur MS Ba) und hat keine Signatur.
Das Fragment stammt aus einer punktierten Bibel, welche auch mit Akzenten und massoretischen Anmerkungen in margine versehen war (und zwar sowohl ober— als auch unterhalb der Kolumnen des Textes).
Es muss bemerkt werden, dass dieses Pergament mit hebraischem Text nicht der obere Einband ist, sondem bloss die Fiillung des Einbandes. tjber diesem Pergamentfragment befindet sich noch ein Lederdeckel. Weiter muss in Betracht gezogen werden, dass die zwei Fragmente, die das oben beschriebene Manuskript decken, ein Gauzes bilden. Sie sind nicht nur als Einbanddeckel, sondern auch als Riicken- ausfiillung verwendet worden.
Der Buchbinder verwendete bei seiner Arbeit hebraische Codices
18
Abbildung 1auch als Einlagen. So, dass wir auf diesen noch heute deutlich hebraische Buchstaben, selbst ganze W orter erkennen konnen. — Es mag sein, dass einige dieser Einlagen ebenfalls aus Bibelcodices stammen, zumeist jedoch nicht. Ich konnte bei einigen Bruchteilen Zitate aus dem Talmud erkennen und auch Fragmente aus Gebetsformeln.
Eine fliichtige Durchsicht des oben beschriebenen Buches ermoglicht folgende Zusammenstellung solcher Einlagen: 0 /1, 7/8, 20/21, 36/37, 51/52, 66/67, 82/83, 98/99, 113/114, 129/130, 140/141, 148/149, 164/165, 179/180, 195/196 und 211/212.
Das Torso selbst hat auf jeder Seite zwei Kolumnen. Kolumne 1 welche innen ist, beginnt mit Konige II. Kap. 15. Vers 20 in der Mitte des Satzes. — Kolumne 2 beginnt mit dem Versbeginn des Verses 23. Kolumne 1 endet 1, 26. Kolumne 2 endet loco citato Vers 33 und mit den zwei ersten Worten aus dem Vers 34. Die Seite / die zweite Seite / nach innen ist die verso Seite des Textes. Kolumne 1 setzt den Text dort fort wo er in der 2. Kolumne der 1. Seite / recto / aufhort. Kolumne 2 beginnt loco citato Kap. 16. Vers 4 und endet mit Kap. 16. Vers 10.
Paleographisch genommen scheint die Handschrift sehr alt zu sein. Man kann sie noch in das X III. Jahrhundert einreihen. Vergleiche Abbildung Nr. 1 und 2. Abbildung 1 wahlte ich weil wir auf dieser auch den Text des lateinischen Kodex sehen. Abbildung 2 zeigt die erwahnten massoretischen Anmerkungen.2.) Fragment einer Bibel
Das Fragment bildet das Vorsatzblatt des Grundbuches der Stadt
19
Abbildung 2Bratislava aus dem Jahre 1439. Das Grundbuch ist Eigentum und be- findet sich im Stadtischen Archiv der Stadt Bratislava. Es enthalt drei Kolumnen einer Thorarolle und bringt den Text: Gen. XXXVIII 9 — XL 11.
Dieses Fragment publiziert schon Prof. Schreiber Sandor in “Kozepkori heber keziratok” ... Er wurde in Magyar konyvszemle 1962, Heft 1, Seite 25— 40 publiziert.
II. BIBELKOM M ENTARE:3.) Fragment eines Psalmkommentars
Die Fragmente haben folgende Inv. Nummern:a. / MS Ba Z1 Heb 15b. / MS Ba Z1 Heb 16
aJ bildet den Einband des Buches “Aristus, Zacharias: Sumula verbi Dei . . . Bremae, 1610.” Das Buch ist aus der Franziskanerbibliothek in Skalica.
Es hat die Inv. Nr. MS Ba 12971. b ./ wurde als Einband des Buches Lavaterus, Rudolphus: Katabasis eis Adoy . . . . Frankfurt, 1610 verwendet. Es kommt ebenfalls aus der Franziskanerbibliothek in Skalica und hat jetzt die Inv, Nr. MS BA14328.
Ich bin der Ansicht, dass die Fragmente a und b zusammengehoren. Die ZusammengehSrigkeit beider Fragmente beweisen sowohl der Text, die Schriftart, als auch der Umstand, dass sie aus einer Bibliothek kommen.
Interessant ist nur die Tatsache, dass das hebraische Fragment beia ./ in der Schriftrichtung des Buches, bei b ./ hingegen quer auf diese beniitzt wurde (siehe Abbildung 3 ).
Der Text des Kommentars ist scheinbar in einer Kolumne geschrie- ben. Paleographisch wurde ich dieses Fragment ins XIV Jahrhundert einreihen.
20
Abbildung 3
Das Fragment ist augenscheinlich ein rabbinischer Kommentar zu den Psalmen. Trotzdem die Einbande noch nicht geoffnet sind konnte ich bei dem Fragment “a” feststellen, dass dort der 90. Psalm kom- mentiert wird. Den genauen Titel des Werkes wird man aber wahr- scheinlich erst nach der Entfernung der Fragmente aus den jetzigen Einbanden feststellen konnen.
III. TALM UND:4.) Fragment des Talmudtraktates Pessachim.
Das Fragment wurde zum Einbanddeckel des unter Nr. 2 erwahnten Grundbuches der Stadt Bratislava beniitzt.
Es handelt sich hier um das Fragment eines in Folioformat geschriebenen Talmudtraktates. Der Text war in zwei Kolumnen geteilt.
Auch dieses Fragment publizierte Dr. Schreiber. Siehe unter Nr. 2. Bibelfragment.
21
IV . TA LMUDK OMM ENT A R5 ./ Fragment aus Raschi’s Kommentar zum Traktat Sebachim. Es hat die Inv. N r.: MS Ba Z1 Heb 7. Das Pergamentfragment ist dem Riicken- und Seiteneinband des Buches Pazmany, Peter: Csepregi Szegyenvallas, Pragae, 1616, entnommen.
Das Fragment und auch das Buch, dem es entnommen ist, gehoren der Bibliothek der MS Ba. Das Buch hat die Signatur: MS Ba 25242.
Dieses Fragment welches Tecto und verso beschrieben ist, hat auf beiden Seiten zwei Kolumnen. Es ist auf einer Seite beschnitten, was jedoch die Schrift nicht beschadigte. Nur durch Beschneidung oben und unten ist die Schrift stark beschadigt. Wir wissen deshalb auch nicht wie viele Zeilen die einzelnen Kolumnen hatten. In dem jetzigen Zustand sind auf Verso 29 Zeilen auf Recto 30 Zeilen geblieben.
>;י ''*'’י %־ 13י? * )n#* ir l ■',■"-' •ייייי־ י־* - י־ ״יי
' • • .׳ . • י <• .■h,- , **I I
*•5י» >**י.9 '*ליי »•« >ןי *. מיי *י *ו י׳י * • - י - ז ד ז •K' י
- -י-\51ז>י •ימי• *-ד י״,;■׳ ■*"י*, -■׳'׳״ &?יגייי9• י64 •*׳־ז* «!*»»_ ■ +.‘״••י י!«ן ׳ %f
*.y*•*• nejrr -מ»זיי׳נ^'1י *-י» ■*״ד-: י^ ■יי ׳ ' י ־ ו י ד י י - •.
*ז ׳*״־< •**‘Jf* >»*י» *י ;#»יr . - f j
4V.*.** ',׳»€<f i* »**> *• י י * “* **a- vj CS '
י* י־'י'זי י ■-י■״׳ י-י י ^v ׳■ *''V'~■ ' ■' V-'i' .
■ >«.>•»* ןוייילייו׳*־!**/ י־■■״ . ■ ' |^\ו -- .י!*־.•׳ '־;י־י «זד#:1'י«
־ 'SV ,v< * י־ •י ■יי
j v, ־י- י־ י מ־ל׳
v % >V- i l-־׳׳s ־;■*•י׳ ,.... •
1 . <». ■״*קן •w ״ ■ -יי#7,<? fto ji.'wי p• ,>ז
מ ו•׳•*♦ י י ״ י י ז ז ו *1,* ■ 1>־ * י 4''3* •
,■■•יי י,»וג»י : •»: י »«•**«־ ~״ך״,׳יי* ׳*י ־ *י> « ^,
״׳ ר * י ;•;!,״,גי !,•*-•!.,♦*מ■:■' י
Abbildung 4
Es sei bemerkt dass recto (Abbildung 4) besser zu lesen ist als verso, denn verso ist das Pergament gebraunt und die Schrift verblasst. Dies rniissen wir dem Umstand zuschreiben, dass das verso beim Einband nach aussen kam und so der Abniitzung mehr ausgesetzt war.
Dieses seltene Pergament ist ein Fragment des Raschi-Kommentars zum Traktat Sebachim. Es bringt den Text von Folio 31a wie dies die Worte “im Pessachim Traktat lernten wir es” verraten. Auf der Verso- Seite ist die Beendigung von Raschis 31b.
22
ztjgl
Abbildung 5
Wie aus dem Zusammenhang ersichtlich ist, ist das Folio unten viel mehr beschnitten als oben, daher ist eine grossere Textliicke zwischen verso und recto als zwischen den Kolumnen 1 und 2.
Paleographisoh ist der Codex eine deutsche rabbinische Schrift aus dem Anfang des XIV. Jahrhunderts.
V. MAIMON1DESC ODEX:6./ Fragment des Maimonidescodexes: Hilchot Ischut, mit der Signatur / MS Ba Z1 Heb. 3. Die Handschrift ist ein Einbandausschnitt eines unbekannten Buches.
Das Fragment ist recto und verso (Abbildung 5) in je eine Kolumne beschrieben. Recto ist sie viel blasser und kaum lesbar. Dies deshalb, weil sie beim Einbinden nach aussen kam. Dieses Blatt ist oben, unten, recto links und verso rechts beschnitten. Ausser der eigent- lichen Kolumne sind auf recto unten deutlich noch Marginalien sichtbar.
23
Links sind Spuren von Glossen, die hochstwahrscheinlich zu den Margi- nalien gehoren, ausserdem sehen wir auch eine kleine Marginalie rechts. Bemerkenswert bei diesen Marginalien ist, dass ihr Anfang immer mit roter Tinte geschrieben ist.
Dieses Folio enthalt ein Fragment aus dem Maimonides Codex “Hilchot Ischut” Kapitel 16. Eine nummerierte Halachaeinteilung ist nicht vorhanden, nur grossere Liicken zeigen an, wo eine Halacha endet, beziehungsweise eine andere beginnt. Recto oben in der Mitte beginnt die 6. Halacha des 16. Kapitel der oben erwahnten Maimoni- desstelle.
Hier sei bemerkt, dass die Vergleichung dieser Handschrift mit dem Maimonidesausgaben kleinere Abweichungen vorweist.
Paleographisch gesehen ist es eine deutsche rabbinische Schrift aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts.7 ./ Fragment des Maimonidescodexes: Hilchot Nedarim, aus dem Einband des Buches: Cicero, Marcus Tulius:
De partitione oratoria d ia logu s___ Colonia, 1539.Das Buch kommt aus dem Piaristenldoster in Podolinec. Es hat
noch keine Signatur.Buch und Fragment sind Eigentum der Bibliothek MS Ba.Es ist ein stark beschadigtes Pergamentfragment, welches sowohl
von der Zeit als auch vom Biicherwurm in Mitleidenschaft gezogen wurde und den Riicken - und Seiteneinband des erwahnten Buches der klassischen lateinischen Literatur bildete.
Dieses Fragment enthalt einen Teil aus dem Maimonides Codex “Hilchot Nedarim”. Auf jeder Seite sind zwei Kolumnen, von denen die eine nur oben, wahrend die zweite auch an den Seiten beschnitten ist, so dass durch diese Beschadigung bloss Bruchteile des Textes iibrig blieben.
An diesem Fragment sind beide Seiten sowohl recto als auch verso (Abbildung 6) sehr verblasst und schwer leserlich. Der Unterschied besteht bloss darin, dass auf recto in Kolumne zwei die Zeilen ganz erhalten sind wahrend im verso die Kolumne eins. Auf recto finden wir das 2. Kapitel des angefuhrten Maimonidestextes. Auf verso, wie dies in Kolumne eins in der fiinften Zeile unten deutlich zum Vorschein kommt, da dort durch Majuskulbuchstaben angegeben wird, beginnt das 3. Kapitel. Ausser der Kapiteleinteilung finden wir in dieser Hand- schrift keine Halachaeinteilungen, weder eine nummerierte noch eine unnummerierte. Nur eine kleine Liicke zwischen der einen und der anderen Halacha deutet an, dass hier eine Halacha aufhbrt, respektive die zweite beginnt.
Zur Prazisierung des Inhaltes kann nur so viel bemerkt werden, dass in der zweiten Kolumne recto die letzten Worte der 4. Halacha der oberwahnten Maimonidesstelle erhalten sind. Diese zieht sich durch diese Kolumne und geht iiber auf verso, wo dann das Ende der Kolumne das dritte Kapitel des Maimonidestextes beginnt. Verso sind bei Hala- choth 15 und 16 die Zeilen viel kiirzer, um einer Marginalie Raum zu lassen, die dann dort eingeschrieben ist. Dies um die Bemerkung nicht
24
־ ׳»•««־? ׳ ■^^ $**»# , <4s&sHS £8, f * ♦** ~ * ' :$*$**&* ' " &* '&$&*& ׳ -
Ar%m^ TrfiM#*r^ , ^ * *£**$&&£ ״ י־' ׳׳ y*P**,r»? ׳ T&&?% -T£: * t?W :«! '*״ , ״• 'J^ %•'
?־ו? »,שיע״יי י j
“3#$*?a** 5* - 4 ׳י י- ׳* ׳' ^f£ 1r?r* *■ war4 י׳ ׳* ® WfJ?JUjf < ,. w r » ־ ״*•י » ^־ו > «יי3? *{<5 ־ 5»$ £ f® » twx׳*■ '?'$ v? I■*-*?*■•■ "' .» י ׳ ״-. ? 4- ';«5* ז?י»;'ז>!י,י | ^״<3 . >jf~V. -*-*-? -**t&mi**• v »'
־ ז 1■י י י ; י '^ « * ^ לי. V r » * r j w r '' * * > » ־ • ״ * ׳ ן ־ י י ־־ #"■ . ,.;-• /,, -*y״ f'jc ־־j■׳ ?־ ״ *"“■י׳—■"׳'*' ׳'*י ■—-' t*»‘• «M • *ז יי
,׳ • ׳*»-:: "-.*« ' j i V I «! • *, # « ׳
״־1 —' ־׳־—* - ׳*5 י'~**%׳ —
> ■ י . ■ _ ״ ״ . ~* י _ . , . «־.׳ ;,«■ ׳ .; ' ',« ] A r ! . ■ - “ י*י ־
*&»« ' ■ ״־ r י**r»» . .־ « * ^ R ״ ־ ׳- •- ' t. *,
,״»■ , ■ - ::..?״ V '1• ;■■׳r n ••: 4 ■- ־ • ׳-ן -,. ,-■.W ' t . -; » ־ י־*- ־ - • *
r ׳ - • > ^ . ?**) <»* ! ?!י»־ ~ * » י1« <
* - •*♦»■*#-•»«****•..•■ «״ * *;״ * •0יז־י׳־׳י - ■• - ~ . .w « * « W s iw < ׳׳'%'r<«׳׳'׳ p ■ _■
- ■JJJW*•*3* ® ' י י?י* - ־׳ ״ י ־ ': י ' ., *f ' " ■י 5־ ".':is *'־ S1 ■:'
• י - ״ »« • r ״ ׳»* ’* - - • ■ .■/’■ ^ r --------------------------&_נ׳־ ' ז-:י ME ULjs
׳ ־PBMjBffiEf
י’ ־BT'Pf■■ -p » «r«y. יי■?.־•*[~#.ot#wac ׳״to
•er *^ ^• . *עזיייווי“ י*י* & «fc*kfc i ***י ־ •ייא־I $<ן «י«-י*! -»*•I *1r :«■«>״•«■ r-*-r״s־I . . . - . *. 7 * v * j!■{*>' ד!'*; u7r . ן6* f»«sp* !״׳*#י i ׳־2 | w#5W* ייי
-;
... ^ . w - e ״-»
**ייי#ו9מ .®.:* f..1»< ־K11 ■: ■ S י®' **f■*
Abbildung 6
am Rand zu plazieren. Die Identitat dieser Margine war ich ausser- stande festzustellen.
Paleographisch betrachtet ist es eine deutsche rabbinische Schrift aus dem XIV. Jahrhundert.
VI. M IDRASCHIM :8 ./ Jalkut Simoni
Ein Fragment des Jalkut Simoni und zwar § 541 - 543.Siehe die schon erwahnte Studie in Studia philologica necnon philo- sophia (weiter oben S. 3.) und auch in der Abhandlung Prof. Dr. Schreiber (op. cit. siehe unter Nr. 2.)
V II. SIDDURIM :9.1 Zwei Fragmente eines Siddur; beide haben die Inv. N r.: MS Ba Z1 Heb 8.
25
ר ע י י י מ
Abbildung 7
Die Fragmente sind Ausschnitte eines Buches ohne Titelseiten. Die Seitenanschrift besagt, dass es sich um das Buch: Rudimentorum philosophiae naturalis lib. I. II: handelt. Zu diesem Werke ist eine weitere Abhandlung: I. Megiri . . . libelli (ebenfalls ohne Titelseite) dazugebunden.
Dieses Buch hat die Signatur MS Ba M 5641.Fragmente und Buch gehoren der Bibliothek MS Ba.Diese Fragmente sind in je zwei Kolumnen, beziehungsweise Seiten
geschrieben. Da nun der Text fortlaufend ist, enthalt Fragment A die Seiten oder Kolumnen 1, 2, 7 und 8, Fragment B dagegen die Kolumnen3, 4, 5 und 6.
Es muss noch vorausgeschickt werden, dass Fragment A. unten, das Fragment B oben beschnitten ist. Die Seiten 2, 4, 5 und 7 sind mehr verblasst als die iibrigen, da diese beim Einband der Abniitzung mehr ausgesetzt waren. Diese Fragmente sind der Rest eines Siddurs welches fur die Wochentage — und Sabbatgebete bestimmt war (also nicht wie ein Machsor, der nur die Festgebete enthalt). Es mag sein, dass er bloss fur den Sabbat bestimmt war.
Der Inhalt, der sich darin befindlichen Gebete ist folgender:Seite 1. (Abbildung 7) In der oberen Halfte (links) befindet sich
das “Aw-Harachamim”-Gebet, welches nach dem Yerlesen der Thora vor dem Mussafgebet fiir die M artyrer verrichtet wurde. Es wurde nach den Kreuzziigen 4856 (biirgerliche Zeitrechnung 1096) verfasst. Der erhaltene Teil enthalt Zitate der Hagiographen aus den Psalmen:
26
namlich die zweite Halfte der Psalmsatze: 79, 10; 9, 13; und Psalm 110, 6 — 7. Der Kopist hat im Vers 6 zwei Worte ausgelassen, die jedoch in einer kleineren Schrift in Margine nachgetragen sind. Aus dieser Margine ist ersichtlich, dass unser Fragment nicht nur oben und unten beschnitten wurde. Dies erklart uns, warum das zweite Wort nur halb erhalten ist. Dieses Aw-Harachamimgebet ist nur ein aschkenasischer Ritus und im sephardischen nicht iiblich. Wir sind deshalb uberzeugt, dass wir ein aschkenasisches Gebetbuch vor uns haben, was dem Vor- findungsort entspricht. In derselben Zeile, in welcher das Ow־Harachamim Gebet beendet ist, folgt die Einzeichnung Aschre Joschwe. Dies bedeutet, dass nach dem Aw־Harachamim der Psalm 145 rezitiert wurde. Diesem wurden zwei Psalmverse, namlich 84,5 und 143, 15 vorgeschickt. Dann folgt in einer separaten Zeile in einer kleineren Schrift, der Psalmvers 145, 15. Hier jedoch nur die ersten zwei Versteile; der dritte Versteil fehlt. Nach unserer Sitte ist der ganze Vers zu sagen. Nachdem der Vorbeter die ersten zwei Versteile anstimmt, wird der dritte Versteil von der Gemeinde beendigt. Dies scheint ein Beweis zu sein, dass unser Siddur nur fur den Vorbeter bestimmt war und deshalb bloss das enthalt, war der Vorbeter zu sagen hat.
Dann folgt in der unteren Halfte auf Seite 1 die Kiduschs fur den Mussaf an Sabbat, namlich die aschkenasische Version “NAARIZCHA ve MAKDISCHCHA”, welche auf Seite 2 fortgesetzt wird. Bei genauer Betrachtung der Seiten eins und zwei ist festzustellen, dass obwohl das Blatt unten beschnitten ist, bloss eine beziehungsweise anderthalb Zeilen fehlen, da von der vorletzten Zeile der obere Teil der Buchstaben vor- handen ist.
Auf Seite 3 ist in den oberen vier Zeilen die Beendigung der vierten Benediktion fur den Mussaf Schemono Essre... erhalten. Es ist dies eine Benediktion, die in einem alphabetischen Akrostichon abgefasst ist. Der hier angefuhrte Abschluss hat die Eigentiimlichkeit, dass er von dem iiblichen Text abweicht. So blieb uns eine interessante Variation erhalten. In der fiinften Zeile finden wir nur die Bezeichnung “R’ZE und MOADIM”. Dies bedeutet, dass hier die Gebete wie an Wochentagen verrichtet werden.
Dann folgt in der sechsten Zeile der Seite 3 die Hynme “£N k’ELOHfiNU”, welche in ihren ersten cfrei Strophen das Akrostichon “AMEN” aufweist. Laut dem sephardischen Ritus wird diese Hymne auch an Wochentagen gesagt, dem aschkenasischen nach nur an Sam■ stagen und Feiertagen. Da unser Fragment dem aschkenasischen Ritus folgt, ist es richtig, dass sie bei den Sabbatgebeten figuriert.
Wir hatten schon angefiihrt, dass das Fragment B oben beschnitten ist. Wie dies der Zusammenhang der Seiten 3 — 4 ergibt, muss ange- nommen werden, dass von 4 oben vier Zeilen weggeschnitten sind. Auf Seite 3 folgt dann die Beraita von Pittum Haketores, welches nach der oberwahnten Hymne iiber die Vorschriften des Weihrauches gesagt wird. Sie ist dem Traktat Kerituth 6 recto entnommen. Denn die oberwahnte Hymne endet mit den Worten “Du bist der, vor dem unsere
27
Vater dargebracht haben, das Raucherwerk der Gewiirze”. Hierauf folgt die Zusammenstellung der Raucherwerke.
Auf Seite 5 befindet sich die Beendigung der mittleren Benediktion des Schemono Essre... Es ist dies sicherlich das Minchagebet des Sabbat. Dieses befindet sich in den ersten vier Zeilen. Ahnlich wie auf Seite 3 die zur Beendigung des Mussafgebetes gehort, steht in der 5. Zeile R’Zfi. Dies bedeutet, dass nach dieser Benediktion die Beendigung des Sche- mono Essre-Gebetes wie an Wochentagen folgt.
Die unteren sieben Zeilen sind mit folgenden Bibelversen ausgefiillt: Psalm 119, 142; 71, 19 und 36, 7. Diese Reihenfolge ist in dem aschke- nasischen (deutschen) Ritus iiblich. Der sephardische Ritus hat die verkehrte Reihenfolge, dass heisst 36, 7; 71, 19 und 119, 142.
Die Sitte, diese Verse nach dem Minchagebet am Sabbat zu sagen, wird bereits im altesten Siddur des Raw Amram Gaon erwahnt. Auf Seite 6 befindet sich die vierte Benediktion des Schemono Essre. in seiner erweiterten Fassung fur den Ausgang des Sabbat (siehe Davidson I. Alef Nr. 8797-8798). Der Beginn der Benediktion ist jedoch weg- geschnitten, wie wir dies oben bei der Beschneidung des Blattes beschrie- ben. In der dritten Reihe von unten steht in einer kleineren Schrift das Wort “Maschiwenu” was andeuten soil, dass die oben befindliche Poesie die Benediktion des Schemono Essre. ist. Von Seite 6 unten angefangen und auf Seite 7 — 8 sind Segensverse aus der Bibel, welche beim Ausgang des Sabbats beim Abendgebet rezitiert werden. Es muss bemerkt werden, dass diese nicht beendet sind und dass auch eine grosse Liicke zwischen Seite 6 und 7 besteht. Das lasst sich nur dadurch erklaren, dass die Lage, aus der unser Pergament genommen wurde, mindestens 16 Seiten hatte. Wir haben bereits oben darauf hingewiesen, dass zwischen Seite 4 und Seite 5 eine Liicke besteht und hier ist wieder eine Liicke bewiesen. Nachdem auch zwischen den Seiten 6 und 7 eine solche besteht, konnen wir den Schluss ziehen, dass von der Lage, aus der unser Fragment ursprunglich bestand, folgende Seiten iibrig blieben 1 - 2, 5 - 6,11 - 12 und 15 — 16. Die iibrigen Seiten fehlen. (Auf der Abbildung 7 ist also Seite 1 (links) und Seite 16 rechts).
Was die Schrift anbelangt, lasst sich noch gut erkennen, dass sie liniert war. Sie ist durchwegs — mit Ausnahme der Worter die nur etwas anzeichnen sollen — punktiert. Der Kopist liebte die Symetrik und trachtet die Zeilen auszufiillen. Er tat dies grosstenteils mit dem ersten Buchstaben des kommenden Wortes der nachsten Zeile, in dem er das Wort dort wiederholt. Die Ligaturen Alef mit Lamed sind haufig (siehe Abbildung 7 rechts Zeile 6 von oben). Das Tetragram wird mit zwei Jodim und einem Nun inversum geschrieben, welches de facto wie vier Jodim aussieht: rechts eine und links drei, das mittlere ׳paralell mit dem rechten, eines oben und eines unten.
Paleographisch kann die Handschrift gegen das Ende des XV. Jahrhunderts datiert werden.10./ Schir ha-Jichud (Ein Siddurfragment); Signatur des Fragmentes: MS Ba. Z1 Heb 5. Aus dem Buche: Pjsne Pohebnj, (Kralice), 1615. Die Signatur des Buches: MS Ba Fr 13288.
28
ד * ל1> ח ? י דד
/ ^ ך ן ק י י ״ < ר : י*{יי
^ ^ י ■ודאמיי־־^ן־ יוא^ך^מי ו1נ ^ ^ ■ י י ט כ י ־ ש ג ' • ^
. י ' ג מ £ ״ י ג ע & ' * * • w t y
י ^י ל ע ב ר p S
> . * |S ~ * •
Abbildung 8
Abweichend von anderen Einbanden bringt hier nur der eine Ein- banddeckel einen hebraischen Text, der andere besteht aus einem unbe- schriebenen Pergament.
Der Text ist nur in einer Kolumne geschrieben. Neben den Tex’, sind aber in Margine Glossen (Anmerkungen, Erganzungen).
Verso und recto (Abbildung 8) des Fragmentes enthalten einen Teil des sogenannten Einheitsgesanges (Schir ha-Jichud) fur den vierten Tag der Woche, den Mittwoch. (Siehe Davidson I. Alef Nr. 7505). Der Gesang ist in einem alphabetischen Akrostichon abgefasst. Die Zahl der Verse jedes Buchtstaben ist jedoch nicht einheitlich. In der heutigen Fassung hat diese Poesie 103 Zeilen. Da das hebraische Alphabet aus 22 Buchstaben besteht, miisste jeder Buchstabe vier-, beziehungsweise fiinfmal wiederholt werden. De facto gibt es aber Buchstaben, die sich bloss zweimal wiederholen, wie zum Beispiel der Alef.
Dieses Fragment ist die Mitte eines oben und unten beschnittenen Blattes; es ist nicht festzustellen, ob mehr oben oder unten. Wahr• scheinlich jedoch ist, dass das Fragment mehr oben als unten beschnitten ist. Auch an der Seite ist dieses Blatt sehr stark beschnitten. Recto fehlen die Satzanfange verso die Satzendungen.
Recto und verso enthalten im jetzigen Zustand je sieben Zeilen. Die ersten drei recto Zeilen gehoren zu dem Teil, welcher laut den Akrostichon mit Kaf beginnen. In der heutigen Fassung ist der Kaf neunzehnmal vertreten, diese drei Beiten entsprechen der heutigen 8. 9. 10. Zeile. Zeile 4, 5 und 6 entsprechen wieder der 17. 18. und 19. Zeile, so dass in der Mitte sechs Zeilen fehlen. Dies bestatigt meine Theorie in der grossen Fassung des K iriat sefer, wo ich bewies, dass die Ein- heitsgesange allmahlich an ihrem Umfange zunahmen. Unsere jetzige Fassung besteht aus verschiedenen Schichten, die sich im Laufe der Zeit aufeinander legten. Samtliche wurden bewahrt. Die siebente Zeile gehort zu dem Teil der laut Akrostichon mit Lamed beginnt. In der jetzigen
29
Fassiing haben wir vier Satze die mit Lamed beginnen. Der hier ange- fuhrte Satz entspricht dem dritten Satz der heutigen Version. Aus dem Fehlen der iibrigen Satze zum Lamed konnen wir dieselbe Schlussfolge- rung ziehen, die wir bereits beim Kaf angefiihrt haben.
Verso enthalt ebenfalls sieben Zeilen. Die erste Zeile beginnt mit Nun, die 2. 3. 4. mit Samech, die 5. 6. 7 mit Ajin. Dieser Teil korres- pondiert vollkommen mit der heutigen Fassung.
Die Linierung ist heute nicht mehr wahrzunehmen, es ist jedoch ausser Zweifel, dass sie vorhanden war. Die Schrift ist durchwegs punk- tiert. Die Buchstaben, die Rafe ausgesprochen werden, haben oben einen Strich, zur Bezeichnung, dass sie ohne Dagasch sind. (Siehe die An- merkung oben).
Es scheint, dass die Schrift aus dem XV. Jahrhundert stammt, und zwar eher aus der ersten als aus der zweiten Halfte. Fur dieses Alter spricht auch die viel kiirzere Fassung der Poesie. Sie wurde also zu einer Zeit abgeschrieben, als die spateren Erganzungen noch nicht existierten (Siehe das Buch von A. M. Habermann: Einheits- und Ehrengesange, Jerusalem 5708).
(Weiterer Teil folgt)
30
Oberrabbiner Elijahu Kalz (Bratislava)
M ITTELA LTERLICHE HEBRÄISCHE H AND SCH RIFTEN FRAG M EN TE AUS BRATISLAVA
(II. Teil)
V III. M ACHSORIM :
11.) M achsorfragm ent für den 2. A bend des N eujahrsfestes. F orm at 240 x 737 mmS ignatur des hebr. Textes: MS Za ZI Heb 11
Aus einem Buch ohne Titelblatt. W ahr- scheinlich, wie dies die A ufschrift auf der Seite ansag t: D ialecticae com pendium (oder Praeceptiones dialecticae et rheto- ricae...)
Das Buch stam m t aus dem Franzis- kanerkloster in Skalica. Das Buch ist noch ohne Inv. Nr. S ignatur: MS Ba
Das Fragm ent ha t eine fast quadrati- sehe F orm und diente als Rücken- und Seitendeckel eines E inbandes.
Dieses Fragm ent enthält M aariw poesien fü r den zweiten Abend des N eujahrsfestes (siehe darüber Davidson II. U nter K af N r. 492 ). Diese stammen aus der Feder des E fraim , Sohn des Jakob aus Bonn. A uf recto befindet sich der erste Teil der Poesien, welche in A krostichons abgefasst sind und die Buchstaben von Alef bis Vav erfassen. D er dritte Teil (A bbildung 9) der Poesie ha t ein A krostichon welches das voll- kommene A lphabet und auch den Nam en des A utors in sich b irg t. Der Name des Vaters lässt sich jedoch n u r schwer eruieren, höchstwahrschein- lieh fehlen h ier einige Sätze. Recto sind nu r die ersten sieben Zeilen des A lphabets. Verso beginnt m it Kaf, dies deshalb weil unser Fragm ent oben, unten und an den Seiten beschnitten ist. Die fehlenden Buchstaben sind gewaltsam weggeschnitten worden. W ie viel oben und unten fehlen, ist schwer feststellbar. Es ist aber m ehr als w ahrscheinlich, dass unten m ehr fehlt als oben. Denn auf recto scheint oben nichts zu fehlen, da es bloss ein unbeschriebenes Pergam ent ist. A uf verso befindet sich auch
63
A bbildung 9
noch ein Teil der Schiusspoesie, welche das alphabetische A krostichon des ersten Teiles, das m it Vav endet, m it dem Z ajin fortsetzt. Recto ist sehr verblasst und abgewetzt. Dies ist dem U m stande zuzuschreiben, dass es bei der V erw endung als E inband nach aussen kam und so m ehr der A bnützung ausgesetzt war.
Palaeographisch gesehen kann der Codex an das Ende des XIV . oder zu A nfang des XV. Jah rhunderts angesetzt werden. D er Buchstabe Hé hat im m er seinen linken Fuss m it dem Dach des Buchstaben verbunden. Das T etragram m schreibt der K opist m it zwei Jad im und links m it einem N un inversum . das m anchm al m it einem zweiten N un verbunden ist.
12.) E in M achsorfragm ent fü r den 2. Tag des N eujahrsfestes: A und B: Form at. 3 9 0 x 2 9 0 mm.
S ignatur des Fragm entes:Aus dem E inband des Buches: H istoria genealogiae D om ini nostri
Jesu C hristi ... I. I I . III . F rankfu rt, 1519.Das Buch kom m t aus der Bibliothek des Franziskanerklosters in
Prus. S ignatur MS Ba.Das Fragm ent besteht aus zwei Folios, welche recto und verso be-
schrieben sind. Säm tliche Seiten m it je 27 Schriftzeichen beschrie
64
A bbildung 10
ben, die eine Schrifthöhe von 8 mm haben, so dass fü r jede Zeile ein starker cm. entsprichl. Die Schriftbreite ist von Seite zu Seite verschieden und bewegt sich zwischen 17 und 23 cm.
Die vier Seiten reihen sich n icht continuell aneinander. Dieses F ragm ent ist aus einer Buchlage genom men, die m ehr als zw ei B lätter hatte, so dass die Innenfolios fehlen. W ir müssen h ier von Folio 1 und Folio 4 sprechen, da unbedingt m indestens Folio 2 und 3 fehlen.
Dem Usus der Zeit entsprechend waren die Folios liniert, die Spuren dieser L inierung sind durch Löcher die m it einer Ahle durchgeführt wurden, noch heute deutlich sichtbar. (A bbildung 1 0 ). In teressant ist es, dass die Buchstaben auf Folio 1 recto und verso grösser sind als die Buchstaben auf Folio 4• recto und verso. Jedoch stam m en sie aus einer H and, denn palaeographisch ist nichts W esentliches zu m erken, was eine D ifferenzierung zulassen würde. In beiden Folios sind L igaturen fü r den G-ttesnamen, welche das Alef m it dem Lam ed in einem Buchstaben Zusammenlegen. Das T etragram m besteht aus zwei Jad im und links davon einem Zeichen, das dem N un inversum nahe kommt. (Siehe Rocenka fü r das Ja h r 5725 Seite 1 5 —2 2 ־ ) N ur selten, höchstw ahrscheinlich aus
65
Raum m angel, benützt der K opist die S chreibart des T etragram m m it d rei Jad im (zwei Jad im und oben in der M itte der d ritte J o d ) . So zum Bei- spiel Folio 1 recto in der siebten Zeile von unten M itte. E in grosser U nterschied besteht zwischen dem, dass Folio 1 durchwegs sowohl recto als auch verso punktiert ist, w äh rend Folio 4 unpunktiert ist. ,1M erkw ürdig sind die Buchstaben Lam ed, die oben am Kopfe rechts einen dünnen Streifen tragen. (Vergleiche Enz. Judaica Band II. Spatio 4 3 3 /3 4 Tafel V. Entw icklung der Q uadratschrift R u b rik ) . Die Buchsta- ben, welche einen Dagasch haben können, sind, wenn sie ohne diesen be- nützt werden, auf ihrem H aupte m it einem wagrechten S trich versehen, der besagen will, dass sie ohne Dagasch geschrieben sind (Siehe dazu M achsor L ipsia, Leipzig, 1964 im hebr. T ext Seite 28 — 2 9 ) . Verges- sene Buchstaben werden hie und da m it kleinen Buchstaben nachgeholt.
M an kann behaupten, dass der K opist ein ästhetisches Gefühl hatte, das sich in der E inteilung der Zeilenglieder auf Folio 1 recto zeigt. Sonst sehen w ir nur, dass er bei Beginn eines neuen Absatzes besonders grosse Q uadrata benützt. Siehe Folio 1 verso, wo die grossen Buchstaben den Raum von drei Zeilen in A nspruch nehm en.
Vom palaeographischen Aspekt gesehen, muss dieser M achsor in das XV. Jah rhundert datiert w erden und zw ar eher in die erste als in
die zweite H älfte dieses Jahrhunderts. Der K opist bevorzugte den Alef, Ivo er diesen als A bkürzung (dies n icht n u r in L igaturen) benützt, ohne den linken Fuss zu schreiben. Siehe Folio 4 die unteren Zeilen. Bevor w ir zur Beschreibung dieser zwei Folios kommen, muss bem erkt werden, dass Folio 1 verso und Folio 4 recto bei dem E inbinden nach aussen kam en. Deshalb sind sie m ehr vergilb t und w eniger leserlich.
Ausser dem Text finden w ir auf den beiden Folios lateinische Ver- merke, die Zeugenschaft davon abgeben, dass diese M achsorblätter zum E inbinden frem der Bücher benützt wurden. Der B uchbinder verwendete sie ihrem Zwecke w idersprechend als E inbandm aterial. Eine E in tragung fü h rt auch das D atum 1596 an (siehe Folio 1. verso oben rech ts). Dies besagt aber nicht, dass dieses F ragm ent dam als als E inbandrnaterial verwendet w urde. M an kann m it aller W ahrscheinlichkeit annehm en, dass diese E in tragung in späterer Zeit entstand.
Das P ergam ent dieser beiden Folios ist stark beschädigt, ganze Stücke sind ausgebrochen. Sie sind auch vom Bücherw urm zernagt.
Folio 1 recto: (A bbildung 10) E nthält zwei Gebetstücke, die fü r den 2. T ag des N eujahrsfestes zum M orgengebet bestim m t sind. S iestam - men aus der Feder des bekannten D ichters Sim on ben Abun. Die Poesie ist im durchbrochenen alphabetischen A krostichon verfasst. Das heisst, die S trophen beginnen stets m it einem ungeraden Buchstaben des Al,pha- bets. Uns blieb h ier n u r der Abschluss, das heisst die letzte Strophe, die m it Schin anfängt, erhalten. Diese S trophe ist bei uns die Zeile 5 und 6 von oben.
Dieses m erkw ürdige Gedicht, das die Grösse und die E rhabenheit des him m lischen Königs (unseres G-ttes) schildert, w ird in unseren M achsorim m it einer E infügung, welche die N ichtigkeit und Vergänglich- keit des irdischen Königs schildert, verbunden. In diesem M achsor sind
66
jedoch n u r zwei S trophen davon enthalten. Diese E infügung ist wahr- scheinlich ein Gegenstück zum G rundstock der Poesie. Sie w urde eben- falls in einem alphabetischen A krostichon verfasst, aber n icht wie der obere Teil in ungeraden Buchstaben, sondern in geraden. In unseren M achsorim ist es heute nu r abgekürzt enthalten. Es ha t n u r die erste and letzte Strophe, w elche m it Bet und Taw beginnen, die übrigen neun Strophen fehlen. (Siehe D avidson III . 1653). Es ist heute n icht m ehr klar, ob diese K ürzung der Zensur zuzuschreiben ist oder ob sie bloss von der K ürzungssucht d ik tiert w urde. In unserem M achsor sind es n icht zwei S trophen, sondern vier. Ih r Inhalt deckt sich n ich t m it dem Inhalt der gedruckten M achsorim . Leider kann der Buchstabe, m it welchem die erste S trophe beginnt, n icht m ehr festgestellt werden, da oben do rt das Pergam ent schwer beschädigt ist. E ine Rückfolgerung aus den zurück- gebliebenen Zeilen beweist, dass es sich h ier um den Buchstaben Bet handelt. W ir haben also vier S trophen vor uns m it den geraden Buch- staben Bet. Dalet, Chet und Taw. Auch hier fehlen noch im m er sieben Strophen, jedoch n icht neun wie in unseren M achsorim . D er Inhalt der S trophen Bet und Taw ist grundverschieden von den gedruckten Mach- sorim . Mit diesen Versen ist unser Folio ein B eitrag zur Entwicklungs- geschichte der M achsorim . W ir erfahren so auch etwas Neues zur Ge- schichte der Liturgie.
Zeile 7 und 8 sind ein Bindeglied zwischen dem beendeten und dem folgenden Teil der L iturgie. Dieses ist un ter dem Nam en “Kol schinana schachak” bekannt. Es ist dies der neunte Teil dieser K eroba (siehe Davidson II . K af 393 und I. Alef 890 6 ). Diese K eroba ist ebenfalls eine akrostichonische Poesie. Im A krostichon kom m t vierm al der Nam en Sim on b a r Jizchak Chasak zum Vorscheine. U nser K opist verstand es diese A krostichone gut und geschickt hervorzuheben, indem er das Vorgesetzte Kol stets separat schreibt, und so das N am ensakrostichon prägnan t zum V orschein bring t.
Folio I. verso: Die ersten fünf Zeilen sind die Beendigung des “Kol schenana schachak” . Die sechste Zeile ist das Bindeglied zum kommen- den Teil der K eroba. näm lich der sogenannte Siluk (B eendigung), von welchem w ir n u r einen Teil in unserem M achsor haben.
Folio 4 recto : H ier finden w ir das Schacharit (M orgengebet) fü r Rosch H aschana. Präzise gesagt ist es n u r die Beendigung der dritten Benediktion. Der A nfang dieser Benediktion w ar w ahrscheinlich auf dem fehlenden Folio 2 und 3, wo der obenerw ähnte Siluk beendet w urde. Es folgen die ganze vierte Benediktion, so wie die letzten drei Benedik- tionen, w elche m it ih ren Einfügungen auf verso beendet sind.
Auch h ier m uss bem erkt werden, dass diese Fassung, welche w ir in diesem Fragm ent vor uns haben, einige wesentliche Abweichungen von dem üblichen Text unserer M achsorim aufweist. Besonders auffal- lend ist dies am A nfang der fünften Benediktion, welche den grössten Teil von Folio 4 recto ausfüllt (siehe D avidson I. A lef N r. 870 3 ). E in Teil davon ist schon im bekannten S iddur des Raw A m ram Gaon vor- zufinden. (Siehe auch im Buche Likuté M aharjach II. Ausgabe I. Teil Seite 113 — 114). A uf der unteren H älfte des Folio 4 verso finden w ir
67
das Avinu M alkénu Gebet. Es ist in zwei Kolum nen geschrieben. Es ist dies ein uraltes Gebet, welches bereits im Talm und T rak ta t T aniat Folio 25 verso erw ähn t w ird (siehe h ierüber Davidson I. Alef N r. 2 1 6 ). In der ersten K olum ne beginnt der Satz im m er m it dem W ort M alkénu. Das Pergam ent ist sehr beschädigt und stark beschnitten. Dies ist deutlich ersichtlich; denn in den letzten Zeilen findet sich das W ort Avinu. In der zweiten Kolum ne sind W orte stets abgekürzt.
Es muss noch bem erkt werden, dass diese Folianten, welche unpunk- tie rt sind, ganz pleno geschrieben sind. Das heisst, dass auch dort ein Vav vorkom m t, wo n u r ein Kamaz hingehört.
Palaeographisch ist die eigentüm liche A rt des Lamed, was bereits oben beschrieben ist von grosser Bedeutung.
1.) F ragm ent eines kolorierten und illu s trie rten (? ) P 'ach tm achsorsF orm at 163 x 113 mmSignatur des F ragm entes: MS Ba ZI Heb 14Aus dem Einbande des Buches: D anticanus, A rthusias M. Gotar-
dus: M ercurii gallobelgici rerum in Gallia et Belgo po tiss im u m . . . . F rankfu rti, 1609.
S ignatur des Buches MS Ba F r 10438. Das Buch war ursprünglich im Besitze des Franziskanerklosters in Skalica.
Eine besondere Stellung unter den hebräischen F ragm enten in P ressburg nim m t das F ragm ent eines P rachtm achsors ein, der sich durch zwei Dinge auszeichnet.
Erstens: Dass e r einen K om m entar hatte und zweitens: dass er in F arbenprach t prunkte. Der K opist verstand es näm lich, sein W erk fürs Auge dadurch anschaulicher zu gestalten, dass er die einzelnen Zeilen abwechselnd rot — schwarz zu schreiben beginnt und dass er auch die Zeilenenden abwechselnd rot und schw arz schrieb. E r wollte so die ein- zelnen Strophen besonders betonen und unterstreichen.
Das Fragm ent zeigt auch ein einziges Bild. Ü ber dieses kann ich aber nichts Genaues sagen, weil bis heute der E inband des Buches nicht geöffnet ist. A ber auch so konnten die obenbeschriebenen Tatsachen festgestellt werden. Es konnte weiter festgestellt werden, dass dieser M achsorteil fü r Rosch H aschana bestim m t w ar und den P iu t fü r “Hao- ehes Be-Jad m idat M ischpat” (siehe Davidson II. Hé N r. 19) zum M ussafgebet anführt. Dieser P iu t erstreckt sich auf beide Seiten des E inbandes und füllt so das Pergam ent sowohl recto als auch verso aus. Die auf unserem Bilde sichtbaren Buchstaben stammen aus dem Vers- teil, der m it A jin beginnt. Die Masse der Fragm ente können aus dem obenangeführten G runde nicht genau angegeben werden.
Da dieses Fragm ent nicht genügend zugänglich ist, kann ich m ich vom palaeographischen Aspekt dazu vorläufig n icht äussern.
14.) M achsorfragm ent fü r Sukkot (H oschana R abba) F orm at: M omentan n icht festzustellen, da das Fragm ent — ein Privatbesitz — m om entan n icht v o rlieg t) .
Ohne Signatur.Aus einem näher n icht bekannten E inband.E in M achsorfragm ent aus einem M achsor fü r die Sukkothtage,
68
— y . . j t f ' i p ü i ו r r ' 1HMMMknlh 1 M M VM Il- r » ? 7 ר נ C t 2 y & t״ ^ q t ' T J t י ד ד י5ק י
־1ב ד ב י ל ש ע י ל י ע ד ב ז י ו א ־ י ד י ב י ^ י ש ב י •
^ ? n t f ^ arw n 1 7 דר0*7ר7ליי3ש — gra» run ?ם ■> ■! a^7P?try j
ב י ד ע ה נ י מ מ ז י ד י ב ״ ד ע * ר ״ 5י3מ ר ב ד כ ח
ד י־0ד ;— ] T<3rS 8 r j y׳ p y r s r י י”ב ב j
י ד ל י ו ב ב י י ו ב ־ ל ע ׳ ז ז י ז ^ ־ י י « ־ ? ס ב
< r r ' גי׳פ rarre ant r q r a p g ד יז3מ
A bb ildung 11
präziser fü r H oschana R abba. Dieses B latt ist oben sta rk beschnitten, recto fehlt der rechte Teil, verso d er linke Teil. A uf rec to ist bloss das Zeilenende, der R efra in ist geblieben, näm lich die W orte ’H oscha n o ” , “ O h ilf doch” . An dem erw ähnten T age w erden viele G ebete rezitiert, die diesen R efra in haben, so dass es unm öglich ist, d ie präzise Bestim- m ung m it S icherheit zu geben und dass H oschana Gebet, welches sich auf diesem Blatte befindet, genau zu bezeichnen.
Von der V ersoseite lässt sich noch viel w eniger m it Bestim m theit sagen. Es kann h ie r n u r verm erkt wrerden, dass sich auch dort ein H oschanagebet befand, welches im akrostichonischen A lphabet abgefasst war. A uf unserem F ragm ent befinden sich nu r zehn A nfangsbuchstaben.
Es kann vielleicht die V erm utung ausgesprochen werden, dass es sich h ier den “ Eeroch Schui” handelt (siehe Davidson I. Alef Nr. 7071). Zu dieser V erm utung gelangte ich nach genauer P rü fung der Punktie- rung der übrigen Buchstaben. Zur Schrift lässt sich bei einem so kleinen
69
F ragm ent eines P rachtm achsors wenig sagen (kolorierter M achsor). Verso sind die akrostichonischen Buchstaben in ro ter S chrift geschrie- ben. Die Entstehungszeit dieser H andschrift festzustellen, b in ich ausser- Stande, denn die paar Buchstaben, die h ier erhalten sind, haben keine Charakteristika, die es erm öglichen w ürden, diese H andschrift zu datie- ren. Die S chrift w ar lin iert und auch punktiert. A uf der verso Seite sind sogar die akrostichonischen Buchstaben m it Q uerpunkten versehen. Die zur L inierung notw endigen Löcher sind noch heute deutlich sicht- bar.
15.) M achsorfragm ent fü r Schm ini Azeret.F orm at 2 8 8 x 2 0 7 mmS ignatur des F ragm entes: MS Ba ZI Heb 6P ergam entfragm ent aus den Rücken - und Seitentafeln des Buches
(ohne T itelblatt, lau t einer handgeschriebenen A nm erkung) G ram m atica greca . . . Brunswigae 1554.
Das Buch ist aus dem Piaristenkloster in Podolinec.Sign. MS Ba / ohne Inventarnum m er.Recto (A bbildung 11) oben b ring t das Folio den letzten Teil der
M aariwpoesie fü r den achten T ag des Sukkothfestes, den sogenannten Schm ini Azereth. Es muss bem erkt werden, dass er n icht identisch m it den bekannten Poesien fü r diesen Tag ist. In dem unteren Teil recto beginnt die M aariw poesie fü r den neunten T ag des Sukkothfestes, den sogenannten Sim chat Thora. A uf recto befindet sich davon der erste Teil. Der zweite Teil beginnt auch noch auf recto, w ird jedoch auf verso fortgesetzt.
Verso ist dann m it dem dritten Teil ausgefüllt, der in einer Poesie m it einem A krostichon ist. Von diesem A krostichon sind die Buchstaben von Alef bis A jin erhalten. (Siehe zu diesem Teil D avidson I. Alef N r. 8541 ). Es m uss bem erkt werden, dass der K opist in dem ersten Teil dieser Poesie, der sich auf recto befindet, sta tt des Alef ein A jin schreibt. Verso ist sehr blass, kaum m ehr lesbar, recto indessen deutlich und rein. Dies ist dem U m stande zuzuschreiben, dass recto beim E inband nach innen kam , verso dagegen nach aussen, so dass es der Abwetzung m ehr ausgesetzt w ar.
Dieses F ragm ent gehörte einem M achsor an, in welchem die M aariw- poesien aneindergereih t w aren. Also n ich t so wie in den gewöhnlichen M achsorim auch in den handsch riftlichen ), in welchen zum eist die Poesien nach den Tagen geordnet sind. Die M aariwpoesien sind n icht konzentriert. Vergleiche jedoch M achsor V itri von Seite 655 bis Seite 583.
Dieser M achsor w ar punktiert, was in der un teren H älfte recto noch k lar sichtbar ist. Ob jedoch auch die obere H älfte ursprünglich punktiert war, ist fraglich. F ü r verso ist dies jedoch m it Bestim m theit anzuneh- men.
Der K opist beweist grosses V erständnis fü r Ästhetik. E r hebt beson- ders die Sym m etrie hervor. Denn er ist bedacht, die Buchstaben bis zum Zeilenende auszuziehen, dam it keine Lücken enstehen sollen. W o dies n icht möglich ist, füllt er den leeren Raum m it einem grossen “K am ata’
70
aus, näm lich m it einem langen Strich, un ter dem sich ein P unk t befindet. Siehe recto Zeile zwei von oben, als auch Zeile 9. M ehr ist n icht zu erkennen, da das P ergam ent sehr vergilbt und veraltert ist. Der K opist benützt auch die L igatur, näm lich das Alef verbindet er m it Lam ed. Das T etragram m kürzt er in zwei Jad im , welche links m it einem Nun inversum flankiert sind.
Palaeographisch gesehen, kann m an die H andschrift spätestens in den A nfang des XV, Jahrhunderts einreihen.
16.) Zwei M achsorfragm ente zu SchebuothForm at: A : 9 7 x 2 0 0 mm
B : 90 x 200 mmS ignatur der F ragm ente: MS Ba ZI Heb 9A usschnitte aus dem E inband des Buches:M orton, T h .: Secunda pars apologiae catholicae . . .Londini 1606.Das Buch stam m t aus der Franziskanerbiblio thek Skalica.
S ignatur: MS Ba E r 15762.Diese zw ei obenerwähnten Bruchteile gehören zueinander und
enthalten einen Teil der liturgischen Gebete fü r Schebuoth.Fragm ent A. en thält einen Teil des Jozer fü r den zweiten Tag
des Schewuothfestes und eine P araphrase der zehn Gebote. Auf der Seite recto befinden sich der zehnte Teil der K eroba des Sim on ben Jizchak ben Abun, welcher in einer verkehrten alphabetischen Reihenfolge abge- fasst ist, das heisst m it dem letzten Buchstaben Taw beginnend. H ier haben w ir die Verse von A jin , fortlaufend, dies bedeutet sechs Vers- glieder. Die neunte Verszeile, respektive die letzten zwei Versglieder, sind strenge genom m en bloss B indeglieder zwischen dem 10. und dem komen- den 11. Teil der K eroba. D ieser Teil ist auch auf der recto Seite dieses Blattes. E r ist in alphabetischer Reihenfolge verfasst. D er Schreiber benützt ein M ajeskulum Alef, um den A nfang eines neuen Teiles anzu- deuten.
Von diesem P iutteil sind nu r drei kom plette Verszeilen, respektive sechs V ersglieder erhalten, das heisst von Alef bis Vav. Von der vier- ten Verszeile ist n u r der obere Teil teilweise erhalten, der untere Teil ist gewaltsam beschädigt (beim B inden ).
A uf der Verso Seite: In der oberen Zeile sind die letzten W orte des zwölften Teiles des sogenannten Seder der erw ähnten K eroba vor- zufinden, welche in einem A krostichon den N am en seines A utors Simon ben Jizchak Chasak anzeigt. D ann folgen zwei Zeilen in k leinerer Schrift, die erste Zeile enthält B indew örter zwischen dem Seder und dem Siluk, das heisst der Beendigung der K eroba. Diese zweite Zeile enthält auch tatsächlich die A ufschrift S ilu k = Beendigung.
Dieses M achsorfragm ent ist recto und verso sowohl oben als auch unten beschädigt. Dies tr itt schon dem blossen Auge deutlich zum Vor- schein und w ird auch durch den Inhalt eindeutig bewiesen. W ir können daher m it Sicherheit annehm en, dass die Höhe des ursprünglichen M achsorfolios m ehr als die Breite betrug. W ahrscheinlich hatte dieses Pergam entblatt ursprünglich Masse von 30 x 20 cm ( ? ) .
Zu der oben erw ähnten K eroba siehe D avidson I. un ter Alef
71
Nr. 2010. Zu den Detailen Davidson III . Taw N r. 595, in ersten Teil un ter Alef 5927, un ter I II . Schin 1189 und II. Vav Nr. 288.
F ragm ent B recto und verso enthält die Fortsetzung des A und die sogenannten A charot. In unseren M achsorim sind die fü r den M ussaf des zweiten Tages des Schebuoth (siehe Davidson I. Alef N r. 2186) bestimm t.
Zum U nterschiede zum Fragm ent A ist B nu r unten beschädigt. W ir haben also bloss den oberen Teil, da der untere Teil fehlt.
N ach dieser Beschreibung ist es klar, dass diese zwei Pergam ent- fragm ente ursprünglich einander folgten. Der Schrift nach scheinen die Fragm ente dem Ende des XV. oder dem A nfang des XVI. Jahrhunderts anzugehören. Nach alter S itte sind die Buchstaben m it Rafe, das heisst, dass sie ohne Dagasch gelesen werden, ohne Strich.
Das Pergam ent ist lin iert und die Buchstaben punktiert. Das T etragram m w ird m it zwei Jodim geschrieben, die an der linken Seite m it einem N un inversum flankiert sind, welches m it dem zweiten Jad verbunden ist und von ihm auszugehen scheint. Der Schreiber benützt die L igatur und verbindet A lef m it Lam ed, er zeichnet aber dabei auch den linken Fuss m it Alef.
IX . BU SSG E B E TSA M M LU N G :17.) M achsorfragm ente m it Selichot:F orm at: A: 176 x 1 0 1 m m
B: 176 x 103 mmS ignatur der Fragm ente: MS Ba ZI Heb 2Die Fragm ente A. B. w urden von dem Einbanddeckel des Buches:
N eander, C onradus: Epistolas anniversarias . . . ebreice, latine ac ger- m anias, Lipsiae, 1585 entnom m en.
Das Buch w ar Eigentum des Franziskanerklosters Skalica. S ignatu r: MS Ba F r 11206.
Fragm ent A enthält sowohl recto als verso verschiedene Selichot. Es ist jedoch sehr schwer festzustellen, welche Seite recto und welche verso ist, da es m ir n icht gelang, die präzise Iden titä t festzustellen. Doch auch dann hätte es die Reihenfolge der Selichot nicht m it Sicherheit festgestellt, da die Selichotordnungen so m annigfaltig sind und die Reihenfolge sehr wechselvoll ist.
M it S icherheit lässt sich nu r eine Selicha identifizieren. Sie beginnt m it einer M ajuskel. Trotzdem , dass von dem ersten Buchstaben nu r der linke Fuss übrig blieb, ist er sicher ein Taw. Es ist dies die Selicha die Davidson im III . Band un ter Taw N r. 429 anführt und die fü r den V ersöhnungstag bestim m t ist.
Dieses F ragm ent ist sowohl oben als unten und auch auf beiden Seiten beschnitten.
F ragm ent B muss ebenfalls zu den Selichot des Versöhnungstages gehören; ob es de facto B ist und nicht A, kann nicht bewiesen werden. Ich wählte deshalb die Bezeichnung, weil ich in dem sogenannten Frag- m ent A einen sicheren A nhaltspunkt fand, w ährend ich in B keinen fand.
72
^ w כיו ■ממן © 1^ *1 ü י - ־ • נ ן £ ד & ) * י י $ ג ן י V* >*נ ; i* m v t m ß י .
י־עיגץ ס* יימץ 0!ןיי*1י **כ ^יימימ*ין ני
ט*ע*ר׳fvyi ♦טי* W$?%* ,׳'2מל$0טל«מי יי8*ה *מ ^:♦ועיי
* * ו מ * ט י י1שy 0י נ ו ע ♦ % ג * י ע
w » a׳W # Ö ׳& \ נ & כ * ? ע י * ש י י a♦ ז p N f f Ä w ל מ י ? «8י ^ ״ ע ד כ & לז
3. *׳׳ ב7* 9 * י * ( ' \ é" 1 ז ) j 1 » # ! w w * ש » נ יי ד י ^ י ט ו י ? ^0 ? » ש
ג י ע ^ ה י ל »ז * י ( * r מי y v« ו ^ ד מי ע !5 י <11מ ^ $ 3>י ע 5W ת ^ ^ ת י ד ו י ע m' *י♦4? ש v j * w * p v
י ד' ע צ מ ז י ־1• *י -**4* * ׳ י1י״« •<»)-: .2י ״ י י ׳ . ׳ ♦<»%* י־*.* , *,ז־י׳w 0 ־ ידיעון עיי*»י1 כ^ילך -ייי>ו*^ כ4 . ט •■ ה*יז י♦*/•
?&**? »lyA V<** ?גכ״״י* י>י w.w ' ע.י»ע ?‘14«״/״«^ יw ?כ*ג#/»׳׳יש^ c?~ י*י? שי*י **ץ י*ך4 י*״. hi.
v» ** עז10י0י inup* *v ry ■י*,־ז>וי•. ען*ייי.*• יו *יו»
j • י יוי״^ *♦•^יך ♦י ^1 v tru n :
v? 1> י—»** mמ ט ש ' V w* י ' t w ^ ♦ t . י י * י ו **1 •*נ ד כ י י ( * ^1 j A w è r w w r j
12 A bbildung
Die Schrift ist in beiden Fragm enten dieselbe, die Rafebuchstaben sind m it einem S trich oben bezeichnet. In beiden finden w ir die L igatur Alef m it Lam ed (die L igatur ist im linken Fuss des A lef). Das Tetra- gram m w ird in beiden Bruchstücken m it zwei Jad und einem N un inversum geschrieben. Die Schrift scheint, palaeographisch gesehen, aus dem X IV . Jah rhundert zu stammen. Beide F ragm ente sind punktiert und höchst- w ahrscheinlich auch liniert, was jedoch m it freiem A uge nicht feststell- b a r ist. Es ist m ehr als w ahrscheinlich anzunehm en, dass beide Frag- m ente aus einem Selichot — Codex sind und aus einer H .md stammen׳Dies auch trotzdem , dass die Schrift im Fragm ent A grössere Buchstaben aufw eist als im Fragm ent B.
Es muss noch bem erkt werden, dass das F ragm ent B nu r auf den beiden Längsseiten beschnitten ist, oben und unten jedoch nicht.
1.) M achsorfragm ente m it verschiedenen Selichot
73
Form at: A 2 0 1 x 1 6 1 m m B 293 x 158 mm
S ignatur der Fragm ente: MA Ba ZI Heb 1Die Fragm ente C D gehörten zu dem E inband des Buches: apo-
calypseos, id apocalypsis D. Jaarius. F rank fu rt 1609. Das Buch hat die S ignatur MS Ba F r. 2355.
Die F ragm ente w urden zum E inband des Buches:Pareus, D avid: In divina ad hebreos S. Pauli apost. epistolam comen- tarius, F rankfurt. 1609, verwendet.
Das Buch gehörte in die B ibliothek des Franziskanerklosters Skalica. S ignatu r: MS Ba F r. 11213.
Die zwei Fragm ente A und B gehören zusamm en und stam m en aus einem Codex, in welchem sich eine Sam m lung von Bussgebeten befand, von einem sogenannten Selichothbuch, in welchem sich zum indest 203 Bussgebete befanden. Es m ag sein, dass es ein selbständiges Selichoth- buch w ar, es ist aber auch n icht ausgeschlossen, dass es n u r ein Teil eines grossen M achsors war, in welchem säm tliche Gebete des ganzen Jahres enthalten w aren und m it ihm auch die Selichoth fü r den Ver- söhnungstag und die übrigen Bussetage, an welchen diese gebetet w erden.
Folio A recto (A bbildung 12) ist an der rechten Seite beschnitten, so dass die A nfänge der Zeilen fehlen (verso ist demzufolge links be- schn itten ). A uf A recto befindet sich die Selicha die m it den W orten “ M eitcha T ehilati” beginnt; diese Selicha w ar in unserem Codex m it der N um m er 189 bezeichnet. Es ist dies eine Selicha. die fü r das M inchagebet des Versöhnungstages bestim m t ist (siehe Davidson III . M. Nr. 131). Diese Selicha stam m t aus der Feder von M ordechai Hason. Das Akrosti- chon ist in neun Strophen aufgestellt, und ergib t den Nam en des Ver- fassers. U nsere Seite beginnt m it der M itte der vierten Strophe, die m it K af anfängt. N ach dieser Selicha steht in einer abweichenden Schrift, die kleiner ist, “El M elech” . . . “V aja -—- V er” . . . und viele biblische Verse, die zur Selichoth gehören. In der M argine befindet sich die Bezeichnung aus einer anderen Feder. Sie ist auch m it anderer T inte geschrieben und deshalb w ahrscheinlich aus einer späteren Zeit. Akeda, eine A rt Selicha (siehe Davidson, I. Alef Nr. 8517 ). Die M argine gibt an, dass sie sich un ter N um m er 203 befindet. In den letzten zwei Zeilen recto beginnt die Selicha, die m it den W orten “B rit Ke — R uta mi lischkoah” anfängt, welche aus der Feder des R abbi Bin jam in ha — K atan, dem Sohne des Rabbi Jechiels, stam m t. Diese Selicha ist auf die tragischen Ereignisse der Kreuzzüge aus dem Jah re 1096 abgefasst. An der Seite ist die N um m er der Selicha m it K af Zadok angegeben, das heisst, dass es die 190. Selicha des Codexes ist (siehe Davidson, II. B un ter N um m er 1717). Verso ist gänzlich von dieser Selicha ausgefüllt, die sogar auf B recto übergeht, und die ersten sieben Zeilen dieser Seite ansfüllt. Dann folgen einige Zeilen in k leinerer Schrift, die w ieder Bibel- zitate anführen, die zu der Selicha gehören. Dann folgt eine Selicha welche m it den W orten “El h a r ha — m or G ivad” beginnt und die von B recto auf verso übergeht (siehe Davidson, I A lef N r. 6503).
Nach dieser Selicha ist m it derselben Schrift und derselben Grösse
74
der P ism an “ADONAI AFONAT” (Siehe Davidson, I. Alef N r. 2275) aufgezeichnet. H ierauf folgt in derselben Schrift in einer separaten Zeile “Le Ne — lila” . Das bedeutet, dass die kom m ende Selicha fü r das Neillagebet bestim m t ist. Dann folgt die Selicha “ Umi Ja — M aod” (siehe Davidson, II . Tav nach der N um m er 399 wie auch im Band I I I T av Nr. 4 3 1 ). Auch aus unserer Selicha geht hervor, das , sie entgegen Davidson eine separate Selicha ist, und n icht ein Teil e iner grösseren Selicha. An der Seite bei Beginn ist die Zahl m it K af Zadek Bet ange- geben. Dies bedeutet, dass es die 192. Selicha ist.
In diesem zwei F ragm enten haben w ir verschiedene Selichot fü r das M incha und Neilla des V ersöhnungstages. Vergleiche hiezu die “Randbem erkungen zum täglichen Gebetbuche” von P rof. A. Berliner, Berlin 1912, Seite 78. wo verschiedene Selichotordnungen für das M inchagebet des V ersöhnungstages zusamm engestellt sind. Sie sind elf an der Zahl, aber keine von diesen ist m it der unseren identisch.
Aus diesem Selichotbuche kennen w ir noch zwei Fragm ente (C, D ), S upralibros ICM 1609, alte S ignatur 2355.
Da diese vier F ragm ente zusam m engehören und fortlaufend sind, e rübrig t es sich, von den F ragm enten C D eine nähere Beschreibung zu geben. Auch die S chrift bestätigt, dass sie aus derselben Selichotsam m lung stammen, wie die bereits oben beschriebenen Fragm ente A und B. Die in M argine angegebenen Zahlen der zwei Fragm ente zeigen an, dass es sich um die Selichot 195, 196, 197 und 198 handelt. F ragm ent C recto ist oben und an der Seite beschnitten, verso ist logisch die Beschneidung links. In der oberen Hälfte ist die Beendigung einer Selichoth, die in dieser Sam m lung m it N um m er 194 bezeichnet war.
Dann folgt die Selichoth N um m er 195 “ Beaschm oret H aboker” (siehe Davidson II. Bet Nr. 10 ). W ie aus dem Zusam m enhang von recto zu verso ersichtlich ist, fehlen ungefähr 2 - 3 Zeilen und zw ar darum weil das Folio oben beschnitten ist. Verso ist die Beendigung der oben erw ähnten Selicha. D ann folgt die 196 Selicha, die m it den W orten “ Jachbienu Zel — Jado” beginnt. Diese Selicha w ird dann auf Frag- m ent D fortgesetzt (siehe darüber D avidson II. un ter Jad Nr. 2428). A uf Fragm ent R folgt die Selicha 197, die m it den W orten “ Jasm ienu Solachti” beginnt, die dann verso abgeschlossen w ird (siehe D avidson II. Jad N r. 411 6 ). Verso unten beginnt eine Selicha m it den W orten “Jeraze Zorn AM OH” (siehe Davidson II. Jad II. N r. 3920 ).
Palaeographisch genom m en gehört die S chrift dem XV. Jah rhundert an. D ie Schrift h a t eine besondere M erkw ürdigkeit, dass näm lich der Alef aus einem Jad und einem Vav besteht. Das T etragrannn besteht aus zwei Jadim . die links m it einem N un inversum geschrieben sind.
IX . M A C H SO R K O M M E N TA R E :19.) E in P iutkom m entarF orm at: noch unbekannt, da das F ragm ent vom E inband noch nicht
abgelöst ist.S ignatur des F ragm entes: MS Ba ZI Heb 13Das Fragm ent ist im E inband des Buches:
A bbildung 13
Grasser, C onrad: H istoria A ntichristi, Lugduni B atavorura 1608.Aus der B ibliothek des Franziskanerklosters Skalica.
S ignatur des Buches: MS Ba F r 10129.Ein interessantes W erk.E ine der darauf sich befindlichen Selichot. au f welche sich der Kom-
m entar bezieht, konnte ich agnoszieren. Es ist dies die Selicha, welche m it den W orten “ Schalom Tischpot L anu” (siehe Davidson III . Sch. N r. 1929) beginnt.
Im Falle, dass dieser auch vom Einbande gelöst w ird, w ird es m öglich sein, auch diesen K om m entar genauer zu bestimmen.
M it diesem Fragm ent schliesse ich die Reihe hebräischer Fragm ente in alten Bucheinbänden einstweilen ab. Ich betone einstweilen, denn ich b in überzeugt, dass diese Studie eine A nregung zur weiteren Suche und Forschung sein wird. Ich selbst bin schon auf der Spur weiterer F ragm ente, so in Bratislava als auch in B rünn und anderswo. Dieses Gebiet ist n icht n u r fü r die hebräische Geistesgeschichte, sondern auch fü r andere äusserst anregend. Ich kann h ier zum Beispiel ein F ragm ent eines Bibeltextes (Ezechiel 32. 22 ff) in slowakischer (tschechischer?) Sprache anführen (A bbildung 13) welches fü r die Slawistik sehr wert- voll zu sein scheint. Mit diesem Fragm ent beschäftige ich mich n u r in- sofern, als dass ich genau lokalisierte. Die philologische Seite überlasse ich Fachm ännern. Zu textkritischen Fragen dieses Fragm entes werde ich mich noch äussern.
76
Diese Studie ist fü r m ich n u r der A nfang auf diesem Gebiet. Essind noch m ehrere Biblio'.heken in Bratislava und vor allem, in der ganzen CSSR. die eine grosse Menge solcher Fragm ente bergen können.
Leider stösst diese Aktion auf verschiedene prinzipielle Schwierig- k eiten :
a.) alte Bucheinbände sind geschütztes K ulturgut und unterliegen dem D enkm alschutz;
b.) das A nfertigen entsprechender Bucheinbände als Ersatz für die alten ist ein hoher finanzieller Kostenpunkt.
Diesen Tatsachen zum Trotz halte ich die Forschung auf diesem Gebiete fü r äusserst wichtig. V or allem vom Standpunkte der Geschichte der hebräischen H andschrift w äre aber ein solches U nternehm en not- wendig sowohl für die Palaeographie als auch fü r die H andschriftenkritik , da diese Fragm ente — wie dies auch diese kurze Auswahl beweist — sicher neue V arianten enthalten.
Ich hoffe und werde mich bem ühen, m it G-ttes Hilfe diese For- schung weiter fortzusetzen und einen K reis von M itarbeitern unter unseren Bibliothekaren zu gewinnen. Denn allein, kann sich niem and diecer A rbeit unterfangen.
77
Jahrgang 1966 Nummer 2/3
ZEITSCHRIFT ESP DIEGESCHICHTE
DER
JUDENH E R A U S G E G E B E N
V O NH U G O G O L D
dlAMÈNbTU AVIV_______ I S » A I l
Zeitschrift 1966 N0* 2/3 für die Geschichte der Judentel-Aviv, P.O.B. 3002, (Israel)
Erscheint vierteljährlich Tel-Aviv, April-Sepfember 1966
י 5726 ר ש ת - ן נ י סAus dem Inhalt:Oberabbiner Elijahn Katsc (Bratislava)
M ittelalterliche Hebräische Handschriftenfragmente aus Bratislava (II, Teil) W
Dr. Max Brod (Tel-Aviv)Der Prager Kreis 79
Zeev B arth (Ram at-Gan)Zur Geschichte der Judengemeinde Vrbové 81
Dr. Wilhelm Benda (Frag)Das staatliche jüdische Museum ln Prag 85
Melr Faerber (Tel-Aviv)Mittelschülerverbindungen in der zionistischen Bewegung der CSR 95
Ludwig Blum (Jerusalem)S ta tt einer Autobiographie 108
Dr. Jehoschua Guvrin [Oskar Grnnbaum ] (Tel-Aviv)Unglück, Glück und Tragödie des m ährischen Judentum s Herzog Albrecht V. — ein Vorläufer Hitlers 111
Dr. Fritz UUmann (Jerusalem)Die Judengemeinde Luck und ih r Untergang 117
Dr. W alter S. Kobner (Haifa)“ Barissia” — Portrait einer Studentenverbindung 125
Dr. Oskar Neumann (Tel-Avlv)Zur Geschichte der Zionistischen Jugendbewegung in der Slowakei 133
Artur Herzog (Tel-Aviv)Erinnerungen und Eindrücke von der I. Makkabiah ln Tel-Aviv im Jahre 1932 143
Ing:. E rn st F uchs (Tel-Aviv)Der tschechoslowakische MakkabikreisEine Würdigung und Ehrung seiner Toten 148
Dr. Mosche Atlas (Jerusalem)Die jüdische Geschichte der S tadt (Bartfeld, B artfa) und des Bades Bardejov in der Tschechoslowakei 151
Judaica — Jüdische L iteratur — Allgemeine Geschichte Verschiedenes
Jeder Beitrag erscheint unter eigener Verantwortung des Verfassers. Für Manuskripte, die nicht im Einvernehmen mit der Redaktion eingesandt werden, ivird keine rechtliche Haftung übernom- men. J Es wird gebeten Manuskripte einseitig zu, schreiben —
erwünscht mit Schreibmaschine. / Eine Verpflichtung zur Besprechung oder R ü c k s e n d u n g unverlangt eingesandter Bücher wird nicht
übernommen.
Nachdruck nur mit ausdrücklicher vorheriger Genehmigung des_____ Verlages und des Autors gestattet_________________
Redaktion und Verlag PUBLISHING HOUSE “OL A M E N U ” Tel-Aviv, P.O.B. 3002 Tel. 220025 ISRAELHerausgeber und Chefredakteur — H U G O G O L D , Tel-Aviv
Abonnement (nur ganzjährig) U S$ 8.50, DM 34.— ö.S. 250.—































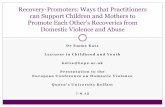






![Profánnosť v myslení kresťanských humanistov. In: Pohanstvo a kresťanstvo. [Zborník z konferencie usporiadanej 5. – 6. II. 2003 v Banskej Bystrici.] Bratislava : Chronos,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632454d45f71497ea904c181/profannost-v-mysleni-krestanskych-humanistov-in-pohanstvo-a-krestanstvo.jpg)

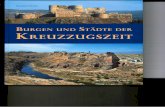



![Luteránsko-rímskokatolícky dialóg: Od Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení po súčasnosť [Diplomová práca, Bratislava: EBF UK]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63199995b41f9c8c6e09d07c/luteransko-rimskokatolicky-dialog-od-spolocneho-vyhlasenia-k-uceniu-o-ospravedlneni.jpg)


![Yugoslav Myths [IESIR Bratislava Working Papers 2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b96d03e8acd9977057f7f/yugoslav-myths-iesir-bratislava-working-papers-2007.jpg)




