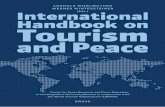Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand des 16. und 17. Jahrhunderts
Transcript of Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand des 16. und 17. Jahrhunderts
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand
des 16. und 17. Jahrhunderts
Philipp Walter
I.
Das Phänomen akademischer Landstandschaft ist im Rahmen der bisherigen stände-, universitäts- und landesgeschichtlichen Forschung entweder vollständig ignoriert oder allenfalls im Rahmen einiger weniger allgemeiner Ausführungen erörtert wor-den. Dies findet seine Ursachen in der disparaten Forschungslage zu den landständi-schen Entwicklungen und Institutionen im Reich im Allgemeinen und einzelner Ku-rien oder Ständegruppen im Speziellen. Für die Universitäten kommt erschwerend hinzu, dass sich nur wenige von ihnen auf den Landesversammlungen ihrer Territo-rien finden und man zudem unterscheiden muss, ob die Korporation als solche oder lediglich in Vertretung landsässiger Güter, mit denen die Hohen Schulen durch den Landesherrn fundiert wurden, zu den Landesversammlungen berufen wurde.
Exemplarisch dafür steht das erste sichere Auftreten der Universität Leipzig im Rahmen einer kursächsischen Landesversammlung.1 In einem Schreiben an Kur-fürst Moritz vom 25. Oktober 1550 entschuldigt sich die Universität für ihr Nicht-erscheinen auf dem unmittelbar bevorstehenden Landtag in Torgau, erklärt sich aber gleichzeitig dazu bereit, dass alles, was die fünf Universitätsdörfer aufgrund der Landtagsbeschlüsse zu leisten hätten, auch von diesen abgestattet werden würde.2 Dass die Alma Mater Lipsiensis aufgrund der ihr 1544 aus dem Besitz des Thomas-klosters übertragenen fünf neuen Universitätsdörfer zu erscheinen hatte, war aber vielmehr eine Vermutung der Universität selbst, als dass sich solches aus dem kur-
1 Einzelne Universitätsprofessoren lassen sich sporadisch auch schon zuvor als Berater bzw. Gutachter im Rahmen der Landesversammlungen fassen. So finden sich etwa die beiden Leipziger Juristen Simon Pistoris (von Seuselitz) und Georg (Jörg) Breitenbach auf dem Leipziger Landtag von 1537. Dabei werden diese im Anschluss an die Proposition als Mitglieder einer fünften Gruppe „Juristen“ (neben Grafen, Prä-laten, Ritterschaft und Städten) genannt, ohne dass sich etwas über ihr konkretes Wirken sagen ließe. Vgl. Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (im Folgenden: SächsHStA Dresden), 10024 Geheimer Rat, Loc. 9353 / 13, Bl. 22v.
2 Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9355 / 1, Bl. 109r. Zu den fünf neuen Universitätsdör-fern Zuckel- und Holzhausen, Kleinpösna, Wolfshain und Zweenfurth vgl. Karlheinz Blaschke, Die fünf neuen Leipziger Universitätsdörfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Universität und des Leipziger Landes, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Leipzig, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe Nr. 3, (1952), Heft 5, S. 76–125.
Philipp Walter128
fürstlichen Ausschreiben explizit hätte erkennen lassen.3 Die Universität bewegt sich dabei klar in tradierten Argumentationsmustern, wenn sie davon ausgeht, dass sich die Legitimation von Landstandschaft entweder kraft alten Herkommens oder aufgrund von Landesfreiheiten herstellen ließe und die Qualifikation dafür über „Geburt, Besitz eines landsässigen Gutes, Amt als Magistrat oder Prälat erfolgte“4. Inwiefern eine dieser Qualifikationskriterien auch für die Alma Mater Lipsiensis an-genommen werden kann oder ob nicht speziell für diese wie andere Universitäten im Reich weitere Argumente herangezogen werden müssen, soll im Folgenden dis-kutiert werden.
Festzuhalten bleibt zunächst, dass die Universität Leipzig ab 1550 zu den kursäch-sischen Landtagen berufen wurde; spätestens seit 1561 gemeinsam mit der Witten-berger Leucorea.5 Dabei spielt es für die Tatsache akademischer Landstandschaft auch keine Rolle, dass die Universitäten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Landesversammlungen häufiger fernblieben oder sich durch externe Bevoll-mächtigte vertreten ließen.6 Die Rechtmäßigkeit der Einladungen und die mit de-ren Annahme akzeptierte Landstandschaft blieben dahingehend unwidersprochen.
Im Folgenden soll ein knapper Überblick des aktuellen Forschungsstandes zur kursächsischen Ständegeschichte wie der punktuellen Beiträge zur akademischen Landstandschaft geliefert werden und eine quantitative wie qualitative Analyse uni-versitärer landständischer Vertretung im Reich im Allgemeinen wie der Leipziger Universität im Speziellen erfolgen. Dazu wird in einem ersten Schritt die Frage zu beantworten sein, welche Universitäten überhaupt Sitz und Stimme auf den Landes-versammlungen ihrer jeweiligen Territorien wahrnahmen und, sofern sich dies ex-plizit beantworten lässt, was sie dazu qualifizierte. Da das Phänomen akademischer
3 Zwar ist das Ausschreiben an die Universität nicht überliefert, doch zeugt die akademische Antwort von einer spürbaren Unsicherheit hinsichtlich der Begründung der bis dato unbekannten Landstandschaft. So hätte der Kurfürst die Universität „uf den itzt vorstehenden Landtag genediglich haben erfordern laßen, welliches dan on Zweivell von wegen der fünf Dörfer domit E. Churf. G, uns genediglich begnadet besche-hen“. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9355 / 1, Bl. 109r. Bei einem eindeutig formulierten Ausschreiben wäre die Bekräftigung unnötig, dass dieses ohne Zweifel aufgrund der neuen Universitäts-dörfer geschehen wäre.
4 Barbara Stollberg-Rilinger, Ständische Repräsentation – Kontinuität oder Kontinuitätsfiktion?, in: Zeit-schrift für Neuere Rechtsgeschichte 28 (2006), S. 279–298, hier S. 281.
5 Die Universität Wittenberg findet sich bereits auf den ernestinischen Landtagen von 1511 und 1518. Für 1511 vgl. Carl August Hugo Burkhardt, Ernestinische Landtagsakten, Bd. I (1487–1532), Jena 1902, S. 80; für 1518 ebd., S. 125. Doch lassen sich weder weitere Einladungen noch die Wahrnehmung derselben seitens der Leucorea nachweisen, sodass auch dabei Uwe Schirmers Befund gültig bleibt, wonach man von einer (einzelnen) Einladung kaum auf die Landstandschaft des davon Betroffenen schließen könne. Vgl. Uwe Schirmer, Die ernestinischen Stände zwischen 1485 und 1572, in: Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen, Bd. 27, Weimar 2008, S. 23–50, hier S. 30. Dies gilt letztlich auch für das einmalige Auftreten in der Landtagsüberlieferung, die gerade in der frühen Zeit kaum Begründungen für das Erscheinen einzelner Personen oder Institutionen liefert.
6 So übernahm der seit 1539 in kurfürstlichen Diensten stehende ehemalige Leipziger Bürgermeister und Ordinarius der Juristenfakultät, Ludwig Fachs, 1552 auf Bitten der Universität die Vertretung ihrer Inte-ressen auf dem Dresdner Landtag desselben Jahres. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9355 / 4, Bl. 124r; zur Person Ludwig Fachs vgl. Carl Friedrich von Gerber, Die Ordinarien der Juristen-facultät zu Leipzig: Gratulationsprogramm der Juristenfacultät zu Leipzig an Carl Georg von Wächter, Leipzig 1869, S. 28 f.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 129
Landstandschaft auch schon in Teilen der frühneuzeitlichen Reichspublizistik ihren Niederschlag gefunden hatte, werden deren relevante Argumente an entsprechender Stelle herangezogen und diskutiert.7 Im Anschluss daran werden die allgemeinen Befunde am Beispiel der Universität Leipzig exemplarisch untersucht. Dabei sollen zum einen die konkreten Umstände der Leipziger Landtagsberufung 1550 unter Berücksichtigung zuvor einsetzender Entwicklungen untersucht werden.8 Zum an-deren stehen ausgehend von der Wahl der Deputierten aus dem Kreis des consi-lium professorum publicum die konkreten Prozesse und Ergebnisse akademischer Landtagsarbeit im Mittelpunkt dieser Abhandlung. Wo lassen sich die universitä-ren Deputierten im tradierten ständischen Gefüge einordnen und welche mögli-chen Probleme gehen damit einher (Präzedenz!)?9 Welche Belange werden durch die Universität(en) auf den Landtagen eingebracht, welche thematische Bandbreite decken diese ab und welche Ergebnisse sind damit verbunden?10 Dabei muss der Blick vor allem auf grundsätzliche Bemerkungen akademischer Landtagszugehörig-keit und -praxis gerichtet werden, um davon ausgehend einige spezifische Befunde universitärer Landstandschaft eingehender darstellen zu können.
7 An dieser Stelle sei nur auf die m. E. nach Wichtigsten verwiesen: Veit Ludwig von Seckendorff, Teutscher Fürsten Stat, Bd. 1, mit einem Vorwort von Ludwig Fertig, Frankfurt am Main 1665 (ND Glashütten im Taunus 1976); Johann Jacob Moser, Von der Teutschen Reichs-Stände Landen, deren Landständen, Unter-thanen, Landes-Freyheiten, Beschwerden, Schulden und Zusammenkünften, Frankfurt / Leipzig 1769 (ND Hildesheim / New York 1977); Carl Heinrich von Römer, Staatsrecht und Statistik des Churfürstenthums Sachsen und der dabey befindlichen Lande, Bd. 3, Wittenberg 1792.
8 Verwiesen sei dabei etwa auf den Leipziger Landtag von 1547, den Kurfürst Moritz zum Anlass nahm, um zahlreiche Leipziger wie vor allem Wittenberger Universitätslehrer (u. a. Melanchthon, Bugenhagen und Cruciger) in die albertinische Landstadt zu laden. Nach der Wittenberger Kapitulation vom 19. Mai 1547 benötigte er zum einen deren Rat in konfessionellen und kirchenpolitischen Fragen, zum anderen artiku-lierte sich während des Schriftwechsels das gemeinsame Interesse von Kurfürst und Universitäten, dass das albertinische Kurfürstentum zukünftig zwei Landesuniversitäten besitzen sollte. Vgl. Thomas Töpfer, Die Universitäten Leipzig und Wittenberg im Reformationsjahrhundert. Aspekte einer vergleichenden Universitätsgeschichte im territorialen Kontext, in: Detlef Döring (Hrsg.), Universitätsgeschichte als Lan-desgeschichte. Die Universität Leipzig in ihren territorialgeschichtlichen Bezügen (= Beiträge zur Leipzi-ger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Reihe A, Bd. 4), Leipzig 2007, S. 41–83, hier S. 61–68; ders., Die Leucorea am Scheideweg. Der Übergang von Universität und Stadt Wittenberg an das albertinische Kursachsen 1547 / 48. Eine Studie zur Entstehung der mitteldeutschen Bildungslandschaft (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Reihe B, Bd. 3), Leipzig 2004, bes. S. 178–183; Politi-sche Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, Bd. 3: 1. Januar 1547–25. Mai 1548 (= Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Phil.-hist. Klasse, Bd. 68, Heft 3), Johannes Herrmann, Günther Wartenberg (Hrsg.), Berlin 1978 Nr. 674–695, S. 463–488.
9 Hingewiesen sei dabei nur auf die problematische Einordnung der akademischen Deputierten in die tradierte ständische Sitzordnung und Rangfolge etwa anlässlich der Landtagsproposition oder des -ab-schieds. Dass es sich bei Rangkonflikten keineswegs um marginale und anachronistische Formen zere-moniellen Handels handelt, wird etwa am Beispiel des frühneuzeitlichen Reichstages durch Barbara Stollberg-Rilinger hervorgehoben. Vgl. Barbara Stollberg-Rilinger, Zeremoniell als politisches Verfahren. Rangordnung und Rangstreit als Strukturmerkmale des frühneuzeitlichen Reichstags, in: Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichsgeschichte, Berlin (= ZHF, Beiheft 19) 1997, S. 91–132, hier S. 94–96.
10 In diesem Sinne stellen dieser Aufsatz und in erhöhtem Maße das dahinter stehende Dissertationsvorha-ben den Versuch dar, die etwa durch Detlef Döring erkannte und bemängelte Forschungslücke zu schlie-ßen, die sich ihm bei der Analyse Leipziger Landstandschaft und Landtagsarbeit offenbart hat. Vgl. Enno Bünz, Detlef Döring, Manfred Rudersdorf, Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, Bd. 1, Spätes Mittelalter und Frühe Neuzeit 1409–1830 / 31, Leipzig 2009, S. 585.
Philipp Walter130
Zu Beginn soll aber ein knapper Überblick der vorliegenden Forschung zur kurs-ächsischen Ständegeschichte wie zur frühneuzeitlichen akademischen Landstand-schaft geboten werden.
II.
Die Forschung zur landständischen Verfassung im Allgemeinen wie die ihrer Etablie-rung und differenzierten Ausformung in den Territorien des Reichs ist äußerst viel-schichtig, mit bestimmten (regionalen) Schwerpunkten und geprägt durch eine Reihe tiefgreifender Paradigmenwechsel.11 Die moderne Erforschung kursächsischer Stän-degeschichte wie die der ständischen Institutionen und Gruppen fand ihren Anfang in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts12 und einen ersten Höhepunkt mit der maßgeblichen Arbeit Herbert Helbigs zum wettinischen Ständestaat13. Für Kursach-
11 An dieser Stelle ist weder Raum noch Notwendigkeit, die Forschung zur landständischen Verfassung darzustellen. Für einen ersten Zugriff sei auf die Arbeit von Kersten Krüger verwiesen, die einen guten Forschungsüberblick zu(r) landständischen Verfassung(en) bietet. Vgl. Kersten Krüger, Die landständische Verfassung (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 67), München 2003.
12 Hierbei sind vor allem die Beiträge des Dresdner Archivars Johannes Falke hervorzuheben, die gerade für die zweite Hälfte des 16. und das 17. Jahrhundert immer noch zu berücksichtigen sind. Vgl. Johan-nes Falke, Die landständischen Verhandlungen unter dem Herzog Heinrich von Sachsen. 1539–1541, in: Archiv für Sächsische Geschichte 10 (1871a), S. 39–76; ders., Zur Geschichte der sächsischen Landstände. Die Regierungszeit des Herzogs Moritz 1541–1546, in: Mittheilungen des Königlich Sächsischen Altert-humsvereins 21 (1871b), S. 58–115; ders., Zur Geschichte der Sächsischen Landstände. Die Regierungs-zeit des Kurfürsten Moritz 1547–1554, in: Mittheilungen des Königlich Sächsischen Alterthumsvereins 22 (1872), S. 77–132; ders., Zur Geschichte der Sächsischen Landstände. Die Regierungszeit des Kur-fürsten August. 1553–1561, in: Mittheilungen des Königlich Sächsischen Alterthumsvereins 23 (1873), S. 59–113; ders., Zur Geschichte der Sächsischen Landstände. Die Regierungszeit des Kurfürsten August. 1565–1582, in: Mittheilungen des Königlich Sächsischen Alterthumsvereins 24 (1874), S. 86–134; ders., Die Steuerbewilligungen der Landstände im Kurfürstenthum Sachsen bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. I. Artikel, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 30 (1874), S. 395–448; ders., Die Steuerbe-willigungen der Landstände im Kurfürstenthum Sachsen bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. II. Artikel, in: Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 31 (1875), S. 114–182; ders., Die Steuerverhandlungen des Kurfürsten Johann Georg I. mit den Landständen während des dreißigjährigen Krieges, in: Archiv für Sächsische Geschichte NF I (1875), S. 268–348; ders., Die Steuerverhandlungen des Kurfürsten Johann Georgs II. mit den Landständen. 1656–1660, in: Mittheilungen des Sächsischen Alterthumsvereins 25 (1875), S. 79–129. Daneben sei noch auf die Arbeit v. Witzlebens verwiesen, die neben einer Darstellung der Konstituierung der meißnisch-sächsischen Landschaft 1438 eine erste, wenngleich auch durchaus nicht fehlerfreie, Übersicht der meißnisch-sächsischen Landesversammlungen lieferte. Vgl. Cäsar Dietrich von Witzleben, Die Entstehung der constitutionellen Verfassung des Königreichs Sachsen, Leipzig 1881. Bereits 1799 legte der Leipziger Jurist und Universitätsprofessor Christian Ernst Weiße eine erste Arbeit zur kursächsischen Land- und Ausschusstage vor. Vgl. Christian Ernst Weisse, Zusätze und Berichtigungen zu Schrebers ausführlicher Nachricht von den churfürstl. sächsischen Land- und Ausschußtägen. Nebst einigen wichtigen Landtagsverhandlungen, Leipzig 1799.
13 Vgl. Herbert Helbig, Der Wettinische Ständestaat. Untersuchungen zur Geschichte des Ständewesens und der landständischen Verfassung in Mitteldeutschland bis 1485, Köln et al. 21980, erstmals 1955. Darüber hinaus wäre noch Ursula Starkes Göttinger Dissertation zu nennen. Vgl. Ursula Starke, Veränderungen der kursächsischen Stände durch Kriegsereignisse im 17. Jahrhundert, phil. Diss. (masch), Göttingen 1957. Zuletzt fanden sich bei Uwe Israel einige kritische Anmerkungen zu Helbigs Diktum, wonach die Do-kumente des Landtages von 1438 als „konstituierende Urkunden der landständischen Verfassung in den meißnisch-sächsischen Landen“ zu werten seien, wie auch eine grundsätzliche Ablehnung des Terminus „Ständestaat“, wenigstens bis zum Jahr 1485. Eine aktuelle Untersuchung der Frühphase meißnisch-säch-sischen Ständewesens steht allerdings noch aus. Vgl. Uwe Israel, Die mittelalterlichen Anfänge der sächsi-schen Landtage, in: Sächsischer Landtag (Hrsg.), DIALOG 4, Dresden o. J., S. 34–37, hier S. 37.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 131
sen kann nach einer erheblichen Lücke in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seit den 1990er Jahren wieder ein spürbarer Anstieg des Forschungsinteresses kon-statiert werden. Dabei rückt neben der Frage nach dem Verhältnis von Landesherr und Landständen im Allgemeinen zunehmend die Rolle einzelner Ständegruppen im Rahmen der landständischen Verfassung und ihrer Institutionen in den Fokus der Forschungen.14 Zur Existenz universitärer landständischer Vertretung äußerte man sich dabei aber nur in Ausnahmefällen und mit wenigen Worten, ohne weiter auf deren Entstehung, Legitimation, Wirkung oder Bedeutung einzugehen.15 Einzige bedeutende Ausnahme ist die Freiburger Dissertation von Friedrich Gackenholz, die (auch) das Phänomen akademischer Landstandschaft des 16. und 17. Jahrhun-derts diskutiert. Dabei müssen manche Aussagen und Schlussfolgerungen allerdings äußerst kritisch gesehen werden. So ist die Übertragung von Zuständen des späten 18. auf das 16. und 17. Jahrhundert kaum aufrechtzuerhalten, wie dies etwa für die wettinischen Universitäten getan wurde.16
Für die Beschäftigung mit dem Phänomen der akademischen Landstandschaft bieten unter anderem die historiografischen Arbeiten der frühneuzeitlichen Staats-rechtler Veit Ludwig von Seckendorff, Carl Heinrich von Römer und Johann Jacob Moser erste Ansatzpunkte. Während Seckendorff es noch bei eher summarischen Bemerkungen zur universitären Landstandschaft im Reich belässt, die dahinge-hend verstanden werden können, dass die Professorenkollegien aller Universitäten im Reich als Prälaten und somit Landstände anzusehen wären17, weisen die in der
14 Vgl. Karlheinz Blaschke (Hrsg.), Begleitheft zur Ausstellung 700 Jahre politische Mitbestimmung in Sach-sen, Dresden 1994; Frank Göse, Zwischen „Ständestaat“ und „Absolutismus“. Zur Geschichte des kurs-ächsischen Adels im 17. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Stän-detum und Landesherrschaft, in: Katrin Keller,Josef Matzerath (Hrsg.), Geschichte des sächsischen Adels, Köln et al. 1997, S. 139–160; Reiner Gross (Hrsg.), Landtage in Sachsen 1438–1831. Beiträge auf dem von der Professur Regionalgeschichte Sachsens der Technischen Universität Chemnitz veranstalteten wis-senschaftlichen Kolloquium am 25. Februar 2000, Chemnitz 2000; Josef Matzerath, Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte, Dresden 1998; ders., Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte. Die Ständeversamm-lungen des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von Alexander Kästner und Wulf Wäntig, Dresden 2013; Ulf Molzahn, Adel und frühmoderne Staatlichkeit in Kursachsen. Eine prosopographi-sche Untersuchung zum politischen Wirken einer territorialen Führungsschicht in der Frühen Neuzeit (1539–1622), phil. Diss. (masch.), Leipzig 2005; Krüger, Nina, Landesherr und Landstände in Kursachsen auf den Ständeversammlungen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts (= Europäische Hochschulschrif-ten, Reihe III Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 1034), Frankfurt am Main 2007; Uwe Schir-mer, Der landständische Einfluß auf die Politik der Herzöge und Kurfürsten von Sachsen von 1541 bis 1586 – Fürstengewalt und Ständerecht, in: Helmar Junghans (Hrsg.), Die sächsischen Kurfürsten während des Religionsfriedens von 1555 bis 1618, Leipzig et al. 2007, S. 263–278; ders., Die ernestinischen Stände zwischen 1485 und 1572, in: Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen, Bd. 27, Weimar 2008, S. 23–50; ders., Zwischen Fürstentestament und Freundbrüderlichem Hauptvergleich. Die politi-sche Wirkkraft der kursächsischen Stände auf dem Landtag von 1657, in: Martina Schattkowsky,Manfred Wilde (Hrsg.), Sachsen und seine Sekundogenituren. Die Nebenlinien Weißenfels, Merseburg und Zeitz (1657–1746) (= Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 33), Leipzig 2010, S. 97–112.
15 Vgl. Molzahn, Adel (Anm. 14), S. 51–53.16 Vgl. Friedrich Gackenholz, Die Vertretung der Universitäten auf den Landtagen des Vormärz. Insbeson-
dere dargestellt am Beispiel der Universität Freiburg i. Br. (= Freiburger Rechts- und Staatswissenschaft-liche Abhandlungen, Bd. 40), Karlsruhe 1974.
17 „Deßgleichen werden auch die Collegia der Professoren auff Hohen Schulen, die zumal im Lande mit Gütern und Herrschafften begabet sind unter dem Namen der Prælaten verstanden und vor Land-Stände gehalten.“ Seckendorff, Fürstenstaat (Anm. 7), S. 49.
Philipp Walter132
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstandenen Arbeiten von Römer und Moser bereits differenziertere Befunde auf. Für Römer gehören zu den kursächsischen Prä-laten neben den Domherren zu Meißen, Wurzen, Merseburg, Naumburg und Zeitz ebenfalls die Rektoren (!) der beiden Universitäten Wittenberg und Leipzig.18 Moser kommt den hier zu präsentierenden Befunden noch am nächsten. Im Rahmen seiner allgemeinen Betrachtung von Landständeklassen ordnet er die Abgeordneten (!) der beiden Universitäten Wittenberg und Leipzig dem „Collegio“ der Prälaten, Grafen und Herren zu und weist zudem völlig richtig darauf hin, dass diese zwar formal zu dieser „Classe“ oder „Collegio“ gehören würden, jedoch ihre „Sessiones und Delibe-rationes“ von diesen getrennt wahrnehmen würden.19 Moser hält bezüglich der Uni-versitäten im Reich generell fest, dass aus dieser Gruppe nur evangelische, nicht aber die katholischen Hohen Schulen zu Landständen ihrer Territorien aufgestiegen sind. Eine exakte Auflistung der betreffenden Universitäten bleibt er allerdings ebenso schuldig wie eine Begründung ihrer Landstandschaft.20
III.
Mosers Überlegungen bezüglich der Landstandschaft evangelischer Universitäten und dem Fehlen jeder katholischen akademischen Vertretung auf den Landesver-sammlungen ihrer Territorien führt zu der Frage, welche Aussagen sich tatsächlich zur akademischen landständischen Vertretung und ihrer regionalen wie konfessio-nellen Verbreitung treffen lassen. Für das beginnende 17. Jahrhundert kann das (auch nur zeitweilige) Auftreten der fünf folgenden Universitäten auf den Ständever-sammlungen ihrer jeweiligen Territorien als sicher gelten: Gießen, Helmstedt, Leip-zig, Marburg und Wittenberg21. Katholische Universitäten oder Kollegien lassen sich
18 „Die Rectores der beyden Universitäten zu Leipzig und Wittenberg rechnen sich nicht weniger, als die Capitularen, zu den sächsischen Prälaten. Es ist dieses noch aus jenen Zeiten herzuleiten, wo man die Universitäten als geistliche Corpora betrachtete, und die Rectores, als Häupter derselben, vorzüglicher Ehre würdigte. In Absicht der chursächischen Universitäten ist es auch bereits durch die obenangeführten Landtagsverhandlungen ganz ausser Zweifel, daß sie als Prälaten zu betrachten sind.“ Römer, Staatsrecht und Statistik (Anm. 7), S. 133 f.
19 „Die beiden Universitäten, Leipzig und Wittenberg, pflegen sonst zu den Prälaten, Grafen und Herren gezogen zu werden; wie sie denn auch bey der Proposition so wohl als dieselben, das Jus votandi haben; […] also auch forthin, ihre besondere Sessiones und Deliberationes anstellen, und dißfalls zu den Prälaten, Grafen und Herren sich nicht eindringen sollten […].“ Moser, Reichs-Stände (Anm. 7), S. 441.
20 „Die Universitäten werden meines Wissens in allen Catholischen Landen nicht unter die Land-Stände ge-rechnet; so auch nicht im Chur-Brandenburgischen, Braunschweig-Lüneburgischen, Holsteinischen, Wür-tembergischen etc. Hingegen werden selbige unter die Land-Stände gezählet in Chur-Sachsen, in Hessen etc.“ Ebd., S. 481.
21 Diese Gruppe könnte für das 18. Jahrhundert noch um die hohenzollerische Universität Frankfurt an der Oder ergänzt werden, doch trat diese lediglich auf Ebene der Lebuser Kreistage als ständischer Akteur auf. Mit der Übertragung sämtlicher Güter des aufgelösten Kartäuserklosters „Gottes Barmherzigkeit“ bei Frankfurt an der Oder 1540 trat die Universität die Nachfolge desselben als geistlicher Stand an. Vgl. Gebhard Falk, Die Universität Frankfurt (Oder) als spätfeudale Grundherrschaft, in: Günther Haase, Joachim Winkler (Hrsg.), Die Oder-Universität Frankfurt. Beiträge zu ihrer Geschichte, Weimar 1983, S. 91–99; Klaus Vetter, Die Universität Frankfurt (Oder) als Kreisstand des Kreises Lebus im 18. Jh., in:
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 133
um 1600 nicht als (aktive) Landstände identifizieren. Dies ist etwa für das Herzog-tum Bayern und die auch dort mit der Reformation und Reorganisation der höheren Bildung beauftragten Jesuiten dadurch zu erklären, dass die Hohen Schulen zwar mit der Übernahme bzw. Übertragung einst landsässiger Güter Teil der bayrischen Landstände wurden, sich von den damit verbundenen persönlichen Lasten und Äm-tern jedoch vollständig befreien ließen. Die Fragen des Für und Wider der mit der Landstandschaft verbundenen Würden und Lasten wurde von zahlreichen Jesuiten eingehend diskutiert und in den meisten Fällen mit einem negativen Urteil bedacht. Der General des Jesuitenordens Aquaviva selbst sprach sich 1593 dafür aus, dass der Orden unter Bewahrung aller seiner Privilegien von den Würden und Belastungen der Landstände befreit werden sollte.22 Letztlich blieben die bayrische Universität wie die Kollegien nur dem Namen und Ansehen nach Landstände. Sie beteiligten sich weder an der eigentlichen Arbeit in den landständischen Gremien und Institu-tionen noch waren ihre Glieder von den Konsequenzen dabei gefasster Entschei-dungen betroffen.23
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts lassen sich somit vier protestantische Universi-täten (Gießen, Helmstedt, Leipzig, Wittenberg) und eine reformierte Hohe Schule (Marburg) auf den Landesversammlungen im Reich fassen.
Die 1527 vom hessischen Landgrafen Philipp dem Großmütigen als erste dezi-diert lutherische Universität gegründete und 1541 mit kaiserlichen Privilegien aus-gestattete Universität Marburg findet sich wahrscheinlich 1557, spätestens aber 1572
ebd., S. 100–104; Michael Höhle, Universität und Reformation. Die Universität Frankfurt (Oder) von 1506 bis 1550 (= Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte, Bd. 25), Köln et al. 2002, bes. S. 459–472. Unter völlig anderen Voraussetzungen und wohl nach englischem Vorbild erhielten die österreichischen Universitäten nach 1790 und im Zuge der Neugestaltung der österreichischen Unterrichtsverfassung durch Leopold II. die Landstandschaft. Vgl. Alfred Wretschko, Die Frage der Landstandschaft der Universität Innsbruck, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 41 (1920), S. 40–74.
22 Die Jesuiten wurden am 26. Juni 1597 durch die Herzöge Wilhelm und Maximilian für alle ihre im Her-zogtum liegenden Kollegien „sowohl ihres tugendsamen und ehrsamen Wandels halber als auch wegen des christlichen allgemeinen Nutz, der allenthalben durch sie befördert wird“ zum Landstand erklärt, in den Prälatenstand gesetzt und sogleich von allen persönlichen Lasten und Ämtern, die mit einer solchen Landstandschaft verbunden waren, befreit. Grundlage der aufgeworfenen Frage waren die Landsässigkeit des durch Ingolstädter Jesuiten übernommenen Klosters Biburg wie die einiger Güter der Kollegien in Regensburg und München. Vgl. Bernhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Erster Band: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1907, bes. S. 592–595, Zitat S. 595. Allgemein zur Problematik „Jesuiten und Universität“ vgl. Karl Hengst, Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, NF 2), Paderborn et al. 1981. Lieberich führt neben der Universität Ingolstadt ebenso das „Kollegiatstift München, [das] Damenstift St. Anna in München, die verschiedenen Jesuitenkollege bzw. als deren Nachfolger die Malteserkommenden des 18. Jahrhunderts“ unter den bayrischen Prälaten, jedoch unter dem ausdrücklichen Verweis darauf, dass die genannten Institute „als Übernehmer älterer landständischer Klöster“ keinen Zuwachs für die bayrische Prälatenkurie darstellen würden. Heinz Lieb-berich, Die bayerischen Landstände 1313 / 40–1807, München 1990, S. 200 (Erstveröffentlichung: Mittei-lung für die Archivpflege in Oberbayern, Nr. 14–24, Umdruck 1943 / 44).
23 Sie können daher mit einiger Berechtigung ebenso als „stumme Landsassen“ angesprochen werden, wie dies Lieberich für die bayrischen Hochstifte getan hat. Diese hätten trotz sie dazu berechtigender Be-sitzungen und als Ausdruck ihrer Unabhängigkeit auf den Besuch der bayrischen Landesversammlungen verzichtet. Vgl. Lieberich, Landstände (Anm. 22), S. 199.
Philipp Walter134
unter den hessischen Landständen.24 Dabei bildete die Universität zunächst allein die im Zuge der Reformation aufgelöste Prälatenkurie, die sich ab 1583 aus den Obervorstehern der adeligen Stifte, den Vorstehern der vier hohen Hospitäler und den Vertretern der Universität zusammensetzte. 1584 trat als Folge des Carlstadter Vertrags wieder der Komtur des Deutschen Ordens in eigener Person hinzu.25 Die Ursache für das Wiederentstehen einer Prälatenkurie kann nach Siebeck nicht mit der Nutznießung des bis 1527 geistlichen (landsässigen) Besitzes erklärt werden, da etwa die Universität ihre Einkünfte aus diesen Gütern bezog, keineswegs aber in den Besitz derselben gelangte. In ähnlicher Weise argumentiert Christa Reinhardt, die lediglich von einer Ausstattung der Universität mit Einkünften zahlreicher säku-larisierter geistlicher Güter ausgeht und nicht von einer vollständigen Übertragung derselben an die Hohe Schule.26 Da die Quellen selbst zu den Motiven der Wieder-einführung einer Prälatenbank im Allgemeinen27 wie der Etablierung einer bis dato unbekannten Landstandschaft der Universität im Speziellen schweigen28, mutmaßt Siebeck, es müsste sich im Fall der Alma Mater Philippina um eine Vorbildwirkung anderer Universitäten handeln, ohne jedoch zu konkretisieren, an welche andere
24 1557 ist die Universität sehr wahrscheinlich anlässlich eines Landtages zur Bewilligung einer Türken-steuer anwesend. Eine eigene Bank hat sie aber zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht gebildet, da nur Ver-treter von Ritterschaft und Städten für ihre Kurien den Landtagsabschied unterschrieben. 1572 ist dann erstmals ein Vertreter der Universität bei den Unterzeichnern des Abschieds zu finden. Vgl. Hans Siebeck, Die landständische Verfassung Hessens im sechzehnten Jahrhundert, Kassel 1914, S. 29 f. Für Hollenberg steht die Anwesenheit des Marburger Professors Johannes Oldendorp bereits für 1557 fest, wobei dieser lediglich an den ritterschaftlichen Beratungen teilnahm. Auf Initiative der landesherrlichen Räte sollten ursprünglich sowohl die Universität als auch der Landkomtur des Deutschordensballei als Prälaten ge-laden werden. Aufgrund der strittigen Frage der Reichsunmittelbarkeit weigerte sich der Landkomtur, bestärkt durch ein Schreiben des Deutschmeisters, am Landtag teilzunehmen und damit die eigene Land-standschaft anzuerkennen. Im Landtagsabschied werden neben Ritterschaft und Städten auch die Präla-ten aufgeführt. Vgl. Günter Hollenberg (Hrsg.), Hessische Landtagsabschiede: 1526–1603, Marburg 1994, Nr. 36, Landtagsabschied 1557, S. 221.
25 Vgl. Siebeck, Verfassung (Anm. 24), S. 30.26 „Angesichts dieser Sachlage [u. a. Marburg nicht fundiert mit säkularisiertem Kirchengut] läßt es sich
meines Erachtens schwer sagen, warum seit 1572 Vertreter der Universität auf den Landtagen erschie-nen.“ Christa Reinhardt, Prälaten im evangelischen Territorium. Die Universität Gießen als hessen-darm-städtischer Landstand, in: Peter Moraw,Volker Press (Hrsg.), Academia Gissensis. Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte, Marburg 1982, S. 161–182, hier S. 166. Friedrich Gackenholz wiederum sieht eindeutig die Ausstattung mit landsässigen säkularisierten Kirchengütern als legitimierende Ursache. Vgl. Gackenholz, Vertretung (Anm. 16), S. 28 f. Baumgart hält für 1540 die Ausstattung mit säkularisiertem Kirchengut fest, weist aber zugleich darauf hin, dass dieses „der Aufsicht des Marburger Universitätsöko-nomen“ unterstellt gewesen wäre. Dieser hätte sowohl dem Landesherrn als auch der Universität Rechen-schaft geschuldet. Vgl. Peter Baumgart, Die deutsche Universität des 16. Jahrhunderts. Das Beispiel Mar-burg, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 28, Marburg 1978, S. 50–79, hier S. 64.
27 Ob es tatsächlich zu einer Wiedereinführung der Prälatenkurie kam, ist in der hessischen Landes- und Ständeforschung durchaus kontrovers diskutiert worden. So lehnt Demandt die reale Wiedereinfüh-rung dieser Kurie mit allen damit verbundenen Konsequenzen (u. a. eigene Versammlungen / Beratun-gen / Stimmabgabe) ab. Vgl. Karl E. Demandt, Die hessischen Landstände im Zeitalter des Frühabsolutis-mus, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 15, Marburg 1965, S. 38–108, hier S. 43. Auch Günter Hollenberg argumentiert in ähnlicher Weise wenn er zwar die Wiedereinführung der Prälaten konstatiert, gleichzeitig aber die Existenz einer separaten Prälatenkurie ablehnt. Die neu hinzugezogenen Prälaten würden gemeinsam mit der Ritterschaft tagen und schließen und bildeten somit keine eigene Bank / Kurie. Vgl. Hollenberg, Landtagsabschiede (Anm. 24), S. 17.
28 Ein Umstand, der auch im Leipziger Beispiel festzustellen ist und dort eingehender diskutiert werden soll.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 135
Hohe Schule dabei zu denken wäre. Als Vorbild kommen dabei meines Erachtens nach nur die wettinischen Universitäten in Frage.29
Über Tätigkeit und Wirkung der Marburger Deputierten ist in den wenigen spezifischen Forschungsbeiträgen nichts zu finden. Dies begründet sich in der Tat-sache, dass die akademischen Vertreter wie die übrigen Prälaten aller Erkenntnis nach wohl gemeinsam mit der hessischen Ritterschaft tagten, deren Vorsitzender als Erbmarschall sowohl das Direktorium des Landtages wie das der ritterschaftlichen Kurie führte. Daher werden der Gruppe der Prälaten nur marginale Einfluss- und Wirkungsmöglichkeiten zugeschrieben.30
Stellt die Frage nach Ursprung bzw. Vorbildern der Marburger landständischen Teilhabe ein noch intensiver zu diskutierendes Problem dar, lässt sich dieselbe Frage für die Gießener Verhältnisse wesentlich einfacher beantworten. Die Ludoviciana wurde zwischen 1605 und 1607 in Folge des Marburger Erbfolgestreits und in Kon-kurrenz zur nunmehr reformierten Marburger Hohen Schule31 erst als Gymnasium, schließlich als hessen-darmstädtisch-lutherische Volluniversität gegründet und mit kaiserlichen Privilegien versehen.32 Dabei kann die Fortführung der Marburger
29 Vgl. Siebeck, Verfassung (Anm. 24), S. 28. In ähnlicher Weise bezeichnet Moraw die Umstände bzw. Legi-timationsgrundlagen der Marburger Landstandschaft als „unklar“. Vgl. Peter Moraw, Kleine Geschichte der Universität Gießen von den Anfängen bis zur Gegenwart, Gießen 21990, S. 34. Als naheliegende Möglichkeit einer Vorbildwirkung bieten sich in erster Linie die wettinischen Universitäten an. So Hollen-berg, Landtagsabschiede (Anm. 24), S. 16 und Reinhardt, die explizit Leipzig und Wittenberg nennt und zudem ständische Gerechtigkeitsvorstellungen anführt, indem sie bezüglich der ständischen Motivation festhält, „daß es doch nicht ganz gerecht sei, die Institution [Universität Marburg] und ihren Besitz samt abgabepflichtiger Untertanen von anderen vertreten zu lassen“. Reinhardt, Prälaten (Anm. 26), S. 166. Be-zeichnenderweise spricht Reinhardt hier wieder vom Besitz und den Untertanen der Universität, die sei-tens der Stände zur Legitimation akademischer Landstandschaft herangezogen wurden. Prinzipiell ist von einer engen Anlehnung bzw. Orientierung der Marburger Hohen Schule an (vor allem) der Wittenberger Leucorea auszugehen. So rekrutierte sich zum einen ein Großteil der ersten Professoren aus Wittenberg und zum anderen orientierte sich die erste Marburger Lektionsordnung eindeutig an derjenigen der Leu-corea. Zudem gilt der (wenigstens indirekte) Einfluss Melanchthons auf Gründung und Ausbildung der Marburger Universität als gesichert. Vgl. Karl Hartfelder, Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae (= Monumenta Germaniae Paedagogica, Bd. 7), Berlin 1889, S. 531 f. Bedenkt man zudem die traditionell engen Bindungen zwischen den Häusern Sachsen und Hessen und die Tatsache, dass 1550 erstmals Leip-zig auf einem kursächsischen Landtag nachzuweisen ist, so erscheint die Vorbildwirkung kursächsischer akademischer Landtagspraxis als ernstzunehmendes Argument. Zu Art und Bedeutung des hessisch-säch-sischen Verhältnisses während der Zeit der lutherischen Reformation im Reich vgl. Manfred Rudersdorf, Moritz von Sachsen und die Landgrafschaft Hessen. Protestantische Politik im Zeichen des dynastischen Familienverbandes, in: Karlheinz Blaschke (Hrsg.), Moritz von Sachsen – Ein Fürst der Reformationszeit zwischen Territorium und Reich (= Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte, Bd. 29), Stutt-gart 2007, S. 75–93.
30 Vgl. Demandt, Landstände (Anm. 27), S. 42 f. sowie Hollenberg, Landtagsabschiede (Anm. 24), S. 17. Welche Bedeutung der Frage nach einer separaten Prälaten- oder gar Universitätskurie zukommen kann, soll an-hand der hier noch zu diskutierenden Leipziger wie Wittenberger Verhältnisse deutlich gemacht werden.
31 Zum Konfessionswechsel vgl. Gerhard Menk, Die „Zweite Reformation“ in Hessen-Kassel. Landgraf Moritz und die Einführung der Verbesserungspunkte, in: Heinz Schilling (Hrsg.), Die reformierte Kon-fessionalisierung in Deutschland – Das Problem der „Zweiten Reformation“ (= Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Bd. 195), Gütersloh 1986, S. 154–183.
32 Zu den Gründungsumständen vgl. Manfred Rudersdorf, Die Geburt einer Universität – Gießen 1607. Eine frühneuzeitliche Universitätsgründung im Spannungsfeld von Dynastie, Territorium und Konfes-sion, in: Horst Carl, Friedrich Lenger, Universalität in der Provinz. Die vormoderne Landesuniversität Gießen zwischen korporativer Autonomie, staatlicher Abhängigkeit und gelehrten Lebenswelten, Darm-stadt 2009, S. 63–82; ders., Der Weg zur Universitätsgründung in Gießen. Das geistige und politische Erbe
Philipp Walter136
landständischen Praxis in der neu konstituierten Landgrafschaft Hessen-Darmstadt auch als Legitimierungsanspruch der die lutherische Tradition fortsetzenden Hohen Schule gewertet werden. Das Streben, als eigentliche Philippina wahrgenommen zu werden, lässt auch die Adaption der universitären Landstandschaft als wahrschein-lich erscheinen.33
Moraws Urteil über die Gießener Wirkungs- und Einflussmöglichkeiten im Rah-men der territorialen Ständeversammlungen fällt allerdings ähnlich ernüchternd aus wie für die Marburger Hohe Schule. Zwar erlebt bereits der erste nach Etablierung der Universität einberufene hessen-darmstädtische Landtag 1610 die Anwesenheit der neu gegründeten Universität und wurden seitdem die Landesversammlungen auch stets durch zwei oder drei Professoren besucht., darunter in erster Linie Ju-risten und vielfach der Vizekanzler und Syndikus der Universität. Doch, so Moraw, „[g]egenüber der ständischen und zahlenmäßigen Vorherrschaft des Adels […] ver-mochte selbst die Überlegenheit juristischen Sachverstandes nicht viel auszurichten, da es meist um Finanzsachen ging; und hier hatte man nur wenig zu bieten. So war die Universität schwerlich eine politische Kraft im Lande, und schon gar nicht gegen den Landesherrn“34.
Die Helmstedter Julius-Universität lässt sich das erste Mal sicher in einem Ver-zeichnis der braunschweigisch-wolfenbütteler Landstände des Jahres 1585 nachwei-sen. Dieses liefert zugleich die Begründung der Landstandschaft mit, indem als Be-rufungsgrund angeführt wurde, dass die Universität wegen ihrer „Egidischen und Closters Marien güter zu Ganderßheim“ berufen worden wäre.35 Die Universität wird somit nicht für sich und als privilegierte Körperschaft berufen, sondern ledig-lich als Vertreterin der ihr übergebenen landsässigen Güter.36
Für die Jenaer Salana kann eine Verbindung zwischen der Fundation mit land-sässigen Gütern auf der einen und einer daraus resultierenden Landstandschaft auf der anderen Seite ausgeschlossen werden. Die 1548 durch den „geborenen“ Kur-fürsten Johann Friedrich den Großmütigen ins Leben gerufene Universität, die in scharfe Konkurrenz zum nunmehr albertinischen Wittenberg trat und letztlich den Anspruch des „besseren Wittenbergs“ vertrat, finanzierte sich im 16. Jahrhun-
Landgraf Ludwig IV. von Hessen-Marburg, in: Peter Moraw, Volker Press (Hrsg.), Academia Gissensis. Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte, Marburg 1982, S. 45–82.
33 „Aus alledem geht hervor, unter welchem Grundsatz die Universität Gießen ins Leben getreten ist: Sie sollte in der Sicht des Kaisers, des Landgrafen und erst recht der lutherischen Exulanten die bessere, un-verdorbene, eigentliche Philippina sein […] Bis ins Detail kopierte man daher das Marburger Vorbild […].“, Moraw, Gießen (Anm. 29), S. 21 f.
34 Ebd., S. 34.35 Vgl. Hermann Koken, Die Braunschweiger Landstände um die Wende des 16. Jahrhunderts unter den
Herzögen Julius und Heinrich Julius 1568–1613 im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel, Kiel, Univ., Diss., Braunschweig 1914, S. 6. Moser führt die Universität Helmstedt nicht unter den braunschweigisch-wolfenbütteler Landständen. Vgl. Moser, Reichsstände (Anm. 7), S. 463.
36 Zur Übergabe des Marienklosters Gandersheim und des Aegidienklosters bei Braunschweig vgl. Michael Maaser, Humanismus und Landesherrschaft. Herzog Julius (1528–1589) und die Universität Helmstedt (= Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 46), Stuttgart 2010, S. 50.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 137
dert zum allergrößten Teil aus landesherrlichen Zuwendungen.37 Eine Fundation mit (landsässigen) Gütern erfolgte erst 1633 durch die Ausstattung der Universität mit den heimgefallenen Lehngütern Remda und Apolda.38 Auf den ernestinischen Landtagen findet sich die Universität aber bereits kontinuierlich seit der ersten nach Verleihung der kaiserlichen Privilegien (1558) stattfindenden Ständeversammlung von 1567.39 Eine Kopplung akademischer Landstandschaft an die Übertragung zuvor bereits landsässiger Güter liegt dementsprechend nicht vor, was nicht zuletzt auch daran deutlich wird, dass die akademischen Deputierten nach 1633 sowohl für die Universität als auch die fundierten Güter auf den Landtagen Sachsen-Weimars Sitz und Stimme wahrnahmen.40
So stellt sich auch im Fall der Salana die Frage, worauf sich ihre Landstandschaft letztlich gründet, wenn diese nicht vom Besitz landsässiger Güter herzuleiten ist. Gerhard Müller sieht bereits in der „konfessionspolitische[n] Gründungsintention der Jenaer Universität“ das wesentliche Argument „die neue Alma mater mit land-ständischen Würden und Rechten zu versehen“.41 Greift man seine Argumentation auf, so wird zweifellos deutlich, dass dies eine neue Legitimation landständischer Zugehörigkeit bedeuten würde. Weder altes Herkommen noch Landesfreiheiten las-sen sich für die Universität(en) in Anspruch nehmen, sodass die ihr zuwachsende Be-deutung im konfessionellen lutherisch-reformierten Territorialstaat eine (mögliche) Erklärung der akademischen Landstandschaft darstellen kann.42 Letztlich muss aber
37 Zur Jenaer Universitätsgeschichte vgl. Max Steinmetz (Hrsg.), Geschichte der Universität Jena 1548 / 58–1958. Festgabe zum vierhundertjährigen Universitätsjubiläum, Bd. I: Darstellung, Jena 1958; Detlef Igna-siak, Kurfürst Johann Friedrich I. und die Gründung der Universität Jena, Jena 1996 (Jenaische Blätter 6); Joachim Bauer, Dagmar Blaha, Helmut G. Walther, Dokumente zur Frühgeschichte der Universität Jena 1548 bis 1558, Weimar / Jena 2003; Joachim Bauer, Andreas Klinger, Alexander Schmidt, Georg Schmidt (Hrsg.), Die Universität Jena in der Frühen Neuzeit, Heidelberg 2008. Zu Fragen der Universitätsfinanzie-rung vgl. Uwe Schirmer, Die finanziellen Grundlagen der Universitäten Leipzig, Wittenberg und Jena im Vergleich 1409–1633, in: Stefan Michel, Christian Speer (Hrsg.), Georg Rörer (1492–1557). Der Chronist der Wittenberger Reformation (= Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutheri-schen Orthodoxie, Bd. 15), Leipzig 2012, S. 75–103.
38 Zur Dotierung und Verwaltung der beiden Güter vgl. Stefan Wallentin, Fürstliche Normen und akademi-sche „Observanzen“. Die Verfassung der Universität Jena 1630–1730, Köln / Weimar / Wien 2009, S. 77–94 und S. 328–341; Schirmer, Grundlagen (Anm. 37), S. 93 f.; Heinz Wiessner, Die wirtschaftlichen Grundla-gen der Universität Jena im ersten Jahrhundert ihres Bestehens (1548 / 58–1658), phil. Diss. (masch.), Jena 1955, bes. 185–226.
39 Vgl. Gerhard Müller, Universität und Landtag. Zur Geschichte des Landtagsmandats der Universität Jena (1567–1918), in: Werner Greiling, Hans-Werner Hahn (Hrsg.), Tradition und Umbruch. Geschichte zwi-schen Wissenschaft, Kultur und Politik, Rudolstadt et al. 2002, S. 33–59, hier S. 34.
40 Vgl. Thüringer Hauptstaatsarchiv Weimar (im Folgenden: ThürHStA Weimar), Hzgt. SWE B 13, Instruk-tionsschreiben der akademischen Deputierten vom 3. Februar 1634, Bl. 100r–104v.
41 Müller, Universität (Anm. 39), S. 34.42 Zur Bedeutung von Reformation und Bildungswesen und deren Wechselwirkung mit dem lutherischen
Territorialstaat vgl. Notker Hammerstein (Hrsg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. 1: 15. bis 17. Jahrhundert. Von der Renaissance und der Reformation bis zum Ende der Glaubenskämpfe, Mün-chen 1996, bes. 253–312; ders., Universitäten und Reformation, in: Historische Zeitschrift 258 (1994), S. 339–357; Rudolf Stichweh, Der frühmoderne Staat und die europäische Universität. Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung (16.–18. Jahrhundert), Frankfurt a. M. 1991. Zu Reformation und Bedeutung der Universität Leipzig vgl. Bünz, Döring, Rudersdorf, Univer-sität Leipzig (Anm. 10), S. 331–447; Herbert Helbig, Die Reformation der Universität Leipzig im 16. Jahr-hundert, Gütersloh 1953.
Philipp Walter138
ebenso konstatiert werden, dass (bisher) keine landesherrlichen oder universitären Quellen vorliegen, die grundlegend Auskunft darüber erteilen, weshalb diese Uni-versitäten landständisch wurden und anderen, mit möglicherweise ähnlichen struk-turellen und politischen Voraussetzungen, dieses Privileg verwehrt blieb. Auch die Zeitgenossen stehen vor dem Problem, dass sie sich nur auf den „geistlichen Stand“ der Universitäten und ihre alte Herkunft berufen können, wo – wie bei den kursäch-sischen Universitäten 1661 geschehen – zwar nicht ihre Landstandschaft als solche, wohl aber ihr Prälatenstatus in Frage gestellt wurde.43
Die Universitäten Leipzig und Wittenberg zählen seit der Mitte des 16. Jahrhun-derts zu den Landständen des Kurfürstentums Sachsen. Dabei wird die Alma mater Lipsiensis wie bereits erwähnt erstmalig 1550 zu einem Landtag nach Torgau gela-den. Es ist davon auszugehen, dass dies ebenso für Wittenberg der Fall war, doch in der landesherrlichen wie universitären Überlieferung ist die Leucorea erst anlässlich des Torgauer Landtages von 1561 nachzuweisen.44 Von diesem Zeitpunkt an finden sich die beiden Hohen Schulen auf nahezu jedem kursächsischen Landtag des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine die akademische Landstandschaft legitimierende landes-herrliche Privilegierung lässt sich jedoch auch in diesem Fall nicht nachweisen. Ob eine solche Privilegierung überhaupt jemals stattgefunden hat, muss zudem fraglich bleiben. Die bereits dargelegte Leipziger Reaktion auf das Ausschreiben von 1550 legt den Schluss nahe, dass eine offizielle landesherrliche Begründung für den neu-artigen Status eines Landstandes nicht vorlag.45
Besonders deutlich wird das Fehlen einer offiziellen Aufnahme der Universitäten in den Kreis der kursächsischen Landstände und die Begründung dieses Vorgangs anlässlich des Präzedenzstreits von 1661. Diese noch ausführlicher zu diskutierende Auseinandersetzung zwischen den Grafen und Herren bzw. deren Vertretern sowie den Deputierten der drei kursächsischen Stifte Meißen, Merseburg und Naumburg auf der einen und den beiden Universitäten auf der anderen Seite zwang diese dazu, sich zu rechtfertigen und den in Anspruch genommenen Prälatenstatus zu begrün-den. An dieser Stelle kann diesbezüglich bereits festgehalten werden, dass die Uni-versitäten zwar zahllose Argumente zur Untermauerung ihres Prälatenstandes wie zum Teil auch ihrer ständischen Qualität an sich zusammentrugen, dass dabei aber
43 Vgl. UA Leipzig, LTA 18 I, (Konzept) Refutation und Reprotestation der beiden Universitäten auf das Schreiben der gräflichen Deputierten vom 28.1.1661, Bl. 570r–580v.
44 Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9356 / 13, Bevollmächtigungsschreiben der Universi-tät Wittenberg, Bl. 16r. Allgemein ist die Wittenberger Überlieferung wesentlich lückenhafter als die der Universität Leipzig. Auffallend ist, dass beide Überlieferungen erst im ausgehenden 16. bzw. beginnenden 17. Jahrhundert ihren Anfang nehmen (Wittenberg 1592, Leipzig 1601). Die Wittenberger Lücken lassen sich nicht zuletzt mit den kriegsbedingten Verlusten des Universitätsarchivs 1813 erklären. Vgl. Friedrich Israël, Das Wittenberger Universitätsarchiv, seine Geschichte und seine Bestände (= Forschungen zur Thüringisch-Sächsischen Geschichte, 4. Heft), Halle an der Saale 1913, bes. S. 4–9.
45 Molzahn deutet das Entschuldigungsschreiben der Universität von 1550 als Beleg dafür, dass die Univer-sitäten tatsächlich durch die Ausstattung mit eingezogenem (schriftsässigem) Kirchengut einen Platz in der Prälatenkurie erhielten. Dabei deutet er meines Erachtens zu viel in das universitäre Dokument hinein; vom Prälatenstatus oder der Prälatenbank ist darin keine Rede. Vgl. Molzahn, Adel (Anm. 14), S. 51.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 139
keinerlei landesherrliche Privilegierung herangezogen werden konnte. Hätte eine solche vorgelegen oder wäre den juristisch versierten Professoren ein solches Doku-ment bekannt gewesen; man hätte sich ohne Zweifel darauf berufen und damit jede weitere Diskussion unterbinden können.46 Es ist daher wohl von einer unkommen-tierten Einladung der Universitäten durch Kurfürst Moritz auszugehen, die durch die Leipziger Hohe Schule aus Mangel an Alternativen auf die ihr neu fundierten Dörfer bezogen wurde.47 Diese Fundierung kann aber kaum das zentrale Argument für den 1550 neu etablierten universitären Landstand gewesen sein. Zwar waren die neuen Universitätsdörfer Holzhausen und Zuckelhausen amtssässig und wurden daher durch einen oder mehrere gewählte Deputierte aus dem Kreis der Amtssas-sen auf den Landtagen vertreten48, doch erfolgte das Ausschreiben für die Leipzi-ger Amtssassen, wozu auch die beiden genannten Dörfer gehörten, getrennt von dem der Universität selbst.49 Die Universität Leipzig wurde also zum einen als privi-legierte Körperschaft gemeinsam mit ihrer Wittenberger Schwesteranstalt berufen, zum anderen aber über das Ausschreiben an den Leipziger Schösser in Vertretung ihrer beiden amtssässigen Dörfer.50
Dies stellt auch den eklatanten Unterschied zur landständischen Berufungspra-xis von Braunschweig-Wolfenbüttel oder des Herzogtums Bayern dar. Erscheinen Helmstedt und Ingolstadt51 nur in Vertretung ihrer landsässigen Güter, die schon
46 Um den eigenen Argumenten mehr Gewicht zu verleihen und diese zu untermauern, führten die akade-mischen Deputierten ansonsten selbstverständlich kurfürstliche wie königlich / kaiserliche Dokumente im Rahmen der Landtagsverhandlungen an. So bezogen sich die Universitäten während des Dresdner Land-tags 1660 / 61 ohne Weiteres auf die authentica habita Kaiser Friedrichs I. von 1155, um gegen die aus ihrer Sicht den universitären Privilegien und Freiheiten zuwiderlaufende mangelhafte finanzielle Versor-gung der Hohen Schulen zu protestieren. Es wäre daher nur folgerichtig und aus Sicht der Universität(en) geradezu existentiell, erhaltene Privilegien etc. zu bewahren, um diese ggf. heranziehen und zur Unter-mauerung eigener Positionen / Ansprüche anführen zu können. Vgl. UA Leipzig, LTA 18 I, Bedenken und angehängte Bitte der Universitäten wegen der Steuer vom 14. Dezember 1660, fol. 207v–208r.
47 Vgl. dazu Anm. 2.48 Seit dem 1. Januar 1549 gehörten die Dörfer dem Amt Leipzig an, nachdem sie zuvor dem Amt Naunhof
und nach dessen allmählicher Auflösung dem Amt Grimma angehörten. Vgl. Blaschke, Universitätsdörfer (Anm. 2), S. 78 f.
49 In der landesherrlichen Überlieferung findet sich 1622 neben Christoph von Kroßewitz mit Dr. Franz Romanus erstmals auch ein akademischer Vertreter als Deputierter der Leipziger Amtssassen. Vgl. Sächs-HStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9364 / 4, General- und Spezialgravamina der Landschaft (1622), unfol. Eine systematische Durchsicht der Bestände des Leipziger Kreises im Staatsarchiv Leipzig würde sicher noch weitere diesbezügliche Erkenntnisse zu Tage fördern; allerdings setzt die archivalische Über-lieferung erst mit dem Landtag von 1660 ein.
50 Die Zugehörigkeit in den Prälatenstand und die entsprechende Kurie war im ausgehenden 16. Jahrhun-dert keineswegs so klar, wie dies u. a. auch in den späteren universitären Dokumenten erscheinen mag. So führt die Landtagsordnung von 1595 unter dem 2. Artikel die Universitäten noch als eigenständigen (sic!) Landstand auf. „Alßdan leßet Er ein gemein schreiben mutatis mutandis gedrucktt außgehen, darinnen Er alle seine Landtstände, Von Prälaten, Grauen, Herren, der Ritterschaft, Städten und Vniuersiteten Persön-lich zu erscheinen erfordern thutt […]“ Friedrich Karl Hausmann, Kursächsische Landtagsordnung nebst Beilagen, Bemerkungen und einem Anhange, Landtagsordnung 1595, Leipzig 1799, S. 85. Molzahn führt in seiner Studie die drei neugeschaffenen Fürstenschulen (1543) mit unter den Prälaten auf, nachdem er zuvor jedoch schon zu dem Ergebnis kam, dass diesen in der Prälatenkurie keine Plätze zugewiesen wur-den. Molzahn, Adel (Anm. 14), S. 51–53.
51 Ingolstadt wird an dieser Stelle im Gegensatz zu den vorherigen Aussagen mit aufgenommen, da hier nicht nach der realen Wahrnehmung landständischer Rechte gefragt wird, sondern nach der Grundlage der (theoretischen) Landtagspartizipation / -berufung.
Philipp Walter140
vor der Fundation zur Prälaten- oder ritterschaftlichen Kurie ihrer Territorien ge-hörten, und deren landständische Qualität lediglich von den Universitäten / Kolle-gien übernommen und fortgeführt wurde, so treten uns die wettinischen und wohl auch hessischen Universitäten als neu konstituierte Landstände gegenüber, die (zum Zeitpunkt ihres erstmaligen Auftretens) als lutherische, privilegierte Korporationen Einzug auf den Landtagen hielten. Als ursächlich dafür wäre an den enormen Be-deutungszuwachs der Hohen Schulen zu denken, der diesen im reformatorischen Kontext wie der lutherischen Konfessionalisierung zukam.52 Vorrangig sind dabei die Sicherung der reinen Lehre und die Ausbildung des Pfarrer- wie Beamtennachwuch-ses. Wie im Fall der Jenaer Salana konnte zudem noch die Bedeutung als Ort der eigenen Konfessionsbildung – hier in klarer Abgrenzung zur Wittenberger Leucorea und des albertinischen Kurfürstentums – wie der Pflege und Aufrechterhaltung dy-nastischer Ansprüche hinzutreten.53
Dass in der soeben skizzierten Art und Weise gerade die wettinisch-sächsischen wie hessischen Universitäten als Landstände ihrer Territorien auftreten und damit die Hohen Schulen der „ersten und […] vornehmsten Anwälte der evangelischen Sa-che im Reich“54, wird nicht als bloßer Zufall gedeutet werden können. Zu evident scheint hier die Verbindung aus ungebrochener landständischer Partizipation55, lu-therischer Reformation und der Bedeutung der Universitäten für den frühmoder-nen Territorialstaat56. Dass für die Etablierung landständischer Universitäten die Ausstattung mit säkularisiertem und zuvor landsässigem Kirchengut möglicherweise das auslösende Moment darstellt, erscheint wenigstens möglich. Es stellt sich dann die Frage, weshalb die Universität Leipzig erst 1550 und nicht bereits auf den drei Landtagen von 1546, 1547 und 1548 / 49 in Vertretung ihrer landsässigen Güter in Erscheinung trat oder wenigstens zu den Landesversammlungen berufen wurde.
Allerdings bleibt dabei die Frage und kann an dieser Stelle auch nicht abschlie-ßend beantwortet werden, weshalb sich keine weiteren als die genannten (protes-
52 Als exemplarisch dafür können Luthers programmatische Reformvorschläge in seiner Schrift „An den Christlichen Adel deutscher Nation von des Christlichen standes besserung“ angesehen werden. Vgl. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 6, Weimar 1888, S. 381–469, bes. S. 457–462.
53 Daniel Gehrt, Ernestinische Konfessionspolitik. Bekenntnisbildung, Herrschaftskonsolidierung und dy-nastische Identitätsstiftung vom Augsburger Interim 1548 bis zur Konkordienformel 1577 (= Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Bd. 34), Leipzig 2011, S. 36–39.
54 Rudersdorf (Anm. 29), S. 75. In ebensolcher Weise betont Mörke die Vorreiterrolle Kursachsens und Hes-sens für die protestantische Sache. Vgl. Olaf Mörke, Die Reformation (= EDG, Bd. 74), 2., aktualisierte Aufl., München 2011, S. 46.
55 Die kursächsische Landtagsgeschichte beginnt mit dem Zusammenschluss der Landstände zu einer Kör-perschaft unter Kurfürst Friedrich II. und Herzog Wilhelm 1438. Landtagsabschied und Revers gelten als „konstituierende Urkunden der landständischen Verfassung in den meißnisch-sächsischen Landen“. Krüger, Landesherr (Anm. 14), S. 42 f.
56 Auch den katholischen Universitäten und Kollegien ist eine solche Bedeutung zuzusprechen. Doch gelten bei diesen – insbesondere wenn sie teilweise oder vollständig unter jesuitische Obhut gelangten – die bereits vorgestellten Einschränkungen, dass diese entweder nur für ihre landständischen Güter Sitz und Stimme auf den Landesversammlungen wahrnahmen oder sich aufgrund bestehender theologisch-prakti-scher Bedenken – wie am Beispiel der bayrischen Jesuiten gezeigt – von den damit verbundenen ständi-schen Rechten und Pflichten befreien ließen. Vgl. Hengst, Jesuitenuniversitäten (Anm. 22).
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 141
tantischen) Universitäten auf den Ständeversammlungen nachweisen lassen. Eine einfache Erklärung ist dabei nicht zu erwarten und es wird die Aufgabe sein, sich mit einem vergleichenden landes- wie ständegeschichtlichen Zugriff den einzelnen Universitäten und der konkreten Ausformung der landständischen Verfassung des jeweiligen Territoriums anzunähern.57
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle nur, dass die Universität Leipzig im ausgehen-den 16. Jahrhundert gemeinsam mit Wittenberg kursächsischer Landstand war. Die beiden Landesuniversitäten bilden im Rahmen der tradierten ständischen Ordnung eine neue, nur schwer in das bestehende Gefüge zu integrierende Gruppe.58 Dass die beiden neuen Landstände mit dem unbeanspruchten Status zunächst wenig an-zufangen wussten, zeigt sich unter anderem daran, dass sich wenigstens bis 1570 keine aktive Beteiligung der Universitäten an den ständischen Beratungen erkennen lässt. Vielmehr blieben die Akademien den ersten Ständeversammlungen nach 1550 zunächst fern oder autorisierten Bevollmächtigte, um den Beratungen an ihrer Stelle beizuwohnen. Dabei ging es aber in erster Linie um die rein physische Repräsenta-tion ihrer „Principalen“ und weniger um eine reale Mitwirkung an den ständischen Verhandlungen.59
Die seit den 1570er Jahren in der landesherrlichen und in weit stärkerem Maße seit dem letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts in der universitären Überlieferung zu fassende Wahrnehmung und Teilhabe Leipziger akademischer Landstandschaft soll im folgenden Abschnitt zusammengefasst und anhand ausgewählter Schwer-
57 So hätte man unter Berücksichtigung der genannten Kriterien durchaus eine Universität wie die württem-bergische Hohe Schule in Tübingen erwarten können, doch ergeben sich bei der konkreten Frage nach der Ausformung des württembergischen Ständewesens markante Unterschiede zu denen in Hessen oder Sachsen. Im Herzogtum Württemberg bildeten die Vorstände der säkularisierten und dem Land inkorpo-rierten 14 Klosterbezirke unter Herzog Christoph eine Prälatenkurie. Deren Vertreter waren als Vorsteher nunmehr evangelischer Klosterschulen ein bedeutender Teil der württembergischen Stände und berieten und schlossen – im Gegensatz zu Hessen oder Sachsen – auch gemeinsam mit den übrigen Ständen, der „Landschaft“. Das numerische Verhältnis von Prälaten zu Landschaft lag bei 14 zu ca. 60. Vgl. Oliver Auge, Zur Bedeutung der geistlichen Landstände bis zur Reformation – der Südwesten und Nordosten des Reiches im Vergleich, in: Sönke Lorenz, Peter Rückert (Hrsg.), Auf dem Weg zur politischen Partizipa-tion. Landstände und Herrschaft im deutschen Südwesten (= Veröffentlichungen der Kommission für ge-schichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 182), Stuttgart 2010, S. 63–89, hier S. 87 f.
58 Dies wird nicht zuletzt anhand der Tatsache deutlich, dass die Universitäten in der Landtagsordnung von 1595 noch separat aufgeführt werden. Hätten sie sich ohne Weiteres den Prälaten zuordnen lassen, wäre dies unnötig gewesen, vgl. Anm. 50. Gut 130 Jahre später ist die Frage der Zuordnung insofern gelöst, dass als kursächsische Landstände nur noch die Prälaten, Grafen und Herren, Ritterschaft und Städte an-gesprochen werden. Vgl. Hausmann, Landtagsordnung (Anm. 50), Land- und Ausschusstagsordnung von 1728, S. 8. Eine Landtagsordnung von 1676, die eine korrigierte Version der Ordnung von 1656 / 57 dar-stellt, weist die Universitäten ebenfalls noch separat aus. Vgl. Krüger, Landesherr (Anm. 14), Anhang VII, Nr. 2: Landtagsordnung 1676.
59 Es finden sich etwa 1561 in der Wittenberger Vollmacht für „Lorentium Lindeman“, Hofrat und Or-dinarius der juristischen Fakultät, keinerlei konkrete Anweisungen; er soll lediglich alles anhören und mitbeschließen. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9356 / 13, Entschuldigungs- und Vollmachtschreiben der Universität Wittenberg, Bl. 16r. Ähnlich sieht es 1565 für die Leipziger Universi-tät aus, als diese sich beim Kurfürsten entschuldigen lässt und an ihrer Stelle „Leonhardo Badehorn“ be-vollmächtigt alles anzuhören und mitzubeschließen. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9356 / 14, Entschuldigungs- und Vollmachtschreiben der Universität Leipzig, Bl. 38r.
Philipp Walter142
punkte dargestellt werden. Diese orientieren sich am typischen Ablauf eines früh-neuzeitlichen Landtages.60
IV.
Der Entschluss, einen Landtag einzuberufen, lag in den Händen des Landesherrn. Ein ständisches Selbstversammlungsrecht existierte in aller Regel nicht.61 Da sowohl für die kursächsischen wie auch alle übrigen Landtage das zeitgenössische Sprich-wort Geltung besaß, wonach „Landtage [in erster Linie] Geldtage sind“62, orientierte sich die Landtagsfrequenz hauptsächlich anhand der Dauer ständischer Steuerbe-willigungen.63 Und so wurden die meisten Landtage auch kurz vor oder nach Ab-lauf der alten Steuerbewilligungen in einer der großen Land- oder Residenzstädte ausgeschrieben.64 Die exakten Vorbereitungen oblagen ab 1574 dem Geheimen und zuvor wohl dem Hofrat, welcher auch für die Konzeption des Ausschreibens ver-antwortlich war.
Das erste nachzuweisende Ausschreiben für die Universität Leipzig findet sich 1561 als Konzept in der landesherrlichen Überlieferung. Dabei lässt sich kein Argu-ment dafür finden, dass die Hohe Schule (nur) wegen ihrer (schrift- oder amtssässi-gen) Dörfer auf dem Landtag zu erscheinen hätte. Die Universität wird ohne Zusatz oder Einschränkung als Ganzes auf die Landesversammlung geladen; das Ausschrei-ben folgt in Form und Ausfertigung dem der drei Domkapitel.65 Die parallele und
60 Der typische Ablauf besteht aus dem Ausschreiben und den damit verbundenen Vollmachten und Ins-truktionen, über die landesherrliche Proposition und die ständischen Verhandlungen hin zu Abschied, Revers und Auslösung. Kersten Krüger fasst – orientiert an einer modellhaften Darstellung Mosers – den typischen Verlauf eines frühneuzeitlichen Landtages im Reich zusammen. vgl. Krüger, Verfassung (Anm. 11), S. 13–17.
61 1661 ließen sich die Stände im Landtagsrevers ein (eingeschränktes) Selbstversammlungsrecht durch den Kurfürsten bestätigen. Dieses sicherte ihnen für die kommenden sechs Jahre – also für die Dauer der Steuerbewilligung – das Recht zu, sich, wann immer man es für nötig erachten würde, in den Kreisen zu versammeln und jeweils einen städtischen und zwei Vertreter der Ritterschaft für eine Landesversamm-lung zu bevollmächtigen. Diese hätten dem Erbmarschall Zeit und Ort der gewünschten Versammlung anzuzeigen und dem Kurfürsten wären abschließend die Ergebnisse / Forderungen vorzulegen. Es handelt sich hierbei um eine Versammlung, die dem Charakter nach eher als ein Ausschusstag zu bezeichnen wäre. Der Passus des ständischen Selbstversammlungsrechts stellt ohne Zweifel eine Reaktion auf die massive Verzögerungstaktik der kursächsischen Landstände 1660 / 61 dar, die nicht zuletzt die Aufrichtung eines neuartigen Steuerwerks verhindern konnte. Zudem führte die lange Dauer (November 1660 – April 1661) des Landtages zu einem enormen Anstieg der Auslösungs- und allgemeinen Landtagskosten. Vgl. Säch-sHStA Dresden, Ältere Urkunden, O.U. 13471a, Landtagsrevers vom 9. April 1661.
62 Zitiert nach: Ernst Schubert, Fürstliche Herrschaft und Territorium im späten Mittelalter (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 35), München 2006, S. 44.
63 Liefen die Steuerbewilligungen aus, war ein neuer Landtag unabdingbar, da der Landesherr nur über die Mitsprache und in der Auseinandersetzung mit seinen Ständen mit einer neuerlichen Steuerbewilligung rechnen konnte. Darüber hinaus beriefen die sächsischen Kurfürsten unmittelbar nach ihrem Regierungs-antritt einen Landtag ein. Vgl. Krüger, Landesherr (Anm. 14), S. 62.
64 Nachdem der Ort zuvor häufig gewechselt hatte (u. a. Grimma, Leipzig, Meißen, Torgau) fanden die Lan-desversammlungen seit 1631 immer in Dresden statt. Vgl. Nina Krüger, Britta Günther, Landtage in Sach-sen 1438–1831, in: Gross, Landtage (Anm. 14), S. 85–111.
65 Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9356 / 13, Bl. 8r.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 143
gleichlautende Formulierung des landesherrlichen Ausschreibens für die Domkapi-tel und die Universitäten endet 1582. Von da an werden die Universitäten getrennt von den Kapiteln zum Landtag beschrieben; dies schlägt sich auch in (marginalen) Unterschieden der Anredeformel nieder.66
Die Ausschreiben wurden den Ständen ein bis drei Monate vor dem angesetzten Landtagstermin zugestellt. Für die Universitäten hatte dies im Gegensatz zu den Schriftsassen oder Städten noch zur Folge, dass man vor der Aufgabe stand und dazu auch explizit im Ausschreiben aufgefordert wurde, ein oder mehrere der Pro-fessoren als Deputierte festzulegen.67 Das consilium professorum publicum bildete das Gremium, aus dessen Mitte und im Namen von „Rector, Magistri und Doctores“ die Leipziger Landtagsdeputierten bestimmt wurden. Meist waren dies ein oder zwei Professoren der juristischen Fakultät, bis ins erste Drittel des 17. Jahrhunderts auch häufig ihr Ordinarius, und in einigen Fällen trat ein Vertreter der anderen Fakultä-ten hinzu.68 Ergänzt wurde diese Gruppe häufig durch den Universitätsnotar.
Bei der Wahl der Professoren wurde neben der fachlichen Qualifikation auch Wert auf eine gewisse Kontinuität gelegt. So finden sich auf den 25 Landtagen im Zeitraum zwischen 1550 und 1660 17 verschiedene Leipziger Professoren als uni-versitäre Deputierte.69 Schränkt man diese Gruppe auf diejenigen ein, die im Rah-
66 Vgl. ebd., Loc. 9357 / 5, Bl. 162r.67 Bei den landsässigen Städten war es in der Regel der Bürgermeister und bei den schriftsässigen Gütern
der Inhaber desselben, der auf den Landesversammlungen erschien; eine Deputiertenwahl war hier nicht notwendig.
68 Die Zusammensetzung richtet sich stark nach dem Charakter des bevorstehenden Landtages. Für den Fall, dass es sich um einen gewöhnlichen, d. h. am Finanzbedarf des Landesherrn und der Abstellung ständi-scher Gravamina orientierten, Landtag handeln sollte, finden sich in den allermeisten Fällen Juristen als akademische Deputierte. Sobald aber die Landtage zum Austragungsort anderweitiger, etwa konfessionel-ler Themen wurden, schlug sich dies auch in der Zusammensetzung der universitären Delegation(en) nie-der. So schrieben die Wittenberger Abgeordneten (Johann Zanger, Salomon Albrecht, Michael Reichard) anlässlich des Landtages 1592 an die Leucorea, dass „furnemblichen Relligionssachen tractiret werden“ und die Universität Leipzig deswegen mit zwei Theologen (Zacharias Schilter, Burkhard Harbart) und vier weiteren Personen vor Ort wäre. Aus diesen Gründen würde man um ein „außfurliches bedencken, deßen unß undrethalben zugebrauchen“ bitten, damit sich im Anschluss niemand über die Ausführungen der Wittenberger Deputierten beschweren müsste. Vgl. Universitätsarchiv Halle-Wittenberg (im Folgenden: UA Halle-Wittenberg), Rep. 1 Nr. 3881, Schreiben der Wittenberger Deputierten an die Leucorea vom 22. Februar 1592, unfol.
69 Nur für die Jahre 1552, 1561, 1565, 1592, 1609, 1612, 1622, 1628, 1631, 1635, 1640, 1657, 1660 / 61 liegen die Namen der akademischen Deputierten vor. Es ist jedoch auch für die meisten der übrigen Landtage zwischen 1550 und 1660 von der Anwesenheit akademischer Deputierter oder bevollmächtigter Dritter auszugehen: Ludwig Fachs (Ordinarius der Juristenfakultät)1552 DresdenModestinus Pistoris (Vizeordi-narius der Juristenfakultät)1561 TorgauLeonhard Badehorn (Leipziger Bürgermeister)1565 TorgauZacha-rias Schilter (theol.), Burkhard Harbart (theol.), Christoph Meurer (Rektor und Prof. an der Phil. Fakul-tät), „Doctor Jungerman syndico“, „Doctor Kittlern medico“ und „M. Matthæo Drossero“1592 TorgauN. N.1601 TorgauN. N.1605 TorgauMichael Wirth (Ordinarius der Juristenfakultät), Franz Romanus (jur.), Syndikus Bartholomäus Gölnitz, „Notarium publicum Jonam Neandrum“1609 TorgauBartholomäus Göl-nitz (Rektor), Michael Wirth (jur.), Christoph Braun (med.), Johann Friderich (phil.), Christoph Finkelthaus (Universitätsnotar)1612 TorgauFranz Romanus (Ordinarius der Juristenfakultät), Bartholomäus Gölnitz (jur.), Johann Müller1622 TorgauFranz Romanus (Ordinarius der Juristenfakultät), Bartholomäus Gölnitz (jur.), Johann Müller, Friedrich Leibnütz 1628 TorgauHeinrich Höpfner (theol.), Bartholomäus Gölnitz (jur.), Sigismund Finkelthaus (jur.), Friedrich Leibnütz (Universitätsnotar)1631 DresdenJohann Böhm (jur.), Sigismund Finkelthaus (jur.), Friedrich Leibnütz (Universitätsnotar)1635 DresdenDavid Lindner (Syndikus), Johannes Strauch (stellv. Universitätsnotar)1640 DresdenQuirin Schacher (jur.), Franz Roma-
Philipp Walter144
men der lückenlosen Überlieferung ab 1609 nachzuweisen sind, dann reduziert sich diese Gruppe auf zwölf Personen. Von diesen finden sich acht auf zwei oder mehr Landtagen wieder; an der Spitze steht dabei Bartholomäus Gölnitz, der die Landes-versammlungen von 1609, 1622, 1628 und 1631 besuchte. Für die Gelehrtenfamilie Romanus wird die Wahl zum Universitätsdeputierten im 17. Jahrhundert beinahe zu einer Familientradition, denn es finden sich Vater oder Sohn zwischen 1609 und 1660 auf fünf Landtagen, wobei die Versammlung von 1628 von beiden gemeinsam besucht worden ist.70
Dass die Alma Mater Lipsiensis während der ersten Jahre ihrer neu gewonnenen Landstandschaft derselben nur relativ wenig Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ, was auch anhand der Deputationspraxis deutlich wurde, lässt sich sehr wahrscheinlich auf die bereits dargelegte universitäre Auffassung zurückführen, dass die Landtags-berufung ausschließlich mit der Neufundierung 1543 / 44 im Zusammenhang gestan-den hätte. So entschuldigte man sich auch 1552 für das eigene Nichterscheinen und autorisierte stattdessen den in Dresden weilenden Ordinarius der Juristenfakultät und kurfürstlichen Gesandten Ludwig Fachs mit der Wahrnehmung der akademi-schen Landtagsgeschäfte. Dabei beschränkten sich alle Anweisungen Fachs‘ auf die Zusicherung an die übrigen Stände, dass die fünf Universitätsdörfer alle von der Landschaft gefassten Bewilligungen erfüllen würden. Die Universität trat in diesen Jahren im Rahmen der landständischen Verhandlungen also nicht als Akteur in Er-scheinung.71
Gegenstand solcher Verhandlungen war die Hohe Schule natürlich auch schon vor 1550 immer wieder gewesen, doch war sie dabei nicht als albertinischer Land-stand aufgetreten, sondern lediglich als Objekt der Disputationen und Kontroversen zwischen Landesherr und Ständen, ohne dabei durch aktive Teilnahme der eigenen Position Stimme und Gewicht verleihen zu können.72 Dies änderte sich spätestens mit den Landtagsverhandlungen der 1570er Jahre (1570, 1576) und der durch die akademischen Deputierten forcierten oder aufgegriffenen Thematisierung universi-tärer Fragen bzw. Gravamina.73
nus (jur.)1657 DresdenQuirin Schacher (jur.), Franz Romanus (jur.), Bernhard Leidner (Aktuar) / Johannes Heinrich Ritter (Notar)1660 / 61 Dresden.
70 Allerdings ist Franciscus Romanus Junior als Sohn des Leipziger Ordinarius nur Gast und nicht durch die universitäre Vollmacht legitimiert. Im Verzeichnis der anwesenden Prälaten, Grafen und Herren wird dahingehend vermerkt, dass Franciscus Romanus „et filius eius H. D. Franciscus Romanus Junior beneben den S. Famulo“ auf dem Landtag erschienen wären. Vgl. UA Leipzig, LTA 7 II, Verzeichnis der anwesenden Prälaten, Grafen und Herren, Bl. 11r.
71 Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9355 / 4, Schreiben der Universität Leipzig an Ludwig Fachs in Dresden, Bl. 124r.
72 Dies steht nicht im Widerspruch zu der bereits erwähnten Tatsache, dass sich auch schon vor 1550 spo-radisch universitäre Vertreter im Rahmen der Landtage nachweisen lassen, denn diese erscheinen eben nicht als albertinischer Landstand oder in Vertretung eines solchen.
73 Die Leucorea und ihr folgend auch die Universität Leipzig baten anlässlich der Torgauer Verhandlun-gen von 1570 um die Beibehaltung des reduzierten Steuersatzes der Professoren. Dieser Bitte kam der Landesherr auch nach und gewährte den Professoren beider Hoher Schulen weiterhin den ermäßigten Satz von 50 % der gewöhnlichen Höhe. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9357 / 4,
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 145
Als übliche Verfahrensweise anzunehmen und für die Landtage des 17. Jahrhun-derts auch mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich zu belegen ist, dass die Universi-tätsdeputierten vor ihrer Abreise mit einer Vollmacht und / oder Instruktion seitens des consilium professorum versehen wurden. Durch diese waren sie legitimiert, im Namen der gesamten Universität zu sprechen, zu entscheiden und Bewilligungen zu gewähren. Konkrete Aufgaben oder Forderungen wurden den Leipziger Depu-tierten in diesen Schreiben selten an die Hand gegeben. In wenigen Fällen behielt sich die Universität ein gewisses Vetorecht vor, um auf Grundlage der einlaufenden Landtagsdokumente zu reagieren und gegebenenfalls Instruktionen folgen zu las-sen.74 Dies konnte auch eine direkte Intervention der Universität(en) bei der Land-schaft75 zur Folge haben oder aber zur Zusendung notwendiger Akten / Schriftstü-cke führen, die seitens der Deputierten für die weiteren Verhandlungen benötigt wurden. Um die Unkosten der Anreise und der ersten Tage vor Ort bestreiten zu können, erhielten die Deputierten aus dem akademischen Fiskus vor ihrer Abreise eine geringe Geldsumme.76
Die Leipziger Delegation reiste in der Regel einen Tag vor Publikation der lan-desherrlichen Proposition mit ein oder zwei Kutschen und in Begleitung einiger Diener an, meldete ihre Ankunft samt der Pferdeanzahl dem Hofmarschall77 und bezog ihr Quartier in der Stadt selbst. Die Unterkunftsfrage wurde wohl des Öfteren
Bittschreiben der Universität Wittenberg, Bl. 215r–217r sowie ebd., Kfs. Bewilligung (Konzept), Bl. 218r. 1576 sind sowohl Fleiß und Einsatz der Professoren wie auch die Besetzung vakanter Stellen Gegenstand ständischer Verhandlungen. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9357 / 5, Gebrechen der Landschaft, Bl. 126v.
74 Die Korrespondenz zwischen Universität und Deputierten lässt sich nicht für jeden Landtag nachweisen, darf aber als übliches Prozedere angenommen werden. Für den Landtag von 1640 lässt sich relativ genau der Schriftwechsel zwischen akademischen Deputierten und der Hohen Schule nachvollziehen und es ist zu erkennen, dass Rektor und Universität fortlaufend über die Landtagsvorgänge (speziell die Proposition und allgemein die landesherrlichen wie ständischen Positionen) informiert und um ihre Meinung gebeten wurden. Dies konnte soweit führen, dass die Universität selbst unmittelbar in das Landtagsgeschehen intervenierte; etwa in Form von Memorialen oder Bittschriften. Vgl. UA Leipzig, LTA 11, Bl. 43r–44r, 63r–65v, 188r–191r, 332r–333r, 410r.
75 Es wird sich hierbei an der Quellensprache orientiert und unter dem Terminus ‚Landschaft‘ werden die Vertreter der ritterschaftlichen wie städtischen Kurie verstanden. Dabei sei an dieser Stelle darauf hin-gewiesen, dass dieser Begriff auf die Territorien des Reichs bezogen nicht fest definiert war und in jedem einzelnen Fall darauf zu achten ist, welche Ständegruppen damit angesprochen wurden bzw. sich selbst darunter verstanden.
76 1640 erhielten die Leipziger Deputierten bei der Abreise 38 Taler und 12 Groschen durch Heinrich Hart-mann ausgehändigt. Nach ihrer Rückkehr beliefen sich die gesamten Landtagsunkosten auf 192 Taler, 20 Groschen und 10 Pfennig. Vgl. UA Leipzig, LTA 11, Aufstellung der Landtagskosten mit drei Anhängen, Bl. 458r–458v. Die Frage der Landtagsunkosten und wie diese den Ständen zu erstatten wären ist eine von allen beteiligten Parteien immer wieder kontrovers diskutierte Frage. Bis 1622 war es allem Anschein nach üblich, dass den Prälaten wie Universitäten ihre Landtagsunkosten vollständig aus der kurfürstlichen Kammer erstattet wurden. Von da an erhielten die Universitäten und wohl auch die Stifte – trotz zahl-reicher Protestschreiben – „nur“ noch die im jeweiligen Ausschreiben festgelegte Auslösung pro Tag und Pferd (1622: 2 Gulden pro Pferd; 1631: 1,5 Gulden pro Pferd; spätere Landtagsausschreiben verzichten ganz auf konkrete Angaben). Wurden die Landtagsunkosten anfänglich noch aus der landesherrlichen Kammer bestritten, so sollten sie später (1635) von den ersten zu zahlenden Steuerbeträgen abgezogen, um schließlich ab 1657 gleich über eine speziell dazu bestimmte Steuersumme (2 Pfennig vom Schock) finanziert zu werden.
77 Diese Meldung bildete die Berechnungsgrundlage der Landtagsunkostenerstattung.
Philipp Walter146
durch vertraute Personen am Landtagsort im Voraus in die Hand genommen und dürfte sich nicht selten als überaus kompliziert dargestellt haben.78
Die Umstände der Landtagseröffnung wie der ersten Verhandlungen lassen sich hervorragend anhand (ständischer) Protokolle nachvollziehen.79 Aus akademischer Perspektive liegt ein erstes Protokoll dieser Art für den Landtag von 1631 vor und gewährt frühe Einblicke in die alltägliche Landtagspraxis. So ist zu erfahren, dass den Ständen am Abend vor der eigentlichen Landtagseröffnung Zeit und Ort der-selben mitgeteilt und die akademischen Deputierten aufgefordert wurden, sich ge-meinsam mit den übrigen Ständen am 18. Juni 163180 um halb sechs Uhr morgens auf dem Schloss einzufinden, gemeinsam zu singen und im Anschluss die Predigt81 (aus den Sprichwörtern Salomos (27,23); „Auf deine schaffe habe acht undt nim dich deiner herde ahn.“) anzuhören hatten. Im Anschluss daran fanden sich die Stände in der Salamanis-Stube ein, um dann vom Hausmarschall Georg Pflugk über den Riesensaal in den steinernen Saal über der Schlosskirche geführt zu werden. Dort erschienen wenig später „Ihre Churf. Dhl. Hoffjungkhern […], dan die vier Junge Herren, folgendts Ihr Ch. Dhl. und hernach die geheimbdte und anderen Rathe“. Die versammelten Stände wurden darauf durch den Geheimen Rat Nicol Gebhard von Miltitz angesprochen, an die gefährlichen Zeitenläufte erinnert und auch darü-ber aufgeklärt, weshalb der Landtag erst mit einigen Tagen Verzögerung beginnen konnte. Daraufhin wurde die kurfüstliche Proposition durch den geheimen Sekretär Conradt Jehen vorgelesen und danach dem Erbmarschall zugestellt, woraufhin sich die Stände zu den nach Kurien getrennten Beratungen zurückzogen.82
78 Das galt beispielsweise als, wie 1635 geschehen, die Universität Wittenberg „auß erheblichen bedencken und ursachen“ in einem Schreiben an die Leipziger Hohe Schule auf ein gemeinsames Quartier ihrer wie der Leipziger Deputierten drängte. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Schreiben der Universität Wittenberg an die Universität Leipzig vom 10. Dezember 1634, Bl. 11r–11v. Die Universität Leipzig hatte zum Zeitpunkt des Briefes weder ihre Deputierten nominiert, noch eine ausreichend geräumige Unterkunft gefunden. Dies sollte im weiteren Verlauf auch nicht mehr gelingen und so fanden die Leipziger Deputierten nur für sich und getrennt von ihren Wittenberger Kollegen Unterkunft bei Andrae Manigkens (kurfürstlich-sächsischer Hofbäcker) ehelicher Hausfrau. Dabei hatten sie für jede Mahlzeit 10 Groschen zu bezahlen, wofür sie jedoch nur Bier und keinen Wein bekamen. Die beiden Knechte erhielten ein Essen für zusam-men 4 Groschen und für die Stube, Betten, Holz, Licht und Stallung sollten pro Woche zwei Reichstaler gegeben werden. Vgl. ebd., Notiz über die Konditionen der Unterkunft der Leipziger Deputierten vom 21. Dezember 1634, Bl. 17r.
79 Grundsätzlich dazu Krüger, Landesherr (Anm. 14), S. 62–68.80 Ursprünglich war die Eröffnung für den 12. Juni 1631 geplant, doch der Kurfürst hielt sich zu diesem Zeit-
punkt noch in Leipzig auf, um die Rückkehr seiner zum kaiserlichen General Tilly deputierten Gesandten abzuwarten. Er beauftragte jedoch am 13. Juni die Geheimen Räte gemeinsam mit dem Kanzler Wolf zu Lüttichau und Hofrat Gabriel Tünzel, die Proposition vorzubereiten, damit man unmittelbar nach seiner Rückkehr mit der Eröffnung des Landtages beginnen könnte. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9366 / 5, Schreiben des Kfs. an die Geheimen Räte vom 13. Juni 1631, Bl. 27r.
81 Es liegt bisher keine systematische Untersuchung (u. a. Inhalt, Intention) der kursächsischen Landtags-predigten vor. Davon wären u. U. zusätzliche Aspekte des Verhältnisses von Landesherr und Ständen zu erwarten, da die bisher im Rahmen der universitären Landstandschaft überprüften Predigten eine starke Verankerung in den jeweiligen konkreten Landtagsumständen (Anlass / politische Verhältnisse im Kurfürs-tentum wie im Reich etc.) erkennen lassen. Dass die Predigt unmittelbaren Bezug auf den Landtag und die drängenden Fragen nehmen sollte, ist zudem explizit in der kursächsischen Landtagsordnung von 1728 aufgeführt. Vgl. Hausmann, Landtagsordnung (Anm. 50), S. 11.
82 Vgl. UA Leipzig, LTA 8, Protokoll der Eröffnung des Landtages vom 18. Juni 1631, 10v–11r.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 147
In dieser oder ähnlicher Form gestalteten sich die meisten Landtagseröffnungen des 16. und 17. Jahrhunderts, wenngleich die Anwesenheit von vier wettinischen Prin-zen ein bemerkenswertes Ereignis darstellte, wie dies bereits anlässlich des 1628er Landtages durch den Leipziger Deputierten Johann Müller konstatiert wurde.83
So wie der frühneuzeitliche Reichstag das „theatrum praecedentiae“ und somit das zentrale „Forum symbolisch-zeremoniellen Handelns im Reich“84 darstellte, kann dies in abgewandelter Form auch für die ständischen Versammlungen der Territorien des Reichs gelten. Der kursächsische Landtag und vor allem seine althergebrachte und tradierte Sitzordnung war Ausdruck einer festen (symbolischen) Rangfolge, da sie „allen anderen Rangkriterien den Vorzug der unzweideutigen Sichtbarkeit, der Positivität (im wörtlichen Sinne) voraus hatte“85. Die Rangordnung der kursächsi-schen Stände, wie sie in der Sitzordnung der Landtage und ihrer Unterteilung in die drei Kurien (1. Prälaten, Grafen und Herren, 2. Ritterschaft, 3. Städte) ihren symbo-lischen Ausdruck fand, korrespondiert jedoch kaum mit den realen Macht- und Be-deutungsverhältnissen im Land.86 Dass etwa die kursächsischen Prälaten (Hochstifte Meißen, Merseburg, Naumburg) auch noch im 17. Jahrhundert als vornehmste Glie-der der sächsischen Landstände angesprochen wurden, war weniger in ihrer aktuel-len politischen oder ökonomischen Bedeutung begründet als vielmehr in der ihnen in der vorreformatorischen Zeit zukommenden und tradierten Relevanz. Hinzu trat die Tatsache, dass seit der Mitte des 16. Jahrhunderts kursächsische Prinzen zu Ad-ministratoren der Stifte gewählt wurden.87
Als problematisch für die akademischen Deputierten wie die ständische Posi-tion der Universitäten und damit geradezu sinnbildlich für deren schwer zu ver-ortende Stellung innerhalb des albertinischen Ständegefüges erwies sich die im Laufe des 17. Jahrhunderts durch die Gruppe der Prälaten, Grafen und Herren bzw. deren Vertreter aufgeworfene Frage nach der eigentlichen Qualität der akademi-schen Landstandschaft und deren Manifestation auf der Ständeversammlung. Aus-lösendes Moment dieses als „Präzedenzstreit“ bekannt gewordenen Konflikts wurde die Frage nach dem „richtigen“ Platz der Universitätsdeputierten unter ihren Mit-ständen auf dem Dresdner Landtag 1660 / 61. Mit Fragen der Zuordnung innerhalb der tradierten Landtagsverfahren und ständischen Beratungsgremien wurden die akademischen Deputierten im Laufe des 17. Jahrhunderts sporadisch konfrontiert,
83 Der Leipziger Deputierte bemerkt dazu, dass man sich nicht erinnern könne, dass jemals im Kurfürsten-tum Sachsen ein Landtag stattgefunden hätte, der sich durch die Anwesenheit des Landesherrn und seiner Söhne (darunter ein Magdeburger Erzbischof – August – und die Bischöfe von Merseburg und Meißen) ausgezeichnet hätte. Vgl. UA Leipzig, LTA 7 II, Protokoll vom 18. Februar 1628, Bl. 9v-10r.
84 Stollberg-Rilinger, Zeremoniell (Anm. 9), S. 94.85 Ebd., S. 102.86 Die Rangordnung unterscheidet sich damit eklatant von den Reichstagsverhältnissen, die in viel stärkerem
Maße die realen Bedeutungs- und Machtverhältnisse ihrer Glieder repräsentieren.87 Vgl. Krüger, Landesherr (Anm. 14), S. 51–53. Ähnliches ließe sich auch zur Gruppe der Grafen und Herren
ausführen.
Philipp Walter148
doch führten diese in keinem Fall zu mehrjährigen Auseinandersetzungen.88 Eine kurfürstliche Entscheidung über den akademischen Stations- und Sessionsstatus wurde aber erst durch den „Präzedenzstreit“ unumgänglich. Ursächlich für diese innerständische Kontroverse war die Tatsache, dass die Leipziger wie Wittenberger Deputierten anlässlich der Propositionspublikation am 12. November 1660 ihren Platz innerhalb der Schranken und neben den Abgeordneten der drei Stifte ein-genommen hatten.89 Dies und der Umstand, dass sich die Universitäten in einem an den Kurfürsten gerichteten Schreiben vom 3. Dezember 1660 „alß eine[n] son-derlichen prälatur-Stand[…]“ bezeichneten, führte zu massiven Protesten der Depu-tierten der Grafen und Herren und, deren Widerspruch aufgreifend, auch seitens der drei kursächsischen Stifte.90 Die umfangreichen, im Rahmen des Landtages und darüber hinaus stattgefundenen Auseinandersetzungen sollen hier nicht im Detail diskutiert werden. Als entscheidend für eine der zentralen Fragen dieser Ausfüh-rungen erweist sich hierbei aber, dass der Status der kursächsischen Universitäten auch über 100 Jahre nach ihrer Aufnahme in den Kreis der kursächsischen Stände noch nicht endgültig fixiert scheint. Trotz aller gelehrten Versuche seitens der Aka-demien, ihren Prälatenstatus unzweifelhaft nachzuweisen, wurde dieser von ihren ständischen Kontrahenten im Laufe der sich zuspitzenden Kontroverse rundheraus abgelehnt.91 So fand der Konflikt im Rahmen des Landtages von 1660 / 61 keine Lö-
88 Die Sitzordnung der einzelnen Landtage lässt sich nur in den wenigsten Fällen rekonstruieren, wobei für die hier aufgeworfenen Fragen von vorrangigem Interesse wäre, ob die akademischen Deputierten inner- oder außerhalb „der Schranken“ standen und ob „zur Rechten“ oder „Linken“ des Kurfürsten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Universitäten oder ihre Vertreter scheinbar eine unterschiedliche Wahrnehmung davon hatten, ob ihnen ihr angestammter und somit zustehender Platz seitens der Mit-stände (konkret Prälaten, Grafen und Herren) verwehrt wurde oder nicht. So bedenkt die Universität Leipzig im Vorfeld des 1660er Landtages ein Schreiben der Leucorea, das die Leipziger Unterstützung bei der Wiederinanspruchnahme zuvor verwehrter Sessionsplätze nachdrücklich einfordert, lediglich mit der Antwort, dass man sich nicht erinnern könnte, dass der Hohen Schule einmal die ihr zukommende Session „von iemandten disputiret weniger deßwegen einige quaestion moviret worden“ wäre. Vgl. UA Leipzig, LTA 18 I, Schreiben der Leucorea an die Universität Leipzig vom 17. September 1660, Bl. 7r–7v; ebd. Antwort der Universität Leipzig vom 22. September 1660, Bl. 8r.
89 Der exakte Ablauf und das Zustandekommen dieser den gräflich-stiftischen Protest mit auslösenden Situ-ation lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren, da darüber zwar einiges an Quellenmaterial vorhanden ist, dieses jedoch bei drei verschiedenen Perspektiven (universitär, gräflich, stiftisch) auch drei voneinander abweichende Versionen liefert. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass der Ort der universitären „station“ als unzulässig und damit gräflichen Vorrechten zuwiderlaufend betrachtet wurde. Die Stiftsdeputierten schlossen sich erst in dem Augenblick der Position der Grafen und Herren an, als ihnen die universitäre Eigenbezeichnung als „sonderlicher Prälaturstand“ bekannt wurde.
90 Vgl. UA Leipzig, LTA 18 I, Protestation der Grafen und Herren gegen die Universitäten wegen der Präze-denz vom 19. Dezember 1660, Bl. 320r–321v sowie ebd. Antwort der Domkapitel auf die von den Univer-sitäten anlässlich der Publikation der Proposition „affectirte station“ vom 29. Januar 1661, Bl. 690r–693r. Eine besondere Note erhielt dieser Streit zudem dadurch, dass mit dem gräflich-stolbergischen Deputier-ten Johann Georg Nicolai die treibende Kraft im Präzedenzstreit zugleich der Deputierte der Universität Wittenberg war. War die parallele Mandatsübernahme gerade universitärer Deputierter etwa für die Gra-fen und Herren nichts völlig Unbekanntes, barg dieser Fall doch eine Reihe gravierender Besonderheiten, die an dieser Stelle jedoch nicht weiter diskutiert werden können. Vgl. UA Leipzig, LTA 18 II, Landtags-protokoll der Universitäten; SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9375 / 1, (unvollständiges) Landtagsprotokoll der Prälaten, Grafen und Herren, Bl. 1r–17v.
91 Gerade die Leucorea, als Initiator und Ausgangspunkt der beklagten besonderen Stellung und Titulatur der Universitäten, versuchte direkt, d. h. unter Umgehung ihres Deputierten auf dem Landtag, Einfluss auf den Kurfürsten und die Haltung der involvierten Parteien zu nehmen. Dabei wurden neben eher handfes-
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 149
sung; diese konnte erst 1666 durch eine kurfürstliche Entscheidung herbeigeführt werden. Dabei ist das Ergebnis als Kompromisslösung anzusehen, da die Universitä-ten einerseits weiterhin nicht zur Session der Prälaten, Grafen und Herren geordnet wurden und somit auch dauerhaft unter sich bleiben und gesonderte Bedenken etc. abzugeben hätten. Andererseits sollten die Akademien während der Propositions-publikation ihren Platz „unterhalb denen Praelaten haben und behalten“, was einer-seits die Stellung der Universitäten als herausgehobene Glieder der kursächsischen Stände bestätigte, andererseits aber nach wie vor einen auch sichtbaren Unterschied zu den Prälaten deutlich machen sollte. Sie erhielten ihren Platz eben nicht bei den Prälaten, sondern unterhalb, das heißt deutlich wahrnehmbar abgesetzt von diesen.92 Wie praxistauglich dies war, muss an dieser Stelle offen bleiben, doch wurde auch schon anlässlich der Eröffnung des 1666er Landtages nach den Prinzipien der kur-fürstlichen Entscheidung verfahren, d. h. die universitären Deputierten traten nach Aufforderung durch den Oberhofmarschall in die Schranken und zu den Prälaten, ließen aber einen wahrnehmbaren Abstand zu eben jenen. Dies schien aber am Ord-nungs- oder ästhetischen Empfinden des Oberhofmarschalls zu rühren, da er den Universitäten sogleich befahl, die Lücke zu den Stiftsdeputierten zu schließen und damit die Situation von 1660 wiederherzustellen.93
Festzuhalten bleibt, dass mit der kurfürstlichen Entscheidung von 1666 zwar die Frage der akademischen Station (zur Rechten des Kurfürsten, aber klar von den Stiftsdeputierten getrennt) wie auch die ihrer Session (eigener Tagungsraum und eigene Landtagsschreiben) entschieden wurde, eine eindeutige Zuordnung der bei-den Universitäten zu einer der gewöhnlichen Ständegruppen jedoch unterblieb. Auch ein halbes Jahrhundert später hatte sich daran trotz des Fehlens der Univer-sitäten bei der Auflistung der kursächsischen Stände in der Landtagsordnung von 1728 nichts geändert.94 Die Universitäten waren nach der landesherrlichen Entschei-
ten Argumenten wie dem des 1634 durch den Kurfürsten festgestellten Prälatenstatus der Leucorea („teste Dno Carpz lib. 3 Jurispr. Consist. Def 12 num 14 […] item Dn. Carpz. Sib. 3 Iurispr. Consist. def 12 n. 9“) auch deutlich weniger konkrete angeführt. So würde sich aus der Tatsache, dass die Grafen und Herren die Präzedenz der Stifte ohne Widerspruch akzeptieren würden, das deswegen den Universitäten ebenso zukommende Vorrecht eindeutig ergeben. Dieses Argument war allerdings nur solange einigermaßen plausibel, wie der Status der Akademien als Prälaten und kursächsische Stände unwidersprochen blieb. Dies änderte sich jedoch mit einem Protestschreiben der Stifte vom 29. Januar 1661. Vgl. UA Leipzig, LTA 18 I, Schreiben der Universität Wittenberg an den Kurfürsten wegen der Protestation der gräflichen Ab-geordneten die Präzedenz und Session betreffend vom 28. Dezember 1660, Bl. 486r–490v.
92 Vgl. UA Leipzig, Rektor Rep. I Kap. I Nr. 28b, Entscheidung des Kurfürsten die Station der beiden Uni-versitäten betreffend vom 13. April 1666, Bl. 12v. Als ein ausschlaggebendes Argument für diese Entschei-dung wird seitens des Kurfürsten die Tatsache angeführt, dass die klageführenden Prälaten, Grafen und Herren keinen Alternativplatz für die Universitäten anbieten konnten. Da man sie weder bei der Ritter-schaft noch bei den Städten oder an einem anderen Ort platzieren konnte, wäre es nur recht und billig, sie würden ihren Platz bei den Prälaten behalten. Wären die Akademien lediglich wegen ihrer landsässigen Güter zu den Landtagen berufen worden, wäre es anlässlich dieser Kontroversen ein Leichtes gewesen, den Hohen Schulen den ihnen deswegen zustehenden Platz unter der Ritterschaft zuzuweisen.
93 Vgl. UA Leipzig, Rektor Rep. I Kap. I Nr. 28b, Protokoll des ersten Tages der Landesversammlung vom 5. März 1666, Bl. 12v.
94 Vgl. Anm. 50. Gleichwohl ließe sich diese Tatsache auf verschiedene Weisen interpretieren. Zum einen könnte sie als Indiz dafür gelten, dass die Universitäten nunmehr unzweifelhaft den Prälaten zugerechnet
Philipp Walter150
dung von 1666 ein unbestrittener, aber nach wie vor nur schwer einzuordnender Teil der kursächsischen Stände.
Die überlieferten Quellenbestände zur Landtagspraxis des gesamten 17. und soweit festzustellen auch der wenigen Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts, zeugen un-abhängig von der Frage nach dem universitären Prälatenstatus von den separaten Sitzungen der Deputierten der kursächsischen Universitäten und ihrer daraus resul-tierenden eigenständigen Repliken, Dupliken, Quadrupliken, Bedenken und Gra-vamina. In diesem Sinne agieren die beiden Hohen Schulen unabhängig von ihren Mitständen, formulieren individuelle wie teils kollektive Reaktionen und können als fünfte kursächsische Ständegruppe angesprochen werden.95 Der Charakter univer-sitärer Landtagspraxis wird im Folgenden in seinen wesentlichen Zügen vorgestellt und in das landständische Gesamtgefüge eingeordnet.
Hauptgegenstand der ständischen und somit auch der universitären Landtags-arbeit war die Auseinandersetzung mit der kurfürstlichen Proposition wie die Prä-sentation eigener Anliegen und – zentraler Bestandteil ständischer Versammlun-gen – die Vorlage einzelner oder kollektiver Landesgravamina. Die Annahme der Gravamina durch den Landesherrn und die Zusage, dieselben, wenn schon nicht unmittelbar während des Landtages – was in der Regel kaum möglich war –, so doch baldmöglichst nach diesem abzustellen, bildeten die Grundvoraussetzung für alle ständischen Steuerbewilligungen.96 Die Proposition wurde in vier oder fünf Ausfertigungen in die einzelnen Kurien gegeben, um dort als Grundlage der inner-ständischen Verhandlungen zu dienen. Die Universitäten und Schulen waren in aller Regel nur in einem sehr allgemeinen Kontext Gegenstand der Proposition, war diese doch in erster Linie das Medium der landesherrlichen Finanzforderungen wie die Aufforderung an die Stände, zu sehr konkreten, meist tagesaktuellen Fragen Stellung
wurden und man daher auf eine separate Auflistung derselben verzichten konnte. Dem entgegen steht allerdings die eindeutig formulierte Trennung der Universitäten von der Gruppe der Prälaten, Grafen und Herren in allen Fragen der gemeinsamen Beratungen. Andererseits könnte genau aus dieser Tatsache die Schlussfolgerung gezogen werden, dass der 1660 monierte „sonderliche Prälatenstatus“ Teil der Land-tagsrealitäten geworden war. Das heißt, die Universitäten sind zwar seitens des Landesherrn grundsätzlich als Prälaten anerkannt, allerdings nicht analog zu den Stiften, sondern in Form eines davon abweichen-den, die gewöhnlichen Kriterien verlassenden, aber auch nicht näher definierten „sonderlichen prälatur-Stand[es]“.
95 Muss in anderen Territorien des Reichs durch das Ausscheiden der landsässigen Prälaten oder Ritter-schaft eher von einer Reduzierung der ständischen Gruppen gesprochen werden, kann für Kursachsen durchaus eine davon abweichende Entwicklung konstatiert werden. Die Universitäten treten neben die etablierten Gruppen der Prälaten, Grafen und Herren, Ritterschaft und Städte. Damit ist aber keineswegs das Modell der drei Kurien in Frage gestellt, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass die erste – un-abhängig von der ihr zukommenden Bedeutung – mit drei Stimmen (Stifte, Grafen und Herren, Universi-täten) auf den Landtagen in Erscheinung trat.
96 Molzahn sieht in den Gravamina die Umsetzung des ständischen Beschwerderechts wie auch die Wahr-nehmung der den kursächsischen Ständen zukommenden Beratungsfunktion. Vgl. Molzahn, Adel (wie Anm. 14), S. 121–144, hier S. 121. Die Frage, welche Gravamina die Qualität besitzen würden, im Rahmen der Landtage thematisiert zu werden, war ein immer wiederkehrender Streitpunkt zwischen dem Landes-herrn und seinen Ständen wie auch zwischen den ständischen Gruppen selbst. Die Schwelle, die ein / e Frage / Anliegen eines einzelnen Standes zu einer / m von kollektiver und damit gesamtterritorialer Be-deutung machte, blieb letztlich undefiniert und von situativem Charakter.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 151
zu beziehen und den Landesherrn zu beraten.97 Dieser allgemeinen, ständischen Pflicht zur Stellungnahme kamen die Universitäten ebenso wie die übrigen Stände nach. Das universitäre Bedenken auf die kurfürstliche Proposition wurde umgehend formuliert und lag meist vor allen anderen ständischen Reaktionen vor, sofern nicht langwierige Schriftwechsel mit der Universität dasselbe verzögerten.
Problematisch, und gerade im Laufe des 17. Jahrhunderts wiederholt durch die Universitäten wie auch die Stifte, Grafen und Herren und teilweise sogar die Städte thematisiert, waren Art und Weise der (Nicht-)Kommunikation der Landtagsdoku-mente an den Landesherrn bzw. seine Beamten durch den Enge(r)n Ausschuss der Ritterschaft. Legt man die Beschwerden der betroffenen Stände zugrunde, schien es grundsätzliche Praxis gewesen zu sein, dass die Bedenken der Stifte, Grafen und Herren wie der Universitäten gemeinsam, aber nicht als Teil der Landschafts-Doku-mente an den Kurfürsten gelangten.98 Dieses angemahnte Prozedere scheint wie-derholt seitens des Enge(r)n Ausschusses der Ritterschaft ignoriert oder umgangen worden zu sein, sodass die akademischen Dokumente entweder zu spät oder über-haupt nicht den Weg zum Kurfürsten fanden und dadurch ihre Anmerkungen und Gegenreden keinen Einfluss auf die Position der ‚Landschaft‘ erlangen konnten. In solchen wie anderen Fällen von immenser Bedeutung für die Universitäten suchten diese, parallel zu den gewöhnlichen Landtagsgeschäftsgängen und -hierarchien, Ein-fluss auf die Meinung des Kurfürsten und seiner Regierung zu nehmen. Zu diesem Zweck konnten die Universitäten auf die Unterstützung hoher landesherrlicher Be-amter, die in mannigfacher Art und Weise mit den Hohen Schulen verbunden wa-ren, zählen und deren Hilfe aktivieren.
In geradezu idealtypischer Weise lässt sich das soeben Ausgeführte am Beispiel des Landtages von 1635 darlegen. Dieser ganz unter dem Eindruck der zwischen dem sächsischen Kurfürsten und kaiserlichen Unterhändlern in Leitmeritz begon-nenen und schließlich in Pirna fortgesetzten Friedensverhandlungen99 stattfindende
97 So wurde in den meisten Fällen nur ganz allgemein versichert, dass man die Universitäten und Landes-schulen in gutem Zustand erhalten möchte, da sie grundsätzlich für die Ausbildung der Jugend wie des Beamten- und Pfarrernachwuchses in höchstem Maße nützlich und notwendig wären. Konkreter wurde es etwa in der Proposition von 1601, die eine Visitation der Universitäten und Schulen ankündigte, da dies neben anderen wichtigen Gründen vor allem wegen der dort eingerissenen calvinistischen Umtriebe not-wendig wäre. Vgl. SächsHStA Dresden, 10024 Geheimer Rat, Loc. 9359 / 5, Proposition vom 9. Dezember 1601 Bl. 238v–240r.
98 Molzahn beschreibt den oft langwierigen Prozess der ständischen Entscheidungsfindung und -entwicklung sehr eindrücklich, geht dabei aber nicht näher auf die immer wieder auftretenden Probleme ein. Molzahn, Adel (Anm. 14), S. 86–89. Für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts sind ferner Krügers Ausführungen zu beachten, die unter anderem auf verschiedene Modifizierungen und Neuerungen im Landtagsverfahren (so u. a. die Präliminarschreiben) aufmerksam machen. Vgl. Krüger, Landesherr (Anm. 14), S. 68–84.
99 Diese fanden nach dem Landtag ihren Abschluss im Prager Frieden vom 30. Mai 1635, der den wetti-nischen Kurfürsten u. a. die beiden Lausitzen als Ausgleich für die aufgelaufenen und unbeglichenen kaiserlichen Schulden einbrachte, sowie manche Bestimmungen der Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück vorbereitete bzw. vorwegnahm, ohne allerdings zu einem allgemeinen Reichsfrieden auf-steigen zu können. Vgl. Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, 2. Teil, 10. Band, Der Prager Frieden von 1635, Teilbände 1–4 (= Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißig-jährigen Krieges, NF), bearbeitet von Kathrin Bierther, München / Wien 1997.
Philipp Walter152
Landtag, hatte als zentralen Gegenstand der landesherrlichen Proposition vom 6.1. die Aufforderung an die Stände zum Inhalt, sich mit dem konzipierten Frieden aus-einanderzusetzen und dem Kurfürsten ihre Meinung und ihren Rat zu verschie-denen Detailfragen (Generalat des Kurfürsten bei der konzipierten Reichsarmee) kundzutun. Darüber hinaus enthielt die Proposition diverse unmittelbar mit dem projektierten Frieden in Zusammenhang stehende Finanzforderungen (u. a. Bezah-lung der nicht umgehend zu demobilisierenden Truppen) sowie die Aufforderung an die Stände, die ausgelaufenen Bewilligungen (Land- und Tranksteuer, Fleischpfen-nig) zu verlängern und nach Möglichkeit zu erhöhen. Kirchen, Schulen und Universi-täten waren in der bereits skizzierten eher allgemeinen Form Teil der Proposition.100
Diesen Punkt greifen die akademischen Deputierten jedoch dezidiert und als zweitwichtigstes Anliegen der Proposition wie des Landtages heraus, um in ihren Bedenken vom 19. Januar 1635 nachdrücklich für die Wiederaufrichtung und -her-stellung der Universitäten, der professoralen Saläre und Stipendien wie der Kom-munitäten zu plädieren.101 Gerade der Kurfürst wüsste um die Bedeutung der Uni-versitäten, schließlich würde er von ihrer „gewesenen Blüte“ (!) auch jetzt noch profitieren.102 So schlüssig die akademischen Deputierten auch die Notwendigkeit einer allgemeinen Landeshilfe für die Kirchen, Schulen und Universitäten in ihren Bedenken darlegten und vonseiten des Enge(r)n und Weiten Ausschusses der Städte Unterstützung erfuhren, so wenig nahm sich das Antwortschreiben der ‚Landschaft‘ vom 29. Januar 1635 dieser Position an. Stattdessen verwies dieses klar unter Fe-derführung des Enge(r)n Ausschusses der Ritterschaft entstandene Dokument alle Fragen der Kirchen, Schulen und Universitäten an das Oberkonsistorium und die geistlichen Räte des Kurfürsten;103 damit blieben diese Fragen ohne das Prädikat einer „allgemeinen Landesangelegenheit“ und sollten auf die Ebene der landesherr-
100 Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Kfs. Proposition vom 6. Januar 1635, Bl. 25r–45v.101 Darüber hinaus sollten die Universitäts- und Landschuldörfer mit Einquartierungen verschont, die Dörfer
und Professoren von Kontributionen befreit und für die ordnungsgemäße Auszahlung der ad pias causas gestifteten Güter und reditus gesorgt werden. Dazu trat der Wunsch nach Befreiung von den Steuerresten wie von der zukünftigen Steuer und die Verschonung oder Minderung der Professorenhäuser von der Steuer. Besonders problematisch und Anlass vor allem der stiftischen Kritik war die Forderung nach einer zeitlich begrenzten Umwidmung derjenigen Stiftskanonikate, die mit „nicht wohl verdienten Persohnen“ besetzt wären, zugunsten der professoralen Saläre. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Schreiben der Universität Leipzig an Ritterschaft und Städte vom 13. Februar 1635, Bl. 323r–326r.
102 Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Bedenken der Universitäten vom 19. Januar 1635, Bl. 116r–136v.103 Das Oberkonsistorium wie die kurfürstlichen Räte wären am besten über den Zustand der betroffenen
Landeskleinodien informiert und wüssten daher auch zweifellos, wie diesen geholfen werden könnte. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Bedenken der Landschaft vom 29. Januar 1635, Bl. 146r–184v. Dass dieses Antwort-schreiben unter entscheidendem Einfluss der Ritterschaft entstanden sein muss, lässt sich unter anderem anhand der städtischen Bedenken vom 18. Januar 1635 belegen. Darin bedachten die Städte den Punkt der Kirchen, Schulen und Universitäten zwar auch nur mit vergleichsweise wenigen Worten, ließen aber keinen Zweifel daran, dass Zustand, Ausstattung und Erhaltung dieser Institutionen legitime Landesange-legenheiten und somit ‚landtagsfähig‘ wären. Dies findet sich jedoch in der offiziellen Antwort der ‚Land-schaft‘ nicht wieder, die stets im Namen von Adel und Städten ausgestellt wird. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Bedenken des Enge(r)n und Weiten Ausschusses der Städte vom 18. Januar 1635, Bl. 77r–77v.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 153
lichen Verwaltung geschoben werden.104 Die Universitäten erhielten von dieser Tat-sache bereits vor dem 29.1.1635 entweder mündlich oder in Form einer Abschrift der konzipierten Landschaftsantwort Kenntnis und bemühten sich daraufhin, dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Passagen in der Erklärung der Landschaft in ihrem Sinne geändert werden oder aber die universitären Bedenken vollständig an den Kurfürsten bzw. seine Räte gelangen.105 Dies wurde durch die Landschaft abgelehnt und die Universitäten damit vertröstet, dass sie sich schon bei den Ober-konsistorialräten Hilfe zu suchen wüssten.106 Von diesem Zeitpunkt an versuchen die Wittenberger, aber vor allem die Leipziger Deputierten in Person von Sigismund Finkelthaus und des Notars Friedrich Leibnütz, die akademischen Anliegen auf in-formellen Wegen voranzubringen. So wandet man sich zum einen unmittelbar an das Oberkonsistorium, traf sich am 30.1.1635 mit dem Oberkonsistorialpräsiden-ten Friedrich von Metzsch und weiteren Räten, ließ sich deren Unterstützung und Fürsprache („Intercession“) zusichern und diskutierte die relevanten Fragen, um anschließend von Seiten des Oberkonsistoriums informiert zu werden, dass dieses große Bedenken tragen würde, sich ohne ausdrückliche kurfürstliche Anweisung zu Landtagsangelegenheiten zu äußern, zumal der Landesherr in seiner Proposition eindeutig zu verstehen gegeben hätte, dass die Landstände (auch) über akademische Angelegenheiten wie die der Kirchen und Schulen beraten und Vorschläge, wie die-sen „Kleinodien“ zu helfen wäre, vorzulegen hätten.107 Zum anderen wandte man
104 Über die Motive schweigen die Quellen, doch angesichts der Dauer des Landtages und den permanenten Wünschen der Stände, diesen alsbald zu beenden, scheint vor allem ein Argument zentral gewesen zu sein, nämlich die Landtagsgegenstände soweit es geht einzuschränken und sich auf die vermeintlich vor-rangigen Fragen (Friedensverhandlungen und Steuerforderungen) zu konzentrieren. Die vollzogenen oder erbetenen Landtagsdemissionen nötigten den Kurfürsten im Rahmen seiner Replik zu einer scharfen und diese ablehnenden Reaktion. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Kfs. Replik vom 9. Februar 1635, Bl. 255r–285v.
105 In diesem Sinn fordern die Universitäten, dass ihre Gedanken nicht nur beherzigt „undt Ihrer Durchl. in Ihren bedengken weitleufiger ahnfuhren, sondern auch derer Universiteten auf geseztes unterthanigste meinung zu gleich wie billich vollkomblich überliefern laßen wollen“. SächsHStA Dresden, 10024 Gehei-mer Rat, Loc. 9367 / 5, Memorial der beiden Universitäten vom 27. Januar 1635, Bl. 58r–59v. Auch dies ist ein Beleg dafür, dass jedwedes Anliegen, jede Äußerung und Anmerkung den „Flaschenhals“ des Enge(r)n Ausschusses der Ritterschaft passieren musste und dabei nicht selten die Gefahr bestand, dass unpopu-läre oder nicht mehrheitsfähige Verlautbarungen unberücksichtigt blieben und somit nicht zur Kenntnis des Landesherrn gelangten. Ein ähnliches Vorgehen lässt sich u. a. auch bei den Stiften konstatieren, die aber im Gegensatz zu den Universitäten immer auf ihren ohnehin speziellen Status / ihre Sonderrolle als kursächsischer Stand Wert legten, der u. a. in ihrem häufigen Verweis darauf zum Ausdruck kommt, dass man alle Landtagsbeschlüsse nur vorbehaltlich annehmen könnte, da darüber abschließend gesonderte Stiftstage zu entscheiden hätten.
106 Dies geschah mit dem ausdrücklichen Verweis darauf, dass die Weitergabe der universitären Dokumente an den Kurfürsten dem Herkommen zuwider wäre und man diesem Ansinnen, wie dies auch bei den Stif-ten, Grafen und Herren geschehen wäre, nicht entsprechen könnte. Der Verweis an das Oberkonsistorium bzw. dessen Räte macht deutlich, dass die ‚Landschaft‘, in erster Linie aber die Ritterschaft, versuchte, Fra-gen der Kirchen, Schulen und Universitäten von den allgemeinen Landtagshandlungen auszuschließen. Das Oberkonsistorium konnte nicht als Interessenvertreter dieser Landesinstitutionen auftreten, schließ-lich war diese landesherrliche Behörde kein Teil der kursächsischen Stände; im Gegensatz zu den an sel-biges verwiesenen Universitäten. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Notiz von Friedrich Leibnütz vom 29. Januar 1635, Bl. 145r.
107 Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, „Academiarum media“ vom 30. Januar 1635, 187r–190v. Vonseiten des Oberkon-sistoriums wird daraufhin ein Sekretär zum Enge(r)n Ausschuss der Ritterschaft geschickt, der den Land-schaftsdirektor Heinrich Hildebrand von Einsiedel zu Scharfenstein über die universitären Angelegenhei-
Philipp Walter154
sich direkt an die Geheimen Räte Friedrich von Werthern, Friedrich Timaeus und Nicol Gebhardt von Miltiz, um diese zur Fürsprache bei der Landschaft zu bewegen, wie die Möglichkeiten auszuloten, die akademischen Anliegen direkt an den Kur-fürsten gelangen zu lassen, wobei ihnen beides in Aussicht gestellt wurde. Die Arbeit der Leipziger Deputierten führte schließlich dazu, dass die akademischen Anliegen summarischer Teil der Landschaftsduplik wurden und zudem die gesamten akade-mischen Dokumente / Forderungen dem Landesherrn bzw. seinen Räten zugestellt wurden.108 Konkrete Ergebnisse blieben jedoch aus, sodass der Landtagsabschied die Kirchen, Universitäten und Schulen nur in sehr allgemeiner Form berücksich-tigte, ohne einen der Vorschläge konkret aufzugreifen.109
Aufgrund dieses Falles ist aber kein grundsätzlich negatives Urteil über Art und Wirkung akademischer Landtagspraxis zu fällen, will man nicht die Handlungsmög-lichkeiten und -prinzipien frühneuzeitlicher Landesversammlungen fehldeuten. Eine simple Rechnung, die allein nach den eingebrachten Forderungen, Bedenken und Gravamina einzelner Ständevertreter und daraus resultierender handfester Ergeb-nisse fragt, sei es als Teil des Abschieds oder dem Landtag nachfolgende landesherr-liche Dekrete oder Mandate, ist kaum für eine adäquate Bewertung etwa der akade-mischen Landstandschaft geeignet. Diese muss ebenso die grundsätzliche Teilhabe der Ständevertreter an den allgemeinen Landesangelegenheiten im Blick behalten, wie deren steten Kampf um die Bewahrung des eigenen Status und dem Widerste-hen etwaiger Marginalisierungsbestrebungen durch Teile der übrigen Landstände. Ebenso bemerkenswert und in die Bewertung akademischer Landstandschaft mit einzubeziehen ist die kontinuierliche, das heißt zum Teil jahrzehntelange, Ansprache und Präsentation von Mängeln in Zustand und Ausstattung der Universitäten wie ihrer fundierten Dörfer. Der 1653110 im Rahmen eines Ausschusstages erstmals be-
ten informiert und den Erbmarschall zu einer Reaktion bewegen kann. Dieser will es laut Protokoll zwar beim alten Herkommen belassen und auch weiterhin die universitären Bedenken nicht an den Kurfürsten übergeben, erklärt sich aber darüber hinaus dazu bereit, sich dafür einzusetzen, dass in einer möglichen Replik der ‚Landschaft‘ der Punkt der Kirchen, Schulen und Universitäten ausführlicher als zuvor berück-sichtigt wird. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Protokolle vom 31. Januar und 1. Februar 1635, Bl. 199r–202r.
108 Die Landschaft kam in der Duplik aber nicht umhin darauf hinzuweisen, dass „zwar wohl nicht stijli solche Ihre underthenigste gedancken in schriften mitzuübergeben, iedoch auf das in diesem wichtigen Punct E. Churf. Drchl. nichts verhalten bleibe, oder sie die Universiteten des hinderhalts halben uns et-was zuzumeßen haben und Ihnen satisfaction geschehe. So haben wirs vor dismal beygelegt, auch hiermit undthenigst vor sie intercetiren wollen“. Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Duplik von Ritterschaft und Städten vom 20. Februar 1635, Bl. 362r –374r.
109 „Wollen auch darbeneben uns unterdeßen sonderbahr angelegen sein laßen, auf daß bey diesen höchstzer-rütteten unruhigen betrübten und gefährlichen Leuften und Zeiten, Kirchen, Universiteten und Schulen bestes in acht genommen.“ Vgl. UA Leipzig, LTA 9 I, Landtagsabschied vom 13. März 1635, Bl. 534r–536v.
110 Mit dem (Ausschusstags)Abschied vom 2. April 1653 (publiziert am 4. April) bewilligte die Landschaft zwei Pfennige „semel pro semper“ von jedem gangbaren Steuerschock (1. Pfennig Martini 1653; 2. Pfennig Martini 1654). Damit und mit weiteren Maßnahmen seitens des Kurfürsten sollte der Ruin der Univer-sitäten und Landesschulen verhindert werden. Vgl. UA Leipzig, LTA 13, Abschied vom 2. April 1653, Bl. 241r–262v. Von einem vollständig aufgebrachten Pfennig waren um 1650 etwa 15 000 Gulden an Einnah-men zu erwarten und selbst für diesen eher unwahrscheinlichen Fall konnte die bewilligte Summe nur als Anfang einer kontinuierlichen Hilfe angesehen werden.
Die Universität Leipzig als kursächsischer Landstand 155
willigte und 1657111 durch einen regulären Landtag verlängerte „Universitätspfennig“ ist auch den kontinuierlichen Bemühungen der Universitäten um die Wiederher-stellung ihrer Finanzierungsgrundlagen zu verdanken. Zwar ging die Initiative 1653 von Johann Georg I. bzw. der durch die Räte formulierten Proposition aus, doch lässt sich die aktive Einflussnahme der Universitäten wie ihrer Deputierten eindeu-tig nachweisen. Dies ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil die Universitäten nicht zu den Ausschusstagen berufen wurden und somit nur indirekt Einfluss auf die Verhandlungen und ihren Ausgang nehmen konnten.112 Das Ergebnis ist eine bis dahin unbekannte steuerfinanzierte Hilfe.
Anders als 1653 wäre vier Jahre später eine Steuerbewilligung zugunsten der Universitäten ohne deren massive Intervention bei Johann Georg II. und den Stän-den nicht erfolgt. Weder die Proposition (9. Februar 1657) oder die Bedenken der ‚Landschaft‘ hatten eine Erneuerung / Verlängerung des Universitätspfennigs zum Inhalt noch suchte man nach alternativen finanziellen Unterstützungsmöglichkei-ten.113 Erst die kurfürstliche Triplik (23. Mai 1657) griff die universitären Memoriale und Bittschriften auf. Dies geschah unter explizitem Verweis darauf, dass man damit den Bitten der Universitäten nachkommen würde. Die „semel pro semper“ zu be-willigenden 1,5 Pfennige wären auch nur zur Unterhaltung der Universitäten und Landesschulen bestimmt.114 Wurden mit den Bewilligungen auch keinesfalls alle universitären Finanzierungsprobleme gelöst, zumal sich die Einnahme der Gelder bis in das Jahr 1661 hinauszögerte,115 so konnten hier doch erstmals dezidiert den Universitäten und Landesschulen gewidmete Steuermittel aktiviert werden. Die als „Kleinodien“ des Landes bezeichneten Hohen Schulen wurden damit auch aus Per-spektive der ständischen Kernkompetenz – der Steuerbewilligung – ein im besten Sinn gewöhnlicher Landstand.
111 Die Stände bewilligen nochmals einen Pfennig vom gangbaren Schock. Vgl. UA Leipzig, LTA 16, Landtags-abschied vom 15. Juni 1657, Bl. 1670r–1687r.
112 Leipzig (N. N.) wie Wittenberg (August Buchner, Christoph Notnagel) waren anlässlich des 1653er Aus-schusstages jedoch mit Deputierten vor Ort und es ist auch deren intensiver Einflussnahme auf die ver-sammelten Stände wie den Kurfürsten zu verdanken, dass der ursprünglich (Antwort der Landschaft auf die kfs. Proposition vom 16. Februar 1653) „semel pro semper“ bewilligte eine Pfennig um einen weiteren erhöht wurde. Neben den Aktivitäten der akademischen Deputierten lässt sich auch die mehrfache Inter-vention der beiden kursächsischen Universitäten nachweisen. Vgl. SächsHStA Dresden, 10015 Landtag, Landstände A-H: A 27; UA Leipzig, LTA 13 I, II; UA Leipzig, Rektor, Rep. I / XV / 222.
113 Einzig der sechste Propositionspunkt nahm Bezug auf die Universitäten, indem die vor allem dem Penna-lismus geschuldete schlechte Disziplin auf den Hohen Schulen angeprangert und um Vorschläge, wie dies zu ändern wäre, angehalten wurde. Vgl. UA Leipzig, LTA 15, Proposition vom 9. Februar 1657, Bl. 8r–21v.
114 Vom ersten 1653 bewilligten Pfennig mussten 1 000 Gulden an den Oberhofprediger Jacob Weller von Molsdorf und 1 000 Reichstaler an Professor Johann Raue abgeführt werden. Der Danziger Professor sollte mit dieser Summe befähigt werden, einige seiner Reformvorhaben des Unterrichtswesens umzuset-zen. Vgl. UA Leipzig, LTA 13, Abschied vom 2. April 1653, Bl. 241r–262v.
115 Noch anlässlich des Landtages von 1660 / 61 musste Johann Georg II. einen Befehl an alle Kreise ergehen lassen, worin diesen die Ablieferung des halben noch ausstehenden Pfennigs von 1657 binnen 14 Tagen befohlen wurde. Vgl. UA Leipzig, LTA 18 I, Befehl wegen des halben Pfennigs vom 17. Dezember 1660, Bl. 91r–91v. Die Zahlungsmoral oder -fähigkeit der Stände war aber ein allgegenwärtiges Problem und kein Spezifikum in Bezug auf die Universitäten und Landesschulen.
Philipp Walter156
V.
Die Landstandschaft der Universität Leipzig wie die der Wittenberger Leucorea muss neben den erwähnten ernestinischen und hessischen Ausnahmen als Sonder-fall der landständischen Entwicklung im Reich angesehen werden. Die Ursachen dafür können heute wie damals nur ansatzweise erklärt werden, doch sind dafür zweifellos die immense Bedeutung der Hohen Schulen für den lutherischen Ter-ritorialstaat im Allgemeinen wie die spezifische Situation im neuen Kurfürstentum Sachsen nach dem Schmalkaldischen Krieg im Besonderen zu beachten.116 Hinzu treten die Ausstattung der Universitäten mit säkularisiertem, zum Teil landsässigem Kirchengut sowie möglicherweise das Aufgreifen einer schon zuvor existenten ein-geschränkten landständischen Partizipation, wie dies am Wittenberger Beispiel der Jahre 1511 und 1518 belegt werden konnte. Die Etablierung und Akzeptanz der Uni-versitäten als kursächsische Landstände vollzog sich in den Jahrzehnten nach 1550, wobei die Hohen Schulen selbst zunächst kein erhöhtes Interesse an ihrem neuen Status und den daraus erwachsenden Rechten und Pflichten aufwiesen. Doch spä-testens zur Jahrhundertwende müssen die Universitäten als regulärer und prinzipiell unwidersprochener Teil der kursächsischen Landstände angesehen werden. Daran ändert auch die sporadisch vonseiten der Prälaten wie Grafen und Herren proble-matisierte Frage nach der „richtigen“ Verortung der Universitäten innerhalb des tra-dierten kursächsischen Ständegefüges nichts. Zwar waren die Hohen Schulen weder „wirkliche“ Prälaten, auch wenn sie dies immer wieder postulierten, noch ließen sie sich einer der anderen Ständegruppen zuordnen, doch führte diese Unsicherheit nicht zur prinzipiellen Infragestellung akademischer Landstandschaft, sondern zu einer Reihe von Improvisationen, die nichts im Sinne der klassischen ständischen Einteilung entschieden und damit die akademische Sonderstellung auf den Landta-gen institutionalisierten. Die kursächsischen Universitäten waren eben keine „stum-men Landsassen“, sondern aktive und streitbare Landstände, die den akademischen Anliegen Gehör und Stimme verschafften und zudem als Anwälte ihrer Untertanen wie zum Teil der Landesschulen auftraten.
116 Für die Verhältnisse vor allem der Wittenberger Leucorea vgl. Thomas Töpfer, Die Leucorea am Scheide-weg. Der Übergang von Universität und Stadt Wittenberg an das albertinische Kursachsen 1547 / 48. Eine Studie zur Entstehung der mitteldeutschen Bildungslandschaft (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Reihe B, Bd. 3), Leipzig 2004.