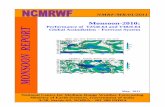Das fidschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfindung und Spiegel hierarchischer...
Transcript of Das fidschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfindung und Spiegel hierarchischer...
Tübinger ArchäologischeTaschenbücher
herausgegeben vonManfred K. H. Eggert
und Ulrich Veit
Band 7
Waxmann 2010
Münster / New York / München / Berlin
Peter Trebsche, Nils Müller-Scheeßel,Sabine Reinhold (Hrsg.)
Der gebaute Raum
Bausteine einer Architektursoziologievormoderner Gesellschaften
Waxmann 2010
Münster / New York / München / Berlin
Bibliografische Informationen Der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbiografi e; detaillierte bibliografi scheDaten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Gedruckt mit Unterstützung der , Düsseldorf.
Tübinger Archäologische Taschenbücher, Band 7
ISSN 1430-0931ISBN 978-3-8309-2285-8
© Waxmann Verlag GmbH, 2010Postfach 8603, D-48046 Münster
www.waxman.comE-Mail: [email protected]
Umschlaggestaltung: Pleßmann Kommunikationsdesign, AschebergUmschlagzeichnung: Holger Sinogowitz (nach einem Motiv vomunteren Tor von Schloss Hohentübingen aus dem frühen 17. Jh.)Druck: Hubert & Co., GöttingenGedruckt auf alterungsbeständigem Papier, DIN 6738
Alle Rechte vorbehaltenPrinted in Germany
Vorwort
Der vorliegende Band entstand aus zwei Tagungen, die sich der Frage nach dem Verhältnis von Sozialstrukturen und Raumgefüge in vormodernen Kulturen widme-ten. Im Rahmen des 6. Deutschen Archäologie-Kongresses organisierten Nils Mül-ler-Scheeßel und Sabine Reinhold am 14. Mai 2008 in Mannheim eine Sitzung der Arbeitsgemeinschaft »Theorie in der Archäologie« zu dem Thema »Der konstruierte Raum – Sozialgefüge und Raumstrukturierung in ur- und frühgeschichtlichen Sied-lungen«. Vom 4. bis 6. Februar 2009 veranstalteten Peter Trebsche und Nils Müller-Scheeßel in Wien einen noch stärker transdisziplinär orientierten Workshop mit dem Titel »Bausteine einer Soziologie vormoderner Architekturen«, aus dem der größere Teil der Beiträge hervorging. Das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien und die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts übernahmen freundlicherweise die Schirmherrschaft dieser Veranstaltung.
Allen Beteiligten beider Veranstaltungen, den Vortragenden wie den Diskussions-teilnehmern, sei herzlich gedankt.
Der Dank der Herausgeber geht weiterhin an die Bremer Stiftung für Kultur- und Sozialanthropologie, die einen Zuschuss zu den Reisekosten der Referenten und Referentinnen der Mannheimer Sitzung gewährte, an das österreichische Bundes-ministerium für Wissenschaft und Forschung sowie vor allem an die Gerda Hen-kel-Stiftung, die Anreise und Übernachtung der Teilnehmer des Wiener Workshopes fi nanzierte und durch einen Druckkostenzuschuss das Erscheinen des vorliegenden Bandes ermöglichte.
Wir bedanken uns ferner bei den Autoren für die äußerst pünktliche Abgabe der Manuskripte und die angenehme Zusammenarbeit. Manfred K. H. Eggert und Ulrich Veit nahmen das Buch in die von ihnen herausgegebene Reihe der »Tübinger Archä-ologischen Taschenbücher« auf, und Beate Plugge vom Waxmann-Verlag sorgte auf bewährte Weise für die rasche Drucklegung, wofür ihnen ebenfalls unser Dank gebührt.
Die Herausgeber, Dezember 2009
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PETER TREBSCHE, NILS MÜLLER-SCHEESSEL UND SABINE REINHOLD
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Theoretische Bausteine aus Architektursoziologie und Ethnologie
BERNHARD SCHÄFERS
Architektursoziologie. Grundlagen – theoretische Ansätze – empirischeBelege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
HERBERT SCHUBERT
Architektur als Prozess – Perspektiven eines architektursoziologischen Modellsder »Verhäuslichung« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
JOACHIM FISCHER
Architektur als »schweres Kommunikationsmedium« der Gesellschaft. Zur Grund legung der Architektursoziologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
HEIKE DELITZ
»Die zweite Haut des Nomaden«. Zur sozialen Effektivität nicht-moderner Architekturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
HANS PETER HAHN
Gibt es eine »soziale Logik des Raumes«? Zur kritischen Revision eines Strukturparadigmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ANDREAS DAFINGER
Die Durchlässigkeit des Raums: Potenzial und Grenzen des Space Syntax-Modells aus sozialanthropologischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Archäologische Bausteine aus Jungsteinzeit, Eisenzeit und Mittelalter
PETER TREBSCHE
Architektursoziologie und Prähistorische Archäologie: Methodische Über-legungen und Aussagepotenzial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
NILS MÜLLER-SCHEESSEL, ROBERT HOFMANN, JOHANNES MÜLLER UND KNUT RASSMANN
Entwicklung und Struktur des spätneolithischen Tells von Okolište (Bosnien-Herzegowina) unter architektursoziologischen Gesichtspunkten . . . . . . . . . 171
RENATE EBERSBACH
Seeufersiedlungen und Architektursoziologie – ein Anwendungsversuch . . . 193
SABINE REINHOLD
Rund oder eckig? Überlegungen zu prähistorischen Siedlungen mit rundemund ovalem Grundriss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
FRANZISKA LANG
›Geschlossene Gesellschaften‹ – Architektursoziologische Überlegungen zum antiken griechischen Hofhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
MATTHIAS JUNG
Keltische Paläste? Eine Diskussionsbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
SABINE RIECKHOFF
Raumqualität, Raumgestaltung und Raumwahrnehmung im 2. / 1. Jahrhundertv. Chr.: Ein anderer Zugang zu den ersten Städten nördlich der Alpen . . . . . 275
SUSANNE SIEVERS
Zur Architektur der keltischen Oppida: zwischen Tradition und Innovation . 307
HOLGER WENDLING
Landbesitz und Erbfolge – Ein ethnographisches Modell zur Sozialstruktur und Raumgliederung der mitteleuropäischen Latènezeit . . . . . . . . . . . . . . . . 325
JANINE FRIES-KNOBLACH
Hinweise auf soziale Unterschiede in frühmittelalterlichen Siedlungen inAltbayern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
CLAUDIA THEUNE
Innovation und Transfer im städtischen und ländlichen Hausbau des Mittelalters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Die Vielfalt der Baukulturen –Bausteine aus Ethnologie, Bauforschung und Architektur
THOMAS J. PIESBERGEN
Ein Modell zur Genese kosmologischer Konzepte und ihrer Repräsentation im architektonischen Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
HERMANN MÜCKLER
Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung undSpiegel hierarchischer Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
ERICH LEHNER
Samoanisches Fale und mongolisches Ger: Eine Gegenüberstellung von Bau-typologie und Gesellschaft in den Traditionen von Sesshaften und Nomaden 443
ANDREA RIEGER-JANDL
Identität im Wandel: Lokale Bauformen – überlokale Einfl üsse (FeldbeispielLadakh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
HERMANN MÜCKLER
Das fi dschianische Versammlungshaus als Ortder Identitätsfi ndung und Spiegel hierarchischer Strukturen
Zusammenfassung: Am Beispiel der inneren Strukturierung des Versammlungshauses in Fidschi werden die Bedeutung dieses Gebäudes als Identität stiftende und Orientierung vermittelnde Kategorie für die Fidschianer sowie die Wechselbeziehung zwischen Gebäude und Mensch skizziert. Ausgehend von einer kurzen Darstellung grundlegender Elemente der Orientierung im Raum, die eng mit der sozialen Gliederung der Gesellschaft verbunden ist, sowie der beson-deren Bedeutung von Land in Fidschi wird auf die spezielle Situation im Versammlungshaus bei Abhaltung einer Kava- bzw. yaqona-Zeremonie eingegangen. Die skizzenhafte Darstellung zeigt dabei die dreidimensionale imaginäre Raum(auf)teilung als zentrales Element der gesell-schaftlichen Organisation entlang der Achse »oben – unten« auf; letztere ermöglicht dem Ein-zelnen das Erkennen seines sozialen Platzes in der Gesellschaft. Dabei kommt der Sitzordnung als einer Projektion vertikaler Ordnung auf eine horizontale Ebene eine besondere Bedeutung zu, denn sie zeigt dem Einzelnen seine eigene Position in der Gruppe und die Position der ande-ren im sozialen und politischen Kontext. Im Versammlungshaus, wo die offi ziellen, von einem komplexen Ritus begleiteten Kava-Zeremonien stattfi nden, zeigt sich eine klare Dichotomie zwischen »oben« und »unten«, die durch imaginäre räumliche Aufteilungen und Aufenthalts-bereiche gekennzeichnet ist. Im Zentrum steht dabei die tanoa, jene Holzschüssel, die für die Kava-Zubereitung verwendet wird. Mit ihr verknüpft ist die Verbindung zu den Ahnen, in ihr wird der Trank zubereitet, der die Würdenträger mit der Kraft bzw. Effektivität des mana aus-stattet und damit für die Ausführung ihrer Ämter legitimiert. Daneben gibt es auch tatsächliche vertikale Parameter von symbolischer und praktischer Bedeutung, die von den Dorfbewohnern beachtet werden müssen.
Die traditionelle fi dschianische Architektur kennt einige Besonderheiten, die sich in anderen Teilen des Pazifi k nicht fi nden. Gleichzeitig sind die indigenen Baufor-men Spiegel einer schrittweisen, durch wechselseitige Beeinfl ussungen geprägten Entwicklung der Bewohner der Großregion Ozeanien, die in die Subregionen Mela-nesien, Mikronesien und Polynesien gegliedert ist. Dies trifft insbesondere für die Schnittstelle zwischen Melanesien und Polynesien zu – exakt das Gebiet also, wo sich der Staat Fidschi mit seinen zwei Hauptinseln und zahllosen Kleinstinseln befi ndet (vgl. dazu Tischner 1934). Fidschi vereint sowohl im physischen Erscheinungsbild der Bewohner als auch in den kulturellen Praktiken – insbesondere der gesellschaftlichen Gliederung und der traditionellen politischen Organisation – Spezifi ka beider Regio-nen (vgl. Mückler 1998). Der aus globaler Sicht überschaubare Kleinstaat mit einer Gesamteinwohnerzahl von weniger als einer Million Menschen zeichnet sich heutzu-
430 Hermann Mückler
tage durch eine ethnisch und kulturell heterogene Situation aus. Neben den indigenen Fidschianern melanesisch-polynesischer Abstammung machen Indo-Fidschianer – die Nachfahren ehemaliger Plantagenarbeiter – etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus. Während diese relativ spät ins Land gekommenen Siedler wenig zur Entwicklung einer regionalspezifi schen eigenständigen Architektur beigetragen haben, können die Fidschianer auf über Jahrhunderte überlieferte Bautraditionen zurückblicken.
Dazu zählen die Repräsentations- und Wohnhäuser von meist rechteckigem Grundriss, die mbure (sprich: bure) genannt werden. Sie zeichnen sich gewöhnlich durch ein wuchtiges Walmdach mit einer dicken, Wärme dämmenden Strohschicht und leichten Wandverkleidungen mit häufi g geometrisch ornamentierter Gestaltung aus. Unterschieden werden zwei grundsätzliche Bautypen: Bei dem einen Typ ist ein zentraler Stützpfosten im Hausinneren vorhanden, bei dem anderen fehlt dieser (vgl. Freeman 1986). Mbure(s) – ein Wort, das ursprünglich soviel wie »Tempel« hieß – dienten in der Vergangenheit sowohl für kultische Handlungen als auch als Versammlungshaus der Dorfältesten, als Männer- oder Junggesellenhaus, als Emp-fangsraum für Fremde oder auch als Haus des Häuptlings (Lehner 1995, 67). Die Bezeichnung mbure gilt dabei als Überbegriff für alle fi dschianischen Gebäude, die Bezeichnung vale levu im engeren Sinn für das Versammlungshaus und heißt über-
Abb. 1. Darstellung eines vale levu, eines fi dschianischen Versammlungshauses, vom Ende des 19. Jahrhunderts (nach Thomson 1908).
431Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung
setzt »großes Haus«. Das Innere dieser Häuser besteht aus einem einzigen Raum und ist nach europäischen Verhältnissen ziemlich kärglich ausgestattet (Abb. 1). Auch wenn heute zunehmend Bettgestelle in den Wohnhäusern Einzug halten, so spielte sich das traditionelle Leben bis vor kurzem und teilweise noch heute auf Matten am Boden ab. Diese Matten aus Blättergefl echt waren häufi g Brutstätte für Ungeziefer aller Art, da sie selten bis nie gereinigt wurden. Heute halten auch schrittweise Möbel
Abb. 2. Das Dorf Serui. Gut zu sehen ist das fast vollständige Fehlen von Fenstern an den Häusern. Darstellung aus dem 19. Jahrhundert (nach Thomson 1908).
432 Hermann Mückler
Einzug, und damit gliedert sich die Verwendung dieses Großraumes zunehmend in partikular genutzte Raumteile. Markantes äußeres Kennzeichen dieser Häuser waren und sind die hohlen Farnstämme, welche die Walmdeckung an beiden Stirnseiten des Hauses durchdringen. Diese nicht durchgehenden, sondern aufeinander gesteckten Pfosten verleihen dem Gebäude ein eindrucksvolles Erscheinungsbild. Während das Wohnhaus nur durch einen Eingang besitzt, ist beim äquivalenten Gebäude für Repräsentationszwecke die Anlage mehrerer Ein- bzw. Ausgänge eine Notwendig-keit, wie sich im Folgenden noch erschließen wird. Fenster gab es keine (Abb. 2).
Von Bedeutung war die Plattform, auf dem das Gebäude errichtet wurde: Je höher die mit Erde aufgeschüttete und durch Steine befestigte Plattform war, desto größer war die Wichtigkeit des Gebäudes, seiner Nutzung bzw. seiner Bewohner anzuset-zen. Manche Plattformen waren so hoch, dass sie nur mittels Treppen oder Leitern erklommen werden konnten. Besonders markant war dies bei jenen Gebäuden, die für religiöse Zwecke im traditionellen Kontext erbaut wurden. Diese mbure kalou genannten Geister- bzw. Ritualhäuser zeichneten sich meist durch ein extrem hohes steilwandiges Dach aus, welches durch die Stein- / Erdbasis noch an Höhe gewann. In diesen Häusern wurde in vorchristlicher Zeit den traditionellen Gottheiten gehuldigt, hier wurden Fetisch-Figuren der ndegei genannten Hauptgottheit bzw. anderer Göt-ter aufbewahrt und religiöse Zeremonien von Priestern abgehalten. Heute existieren solche Gebäude nicht mehr.
Ein spezieller Bautyp, das so genannte rausina, ist ein Rundhaus, welches entwick-lungsgeschichtlich als Vorläufer der mbure gesehen werden kann. Konstruktionstypi-sche Merkmale sind eine Mittelstütze und unterschiedliche Formen der Dachkonst-ruktion bzw. -deckungen, die ein kegelförmiges, bisweilen aber auch birnenförmiges Erscheinungsbild bewirken. Auch diese Gebäudeform ist heute nicht mehr existent.
Die modernen Versammlungs- und Wohnhäuser sind durchgehend rechteckig, manchmal quadratisch, aus Holz, Wellblech, Ziegeln oder Schalsteinen gebaut und fast durchgehend mit einem Wellblechdach gedeckt. Ein entscheidendes Element, welches diese »modernen« Häuser von den alten unterscheidet, ist das Vorhandensein von Fenstern. Diese ermöglichen es, dass heute z. B. die Schulkinder eines Dorfes nachmittags im Versammlungshaus gemeinsam am Boden liegen und ihre Hausaufga-ben erledigen können oder dass Frauen gemeinsame Arbeiten bei der Textilherstellung in das leerstehende Gebäude verlegen – alles Tätigkeiten, die eine gewisse Helligkeit im Hausinneren erfordern. Bei solchen Beschäftigungen sind die kulturspezifi sch fest-gelegten (zeremoniellen) Regeln zur Nutzung des Hauses weitgehend aufgehoben.
Anders ist es bei allen Arten von Festen, Feiern und Ritualen, die von einer Kava-Zeremonie (fi dschianisch: yaqona-Zeremonie) eingeleitet oder begleitet werden: Sie folgen festen Regeln, bei denen das Haus durch unsichtbare Aufteilungslinien, genaue Sitzordnung und spezielle Regeln des Benehmens seine Raumfunktion im Sinne einer Orientierungsmöglichkeit spüren lässt.
433Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung
In Fidschi wird die Bewegung im Raum – insbesondere im Innenraum – von kulturspezifi schen Regeln bestimmt, die gesellschaftlichen, historisch gewachsenen rituellen Notwendigkeiten und standes- bzw. prestigerelevanten Besonderheiten fol-gen. Sie ermöglichen dem Individuum und der Gruppe eine Orientierung im Raum und strukturieren diesen. Bevor man sich jedoch dem Verhalten der Fidschianer im Innenraum des Versammlungshauses, des neben der Kirche wichtigsten Gebäudes im Dorf, widmet, ist es notwendig, allgemein auf das Raumverständnis und die räumliche Orientierung der Fidschianer einzugehen.
Es gibt zahlreiche Aspekte im Raumverständnis der Fidschianer, die – mit loka-len Abweichungen – auch auf andere Gesellschaften der Region zutreffen. Zentraler Ausgangspunkt aller Überlegungen ist dabei die Tatsache, dass »Raum« auch und vor allem im Sinne einer Ressource verstanden werden muss, als eine Ressource von Ausdehnung und »Platz haben«, die in Ozeanien generell begrenzt ist. Da die Region ausschließlich von Inseln geprägt ist und größere Landfl ächen nur in Neuguinea vor-handen sind, die weite Inselregion jedoch aus vergleichsweise kleinen, häufi g auch winzigen korallinen Atollinseln besteht, ist Land im Sinne von Grund und Boden eine äußerst rare und damit extrem bedeutungsbesetzte Kategorie. Inseln stellen in sich geschlossene Entitäten dar, und begrenzte Landressourcen bedeuten daher auch begrenzte Wasserspeicherkapazitäten und damit limitierte landwirtschaftliche Nutz-barkeit sowie limitierte Möglichkeiten für das Überleben von Menschen. Fidschi selbst ist vergleichsweise privilegiert, was die Ressource Grund und Boden betrifft, denn die beiden Hauptinseln Viti Levu (»Großes Viti«) und Vanua Levu (»Großes Land«) sind verhältnismäßig groß. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Inseln han-delt es sich aber um kleine und kleinste Eilande, die demographisch nur begrenzt tragfähig oder ganz unbewohnbar sind.
Da die Orientierung des Einzelnen und der Gruppe folgerichtig am Vorhandensein von »Land« erfolgt, durchdringt das Bewusstsein seiner limitierten Verfügbarkeit alle Lebensbereiche in Fidschi. »Land«, aber auch »Gebiet« und »Ort« heißen auf Fid-schianisch vanua. Mit dem Begriff vanua verbinden sich nach Ansicht des fi dschiani-schen Autors Asesela Ravuvu (1983, 70) nicht nur die Festlegung und Beschreibung von Grund und Boden mitsamt der Vegetation, den Tieren und allen darauf errichteten Objekten, vielmehr ist vanua ein Begriff, der insgesamt das soziale und kulturelle System beinhaltet und beschreibt. Michael Dickhardt (2003, 227) zählt vanua zu den vier identitätsstiftenden Sinnordnungen, zu denen auch matanitu, der »Staat«, lotu, die »Kirche« und ilavo, das »Geld«, gehören. Vanua hat mehrere Bedeutungen: Vanua ist die Seele oder menschliche Manifestation der physischen Umgebung, zu der die Menschen sich zugehörig fühlen bzw. mit der sie sich identifi zieren. Vanua ist gleichzeitig die größte Gruppe von miteinander verwandten Menschen, die alle einem gemeinsamen anerkannten Häuptling Respekt und Treue schulden. Vanua ist damit die größte Einheit räumlicher und kultureller Identifi kation des Einzelnen, wie es der fi dschianische Ethnologe Rusiate Nayacakalou (1985, 11) einmal formuliert hat.
434 Hermann Mückler
Vanua ist untergliedert in verschiedene soziale Einheiten, die gewöhnlich in enger Verbindung zueinander stehen und sich in verschiedenen Ausformungen darstellen. Die Menschen sind lewe ni vanua, das »Fleisch« oder der Teil des Bodens, während vanua als alleinstehendes Wort auch für die Bezeichnung benachbarter sozialer Grup-pen verwendet wird. Vanua ist ein Teil einer hierarchischen Struktur, die neben der vanua (im Sinne von »Stamm«) die yavusa (im Sinne von Klan), die mataqali (Sub-Klan, lineage) und die (i)tokatoka (Sub-lineage bzw. erweiterte Familie) kennt. Damit ein Stamm oder eine Gruppe als vanua von den anderen anerkannt wird, müssen auf dem damit bezeichneten Grund und Boden Menschen leben, die ihre Rechte pfl egen und verteidigen. Hier gilt: Ein Land ohne Menschen ist wie eine Person ohne Seele. Die Menschen sind die Seele des physischen Landes oder Bodens. So wie es eine Wechselwirkung zwischen Körper und Seele gibt, so gibt es hier eine Beziehung zwi-schen dem Land und den Menschen, die bestimmen, was mit diesem Land gemacht wird. Das Land ist die Hauptlebensquelle. Es ist die physische und geographische Wirklichkeit der Menschen, von dem ihr Überleben als Individuen und als Gruppe abhängt. Land ist eine Quelle der Sicherheit, es garantiert Ernährung, Zufl ucht und Schutz sowie die materielle Basis für die eigene Identität. Land ist so die Ausweitung des Selbst. Land ist nutzlos ohne Menschen, und die Menschen sind ohne Land hilfl os und ungeschützt.
Die hier dargestellte Gliederung ist eine vertikale Hierarchie und korreliert mit der grundsätzlichen Auffassung, die Fidschianer von ihrer Stellung im Raum haben. In ihrem gesamten Verhalten zwischen Ehrerbietung und Verteilung spielen die beiden Orientierungen im Raum i cake (»oben« bzw. »darüber«) und i ra (»unten« bzw. »darunter«) eine wesentliche Rolle. Auch alle horizontalen Orientierungen und Auf-teilungen lassen sich zwischen den beiden Achsen »oben« und »unten« einordnen (vgl. Toren 1990, 196 ff.). In den Häusern innerhalb des Dorfes bei der yaqona-Zere-monie, beim Essen und Diskutieren von Dorfangelegenheiten, bei Gottesdiensten, bei Feiern und bei Trauer – bei allen sozialen Anlässen – sitzen diejenigen von höherem Status »oben«, die von niedrigerem Status »unten«. In diesem Fall ist die Achse »oben – unten« von einer vertikalen auf eine horizontale Ebene bzw. ebene Fläche umgelegt, was im Folgenden noch genauer ausgeführt wird.
Ergänzend zur räumlichen Orientierung, die hier immer auch eine soziale ist, soll schließlich der Begriff yavu angeführt werden. Yavu ist der im Idealfall erhöhte Platz, auf dem ein Haus (mbure) errichtet wird, es ist die Basis oder das Fundament des Hauses. Mit dem Begriff verbindet sich auch der »heilige Besitz« der Familie (Ravuvu 1983, 14 ff.). Von mehreren Autoren wurde auf die Bedeutung des Hauses für die sozialen Beziehungen und die Identität des Einzelnen hingewiesen, so von Quain (1948, 82 f.), Sahlins (1962, 106), Nayacakalou (1978) und Toren (1990, 29 ff.). Mit yavu wird der Platz innerhalb der dörfl ichen Hierarchie legitimiert und die Bezie-hung zur Dorfgemeinschaft bestimmt. Ein taukei ni koro, ein lange Ansässiger des Dorfes, muss eine traditionelle yavu haben, d. h. einen Platz, dessen Besiedlung sich
435Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung
bis zur Entstehung der Siedlung rückdatieren lässt, als die Urahnen das erste Haus errichteten. Personen, die keine traditionelle yavu ihr Eigen nennen können, werden auch innerhalb des Dorfes manchmal als vulagi, Besucher oder Fremde, bezeichnet. Grundsätzlich besteht eine Korrelation zwischen der Höhe des Fundaments und der Stellung der Hausbewohner. Je höher die yavu, desto höher der Rang der betreffenden Hausbewohner. So symbolisiert in der Regel eine hohe yavu, also ein Fundament, wo man mehrere Stufen steigen muss, um das Haus betreten zu können, die Stel-lung eines Häuptlings. »Ihre Hausplattform ist hoch«, sagt man in Fidschi, wenn von einer angesehenen Familie die Rede ist, und die Einladung »cabe mai« (thambe mai, »komm herauf«) ist fest im fi dschianischen Sprachgebrauch verankert, auch wenn es sich um ein modernes, ebenerdig gebautes Haus handelt (Lehner 1995, 67). Hier manifestiert sich die Dichotomie zwischen »oben« und »unten« in sehr anschaulicher vertikaler Weise. Sie fi ndet sich vor allem bei den Gebäuden, die traditionellerweise spirituell-religiösen Zwecken dienten, den bure kalou, von denen jedoch heute kaum mehr Beispiele existieren, den Versammlungshäusern (vale levu) und bestimmten Häuptlingshäusern, insbesondere jenen so genannter paramount chiefs.
Abb. 3. Halbfertiges fi dschianisches Haus. Die aufgeschüttete Erdbasis ist mit Steinen befestigt (nach Thomson 1908).
436 Hermann Mückler
Die Bauweise einer yavu folgt überlieferten Prinzipien. Gewöhnlich wird aus Erde ein Hügel aufgeschüttet, der in meist rechteckiger Form angelegt ist. Die Ecken des Rechtecks dienen in weiterer Folge der Aufnahme der Eckpfosten des darauf zu errichtenden Hauses. Der Erdhügel selbst wird mit massiven Steinen befestigt, um ein Abrutschen des Erdmaterials zu verhindern (Abb. 3). Dabei werden die Seitenwände abgeschrägt, je nach Höhe der Plattform in unterschiedlichem Winkel. Die yavu bie-tet damit die Gestalt einer abgefl achten eckigen Pyramide (Pyramidenstumpf) mit schrägen Seitenwänden, die auch eine oder mehrere Stufen aufweisen kann. In die Pyramidenplattform werden neben den Eckpfosten die Wandsteher in vorbereitete Pfahllöcher versenkt. Auf den Grund dieser Pfostengruben wird ein Stein gelegt, um spätere Setzungen der tragenden Stützen zu verhindern. In vorkolonialer Zeit bzw. in jener Epoche, bevor die christliche Mission in Fidschi Einzug hielt – also bis ca. Mitte des 19. Jahrhunderts –, wurden unter den Eckpfosten manchmal nicht nur Steine, sondern auch die Schädel getöteter Kriegsgegner eingegraben, was sich archä-ologisch nachweisen lässt. Die Menschenjagd in Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen und der dabei auch manchmal praktizierte Kannibalismus dienten vor allem der ultimativen Demütigung eines besiegten Kriegsgegners. Eine yavu gehört zur agnatischen Linie bzw. wird in dieser vererbt; der Name einer yavu, der die Linie der Alten eines Clans oder eines Geschlechts repräsentiert, wird nicht gewechselt, sondern weiter tradiert (Toren 1990, 30).
Die räumliche Orientierung der Fidschianer ist folglich stark durch die Stellung des Einzelnen im sozialen hierarchischen System determiniert und umgekehrt. Die soziale Stellung weist dem Individuum jeweils einen exakten Raum im Sinne von Platz zu. Dieser wird, für alle Umstehenden sichtbar, zum äußeren Zeichen der Funk-tion und des Bedeutungsgrades, der Dauer und der Intensität der Zugehörigkeit zur Gruppe.
Am deutlichsten kommt dies bei der Kava-Zeremonie – auf Fidschianisch yaqona-Zeremonie – zum Ausdruck. Das yaqona-Trinken (auch yanggona geschrieben) stellt einen gesellschaftlichen Höhepunkt im Leben der Fidschianer dar. Das Wort yaqona ist die fi dschianische Bezeichnung für die im ozeanischen Raum verbreiteten und kul-tivierten Varietäten des Pfefferstrauches Macropiper methysticum und wird exakt mit yaqona ni viti beschrieben. Der Zusatz ni viti bedeutet hier soviel wie »aus Fidschi« und verweist darauf, dass es sich um ein Getränk mit lokalen Wurzeln handelt. Dies ist in Abgrenzung zu yaqona ni vavalagi zu sehen, was in etwa »Getränk der Europäer« bedeutet und meistens alkoholische Getränke bezeichnet. Die Stammpfl anze ist ein strauchartiges, etwa 2 m hohes Gewächs mit gestielten breitovalen Blättern. Der Wur-zelstock, der frisch etwa 1–2 kg schwer ist, bildet mitsamt den stärkeren Wurzeln und den unteren Teilen des Stammes die Droge (Wernhart / Maruna 1979, 16). Die Wurzeln werden ausgegraben und zu Pulver zerstampft, das im Rahmen der Zeremonie mit Wasser vermengt wird. Yaqona fi ndet seine linguistische Entsprechung im polynesi-schen Wort kava, welches sich vom samoanischen Wort ’ava ableitet. Auch in Fidschi
437Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung
wird der Begriff kava substituierend für yaqona verwendet, und im deutschsprachigen Raum wird das Getränk ebenfalls als »Kava« bezeichnet. Seine Bestandteile, insbe-sondere das Kavalacton Kavain, kommen auch in pharmazeutischen Produkten vor, welche sich die sedierende Wirkung der Inhaltsstoffe zunutze machen.
Der Kava-Trunk ist ein beruhigendes, nicht alkoholisches Getränk, das bei ver-mehrtem Genuss Zunge und Lippen betäubt sowie die Empfi ndlichkeit der Augen
Abb. 4. Skizze eines fi dschianischen Versammlungshauses.
34
5
6
6
2 3
5
5
5
5
6
6
7
7
1
2
2
2
2
3
3
3
4 4
4
2
tanoa (Kavaschüssel)
sau („Nabelschnur“)
Anrichte-bereichfür Speisen
„obere“ Türe „obere“ Türe
„untere“ Türe
„hintere“ Türe
„i cake“ (oben)
„i ra“ (unten)
1 33 3 3
yaqona (Kava)
1 turaga ni vanua (Häuptling, Dorfvorsteher)2. turaga ni koro (Sprecherhäuptling, Dorfverwalter)3. Ehrengäste, Älteste etc.4. Priester/Prediger5. In absteigender Reihenfolge die erwachsenen Männer6. für die Kavazubereitung zuständige junge Männer7. Männer, die für die Musik sorgen
1. Frau des Häuptlings2. Frau des Sprecherhäuptlings u. ältere Frauen3. Frauen, die bei Festen für den Tanz sorgen4. Für die Speisenbereitung zuständige Frauen
Männer
Frauen
© H. Mückler
438 Hermann Mückler
gegenüber Licht erhöht. Kava kann man im melanesischen Raum, wo die Wurzel erstmals kultiviert wurde, häufi g auf informeller Basis, d. h. in einem nicht ritualisier-ten Rahmen, trinken. So gibt es beispielsweise in Vanuatu (früher: Neue Hebriden) so genannte Kava-Bars, die durch eine rotes Licht gekennzeichnet sind und wo man gegen Bezahlung eine randvolle Kava-Schale erhält, die man in dafür vorgesehenen »Schankräumen« einnimmt. In Polynesien hingegen ist das Kava-Trinken fast immer in eine mehr oder weniger ritualisierte Gemeinschaftshandlung eingebunden (vgl. dazu Mückler 1996). Die Tatsache, dass die Kava-Zeremonie im polynesischen Raum auch in Samoa, auf Tonga und in Teilen Zentralpolynesiens verbreitet ist und durch die polynesischen Einfl üsse über Ostfi dschi den Eingang in das traditionelle fi dschia-nische Zeremoniell gefunden hat, zeigt die Verbindungen, die zwischen diesen Insel-gruppen über lange Zeit und schon vor langer Zeit bestanden haben. Der Missionar John Williams (1983 [1858], 141 f.) beschrieb als einer der ersten eine entsprechende Zeremonie. Das im Folgenden beschriebene Ritual folgt eigenen Beobachtungen des Autors im Dorf Nadoria an der Ostseite der Insel Viti Levu.
Die fundamentalen Symbole der yaqona-Zeremonie, die yaqona-Schüssel, fi dschi-anisch tanoa, und die Trinkschale, bilo, sind in Samoa und auf Fidschi die gleichen und lassen eine enge Beziehung zwischen diesen beiden Inselgruppen vermuten, die auch im gemeinsamen Mythenreichtum ihren Ausdruck fi ndet. Das yaqona-Ritual besteht aus dem zeremoniellen Mixen und dem Trinken der Flüssigkeit des Juice der
Abb. 5. Tanoa, die Holzschale zur Zubereitung des yaqona-Getränks.
439Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung
Kava-Wurzel. Das Ritual fi ndet im Gemeinschaftshaus statt. Dieses hat fast immer rechteckige Form, mit mehreren Türen auf beiden Längsseiten und einer Tür an der »unteren« Stirnseite. Ein »klassisches« Gemeinschaftshaus zeichnet sich durch mindestens vier und maximal sechs Seitentüren aus, wobei es im Haus selbst eine klare Aufteilung zwischen »oben« und »unten« gibt (Abb. 4). Diejenige Stirnseite, die keine Tür aufweist, gilt als »oben«, die Seite also, der die höchste Bedeutung zukommt. Die Mehrzahl der Seitentüren resultiert daraus, dass die »wichtigen« Per-sonen, die das Haus betreten, dieses im »oberen« Teil betreten und nicht die weiter hinten liegenden Türen benutzen.
Traditionellerweise befi ndet sich der Platz des Dorfhäuptlings, des turaga ni vanua (Häuptling der Gemeinschaft, der vanua), in der Mitte der »oberen« Stirnseite. Ihm zur Seite sitzen der Sprecherhäuptling turaga ni koro (Häuptling des Dorfes), even-tuell der Priester sowie besondere Gäste, die man dadurch, dass man sie an der Stirn-seite sitzen lässt, auszeichnet und denen man so Wertschätzung vermittelt. An den Längsseiten sitzen, von »oben« beginnend, die wichtigsten der älteren Männer, in absteigender Reihenfolge gefolgt von den jüngeren Männern, und zwar in genauer Rangfolge ihres Alters, ihrer Funktion und ihres Ansehens in der Gemeinde. Der Raum wird in der Mitte durch eine unsichtbare imaginäre Linie quer in zwei Hälf-ten geteilt. Ab der Mitte sitzen die Frauen – aber auch Männer niederer Rangstufen – nach demselben System, also ab der Mitte die Häuptlingsfrau sowie die wichtigsten älteren Frauen, gefolgt von den jüngeren Frauen, wobei in der »unteren« Raumhälfte die Sitzordnung wesentlich lockerer ist als im oberen Teil. Ebenfalls am Ende dieser die Dorfhierarchie bzw. Bedeutung von Personen und Handlungen widerspiegelnden Aufteilung, d. h. am »unteren« Rand des Hauses, dürfen sich die Kinder aufhalten. An der »unteren« Stirnseite befi ndet sich eine Tür, durch die Essen in den Raum gereicht wird. Dieses wird in einer der beiden »unteren« Ecken abgestellt und für das Auftragen zubereitet.
Bei der yaqona-Zeremonie steht die tanoa genannte Kava-Schüssel in der Mitte des Raumes, manchmal im oberen Bereich, knapp oberhalb der imaginären, den Raum teilenden Linie. Die tanoa ist aus massivem Hartholz hergestellt und wird in ihrer traditionellen dünnwandigen Form als tanoa dina bezeichnet (Abb. 5). Sie weist mindestens vier, manchmal bis zu zwölf Beine auf und hat an einer Seite eine Boh-rung, an der mittels eines Kokosfaserstricks eine Muschel gebunden ist. Diese Schnur hat eine Länge von ungefähr einem Meter und wird bei Zeremonien zu Ehren eines besonderen Gastes – also nicht immer – so ausgelegt, dass die Muschel in Richtung des Häuptlings zeigt. Meist handelt es sich dabei um eine Zeremonie namens yaqona vakaturaga, bei der ein Oberhäuptling (paramount chief) anwesend ist. Die Schnur teilt den Raum noch einmal und zwar entlang seiner Längsseite in zwei längliche Hälften. Die teilnehmenden Würdenträger sitzen in einem imaginären Halbkreis an den Wänden um die Holzschüssel herum, während die Redner zwischen ihnen pos-tiert sind. Die Beteiligten sitzen, meist mit überkreuzten Beinen, auf Pandanusmatten
440 Hermann Mückler
auf dem Boden. In direkter Verlängerung der Schnur sitzt die ranghöchste Person im Raum, die sich im Scheitelpunkt des imaginären Halbkreises befi ndet – sie ist sozu-sagen i cake sara (»ganz oben«). Die Schnur symbolisiert dabei eine »Nabelschnur« (fi dschianisch sau), welche die Verbindung zwischen der Welt der Ahnen und den Lebenden darstellt. Da die tanoa in ihrer Funktion des Haltens des Wassers und der Pfl anzensubstanz als feminin angesehen wird, verbindet die sau die Kava trinkenden Anwesenden mit der ebenfalls weiblichen Erde. Hier wird ein enger Zusammenhang mit vanua sichtbar. In vorkolonialer Zeit war die sau so hoch bewertet, dass ein unbedachtes Überschreiten der Schnur zumindest theoretisch mit dem Tode geahndet werden konnte. Diese Verbindung zur Erde stellt gleichzeitig ein zentrales Symbol der Aufl adung mit dem für einen Häuptling wichtigen mana dar. Diese Kraft, Wirk-samkeit oder Effektivität wird von der Erde über die sau in die tanoa und von dort über die bilo mit dem Trank auf den Trinkenden übertragen und symbolisiert etwas Wesentliches: Derjenige, der als erster oder als einer der ersten den Kava-Trunk zu sich nimmt, wird für alle Anwesenden sichtbar mit mana aufgeladen und auf diese Weise für die Ausübung des Amtes, der Funktion und damit der jeweiligen Rolle in der Gesellschaft legitimiert.
Abb. 6. Kava-Trinken der Frauen im Freien. Hier handelt es sich um eine weniger rituali-sierte Form geselligen Zusammenseins (nach Whitson 1930).
441Das fi dschianische Versammlungshaus als Ort der Identitätsfi ndung
Direkt gegenüber dem obersten Häuptling und hinter der Schüssel sitzt ein Mann, lose yaqona genannt, der in der Regel aus der Familie des obersten Häuptlings ent-stammt. Er bereitet den Trank zu, indem er die Wurzel mit Wasser vermischt. Durch Kneten des mit Kava-Pulver gefüllten »Beutels« im Wasser nimmt dieses eine grau-braune Färbung an. Zwischendurch wird von der Person, die den Trank zubereitet, in regelmäßigen Abständen der breite Rand der fl achen Holzschale durch kreisende Wischbewegungen vom Spritzwasser gereinigt. Der gesamte Vorgang der Zuberei-tung wird von rituellen Formeln und Ansprachen eingeleitet und begleitet, die auf die Bedeutung der Zeremonie und den Anlass für das Zusammenkommen Bezug nehmen (Toren 1990, 90). Hat das Wasser die richtige Färbung erreicht, wird der Trank in der Reihenfolge der Bedeutung der Anwesenden einzeln jeweils in einer Schale – in der Regel in einer Kokosnusshalbschale – mit beiden Händen vom lose yaqona überreicht, wobei die erste Schale dem Ehrengast bzw. Häuptling vorbehalten ist. Das Zubereiten der ersten Schale und das Trinken derselben geht in absolutem Schweigen aller Anwesenden, ausgenommen den in der Zubereitung involvierten Rednern, vor sich. Das Zurückreichen der leeren Schale wird von dreimaligem Klat-schen des Trinkenden und der Anwesenden begleitet. Es handelt sich fast immer um Männer, die Kava zubereiten; daneben gibt es eigene Kava-Runden für Frauen, wo diese ihn zubereiten und trinken (Abb. 6). Die Männer im »unteren« Teil des Raumes warten darauf, im Anschluss an die »offi zielle« yaqona-Zeremonie Musikstücke und Gesang darzubieten.
Das Prinzip der Achse »oben – unten« ist bei dieser Zeremonie im horizontalen Sinn zu verstehen, und hier schließt sich der Kreis der räumlichen Manifestation sozi-aler Ordnung. Es ist eine dreidimensionale Ausrichtung, die bei der yaqona-Zeremo-nie beobachtet werden kann: Die tanoa in der Mitte des Raumes teilt diesen entlang der Längs- und der Querachse. Die im Zusammenhang mit den yavu beschriebene, tatsächlich vertikale Achse kommt insofern zur Geltung, als es den Anwesenden ver-boten ist, sich höher als der Kopf des höchsten Repräsentanten im Raum zu bewegen. Rangzuschreibung, Status und damit letztlich die Orientierung und Stellung des Ein-zelnen defi nieren sich in Fidschi auch und vor allem durch die kulturspezifi sche und historisch gewachsene dreidimensionale Strukturierung des (Innen-) Raums, die am Beispiel der zeremoniellen Nutzung des Versammlungshauses hier skizziert wurde. Dass die Sitz- und damit Rangordnung in solch einem Gebäude immer wieder neu verhandelt wird, zeigt sich daran, dass die Sitzordnung auch Anlass für Diskussionen, im schlimmsten Fall für Streit sein kann. Ein unakkordiertes »Vorrücken« einzelner ehrgeiziger Personen in der Sitzordnung kann schon einmal einen scharfen Verweis von Ranghöheren nach sich ziehen. Die Sitzordnung ist verhandelbar und ändert sich für ein Individuum im Laufe seines Lebens mit dem Wechsel der Funktionen im Dorf – sie ist Gegenstand von Gesprächen und Diskussionen.
Somit ist die Sitzordnung im vale levu ein Spiegel der gesellschaftlichen Struk-turierungen des Dorfes, mit all seinen Funktionsträgern, seinen Fluktuationen, ein
442 Hermann Mückler
Spiegel sich wandelnder Kräfteverhältnisse und Ort der Identitätsstiftung und -fi n-dung für die Bewohner und damit unverzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden Dorfgemeinschaft.
Literaturverzeichnis
Dickhardt 2003: M. Dickhardt, Räume in Fiji: Kulturelle Räumlichkeit aus der Perspektive ihrer Modi. In: B. Hauser-Schäublin / M. Dickhardt (Hrsg.), Kulturelle Räume – Räumliche Kultur. Göttinger Studien zur Ethnologie 10. Münster u. a.: LIT, 221–65.
Freeman 1986: S. Freeman, The Centre-Poled Houses of Western Viti Levu. Domodomo (Fiji Museum Quarterly) 4, 1, 1986, 2–19.
Lehner 1995: E. Lehner, Architektur der Südsee. Traditionelle Bautypen auf Hawaii, Tonga, Samoa, Neuseeland und den Fidschi-Inseln. Wien: Phoibos 1995.
Mückler 1996: H. Mückler, Kava in Ozeanien: Neue Betrachtungen zu einer Kulturpfl anze und deren Bedeutung im kulturellen Kontext. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft Wien 125, 1996, 207–24.
Mückler 1998: Ders., Fidschi. Zwischen Tradition und Transformation. Frankfurt a. M.: IKO 1998.
Mückler 2007: Ders., Invisible Lines – On the Diffi culties of Drinking. Unsichtbare Linien – oder: das komplizierte Trinken. Journal of Comparative Cultural Studies in Architec-ture 1, 1, 13–20.
Nayacakalou 1978: R. Nayacakalou, Tradition and Change in the Fijian Village. Suva: Institute of Pacifi c Studies of the University of the South Pacifi c 1978.
Nayacakalou 1985: Ders., Leadership in Fiji. Suva, Oxford: University of the South Pacifi c, Oxford University Press 1985.
Quain 1948: B. Quain, Fijian Village. Chicago: University of Chicago Press 1948.Ravuvu 1983: A. Ravuvu, The Fijian Way of Life. Vaka i Taukei. Suva: Institute of Pacifi c
Studies of the University of the South Pacifi c 1983.Sahlins 1962: M. Sahlins, Moala: Culture and Nature on a Fijian Island. Ann Arbor: University
of Michigan Press 1962.Thomson 1908: B. Thomson, The Fijians. A Study of the Decay of Custom. London: William
Heinemann 1908.Tischner 1934: H. Tischner, Die Verbreitung der Hausformen in Ozeanien. Leipzig: Verlag der
Werkgemeinschaft 1934.Toren 1990: Ch. Toren, Making Sense of Hierarchy, Cognition as Social Process in Fiji. Mono-
graphs of Social Anthropology 61. London: Athlone Press 1990.Wernhart / Maruna 1979: K. Wernhart / H. Maruna, Betrachtungen über das Kava-Trinken aus
medizinisch-biochemischer und ethnologischer Sicht. Dr. Med. 3, 1, 1979, 16–20.Whitson 1930: T. W. Whitson, A Day in Suva, Fiji. Suva: ca. 1930 [Werbebroschüre der Union
Steam Ship Company].Williams 1983: J. Williams, Fiji and the Fijians I: The Islands and Their Inhabitants. Suva: Fiji
Museum 1983 [Erstausgabe: London 1858].