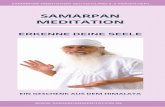Beitrag zur Problematik nicht-kardialer Comorbiditäten bei ...
Strukturen ideologischer Konflikte bei Parteienwettbewerb
-
Upload
uni-konstanz -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Strukturen ideologischer Konflikte bei Parteienwettbewerb
STRUKTUREN IDEOLOGISCHER KONFLIKTEBEI PARTEIEN\TETTBEWERB
Yon Gerhard Lehmbruch
Die normative Theorie der Demokratie hat der Frage, wie die Funktionsfähigkeit despolitisdren Systems von ideologischen Konflikten bäeinflußt wird, viel Aufmerksam-keit gewidmet1' Es wird dabei vorausgesetzt, daß der Gegensatz politischer übe rzeu-gungen eine Dimension des politisd-ren Konflikts im Gemei.rwer.rr^irr, die man analy-tisch von anderen Dimensionen' etwa der des sozioökonomischen Irrt.resr.rkonflikts,trennen kann 2' Besonders widrtig ist die vorstellung geworden, daß - statistisdr aus-gedrückt - bestimmte Häufigkeitsverteilungen,rol-üb"g..rgrr.rg.r, innerhalb derwählerschaft das Funktionieren des syrte-, befördern od.. Ü..iJträchtigen. In derliberalen Demokratietheorie begegnet insbesondere der Gedanke, daß ein gewisses Maßan Übereinstimmung in politisclen Überzeugungen (rrKonsensusu) die potentiell des-integrierenden Auswirkungen des Konflit t.s 1"öissensus,,) auffangen und so die sta-bilität der Demokratie sidrerstellen müsse. (,wir woll.n di., im fäg.rrden als ,,Kon-sensuspostulat" bezeidrnen.) Die zugrunde liegende Hypothes. k".rrr".ine sozialtechno-logisdre \wendung bekommen, indem nach tvt-aßregeln gefragt wird, durc; welc6e dieKonsensusbildung und folgli& die stabilität a.r a.-okr"Iir.h.., syrr"-, gefördertwerden kann; hier wird vielfach an Eingriffe in das institutionelle befüge (2. B. inForm von Wahlsystemänderungen) gedacht.Der mit diesen Bemerkungen kurz umrissene Gegenstand der politikwissenschaftlidrenDiskussion wird nun u. E. vielfach insofern unlureichend eriaßt, als einige wichtigeempirische Aspekte des ideologischen Konflikts gemeinhin allzugrobflächig behandeltwerden' Nicht nur, daß man die versdrieden.r, Äpirischen Dimeisionen der zugrundeliegenden Begriffe nicht mit hinreichender Sorgf"lt "ur.i'anderhält. Der genauerenKlärung und differenzierten Analyse bedarf voi allem die Frage, wie die möglicler-weise funktional bedeutsamen Konsensus-Dissensus-verreilungen im parteiensystem -als der zenttalen Arena für die Austragung ideologischer Konflikte - gelagert undaufeinander bezogen- sind. Im folgend"n ,oil dies ii einer sekundäranalyse neuererempirischer ljntersuchungen erörtert werden; dabei wird über die Formulierung vonHypothesen zur struktur ideologischer Konflikte hinaus eine präzisierung und Diffe-renzierung der empirisdren wie auch der normativen Fragestellung angesrrebt. unserestudie besdrränkt sich durcJrweg auf politische systeme des \Testens mit voll entwickel-tem Parteienwettbewerb um den zugang zu Entscrreidungspositionen.
1 wir bezeidrnen hier zunädrst summarisch poritische überzeugungen ars uldeorogie., werdenabcrqreiter unten eine terminologiscle oiff.tä"ri.l"rg J"iirrrr.ä urid arl.i J." Terminus enger2 Eine gewisse unabhängigkeit der ideologischen von sozioökonomisclen Konflikten wird be-kanntlidr audr von d"tt s,rbiileren version"i d", -"r*iriirÄ.n Ideologielehre eingeräumt.
286 Gerbard Lebmbrudt
1. Struktwrdimensionen von Konsensus und Dissensas
Als zentrale Begriffe verwenden wir ,'Konsensus,, oder uDissensus" über politiscbe
überzeugungen, und zwar innerhalb des politischen Systems (Inter-Gruppen-Konsen-
sus bzw. -Dissensus). Vir schließen also sowohl die gelegentlidr begegnende Gleichset-
zung von ,rKonsensus., mit kultureller oder sozialer Homogenität aus s als audt die mit
,,Inreressenaggregationo innerhalb einer Partei (Intra-Gruppen-Konsensus) a. Dies vor-
ausgesetzr, können wir die empirisdren Dimensionen der Begriffe Konsensus bzw. Dis-
sensus in zwei Klassen einteilen. Die einen beschreiben die Struktur des Universums von
überzeugungen, die den politischen Konsensus oder Dissensus konstituieren: ihre Ver-
teilung und Intensität sowie die Organisation der "Überzeugungssysteme<( (belief
systern). Die anderen Dimensionen beschreiben Konsensus oder Dissensus hinsidrtlidr
des Objektes der Uberzeugungen.
'l.1. Häut'igkeitsverteilang wnd Intensität aon politisdten Überzewgt ngen
Im Diskurs der normativen Demokratietheorie werden die Begriffe uKonsensusn und
nKonfliktu (oder oDissensus") in der Regel qualitativ gefaßt. \üill man ihnen nun
empirisdr beobachtete Sachverhalte so zuordnen, daß sidr überprüfbare Hypothesen
forrnulieren lassen, dann wird man dafür praktikable Messungskriterien fesrcetzen, also
die qualitativen Begriffe uoperationalisieren" müssen. Es darf darum niclt befremden,
wenn hier die Fragestellung mit einigen (übrigens elementaren) statistisdren Termini
angegangen wird.rWenn die Parteien- und \üählerforschung die Verteilung von Konsensus und Dissensus
rnessen will, bedient sie sich vielfach des Begriffspaares von Konsensus einerseits, Pola-
risierwng andererseits: Eine Population (also die statistische Ausgangsgesamtheit: seien
es Wähier, oder Parteimitglieder, oder bestimmte Elitegruppen) ist "polarisiert>, wenn
der Konsensus niedrig ist im Verhältnis zum Dissensus. Vielfadr wird dies Verhältnis
als Dic}otomie behandelt, indem etwa die Zustimmung zu bestimmten Aussagen ge-
messen wird s. Man kann dann verschiedene Populationen hinsichtlidr des Maßes an
Konsensus/Polarisierung vergleichen und gegebenenfalls auf einer Ordinal- bzw. Kar-
dinalskala anordnen. Eine verfeinerte Messung beschreibt die Verteilung von Konsen-
sus/Dissensus innerhalb einer Population, indem zugleich die Extremität (2. B. auf
3 Insbesondere halten wir die Verwendung des Konsensusbegriffs für Übereinstimmung kultu-reller \Tertsysteme, z. B. gemeinsame religiöse Anschauungen (so bei Reinhold Niebubr.' "Con-
sensus in einer demokratischen Gesellsdraftu, in: PVS, 2.Jg.,1961, S. 206 ff ' ) oder "übergrei-
fende Solidaritätsgefühle.. (Harry Eckstein: Division and cohesion in democracy, A study ofNorway, 1966, S. 19\ fnr nidrt sehr zweckmäßig.n Vgl. zu diesem Spradrgebrauch etwa Ru.dolt'
.Wildenmann.' uKonsensus und Machtbildung,Analysiert am Beispiel der engl ischen Unterhauswahlen vom 8. Oktober 1959", in:ZfP,7.Jg.(1960), S.210: "Das \(ahlsysrem veranlaßt die Parteien, zuerst in sidr einen Konsensus überRegierung und Programm herbeizuführen und sidr danach... dem al lgemeinen Votum zu
stellen."5 So verfahren zum Beispiel Jarnes'W. Prothro und C. W.Grigg: "Fundamental principles ofdemocracy, Bases of agreement and disagreement", in: JoP 22 (1960), 5.276-294, sowie HerbertMcClosky: "Consensus and ideology in American pol i t ics", in: APSR 58 (1964),5.362-382.
S truk tar e n ide olo gis cI er K onf lih te b e i P ar t e ie nw e t tb ew e rb 287
einem Redrts-Links-Kontinuum) oder Intensität der jeweiligen überzeugungen unrer-sud-rt wird; dies kann mit Hilfe von hierarchisch skalierten Aussagenreihen geschehen,wie sie bei der Einstellungsmessung gemeinhin verwender werden 6. Vielfac} bestehteine Korrelation von exrremen Positionen mit hoher Intensität ?, und dieser Zusammen-hang von Extremität und Intensität kann es rechtfertigen, daß (statt der kompliziertenunabhängigen Messung beider Variablen) einfadr die (an Hand der Selbsteinsdrätzungermittelte) Intensität der Meinung als Indikator für Extremität der Einstellung ver-wendet wird, wie es bei dem bekannten Begriff der ,,Parteiidentifikation., üblich ist 8.
Es ergeben sic} bei soldren Messungen drarakteristische Häufigkeitsverteilungen: Eineunimodale Verteilung der Präfererlzen, d. h. die Massierung um einen häufigsten rWert
(Modus) ist gleicJrbedeutend mit starkem Konsensus; als graphisdre Ausdrucksformkommen hier die bekannte Glod<enkurve oder die J-Kurve in Betradrt. Eine bimodaleVerteilung, mit zwei auseinanderliegenden Modi (U-Kurve), wäre demgegenüber alsPolarisierung zu bezeichnen e.
In diesem Zusammenhang gehört schließlich nodr die an das Konzept der Parteiidenti-fikation anschließende Messung von Parteidist anzen oder oEntfernungsbeziehun-genu 10 mit Hilfe des sog. Sympathieskalometers, die nicht nur die Einsdrätzung dereigenen Parteibindung durcJr den Befragten erfassen soll, sondern zugleidr seine Ein-sdrätzung der übrigen Parteien; aus geringen Distanzwerten in der Einsdrätzung wirdmitunter auf starke Bereitsc}aft zum Parteiwechsel gesc.:hlossen 11. Ob das ridrtig ist,
u Vgl. erwaV. O. Key: Public opinion and American democracy (1961), S. 108 ff. - In dieTechnik der Skalierungsverfahren führen ein: Peter R. Hofstäner: Einführung in die Sozial-psychologie (19664), S. 165 ff .; Erwin K. Scheuch; ,skalierungsverfahren in der Sozialfor-schung*, in: Handbudr der empirisdren Sozialforschung, Bd. I.' Kry, a.a.O., S. 209; Hot'stätter, a.a.O., 5,171.I Dieser Begriff ist aus den Arbeiten des Survey Researdr Cenrer der University of Midrigangeläufig; siehe z. B. Angus Carnpbell, Pbilip E. Converse,'Waren E. Mitler und Donald E. ito-,äes. ' The American voter (1960),5.124.e Mit solchen Häufigkeitsverteilungen arbeiten vor allem die bekannten Modellanalysen vonAnthony Dousns: An economic theory of democracy (1957), S. 115 ff . , und Robert 'A. Dahl:A preface to democratic theory (1956), S.90 ff., sowie ders.: Pluralist democracy in the UnitedStates, Confl ict and consent (1967),5.270 ff . ; dort wird der Leser aucl graphische Darstel lun-gen f inden; vgl. ferner Key, a.a.O.10 Diesen Terminus verwendet Helmut tJnhelbacb: Grundlagen der Wahlsystematik (1956),S. 36 ff., der jedoch ,Entfernung" an Hand eines Satzes von objektiven Unterschieden zwischenden Parteien definiert, die sich nur sehr umständlich operationalisieren lassen würden, währenddie Distanzmessung im hier erörterten Sinne auf dem einfadreren, freilich auch vieldeutigenPrinzip der subjektiven Einschätzung beruht. Die dem zugrunde liegenden psydrologischenHypothesen erörtert Philip E. Conoterse.' "The problem of party distances in mädels of votingc.hange", in: M. Kent Jenningsund L. HarmonZeigler (Eds.): The electoral process (1966).11 LJnter diesem GesicJrtspunkt wird das Instrument insbesondere in der oKölner Wahlstudiel-961" und den Folgeuntersuchungen verwendet, die stark von dem sozialpsychologischen Ansatzdes "American voter" (Campbell u. a., a.a.O.) beeinflußt sind; vgl. voi allem Max Kaase:"\Wechsel von Parteipräferenzen" (1967), S. 84, und Rudolf
'Wildenmann: ,,Parreien-Identifika-
tion in der Bundesrepublik", inz Otto Stamrner (Hrsg.): Party sysrems, party organizations, andthe politics of the new masses (1968, Manuskriptdruck). Eine geringere-Rolie spi"lt es bei KlausLiepelt und Alexarzder Mitscherlich (lFrrsg.): Thesen zur \7ähleiflukiuation (1948), S. 104.
288 Gerhard Lebmbruch
kann hier dahingestellt bleiben 12; immerhin erscheint die Auffassung plausibel, daß
geringe Distanzen ein hohes Maß an Konsensus anzeigen, große Distanzen dagegen
Polarisierung.
Eine verbreitete Hypothese besagt, daß zwischen einem Zweiparteiensystem und uni-
modaler Verteilung der politischen überzeugungen ein Verhältnis der Abhängigkeit
bestehe, sei es, daß das Zweiparteiensystem die Bildung von Konsensus begünstige 13,
sei es umgekehrt, daß das Funktionieren von Zweiparteiensystemen (insbesondere die
Chance des Alternierens der Parteien in der Machtausübung) von einer unimodalen
Verteilung der politischen überzeugungen abhänge 14. Dabei wird impliziert, daß die
Häufigkeitsverteilung zugleich eine symmetrische sei, m. ä. V., daß der häufigste Wert
ungefähr in der Mitte des Kontinuums liege (wie bei der Normaiverteilung oder Glok-
kenkurve), und daß die Grenze der Anhängerschaft beider Parteien diesen Modus
durchschneide. In diesem Falle würden nämlich die Parteien in ihrer Konkurrenz um
die Vähler zur Mitte konvergieren, sich also gemäßigt verhalten 15.
Hierbei wird freilich davon ausgegangen, daß sich Überzeugungen auf einern Konti-
nuum hinreichend beschreiben lassen. Diese Annahme ist nicht unproblematisch, v'eil sie
eine starke Aggregation verschiedener möglicher Konfliktdimensionen voraussetzt.
Eine solche Situation ist zwar denkbar (insbesondere bei starker Polarisierung), aber
nicht zwangsläufig; ob sie vorliegt, ist eine von Fall zu Fall zu entscheidende empirische
Frage. Vielfach wird es sinnvol ler sein, die Vertei lung pol i t ischer Präferenzen auf meh-
reren Konf l ik td imensionen zu beschre iben ( r .B.Wir tschaf ts- und Soz ia lpo l i t ik e iner -
seits, Kulturpol i t ik andererseits) 16. Dies l 'ürde gleichzeit ig eine befr iedigendere Be-
schreibung der Konfi iktstruktur von Vielparteiensystemen ermöglichen als die auf dem
eindimensionalen Modell beruhende Hypothese, daß ,polymodale" Verteiiungen von
politischen überzeugungen zur Entstehung von Vielparteiensystemen führen 17. Man
12 Vgl. aber die Ausführungen unten, S. 298, sowie vor allem Frieder Naschold: Zur progno-stischen Kontroverse über die Dynamik des Wählerverhaltens in der Bundesrepublik (erscheintdemnächst in den Veröffentl ichungen des Inst i tuts für angewandte Sozialwissenschaft, BadGodesberg).13 Vgl. z. B. Helrnut IJnkelbach in: Flelmut [Jnkelbach, Rudolf Wildenmann urtd \YernerKaltef leiter; Wähler - Parteien - Parlament, Bedingungen und Funktionen der \ \ 'ahl (1965)s. 69 ff.1a So vor al lem Downs, a.a.O., S. 117 ff . , sowie Robert A. Dahl: "Some Explanations", in:Robert A, Dahl (Ed.): Pol i t ical opposit ions in Western democracies (1966). 5.372 f i .15 Bei einer unimodalen asymmetrischen Verteilung (J-Kurve) dagegen s'ürdc es sich, je aus-geprägter die Schiefe der Verteilung ist, um einen Konsensus auf extremer Position handeln, derfunktionierendem Parteienwettbewerb keinen Raum 1äßt.16 So argumentiert überzeugend Donald E. Stokes: "Spatial models of partv competit ion", in:APSR 57 (7963),5.368-377. Zum Verfahren vgl. audr die mehrdimensionale Messung pol i-
tischer Einstellungen bei H. J. Eysenc,ä: The psydrology of politics (1954), S. 107 ff., deren Ein-zelheiten allerdings umstritten sind.17 Dorans, a.a.O., S. 125 ff. - Verwirrend ist die Darstellung der Parteiensysteme Italiens,Frankreichs und der \Teimarer Republik als upolymodaler" Verteilungenbei Giovanni Sartori:"European political parties, The case of polarized pluralism", in: Josepb LaPalombara undMyroiWeiner: Pol i t ical part ies and pol i t ical development (1966), S. 153 ff . , die -ganz tr ivial-einfach die in \Tahlen ausgedrückten Parteipräferenzen als Verteilungsmodi behandelt'
S truk t ur e n id e olo gi s clt e r K onl lik t e b e i P ar t e i enzu e t tb e w e r b 289
trüge damit einerseits der "überlagertrng von Dualismen" (Duverger) Rechnung, äus
der die europäischen Vielparteiensysteme entwicklungsgeschichtlich hergeleitet werden18,
und könnte andererseits die Veränderung von Konsensus zu Polarisierung und umge-
kehrt besser beschreiben: Konsensusbildung atrf einer Konfliktdimension kann logisch
unabhängig sein von Polarisierung auf einer anderen; darüber hinaus kann sich die
Relevanz der einen l(onfliktdimension gegenüber anderen Dimensionen verändern 1e.
1.2. Die Organisation der rÜberzewgungssysteme<
I(onsensus bzw. Polarisierung werden nicht selten mit dem Ideologiebegriff beschrie-
ben; z. B. wird das Konsensuspostulat mitunter so formuliert, daß ein gewisses Maß an
ideologischer übereinstimmung eine Funktionsbedingung für Parteienwettbewerb sei.
Dieser Sprachgebrauch hebt nicht so sehr auf die psychologischen oder sozialen Fwnle-
trcnen von Ideologie ab, die vielfach als die für das Verständnis des Ideologiebegriffs
entscheidende Dimension erscheinen (also beispielsweise die gesellschaftliche Verhül-
lungsfunktion von Ideologie) 20, sondern auf ihren Inhalt (ldeologie als Aggregat von
normativen oder wertenden Aussagen) oder auf ihre Struktur. Die empirisch orien-
tierte Literatur arbeitet heute darüber hinaus auch mit strwktwrellen Definitionen von
Ideologie. Dabei wird zwischen den "Überzeugungssystemen" (beliet' systems) als dem
allgemeineren, und "Ideologie" als dem spezielleren Strukturphänomen unterschieden.
Jedes Individuum zeichnet sich durch eine bestimmte Organisation des Systems seiner
überzeugungen aus 21; aber nur wenn diese Organisation besonderen strukturellen
Kriterien genügt, spricht man von Ideologie: Diese sei eine >particwlarly elaborate,
closewoven, and far-ranging structure ot' attitwdeso zz, oder - was eine noch engere
Definition ist - ,a belief systeftT tbat is internally consistent and consciously beldo 2s.
Zwar kann das nicht als eine erschöpfenCe Definition angesehen werden (denn sie er-
laubt z. B. keine Unterscheidung zwischen oldeologieu und nTheorieu), sondern nur
als eine Dimension des Begriffs; die damit vollzogene begriffliche Einengung ist aber in
Hinblick auf die empirische Fragestellung sinnvoll, weil Ideologie dann als Variable
bei der Beschreibung der Verteilung und Organisation von überzeugungen innerhalb
18 Maurice Du,uerger: Les partis politiques (19542), S. 260 ff.; ähnlich auch Seyrnour M. Lipsetund Stein Rokkan: "Cleavage structures, party systems, and voter alignments", in ihrem Sam-melband: Party systems and voter al ignments (1967), S. 34 ff .1e Vgl. Stokes, a.a.O., S. 372.20 So z. B. in der Textauswahl von Kurt Lenk (Hrsg.): Ideologie - Ideologiekri t ik und Wissens-soziologie (1961). Vgl. aber die Aufzählung der verschiedenen Bedeutungen bei David Minar:"Ideology and pol i t ical behaviour", in: Midwest Journal of Pol i t ical Science 5 (1961,),5.317bis 331. - Man darf dies nicht von vornherein als einander ausschließende Definitionen betrach-ten; es dürfte zweckmäßiger sein, sie (wenigstens teilweise) als Dimensionen eines komplexenIdeologiebegriffs zu behandeln." Vg l . Minar , a .a .O. ,5 .32I f .22 Angus Campbell u. a., a.a.O ., S. 792.23 Samwel H. Barnes: "Ideology and the organization of conflict, On the relationship betweenthought and behavior", in: JoP 28 (1966), S. 514 (Hervorhebung im Original). Vgl. auch dieDefinition bei McClosky, a.a.O., S. 362.
Gerhard Lehrnbruch
einer gegebenen Population verstanden werden kann 2a. Diese Variable läßt sich wie-derum in verschiedene Komponenten zerlegen:
1. Variabel ist zunächst das Niveau der begrifflic}en Artikulation und der Gehalt an(kognitiven, emotiven, wertenden) überzeugungen: Die überzeugungssysteme könnensich nadr ihrem Informationsgehalt durch "Reichhaltigkeit" oder ,nArmut( an Elemen-ten untersdreiden und einen weiteren oder engeren Problembereidr umfassen 25.
2. Yariabel ist weiterhin die Konsistenz der überzeugungssysteme, d. h. die Stärkedes inneren Zusammenhangs zwisdren ihren einzelnen Elernenten 2s. Dieser Zusammen-
hang kann entweder logisch oder gesellschaftlich-historisch (durclr Gruppeninteresse
oder durch "ideengeschichtlicheu Diffusionsprozesse) begründet sein. Ideologien im
engeren Sinne des hier verwendeten strukturellen Ideologiebegriffs sind überzeugungs-systeme, die sich sowohl durch einen großen Informationsgehalt als audr durch starkeKonsistenz auszeidtnen. Geringe Konsistenz von Uberzeugungssystemen kann den An-
schein von geringer Polarisierung (Scheinkonsensus) erwed<en, weil sich in einer gegebe-
nen Population u. U. keine regelmäßigen Muster der Organisation von überzeugungs-systemen feststellen lassen.
3. Die Organisation eines Überzeugungssystems kann sicJr (infolge eines hier nicht wei-
ter zü analysierenden Zusammenspiels von kognitiven und affektiven Faktoren 27)
durdr Flexibilität oder durcl Starrheit auszeic}nen; dies findet seinen Niederschlagu. a. in einem mehr pragmatischen oder mehr doktrinären "Stil" des politischen Ver-haltens. Starrheit eines Uberzeugungssystems kann Polarisierung begünstigen und Kon-
sensusbildung erschweren 28.
a. Schließlic} kann die Stabilität der Organisation eines überzeugungssystems in der
Zeit varäeren 20. Offenbar besteht eine positive I(orrelation zwischen Konsistenz und
2a Hierzu und zum folgenden vgl. insbesondere Philip E. Conver,se.' "The nature of beliefsystems in mass publics", inz Daaid, E. Apter (Ed.): Ideology and discontent (1964), S. 206-261.25 Vgl. dazu aud-r Robert A. Dahl: Ideology, conflict and consensus, Notes for a theory. Inter-national Political Science Association, Seventh World Congress, Brussels, 18-23 September 1962(vervielfält igt), S. 3. - Converse (a.a.O., S. 245 f.) unterscheidet " issue publics" je nach demUmfang der von den individuellen überzeugungssystemen umfaßtcn Problembereiche.28 Converse (a.a.O., S. 207) bezeichnet diesen Zusammenhang - im Ansdrluß an'Wendell R.Garner - als "constraint", womit eine ufunktionel le Interdependenzu oder " interrelatedness"
der Elemente eines Überzeugungssystems gemeint ist: "Constraint" l iege dann vor, \ \ 'enn manaus der Kenntnis einer spezifizierten Einstellung eines Individuums bei diesem mit einiger Wahr-scheinlicl-rkeit auf andere gleichzeitig vorhandene Ideen oder Einstellungen schlicßen könne. DerGrad, zu dem "constraint" vorhanden ist, sei grundsätzl ich meßbar. (Diese Definit ion ist sta-t isch; über dynamische Aspekte von "constraint" vgl. ebda., S. 208.)" Ygl. dazu Dahl, a.a.O. (Anm. 25).28 \(ird, wie dies mitunter geschieht, Ideologie als ein starr organisiertes überzeugungssystemverstanden (eine u. E. unzweckmäßige Einengung des Begriffs), dann kann zunehmende Flexibi-lität von Ideologien auch als "Entideologisierungo interpretiert werden. Sie kann auch zuideologisdrer Konvergenz führen, d. h. zum Abbau von Polarisierung, und dies wird wiederumvielfach als uEntideologisierung" gedeutet. \7eder in dem einen noch in dem anderen Zusam-menhang kann diese Vokabel zum klaren \rerständnis der Phänomcne beitragen.tn Vgl. dazu Conperse: The nature of bel ief systems... , a.a.O., S. 238 ff . - Pb;l ip E. Converseund Georges Dupeux. '"Pol i t ic izat ion of the electorate in France and the United States", in:POQ 26 (1962), S. 17, verwenden auch dcn Ausdruck "crystallization of opinion".
Struhturen ideologisüer Konflikte bei Parteienanttbewerb
Stabilität von Uberzeugungssystemen 30. Geringe Stabilität der Uberzeugungssysremekönnte aber wiederum einen (höchst instabilen) Sdreinkonsensus vortäuschen, weil sichkeine Polarisierung feststellen läßt 3r.
2. Objektdimensionen,z)o,7 Konsensus/ DissensusBesonders uneinheitlich ist der Sprachgebrauch in der Literatur hinsidrtlich dessen, wasman als dasObjehl von Konsensus versteht s2.Ganz grob lassen sich die folgenden Be-deutun gen unterschieden :
2.1. Problemhon sensws und, Fundarnentalkonsensws
Zwar impliziert das Konsensuspostulat, daß in der Demokratie Dissensus zumindesthinsichtlic} politischer Problemalternativen bestehe. Aber in der politischen Publizistikund in der wissenschaftlichen Diskussion wird nicht selten zumindest ein Minimurn anProblemkonsensus (issue consensus) als funktionsnotwendig bezeidrnet 33. Das so for-mulierte Postulat kann sich mitunter auch auf spezifisdre Problembereiche (isswe areas)beziehen, beispielsweise auf die Außenpolitik. Und in einer empirischen lJntersuchungkönnte man das Maß an Konsensus in versdriedenen Problembereichen vergleichen 3a.
Dies kann auch unter der Fragestellung gescJrehen, inwieweit die Verteilung der Ein-stellung zu versdriedenen Problemalternativen eindimensional oder mehrdimensionalist 35.
Ein verwandter Begriff ist d.er des Fundamentalkonsensus, worunter hier die Vorstel-lung verstanden sei, daß es für die Stabilität des demokratischen Systems der überein-stimmung bezüglich der "Spielregeln" des Konfliktaustrags, also über grundlegendeVerfassungsnormen, bedürfe 36. Man kann als Fundamentalkonsensus auch die über-einstimmung vrichtiger Bestandteile der ideologischen Wertsysteme ("Symbole" imSinne von Lassw'ell) auffassen. Eine verbreitete Version des Konsensuspostulats will,daß der Fundamentalkonsensus einerseits, Problemkonfl ikt andererseits, für die gleich-zeirige Gewährleistung von Stabilität und Dynamik der Demokratie erforderlich
30 Converse; The nature of bel ief sysrems . . . , a.a.O., 5.239.31 Nach Converse, a.a.O.,5.242 ff . , lassen sich die Antwortsequenzen übcr gegebene Zeit-räume hinweg bei den weniger gebildeten Befragten statistisdr nur als Zufallsverteilung inter-pret ieren.32 lvlitunter selbst bei einern Autor, wie z.B. Rudolt' Wildennanz, Maclt und Konsens als Pro-blem der Innen- und Außenpolitik (1963).33 Hierher wäre etv,'a die verbreitete Vorstellung zu rechnen, daß die Prinzipien der Privat-initiative und des Vettbcwerbs in der \WirtscJraftspolitik von allen Parteien im Grunds atz be-jaht werden sol l ten.3a Das geschieht insbesondere in der wichtigen Arbeit von Herbert McClosley, Pawl ].Hot'f-mann und Rosemary O'Hara.' "Issue conflict and consensus among party leaders and followers",i n : APSR 54 (196A) ,5 .4A6-427 .35 Dies is t das Problem der oben (Anm. 16) z i t ier tenof bel ief systems . . . , a.a.O., S. 245 f . ) weist für d ieblics" nad-r.36 Wildenmann: Maclt und Konsens, a.a.O., S. 68" Verfassun gskonsens ".
Arbeit von S/o/ees. Converse (The natureUSA eine überschneidung von "issue pu-
ff. u. ö., spridrt in ähnlichem Sinne von
291
292 Gerhard. Lebrnbrucb
seien 37. Als Gegenbegriff zum Fundamentalkonsensus kann man das Konzept der
,rEntfremdung< gegerr"fib.. dem politischen System ansehen, wie es neuerdings verschie-
dentlich in der empirischen Forschung rezipiert worden ist 38.
2.2. Autori tätskonsensus
Eine andere Version des Konsensusbegriffs weist sachlidre Beziehungen zur Vorstellr'rng
vom Fundamentalkonsensus auf, auch wenn sie - strenggenommen - auf eine Äquivo-
kation beruht: Man könnte dies den Autori tätskonsensus nennen. Im Englischen wird
hier gerneinhin nicht vorl >consensr|s< gesprochen, im Sinne von Übereinstimmung über
Auffässungen (wie etwa beim Begriff des ,consensus otnniveTTTn in dem auf die Stoa
zurückgeh.rrd.r, Gottesbeweis), sondern von "consent", als 'Zustimmung" der Indi-
viduen zu Autori tät und zu Akten der Autori tät se. Bekanntl ich ist dies ein Zenttal-
begriff der Loclee.schen \zertragstheorie und dann auch der amerikanischen Unabhän-
gi ik. i trerklärung, und da bei Locke mit dem "consent" der Mehrheit zugleich der
,,consent" al ler Autori tätsunterworfenen f ingiert wird, impliziert der Begrif f hier zu-
gleich einen fiktiven consensus omniuma0. Das läuft aber auf "tacit conscnt" oder
;implied. consent" hinaus (Hume) und ist empirisdr problematisdr. Infolgedessen ent-
halten auch manche Versuche, aus der Stimmabgabe der wähler auf Autoritätskonsen-
sus zu schl ießen, eine peti t io principi i , oder stel len gar eine bloße Definit ion des Vahl-
aktes ohne Inforn1"t i l r1rg.h"l t dar. Die Wählermotivationen implizieren ja nicht not-
wendig auch Zustimmung zum poii t ischen Systen-i oder zur etabl ierten Ar-rtori tät; Inter-
pretat lonen dieses Sinnes sind nichts weiter als f ikt ive Zurechnungen'11. Daher kann
Autori tätskonsensus als empir ische Din-rension unseres Konzeptes nur unter der Bedin-
gung eingeführt werden, daß .r sich um expl izi ten Konsensus handelt, der als solcher
ä-frrir.lr" erhoben werden muß a2, und zwar - hier liegt der wichtigste unterschied
,u, Lorkrschen l(onstruktion - auch bei der unterlegenen Minderheit'
2.3, Ein mebrdimensionaler Konsenswsbegrilf
Die genannten Spielarten des Konsensusbegrif fs, also Minimalkonsensus' oder unimo-
dale v.. t . i lung von Präfe renzen, dann der Problem- oder Fundamentalkonsensus, und
s7 Der Begrif f des "agrecmcnr on fundamentals" in dem Sinne, * ' ie ihn Carl J ' Friedrich w-ie-
derholt kr i t isch.rört. i r hat (vgl. u. a. sein: The new bel ief in the common man,1912, S' 123 ff ' ) ,
ist sehr viel v 'eiter gefaßt, urid tatsachl ich vri l l Friedrich das Konsensuspostulat eben auf dic
übereinstimmung uü.. Spi. lregeln reduzieren (a'a'o., S. 185; vgl. auch ders': Man and his
government , !963, S. 237 f .38 Siehe bes. Robert E. Lane: Pol i t ical ideology, Vhy the American common man bel ievcs s'hat
he does (1962),S. 161 ff . u. ö.; Murray B. Lcö' in: The al icnated voter, Pol i t ics in Boston ( i965)'
se Vgl. äazr: 'C. W. Cassinel l i : "The 'consent' of the governed", in: \Testern Poli t ical Quar-
rcrly-,12 (L959), S. 391-4c9. - 'Wildenmann: Madtt und Konsens, a.a.o., S' 1, Anm' 4, * ' i l l in
diesem Sinne Konsens als ,Zustimmung durch pol i t ische Vil lensakte" definieren'a0 Vgl. dazu die Konrroverse im Anscliluß an Willmoore Kendall: John Lockc and the doctrinc
of -äjority rule (Ig4I); zuletzr Martin Seliger: The liberal politics of John Locke (1968)'
s . 75 f f . , s .294 f f .al So auch Cassinel l i ,a.a'O., S. 393 ff .a2 So interpr.ti...r, Morrii Janowitz lnd, Dutaine Marttick: Competitiv-e pressure and demo-
cratic consenr (1964\t,S.95, die \Tahlen als einen möglicben "process of consent": Sie fragen,
ob es sich in der Tat äarum handle, oder vielmehr um 'Manipulation"'
S truktaren ideologischer Konllikte bei. P arteienuettbewerb 293
sdrließlich der Autoritätskonsensus, brauchen sidr natürlich nicht gegenseitig auszu-scJrließen; empirisch kann man sie vielmehr ais Dimensionen eines komplexen korrr..-susbegriffs ansehen, die sich, wenn man sie operarionalisierte, zu einem Bündel vonIndikatoren für Konsensus (im weiten Sinne) zusammenfassen ließen. Damit ist nochtricht unterstellt, daß sich diese Dimensionen empirisch als kovariant erweisen müßten;wir werden sehen, daß Problemkonsensus und Fundamentalkonsensus unter Umstän-den gegeniäufig sind.
3. Hypothesen über Elitenkonsensus3.1. Bildungsniveau und politiscbe Partizipation als Bedingtmgen d,er KonfliktstrwhturNeuere empiriscfie Untersuchungen haben in bezug auf die \(ählerschaft in den USAdie verbreitete Version des Konsensuspostulats problematisch gemacht, daß funktionie-rende Demokratie einen starken Fundamentalkonsensus bei (zumindest begrenztem)Problemkonflikt voraussetze. Denn einerseits scheint bei der amerikanischen \Wähler-
schaft (trnd ähnlich wohl auch in der BRD) über die Parteigrenzen hinweg ein starkerProblemkonsensus zu bestehen as.
Andererseits zeigt sidr zwar sehr hoher Fundamentalkonsensus, solange man die Zu-stimmung zu ganz allgemein formulierten Grundsätzen der liberaldemokratischenTheorie mißt aa; aber sobald spezifisdre Folgerungen für die Anwendung dieser Sätzegezogen werden sollen, bridrt dieser - sozusagen katechismusartig formulierte - Kon-sensus in sich zusammen 45.
Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man entweder politisch stärker engagierte Indivi-duen oder Individuen mit höherer Sdrulbildung befragt. Als ersrer hatte Stout't'er ge-zeigt, daß "liberaleu Einstellungen (im Sinne der amerikanischen Bürgerrechtsdiskus-sion) bei ,contmunity leaders" im allgemeinen stärker verbreitet sind als bei der Ge-samtheit der Befragten, m. ä. V., daß diejenigen, die auf Gemeindeebene gesel lschaft-l iche Führungsposit ionen innehaben, fundamentale Bürgerrechte stärker befahen als dieMasse der Wähler as. Die folgenden Untersucfiungen haben dies bestätigt: Bei personen
as Für die USA vgl. McClosky/Hot't'mann/O'Hara, a.a.O,Hinweis bei Erwin K. scheuch.' uDie sidrtbarkeit politischerhalteno, in: Erwin K. Scbeuch und Rwdolf 'Wilienmann:
S. 418 f. ; für die BRD u. a. denEinstellungen im alltäglichen Ver-
Zur Soziologie der \7ahl, S. 213,Annr. 40.aa Zum folgenden vgl. insbesondere Prothro/Grigg, a.a.O.,sowie Ke1' , a.a.O., S. 51 f f .
und McClosky, a.a.O. (s. Anm. 5),
a5 Die einsd-rlägigen Ergebnisse von Prothro/Grlgg, die lediglich Konsensus über die Rechte derMehrheit und der lüinderheit gemessen haben, wurden von McCIosÄ7 bei der Untersuchungmehrerer Dimensionen im wesent l ichen bestät igr : abstrakte Formul ie iungen über Rede- unJMeinungsfre ihei t werden von den Vählern stark bejaht , spezi f isd-re AnwÄdungen in ger inge-rem Maße; grundlegenden polit ischen ,Spielregeln. 5siplrnt eine berrächtliche Mehrheit der Wah-lcr zu, doch kann nicht von ausgeprägtem Konsensus gesprochen werden; bei Aussagen überpolit ische, gesellsdraftl idre und rassische sowie wirtschaftl idre Gteichheit der Rechte eibi es star-ken Dissensus.a6 samuel A. stouf fer . 'communism, conforrn i ty and c iv i l l iber t ies (1955).a7 Dies is t d ie entscheidende Var iable bei Prothro/Gr igg, a.a.O.; vgl . besonders den Hinweis,daß sie stärker diskriminiert als regionale und EinkommensunterschiJde (S. 28Z ff.).
294 Gerhard Lehmbradt
mit höherem Bildungsniveau a? und bei aktiven Parteimitgliedern a8 ist der Fundamen-
talkonsensus im allgemeinen stärker ausgeprägt, audr über Formulierungen, welche diespezifische Anwendung der Fundamentalsäve betreffen. Andererseits sind die Partei-
aktivisten in den USA stärker polarisiert in bezug auf politisdre Problemalternativen,d. h. Republikaner und Demokraten untersdreiden sic} (entgegen einer verbreiteten
Annahme) nach ideologiscJr motivierten Präferenzen deutlicl voneinander ae.
Das läßt sich erklären, wenn man dieselben Variablen mit den Strukturdimensionender Überzeugungssysteme in Beziehung setzt. Conaerse hat gezeigt, daß deren Infor-
mationsgehalt und Konsistenz mir abnehmender Sdrulbildung rückläufige Tendenz
aufweist 50; zudem ist audr die Stabilität der Uberzeugungen entspredrend geringer 51.
"Ideologeno in unserem Sinne ö2 sind also tendenziell besser gebildet. Das erklärt sidr
zunädrst natürlidr aus der zugleich mit dem Bildungsniveau wachsenden Fähigkeitintellektueller Artikulation. Sie hat einerseits zur Folge, daß dort, s/o es urn die spezi-fische Anwendung demokratischer Fundamentalsärze auf konkrete Fälle geht, der lo-gische Zusammenhang mit abnehmendem Bildungsniveau weniger einsichtig ist, so daß
der Fundamentalkonsensus (unterhalb der Ebene der staatsbürgerkundlichen Schul-
buchweisheiten) schwadr ist. Andererseits aber werden mit niedrigerem Bildungsstand
auch die Konsequenzen der ideologisclen Grundeinstellungen für politische Handlungs-
alternativen weniger deutlich gesehen, so daß sicJr hier bei den'!flählern tendenziell eingrößerer Konsensus zeigt als bei den "Eliten" (im Sinne höherer Schulbildung oder
stärkeren politischen Engagements) 53. Oder präziser: Es werden nicht etwa ideolo-gisdre Grundeinstellungen weniger konsequent in konkrete Präferenzen umgesetzt, son-
dern es ist von vornherein ein nidrtideologisdrer Bezugsrahmen vorauszusetzen. Venn
z. B. republikanische Wähler in den USA in sozialpolitischen Fragen weiter links (und
näher bei den demokratisdren \7ählern) stehen als republikaniscJre Parteiaktivisten 5a,
dann liegt das offenbar nidrt an einer stärker konsensuellen ,ideologis*reno Orientie-
rung, sondern daran, daß die Wähler mehr von Selbstinteresse als von Icieologie moti-viert sind s5. Es verhält sidr also, wie Converse deutlich gemadrt hat, nidrt etwa so, daßnungebildete" Wähler einen bei ihnen vorhandenen icleologischen überzeugungszusam-
menhang bloß nicht zu art ikul ieren vermögen; vielmehr nehmen sie den logiscJren odergeseilschaft l ich-historisclen Zusammenhang versdriedener überzeugungen gar nidrt
v'ahr 56.
a8 McClosby hat in seinen beiden hier herangezogenen Arbeiten (Issue conflict and consen-sus... , s. Anm. 34, und: Consensus and ideology, s. Anm.5) einen \7ählerschaftsquersdrnit t undein Sample von Delegierten der republikanisc}en und demokratisdren Parteikonventionen ver-glichen, denen der gleicie Fragebogen vorgelegt worden war.as McCloshy/ Hoft 'mann/O'Hara,a.a.O., S. 410 ff .50 Converse: The nature o f be l ie f systems. . . , a .a .O. , S.213 f f .5r Converse,a.a .O. , S.238 f f . ; vg l . audtConaerse/Dupeux: Pol i t ic izat ion. . . , a .a .O. , S. 16 f f .52 Converse arbeitet mit einer sdron in "American voter" (Campbell u. a., a.a.O.) verwendetenSkala der uideologisdren Sensitivität".53 So argument ier t überzeugend McClosh?. 'Consensus and ideo logy. . . , a .a .O. , 5 .372 f .5a McCloshy/Hoffrnan/O'Hara, a.a.O., S. 419.55 Campbell ,t. a., S. 205 f. - \(lir verwenden hier, wie schon gesagt, nicht den funktionalenIdeologiebegriff (im Sinne der ideologiekritisdren Reduktion auf Interesse), sondern einenstrukturell-deskriptiven. 56 Conaerse, a.a.O., S. 227 ff.
strukturen ideologischer Konfrikte bei parteienwettbewerb295
Ein weiteres kommt hinzu: Politisch stark Engagierte (also z. B. parteiaktivisten) er-werben durdr ihr politisches Engagement i- ailg"rrreinen einen ausgeprägteren ideolo-giscJren Bezugsrahmen für die ,Definition der S-ituation.,. Dabei dürfte der Sozialisa-tionsprozeß in politischen organisationen, durch den die Individuen mit den organisa-tionszielen und mit den Überzeugungssystemen der ideologisch stark artikulierten or-ganisationsführer bekannt werden, eine wichtige Rolle spielen. so erlernen die Mitglie-der komplexere Überzeugungssysteme, sie internalisieren srärker die demokratischenFundamentalnormen und können diese eher auf konkrete Fälle in konsistenrer weiseanwenden, und zugleich beziehen sie stärker artikulierte und differenzierte positionenin bezug auf politisdre Handlungsalternativen. Da im übrigen, wie vielfach nachgewie-sen wurde, Bildungsniveau und politische Partizipation stark positiv korrelieren, kannman annehmen, daß bei Individuen mit gehobener sctrurbildung 57 die Artikuriertheitund Konsistenz der Überzeugungssysteme vielfach noch durch größeres politisdresEngagemenr verstärkt wird b8.
3'2' Kont'liktstruktwren bei wäbler-Etiten-Dichotomisierung im vergleicb politis&erSysteme
Alle bisher referierten untersuchungen srammen aus den usA, und man könnte vermu-ten' daß die dort beobachteten Konfliktstrukturen nicht allein durcü solche Faktorenwie die unterschiedlicle intellektuelle Artikulationsfähigkeit von ,,Eliteno und ,Mas-sen> zu erklären sind, sondern auch aus eigentümlichen kulturellen und institutionellenRahmenbedingungen des politischen Systems. Es wäre also zu fragen, wie sich die Kon-fliktstrukturen darstellen, wenn nran im internationalen vergleich den systemischenRahmen variiert, dabei aber den charakteristischen Ansatz dieser untersuc{rungen bei-behält: also die dichotomische Erhebung von Einstellungen und überzeugungssystemender politisch Engagierten oder der Individuen mit höherem sozialen Status einerseits( 'El i tenu im Sinne eines deskript iven Konzepts), cler gesamren vählerpopulat ion(oder aucl nur der nNichtelitenu) andererseits. D.nn man wird jedenfalls nicht schonaus den angeführten amerikanischen IJntersuchungen verallgemeiner.rd folgern können,daß etwa der Fundamentalkonsensus der E,l i ten . in fu. demokratiscJre systeme generel lkennzeichnendes Phänomen sei.Der naheliegende Vergleichsfall ist Frankreich, denn nach einer verbreiteten Auffas-sung ist die französische wählerschaft stark polarisiert re. Die wahlökologische For-sdrung der Siegt'riel-Schule hat die Hypothese einer Rechts-Links-polarisierung der\rählersdraft axiomatisch ihren untersuchungen zugrunde gelegt, und man hat mit-
57 \ilie sie Prothro/Grigg untersuchr haben.5e Vgl' dazu audr die Ergebnisse der Untersuchung über einen provinzialverband der italie-nischen sozialistischen Paitei bei samuel H. Barnä:-i;;ry democracy, politics in an Italiansocialist federation (1967)' s. 165: Hohe id.eologisch" i*r;,;rr;,ät (im 6ir;; l;. von campbellu' a'' a'a'O'' und Converse, a'a.O., verwe.ndeten"idcologischen Sensitivitätsskala) findet sidr bei
;:ttffi:I-N{itgliedern, die zugleich höheres nifarrgr".il,r^, ood, hohes partizipationsniveau
ut vgl' z' B' Frangois Go-guel; La politique des paruis sous la Troisiäme Rdpublique (1946),S.25 ff.; Jacques Fauoet: La France dddriide figsil.
296 Gerbard Lebrnbruch
unter von einem generarionen-, wenn nicht jahrhundertealten Gegensatz dieser beiden
fundamentalen Orientierungen gesProchen 60.
Nun läßt sich das zumindest für die Gegenwart empirisch nidrt ohne weiteres bestäti-
gen. Das zeigt u. a. die SoFREs-Untersuchung über politische Orientierungen bei fran-
zösischen \flählern und politisch aktivierten Individuen ot, die von der Annahme einer
eindimensionalen Rechts-Links-Verteilung ausgeht und diese als ein Kontinuum behan-
delt, das sich in fünf ,politische Familien.. 62 unterteilen ließe. Die an Hand der Selbst-
einschätzung ermittelte Verteilung der \Wähler ist nun nicht etwa bimodal, wie man
auf Grund der überlieferten Common-Sense-Hypothese erwarten müßte; vielmehr
haben wir es deutlidr mit einer unimodalen Verteilung zu tun. Anders sieht es aus,
wenn man den Anteil der politisch stärker partizipierenden Individuen betrachtet: Er
wird um so höher, je mehr man sich den beiden Enden des Rechts-Links-Spektrums
nähert Gs; rechnet man die Daten entspredrend um, so wird jedenfalls die unimodale
Verteilung abgeflacht (siehe Tabeile) 6a:
Extreme Linke Zentrum
Linke
Rechte Extreme Keine Summe
Rechte Antwort
o// o
o// o
o // O
1 073 1 0
o// o
1,5
o//o
36
o//o
7 6
o//o
100\7ähler-querschnitt
Aktivisten
Dieses Resultat Iäßt zunächst den Schluß zu, daß die Polarisierung der öffentlichen
Meinung in Frankreich ein Elitenphänomen ist, kann aber mit den zuvor dargestellten
Konfliktstrukturen in den USA nur schwer verglidren werden. Explizit geschieht dies
in cler Untersuchung von Converse und Dupewx .über die Polit isierung der \fähler-
schaf t in beiden Ländern Gs. Ihr zufolge s ind zwar in beiden Ländern die 5 b is 7 0/o
polit ischer Aktivisten (Mitglieder von Parteien und Besucher von mehreren Vahlver-^r"rr,-1,r1gen)
in ihrer Einstellung deutlicher polarisiert und weisen eine größere Stabili-
8o Gogue l , a .a .O . , 5 ,17 f f .6r Eieric Deuticb, Denis Lindon wd Pierre Weill: Les familles polit iques aujourd'hui en
France (1966).62 Dieser: Bejr i f f geht auf AlbertTbibeudet: Les iddes pol i t iques de la France (1928), zurück.
6s Dies dürfte, daPartizipation mit Intensität der polit ischen Überzeugungen positiv korreliert,
e in Beispie l für d ie *ei t . i oben erwähnte gegenläuf ige Tcndenz der Verte i lung von Extremität
und Intensi tät pol i t ischer Einstel lungen sein (vgl . Anm' 7) '6a Nach Deuts ih/L ind.onl 'Wei l l , a.ub. , S. 14 und 18 (Tab. 1 u.3) . - Die Autoren haben übr i -
gens die b imodale Verte i lung bei der \7ählerschaf t mi t Hi l fe e ines f ragwürdigen Kunstgr i f fs zu
i.rr.n versuchr, indem sie beim Zentrum (aber nicht bei der Linken trnd Rechten) die nicht
Part iz ip ierenden el iminier t und mit den Antwortverv 'e igerern zu einer I (ategor ie omaraisu zu-
,u-nr"ng. faßt haben, so daß nur d ie part iz ip ierenden 9 0/o Zentruntsanhänger in der Mi t te
übr igble- iben, gegenüber 32010,marais. . Aber eben dessen Existenz macht natür l ich die An-
,rahÄ. . in. . särk.n Polar is ierung der Vählcrschaf t problemat isch.s5 Phihp E. Con,uerse und Geor{es Dupeux: Polit icization of the electorate in France and the
Uni ted States, a.a.O., S. l -24.
1007 31,7301 921
s truk t ur e n id e olo gis dt e r K onf lih t e b ei p ar t e ienarc t tb ew e rb 297
tät der Einstellungen auf als der jeweilige \üählerquerschnitt. Im internationalen Ver-gleich dagegen sind wohl die Einstellungen der fraizösischen Wähler nicht nennenswerrstärker polarisiert und stabil als die der amerikanischen Vähler; hingegen sind diefranzösisdren Aktivisten denen in den USA an Polarisierung und Stabilität der Einstel-lungen deutlidr überlegen. Dabei ist die Polarisierung der französischen Aktivisten anlausgeprägtesten in der Frage des uKlerikalismus.,, und obwohl die Untersuc6ung siclrhinsichtlidr der analysierten Konfliktdimensionen nur schwer mit den Studien vonHerbert McClosky vergleidren läßt, hat es doch den Anschein, als ob gerade der Fun-damentalkonsensus bei den französischen Aktivisten relativ schwach entwickelt ist.Bei aller VorsicJrt, die angesichts der unterschiedlichen Anlage der hier herangezogenenUntersuchungen geboten ist, scheint also der Sclluß zulässig, daß in der Tat die Wäh-ler-Eliten-Didrotomie für den Vergleich der Konfliktsstrukturen in verschiedenen Na-tionen fruchtbar gemadrt werden kann 66. Allerdings werden wir einige Differenzie-rungen einführen müssen. Sdron das statische Moment in dem Verfahren einer solchenDiclotomisierung wirft eigentümliche Probleme auf: Aus der empirischen Wahlfor-schung ist ja der ,Aktivierungseffektu des wahlkampfes verrraut ut, und wenn polari-sierung abhängig ist vom Maß des politiscJren E.,gagemenrs, dann liegt die Folgerungnahe, daß sie mit diesem in der Zeh variiert. Das ftitot zu dem SchlußJdaß der Ansatzum den dynamischen Aspekt der Vähler-Eliten-Kommunikation erweitert werden muß.
3.5. Prognostisclte Probleme der Kont'liktstruhturenbei der w e st deuts ch en W ählersch at' t
Zunächst sei jedodr danuf aufmerksam gemacht, daß sich aus den bisher entwicheltenHypothesen gewisse Folgerungen für die Analyse und Prognose des wählerverhaltensin der Bundesrepublik Deutschland ergeben könnten. Nadr einer verbreiteten Vorstel-lung war die deutsche Vählerschaft in der Vergangenheit durch starke polarisierunggekennzeichnet, sei es als polymodale Verteilung d., Einrt.llungen, die ihren Nieder-scJrlag in einem Vielparteiensystem fand 68, sei ", als bimodul. V.rt.ilung zu dem Ge-gensatz von Sozialdemokratie und ,Bürgertup.,, während die Entwickiung des par-teiensystems in der BRD durch einen zunehmenden Abbau dieser Gegensätze gekenn-zeichnet sei. Eine Verstärkung dieser Bewegung wird oft für wünschÄr*.r, gehalten,und als hierfür geeignetes sozialtechnologisdres Instrument wird von Teilen der Offent-lic}keit und der Sozialwissensdraft insbesondere eine wahlreform angesehen. Dabeibegegnen beide weiter oben erörterten Hypothesen über den Zusammenhang vonN{ehrheitswahl und Konsensus: Einerseits wird gelegentlich nur behauptet, daß ein
66 uEliten" hier immer als deskriptiver Begriff, der die ganze Sdricht der politisch Engagiertenumfaßt, also nicht bloß udecision-makers.,.87 So zuerst Paul F. Lazarsfeld, Bernard. Berelson und Hazel Gaud.et: The people,s choice,How the voter makes up his mind in a presidential campaign (194g2), 5.73 ff .; vgl. auch Key,a.a .O. , 5 .267 f f .08 \ilie sclon weiter oben angedeutet, wäre es vielleicl-rr ridrtiger, das Vielparteiensystem alsÜberlagerung mehrerer Dimensionen mit bimodaler verteilung ier'Einstell";;;" zu erklären.
298 Gerhard Lehmbradt
,mehrheitsbildendes '\üahlrecht.,
konsensusfördernd wirken würde 69. Andererseits
wird jedoch von vielen Anhängern einer Wahlreform anerkannt, daß ein funktionie-
rendes Mehrheitswahlredrt bereits eine Verstärkung des Konsensus voraussetze, inso-
fern sich nicht mehr festgefügte und stabile weltanschaulidre Blöd<e gegenüberstehen
dürften, sondern bei einem nennenswercen Teil der \(ählerschaft die Bereitschaft zum
parteiwechsel bestehen müsse 70. Daraus ergibt sidr dann die Frage, "inwieweit unser
parteiensystem in den Augen der Wähler heute nodr soziale Antagonismen und Klas-
sengegenrä tze oder bereits einen Konsensus der Gesamtgesellsdraft über die unserer
Verfassung zugrunde liegenden \Tertvorstellungen widerspiegelt" 71'
Als InstrÄ..ri für. die Messung eines soldren Konsensus verwenden die Autoren der
uKölner Vahlstudi e 196to ?2 die Messung der Parteidistanzen mit Hilfe des Sympa-
thieskalometers ?8. Eine Panelbefragung ftir die Monate Juni-September-November
1961 hat eine ,hohe Bewegungsrare< für die Distanzen zwischen der SPD und den
,rbürgerlichen.. Parteien ergeben, die nach der Ansidtt von Kaase die "vorsichtige
Schlußfolgerung<( nahelegt, daß das politische System nur in geringem Maße polarisiert
ist (im Sinne einer ,,fixierten wechselweisen Ablehnung einer Partei") und demzufolge
,rein Wechsel zwisc6en den großen Parteien im wesentlidren möglidr" erscleint 74. Die
Entfernungsbeziehungen zwischen den Parteien seien aber nicht nur kurzfristig (näm-
lich im Zeitraum der Panelbefragung) instabil, sondern darüber hinaus lasse sich, wie
andere Autoren mitteilen, seit 1959 eine zunehmende Verringerung der Distanz zwi-
schen CDU und SpD feststellen 7b. Daraus wird dann oft die sozialtechnologische Fol-
gerung abgeleitet, daß eine .üZahlreform zu einem funktionierenden alternierenden Re-
!;.r,rrigsyrtem führen könne, das insbesondere auch die Chance für einen Machtwedr-
r.1 ,rg""rten der bisher in stetiger Minderheitsposition verharrenden SPD böte 76.
os Vgl. Anm. 13. - Kri t isch zu diesem Argument u. a..Erzain K. Scheuch.'"Die Bedeutung so-
ziale"r Faktoren ftir die wirkung von \Tahlsystemen<, in: Horst Zillefien: Mehrheitswahlrecht?
Beiträge zur Diskussion um die Anderung des wahlrechts (1967), s. 68.z0 Von diesem Postulat her argumenti.r i z. B. das Gutadrten: Zur Neugestaltung des Bundes-
tagswahlrec|ts. Bericht des lro- Bundesminister des Innern eingesetzten Beirats für Fragen der
\üahlredrtsreform (1968), S.2t f .7r Max Kaase: Wechsel 'von Parteipräferenzen, Eine Analyse am Beispiel der Bundestagswahl
196l (1967), S. 74 f. - Daß Fundamentalkonsensus und soziale Antagonismen einander aus-
schlössen, *i. di.r" Antithese unterstellt, ist im übrigen zumindest eine problematisdre Ver-
einfadrung.72 S. Scheucb/Wildenmann: Zur Soziologie der
'$üahl, a'a'O'7s Kdase, a.a.O., S. 75. Vgl. auch oben, 5.287.7a Kaase, a.a.O., S. 101 ff .zs Rudoit'
'Wilien'mann in: tlnbelbach/Wild.enmannlKaltet'Ieirer, a.a.O', S. 158 f'; Rudolt
Wildenmann.. Parteien-identi f ikat ion in der Bundesrepublik, a.a.O., 5.239 ff . (dort Daten für
196l,lg6s und 1967). Die Daten beiWolf gang Leiricb': Politik in einem Bundesland. Die Land-
tags*ahl vom g. lul i tsoz (1968), S.68 i i . , dle sich auf den Zeivaum von November 1961 bis
;oäily"ti 1962 bezieh..,, -ürr"n'als kurzfristige Bewegungen (wie in der von Kaase analysier-
ten Panel-Befragung) beurteilt werden.?0 Vgl. z. B. Erwiä' K. Srbrrslz; ,Der deutsche \(ähler und ein alternierendes Regierungs-
,yrr.ä*, in: Verfassung und Verfassungswirklidrkeit, Jahrbuch lg6T,Tell2,5' 204 f '
S tr uk t ur e n id e ol o gi s ch e r K on t' lik t e b e i P ar t e i e nax t t b earc r b 299
Nun fragt sich zunächst, ob diese Deutungen der Parteidistanzmessung zwingend sind.Kaase macht darauf aufmerksam, daß nodr nicht mit Sicherheit geklärt isr, wie unter-sdriedliche Parteidistanzen und Veränderungen zu interprerieren sind zz. Die Deutung,für welche er sidr entsclieden hat, kann allerdings eine gewisse vorwissenschaftlic}ePlausibilität beanspruchen; sie ist aber nicht empirisch voll erhärtet. Man könnte dem-gegenüber fragen, ob sic} die kurzfristige Instabilität von Parteidistanzen (wie sie inder von Kaase analysierten Panelbefragung gemessen wurde) nidrt audr einfadr auf dieoben erörterte Inkonsistenz und Instabilität der überzeugungssysreme bei zahlreichenWählern zurüd<führen läßt. Und was die längerfristigen Trends betriffr (wie sie fürdie schziger Jahre vorliegen), so liegt die Vermutung nahe, daß sie nidrt eigentlichveränderte Distanzen der Wähler zu den Parteien anzeigen, sondern die von den \(/äh-lern wahrgenommenen Veränderungen in den Distanzen oon Partei zu Partei wider-spiegeln 78, daß sie also mehr den Bewegungen des Parteiensystems - und insbeson-dere den Distanzen zwisclen den Parteieliten - folgen, als daß sie diese bestimmen. DasKonzept der Parteidistanz wäre dann ebenso wenig als unabhängige Variable zu be-handeln wie - möglicherweise - das Konzept der Parteiidentifikation 7e. Und es wäre,wenn man mögliche Entwid<lungen des
'Wählerverhaltens prognostizieren will, for-
scJrungsstrategiscJr vielleidrt sinnvoller, Parteidistanzen bei Elitepopulationen zu mes-sen statt bei VählerquerscJrnitren 80.
Diese Folgerung läßt sich auch von einer weiteren überlegung her begründen: Manmüßte, wenn der in den sechziger Jahren beobadrtete rüd<läufige Trend in den Partei-distanzen der Wähler tatsädrlidr eine langfristige Veränderung des deutsdren Parteien-systems anzeigt, für die Zeit der \freimarer Republik oder vor dem Ersten Weltkriegbeträchtlich größere Parteidistanzen als charakteristisch unterstellen. Diese Unterstel-lung läßt sich natürlich wegen der Eigenart des Instruments nicht empirisch überprü-fen. Sie ist aber audr in sozialhistorisdrer Perspektive problematisdr. Wenn sidr näm-lich, wie wiederholt betont worden ist, die Führungsgruppen zwisdren den verschiede-nen westlichen Industriegesellsdraften stärker untersdreiden als die jeweiligen Mittel-schidrten 81 oder
'lfählerquersdrnitte s2, dann liegt die Frage nahe, wieweit das etwaaudr im longitudinalen Vergleich gilt. Zwar kann man vermuten, daß die starke Ahn-liclkeit zwisdren den Überzeugungssystemen der Vählermassen, wie sie sidr beim inter-kulturellen Vergleidr zwischen westlidren Industriegesellschaft en zeigt, unrer anderemauf soziale und kulturelle Angleidrungsprozesse infolge der Industrialisierung zurüdr-zuführen ist; insoweit wären also eine stärkere Differenzierung in früheren Phasen die-
77 Kaase, a.a.O., S. 101. Zur Kritik vgl. Nascbold, a.a.O. (s. Anm. 12).78 Wildenmann: Parrcien-Identifikation in der Bundesrepublik, a.a.O., S. 244, teilt mit, daß'heuteo (wohl 1967) 30 0/o der \7ähler die CDU und SPD gleidr bewerren, gegen 15 0/o im Jahre1965. Diese Bewegung könnte wohl ein Reflex der durcJr die Große Koalition veränderten Per-zeption des Parteiensystems sein.7s Z'r dieser Problematik des Konzepts der Parteiidentifikation vgl. audr Wildenmann, a.a.O.,s . 268.80 Vorausgesetzt, daß sidr die Validität des Instruments überhaupt erhärten läßt.8L Erwin K. Scheucb; Die Sic}tbarkeit politisdrer Einstellungen im alltäglichen Verhalten,a.a.O., S. 209.82 Converse / Dupeux, a.a.O.
300 Gerbard Lehmbrudt
ser Entwid<lung und ein gewisser uEntpolarisierungstrendu wohl denkbar. \flenn aber
die Mutmaßung zutrifft, daß das beobadrtete Fehlen von ausgeprägter Polarisierung
bei der amerikanisdren oder französischen \7ählerschaft auf mangelnder Konsistenz
und auf geringer Stabilität der Uberzeugungssysteme bei vielen 'Wählern
beruht, dann
ließe sich andererseits vorstellen, daß bei diesen auch in früheren Stadien der gesell-
schaftlidren Entwid<lung ein solcher "Scheinkonsensus<< bestanden hat.
Dem steht nicht etwa der Umstand entgegen, daß manche historisclen Quellen für jene
Zeit einen starken ,rKlassengegensatz<< zwischen ,Bürgertumu und Arbeiterbösregung
zu belegen scheinen. Denn wie Gwenther Rotb wahrscheinlich gemacht hat, gab es da-
mals in den überzeugungssystemen der sozialdemokratisdren Arbeiterschaft ein inkon-
sistentes Nebeneinander von "linkenu und uredrten" Symbolen, und die nur partielle
und vulgarisierte Rezeption des Marxismus ging Hand in Hand mit der Anlehnung an
das kulturelle Wertsystem des Bürgertums 83. Die Stabilität der SPD-Vählerschaft zu
Beginn des Jahrhunderts und in der 'Weimarer
Republik beruhte wahrscheinlich viel
mehr auf ihrer starken Integration in verhaltensorientierenden Organisationen und
Primärbeziehungen als auf konsistenten und stabilen ideologisdren Überzeugungssyste-
men, und Träger der Polarisierung waren sidrerlich in erster Linie nicht die \üähler,
sondern die Parteiaktivisten 8a. Daher ist die Annahme eines stark rüd<laufigen Trends
in der Polarisierung auch nur für die letzteren, nidrt aber für die deutsdre \(ählerschaft
als ganzes plausibel.
Es kommt ein weiteres hinzu: Nimmt man nicht die Parteidistanz, sondern die erklärte
Bereitsdraft zur \Wahl anderer Parteien als Indikator für Konsensus,/Polarisierung,
dann zeigt sich (zumindest nodr ffr neZT eine auffallende Asymmetrie zu Lasten der
SPD: Nadr der ,Kölner \Wahlstudieu erklärten damals von den befragten CDU-\üäh-
Iern 38 0/0, daß sie niemals SPD, weitere 15 0/0, daß sie niemals SPD und FDP wählen
würden. Bei den FDP-\fählern betrugen die entspredrenden Zahlen 63 0/o (niemals
SPD) und 7 0/o (niemals SPD und CDU). Dagegen schlossen von den befragten SPD-'Wählern
nur150/o eine'Wahlentscheidung für dieCDUsowie 23olo dieWahl von CDU
und FDP aus 85. Das scheint darauf hinzudeuten, daß das "Klassenbewußtsein" auf
,bürgerlicher., Seite intensiver ist als bei den Anhängern der Sozialdemokratie. Diese
asymmetrisdre Intensitätsverteilung nun kann man aus zwei voneinander unabhängi-
gen Bedingungen erklären: Erstens hat, wie Con'uerse argumentiert, das Abnehmen
ideologischer Konsistenz bei den (vor allem der Untersdridrt angehörenden) Individuen
mit geringem Bildungsniveau zur Folge, daß die Wähler der olinken., Parteien im all-
gemeinen inkonsistenter in ihren politisdren Orientierungen sind als die \(ähler der
,rReclrten.. 8s. Zweitens sind die sozialdemokratisdr wählenden Arbeiter seit jeher in
einer besonderen Gegendrud<situation infolge des Einflusses konservativer Sozialisa-
83 Guenter Roth: The social democrats in imperial Germany, A study in working-class isolationand national integration (1963), bes. 193 ff . ,212 ff .8a Für dasselbe Phänomen in Rußland vgl. Lenin: \üas tun?as Leirich, a.a.O., S. 94.88 Converse, a.a.O., S. 248 f.
Struktaren ideologischer Konflikte bei P arteienwettbewerb
tions- und Kommunikationsinstitutionen 8?. Man kann annehmen, daß diese asymme-trische Intensitätsverteilung schon in der Vergangenheit für die Polarisierung der deut-schen Wählerschaft drarakteristisdr war, und muß die relative Stabilität der Sozial-demokratie in den Vahlen audr aus diesem Grunde mehr aus den organisatorisdren Be-dingungen des
'Sfählerverhaltens erklären als aus individueller Parteieneinsdrätzungi
Die linken Parteien mußten ihr Handicap dadurch ausgleicJren, daß sie Gruppenloyali-tät und organisatorisdre Kohäsion stärker betonten (Converse) 88.
Es ergibt sic.h der Sdrluß, daß ftir Prognosen über das deutsche'!7ählersystem Instru-mente wie die Parteiendistanzmessung allenfalls in Verbindung mit der Messung ande-rer, intervenierender Variablen zu vervrenden sind 8e. Ob diesem Erfordernis schondadurch Genüge getan wird, daß die Struktur der Primärbeziehungen in ,sozialökono-mischen \7ählerbereichen.. ermittelt wird, ist zweifelhaft e0. Der Vorwurf des struktu-rellen Determinismus, der dagegen erhoben wird, ist sidrerlidr begründer, wenngleichdieser Ansatz im Vergleidr zur bloßen Erhebung individueller Parteipräferenzen und-distanzen gewisse Vorteile zu bieten sdreint. Jedenfalls wird man für Aussagen überdie Funktionsfähigkeit eines Parteiensystems, etwa über die Mögliclkeit eines ,,alter-nierenden Rgierungssystems(, und die Chancen für Machtversdriebungen infolge vonVählerbewegungen, eine komplexere ForscJrungsstrategie wählen müssen als die bloßeAnalyse von Wählerquerschnitten el. Eine solche Strategie müßte unseres Eradrtenseinerseits die Konflikt- und Überzeugungsstrukturen bei verschiedenen Elitegruppenebenso analysieren, wie dies bisher sdron ftir die \flählerschaft gesdrehen ist, und siemüßte andererseits die Struktur der Kommunikationsprozesse sowohl zwisdren denElitegruppen als auch zwisclen Eliten und "Nidrteliten<< zu erhellen suchen 92. Diesezulerzt genannte Aufgabe aber wirft - wie im folgend en zv zeigen sein wird - Frage-stellungen auf, die in der bisherigen empirischen Forschung vielfach nur unzulänglidlerfaßt sind. Der Differenzierung bedarf insbesondere die \7ähler-Eliten-Dichoromie,nicht zuletzt irn Hinblid< auf ihre Rezeption in der neueren normariven (rrevisioni-stischen " ) Demokratietheorie.
87 Über die diesbezügliche Rolle von Schule und Kommunikationsmedien im kaiserlidrenDeutsd-r land vgl. Roth, a.a.O.,5.212 f f .88 Converse, ebda.8e Kaase vermerkt den modifizierenden Einfluß ,,sozialnormativer Bindungenu (Ifledrsel vonParteipräfe renzen, a.a.O.,S. 106).e0 Über diesen Ansatz vgl. Liepelt/Mitscherl ich,a.a,O., S.67 ff . ; dazu siehe meine Besprec}ungin: Frankfurter Al lgemeine Zeitung, 1. 11. 1968, sowie Naschold,, a.a.O.01 Die "Kölner \Tahlstudie" hat insofern über den Ansatz des "American voter" (CampbellIt. a', a.a.O.) hinausgehen wollen, als sie insbesondere den Prozeß des I7ahlkampfes sowie dieinstitutionellen Bedingungen in die Untersuchung einbezog. Die Integration dieser verschiedenenAspekte ist aber u. E. nicht recht geglückt, und zwar wohl gerade deshalb, weil die nadr der hiervorgetragenen Auffassung erforderlichen verhaltensanalytischen Zv'ischenglieder weitgehendvernadrlässigt wurden.sz Zu ähnlidren Folgerungen kommt audt Barnes; Ideology and the organization of conflict,a.a.O., S. 520. - Die Hypothesen, daß in der BRD heute schwächerer Problemkonflikt, stärke-rer Fundamentalkonsensus und eine zunehmende Bereitsdraft zum'$?edrsel von Parteipräferen-zen bestehen, werden durdr diese Erwägungen natürlidr nic}-rt ausgesd-rlossen. Es mag wohl sein,daß sie sidr mit einem komplexeren Forsdrungsansatz erhärten ließen.
301
Gerhard Lehmbrudt302
3.4. Elitenkonsensus als Element einer rel)isionistisdten Demokratietheorie
Die Ergebnisse der oben erörterten amerikanisdren untersudrungen haben einige Auto-
ren zu der Mutmaßung geführt, 'daß eine liberale Theorie der Eintradrt (concord)
durcrraus mit einer Theorie der politischen Eriten vereinbar sein könnte., e3. vielleicht
sei das Funktionieren des demokratisdren systems in erster Linie vom Konsensus der
Eliten abhängig, die durch ihre aktive Teilnahme an den institutionalisierten Prozessen
der politischen willensbildung stärker in den politisdren sozialisarionsprozeß hinein-
gezogerLwerden und darum die Fundamentalnormen in stärkerem Maße internalisie-
ren ga. Erst wenn ein nennenswertes Segment der upolitisdren schichtu dem system
entfremder werde, oder wenn innerhalb äer Eliten k.itt klares Einvernehmen über die
dem Sysrem drohrrrden Gefahren bestehe, könne die Stabilität fragwürdig werden e5'
Doch normarerweise sei expliziter Fundamentarkonsensus in der wählersdraft vielleicht
unentbehrlich; denn die Dissentierenden seien zugleich politisdr wenig engagiert' und
infolgedessen fügten sie sich in politische Entscheidungen, denen sie nicht zustimmen e6'
Insofern erscheint arso poritisÄe Apathie ars ein funktionales Äquivalent für Kon-
sensus.
Diese Konjekturen über Elitenkonsensus ars Bedingung politisdrer stabilität fügen sich
in einen größeren Zusammenhang ein, nämlidr jene neueren versudre einer "Revisionu
der klassischen Demokratietheorie gz, die, in Anknüpfung vor allem..an Schumpeters
bekanntes Theorem von der Demokratie als Elitenkonkurrenz se, die hergebrachten
partizipationspostulate der normativen politisdren Theorie in Frage stellen ge und
ss Eugen Burdick: "Political theory and the voting siudies"' in: Burdi&/Brodbe&' a'a'O''
S. 146; vgl. auch 6däord. Shi ls:"The concept of co.r i"nsus", in: International Encyclopedia of
the Social Sciences 3 (1968)' S' 261'nn Kry ,a .a .O. , S.51 i f . ; . r i l . f " rn . r Rober t A. Dabl : who governs? Democracy and power in
an Amcrican citY (1961), S. 316 ff 'ss DahI, a.a.O., S. 1iO'tl., Daztid. B. Truman' "The American system in c.risis"' in: Political
Science Quarterly 74 (rg5g), s. 4gr-4g;. vgt. r..n.r die ähnlicll F.agestellung bei James N.
Rosenau:..Consensus-building in the A-.ri.i ' national community, Some hypotheses and some
supporting data"' in: JoP 24 (1962)',5',639-661'se Burdich,ebda.; Dahl, a.a.o., s.3t+i Bem^ra n. Berelson, Paul F' Lazarst 'eld und wil l iant '
N. Mcphee..Voting, A study of opinion formation in a pr"si jential campaign (1954)' S' 314 ff '
s7 Zu dieser Vorrräti"rg-"i.r* .-pi.ir.h b"gründeten 'Revisionu der klassisdren normativen
Theorie s. insbes. Berelson u' a' ' a'a'O',5'322's8 Josepb A. Scburnpeter: CapitalismJocialism and democracy (L9544),5' 269 ff '
ee Siehe dazu j"rrr'peter Bicbrorb, Ti" ii.ory of democratic'elitism, A critique (1967)' Die
Betroffenen haben z. T. auf di.r. ninoJnu.rg als ,'elitäre Demokratietheoretikero unwillig
reagiert; vgl. dazu die Kontrorr.rr. ,*irä;;l;A i, valker: "A critique of the elitist theory of
democracy,, in: APSR 60 (1966), S. ZiS-igS', und Robert A. Dahl: Further reflections on "The
elitist theory of democra61,", ebda., s. 296-305 (sowie walkers Replik, ebda'' s' 391 f'); es
dürfte aber grundsätzlicl ni.ht untutreffend ,.i.t, j..r. im einzelnen gewiß differenzierten theo-
retischen Ansätze in den Gesamtzusa--.nh"rrg .in", R"',rition der demokratisdren Theorie zu
,i"ii.", ai" auf die elitären Positionen des Altliberalismus z-urückweist'
S trukturen ideologisüer Konllikte bei Parteienwettbewerb
ihnen die These gegenüberstellen, daß eine aktive Parriziparion der \(ählermassen ampolitisdren Prozeß weder notwendig nodr wünschenswert sei 100.
Natürlich ist diese elitär revidierte Demokratietheorie nicht so neu, wie sie sidr gele-gentlich gibt; sie interpretiert vielmehr Befunde der empirischen Forschung im Sinneüberkommener liberal-konservativer Vorbehalte gegen die fundamentaldemokratischePartizipationsnorm. Das geht aber nidrt ohne Gewaltsamkeit ab, denn vielfach wirdüber der allzu eilig gezogenen normativen Schlußfolgerung die präzise Operationali-sierung der Führer-Anhänger-Dichotomie vernachlässigt und zudem dieses (der Inten-tion nach nominalistische) Hilfsmittel der Analyse unter der Hand essentialistisch um-gedeutet. Zwar hat Daoid Truman in einer Auseinandersetzung mit Walter Lippmann"Public philosopb?" bemerkt, daß dessen Bild der amerikanisdren Gesellsdraft nur dieRegierenden und die Masse kenne und jede vermittelnde Struktur mit Rangabstufun-gen von MacÄt und Verantwortung vernadrlässige. Indem aber Truman dagegendas Konzept eines Elitenkonsensus auf der Ebene der nationalen Führungsschichtvon Parteien und Verbänden setzt, verscliebt er im Grunde die Didrotomie nur umein weniges 101. So oder so bliebe es bei der Konsequenz, daß nicht bloß die apathiscJren\Wähler, sondern auch die politisch engagierten Bürger und Parteiaktivisten unter-halb jener Schwelle der aktiven Partizipation bleiben, von der die revisionistisdreDemokratietheorie spricJrt. Diese engagierte politische ,Mittelschidrt" aber stellt ja dasGros jener ,Eliten", die in den oben behandelten empirischen Konsensusstudien mitdem Wählerquerschnitt verglichen werden. Damit wird jedoch die empiriscJre Begrün-dung des Konzepts vom Elitenkonsensus problematisch. Der Funktion der politischenAktivisten im demokratischen Prozeß - die insbesondere im Zusammenhang mit derFrage der innerparteilichen und innerverbandlidren Demokratie als ein eigener, gewich-tiger Aspekt der normativen Demokratietheorie relevant wird 102 - kann man offenbarmit der Eliten-Masse-Dichotomie nicht beikommen. Es drängt sidr daher die Frage auf,ob für eine empirisch fundierte Überprüfung der demokratischen Postulate nicht kom-plexere Modelle vonnöten sind als jenes simplifizierende Stereotyp, möge es nun alsGegenüberstellung von Führern und Geführten formuliert werden, oder von ,'aktiver.,
und "passiver Offentlichkeit". Die Frage liegt um so näher, als auch für die empirischeAnalyse von Konsensus der didrotomiscle Ansatz sidr bei näherer Betradrtung alsunzulänglidr erweist.
4. Kont'likt und Konsensus in den Interahtionsprozessen des politischen Systems
4.1. Kont'likt- und Entscbeidungsstrukturen in zwei politischen SystemenDie Dicbotomisierung der
'Wählerschaft nach dem Maß der politischen Partiziparion
100 Representativ für die deutsche Rezeption der revisionistischen Demokratietheorie sind u. a.Wilhelrn Hennis: "Das Modell des Bürgers,., in: GSE, 2. Jg. $957), Heft 7, und vor allem RaffDahrendorf; "Aktive und passive Offenrlichkeit., in: Merkur.2l Jg. 0967), S. ll}9-ll21.Vgl. ferner Ulricb Lobrnar: Innerparteiliche Demokratie 1963, S. 27 ff . v. ö.1or Trwrnatz, ebda.r02 Dazu jetzt Frieder Nascholl; Organisation und Demokratie, LJntersuchungen zum Demo-kratisierungspotential in komplexen Organisationen (1969).
303
304 Gerbard Lebmbradt
(oder audr des Bildungsniveaus) erlaubt zwar Konflikt und Konsensus innerhalb eines
politischen Systems präziser zu beschreiben als die traditionellen Verfahrensweisen der
empirischen Erforschung von \Wählerverhalten, und dürfte insofern audr im intersyste-
mischen Vergleidr weiterführen. 'W'enn
wir aber die Stabilitätsproblematik in den Griff
bekommen wollen, um die es der normativen Demokratietheorie geht, müssen wir die
Beziehung dieser Daten zu den Problemlösungsstrategien und Entscleidungsprozessen
im Gemeinwesen herstellen, und das kann audr der didrotomische Ansatz nicht leisten.
Besonders deutiich wird das bei der Frage, wie in politischen Systemen mit starkem
innerem Konflikt zwisclen Subkulturen ("fragmentierten politischen Kulturenu) er-
folgreiche Problemlösungsprozesse vor sich gehen: Jener Ansarz kann dabei zwar blok-
kierende und retardierende Elemente in den Konflikt- und Polarisierungsmustern der
öffentlichen Meinung deutlicher herausarbeiten; er ermöglicht aber keine Hypothesen
darüber, inwiefern unter solchen Bedingungen Konflikte gleichwohl geregelt werdenkönnen. Vielmehr scheinen audr unter dieser empirischen Fragestellung komplexere
Modelle der Konflikt- und Konsensusstrukturen in politisdren Systemen erforderlich.
Dies läßt sich am Beispiel Frankreichs - insbesondere der IV. Republik - zeigen, das
oben schon herangezogen wurde.rWir wir sahen, bedarf das Stereotyp vom >zerrissenen Frankreich.. einer gewissen Kor-
rektur in dem Sinne, daß nicht die Vählerschaft, sondern die politisdren Aktivisten als
polarisierte Schicht anzusehen sind. Die hier lokalisierten Konflikte zwisc}en Subkul-
turen sind nun freilich für das Funktionieren des politischen Systems von um so größe-
rer Bedeutung, als wir es in Frankreich mit einer starken überschneidung von Kon-
fliktdimensionen zu tun haben 103. Die Polarisierung und die mangelnde Flexibilität
der überzeugungssysteme bei den politisch aktivierten \ü/ählern stellen zweifellos stark
retardierende Faktoren bei der Problemlösung dar 104.
Andererseits darf aber über den bekannten Beispielen unbewältigter Konflikte in der
IV. Republik (Algerien) nidrt übersehen werden, daß eine bead-rtlicle Anzahl von Pro-
blemen relativ erfolgreidr gelöst wurde (sowohl in der 'Süirtschaftspolitik
als auch in
den auswärtigen Beziehungen: wirtschaftliche Integration, Deutschlandpolitik, Bezie-
hungen zu Marokko und Sdrwarzafrika 105). Ohne funktionierende Prozesse der Kon-
sensusbildung wäre das nicht möglich gewesen. Die Hypothese vom Elitenkonflikt be-
darf daher offenbar der Differenzierung.
103 Das ist die von Duaerger so genannte uüberlagerung von Dualismen" ; vgl. lfaurice Duver-ger, a.a.O., S. 261 ff .; Jacques Fauvet: Von Thorez bis de Gaulle, Politik und Parteien in Frank-re ich (1953) , S.201 f f . (vg l . auch oben, S.238) .104 Das alles gilt sdron abgesehen von der starken Isolierung der Kommunistischen Partei inder öffentlichen Meinung, die auch in den Vählerumfragen immer wieder zutage getreten ist.Vgl. hierzu insbesondere Pierre Fougeyrollas: La conscience politique dans la France contem-poraine (1963), bes. S. 164 ff.105 Die Lösung des Vietnam- und des Tunesienkonflikts durdr Mendös-France war insofern einSonderfall, als hier das Element der drarismatisdren Führung eine ausnehmend starke Rolle ge-spielt hat. Vgl. dazu Stanley Hoft'rnann, "Heroic leadership, The case of modern France", in:Lewis J. Edinger (Ed.): Political leadership in industrialized societies, Studies in comparativeanalysis (7967),S. 108-154.
Struhturen ideologischer Kont'likte bei Parteienwettbewerb 305
Dwncan MacRae hat die Zusammenhänge zwischen den gesellschaftlidren und poli-tischen Konflikten und der Instabilität der Regierungen in einer statistischen Analysedes Abstimmungsverhaltens in der Nationalversammlung von 1946 bis 1.958 untersuchtund wahrsdreinlich gemacht, daß das Parlament ein konsensuelles Subsystem darstellte,als dessen Kern die Minister und Ministrablen angesehen werden können 106. Entgegender Hypothese, daß die Instabilität der Regierung durd-r den Ehrgeiz von ehemaligenMinistern und Ministeranwärtern bedingt gewesen sei, kommt er zv dem Ergebnis, daßdiese Gruppe stärker zur lJnterstützung der jeweiligen Regierung tendierte, und daßder Dissens, der zur Instabiiität führte, besonders von den Hinterbänklern ausging undvor allem ideologische Konfiiktdimensionen betraf. Soweit das Abstimmungsverhaltenzur \üahlkreisbildung der Abgeordneten in Beziehung gesetzr werden kann, spiegelt esnidrt so sehr regionale Interessen wider als vielmehr lokale politische Konflikte. Diesführt MacRae zu der einleudrtenden Hypothese roz, daß es der Einfluß der ideologischpolarisierten Parteiaktivisten in den \Wahlkreisorganisationen ist, der zum Dissens derHinterbänkler führt, und daß man infolgedessen von dem Nebeneinander eines kon-sensuellen Subsystems im Parlament und eines dissensuellen Subsystems in den Partei-organisationen sprechen muß 108. Das stimmt zu den Beobachtungen, die Robert de
Jowztenel vor Jahrzehnten in seinem berühmten Essay über die parlamentarische Sub-kultur und ihre eigentümlichen Sozialisationsprozesse formulieru har: nIl y a moins dedit't'ärence entre deux dtputös dont I'un est räaolutionnaire et I'awtre ne I'est pas,qw'entre deux röttolutionnaires, dont I'un est d6pwtö et I'autre ne I'est lsas, - denn füralle Abgeordneten gelte das Gesetz der parlamentarisdren Kameraderie: <respecterl'esprit de la maison et ne pas 5s vttiysv Loe.
Damit aber ergibt sich ein Dreischidrtenansatz der Konfliktanalyse: Man muß dieEbene der Vählerschaft, die Ebene der Parteiaktivisten und die Ebene der Parteiführerunterscheiden 110. Dann kann man offenbar das Parteiensystem der Vierten Republikdrarakterisieren durch relativ geringe Polarisierung an der Basis (Vählerschaft), starkePolarisierung auf der mittleren Ebene (Aktivisten), Konsensus an der Spitze 111.
106 Dwncan MacRae: Parliament, parties and society in France, 1946-1958 (1967).107 Sie wird vor allem in Verbindung mit der Untersuchung von Converse/Du.peux, a.a.O.,entwidrelt.108 Damit erweist sich die mit Recht umstrittene Analyse von Nathan Leites audr insofern alsoberflächlidr, als sie die These Faupets von den sozialen und ideologischen Konflikten als Ur-sacle der Instabilität des Regimes summarisdr abtut mit dem Hinweis, daß im Parlanent derVierten Republik nicht ideologische Polarisierung, sondern im Gegenteil ein starker Konsensüber_ die politisdren Spielregeln dominiert habe (wobei die "Fludrt vär der Veranrwortung. einefundamentale Maxime gewesen sei): Nathan Leites: On the game of politics in France (1n1.Leites übersieht, daß wir es hier mit zwei verschiedenen Subsyste-..r ,., tun haben.rOs Robert de louaenel; La Rdpublique des camarades (1914), 5.77,53.110 Natürlidr könnte man noc} weiter nach dem Grad der politischen Involviertheir unrer-scheiden, zum Beispiel: Wähler, Partizipierende, Aktivisten, Parteiführer zweiten Ranges (etwaHinterbänkler im Parlament), Parteispitze; es ist aber nicht gesagt, daß das die AnalysJ *"r.nr-lich fördern würde.111 Die kommunistisdren Parteiführer ausgenommen.
306 Gerhard Lehmbrudt
Indem wir soldrerart konsensuelle trnd dissensuelle Subsysteme untersdreiden, könnenwir Konflikt und Konsensusbildung im politiscJren System als einen komplexen Inter-aktionsprozeß besdrreiben. Mit einem solchen Ansatz läßt sidr zum Beispiel erklären,warum im Parlamentarismus der III. und IV. Republik die Mehrheiten sich im Laufeder Legislaturperioden so häufig zur Mitte hin verschoben haben: Die französische'\(rählerschaft
ist normalerweise politisch wenig engagiert und nur in geringem Maßepolarisiert; zudem überschneiden sich verschiedene mehr oder weniger stark polarisierteKonfliktdimensionen (Kulturpolitik, Sozialpolitik, Verfassungspolitik). Die Partei-organisationen aber stellen vertikale Kommunikationssysteme innerhalb des politischenSystems dar, die als solche die Bevölkerung bis zur Gemeindeebene herunter ideologischsegmentiersn 112. Diese Segmentierung ist, solange keine starken aktuellen Konflikte(z.B.Vahlkampf) gegeben sind, im wesentl ichen latent, denn aktiv erfaßt sind dannnur die Parteikader. Träger des Konflikts sind so vor allem die ideologisdr polarisiertenMittelsc}iclten der Parteiaktivisten; sie mobilisieren im \Tahlkampf oder in politischenKrisen die normalerweise wenig engagierten und in geringem Maße polarisierten \(äh-ler, so daß sich das Bild einer starken Polarisierung und bimodalen Verteilung der poli-tisdren Orientierungen zu ergeben scheint 113. Zugleich kann in der Krise eine Konflikt-dimension stärker durdrschlagen und dadurch (gegenüber der sonst als polymodal er-scheinenden Verteilung) die bimodale Verteilung deutlicher hervortreten lassen. Da imallgemeinen infolge der von den Parteiorganisationen antizipierten geringen Fluktua-tion zwisdren den ideologischen Lagern (insbesondere der uRechten,, und ul-inkenn)der \Wahlkampf sich im wesentlichen auf die Mobilisierung des eigenen (ulatenten")Anhanges ridrtete, weit weniger auf die Gewinnung von Wählern aus anderen Lagern,bewirkte der Vahlkampf eine Verschärfung der Konflikte 114.
Zu Beginn einer Legislaturperiode dominieren nun vielfach diese Gegensätze (insbeson-
dere die Links-Redrts-Polarisierung) auch im Parlament, wobei man eine Situationkognitiver Dissonanz zwisclen dem dissensuellen Bezugssystem der Parteiorganisationund dem konsensuellen Bezugssystem des Parlaments annehmen kann. Im Laufe derZeittreten aber in einem Prozeß der Dissonanzreduktion zunehmend die konsensuellenOrientierungen und Kooperationsnormen der Parteiführer in den Vordergrund. Damitversdrieben sich im klassischen französischen Parlamentarismus auch die Mehrheitsver-hältnisse: An die Stelle der polarisierten Blöd<e (Cartel des Gawcbes, Volksf ront, FrontRöpublicain) treten allmählich die Zenrr,tmskoalitionen, deren Schwerpunkte zwischendem Centre Gauche und dem Centre Droit oszillieren. und erst mit dem Herannahen
112 Vgl. dazu MacRde, a.a.O., S. 301.113 Das ist die Aktivierung latenter Meinungen im Wahlkampf, auf die Lazarsfeld/BerelsonlMcPbee aufmerksam gemacht haben (vgl. Anm. 67).114 Vgl. MacRae, a.a.O., S. 282 f. - Es hat zwar audr in der IV. Republik mehrfach starkeStimmenversdriebungen durdr Aufstieg und Abstieg von neuen Parteien (wie MRP, PRF, Pouja-disten) gegeben; aber sie betrafen bezeichnenderweise vor allem die von Parteiorganisationenweniger erfaßten \(ählerschidrten rechts von der Sozialistischen Panei, insbesondere auf der"klassischen Redrten". Dazwischen zeigte sich (und zeigt sich in den Kommunalwahlen bis indie V. Republik) eine immerhin bemerkenswerte Stabilität der politischen Orientierungen.
Strubtaren ideologis&er Konf likte bei P arteienu)cttbewerb 307
des neuen \Tahlkampfes werden die Konfliktorientierungen der Parteiaktivisten audr
im Parlament wieder stärker dominant 115.
Ein in mancher Hinsidrt ähnliches Bild scheint sicl für Osterreidr in der Zeir der Zwei-
ten Republik zu ergeben: Empirische tlntersudrungen sdreinen bei Spitzenfunktionären
relativ starken Konsensus, bei den mittleren Parteikadern dagegen ausgeprägte ideolo-
gische Polarisierung aufzuweisen; darüber hinaus zeigt sidr bei denjenigen Funktionä-
ren der mittleren Ebene, die nidrt zum Apparat der beiden großen Parteien, sondern zu
den mit ihnen verbundenen 'süirtsdraftsverbänden
und Kammern gehören, offenbar
eine mehr konsensuelle und pragmatische Orientierung 116. Die Wählerschaft aber
sdreint auch in Osterreicl nur in geringem Maße polarisiert zu sein 117. Anscheinend sind
es hier also wiederum die Parteiaktivisten, die im Wahlkampf für die Mobilisierung
der nidrt engagierten \Wähler sorgen und die Polarisierung bewirken; andererseits kann
sich die Zusammenarbeit der beiden politischen Lager (sei es in der Form der Regie-
rungskoalition, die bis 1966 bestand, sei es in der seither praktizierten Form der Zu-
sammenarbeit, die man uBereidrskoalitionu genannt hat) in erheblidrem Maße auf die
Kader der Verbände und Kammern stützen, die im politischen System Osterreichs eine
audr institutionell stark verankerte Stellung im politisdren Prozeß haben.
Für Wahlkämpfe in CIsterreich war, mehr nodr als in Frankreidr, der Umstand bezeidr-
nend, daß die Strategie der Parteiorganisationen von der Erwartung einer nur gerin-
gen Fluktuation zwisdren den ol.agern" (den organisatorisch encadrierten Segmenten
der Bevölkerung) ausging 118' Sie richtete sich zwar audr auf die kleine Gruppe der
rrr ygf. hierzu audt Gerbard Lehmbrucb: "Die französisdren Parteien in der IV. Republik",in: GSE 3 (1958), 5.209 f. ders.: Frankreichs \(eg zur V. Republik (1960), S. 8 f . ; ders.: DasMouvement R6publicain Populaire in der IV. Republik, Diss. phil. (Tübingen 1962, mschr.),s. 349 ff .116 Diese Hypothese stimmt mit den Sdrlußfolgerungen überein, die Rodney Stiet'bold' ausEliteninterviews (Messung der "Ideologie-Pragmagl5rnu5"-Dimension) gezogen hat; einige Mit-teilungen darüber in seinen Arbeiten: Parties, groups and chambers in the political bargainingprocess, Pluralist democracy in Austria, Annual Meeting of the American Political ScienceAssociation, Chicago 1967;Elite-mass opinion structure and communication flow in a consocia-tional democracy (Austria), Annual Meeting of the American Political Science Association,\flashington 7968. - Die ideologische Polarisierung der Parteikader von OVP und SPO istGegensrand eines Forschungsprojekts der politikwissenschaftlic}en Abteilung des Instituts fürHöhere Studien und Wissensdraftlidre Forschung in
'Wien; der Verfasser verdankt Diskussionen
mit Dr. Peter Gerlich wd Dr. Helrnwt l(ramer ebenso wie mit Rodney Stiet'bold wichtigeAnregungen.r17 Vgl. die bei Stiefbold: El i te-mass opinion structure .. . , S. 10 f. (mit Tab. 3 und 4) mit-geteilten Daten (Republikation von Messungen von "partisanship" aus dem "Civic-Culture-
Survey" von Almond undVerba).118 Nadl einer Umfrage des Osterreiclisdren Gallup-Instituts erklärten 92010 der'$(ähler des
Jahres 1962, im Jahre 7959 die gleiche Partei gewählt zu haben (umgeredrnet unter Eliminie-rung der Niclt- und Erstwähler), und zwar 94 0/o der OVP-Wähler und 91010 der SPO-Wähler(Dwaine Maraick u. a. [Hrsg.]:
'$Tahlen und Parteien in Osterreich, Osterreichisches \Tahlhand-
buch, Band I1,1966, S. B 612, 617).1966 hat es offenbar erstmals eine etwas stärkere Fluktua-tion gegeben (Karl Blecha: "\Tahlstudien 1966o, in: Peter Gerlich u. a. [Hrsg.]: Nationalrats-wahl 1966, Osterreichisches \flahlhandbudr, 1968, S. D 175 f .).
308 Gerhard Lehmbrudt
"Gleichgewichtswähler.. 1le, aber in erster Linie auf die Mobilisierung des eigenen tradi-
tionellen Anhangs, und nur in geringem Maße auf Einbrüdre ins gegnerische ,,Lager...
Infolgedessen führte der \flahlkampf zur Aktualisierung der Konflikre 120. Es ist zwar
ridrtig, daß diese Erwartung eines stabilen \Wählerverhaltens einen bestimmten institu-
tionellen Rahmen, insbesondere das geltende Verhältniswahlredrt, zur Voraussetzung
hatte rzr ' 6is diesem Hinweis dürfte aber wohl nur ein Teil der Yarianz in dem vorlie-
genden Konfliktmuster erklärt werden . Ein ganz wesentlicihes Element ist die organisa-
torische "Versäulung" der österreidrisdren Gesellsdraft bis zur untersten Ebene, wie sie
sich am Beispiel jener niederösterreichischen Kleinstadt belegen läßt, in der von ins-
gesamt 32 Yereinen nur 2 nidrt einem politisdren Lager zugerechnet wurden r22. In-
folgedessen lebt ein großer Teil der österreidrischen Bevölkerung in polit isch relativ
homogenen Primärbeziehungetr rzs ,rt-td ist im \Wahlkampf verhältnismäßig wenigen
dissonanten Stimuli ausgeserzr.
Es ist in diesem Zusammenhang an zwei geläufige psycJrologisdre Ansätze anzuknüp-
fen, zum einen an die theoretisdren Konzepte über Herstellung kognitiver Konsi-
stenz 124, zum andern die sozialpsydrologiscJren Hypothesen vom )zweistufigen Kom-
munikationsflußu über ,Meinungsführer<< ztr den Primärgruppen (der Vähler, Konsu-
menten usw.) 125. Man wird nun den 'sfahlkampf
als einen Prozeß verstehen können, in
1le Darunter verstanden die Parteistrategen eine Gruppe von '$7ählern,
von der man annahm,daß sie von \7ahl zu \7ahl die Parteipräferenz änderten mit dem Ziel, das übergewicht einerder beiden großen Parteien zu verhindern. über empirisd-re Daten hinsidrtl idr der ,Gleich-gewichtswähler" vgl. Heinz Kienzl, in: Kurt Blecha, Rupert Gmoser und Heinz Kienzl: Derdurdrleuchtete \fähler, Beiträge zur polit ischen Soziologie in Osterreic} (1964), S. 38 f .; Stief-bold': EIite-mass opinion structure ..., a.a.O., S. 6 ff. (mit Daten des Fessel-Marktforsdrungs-inst i tuts) .120 Dies betont besonders st iefbold: El i te-mass opin ion strucrure. . . , a.a.o. , S. 15 f f .121 Diese Auffassung bestimmt die Arbeit des Hermens-Schülers Karl-Heinz Na$madter.. Dasösterreichische Regierungssystem, Große Koalit ion oder alternierende Regierung (1968).r22 Hdnr Strotzka u. a.: Soziale Bedingungen psychischer Krankheir, Eine sozialpsychiatrisdreFeldstudie (Institut für Höhere Studien und \Tissensdraftl iche Forschung, Wien o. J., Verviel-fä l t igt ) , S. 30.123 Vgl. dazu das Resultat einer vergleichenden Kontrastgruppenanalyse bei Klaus Liepelt: Theinfra-structure of party support in Austria and l7est Germany (vervielfältigres Referat, Inrer-national Conference in Comparative electoral behavior, Survey Research Center, University ofMid-rigan, Ann Arbor 1967), S. 14: Die Gruppen mit Mehrfachbindungen und daraus folgendenEinflüssen von verschiedenen gesellscJraftl ichen Wertsystemen sind für Osterreiclr auf nur 6,5 0/o
der Wählerschaft, für \Testdeutsdrland dagegen auf 16,5 olo za veranschlagen. Hinzu kommtnach Liepelt, daß in den homogenen Gruppen die Bindungen intensiver sind und vor allem dieSPO einen größeren Anteil ihres (sozialstrukturell definierren) Potentials mobilisiert als die SPD.124 Besonders Leon Festinger: A theory of cognitive dissonance (1957); vgl. jetzt audr denÜberblick bei Hans J. Hurnrnel; "PsychologiscJre Ansätze zu einer Theorie des sozialen Verhal-tens<<, in: Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. II, bes. 5.1223 ff .r25 Zterst entwicl<elt bei Lazarst'eld. u. a., a.a.O, S. 49 ff. u. ö.; dann bei Etihu Katz und PaulF. Lazarsfeld; Personal influence, The part played by people in the flow of mass communica-tions (1955)' S. 32 ff. Über die weitere Verwendung des Ansatzes in der Diffusionsforschungberidrten Etterett M. Rogers und Daztid G. Cartano.'"Methods of measuring opinion leader-ship" , in: POQ 26 (1962),5.435-441. - Converse (The nature of bel ief systems.. . , a.a.O.,5.231ff.) glaubt, die Meinungsführerhypothese als Erklärung für die Verteilung von überzeu-gungssystemen falsifizieren zu können, doch sind die von ihm analysierten Variablen (occupa-
S trahturen ide ologisch er Kont'likte b ei P arteienwe ttb ewerb 309
weldrem die Ausgangssituation, nämlich die Existenz inkonsistenter überzeugungs-
systeme bei einem großen Teil der Vählersdraft, für die Betroffenen zunächst als eine
Situation kognitiver Dissonanz zwisdren den heterogenen Bewußtseinsinhalten in Er-
sdreinung tritt. Die zunehmende Polarisierung dürfte zu einem guten Teil so vor sichgehen, daß in dem uzweistufigen Kommunikationsfluß., y6n den Meinungsführern zu
den Mitgliedern der Primärgruppen dissonante Informationen ausgesdrieden und die
Informationen von seiten der Meinungsführer akzeptiert werden 126. \(/enn aber einer-
seits die Primärbeziehungen eines großen Teiles der Bevöikerung sehr homogen sind, so
daß die meisten Individuen nur mit Meinungsführern einer bestimmten Tendenz in
Kontakt treten, und zum andern die Meinungsführer in einem straffen Organisations-gefüge mit ausgeprägter ideologischer Polarisierung auf der Ebene der maßgebenden
Organisationskader (besonders Parteiaktivisten) integriert sind, dann kann im Vahl-kampf eine starke und stabile Polarisierung der öffentliclen Meinung erwartet werden,
obwohl der nidrt engagierte \flähler im übrigen seine lJmwelt nicht als stark polarisiert
perzipiert und keine starken Parteiaffekte offenbart. Eben diese Situation ist in Oster-
reidr offenbar gegeben. Ihr aber korrespondiert in sehr eigentümlicher 'Weise für die
Parteiführer im Parlament, wiederum ähnlidr wie in Frankreich, eine Situation kogni-
tiver Dissonanz zwischen den Kooperationsnormen, die das Parlament insbesondere
während der Ara der Großen Koalition ausgebildet hat, und den Konfliktsnormen der
Parteiorganisationen 127.
4.2. B edingungen von Konfliktstrukturen im Sy stemvergleicb
\fir haben die Konfliktstrukturen in Frankreidr und in Osterreidr mit der Segmentie-
rung in ideologisdre Subkulturen in Verbindung gebracht und damit zugleich unter-
stellt, daß sie eine Beziehung zu der ufragmentierten politischen Kultur" (Almond)
dieser Länder aufweisen. Nun könnte man wohl einwenden, daß das dargestellte
Muster, insofern es durch geringe Polarisierung bei den Wählern, starke Polarisierung
bei den Parteikadern und Konsensus bei den Parteiführern drarakterisiert ist, auf spe-zifische organisatorische Bedingungen zurückzuführen ist, die überhaupt in parlamen-
tarischen Demokratien mit Parteienwettbewerb zu erwarten sind: Die mittleren Par-
teikader sind in weit geringerem Maße institutionalisierter Inter-Parteien-Kommuni-
kation ausgesetzt als die Parteiführer im Parlament, und internalisieren infolgedessen
im politiscl-ren Sozialisationsprozeß in weit geringerem Maße Kooperationsnormen und
konsensuelle Orientierungen. Audr in bezug auf das britische Parteiensystem ist mit-
unter behauptet worden, das Dilemma der Parteiführer bestehe darin, daß "tbeir rnostloyal and. devoted followers tend to have more extreme t,iews tban tbey harse themsel-
tional status, Konfession) wohl zu grob, um Prozesse in Primärbeziehungen überhaupt erfassenzu können. Im übrigen wird man für die Rolle von Meinungsführern im Parteiensystem derUSA andere Bedingungen voraussetzen müssen, als sie in den kulturell segmentierten politisdrenSystemen Kontinentaleuropas mit ihrer starken uVersäulung" gegeben sind.120 über die \7ahl als Aktivierungs- und Polarisierungsprozeß vgl. u. a. die in Anm. 68 ge-nannte Literatur.127 Vgl. meine Darstellung der parlamentarisdren Kooperationsnormen in Osterreidr in: Pro-porzdemokratie, Politisdres System und politisdre Kultur in der Sdrweiz und in Osterreidr(1967), S.20 ff .
3 1 0 Gerbard Lebmbrudt
ves, and to be still fartbcr rernoved lrorn tbe mass ol those who actwally provi.de theOOgg" t28.
Nun muß aber nadr den vorliegenden enrpirisdren lJntersudrungen bezweifelt werden,
ciaß diese Hypothese für Großbritannien zutrif.ft. Ebensowenig wie man von einem
uredrten Flügelo in der konservativen Unterhausfraktion sprecJren kann 12e, lassen sidr
die konservariven \üahlkreisorganisationen als extremistisch drarakterisieren 130. Die
Labourfraktion hat zwar bei ihren Hinterbänklern einen "linken Flügel" mit relativ
konsistenten ideologisc}en Einstellung€n 131, aber die verbreitete Auffassung, daß diese
Tendenz in den Wahlkreisorganisationen eine dominierende Rolle spiele, trifft offen-
bar nicht z;rr32. Ricbard Rose hat in einer Analyse von Resolutionen der \üahlkreis-
organisationen gezeigt, daß diese überwiegend keinen extremistisdren Charakter
haben; die Einstellungen in bezug auf politisdre Problemalternativen seien hier sta-
tistisch zufällig verteilt, und diese Zvfallsverteilung lasse den Parteiführern großen
Bewegungsspielraum 133.
Venngleich der Vorbehalt wiederholt werden muß, daß wir angesidrts der besdrränk-
ten Vergleichbarkeit unserer Daten hier zum Teil auf Konjekturen angewiesen sind,
Iiegt docJr in systemvergleidrender Perspektive die S&lußfolgerung nahe, daß die im
vorigen Abschnitt analysierten Konfliktstrukturen in der Tat für subkulturell segmen-
tierte politische Systeme ("fragmentierte politisdre Kulturen") besonders charakteri-
stisdr sind. Damit wird die Ableitung aus organisationsspezifisclen Rollenstrukturen
nicht etwa ausgeschlossen; vielmehr kann man hier von komplementären Bedingungen
sprechen.
Nach einer neuerdings entwid<elten Hypothese ist in subkulturell segmentierten (rver-
säultenu) Systemen der Konsensus der Spitzeneliten eine wesentliche Voraussetzung
funktionierender Problemlösungsprozesse, während unterhalb der Führungsgruppe die
128 D. E. Butler: "The paradox of party difference", in: The American Behavioral Scientist IV(1960) , S. s .12e Dies ist in der Keele-Swdie über die "Early Day Motions" gezeigt worden: S. E. Finer,H. B. Berrington und D. J. Bartholotnelu: Bad<bendr opinion in the F{ouse of Commons, 1955b i s 1959 (1961 ) , 5 .76 f f .tso John Bit ' fen, "Conservative consti tuency leaders", in: Crossbow IV (1960), Nr. 13, aus-zugsweise abgedrudrt bei Richard Rose (Ed.), Studies in British politics, A reader in politicalsociology (1966), S. 309-313; Frank Bealey, J. Blondel und W'. P. McCanu Constituencypoli t ics, A study of Newcasrle-under-Lyme (1965),5,274 ff . ; Jean Blondel: Voters, part ies andleaders, The social fabric of Bri t ish pol i t ics (19652), S.91 f. , 106 ff .ßt pi7lsv/Perrington/ Bartholomew, a.a.O., S. 15 ff .r32 Edrnard G. Janosik.' Constituency Labour parties in Britain (1968), S. 26 ff .; Blondel,a.a.O.; Bealey/Blondel/McCann, a.a.O., S. 281 ff . ; Mart in Harrison: Trade unions and theLabour party since 1945 (1960), S. 238 f .; Keitb Hindell und Philip'Williarns: "Scarborough
and Blad<pool, An analysis of some votes at the Labour party conferences of 1960 and 1961",in: Political Quarterly (1962).r33 Ricbard Rose: "The political ideas of English parry activists", in: APSR 56 (1962), S. 360bis 371. Die Hypothese von der Zufallsverteilung wird freilich von Janosik hinsichtlich derLabour-V'ahlkreisorganisationen bestritten; er glaubt zeigen zu können, daß diejenigen \(ahl-krersorganisarionen, die sich in einer Minderheitsposition befinden, stärker nadr links tendieren(a.a.O., S. 58 f.) .
Strukturen ideologisdter Kont'likte bei P arteientpettbewerb
Kontakte zwischen den Subkulturen sdrwadr ausgebildet sind 1s4. Diese Hypothese wirdinsofern der Korrektur bedürfen, als es im Zuge der sozioökonomischen Entwid<lungmit erhöhter geographiscJrer Mobilität zu einer Verstärkung der Kontakte zwischenden Subkulturen und damit zu einer Einebnung von ursprünglidren Differenzen in denUberzeugungssystemen auf der Ebene der Vählersdraft kommt 185, so daß wir also -wie oben für Frankreich und Osterreich auseinandergeserzt - wenigstens so lange eineschwächere Polarisierung haben, als die Vähter nicht durdr Krisen oder \Wahlkampf
aktiviert und mobilisiert sind. In diesen Systemen werden die ideologischen Differen-zen eben durch die Parteiorganisationen 136 aufreclterhalten, die sich als uGegengesell-schaft" verstehen, und die Organisationsrollen der unteren und mittleren Parteikadersind hier vorwiegend auf die ideologische Polarisierung hin orientiert.Für "homogene politische Kulturen,. (im Sinne Almonds) scheint dagegen die Hypo-these nahezuliegen, daß die Rollenorientierung der Parteikader hier tendenziell stärkerdurdr die wahlwerbende Funktion der Parteien bestimmt wird, weniger freilich beiprogressiven Parteien, deren Kader auf gesellschaftlicle Reformen hin orientiert sind.Letzteres wurde für die britisdren Labourorganisationen mit ihren ,rlinkenu Minder-heiten gelten und würde auch die ideologische Struktur der Demokratischen Partei inKalifornien erklären, in der "liberaleu (d. h. linke) Positionen in der Führungshier-archie nadt unten hin an Stärke zunehmen raz. f2ff in den Parlamenten auch hier aus-geprägte konsensuelle Strukturen anzutreffen sind - besonders deutlicl in den USA,wo auch die verfassungsmäßige Position des Kongresses und die eigentümlic6e Strukturdes Parteiensystems dazu beitragen 1ss -, erklärt sich dabei aus der Integrationswirkungder rSubkulturu des Parlaments.
t$a Arend, Liiphart: The politics of accomodation, Pluralism and democracy in the Nether-lands (1968),5.77 f. und 103 f. ; ders.: "Typologies of democratic systems", in: ComparativePoli t ical Studies 1 (1968), 5.22 ff . ; ders: "Consäciat ional d.*ocra.y", in: Vorld pol ir ics 21(1968/69),5.216 ff . - Im übrigen ded<en sich Li jpharrs Hypothesen-weithin mit den von unsi.iber den-Typus der "Proporzdemokratie., sdgl ,ico"korj"nzdemokratie* entwichelten; vgl.G. Lehmbruclt: Proporzdemokratie, a.a.O., sowie: ,rKonkordanzdemokratie im politischen S!-stem der Schweiz", Ein Lireraturbericht in: pVS g (196g), S.443 ff .tt' Järg Steiner: Bedingungen für gewaltlose Konfliktregulierungsmuster in subkulturell seg-mentierten demokratischen Systemen, Hypothesen entwid<elt am Beispiel der Sclweiz (in Voi-bereitung), hat zwar die von Lijpbart und uns entwi&elten Hyporhesen über uKonkor-danzdemokratie.. (bzw. "consociational democ racy") übernommen,-insbesondere auch die vonLijphart so stark betonte Rolle des Elitenkonsensus'hervorgehoben, jedocl unter Hinweis aufdie schweizerisdren Verhältnisse überzeugend bestrirt"r,, daß diesem .irr. ,ru, sdrwach entwik-kelte Kommunikation zwischen den Nichteliten korrespondieren müsse.tlu Il Frankreidr spielen in diesem Zusanrmenhang auch ,parapolitische* Verbände eine wich-tige Rolle - es sei nur an die Freimaurerlogen, die Ligue de-l'Enseignemenr und die laizistische'Lehrerverbände sowie auf der anderen Seite die kirchlichen Verbänäe erinnerr.r37 Edmond Constantini: "Intraparty attitude conflict, Democratic party leadership in Cali-fornia", in: Vestern Poli t ical Quarterly ,16 (1963),5.956-972. - Die Daten bei 'samuel ! .Eldersoeld: Political parties, A behavioral analysis (1964), S. 184 ff., sind wegen der Eigenarrder Fragestellung und der Begrenzung des untersudrten Aussdrnimes nur sclr*J, zum Vergleidrheranzuziehen.138 Dazu etwawilliam s.white; citadel, The story of the u.s. senate (1957).
3tr
312 Gerhard Lehnbruch
1.3. V ertikale Dimensionen der Konfliktstruktwren
Man könnte den hier skizzierten Dreischictrtenansatz einer Analyse von Konfliktstruk-
turen so auffassen, daß hier lediglidr drei als horizontale räumliche Kontinua zu be-
sdrreibende Häufigkeitsverteilungen in geeigneter Weise zu aggregieren seien. Uni-
modale Verteilung der Präferenzen bei der \7ählersdraft einerseits, den Parteiführern
andererseits würden dann als konvergierende Bedingungen von Stabilität im Sinne des
liberalen Konsensuspostulats erscheinen, Polarisierung bei Parteiaktivisten als "dys-
funktionaler., Störungsfaktor. Aber die damit unterstellte schlidrte Isomorphie der
Verteilungen an Spitze und Basis dürfte eine problematische Verkürzung der empi-
rischen Realität darstellen. Der skizzierte Ansatz impliziert vielmehr, daß die Analyse
des ideologisdren Konflikts bloß als horizontale Interaktion von Parteien (bzw. Über-
zeugungssystemen), die sich als Häufigkeitsverteilung besdrreiben läßt, der Virklich-
keit nicht ausreidrend gerecJrt wird. Auch dies läßt sich am Beispiel Frankreichs illu-
strieren.
Die Kommunalpolitik in kleinen und mittleren französischen Gemeinden ist wiederholt
unter dem Aspekt ihrer eigentümlichen Konfliktstruktur untersudrt worden. Sie er-
sdreint in diesen Untersuchungen als ein konsensuelles Subsystem, was mit der Hypo-
these von der geringen Polarisierung der französischen Wählerschaft durchaus in Ein-
klang zu bringen ist. Der kommunalpolitische Konsensus ist freilicl nicht im Sinne der
Tönniessdten ,Gemeinschaft" zu verstehen; vielmehr ist eine starke Isolierung der Fa-
milien und geringe Bereitwilligkeit zur Kooperation beobachtet worden. Doc} die fran-
zösischen Dorfbewohner und Kleinstädter erscheinen nicht als polarisiert zwischen riva-
lisierenden politischen Gruppierungen; sie abstrahieren vielmehr von den nationalen
Parteigegensätzen und finden sich statt dessen in einem negativen Konsensus gegenüber
der Außenwelt und insbesondere den Behörden (uilso) 1se. Es besteht die Tendenz, jede
Gruppe im Gemeinderat repräsentiertz;.r sehen zur Aufhebung der Gegensätze in einer
unpolitisdren Flarmonie, die auf der Fiktion beruht, daß Kommunalpolitik statisdren
Sachgesetzliclkeiten unterliege und keine politischen Alternativen kenne, und die der
partriardralischen Autorität des Maire als Grundlage dient. Dieser vertritt die kon-
fliktlos gemadrte Gemeinde gegenüber der Außenwelt, und eben diese Funktion ermög-
licht es ihm, den unpolitischen Konsensus zu manipulieren 140.
Der negative Charakter dieses Konsensus - in dem doppelten Sinne, daß er auf Ab-
wehr gegenüber der Umwelt und auf der Ausschließung von politischen Alternativen
beruht - läßt sidr aber u. E. ausreichend nur als Element des Konfliktes zwisdren "Zen-
rrum<< und "Peripherie" 141 erklären, und dieser Konflikt kann nicht bloß als horizon-
tale Interaktion, unter Vernachlässigung der aertihalen Herrschaftsrelationen im poli-
tischen System beschrieben werden. Vielmehr ist Konsensus bei den \fählern offenbar
ein Konsensus der herrsclaftsunterworfenen uPeripherieu in ihrer Abwehrstellung ge-
genüber flsrn ,rZentrum<< - der Regierung, der Bürokratie. Es liegt die - freilich weit-
lss Lucien Bernot und Renö Blancard.: Nouville, Un village frangais (1953); Laurence Wylie:Village in the Vaucluse (1964).r40 Mdrh Kesselrnann: The ambiguous consensus, A study of local government in France(1967), S. 150 u. ö.141 Diese Begrif fe hier im Sinne von Lipset/Rokkan: Cleavage structures... , a.a.O., S. 35 ff .
3t2 Gerbard Lebmbrach
4.3. V ertikale Dimensionen der Konfliktstrwkturen
Man könnte den hier skizzierten Dreischichtenansatz einer Analyse von Konfliktstruk-
ruren so auffassen, daß hier lediglich drei als horizontale räumliche Kontinua zu be-
sdrreibende Häufigkeitsverteilungen in geeigneter Weise zu aggregieren seien. Uni-
modale Verteilung der Präferenzen bei der Vählersdraft einerseits, den Parteiführern
andererseits würden dann als konvergierende Bedingungen von Stabilität im Sinne des
liberalen Konsensuspostulats erscheinen, Polarisierung bei Parteiaktivisten als "dys-
funktionaler., Störungsfaktor. Aber die damit unterstellte schlidrte Isomorphie der
Verteilungen an Spitze und Basis dürfte eine problematische Verkürzung der empi-
rischen Realität darstellen. Der skizzierte Ansatz impliziert vielmehr, daß die Analyse
des ideologisclen Konflikts bloß als horizontale Interaktion von Parteien (bzw. Uber-
zeugungssystemen), die sidr als Häufigkeitsverteilung beschreiben läßt, der Virklich-
keit nicht ausreic}end gereclt wird. Auch dies läßt sich am Beispiel Frankreichs illu-
strieren.
Die Kommunalpolitik in kleinen und mittleren französisdren Gemeinden ist wiederholt
unter dem Aspekt ihrer eigentümlic}en Konfliktstruktur untersuclt worden. Sie er-
sdreint in diesen Untersuchungen als ein konsensuelles Subsystem, was mit der Hypo-
these von der geringen Polarisierung der französischen \Wählersdraft durchaus in Ein-
klang zu bringen ist. Der kommunalpolitisdre Konsensus ist freilich nicht im Sinne der
Tönniessdten ,rGemeinschaft" zu verstehen; vielmehr ist eine starke Isolierung der Fa-
milien und geringe Bereitwilligkeit zur Kooperation beobachtet worden. Doch die fran-
zösisdren Dorfbewohner und Kleinstädter erscheinen nicht als polarisiert zwischen riva-
lisierenden politischen Gruppierungen; sie abstrahieren vielmehr von den nationalen
Parteigegensätzen und finden sich statt dessen in einem negativen Konsensus gegenüber
der Außenwelt und insbesondere den Behörden (uils") 1se. Es besteht die Tendenz, jede
Gruppe im Gemeinderat repräsentiertztr sehen zur Aufhebung der Gegensätze in einer
unpolitiscJren Harmonie, die auf der Fiktion beruht, daß Kommunalpolitik statisdren
Sachgesetzlichkeiten unterliege und keine politischen Alternativen kenne, und die der
partriardralischen Autorität des Maire als Grundlage dient. Dieser vertritt die kon-
fliktlos gemachte Gemeinde gegenüber der Außenwelt, und eben diese Funktion ermög-
licht es ihm, den unpolitiscJren Konsensus zu manipulieren 140.
Der negative Charakter dieses Konsensus - in dem doppelten Sinne, daß er auf Ab-
wehr gegenüber der Umwelt und auf der Ausschließung von politiscJren Alternativen
beruht - läßt sich aber u. E. ausreichend nur als Element des Konfliktes zwischen "Zen-
rrum<< und nPeripherieo ur .rHär.n, und dieser Konflikt kann nicht bloß als horizon-
tale Interaktion, unter Vernadrlässigung der vertikalen Herrschaftsrelationen im poli-
tischen System beschrieben werden. Vielmehr ist Konsensus bei den \üählern offenbar
ein Konsensus der herrsdraftsunterworfenen "Peripherie" in ihrer Abwehrstellung ge-
genüber dem ,>Zentrum(< - der Regierung, der Bürokratie. Es liegt die - freilich weit-
rls Luc;en Bernot wd Renö Blancard: Nouville, Un village frangais (1953) ; Laurence Wylie:
Village in the Vaucluse (1964).140 Mark Kesselrnann: The ambiguous consensus, A study of local government in France(1967), S. 150 u. ö.irr pf.r. Begrif fe hier im Sinne von Lipset/Rokhan: Cleavage structures .. . ,a.a.O., S. 35 ff .
S truh tar en id e olo gi s ch e r K onl lih t e b e i P ar t e ie nw e t t b e w e rb
gehend spekulative - Hypothese nahe, daß wir diese Interaktionsbeziehung als charak-
teristisch für das politische System Frankreichs insgesamt und als bestimmend für die
Rollenorientierungen der politischen Akteure bis hinauf zu den Parteiführern ansehen
müssen. Crozier hat in seiner bekannten Analyse gezeigt, wie die bürokratische Autori-
tät in Frankreich Konflikte schiedsrichterlidr regelt, die infolge der schwach entwid<el-
ten Kooperation unter Gleidrgestellten anders niclt geregelt werden können 142. Dem
korrespondiert andererseits die starke Betonung des Elemenm der Kontrolle in den
Rollenorientierungen des Parlaments- und Parteiensystems, ja die Identifikation von
Demokratie mit Viderstand und Kontrolle. \flie es nach Auffassung einer namhaften
Autorität in der III. Republik die Aufgabe der Minister war, die Bürokratie zu kon-
trollieren 1{3, so wurden die Minister durch die Abgeordneten und diese durch die "mili-
tants> in den Parteiorganisationen kontrolliert. Das ist das Regime der Kontrolleure,
wie es Alain mit seiner Doktrin dgs "citoyen contre les pouvoirs> vorgesdrwebt fixs 1aa.
Die Artikulierung von politischen Alternativen tritt - so wird man sagen dürfen - bei
solclen Rollenorientierungen zwangsläufig in den Hintergrund.
Nimmt man die vertikalen Dimensionen des ideologischen Konflikts in den Blid<, wie
sie hier offenbar bestimrrrend sind, dann ersdreint das geläufige Konsensuspostulat als
eine Verengung der Fragestellung der normativen Demokratietheorie. Diese wird sidr
vielmehr auf die Bedingungen der Teilnahme an politisdren Entscheidungsprozessen
erstred<en müssen, wobei es nicht ausreidren kann, einfach existierende Interaktions-
beziehungen als funktional bzw. dysfunktional zu qualifizieren, etwa im Sinne der
früher erwähnten Doktrin, daß die Apathie der politisch nicht engagierten'Wähler zur
Stabilität des demokratischen Systems beitrage. Diese wird, wenn man die dynamisclen
Aspekte der Wähler-Eliten-Kommunikation im Auge behält, nur als kurz- oder mittel-
fristige Stabilität angesehen werden können - ganz abgesehen davon, daß auch das
gängige Stabilitätspostulat eine problematisc}e Verkürzung der normativen Demokra-
tietheorie darstellt. Demgegenüber stellt sich die Aufgabe - die hier nur angedeutet
werden soll -, Möglichkeitsspielräume sinnvoller Partizipation und damit einer Ver-
änderung der existierenden vertikalen Konfliktstrukturen auf der Grundlage empiriscl
bewährter Hypothesen theoretisch zu durchdenken und damit zur Uberwindung der
falschen Alternative von bloß "affirmativer,, Sozialforschung einerseits, spekulativer
Geschichtsprophetie andererseits beizutragen 1as.
ßz yigfusl Crozier: Le phdnomöne bureaucratique (1963), 5. 279 ff.rtt Josepb-Barthölömy.'Le gouvernement de la France (19242), S. 115. Für diesen Staatsrec}ts-lehrer und konservativen Parlamentarier war Instabilität der Minister funktional im Sinne derI(ontrolle: Verblieben sie zu lange in ihrem Amte, so würden sie sidr mit der Bürokratie identi-[izierer-r und die Verwaltung gegenüber dem Parlament vertreten (was ntdr Bagehor bekanntlidrz-u den Funktionen englischer Minister gehört!) statt umgekehrt.tu ygf. Alain (d. i. Emile-Anguste Chartier): Elements d'une doctrine radicale (1929).t45 Als einen Ansatz in der hier gemeinten Ricltung vgl. jetzt die lJntersuchung von FriederNascbold,: Organisation und Demokratie, a.a.O. (vgl. Anm. 102), die den Mögli&keiten einersinrrvollen Partizioation von Partciaktivistcn eilt.
313