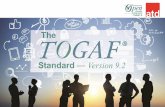Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
Transcript of Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck
Raumplanerische Anpassung an denKlimawandel im Spiegel aktueller Projekte
Adjustment ofspatial planning to climate changereflected by current projects
Schlagworten Anpassung an den Klimawandel, Raumplanung, Regionalplanung,Informationstransfer, Naturgefahren
Keywords: adaptation to climate change, spatial planning, regional planning,information transfer, natural hazards
Kurzfassung
Die raumliche Planung kann bei der Anpassung an den Klimawandel in ihrer Funktion als tiberortliche und tibergeordnete Planung einen wichtigen Beitrag leisten. Eine Reihe von Forschungsaktivitaten im Bereich Anpassung ist in den letzten Iahren gestartet worden, vielfach auch mit explizitem Bezug zur Raumplanung. In diesem Bericht wird ein thematisch gegliederter Uberblicktiber aktuelle Projekte gegeben. Daraufaufbauend werden Schlussfolgerungen beztiglich derWeiterentwicklung der Raumplanung und der Verbesserung ihrer Handlungsoptionen formuliert.
Abstract
Spatial planning understood as a comprehensive planning and supra-local planning can makean important contribution to adaptation to climate change. A number ofproject activities dealingwith adaptation have started in recent years - often including a specific reference to spatial planning. This article aims at giving a thematic review ofrecent projects and to draw conclusions for afurther advancement ofspatial planning and spatial research.
1 Einleitung
Welchen Beitrag kann die Raumplanung beim Umgang mitden Folgen des Klimawandels leisten? Diese Frage wird inder Fachwelt inzwischen intensiv diskutiert; erste Empfehlungen, Ansatze und zum Teil auch bereits Erfahrungen liegen vor, die sowohl im Bereich des Klimaschutzes("Mitigation") als auch in der Klimaanpassung ("Adaption") Handlungsmoglichkeiten fur die Raumplanung aufzeigen. In Bezug auf die Anpassung reicht die Spannweite dabei von informellen Ansatzen wie Akteursnetzwerken(vgl. Schlipf et al. 2008) oder dem Aufbau von Risk-Governance-Strukturen (vgl. Furst 2007, Greiving & Fleischhauer 2008) bis hin zu den Moglichkeiten der formalen Instrumente der Raumordnung sowie den entsprechendenFestlegungen im Baugesetzbuch (BauGB) und Raumordnungsgesetz (RaG) (vgl. Fleischhauer & Bornefeld 2006).Dabei wird zwar haufig die Notwendigkeit der Integrationvon Mitigation und Adaption oder zumindest des Nebeneinanders beider Ansatze unterstrichen, jedoch werdenHandlungsfelder der Raumordnung v.a. bei der Anpassunggesehen(vgl. Ritter 2007; Greiving & Fleischhauer 2008).
182
Eine bedeutende Rolle der Raumplanung bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird durch ihrenquerschnittsorientierten Charakter einerseits, durch denunterschiedliche sektorale Strategien zusammengefUhrtund abgestimmt werden konnen, und den raumlichen Bezug der Folgen des Klimawandels andererseits begrtindet(vgl. Greiving & Fleischhauer 2008, Overbeck et al. 2008).Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des raumplanerischen Instrumentariums ist angesprochen worden (ebd.sowie Birkmann & Fleischhauer in diesem Band).
Zu Klimaschutz und -anpassung allgemein sind in denletzten Jahren eine Reihe von Forschungsprojekten ins Leben gerufen worden, auch aufgrund entsprechender Forderaktivitaten, in Deutschland z.B. die Forderinttiative klimazwei - Forschung Jilr den Klimaschutz und Schutz vorKlimawirkungen des Bundesministeriums fur Bildung undForschung (BMBF). I Daneben existieren transnationaleProjekte, angestofsen durch Bl.l-Porderprograrnme. Durchden BMBF-Regionalwettbewerb KLIMZUG C"KlimawandeIin Regionen zukunftsfahig gestalten") kommen ab 2008
RuR2/2009
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
QueUe:auf Basis von mit Raumplanung im Bezug stehenden Projekten im Projektkatalog von KomPass; eigene Systematisierung
Tabelle IThemenbereiche von Forschungsprojekten im Uberblick
2 Oberblick fiber die Themenbereiche inaktuellen Forschungsprojekten zur Anpassungan den Klimawandel
- mit dem Thema .Exrremereignisse in urbanen Raumen."Einige wenige Vorhaben untersuchen integrative Ansatzevon Adaption und Mitigation. Lediglich bei 4 Projekten imProjektkatalog steht explizit die raumliche Planung im Vordergrund (vgl.Tab. I).
3 Ansatze zum Umgang mit Klimafolgen inaktuellen Porschungsprojekterr'
Im Projekt ADAM werden Optionen und Zielkonflikte zwischen Anpassungs- und Vermeidungsstrategien gegentiber dem Klimawandel identifiziert und analysiert. Einerseits solI untersucht werden, wie der Temperaturanstieg ineiner sozial und okonomisch vertraglichen Weise auf 2°Cbegrenzt werden kann, andererseits sollen jedoch auchHandlungsoptionen ftir den Fall entwickelt werden, dassdieses Ziel nicht erreicht wird. Grundlage hierfur soll dieAnalyse von Vulnerabilitat und Anpassungskapazitaten inEuropa sein. Die Effektivitat unterschiedlicher strategischer Politikoptionen fur die diversen Stakeholder sowieEntscheidungstrager soIl verdeutlicht werden.
Integrierte Vorhaben: Kombinierte Adaptions- undMitigationsstrategien
Zu den Vorhaben, bei denen Mitigation und Adaption ausdnicklich in einem integrierten Ansatz betrachtet werden,zahlen die Projekte AMICA - Adaptation and Mitigation- an Integrated Climate Policy Approach (2005-2007) undADAM - ADaptation and Mitigation Strategies:supportingEuropean climate policy (2006-2009). Wahrend ADAM sichvor allem mit der Frage beschaftigt, welchen Beitrag Politiken auf der EU-Ebene zu Mitigation und Adaption leisten konnen, hat AMICA lokale und regionale Strategien inkonkreten Projektregionen entwickelt, die Adaption undMitigation sowie langfristige Klimaschutzmafsnahmen mitkurz- und mittelfristigen AnpassungsmaJSnahmen kombinieren. Eine Matrix von Mafsnahmen zur Integration vonMitigation und Adaption wurde erarbeitet, die sich auf dreiBereiche konzentrieren und nach Auffassung von AMICAdie "gemeinsame Basis" fur Adaption und Mitigation darstellen: Energie, Bauweisen und Raumplanung. Etwa 40integrierte Malsnahmen wurden drei Typen von "mitigation benefits" und zwei Typen von "adaptation benefits" zugeordnet. Ftir den Bereich Raumplanung wurden Mitigations-Benefits zur Energieeffizienz und -einsparung, zurNutzung erneuerbarer Energien und zur COz-Bindung inBiomasse in Bezug gesetzt zu Adaptions-Benefits wie Warmekornfort, Risikopravention (gegentiber Klimaextremen)und urbaner Biodiversitat. Auf der Projekt-Website sindListen von Malsnahmenvorschlagen bzw. "tools" sowohlfur den Bereich Klimaschutz als auch furAnpassung abrufbar,"
4
3
2
Anzahl
8
7
5
4
KOstenschutz
Nachhaltiges Wassermanagement undHochwassermanagement
Anpassung an den Klimawandel - regional
Weitere Projekte mit sektoralem Bezug (Forst,Naturschutz)
DieRolle der Raumplanung bei der Anpassung anden Klimawandel
Extremereignisse in urbanenRaumen
Integrierte Vorhaben: Kombinierte Adaptions-undMitigationsstrategien
weitere Projekte zur regionalen Anpassung an den Klimawandel dazu, ebenso sind Modellvorhaben der Raumordnung (MORa) geplant. Dazu kommen weitere spezifischePorderaktrvitaten in einzelnen Bereichen, die auch mitdem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden,z.B, die BMBF-Fi:irderaktivitiit RIMAX - Risikomanagement extremer Hochuiasserereignisse'.
Ziel dieses Beitrags ist es, einen Uberblick tiber aktuelldurchgeftihrte oder kurzlich abgeschlossene Projekte zurAnpassung an den Klimawandel mit Bezug zur Raumplanung zu geben und somit einen Beitrag zum Informationstransfer zu leisten. Die Auswahl der Projekte stutzt sichvornehmlich auf den Projektkatalog Klimafolgen und Anpassung' des Umweltbundesamts, einige weitere Projekte wurden erganzt, Ein Anspruch auf Vollstandigkeit wirdnicht erhoben. Der Fokus liegt auf Projekten in Deutschland oder zumindest mit deutscher Beteiligung, es werdenjedoch auch einige europaische Projekte oder Projekte derNachbarlander genannt. Es ist zu erwarten, dass bis zurDrucklegung des Beitrags weitere Aktivitaten in diesem aktuellen und wichtigen Forschungsfeld dazu kommen werden, auf regionaler und Landes-, nationaler wie europaischer Ebene.
Von den insgesamt 88 aufgefuhrten Projekten im KomPassProjektkatalog (Stand: 31.07.2008) wird der Begriff "Raumplanung" bei 33 Projekten in der Projektbeschreibung bzw.unter den Rubriken .Sekroren und Handlungsfelder" oder.Akteure" genannt oder in der Projektbeschreibung naher erlautert - auch wenn meist spezifische sektorale Fragestellungen im Vordergrund stehen. Schwerpunkte derProjekte liegen v.a. in den Bereichen .Hochwasserrtsikomanagement" bzw. .nachhaltiges Wassermanagement"allgemein sowie Kustenschutz. Drei Vorhaben befassensich - mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten
RuR2/2009 183
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
Die RoUeder Raumplanung bei der Anpassungan den Klimawandel
Projekte, die sich schwerpunktmalsig mit der Rolle derraumlichen Planung bei der Anpassung an den Klimawandel befassen, sind die bereits abgeschlossenen INTERREGVorhaben ESPACE und ASTRA, das Projekt ARMONIA, derARL-Arbeitskreis "Klima wandel und Raumplanung' sowiedas Leibniz-Vorhaben KLIMAPAKT.
Das Projekt ESPACE - European Spatial Planning: Adaptingto Climate Events (2003-2008) baute vor allem auf Erfahrungen und Projektergebnissen aus der Wasserwirtschaftauf - der bayerische Projektbeitrag befasste sich mit derFlussgebietsplanung an der Frankischen Saale (vgl. Kleinhans &Weber 2006) -, die Projektergebnisse wurden dannin der Gesamtdarstellung jedoch bewusst auf Raumplanung bezogen. AbschlieEend wurden 14 allgemeine Empfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel fur die unterschiedlichen Verwaltungsebenen von der europaischenbis zur kommunalen Ebene erarbeitet und dabei gefordert,Anpassung zu einem "grundlegenden Ziel der Raumplanung" zu machen." In der zweiten Phase (2008) stand dieldentifizierung von Hemmnissen im Vordergrund, die sichbei der Umsetzung von Anpassungsmafsnahmen ergeben;ein Output war z.B. eine "Decision Support Guidance" furAkteure der Raumplanung.'
ASTRA - Developing Policies& Adaptation Strategies to Climate Change in the Baltic Sea Region (2005-2007) ist dasNachfolgeprojekt von SEAREG (s.u.) und widmete sich derEntwicklung von Anpassungsstrategien im Ostseeraummit einem Schwerpunkt auf Fragen der Raumentwicklung.Dafur wurden bereits existierende Anpassungsstrategienzusammengestellt und - ahnlich wie in ESPACE - ein Strategiepapier mit politischen Leitlinien und Empfehlungenerarbeitet, wobei insbesondere die Notwendigkeit integrierter Ansatze ("holistic approach") und der Kombinationvon top-down- und bottom-up-Ansatzen herausgestelltwurde (vgl. Hilpert et al. 2007).
Ansatzpunkt des ebenfalls abgeschlossenenVorhabens ARMONIA - Applied Multi Risk Mapping ofNatural Hazardsfor Impact Assessment (2004-2007) war die Erkenntnis,dass die Verwundbarkeit von Siedlungsbereichen gegeniiber Extremereignissen v.a. auch darauf zuriickzufuhrenist, dass Planungsgesetzgebung und Planungspraxis raumliche Risiken noch nicht ausreichend beachten. Im Projektwurden Studien zum Umgang mit Naturgefahren durchraumliche Planung in acht europaischen Landern erstelltund Anforderungen der Raumplanung im Umgang mitNaturgefahren identifiziert. Zielwar es, Grundlagen fur dieErarbeitung von integrierten Risikokarten und den raumplanerischen Umgang mit Naturgefahren in besondersbetroffenen Regionen zu entwickeln (Fleischhauer et al.2006). Entsprechend wurden Empfehlungen zur Harmonisierung von Methoden zur Bewertung von Naturgefahren in Europa gegeben. In der zusammenfassenden Ana-
184
lyse wird vor allem die Bedeutung der Weiterentwicklungdes hazard assessment hervorgehoben (vgl. Greiving 2006).
Ziel des ARL-Arbeitskreises .Klimauiandel und Raumplanung' (seit 2007) ist es, Grundlagen zum Themenbereich Klimawandel und Raumplanung bereitzustellen,die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis zufordem.i.Good-Practice Beispiele" auf unterschiedlichenraumlichen Ebenen aufzubereiten und somit insgesamtherauszuarbeiten, welchen Beitrag Raumplanung bei derAnpassung an den Klimawandelleisten kann. 1m 2008 angelaufenen Projekt KLIMAPAKT - Anpassung an den Klimawandel durch riiumliche Planung - Grundlagen, Strategien, Instrumente (2008-2010), einem Projekt der ARLund ihren Kooperationspartnern, sollen die Handlungsmoglichkeiten der Raumplanung iiberpriift und Vorschlage zur Weiterentwicklung des Instrumentariums gemachtwerden. Dabei stehen in enger Zusammenarbeit von Klimafolgen- und Vulnerabilitatsforschung sowie der Raumplanung methodische und konzeptionelle Aspekte imVordergrund. Ziel des Projektes ist daruber hinaus, denAustausch zwischen relevanten Aktivitaten in Wissenschaftund Praxis zu fordern.
In den Niederlanden, die aufgrund ihrer topographischenLage besonders von den Auswirkungen des Klimawandelsbetroffen sein werden, wird der Raumplanung beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels eine hohe Bedeutung zugesprochen. Dies aufsert sich z.B. in den zahlreichen Aktivitaten des nationalen ForschungsprogrammsCcSP - Climate changes Spatial Planning (2004-2011), dasin Zusammenarbeit mit ftinf Ministerien, u.a. mit dem Ministerium fur Wohnungswesen, Raumplanung und Umwelt(VROM), regionalen und lokalen Behorden, dem Privatsektor und NGOs entwickelt wird. Das Programm zielt daraufab, den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und (Raumplanungs-)Praxis sowie die Erarbeitungvon wissenschaftlich fundierten Ergebnissen zum Klimawandel und dessen Folgen zu fordem sowie Vorschlage furAnpassungsmalsnahmen verfugbar zu machen. .Klimawandel" und .Klimavariabilitat" sollen kiinftig feste Bestandteile in den Leitbildern der Raumplanung in den Niederlandensein. Informationen zu den Einzelprojekten in den drei Bereichen Mitigation, Adaption und Integration sind auf derWebsite des Forschungsprogramms erhaltlich,"
Auf europaischer Ebene untersuchte das ESPONJ Project1.3.1 The spatial effects and management of natural andtechnological hazards in general and in relation to climatechange (2000-2006) die raumliche Verbreitung von aktuellen natiirlichen und technologischen Gefahren (Hazards)auf NUTS3 1O- Ebene im ESPON-Raum. Ergebnisse des Projekts waren die Erstellung individueller "Hazard maps"zu 11 verschiedenen Gefahrentypen (Naturgefahren undtechnologische Risiken), einer "Integrated hazard map",sowie "Risk maps" zu den gegeniiber verschiedener Hazards am meisten gefahrdeten Gebieten. Die untersuchten Hazards wurden entsprechend ihrer Raumrelevanz
RuR2/2009
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
ausgewahlt, wobei fur neun der Naturgefahren ein Impaktpotential durch den Klimawandel angenommen wurde (Schmidt-Thorne 2006, 18f). Es wurden Politikempfehlungen ausgegeben, die von der Forderung der Integrationvon Risikomanagement in die Etl-Kohasionspolitik und indie Strategische Umweltprtifung (SUP) bis hin zu Umsetzungsempfehlungen auf nationaler Ebene reichten, z.B.eine garantierte und einheitliche Umsetzung der SUP inklusive der Berticksichtigung potentieller Risiken und Vulnerabilitat (ebd., 21).
Anpassung an den Klimawandel- regional
Vor allem die uberkommunale bzw. regionale Ebene ist furdie Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmafsnahmen relevant (vgl. Ritter 2007). Als ein spezifisch regionalerAnsatz ist der Aufbau von Akteursnetzwerken zu nennen.Das wohl bekannteste ist KIARA-Net (2006-2011), ein Projekt in der Region Starkenburg, in dem unter Mitwirkung aller relevanten Akteure Handlungs- und Umsetzungskonzepte zur regionalen Anpassung an den Klimawandel erarbeitetwerden. In vier Themengruppen (Land- undForstwirtschaft,Weinbau; Bau- und Wasserwirtschaft, Planung; Gesundheit;Tourismus; wurden Handlungsbedarfe in einem partizipariven Prozess identifiziert (vgl. Frommer & Herlitzius 2007).KLARA-Net mochte Impulse geben, die von der Entwicklung von Malsnahmen zur BewaItigung und Verringerungvon Klimaschaden tiber Anpassungsmoglichkeiten unterschiedlicher wirtschaftlicher Branchen bis hin zur Identifikation von Umsetzungsinstrumenten ftihren sollen. In derThemengruppe Bau- und Wasserwirtschaft, Planung wurde eine .Checkliste zur Klimaanpassung fur Kommunen"erarbeitet, die deutlich macht, dass viele Anpassungsmalsnahmen schon mit geringem Aufwand durchfuhrbar sind. II
In der 2008 angelaufenen zweiten Projektphase sollen v.a.Strategien entwickelt werden, wie die Anpassungserfordernisse aus der Region insbesondere der reguiativen und legislativen Ebene vermittelt werden konnen und wie die tatsachliche Implementierung von Anpassungsmafsnahmenbeschleunigt werden kann.
Weitere Beispiele fur Netzwerke auf regionaler Ebene sinddie Projekte KWU - KlimaWandel Unterweser - informieren, erkennen, handeln (2007-2009) sowie KlimaFolgenManagement - Regionales Management von Klimafolgenin der Metropolregion Hannouer-Braunschuieig-Giittingen (seit 2006). In der Region Unterweser stehen Komrnunikationsformen zum Klimawandel irn Vordergrund. Eswerden gemeinsam mit Akteuren aus den Bereichen Tourisrnus, Stadt- und Regionalplanung und LandwirtschaftMethoden und Materialien entwickelt, mit denen Risiko- und Chancenbewusstsein vermittelt und somit HandIungsmoglichkeiten identifiziert werden sollen. Das Verbundprojekt KlimaFolgenManagement verfolgt das Ziel,ubertragbare Managementstrategien zum Klimawandel zuentwickeln und in ausgewahlten Raumen der Metropolregion umzusetzen. Hierzu soll ein Wissensnetzwerk fur Akteure aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik mittels Un-
RuR2/2009
terstiitzung einer internetbasierten Informations- undKommunikationsplattform entstehen und Mafsnahmen zuInformation und Offentlichkeitsarbeit erfolgen.
Die Auswirkungen des Klimawandels im Alpenraum sindGegenstand des Projekts ClimChAlp - Climate Change,Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space(2006-2008). Es wurde eine breites Spektrum von Themenbereichen behandelt, urn eine Einschatzung tiber raumbezogene Spannungsfelder in den jeweiligen Modellregionenzu erlangen; ein Arbeitspaket betrachtet dabei die Auswirkungen des Klimawandels auf Raumentwicklung undWirtschaft. Am Fallbeispiel Berchtesgadener Land wurdeuntersucht, inwiefern raumplanerische Instrurnente (LEPBayern und Regionalplan Sudoberbayern) geeignet sind,den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu begegnen; bisherige Ansatze im Umgang mitalpinen Naturgefahren wurden dabei grundsatzlich positiv bewertet, jedoch auch auf die Notwendigkeit einer tatsachlichen Umsetzung von Zielen und Grundsatzen in derPraxis und in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren/lnstitutionen sowie die Benicksichtigung sich durchden Klimawandel andernder Gefahrenpotenziale - im Projekt wurden hierzu methodische Beitrage und Darstellungen von Best-Practice-Beispielen geleistet - hingewiesen(vgL Hiller & Probst 2008).
Mit Anpassungsstrategien an die raumrelevanten Auswirkungen des Klimawandels auf regionaler Ebene werden sich ab 2009 auch Modellvorhaben der Raumordnung(MORa) befassen. 1m Auftrag des Bundesamts fur Bauwesen und Raumordnung (BBR) wird im Zeitraum 2008-2009ein Forschungsprojekt zur Vorbereitung der Modellvorhaben durchgefuhrt, das besonders betroffene Regionen(sag. .Klunarisikogebiete") bestimmen und zur Identifizierung raumordnerischen Handlungsbedarfes (sog. "Klimawandel-Aktionstypen") Schutz-, Minderungs- und Anpassungsstrategien entwickeln will.12
Kiistenschutz
Ein GroEteil der aktuellen Projekte behandelt die Auswirkungen des Klimawandels in Ktistengebieten und entwickelt z.B. Strategien zur Reduzierung von Risiken aufgrund des erwarteten Meeresspiegelanstiegs, behandeltMoglichkeiten der Vorsorge gegen Sturmfluten oder erarbeitet Grundlagen zur Thematisierung des Klimawandelsim Rahmen des Integrierten Kilstenzonenmanagements(lKZM). Grundlagen fur Anpassungsmafsnahrnen wurdenim internationalen Projekt SafeCoast - Keeping our feet dryin the north sea lowlands (2005-2008) erarbeitet, das sichmit den Folgen des Klimawandels fur die Nordseektisteim Iahr 2050 befasst. Es wurden Empfehlungen erarbeitet, wie ein Hochwasserrisikomanagement die Prinzipienund Erkenntnisse des IKZM nutzen kann, urn angemessene Reaktionen der Raumplanung sicherzustellen. Betontwird auch hier die Notwendigkeit eines "more integratedapproach to coastal risk management, where the main as-
185
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
peets of integration would include: different types of problems, developments, stakeholders, solutions, and typesand scales of planning" (vgl. Roode et al. 2007). Das Projekt SEAREG - Sea Level Change Affecting the Spatial Development in the Baltic Sea Region (2002-2005), befasste siehin erster Linie mit der Bewertung von Klimafolgen in derOstseeregion und nieht mit Anpassungsmafsnahmen: letztere wurden im Nachfolgeprojekt ASTRA erarbeitet (s.o.).In SEAREG wurde ein Entscheidungsunterstiitzungssystemfur die Bewertung der Klimafolgen, insbesondere fur denMeeresspiegelanstieg und das Abflussmuster der Fltisse,erarbeitet, das regionalen und lokalen Planungsstellen imgesamten Ostseeraum zugute kommen sollte." Das Projekt ComCoast - Combined Functions in Coastal DefenceZones (2004-2007) untersuchte fur elf Fallstudien die Moglichkeiten .multifunktionaler", eher flachen- als linienhafter, Kustenschutzzonen im Nordseeraum. Eine Ubersichtder Projektergebnisse ("Guide to the products "J gibt Empfehlungen aus, wie derartige Kustenschutzlosungen auchandernorts erzielt werden konnen.!' Weitere, jedoch schonzeitlich langer zuruck liegende und hier daher nicht naherbetrachtete Projekte, sind z.B. COMRISK (Vorgangerprojekt von SafeCoast, 2002-2005) und KRIM (Grundlagen furRisikomanagement, 2001-2004) u.a.
Extremereignisse in urbanen Raumen
Gerade in urbanen Raumen werden die Schaden durchwitterungsbedingte Extremereignisse aller Voraussiehtnach durch den Klimawandel vielfach zunehmen, wennkeine entsprechende Anpassung erfolgt. Der Verbesserungdes Grundlagenwissens zu Sturzfluten und der Erarbeitung von Handlungsvorschlagen widmete sich das RlMAXVorhaben URBAS - Urbane Sturzfluten: Vorhersage undManagement von Sturzfluten in urbanen Gebieten (2005
2008). Speziell fur die Zielgruppe Kommunen wurden Vorschlage fur Vorsorge- und Handlungsoptionen entwickelt;aus planerischer Sieht interessant sind hier v.a. die Empfehlungen zur Bereitstellung von kommunalen Gefahrenund Risikokarten fur Sturzfluten." Ein weiteres Vorhabenin diesem Themenbereieh ist UFM- Urban Flood Management (2006-2008), das sich mit dem erhohten Risiko vonUberflutungen im Zuge des Klimawandels und Alternativen zur rein technischen Losung mit sukzessiven Deieherhohungen auseinandersetzte, die Leben am bzw. mit dem(Hoch-)Wasser ermoglichen. 1m Fokus stand u.a. die Elbinsel Wilhelmsburg in Hamburg, fur die ein System gestaffelter Deichlinien konzipiert wurde, urn im Schadensfallzur Risikominderung und erhohter Resilienz beizutragen.Die Ergebnisse zweier Workshops zu hochwasserangepassten Siedlungsstrukturen bzw. alternativen Schutzkonzepten fur Wilhelmsburg konnen auf der Website des Projekts abgerufen werden."
1m Projekt KLIMES - Planerische Strategien und stadtebauliche Konzepte zur Reduzierung der Auswirkungen von klimatischen Extremen aufWohlbefinden und Gesundheit vonMenschen in Stiidten (2006-2009) werden Anpassungsstra-
186
tegien fur die Stadtplanung und raumliche Konzepte erarbeitet, die die negativen Auswirkungen von Hitzeperiodenoder Hitzewellen auf den Menschen reduzieren sollen. Zielist die Erarbeitung stadtklimatischer Leitfaden, die ein klimawandelgerechtes Planen und Bauen ermoglichen sollen (vgl.Mayer 2008).
Nachhaltiges Wassermanagement undHochwassermanagement
Haufigere Starkregenereignisse und langere Trockenzeiten,die durch den Klimawandel zumindest in einigen Regionen zu erwarten sind, werden moglicherweise zu Problemen der Entwasserungssysteme fuhren. Lange Trockenperioden und ein Anstieg der mittleren Jahreslufttemperaturkonnen aulserdem zu einer Verringerung der verfugbarenWasserressourcen und somit zur Cefahrdung der Trinkwasserversorgung fuhren. Im Projekt KlimaNet - Wassersensible Stadtentwicklung: Netzwerk Jilr eine nachhaltige Anpassung der regionalen Siedlungswasserwirtschaft anKlimatrends und Wetterextreme (seit 2006) sollen - ebenfalls schwerpunktmafsig fur urbane Raume - nachhaltigeLosungen zur Anpassung der Trinkwasserversorgung anden Klimawandel erarbeitet und deren Umsetzung angestofsen werden, auch unter Einbeziehung der Folgen desdemografischen Wandels und der Moglichkeiten des Stadtumbaus. Hierzu wurde ein interdisziplinares Kompetenznetzwerk zu den Bereiehen Siedlungswasserwirtschaft,Stadtbauwesen, Wasserversorgung und Sozial- und Naturwissenschaften eingerichtet, in dem bestehendes Wissengebtmdelt und zukunftsfahige Strategien entwickelt werden sollen. Mit einem nachhaltigen Management der Ressource Wasser befasst sieh auch das Projekt GLOWA-Elbe- Auswirkungen des globalen Wandels auf Umwelt und Gesellschaft im Elbegebiet (2000-2010), ein Teilvorhaben desProjekts "Globaler Wandel des Wasserkreislaufes" (GLOWA). Es sollen Entscheidungsunterstutzungssysteme erarbeitet werden, die zu einem nachhaltigen Wassermanagement beitragen. Integrative Strategien sollen zum einendie Verfugbarkeit des Wassers, zum anderen seine Qualitat und Verteilung gewahrleisten, Die Ergebnisse der ersten Projektphase - Szenarienrechnungen und Vulnerabilitatsbewertungen - liegen inzwischen vor (s. Wechsung etal. 2005). Das Vorhaben KLIWA - Klimaueranderung undKonsequenzen filr die Wasserwirtschaft (1999-2009) istein Kooperationsvorhaben der Lander Baden-Wurttemberg und Bayern mit dem Deutschen Wetterdienst. Zielist es, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt von suddeutschen Flussgebieten darzulegen,Konsequenzen darzustellen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ein Ergebnis des Projekts ist der sog. .Klimaanderungsfaktor", der fur die Bemessung von Neubauten technischer Hochwasserschutzeinrichtungen alsZuschlag zu den bisherigen Bemessungswerten eingefuhrtwurde, fur 100-jahrliche Hochwasser beispielsweise - jenach Flussgebiet - in Hohe von 15 bzw. 25 % (vgl. Hennegriff & Kolokotronis 2007). FLOWS - Flood Plain Land Use
RuR2/2009
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
Tabelle2Zusammenfassende Ubersicht fiber die Projekte
Projektname Leadpartnerl Lauf- thematischer Fokus geognaflscherFokus WebsiteKoordination zeit
ADAM Tyndall centre for 2006- Optionenu. Zielkonflikte Europa; Fallstudien fOr Tlsza- http://www.ClimateChange 2009 von Adaptions-u. Basin in Osteuropa, Guadiana- adamproject.euResearch, University of Mitigationsstrategien Basin in Spanienu. fOr dieEastAnglia (GB) innereMongolei
ALARM Helmholtz-Zentrum fOr 2004- GroBraumige Europaallg. http://www.Umweltforschung (UFZ) 2009 Umweltrisiken, alarmproject.neValarm
Auswirkungen aufBiodversitat u.6kosysteme
AMICA K1ima-Bundnis / A1ianza 2005- Kombinierte Adaptions- u. Europa; einzelne Stadte http://www.amica-del Climae.v. 2007 Mitigationsstrategien (Dresden u. Stuttgart als climate.net
Fallstudien fOr Deutschland)
ARL-AK AkademiefOr 2007- Herausforderungen fOr die Deutschland http://www.arl-net.deKlimawandel und Raumforschung und 2010 raumliche Planung durchRaumplanung Landesplanung (ARL) den K1imawandel
ARMONIA T6 Territorio (Italien) 2004- EU-weiteHarmonisierung Europaallg. Internetauftritt wurde2007 von Risikobewertungs- eingestellt
Methoden
ASTRA GeologicalSurveyof 2005- Entwicklung von Ostseekuste: http://www.astra-Finland (GTK) 2007 Anpassungsstrategien im Odermundungsgebiet project.org
Ostseeraurn, v.a.bezogen (deutscheFallstudie)auf Raumentwicklung
BRANCH NaturalEngland 2004- Erhaltder biolog.Vielfalt Fallstudien: Limburg (NL), http://www.2007 Kent (GB), Hampshire (GB), branchproject.org
Normandie(F)
ComCoast Rijkswaterstaat, NL 2004- Multifunktionale Nordseeraum/Anralnerstaaten http://www.comcoast.(Abt. des Ministeriums 2007 Kustenschutzlosungen org/index.htmf. offentlicheArbeiten u.Wasserversorgung)
ENFORCHANGE TU Dresden, Institut 2005- Foigendes K1imawandels Modellregionen: DubenerHeide http://www.fOr Bodenkundeu. 2009 fOr die Forstwirtschaft u. Obertausitz enforchange.deStandortslehre
ESPACE HampshireCounty 2003- Anpassungsempfehlungen Nordwest-Europa http://www.espace-Council (GB) 2008 fOr die Raumplanung, project.org
starkerwasserwirtschaftlicherBezug
FLOWS in Deutschland: Behorde 2002- Nachhaltiges (Hoch-) Unterschiedliche Pilotgebiete; http://www.flows.nufOr Stadtentwicklung 2006 wassermanagement in D: Kollau(Fluss im Nordenund Umwelt (BSU), Hamburgs) u. Tarpenbek (BachHamburg in Norderstedt, Schleswig-H.)
GLOWA-Elbe Potsdam-InstitutfOr 2000- Nachhaltiges (Hoch-) dt. Elbeeinzugsgebiet http://www.glowa-Klimafolgenforschung 2010 wassermanagement elbe.de(PIK)
KLARA-net TU Darmstadt, 2006- Regionales RegionStarkenburg http://Fachgebiet Umwelt- und 2011 Akteursnetzwerk, www.klara-net.deRaumplanung, Institut Anpassungs- u.WAR Umsetzungsmoglichkeiten
Klimafolgen- LeibnizUniversitat seit Managementstrategien Metropolregion Hannover- http://www.klimafolgenmanagement Hannover, Institut 2006 zum Klimawandel, Braunschwelq-Gottlnqen management.de
fOr Meteorologie u. WissensnetzwerkKlimatologie
KlimaNet Institut fOr Siedlungs- seit Nachhaltige Anpassung NRW:Bochum, Essenu. Herne http://www.isa.rwth-wasserwirtschaft der 2006 der Trinkwasser- aachen.de/index.RWTHAachen versorgung durch php?option=com_cont
wassersensitive ent&task=view&id=460MaBnahmen, <emid=238Kompetenznetzwerk
RuR2/2009 187
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
KLiMAPAKT ARL 2008- Strategien u. Instrumente Deutschland im Aufbau; unter2010 der raumlichen Planung www.arl-net.de
zur Anpassung an denK1imawandel
KLiMES Meteorologisches Institut 2006- Anpassungsstrategien Baden-WOrtt. u. Hessen: http://www.klimes-der Albert-Ludwigs- 2009 fOr die Stadtplanung, Untersuchungsstandort: bmbf.deUniversitat Freiburg stadtklimatische Leitfaden Freiburg; Teststandort: Kassel
KLiWA DWD,UM BW; Bay. 1999- Auswirkungen des Baden-WOrtt., Bayern, http://www.kliwa.deStMUGV, MUFVRLP 2009 Klimawandels aufden Rheinland-Pfalz
Wasserhaushalt
KWU Sustainability Center 2007- Handlungs- u. Unterweserregion http://www.Bremen(SCB) mit 2009 Kommunikationsmittel zum klimawandel-ECOLOu.ECONTUR Klimawandel unterweser.ecolo-
bremen.de
SafeCoast NationalInstitutefor 2005- Foigen des Klimawandels NordseekOste, http://www.Coastaland Marine 2008 an der NordseekOste, Nordwestdt. Tiefland: safecoast.orgManagement (RIKZ), Hochwasserrisiko- Pilotstudien in DK u, eutschlandRijkswaterstaat (NL) management unter Einbezug (Nds.), Pilotstudien aus Projekt
vonlKZM COMRISK
SEAREG Geological Survey of 2002- Bewertung von Klimafolgen in OstseekOste/ -region; Fallstudie http://www.gtk.fi/Finland (GTK) 2005 der Ostseeregion in Deutschland: Usedom projectslseareg!
(Region Vorpommern) index.htmlhttp://www.gtk.fi/slr
ESPON Geological Survey of 2000- Methoden der Europa http://www.espon.1.3.1 .Spatial Finland (GTK) 2006 Risikobewertung von Natur- eulmmp/online/effectsand u, technischen Gefahren, website/content!management Vulnerabilitat projectsl259/655/of natural and index_EN.htmltechnologicalhazards"
UFM Institut fOr Wasserbau, 2006- Oberflutungsrisiken fOr Hamburg, Dordrecht, London http://ufm-hamburg.TU Hamburg-Harburg 2008 urbaneRaume wb.tu-harburg.de
URBAS Hydrotec 2005- Vorsorge- u. Fallstudien in 15 ausgewahlten http://www.lngenieurgesellschaft 2008 Handlungsoptionen fOr Stadtenu. Kommunen in urbanesturzfluten.de/fOr Wasserund Umwelt urbaneSturzfluten Deutschland projektmbH,Aachen
VERIS-Elbe Leibniz-Institut seit Integriertes Management von dt, Elbelauf u. Einzugsgebiet http://www.veris-fOr 6kologische 2006 Hochwasserrisiken der Elbe elbe.ioer.deRaumentwicklun~ (lOR),Dresden
Optimizing Workable Sustainability (2002-2006) befasste sich mit der nachhaltigen Entwicklung flussgepragterund uberschwemmungsgefahrdeter Bereiche im Nordseeraum. Hochwasserbezogene Informationen sollten in relevante Entscheidungsprozesse integriert werden und durchstrategische und anwendungsbezogene Projekte solltenfur die Raumplanung und den Hochwasserschutz innovative Herangehensweisen und L6sungen erarbeitet werden. Es wurden insgesamt 40 Unterprojekte bearbeitet,die transnational in praktischem und wissenschaftlichemAustausch durchgeflihrt wurden. Ziel war es, die Information tiber klimabedingte Hochwasserrisiken zu verbessern,die Raumplanung zu unterstutzen, Hochwasserschutzmafsnahmen in den jeweiligen Regionen voranzubringenund hochwasserbezogene Frtihwarnsysteme weiterzuentwickeln." In VERIS-Elbe - Veriinderung und Management der Risiken extremer Hochwasserereignisse in grofienFlussgebieten am Beispiel der Elbe (2005-2008) werden dieM6glichkeiten eines integrierten Managements von Hochwasserrisiken vor dem Hintergrund des mittelfristigenKlimawandels und von Veranderungen von Flachennutzungen am Beispiel der Elbe untersucht. Einerseits sollen
188
methodologische Beitrage (Modellsimulationen und Szenarien) geleistet, andererseits Handlungsoptionen fur dieWasser- und Bauwirtschaft sowie die Raumplanung erarbeitet und hinsichtlich ihrer Effizienz uberpruft werden.Extreme Hochwasserereignisse wie das an der Elbe im August 2002 machen deutlich, dass das Management vonHochwasserrisiken auch unabhangig vom Klimawandelein wichtiger Handlungsbereich ist - denn gerade in Bezugauf die kunftige Niederschlagsentwicklung und Hochwassergefahren sind regional groBe Unterschiede zu erwarten und es werden wahl nicht alle Flussgebiete durch denKlimawandel von haufigeren oder starkeren Hochwassernbetroffen sein.
Weitere Projekte mit sektoralem Bezug
Neben der groBen Zahl von Projekten mit Themenschwerpunkten im Bereich Hochwasser- bzw. Wassermanagement finden sich unter den Vorhaben mit Bezug zurRaumplanung auch eine Reihe weiterer sektoraler Projekte. Im Forstbereich ist dies beispielsweise das ProjektENFORCHANGE - Environment and Forests under Changing Conditions (2005-2009), in dem die Veranderungen
RuR2/2009
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
landnutzungsbezogener Umweltfaktoren betrachtet undhinsichtlich der Folgen fur die Funktionen der forstwirtschaftlichen Landnutzungen in Interaktionen mit anderenLandnutzungsarten bewertet werden, auch mit dem Zielder Entwicklung von Leitlinien fur die Fach- und Raumplanung. 1m Bereich Naturschutz konnen hier u. a. die europaischen Projekte BRANCH - Biodiversity Requires Adaptation in Northwest Europe under a CHanging Climate(2004-2007) und ALARM - Assessing LArge scale Risks forbiodiversity with tested Methods (2004-2009) genannt werden. BRANCH kam u.a. zu dem Ergebnis, dass die Raumplanung eine Schlusselrolle bei der Schaffung von Anpassungsmoglichkeiten von Arten an den Klimawandel undsomit dem Erhalt der biologischen Vielfalt einnehmenkann, dieses jedoch bislang nur unzureichend beriicksichtigt wird. Fiir wirksame Konzepte fur den Schutz derBiodiversitat wird die Bedeutung transnationaler Zusammenarbeit ebenso hervorgehoben wie die Notwendigkeitiibersektoraler Sichtweisen, der Flexibilisierung von Planung sowie der Beriicksichtigung langerer Planungszeitraume." In ALARM stehen Grundlagenuntersuchungen zuAnderungen von Biodiversitat und Okosysternen u.a. aufgrund des Klimawandels im Vordergrund. Ziel ist die Entwicklung und Erprobung von Methoden zur Abschatzunggrofsraumiger Umweltrisiken, urn anthropogene negative Auswirkungen auf die Okosysteme vermindern zu konnen.
Hingewiesen werden soll auf einige weitere Projekte, diesich mit der Anpassung in einzelnen Sektoren beschaftigen, z.B, die im Rahmen von klimazwei geforderten Vorhaben KUNTIKUM und GIS-KliSchee (beide im BereichTourismus), LandCaRe 2020 (Landwirtschaft) oder Klimawerkstatt Chiemgau - Inn - Salzach - BerchtesgadenerLand (mit unterschiedlichen Themenfeldern), allerdingsohne explizite Beziige zur Raumplanung." Inhaltliche Aspekte dieser Projekte sind jedoch fur Fragen der Raumentwicklung im weiteren Sinne von Bedeutung, ebenso wievieler weiterer Projekte, bei denen im KomPass-Projektkatalog Raumplanung nicht als Handlungsbereich angegeben wird.
4 Schlussfolgerungen zu den Projektaktlvitatenvor dem Hintergrund der aktuellen Fachdiskussion
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem bisherigen Stand der Projektaktivitaten und aus den derzeit thematisierten inhaltlichen Schwerpunkten fur die Raumplanung ableiten, gerade vor dem Hintergrund der aktuellenDiskussion zur Weiterentwicklung der Raumplanung bzw.des raumplanerischen Instrumentariums?
Von sektoralen zu integrierten Ansatzen kommen
Die IIbersicht iiber die Projekte macht deutlich, dass bislang (Hoch- )Wassermanagement bzw. der Umgang mitExtremereignissen sowie Kiistenschutz einen Grolsteil derForschungs- bzw. Projektaktivitaten ausmachen. Somit
RuR2/2009
steht der Umgang mit konkreten Naturgefahren - die auchheute schon Gegenstand von Raum- bzw. Fachplanungsind - bzw. mit den durch den Klimawandel wachsendenRisiken im Vordergrund der Aktivitaten, auch auf europaischer Ebene (vgl.ARMONlA, ESPON 1.3.1). Entsprechenderhalten auch als besonders vulnerabel erkannte Raumewie der Alpenraum, Kiistenbereiche und urbane Raumederzeit die hochste Aufmerksamkeit. Heute erst wenigerkonkret erkennbare Herausforderungen werden bislang ingeringerem Umfang beriicksichtigt bzw. sind Gegenstandvon Projekten, die Grundlagen erarbeiten, z.B. in Bezugauf die Frage der Auswirkungen des Klimawandels auf dieArtenvielfalt. Projekte mit integrierten Ansatzen sind eherdie Ausnahme.
Die sektorale Beschaftigung mit den Auswirkungen desKlimawandels erleichtert zwar zunachst die wissenschaftliche Bearbeitung und sparer die mogliche Umsetzungvon Projektergebnissen bzw. -empfehlungen (z.B. innerhalb einer speziellen Fachbehorde), ftihrt aber auch dazu,dass ein integratives Risikomananagement bzw. die Entwicklung abgestimmter Gesamtkonzepte zur Anpassung,in denen verschiedene sektorale Strategien integriert werden, erschwert wird. Demgegeniiber fallt auf, dass in einerReihe von Projekten gerade bei den Handlungsempfehlungen die Rolle der Raumplanung oder die Verkniipfung vonFachplanungen mit raumlicher Planung besonders hervorgehoben wird (z.B.ASTRA, BRANCH, ESPACE). Auch inProjekten mit regionalem Fokus wird der Raumplanung, inZusammenarbeit mit den einzelnen Fachplanungen und-behorden, eine entscheidende Rolle zugewiesen (vgl. Hiller & Probst 2008).
Nur wenige Projekte befassen sich bislang mit langfristigen formellen Handlungsmoglichkeiten der Raum- undRegionalplanung hinsichtlich der Folgen des Klimawandels und der Frage nach der Weiterentwicklung des bestehenden planerischen Instrumentariums, wie dies z.B,
von Ritter (2007) gefordert wird; die Beschaftigung erfolgtbislang eher auf der theoretisch-konzeptionellen Ebene (s. z.B, neben bereits genannter Literatur auch Strauls2008). Aktivitaten hierzu sind mittlerweile insbesondere im ARL-Arbeitskreis .Raumplanung und Klimawandel",in KLIMAPAKT sowie in der MORO-Vorstudie angelaufen.Die Analyse des bisherigen Instrumentariums der Raumplanung im Hinblick auf die Ansatze bzw. Moglichkeitenzum Umgang mit dem Klimawandel, wie sie z.B. auch inden Projekten ASTRA oder ClimChAlp fur die jeweiligenProjektgebiete erfolgte, ist ein erster wichtiger Schritt zurWeiterentwicklung des Instrumentariums und zur Klarung der Frage, wie das Zusammenspiel zwischen Raumund Fachplanung hinsichtlich der Herausforderungen, diesich durch den Klimawandel stellen, gestaltet werden soll.Wichtig erscheint hierbei, dass dies nicht pauschal, sondern auf konkrete Handlungsbereiche bezogen erfolgt. Besonders bedeutend scheint es daneben auch, den Bestandan Siedlungen und Infrastrukturen zu beriicksichtigen, wo
189
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
die Raumplanung im Gegensatz zu zukiinftigen Planungsvorhaben nur wenig Einfluss hat.
Die regionale Ebene starken
Der Grolsteil der Projekte bezieht sich auf raumlich-konkrete Risiken und ist entsprechend lokal oder regional verankert. Fur die Anpassung an die Folgen des Klimawandelsbietet die regionale Ebene groEe Potentiale, denn zum einen sind die Auswirkungen des Klimawandels regional unterschiedlich, zum anderen mussen Mafsnahmen letztlichlokal bis regional umgesetzt werden. Die Regionalplanungkann als Mittler zwischen strategischen Zielsetzungen undder kommunalen Umsetzung fungieren; die bestehendenformellen wie informellen Instrumente bieten eine VielfaIt von Steuerungsmoglichkeiten (vgl. Schlipf et al. 2008).Gerade in Prozessen, die kooperative Planungsprozesseanregen, wie z.B, den Aufbau regionaler Akteursnetzwerke, werden diese Ansatze untersucht bzw. umgesetzt (insbesondere in den Projekten KLARA-Net, KlimaFolgenManagement, KWU; eine Beteiligung von Stakeholdern bzw.Entscheidungstragern findet daneben auch in einer Reiheweiterer Projekte statt, z.B, ClimChAlp). Akteursnetzwerketragen zur Steigerung des Problembewusstseins in der Offentlichkeit bei und konnen eine geeignete Plattform furRisikodiskurse bilden: durch den Klimawandel verursachte Risiken werden gemeinsam mit einerVielzahl von regionalen Akteuren - auch unter Beteiligung von Vertreternder relevanten Planungsinstitutionen - identifiziert unddaraus Handlungserfordernisse und -moglichkeiten abgeleitet (vgl. Furst 2007). Greiving & Fleischhauer (2008) betonen die Notwendigkeit eines .mehrgleisigen Umgangs"mit den Folgen des Klimawartdels: es gelte, das generelleBewusstsein zu starken, kooperative Konzepte zu fordern,hoheitliche Instrumente zu starken und Handeln vor Ortzu ermoglichen,
Umgang mit Unsicherheit lernen
1m Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkungen desKlimawandels besteht eine hohe Unsicherheit, auch aufgrund der Unterschiede der unterschiedlichen Klimaprojektionen und aufgrund der Schwierigkeiten bei derkleinraumigen Modellierung von Klimaparametern. Alleine aufgrund der Unsicherheit bezuglich der Entwicklung der Treibhausgasemissionen wird ein gewisses MaEan Unsicherheit dauerhaft bestehen bleiben, was zur Folge hat, dass letztlich die Bandbreite der moglichen Entwicklungen beriicksichtigt werden muss. Fur die raumliche Planung stellt sich daher die Schwierigkeit, tiber keineverlasslichen Grundlagen fur rechtliche Planungsentscheidungen im Umgang mit Risiken durch den Klimawandelzu verfiigen, denn diese lassen sich nicht wie .klassische"Risiken belegen (vgl. Greiving & Fleischhauer 2008). Risikodiskurse konnen hier als ein wichtiges Mittel zur Normgenerierung und Entscheidungsfindung dienen und somitfur die notwendige Akzeptanz bei den Betroffenen sorgen(vgl. Greiving 2007). Neben Porschungsaktivitaten zu den
190
Auswirkungen des Klimawandels in verschiedenen Disziplinen werden Moglichkeiten zum Umgang mit Unsicherheit - auch im Hinblick auf die Einbindung ins raumplanerische Instrumentarium - weiterhin ein wichtigesForschungsfeld bleiben mussen. Analysen zur spezifischenVerwundbarkeit bestimmter Raume konnen hier wichtigeBeitrage leisten. Daschkeit & Kropp (2008) weisen in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeit hin, Best-Practice-Beispiele, die jeweils in einem spezifischen (raumlichen) Kontext entwickelt worden sind, zu verallgemeinernbzw. in einen anderen Kontext zu tibertragen: diese mussten vielmehr als .Moglichkeltsraum potenzieller Handlungen" aufgefasst werden.
Forschung und Umsetzung vernetzen
Eine intensive Vemetzung zwischen Forschung und Praxiseinerseits, Klimafolgenforschung und Raumplanung andererseits wird als wichtige Grundbedingung fur eine erfolgreiche Anpassung an den Klimawandel betrachtet (vgl. z.B,
Fleischhauer & Bornefeld 2006, Ritter 2007, Furst 2007). Invielen der aktuellen Projekte sind Praxispartner beteiligt, sodass wichtige Schritte zu einer verbesserten Vernetzung vonForschungsaktivitaten zur Anpassung an den Klimawandelmit der institutionalisierten Planung bereits gemacht worden sind. Das UBA stellt mit Hilfe von KomPass wichtigeGrundlageninformationen zum Klimawandel allen Nutzernzur Verfiigung und tragt tiber die Website www.anpassung.net zum Wissenstransfer bei, Die Behandlung des Themas.Anpassung an den Klimawandel" in der Regionalplanungspraxis steht insgesamt jedoch noch relativ am Anfang unddie Aufgaben, die sich der Regionalplanung durch den Klimawandel stellen, sind noch nicht klar definiert (vgl. Overbeck et al. in diesem Band). Eine Verbesserung des Wissensaustauschs zwischen den verschiedenen Disziplinen stelltsomit weiterhin eine wichtige Aufgabe dar.
Zwar behandeln Forschungsprojekte im Bereich der Anpassung an den Klimawandel meist konkrete Probleme,die auch raumlich verortet werden konnen, Dennoch sinddie Projektergebnisse oft nicht unmittelbar fur die Planung verwendbar, da in ihnen bestimmte (politisch-administrative) Rahmenbedingungen oder etwaige Hindernissein der Umsetzung nicht ausreichend berucksichtigt werden oder die Ergebnisse nicht ebenenspezifisch formuliertwurden. Wichtig erscheint somit, wenn Projekte in UmsetzungsmaEnahmen munden sollen, dass die jeweiligenFragestellungen schon zu Beginn entsprechend fokussiertwerden, beispielsweise die unterschiedlichen Zeithorizonte in Planung und Politik, rechtliche Rahmenbedingungenoder die institutionellen Zustandigkeiten betreffend. Vertreter der Planungspraxis und ihr Wissen sollten somit vonAnfang an in die Projekte einbezogen werden. Dem Aufbau entsprechender Vernetzungsstrukturen zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen den verschiedenen Disziplinen und tiber die verschiedenen planerischen Ebenenhinweg, sollte fur den Umgang mit dem Klimawandel einehohe Bedeutung beigemessen werden.
RuR2/2009
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
Anmerkungen(1)
Mit 20 Projekten zu Mitigation und 19 zu Adaption, siehe http:/ /www.klimazweLde/.
(2)Mit insgesamt rund 35 Projekten, bei denen zum Tei!auch explizitdie Auswirkungen des Klimawandels angesprochen werden, siehehttp://www.rimax-hochwasser.de/.
(3)Zuganglich auf den Internet-Seiten des Kompetenzzentrums .Klimafolgen und Anpassung" (KomPass) des Umweltbundesamts:http://www.anpassung.net.
(4)Die Links zu den Websites der im Folgenden beschriebenen Projekte finden sich in derTab.2 am Ende dieses Kapitels.
(5)Siehe auch http://www.amica-climate.net.
(6)Vgl. Empfehlung I. der ESPACE-Broschiire, http://www.espaceproject.org/partl /partl_strategygr.htm (Stand: 07.07.08).
(7)Http://www.espace-project.org/publications/Extension%20Outputs/EA/Espace%20FinaLGuidance_Finalv5.pdf (Stand:07.07.08).
(8)Siehe http://www.klimaatvoorruimte.nl/pro3/general/start.asp?i=7&j=0&k=0&p=0&itemid=320 (Stand: 28.10.08).
(9)European Spatial Planning Observation Network, http://www.espon.eu.
(10)NUTS= Nomenclature des unites territoriales statistiques. DieNUTS-Klassifikation dient der Untergliederung des Wirtschaftsgebiets der EU-Mitgliedstaaten NUTS3 entspricht in Deutschlandder Kreisebene.
RuR 2/2009
(11)
Die Checklisten sind im Internet unter http://www.iwar.bauing.tu-darmstadt.de/umwr/Deutsch/forschung/lu-KLARAOI.htmunter .Aktuelles'' abrufbar (Stand: 15.08.2008)
(12)
Weitere Informationen s. http://www.bbr.bund.de/nn_21684/DE/Forschungsprogramme/ModellvorhabenRaumordnung/Programm/programm_node.html?_nnn=true (Stand: 12.11.08).
(13)
Zum Decision Support System siehe auch: http://www.gtk.fi/slr/(Stand: 24.10.08).
(14)
Zum "Guide to the products" siehe http://www.comcoast.org/comcoastvision/vision-pilots.htm (Stand: 12.11.08).
(IS)Erste Ergebnisse sind verfiigbar aufhttp://www2.hydrotec.de/unternehmen/hydrothemen/hydrothemenll06/urbas/ (Stand:24.10.08).
(16)
Siehe http://ufm-hamburg.wb.tu-harburg.de/index.php?id=426(Stand: 23.10.08).
(17)Siehe Projekt-Endbericht (summary brochure) unter http://www.flows.nu/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=28&1=38(Stand: 22.10.08).
(18)Natural England 2007: Planning for biodiversity as climate changes. Branch project final report. http://www.branchproject.org/available/reportsandpublications/ (Stand: 24.10.08).
(19)
Die Links zu den Internetprasenzen der hier aufgefiihrten Vorhaben finden sich unter http://www.klimazweLde/ProjektezumSchutzvorKlimawirkungen/Projekt%C3%BCbersicht/tabid/58/Default.aspx (Stand: 22.10.2008).
191
Katrin Meyer, Gerhard Overbeck:Raumplanerische Anpassung an den Klimawandel im Spiegel aktueller Projekte
LiteraturDaschkeit, A.; Kropp, J. (2008): Anpassung und Planungshandelnim Licht des Klimawandels. Informationen zur Raumentwickiung,H. 6/7, S. 353-361.
Fleischhauer, M.; Bornefeld, B. (2006): Klimawandel und Raumplanung. Ansatzpunkte der Raumordnung und Bauleitplanung furden Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Raumforsch. u. Raumordnung 64, H.3, S. 161-171.
Fleischhauer, M.; Greiving, S.;Wanczura, S. (Hrsg.) (2006): NaturalHazards and Spatial Planning in Europe. Dortmund.
Furst, D. (2007): Raumplanerischer Umgang mit dem Klimawandel. In: Tetzlaff, G.; Karl, H.; Overbeck, G. (Hrsg.): Wandel von Vulnerabilitat und Klima. Mtissen unsere Vorsorgewerkzeuge angepasst werden? Bonn, S. 52-62. = Schriftenreihe des DKK\!, Nr. 35.
Greiving, S. (2006): What are the real needs of spatial planning fordealing with natural hazards? In: Fleischhauer, M., Greiving, S.,Wanczura, S. (Hrsg.): Natural hazards and spatial planning in Europe. Dortmund, S. 185-202.
Greiving, S. (2007): Raumrelevante Risiken - materielle und institutionelle Herausforderungen fur raumliche Planung in Europa.In: Tetzlaff, G.; Karl, H.; Overbeck, G. (Hrsg.): Wandel von Vulnerabilitat und Klima. Mussen unsere Vorsorgewerkzeuge angepasstwerden? Bonn, S. 78-92. =Schriftenreihe des DKK\!, Nr. 35.
Greiving, S.; Fleischhauer, M. (2008): Raumplanung: in Zeiten desKlimawandels wichtiger denn je! Grofsere Planungsflexibilitatdurch informelle Ansatze einer Risiko-Governance. RaumPlanung,H. 137, S. 61-66.
Frommer, B.; Herlitzius, 1. (2007): "KLARA-Net" - Klimaadaptionin der Region Starkenburg. In: Verein zur Forderung des InstitutsWAR: Klimawandel - Anpassungsstrategien in Deutschland undEuropa. Darmstadt, S. 59-78. =Schriftenreihe WAR, Nr. 183.
Hennegriff, w.; Kolokotronis, V. (2007): Methodik zur Ableitungvon Klimaanderungsfaktoren fur Hochwasserkennwerte in BadenWtirtternberg. Wasserwirtschaft 9/2007, S. 31-35.
Hiller, M.; Probst, T. (2008): Auswirkungen des Klimawandels aufRaumentwickiung und Wirtschaft im Alpenraum. Ergebnisse desINTERREG IIIB-Alpenraum-Projekts ClimChAlp. Informationenzur Raumentwicklung, H. 6/7, S. 395-403.
Hilpert, K.;Mannke, R;Schmidt-Thome, P.(2007):Towards ClimateChange Adaptation Strategies in the Baltic Sea Region - Developing Policies and Adaptation Strategies to Climate Change in theBaltic Sea Region, Espoo. Stand: 07.02.08. http://www.astra-project.org/07_publications.html.
Kleinhans, A.; Weber, H. (2006): Hochwasserschutzplanung undKlimawandel. Die Fallstudie .Frankische Saale" im Rahmen desEU-Vorhabens ESPACE. Manuskript zum Vortrag am Tag der Hydrologie 2006,22.123. Marz 2006, Munchen. Stand: 07.07.08. http://www.espace-project.org/partl/publications/reading/LfUHochwasserschutipanungKlima.pdf.
192
Mayer, H. (2008): KLIMES - a joint research project on humanthermal comfort in cities. In: Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs Universitat Freiburg Nr. 17, S. 101-117.24.10.2008. http://www.klimazweLde/ProjektezumSchutzvorKlimawirkungen/Projekt%C3%BCbersicht/KLIMES/tabid/125/Default.aspx.
Overbeck, G.; Hartz, A.; Fleischhauer, M. (2008): Ein l G-PunktePlan .Klimaanpassung". Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel im Uberblick. Informationen zur Raumentwickiung, H.6/7, S. 363-380.
Ritter, E.-H. (2007): Klimawandel - eine Herausforderung an dieRaumplanung. Raumforsch. u. Raumordnung 65, H. 6, S. 531-538.
Roode, N., Baarse, G., Ash, J. & Salado, R. (Hrsg.) (2008): Coastalflood risk and trends for the future in the North Sea region - Resultsand recommendations of Project SafeCoast. Executive Summary.Stand: 24.10.08. http://www.safecoast.org/editor/databank/File/Safecoast%20Chapter%201-hres.pdf.
Schlipf, S.; Herlitzius, 1.; Frommer, B. (2008): Regionale Steuerungspotentiale zur Anpassung an den Klimawandel. Moglichkeiten und Grenzen formeller und informeller Planung. RaumPlanung, H. 137, S. 77-82.
Schmidt-Thorne, P.(Hrsg.) (2006):The Spatial Effects and Management of Natural and Technological Hazards in Europe - ESPON1.3.1 Executive Summary. Geological Survey of Finland, Espoo.
Strauls, C. (2008): Integrative und kooperative Steuerung im Wandel. Zur Koppelung neuer Planungsaufgaben mit dem Stadtumbau. RaumPlanung, H. 137, S. 88-92.
Wechsung, R;Becker,A.; Grafe, P.(2005): GLOWA-Elbe I. IntegrierteAnalyse der Auswirkungen des Globalen Wandels auf die Umweltund die Gesellschaft im Elbegebiet. PIK Report Nr. 95.
Dipl.-Ing. Katrin MeyerAkademie fur Raumforschung und LandesplanungHohenzollernstralse 1130161 HannoverTelefon: + 49 (0) 5 11-34842-22
Dr. Gerhard OverbeckAkademie fur Raumforschung und LandesplanungHohenzollernstrafse 1130161 HannoverTelefon: + 49 (0) 5 11-34842-22Mail: [email protected]
RuR2/2009